Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels. Neue Befunde zur Befestigung und...
-
Upload
hansemuseum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels. Neue Befunde zur Befestigung und...
Alfred Falk, Ulrich Müller und Manfred Schneider (Hrsg.)
Lübeck und der HanseraumBeiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte
Festschrift für Manfred Gläser
Lübeck und der HanseraumBeiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte
Festschrift für Manfred Gläser
Verlag Schmidt-RömhildLübeck 2014
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-7950-5220-1© 2014 by the editors
Herstellung: Schmidt-Römhild, Lübeck
Gedruckt mit Unterstützung der Archäologischen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck e.V.
Redaktion:Claudia Kimminus-Schneider und Dirk Rieger
Technische Redaktion, Satz und Layout:Holger Dieterich und Ines Reese
Umschlagentwurf:Holger Dieterich und Manfred Schneider
Bildredaktion:Holger Dieterich, Ines Reese und Dirk Simonsen
Umschlagbild: Lübeck, Ausgrabung Johanniskloster 1979 bis 1981.Der Ausgräber Manfred Gläser vor der Stadtmauer des 13. Jahrhunderts.
7
André Dubisch, Cathrin Hähn, Eric Müller,Hendrik Rohland und Katrin Siegfried
Alfred Falk
Günter P. Fehring
Mieczyslaw Grabowski
Antjekathrin Graßmann
Rolf Hammel-Kiesow
Jörg Harder
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................. 11
„Lübeck ist Archäologie” ....................................................................... 13
Manfred Gläser – Ein Leben für die Archäologie ................................. 17
Das Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum – Manfred Gläsers Werk ......................................................................... 23
Silexman ................................................................................................ 27
Innenansichten aus dem Leben eines Bereichsleiters ....................... 29
Schriftenverzeichnis Manfred Gläser .................................................. 41
Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels.Neue Befunde zur Befestigung und Entwicklung eines wichtigenSiedlungskerns der Stadt Lübeck ........................................................ 51
Herrn Brehmers Spur ............................................................................ 69
Archäologie in Lübeck – Weltkulturerbe der UNESCOund Grabungsschutzgebiet ................................................................. 79
Kranenkonvent – Befunde und Ergebnisse der archäologischenUntersuchungen in der ehemaligen Beginenniederlassungan der Kleinen Burgstraße 22 zu Lübeck ............................................. 83
Ein mittelalterliches Kloster in Lübeck?Das St. Johannis-Jungfrauenkloster um 1800 ..................................... 95
Der Beitrag der Archäologie zur hansischen Geschichte ................. 107
Aparter Abort – ein erhaltenes Toilettenhausdes 13. Jahrhunderts..............................................................................115
Festschrift für Manfred Gläser
Alfred Falk, Ulrich Müller undManfred Schneider
Annette Borns
Friedhelm Anderl
Alfred Falk
Lara Mührenberg
Doris Mührenberg
Lübeck...
8
Torsten Kempke
Heiko Kräling
Ursula Radis
Dirk Rieger
Ingrid Schalies
Manfred Schneider
Ulf Stammwitz
Peter Steppuhn
Ingrid Sudhoff
Wo lag die Burg Alt Travemünde? ....................................................... 123
Digitale Dokumentation – Die Weiterentwicklung derLübecker Archäologie ......................................................................... 131
Der baugeschichtlich-historische Kontext ausgewählterBaubefunde der Großgrabung im Gründungsviertel Lübecks ......... 135
Exzeptionelle Hofgebäude des 12. Jahrhunderts aus demrezenten Großgrabungsprojekt im Lübecker Gründungsviertel ...... 149
Von Kaianlagen, Bohlwerken und Uferbefestigungen –archäologische Befunde zum Ausbau des stadtseitigenTrave-Ufers im 12.–20. Jahrhundert .....................................................161
„Die erste Kirche in Lübeck gebawet“Lübecks Kirchen – unbekannte Bodendenkmale ............................. 173
Neue archäologische Befunde zu frühen Backsteinbautenin der Lübecker Fischstraße ............................................................... 183
Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhundertsaus der Altstadt von Lübeck ............................................................... 193
Forschung über Grenzen hinaus: deutsch-dänische Kulturprojekte .. 207
Ein Spielstein im Dorf .......................................................................... 215
Status, Power and Values: archaeological approaches tounderstanding the medieval urban community ............................... 223
Zier- oder Prunkglutstülpen aus Enkhuizen und West-Friesland(Niederlande) – Ein Spiegel der Gesellschaftim „Goldenen Jahrhundert” ............................................................... 235
Die Ausgrabungen im Bremer Stephaniviertel beim Neubauvon „Radio Bremen“ 2004 bis 2005 .................................................. 245
Domestic building in Alkmaar, the Netherlands .............................. 257
Der Lübecker Hof im mittelalterlichen Riga ..................................... 265
Grabmalerei im spätmittelalterlichen Brügge .................................. 273
Bring out your Dead! – burial rites and ritual in a medievalmonastic cemetery ............................................................................. 285
Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen und neuzeitlichenInfrastruktur in der Hamburger Altstadt ........................................... 301
...und der Hanseraum
Betty Arndt (Göttingen)
Brian Ayers (Norwich)
Michiel H. Bartels (Hoorn)
Dieter Bischop (Bremen)
Peter Bitter (Alkmaar)
Andris Caune (Riga)
Hubert de Witte (Brügge)
David H. Evans (Hull)
Elke Först (Hamburg)
9
Michael Geschwinde (Braunschweig)
Anna-Therese Grabkowsky (Münster)
Rita Gralow (Wismar)
Uta Halle (Bremen)
Palle Birk Hansen (Næstved)
Volker Herrmann (Bern)
Jesper Hjermind (Viborg)
Lene Høst-Madsen (Skanderborg)
Karl Bernhard Kruse (Hildesheim)
Leif Plith Lauritsen (Maribo)
Gabriele Legant (Allensbach)
Torsten Lüdecke (Hamburg)
Fred Mahler (Uelzen)
Gunnar Möller (Stralsund)
Joachim Müller (Brandenburg)
Ulrich Müller (Kiel)
Ralf Mulsow (Rostock)
Grażyna Nawrolska (Elbing)
Ieva Ose (Riga)
Ingvild Øye (Bergen)
Henryk Paner (Gdańsk)
Anton Pärn und Erki Russow (Tallinn)
Ac muris amplificavit – Archäologische Befunde zur Befestigungder Stadt Braunschweig im Mittelalter ............................................... 311
Die frühe Klosterlandschaft in Holstein ............................................. 319
Der Hof des Zisterzienserklosters Doberan in Wismar im Jahr 1656 ... 329
Archäologische Fragen und archivalische Antworten zumSchuster- und Töpferhandwerk in der Stadt am Beispiel Lemgos ... 339
Næstved Hafen – die Pforte zu Norddeutschland ........................... 345
Hafen, Markt und Pfalz Duisburg im frühen und hohen Mittelalter .... 349
With a hawk on the hand – the 11th-century life of the nobilityby Viborg Søndersø ............................................................................ 357
An Anchor Island and Five Ships under the Opera – a short reviewof the results of the archaeological excavation in Copenhagen ..... 367
Die Hildesheimer Stadtmauern vom 9. bis ins 12. Jahrhundert ....... 373
Lübeck, die Hanse und Lolland-Falster ............................................. 381
Zwischen Infobox und Elfenbeinturm. Reflektionen zur Öffentlich-keitsarbeit der Großgrabung Neue Straße in Ulm (2001–2004) .......... 389
Schreibgriffel der „Harzer Gruppe“ mit Glättspuren ....................... 399
Historische Archäologie bei einer Gebäudesanierung:Untersuchungen im historischen Rathaus der Stadt Uelzen .......... 409
„Viel Steine gab`s…“ Die einstigen spätmittelalterlich-neuzeit-lichen Grenz- und Flursteine in und bei Stralsund ........................... 413
Die Doppelstadt Brandenburg an der Havel. Überlegungen zuStadtplanung im 12. und 13. Jahrhundert und dem Phänomeneiner im Parzellennetz greifbaren sozialen Differenzierung ........... 423
„Archäologie“ + „Kultur“ = „Hansekultur“?Überlegungen zu einem Begriff ........................................................ 439
Die spätslawische Besiedlung des Rostocker Altstadthügels .......... 453
Waren Flaschen die Attribute der mittelalterlichen Pilger aus Elbing? ... 467
Einige Zeugnisse mittelalterlicher Wallfahrten undPilgerzeichen in Riga .......................................................................... 475
Bergen and the German Hansa in an archeological perspective ........ 481
Pilgrim badges with the image of Charlemagne in thecollection of the Gdańsk Archaeological Museum .......................... 491
Halbkeller in Westestland – Steinwerke aus der Städtegründungszeit ... 503
10
Slawische Handelszentren und frühdeutsche Siedlungen:Die Anfänge Lübecks und Rostocks im Vergleich ............................. 513
Zur Ostgrenze des Verbreitungsgebietes der Kugeltöpfe – Neue Betrachtung eines alten Problems .......................................... 519
Castles of the Scanian market – three examples .............................. 527
Helden- und Herrscherdarstellungen an Decken, Wänden undauf Ofenkacheln in Lüneburg ............................................................. 539
Form und Funktion. Einige theoretische Gedanken zur Entwick -lung der mittelalterlichen Burgen im Gebiet nördlich der Elbe .......... 549
Zur Inneren Sicherheit im frühen und hohen Mittelalter - eine archäo-logische Fallstudie zur Verwendung von Schloss und Schlüssel ............ 559
The Abodrites – the Vikings’ neighbours to the south.Relations between the Slavic Abodrites and the Vikingsalternating between conflict and peaceful alliance ........................ 573
Die Reliquie der heiligen Gertrud im Dom zu Turku ....................... 579
10 Jahre U-Bahn-Archäologie in Köln – ein Erfahrungsbericht ............ 587
Just to be on the safe side… Some notes on painted tombsin the Antwerp cathedral of Our Lady (Belgium) .............................. 597
Visby – Lübeck. Kontakte über sechs Jahrhunderte ....................... 609
Ortwin Pelc (Hamburg)
Marian Rębkowski (Stettin)
Anders Reisnert (Malmö)
Edgar Ring (Lüneburg)
Hans Gerhard Risch (Hamburg)
Ralph Röber (Konstanz)
Hans Skov (Aarhus)
Jussi-Pekka Taavitsainenund Markus Hiekkanen (Turku)
Marcus Trier (Köln)
Johan Veeckman (Antwerpen)
Gun Westholm (Visby)
11
Ein Buch mit Manfred Gläser zu erstellen ist in der Lübecker Archäologie eine zwar oft geübte aber stets auch jeweils neue Aufgabe, weiß er doch sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll und wie der Weg dahin führt.
Ein Buch für Manfred Gläser zu erstellen, ohne sein Zutun und Wissen, ist eine besondere Heraus-forderung, spürt man ihn doch stets mit seinen Vor-stellungen einer guten Publikation im Hintergrund. Als Herausgeber werden wir erleben, ob wir seinen Ansprüchen gerecht werden konnten. Publikatio-nen sind immer der Kern der Ergebnisse der wissen-schaftlichen Arbeit des mit diesem Buch zu ehrenden Kollegen und Bereichsleiters der Lübecker Archäolo-gie und Denkmalpflege.
Schon lange war es Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden von Manfred Gläser klar, ohne Festschrift können wir ihn nicht aus dem Amt entlassen. Sie wurde daher bereits ab 2010 ge-plant und vorbereitet, um sie ihm im Frühjahr 2014 mit dem Eintritt in den Ruhestand übergeben zu können. Aber wie so oft überraschte eine Entschei-dung von Manfred Gläser das schon fast fertige Projekt. Seinem Wunsch, seine Amtszeit um weite-re zwei Jahre fortzusetzen, wurde seitens der Hanse-stadt Lübeck entsprochen. Also stand die Festschrift ohne den ursprünglichen Anlass da. Die Herausgeber haben dann entschieden, das Projekt wie geplant ab-zuschließen und ihm die Festschrift noch vor Ende seiner Amtszeit zu übergeben.
Manfred Gläser ist 2014 in seinem 65. Lebensjahr 20 Jahre Amts- bzw. Bereichsleiter in Lübeck. 2014 kann er das größte Projekt der Lübecker Archäologie, die mehrjährigen Grabungen im Gründungsviertel, erfolgreich abschließen. Für uns sind das wesentli-che Punkte, sein bisheriges Wirken für Lübeck und die Archäologie im Hanseraum mit diesem Buch zu würdigen. Es spiegelt das breite Spektrum seiner For-schungsinteressen sowie eines Netzwerkes von Kol-leginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, mit denen er seit vielen Jahren verbunden ist.
Manfred Gläser kam als Amtsleiter 1994 nicht neu nach Lübeck, auch wenn damals sein Arbeitsort das
Kulturhistorische Museum der Hansestadt Rostock war. Das kurze Intermezzo als Direktor dieser ange-sehenen Institution in der schwierigen Nachwende-zeit trat er 1991 an, zuvor war er viele Jahre in ver-schiedenen Projekten der Lübecker Archäologie tätig, in denen er bereits den Grundstock für seine weitere wissenschaftliche Arbeit in Lübeck legte. Auch von Rostock aus lagen sein wissenschaftlicher Fokus und sein Lebensmittelpunkt stets in der Hansestadt an der Trave. So war es auch nur konsequent, die Nach-folge seines früheren Chefs Prof. Dr. Fehring, dem er noch von Rostock aus eine umfangreiche Festschrift widmete, anzutreten und die Lübecker Archäologie mit neuen Ideen, Konzepten und Projekten bis heute zu prägen. Konsequent öffnete er die archäologischen Forschungen und Aktivitäten in Lübeck einer brei-ten interessierten Öffentlichkeit. Veranstaltungen, Führungen, Vorträge und Ausstellungen sind durch ihn zu einem wesentlichen Standbein der Arbeit des Bereiches geworden. Hierdurch wurden die Archäo-logie und Bodendenkmalpflege sowohl in der Bevöl-kerung als auch in der Politik und Verwaltung der Hansestadt fest verankert. Der Aufbau eines wissen-schaftlichen Netzwerkes gelang ihm seit 1995 durch die Etablierung des Lübecker Kolloquiums zur Stadt-archäologie im Hanseraum, das bis zur Gegenwart kontinuierlich bereits neunmal stattfand. Natürlich haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser wissenschaftlichen Institution zu dem hier vorliegen-den Buch beigetragen.
Höhepunkte in der bisherigen Bereichsleitung Manfred Gläsers waren unzweifelhaft die Ausstel-lung zur Dänenzeit Lübecks mit dem Besuch der dänischen Königin und des Bundespräsidenten 2003 im Beichthaus und dessen Ausbau danach unter seiner Leitung zum Archäologischen Museum der Hansestadt Lübeck. Das im Sommer 2005 eröffnete Museum war sein eigentliches Lebenswerk, von dem er 2011, wenige Jahre später, erleben und mit anse-hen musste, wie es vollständig und radikal wieder auf den Ausgangspunkt zurück geführt wurde, um einer anderen musealen Institution Platz zu machen. Dies ist sicherlich die schmerzlichste Erfahrung der
Vorwort
12
Lübecker Archäologie der letzten Jahre. Kompensiert wurde dieser Verlust durch die Bewilligung und er-folgreiche Durchführung des bisher und wohl für eine lange Zeit auch größten archäologischen Projek-tes in Lübeck und Nordeuropa, der Grabungen im Gründungsviertel. Deren umfangreiche Funde und Ergebnisse werden Manfred Gläser auch lange nach dem Ende der Kampagne noch beschäftigen und eine Basis bilden für neue Ideen im Umgang mit dem überaus reichen archäologischen Kulturgut und sei-ner Präsentation in der Welterbestadt Lübeck.
Die Herausgeber dieser Festschrift und deren Au-torinnen und Autoren spiegeln sehr gut das amtliche, kollegiale, wissenschaftliche und freundschaftliche Umfeld Manfred Gläsers. Mit der Universität Kiel ver-bindet ihn ein langjähriger Lehrauftrag, aus der eine Honorarprofessur hervorging. In etlichen Übungen, Seminaren, Exkursionen haben mehrere Studieren-den-Generationen von Manfred Gläser Probleme der Mittelalterarchäologie, der Stadtarchäologie und na-türlich Lübecks kennengelernt, ebenso wie den prak-tischen Umgang mit archäologischen Ergebnissen in Ausstellungen und Publikationen. Die Archäologische Gesellschaft der Hansestadt Lübeck ist mit ihren 200 Mitgliedern Multiplikator der Archäologie in der inter-essierten Stadtöffentlichkeit und unterstützt die Arbeit des Bereiches und seines Leiters in vielfältiger Weise bei Veranstaltungen, Publikationen und Anschaffun-gen wissenschaftlicher Literatur und technischer Ge-räte. Besonders mit dem ehemaligen Archäologischen Museum und dem angeschlossenen Café identifizier-ten sich die Mitglieder der Gesellschaft und Manfred Gläser fehlte natürlich bei kaum einer Veranstaltung,
hielt Vorträge, leitete Führungen und Exkursionen. Manfred Gläser ist kein Freund zu langer Worte,
aber ein Freund voluminöser Publikationen, vor al-lem aus seinem Fachgebiet. So soll das Vorwort der Herausgeber hier enden und den Beiträgen in seiner Festschrift Platz machen, von denen wir hoffen, dass sie den hohen Ansprüchen des Geehrten ein wenig entgegenkommen.
Unser Dank gilt allen, die zum Zustandekommen dieses Buches beigetragen haben: zuerst den vielen Kolleginnen und Kollegen, die Beiträge beigesteuert haben, dem Redaktionsteam Dirk Rieger und Clau-dia Kimminus-Schneider, der Universität Kiel mit Ines Reese und Holger Dieterich für Satz und Lay-out und wichtige Unterstützung bei der Herstellung, der Archäologischen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck für Beteiligung an den Druckkosten, eben-so der Hansestadt Lübeck für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und dem Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel für die Möglich-keit, das Buch dort technisch und graphisch bis zur Drucklegung fertig zu stellen. In bewährter und zu-verlässiger Weise übernahm Herstellung und Druck der Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck. Unser Dank gilt dort dem Geschäftsführer Herrn Sperling und dem Leiter der Technischen Redaktion/Herstellung Herrn Krakow für großzügiges Entgegenkommen bei den Herstellungskosten.
Viel Glück und Erfolg für alle weitere Unterneh-mungen wünschen Manfred Gläser die Herausgeber, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freun-de, Autorinnen und Autoren dieses Bandes!
Alfred Falkfür die Archäologische Gesellschaft
der Hansestadt Lübeck
Ulrich Müller für das Institut für Ur- und Frühgeschichte
der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Manfred Schneiderfür den Bereich Archäologie
und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck
Lübeck, im Februar 2014
51
André Dubisch u. a. • Geschichte des Lübecker Burghügels • S. 51–68
Zweifellos hatte der Lübecker Burghügel bereits viel Spannendes von seiner langen Geschichte preis-gegeben, als Manfred Gläser 1992 mit seinem Aufsatz „Archäologische Untersuchungen auf dem Gelände des ehemaligen Burgklosters. Ein Beitrag zur Bur-genarchäologie“ (Gläser 1992) den bis heute gülti-gen Forschungsstand zur ehemaligen Lübecker Burg darlegte. Seine Ausführungen stützten sich neben der historischen Überlieferung hauptsächlich auf die zwischen 1976 und 1986 unter der Leitung Günter P. Fehrings durchgeführten archäologischen Unter-suchungen. Diese fanden auf dem Plateau des Hügels in und um die Gebäude des ehemaligen Burgklosters statt. Zwanzig Jahre nach dem Erscheinen jenes Ar-tikels erlaubte es eine neue großlächige Ausgrabung,
diesem Kenntnisstand weitere Details hinzuzufügen. Der Bau des neuen Europäischen Hansemuseums Lübeck erforderte es, einen großen Teil der Bodenur-kunde unter wissenschaftlicher Begleitung und Be-obachtung zu zerstören. Die notwendigen Bodenauf-schlüsse an der Westlanke des Burghügels zur Trave hin – immerhin auf einer Fläche von etwa 1300 m2
und mit bis zu 12 m hohen Proilen – erlaubten einen tiefen Blick in das Innere des Hügels und seine in über 1000 Jahren gewachsene Geschichte (Abb. 1). Die Baustelle des Europäischen Hansemuseums stell-te sich dabei mit ihren gewaltigen Erdbewegungen und mächtigen Tiefbauwerken in eine lange Traditi-on teils gewagter, meist auch repräsentativ gedachter Großvorhaben an diesem prominenten Platz.
Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels.Neue Befunde zur Befestigung und Entwicklung
eines wichtigen Siedlungskerns der Stadt Lübeck
von André Dubisch, Lüneburg, Eric Müller, Kiel, Cathrin Hähn, Bremen, Hendrik Rohland, Lübeck, und Katrin Siegfried, Lippstadt
Der befestigte Burghügel mit Schiffslandeplatz
Es waren schon immer Großbauten, die das Bild des Hügels im Norden der Lübecker Altstadt be-stimmten. Die topographische Lage auf einer mar-kanten Erhebung vor der Landenge, die den einzigen trockenen Zugang auf den Werder zwischen Wake-nitz und Trave bildete, bot sich geradezu für die Er-richtung von Befestigungsanlagen an. Die Region um Lübeck war in das weit gespannte Handels- und Verkehrsnetzwerk rund um die Ostsee eingebunden (Müller-Wille 2011, 257 f.) und lag während des Früh- und Hochmittelalters in einer Überschnei-dungszone der dänischen, sächsischen und slawischen Einlusssphären. Außerdem dürfte der Platz eine Rol-le in den innerslawischen Auseinandersetzungen des elften und zwölften Jahrhunderts gespielt zu haben
(Hammel-Kiesow 2008, 13 f.). Grund genug für die Anlage eines befestigten Stützpunktes, der zugleich als Symbol von Herrschaft und Macht dienen konnte.
Abgesehen von einigen verlagerten Funden älterer Zeitstellungen, wie Silexabschlägen und Kleinstfrag-menten wohl kaiserzeitlicher Keramik, waren die äl-testen Befunde etwa mittelslawischer Zeitstellung. In diese Richtung weisen sowohl Keramikscherben, ähn-lich dem Menkendorfer Typ, als auch einige dendro-chronologisch auf die Zeit um/nach 891 datierte Bau-hölzer 1. Die festgestellten Befunde dieser Zeitstellung bestanden vor allem aus dunklen, sandigen Schichten mit schwärzlichen Bändern, die vergangene organische Zwischenlagen repräsentierten. An einigen Stellen wa-ren diese schwarzen Bänder besser erhalten und auch
1 Alle folgenden Dendrodaten beruhen auf einem Gutachten von Dipl.-Holzwirtin Sigrid Wrobel vom 21.11.2013, der hierfür herz-
lich gedankt sei. Zur kritischen Würdigung der Probleme von „um/nach“ Datierungen vgl. Biermann 2013.
52 André Dubisch u. a.
mit Brandlehm durchmischt. Es scheint sich um rost- oder gelechtartige Holzlagen gehandelt zu haben, die teilweise mit noch erhaltenen kleinen Plöcken gesi-chert gewesen waren. Insgesamt zeugten diese Befun-de von den problematischen Untergrundbedingungen am westlichen Abhang des Burghügels: Die Schich-ten waren abgerutscht und verworfen, was auch ihr lückenhaftes Auftreten und unregelmäßiges Erschei-nungsbild erklärt. Eine zuverlässige Rekonstruktion der Baustrukturen ist damit nicht möglich. Auch die erwähnten, dendrodatierten Hölzer waren aus diesem Grund nicht näher einzuordnen. Sowohl die Ergebnis-se aus den Grabungen auf dem Hügelplateau (Gläser 1992, 72–75) und im Beichthaus (Radis 2011, 30) als auch die historische Überlieferung (Helmolds I, 57) legen nahe, in diesen Befunden die Reste einer slawen-zeitlichen Befestigung zu sehen, die der Errichtung der deutschen Burg durch Adolf II. von Schauenburg in den Jahren nach 1143 zeitlich voranging.
Auch wenn die Bauweise und das Aussehen der slawischen Befestigung nicht näher bestimmt wer-den konnten, so war es immerhin möglich, genaueres über die Beschafenheit des Hügels herauszuinden, die die Anlage bestimmte. Während der Hügel di-rekt unterhalb des Burgklosters ofenbar recht steil nach Westen abiel, nämlich von etwa 14 m ü. NN bis auf zunächst nur noch 3,50 m ü. NN und weiter bis zum Wasserspiegel der Trave, so war im nörd-lich gelegenen Bereich, wo im 13. Jahrhundert die Stadtmauer entstehen sollte, kaum Gefälle in dieses Richtung festzustellen. Vielmehr ragte ofenbar eine Art Geländesporn nach Westen in Richtung Trave. Gegenwärtig erscheint er an der Straße, die heute hier verläuft, jäh abgeschnitten und wird durch eine hohe Mauer gestützt. Vermutlich bildete er damals eine günstige Voraussetzung für einen Naturhafen oder wenigstens eine geschützte Anlandestelle unter-halb der Burg. Südlich dieses Sporns sperrte seit 1143
▲
▲ ▲
Abb. 1. Lübeck. Übersichtsplan der Ausgrabungen mit einer Auswahl der wichtigsten Befunde (Grafik: Hansestadt Lübeck, Be-reich Archäologie, H. Rohland).
53Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
der tiefe Graben der mittelalterlichen deutschen Burg die Halbinsel an der schmalsten Stelle der Landbrü-cke. Er war schon zuvor bei den Ausgrabungen und Bohrsondierungen auf dem Plateau des Hügels be-obachtet worden. Damals wurde die Befestigung als ein nach Westen ofenes „U“ rekonstruiert (Gläser 1992, 107, Abb. 6). Bei den Untersuchungen an der Westlanke des Hügels wurde der mittelalterliche Burggraben nun erneut angetrofen, und zwar an der Stelle, an der er von Osten den Hügel herab kom-mend nach Süden umbiegt. Erstmals konnte sein tiefster Bereich in einem vollständigen Querproil er-fasst werden (Abb. 2). Es zeigte sich ein mindestens 3,5 m tiefer Spitzgraben, der in den schweren Ton des gewachsenen Bodens eingegraben worden war, und dessen Sohle sich durch das Gefälle im Hangbereich recht zügig wieder mit Erosionsmaterial füllte. Man versuchte dem Problem der raschen Erosion durch das Auslegen der Grabensohle mit Findlingen und Backsteinbruch zu begegnen. In der letzten Nut-zungsphase des Grabens wurde eine Art Verhau aus Ast- und Wurzelholz eingebracht und mit Staken befestigt. Wahrscheinlich war dies eine Vorbereitung auf eine unmittelbar bevorstehende kriegerische Aus-einandersetzung. Nach den Erkenntnissen der jüngs-ten Grabungen kann nun festgehalten werden, dass der Graben in einem seichten Bogen nach Südwesten
den Hang herabzog, dabei aber aufgrund der Gelän-deform immer mehr die Form eines wohl künstlich übersteilten Hanges annahm. Ein Eichenholzbalken, der in der bald nach dem Aushub des Grabens einsedi-mentierten Füllung auf der Grabensohle aufgefunden wurde, erbrachte eine Datierung in die Zeit um/nach 1144. Da es sich nur um die sehr vage Datierung ei-nes Einzelfundes in der Grabenfüllung handelt, muss man der Versuchung widerstehen, dabei an die für das Jahr 1143 überlieferte Gründung einer civitas an diesem Ort durch Adolf II. von Schauenburg (Hel-mold I, 57) zu denken.
Zu dem tiefen Graben gehörte sicherlich ein ge-waltiger Wall, von dem auch noch Reste festgestellt werden konnten. Er bestand aus starken, überwiegend lehmigen Planierungen, die in Richtung des Hanges anstiegen und häuig dunkle Verfärbungen vergange-ner, hölzerner Einbauten enthielten. In einer Senke, in der sich das abließende Hangwasser sammelte, hatten sich Teile einer Holzpackung oder groben Rostkonst-ruktion hervorragend erhalten (Abb. 3). Diese war aus etwa armdicken oder noch stärkeren, kreuzweise über-einander gelagerten Stämmen und Ästen aus Birken- und anderem Holz zusammengesetzt. Sie wurde nach Nordwesten zum Graben hin von einer, mittlerweile umgestürzten und verdrückten Palisadenwand stabili-siert und außerdem von einigen angespitzten Eichen-
Abb. 2. Lübeck. Profil des Spitzgrabens der deutschen Burg im Hangbereich. Die Grabensohle ist zur besseren Sichtbarkeit nach-träglich hervorgehoben (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, H. Rohland).
54 André Dubisch u. a.
pfählen im Baugrund verankert. Die Pfähle konnten dendrochronologisch auf den Winter 1152/53 datiert werden. Dieses Datum belegt zusammen mit dem auf das Jahr 1156 datierten Burgbrunnen (Fehring 1982, 88), dass die Burg im Verlauf der 50er Jahre des zwölften Jahrhunderts kontinuierlich ausgebaut und wehrtechnisch ertüchtigt wurde. Bei weiteren, in das Jahr 1185 datierten Hölzern einer gleichartigen Holzpackung handelte es sich wohl um eine spätere Reparatur oder Verstärkung des Walles. Die topogra-phische Situation und der Vergleich mit anderen, ähn-lichen Befunden zeigen, dass ein angemessen steiler Burgwall trotz Holzkern sehr erosionsanfällig war und häuig ausgebessert werden musste ( Gabriel 1984, 44 f.). Als Rekonstruktionsvorschlag denke man sich einen außergewöhnlich steilen Hang, der mit Holzpa-ckungen und Lehmplanierungen künstlich befestigt und wahrscheinlich mit einem Wall auf der Hügel-kuppe bekrönt war. Vor dem Steilhang lag ein tiefer Spitzgraben. Ein eindrucksvolles Beispiel einer solchen Anlage stellt noch heute der Burgwall von Oldenburg in Holstein dar, wo der Höhenunterschied zwischen Grabensohle am Fuß des Hügels, und erhaltener oder teils rekonstruierter Wallkrone immerhin bis zu 20 m beträgt (Gabriel 1991, Abb. 3, 4, 5; Toločko 1991, 119).
Auch im südwestlichen Bereich unterhalb der ehe-maligen Burg sowie im weiteren Verlauf zur Trave
hin deutete der Schichtenverlauf auf eine Nutzung in slawischer Zeit hin. So wurde über weite Flächen eine Schicht beobachtet, die als alter Oberlächenho-rizont oder A-Horizont angesprochen werden konn-te und vereinzelt, jedoch ausschließlich, slawische Keramik enthielt. Die wenigen keramischen Bruch-stücke können als früh- bis mittelslawisch angespro-chen werden2. Im Grabungsbereich nahe der heu-tigen Straße An der Untertrave deutete der Verlauf des A-Horizontes auf die schon oben im Text ange-sprochene Situation mit einer Landzunge und einer dahinter liegenden Bucht hin. Hier wurde die halb-sichelförmige Buchtsituation durch das nun noch einmal steil nach Norden hin abfallende Schichten-niveau der ehemaligen Oberläche besonders deut-lich. Darüber hinaus ließ sich sogar der ehemalige Verlauf der Trave an jener Stelle rekonstruieren. Es ließen sich große Mengen an willkürlich angeord-neten Stöcken unterschiedlicher Größe entlang der Uferkante dokumentieren. Hierbei handelte es sich um Schwemmgut, welches sich am Flussufer durch Wasserspiegelschwankungen vermehrt angesammelt haben musste. Direkt entlang des alten Flusslaufes konnten ergänzend mehrere in Reihe stehende Pfos-ten und Reste eines Flechtwerkzaunes ergraben wer-den, die aufgrund der Stratigraphie eindeutig mit dem A-Horizont in Verbindung gebracht werden müssen. Sehr wahrscheinlich wurde mit Hilfe dieser
Abb. 3. Lübeck. Holzrost als Substruktion der mittelalterlichen Befestigung. Im Vordergrund eine moderne Störung (Foto: Han-sestadt Lübeck, Bereich Archäologie, H. Rohland).
2 Eine genauere Durchsicht zur näheren Datierung des Fundmateri-als musste bis zum jetzigen Zeitpunkt unterbleiben.
55Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
Konstruktion der Uferbereich gesichert und zudem gegen das Anspülen von Treibgut geschützt. Inwie-weit die angesprochene slawische Schicht mit der sla-wischen Burg oder einem freiliegenden Uferbereich in Zusammenhang zu bringen ist, lässt sich jedoch nicht abschließend klären.
Der ursprüngliche Uferbereich wurde spätestens ab dem 12. Jahrhundert mit mächtigen Aufüllun-gen nivelliert und das Traveufer im Zuge der Land-gewinnung weiter nach Norden verlagert. Manfred Gläser vermutete aufgrund von Grabungsergebnissen einen zur frühdeutschen Burg gehörenden Anlande-platz bzw. Hafenbereich für Schife und Boote an jener Stelle. Die frühdeutsche Burg und ihre Vor-gängerbauten kontrollierten aufgrund der exponier-ten Lage die Land- und Wasserhandelswege, welche von Nord nach Süd über und entlang des Burghü-gels verliefen. Dass es im Vorbereich der Burg ei-nen Hafen mit Werftcharakter gegeben haben wird, der zum einen die Burg versorgen konnte und zum anderen eine Kontrollfunktion inne hatte, scheint schlüssig. Die bisherigen, durch Altgrabungen ge-wonnenen Erkenntnisse konnten diese Vermutung nur bedingt bestätigen (Gläser 1992, 79 f.). Die neuen Grabungsergebnisse liefern hingegen aktu-elle Einblicke zum Hafengeschehen unterhalb der ehemaligen Burg. Die Grundlage für die Annahme eines Hafenbereiches bildete eine lächig ergrabene,
schwarze, moorig riechende Schicht. Es handelte sich hierbei um einen Nutzungshorizont des späten 12. oder frühen 13. Jahrhunderts, der mit großen Men-gen kleinteiligen Bebeilungs- und Hobelabfalls sowie Metallfunden durchsetzt war. Für die Ansprache als Hafen ausschlaggebend waren neben den Holzspä-nen skandinavische Schifsnieten, ungenutzte Kog-gennägel, „einfache“ Nägel, Kalfatklammern sowie Kalfatklammerrohlinge. Besonders die unterschied-lichen Kalfatklammern, welche typologisch ins 13. Jahrhundert oder älter datieren (Ellmers 1992, Abb. 1A), deuten auf eine Schifsbearbeitung oder Fertigung vor Ort hin.
Konstruktionshölzer, wie z. B. Planken oder Span-ten, die die Nutzung des Platzes als Werft sicher belegen würden, wurden jedoch nicht gefunden. Ergänzend fanden sich in dieser Schicht unter ande-rem kleinere Buntmetallbleche mit Nietenlöchern, mehrere Eisenmesser und ein iligran bearbeiteter Buchbeschlag. In diesem Kontext hervorzuheben sind auch jene Metallfunde, die als Reiter- und Mili-tärausstattung eingestuft werden können und für die Bedeutung des Platzes gesondert betrachtet werden müssen. Dazu zählen unter anderem kleine Pferdege-schirr- und Gürtelschnallen sowie das Fragment eines Wellenhufeisens. Des Weiteren wurden ein Reiter-sporn, der der Form F II nach Goßler 3 zugeschrie-ben werden kann (Gossler 1998, 551 f.) und zwei
1 2 3
Abb. 4. Lübeck. 1 silberner, wappenförmiger Pferdeschmuckanhänger des 13. Jahrhunderts; 2 (Tüllen)-Pfeilspitze des 11. bis 12. Jahrhunderts; 3 Reitersporn des späten 11. bis frühen 13. Jahrhunderts. (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, A. Du-bisch). M. 1:2.
3 Er gehört am ehesten zur Form F II (der Gruppe F) nach Goßler, die vor allem ins 12. und ins frühe 13. Jahrhundert (frühestens spä-tes 11. Jahrhundert) datiert. Leider ist das Material noch in detail-
lierter Form unbekannt. Dennoch lässt sich ein gehobenes Niveau postulieren.
56 André Dubisch u. a.
Pfeilspitzen, die dem Typ 6 nach Kempke4 angehö-ren, aus der Hafen-/Werftschicht geborgen (Kempke 1988, 301 f.). Außerdem muss ein iligran gearbeiteter, silberner, wappenförmiger Pferdeschmuckanhänger Erwähnung inden, der grob in das 2. und 3. Drittel des 13. Jahrhunderts datiert (Abb. 4, 1). Diese aktu-ellen Funde in Kombination mit historischen Quellen lassen Vermutungen zur Nutzung des Bereiches zu: So geht auch Manfred Gläser davon aus, dass im Be-reich zwischen den von der Grabung nicht weit ent-fernten Straßen Kleine und Große Altefähre Schife angelegt haben (Gläser 1992, 79 f.). Zudem wurde in jener Zeit in unmittelbarer Nähe der beiden Stra-ßen ein Haus des Deutschen Ordens eingerichtet, von welchem Kreuzritter nach Livland verschift wurden. Die Fundstücke mit militärischem Charakter deuten ebenfalls auf solch ein Szenario hin.
Die landesherrliche Burg oberhalb des Hafens soll-te nicht einmal hundert Jahre Bestand haben, als der rasante Aufstieg des Handelsplatzes Lübeck sie über-lüssig, ja gefährlich für die weitere Entwicklung der Stadt machte (Hammel-Kiesow 2008). Die Burg wurde nach der Vertreibung der zu diesem Zeitpunkt dänischen Besatzung um das Jahr 1226 geschleift und das Grundstück nach der Schlacht von Bornhö-ved 1227 zur Errichtung eines Dominikanerklosters gestiftet. Dieses Kloster wurde der Heiligen des Ta-ges von Bornhöved, Maria Magdalena, geweiht. Spu-ren von der Beseitigung der Burg ließen sich auch in den Befunden der Grabung deutlich nachvollziehen. Über den Schichten des größtenteils abgetragenen Walles und in die Vertiefung des Grabens wurde in großer Menge Erdmaterial aus verschiedenen Kultur-schichten slawischer und hochmittelalterlicher Zeit-stellung einplaniert.
Dennoch wurden mit diesen großen Erdbewe-gungen nicht alle Spuren der einstigen Befestigung getilgt: Die Senke des ehemaligen Burggrabens war bis ans Ende des 19. Jahrhunderts noch sichtbar. Ein tiefer Geländeeinschnitt zwischen dem Marstallge-bäude und der so genannten Reitbahn, einem wohl
spätmittelalterlichen Zweckbau zwischen Stadtmauer und Kloster, folgte exakt dem Verlauf des Burggra-bens und diente als Wegverbindung zwischen der Innenseite des Burgtores an der Großen Burgstraße und dem Bereich an der Trave (Abb. 11)5. Erst als am Ende des 19. Jahrhunderts die Reitbahn und die Klostergebäude abgebrochen wurden, um Platz für den Neubau des noch heute bestehenden Gefäng-nis- und Gerichtsgebäudes zu schafen, wurde der Graben vollständig aufgefüllt. Eine ganz ähnliche Geländesituation wiederholt sich weiter südlich, mit dem Unterschied, dass sie bis in unsere Tage erhalten geblieben ist: Die heutige Burgtreppe liegt genau in der Verlängerung des in der Straße Hinter der Burg durch Bohrungen erfassten Grabens (Gläser 1992 77, Abb. 3, 6). Unterhalb des Beichthauses ist eine markante Geländestufe zu erkennen, im Beichthaus selbst wurde eine bereits slawenzeitliche, künstliche Übersteilung und Befestigung des Hanges archäolo-gisch festgestellt (Radis 2011, 30). Genau an dieser Stelle lag der südliche Übergang des vom Plateau kommenden Grabens in den künstlich angelegten Steilhang an der Westlanke des Burghügels. Analog zu der heute nicht mehr sichtbaren Situation unter-
Abb. 5. Lübeck. Verziegelte Lehmplatte als Rest eines Ofens im Bereich des Töpfereibezirkes (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, H. Rohland).
Die Schleifung der Burg
4 Die Typologie Kempkes bezieht sich hierbei auf den Ostseeslawi-schen Raum. Demnach überwiegen innerhalb der typologischen Entwicklung der (Tüllen)-Pfeilspitzen die „Vierkanter“ nach der Jahrtausendwende und erreichen prozentual in späteren Zeiten bis ins 12. Jahrhundert und danach sowohl die größte Verbreitung als
auch die größte bekannte Stückzahl.5 Recht deutlich zu erkennen ist dies auf dem Lübecker Stadtplan
von 1872, wo zwischen Marstall und Burgkloster deutlich die Bö-schungssignatur des zur Trave abfallenden Einschnittes zu sehen ist.
57Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
halb der ehemaligen Reitbahn wurde auch hier der Einschnitt des Burggrabens später genutzt, um einen Zugang von den tiefer gelegenen Stadtteilen an der
Trave auf den Höhenrücken an der Großen Burgstra-ße zu schafen.
Abb. 6. Lübeck. Backsteinweg des späten Mittelalters und mit Keramik gefüllten Drainagen (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, H. Rohland).
Die Erschließung eines neuen Quartiers am Fuße des Burghügels
Unmittelbar nach Aufgabe und Beseitigung der Burg wurde ihr westlicher Hangbereich zunächst für handwerkliche Zwecke genutzt. Kurz nach Ab-schluss der Planierungen wurden mehrere Öfen auf dem Gelände angelegt, von denen nur noch verzie-gelte Bodenplatten, größere Mengen Holzkohleabfall und Reste der eingestürzten Ofenkuppeln festgestellt werden konnten (Abb. 5). In seiner Konstruktion mit einer Backsteinplasterung in der Arbeitsgrube ähnelte einer der älteren Öfen dem an der Kleinen Burgstraße aufgedeckten Befund, welcher grob in die 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert werden konnte (Meyer 1993). Ofenbar wurde das Gelände über einen längeren Zeitraum durch Töpfereibetrie-be genutzt. Darauf deuten zumindest die gewaltigen Mengen an Keramikbruch hin, die hier in mächti-gen Schichten abgelagert wurden und das Bodenni-veau damit wiederum erhöhten. Nach einer groben Schätzung wurden allein beim Abtragen der größten
Keramikschicht etwa zwei Tonnen Scherben, über-wiegend von harter Grauware der Variante b, aber auch glasierter roter Irdenware geborgen. Zum Teil waren auch Fehlbrände wie zum Beispiel überfeuerte Scherben oder eingefallene, zerdrückte Gefäße sowie Brennhilfen enthalten. Das Formenspektrum der Ke-ramik verweist allgemein in die Zeit des 13. und frü-hen 14. Jahrhunderts (Gläser 1988 b, 215 f.).
Danach, wohl noch im ausgehenden 14. Jahr-hundert, wurde hier ein Weg aus Backsteinen und Backsteinbruch angelegt. Er führte von Westen kom-mend nach Osten in Richtung Burgtor und folgte dabei etwa der Ausrichtung des alten Grabens. Wahr-scheinlich bildete er eine Verbindung vom ebenfalls im 14. Jahrhundert an der Untertrave entstandenen Arsenal zum Burgtor. Besonders aufällig war die sehr sorgfältige Ausführung des Weges: auf der dem Hang zugewandten Seite verliefen entlang des Weges Gräbchen, die mit Keramikbruch gefüllte waren. Sie
58 André Dubisch u. a.
dienten als Drainage, die verhindern sollte, dass vom Hang herabließendes Wasser und Schlamm den Weg unpassierbar machten (Abb. 6).
Im westlichen Bereich unterhalb des Hanges, zwi-schen dem neu gegründeten Kloster und der Stadt-mauer entstanden neue Grundstücke, die in die Zeit nach Aufgabe der landesherrlichen Burg und somit nach 1226 datieren. Dass es sich hierbei um ein inten-siv genutztes Areal gehandelt hat, wird nicht zuletzt durch das abwechslungsreiche und aussagekräftige Fundspektrum eines stark verdichteten Laufhori-zontes, der stratigraphisch wie auch räumlich auf der Hafen- oder Werftschicht lag, deutlich.
Die Keramik, welche ausschließlich während der Grabung gesichtet wurde, sprach für eine Datierung des Horizontes in das 13. Jahrhundert. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Harte Grauware der Variante b und einen kleineren Anteil Roter Irden-ware. Eine genauere Datierung in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts ließ sich nur aufgrund der geringen Anteile an Faststeinzeug und Steinzeug vornehmen.
Für eine Verwendung des Bereiches als Grund-stück sprachen die mehrphasigen Stakenreihen und damit in Verbindung stehende größere Kant- sowie Rundhölzer. Die größeren Hölzer lieferten zudem verwertbares Material für dendrochronologische Un-tersuchungen, die sie in die Mitte bzw. das Ende des 13. Jahrhunderts datieren. Bei den Holzbefunden handelte es sich hauptsächlich um zwei gekappte Stakenreihen in einer Flucht. Zudem konnte in ei-ner Ecke der Grabungsläche ein aufgrund der nas-sen Bodenverhältnisse sehr gut erhaltener, verstürzter Flechtwerkzaun ergraben werden. Weiterhin ließen einzelne, dicht an den beiden Stakenreihen verlaufen-de und nachträglich eingebrachte Staken und Bretter Reparatur- bzw. Erneuerungsphasen vermuten, die zeitlich nah beieinander lagen. Trotz dieser Erkennt-nisse kann nicht von einem geschlossenen Grund-stück, mit einer nordwestlich und einer südöstlich verlaufenden Grenze die Rede sein.
Im weiteren Grabungsverlauf konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass es sich um ein und die-selbe Grundstücksgrenze gehandelt haben muss: Die südwestliche Stakenreihe war aufgrund eindeutiger stratigraphischer Verhältnisse älter als die nordöstli-che. Es hat somit den Anschein, als wäre das Grund-
stück Ende des 13. Jahrhunderts um gute 5 m in Richtung Nordosten erweitert worden.
Ein weiterer Befund, der im Bereich der Stakenrei-hen entdeckt wurde und auf einen Hofbereich hin-deutete, war ein teilweise zerstörter Wasserspeicher oder Brunnen mit hineingestürzten Keramikgefäßen (Abb. 7). Er bestand aus einem in den Boden ein-getieften Holzfass. Neben einigen Fassdauben hat-ten sich noch die Fassreifen aus längs gespaltenen Weidenruten und der Boden erhalten. Trotz massi-ver jüngerer und moderner Störungen oberhalb und seitlich des Brunnens gehörte er mit hoher Wahr-scheinlichkeit in denselben zeitlichen Kontext wie der oben angesprochene Laufhorizont. Verfüllt war der Brunnen mit Keramik, die grob in das 13./14. Jahrhundert datiert 6. Ein von der Konstruktions-art und der Datierung her ähnlicher Befund wurde weiter östlich ergraben. Hierbei handelte es sich um einen Fassbrunnen, dessen Sohle jedoch aus halbier-ten Backsteinen und Feldsteinen bestand. Von dem zugehörigen Fass, das die Versteifung der Brunnen-röhre bildete, waren jedoch nur die Fassreifen aus gespaltenen Weidenruten erhalten. Sie hatten sich in das tonige, klebrige Sediment eingedrückt und blie-ben zurück, als man beim Aulassen des Brunnens die Fassdauben entfernte. Die eingebrachte Verfül-lung enthielt Backsteinbruch und Keramikscherben. Dabei handelte es sich ebenfalls hauptsächlich um
Abb. 7. Lübeck. Rekonstruktion der Durchführung der Holz-wasserleitung unter der Mauer zum „Blumenhof“ des Burg-klosters. Unterhalb der Fundamentmauern unterstützten Holzkästen den durch den Leitungsgraben geschwächten Baugrund (Grafik: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, K. Siegfried).
6 Die Keramik stammt von der mächtigen Keramikschicht des am Hang gelegenen Töpfereibetriebes, die das Gelände allmählich auf einer großen Fläche bedeckte.
59Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
die zeittypische Grauware Variante b sowie Rote Ir-denware. Bei Ausgrabungen im Johanniskloster der Stadt Lübeck wurde ein ähnlicher Brunnenbefund aufgedeckt, dem dort nur eine kurze Nutzungszeit zugeschrieben wurde (Gläser 1989, 14, Abb. 12.1).
Hausstrukturen oder ähnliche Konstruktionen, die im Zusammenhang mit einer Hofsituation im Bereich näher zur Trave hin zu erwarten wären, wurden nicht entdeckt. Lediglich größere, teils sehr schlecht erhaltene und partiell mit Bearbeitungsspu-ren versehene Bretter lagen in und auf dem Laufho-rizont. Der fehlende Nachweis von Hauskonstruk-tionen in diesem hangnahen Bereich kann jedoch mehrere Gründe haben. Sollten dort Häuser gestan-den haben, kann man davon ausgehen, dass sie auf Unterbaukonstruktionen standen, die nicht in den Boden eingetieft wurden, sondern ihm aulagen. Sol-che Schwellbohlenkonstruktionen wären im Laufe der Zeit, ohne größere Rückstände im Boden zu hin-terlassen, durch nachfolgende Bodeneingrife wie den Bau des Arsenalgebäudes abgetragen worden. Weiter im Südwesten der Grabungsläche hingegen wurden innerhalb zweier Sondagen tatsächlich Reste der In-nenbebauung eines Hauses, ein Hinterhofareal mit einer Backsteinkloake sowie zwei Grundstücksgren-zen erfasst. Diese Befunde sind jeweils grob ins späte Mittelalter zu datieren.
In den hier nah an der Straße angetrofenen Grundstücksarealen lagen zwei Flechtwerkzäune aus
teils noch sehr gut erhaltenen Staken und Zweigen. Sie verliefen in Nordost-Südwest-Richtung, damit rechtwinklig zu den hangnahen Stakenreihen und etwa auf die Achse der Straße Kleine Altefähre zu. Die ergrabenen Befunde verliefen damit entlang der bis ins 19. Jahrhundert noch existierenden Grenzen des Grundstücks an der Ecke zwischen Kleine Altefäh-re und An der Untertrave. Ganz im Südwesten dieses Grundstücks wurden schließlich mehrere übereinan-der liegende Fußbodenniveaus und ein Schwellbalken entdeckt. In den angelegten Proilen ließen sich die Backsteinfußböden mit den entsprechenden Laufni-veaus erkennen, welche immer wieder durch mehrere Zentimeter dicke, luviatile Sedimente überdeckt wor-den waren. Hierbei handelte es sich um Überschwem-mungshorizonte im Erdgeschossbereich des ehemals hier gelegenen Hauses, von dessen konstruktiven Ele-menten aber aufgrund der geringen Größe der Auf-schlüsse kaum Spuren entdeckt werden konnten.
Abschließend sei erwähnt, dass sich die gewonne-nen archäologischen Erkenntnisse über den Verlauf der Grundstücksgrenzen mit der von Rolf Hammel-Kiesow angenommenen und skizzierten Grund-stücksverteilung im Bereich der Untertrave decken (Hammel-Kiesow 2008, Abb. 16). Der grobe Ver-lauf jener Grundstücke konnte somit archäologisch nachgewiesen werden und scheint nach der Nut-zungsphase als Hafen im 13. Jahrhundert in diesem Bereich festgelegt worden zu sein.
Das städtische Arsenalgebäude
In der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden von der Stadt Lübeck die Häusergrundstücke im Bereich zwischen dem Eckhaus an der Straße Kleine Alte-fähre und der Stadtbefestigung erworben. An dieser Stelle sollte ein neues städtisches Großvorhaben re-alisiert werden: das sogenannte Arsenal. Nach dem Kauf der Grundstücke im Jahr 1334 wurden die darauf beindlichen Bauten abgerissen und an die-ser Stelle entstand das, zunächst als Haus der Stadt (domus civitatis) bezeichnete Gebäude. Als solches erfährt es eine erste Erwähnung im Oberstadtbuch im Jahr 1337. Es wurde primär als Lagerhaus genutzt und diente zur Aufbewahrung von Korn, Steinen und auch Schifsgeschützen und -material. Das Ge-bäude wurde über einen langen Zeitraum genutzt, im 16. Jahrhundert fungierte es als Lagerraum für Lüneburger Salz. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es im Zuge von Hafenverbreiterungsmaßnahmen
dann schließlich abgerissen (Bruns u. a. 1974 a, 319 f.).
In den nachfolgenden Jahren entstand auf dem Ge-lände ein neues Gebäude, das als Magazin und Hafen-verwaltung genutzt wurde. Den Namen „Arsenal“ je-doch behielt es bis zum Neubau des Seemannsheims zu Anfang des 20. Jahrhunderts bei. Im Bereich nahe der Straße An der Untertrave konnten auf einer Gesamt-länge von 25 m Reste des etwa 1 m breiten aufgehenden Mauerwerks und das zugehörige Fundament des Ar-senals ergraben werden. Das mächtige, vierlagige, sich nach oben verjüngende Findlingsfundament befand sich in einer Baugrube, die in regelmäßigen Abständen mit senkrechten Bohlen verstärkt worden war. Ergän-zend wurden im südwestlichen Bereich der Grabungs-läche die Fundamente zweier Strebepfeiler angetrofen (Abb. 1). Die erwähnten Befunde zählen zu den stra-tigraphisch jüngsten des näher an der Trave gelegenen
60 André Dubisch u. a.
Grabungsbereiches. Das Fundament und die zugehöri-ge Baugrube durchstießen die älteren Schichten. Auch das Backsteinmaterial und die Fugenausbildung unter-stützen die Aussage, dass diese Reste zum als Arsenal bezeichneten Gebäude des 14. Jahrhunderts gehörten. Insgesamt passt die massive Unterkonstruktion zu dem
Abb. 8. Lübeck. Brunnen oder Wasserbehälter aus einem eingetieften Fass mit darin enthaltenen Gefäßen des 13./14. Jahrhunderts (Links eine moderne Störung. Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, A. Dubisch).
Umstand, dass es sich hierbei um ein großes Bauwerk gehandelt hat, dessen Gründung aufgrund des instabi-len Bodens einen sehr robusten Unterbau voraussetzte. Veriiziert wird diese Aussage durch die beiden meter-dicken Strebepfeiler, die dem Gebäude zusätzlichen Halt verliehen haben.
Die Wasserkunst im Lübecker Norden
Für denselben Zeitraum fanden sich weitere Bele-ge, dass der Bereich unterhalb der ehemaligen Burg infrastrukturell ausgebaut wurde: In Lübeck nahmen hölzerne Wasserleitungen bereits ab etwa 1300 eine zentrale Rolle bei der Wasserversorgung der Stadt ein. Sie ermöglichten im Gegensatz zu den Wasser-trägern und -fahrern den konstanten Transport gro-ßer Frischwassermengen und waren für die weitere Entwicklung des Handwerks unabdingbar. Daher verwundert es auch nicht, dass gerade die Lübe-cker Brauer zwischen 1291 und 1294 die Initiatoren der ersten Wasserkunst am Hüxtertor waren. Lü-beck erhielt mit der Errichtung einer Kombination aus Schöpfrad und Hochbehälter als erste Stadt in Deutschland ein System aus Druckwasserleitungen (Grabowski/Schmitt 1993, 217 f.).
Ein knappes Jahrzehnt später und ebenfalls auf Initiative der Brauer entstand 1302 im Norden der Stadt die „Brauerwasserkunst vorm Burgtor“. Im Gegensatz zu dem älteren Leitungssystem war dieses nicht an künstliche Wasserhebung gebunden, son-dern bediente sich des Gefälles der bereits für die ers-te Wasserkunst aufgestauten Wakenitz zu den tiefer liegenden Gebieten im Bereich der heutigen Straßen An der Untertrave und Kleine Altefähre hin. Nicht als Teil des Hauptarms der „Brauerwasserkunst vorm Burgtor“, jedoch als nachträgliche Ergänzung die-ses Leitungssystem anzusprechen, ist eine aufgrund der idealen Lagerbedingungen im Untergrund her-vorragend erhaltene Eichenholzwasserleitung. Die dendrochronologisch auf das Jahr 1383 (+14/-6) da-tierte Leitung konnte im Zuge der Ausgrabung auf einer Länge von 6,50 m freigelegt werden. Während der Befund im Nordosten durch die Baugrube eines Hochbunkers aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges gekappt worden war, konnte durch eine Kamerabe-fahrung ermittelt werden, dass die Leitung unter einer Mauer hindurch in den benachbarten, soge-nannten Blumenhof des Burgklosters verlief und dort wahrscheinlich einen Wasserspeicher oder auch Sod mit Frischwasser aus der Wakenitz speiste.
In baulichem und zeitlichem Zusammenhang, dendrodatiert auf den Winter 1380/81 bis zum Win-ter 1382/83, stand darüber hinaus ein System aus mehreren nach oben ofenen Holzkästen in der di-rekten Nachbarschaft zu der Wasserleitung. Diese Kästen dienten dazu, den zur Trave hin steil abfal-lenden Hang gegen Rutschungen zu sichern, über-ingen die Wasserleitung und stellten gleichzeitig die Fundamentkonstruktion für eine wohl dem 14. Jahr-hundert zuzuordnende Verschalung der Mauer zum benachbarten Blumenhof dar (Abb. 8).
61Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
Auch wenige Meter hinter dem Arsenalgebäude wurde nach Abtrag des modernen Seemannsheims, das hier weit in den Hügel hineingebaut war, eine hölzerne Druckwasserleitung angetrofen, welche je-doch zeitlich und funktional wenig mit der bereits zuvor genannten Leitung zu tun hatte. Die Wasser-leitung und die dazu gehörende Baugrube störten alle darunter liegenden mittelalterlichen Schichten. Sie zählt, wie auch das Arsenal, zu den jüngsten Be-funden in jenem Bereich. Die Holzleitung wurde im nass-lehmigen Boden nahezu perfekt konserviert. Es handelte sich um einen längs durchbohrten Vier-kantbalken. Die Leitung gliederte sich in drei kon-struktive Elemente: eine sehr massive Mufe (Abb. 9), welche als Verbindungsstück zwischen zwei einzelnen Holzleitungen diente, ein intaktes Lei-tungsstück und ein, aufgrund von Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen aufgesägtes Teilstück. Das Verbindungsstück ist mit anderen Exemplaren zu vergleichen, die bei verschiedenen Grabungen in der Lübecker Altstadt gefunden und nach Grabowski
dem Typ 2 (Grabowski/Schmitt 1993) zuzuord-nen sind.
Es handelt sich hierbei um einen sehr aufwändi-gen und zudem vielseitigen Rohrtyp, welcher nicht zu den ältesten, jedoch auch nicht zu den jüngsten Vertretern zählt. Auch die Tatsache, dass die vorlie-gende Wasserleitung gebohrt und die Rinne nicht ausgehauen wurde, wies auf einen jüngeren Wasser-leitungstyp hin (Grabowski/Schmitt 1993, 222). So lassen sich u. a. im Holzschnitt des Elias Diebel von 1552 technisch-konstruktive Hinweise dafür erkennen, dass in Lübeck im 16. Jahrhundert Was-serleitungen mit einem großen Bohrlöfel hergestellt wurden. Den Beweis für diese zeitliche Einordnung lieferten jedoch die Ergebnisse der dendrochronologi-schen Untersuchungen. Die Mufe sowie drei der für diese Konstruktion in den Boden eingebrachten Un-terleghölzer datieren in das Jahr 1517. Der ergrabene Leitungsabschnitt ist somit als eine Druckleitung des 16. Jahrhunderts anzusprechen.
Abb. 9. Lübeck. Druckwasserleitung des 16. Jahrhunderts. Links im Bild die große Muffe, die ursprünglich der Verbindung zweier Holzröhren diente. Die Konstruktion war auf Unterleghölzern gelagert (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, A. Du-bisch).
62 André Dubisch u. a.
Nach der Schleifung der Burg im 1. Drittel des 13. Jahrhunderts wurde an ihrer Stelle das Burgklos-ter durch den Dominikanerorden errichtet. In den nachfolgenden Jahrhunderten unterlag das Kloster weitreichenden Um- und Ausbaumaßnahmen. Über die Hauptausbauphase des Klosters aus dem 13. und der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts lassen sich leider nur wenige historische Hinweise inden. Für die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts ist die Quellenlage etwas besser. Nach Einführung der Reformation in Lübeck wurde das Kloster schließlich „umgewandelt“ und als Armenhaus genutzt. Diese Neustrukturierung zeigt sich anhand von neuen Anbauten, die als Ar-menwohnungen genutzt wurden. Für den Erhalt der Gebäude scheint jedoch wenig getan worden zu sein. Diese Erkenntnis lässt sich unter anderem aus Be-richten gewinnen, die über einstürzende Bereiche des Gewölbes im Beichthaus oder aber über den Zerfall der Gebäude im 18. Jahrhundert informieren (Balt-zer u. a. 1928, 242 f.).
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Gebäude des Armenhauses sowie des Klosters zum Teil abge-rissen und die Überreste in ein neues Gefängnis- und Gerichtsgebäude integriert. Auch der nordwestlich des Burgklosters gelegene, sogenannte Blumenhof war seit der Klosterzeit großlächig von zahlreichen Baumaßnahmen betrofen, wie Pläne zur Altbebau-ung erkennen lassen. Bei den Grabungen konnten Ausschnitte und Reste der oben erwähnten Gebäude wieder entdeckt werden. So ließen sich mit Hilfe der Grabungsergebnisse neue Erkenntnisse über die Nut-zung und die zeitliche Einordnung der Gebäude so-wie des Blumenhofes gewinnen. Begrenzt wurde der Blumenhof durch eine nördliche Mauer, die hier als Blumenhofmauer bezeichnet wird. Die Mauer dien-te dazu, unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und Grundstücke eindeutig voneinander zu trennen.
Der von ihr eingefasste Bereich des Blumenhofs er-lebte seit seiner Einfriedung im 13./14. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert hinein die verschiedensten Nutzungs- und Bebauungsphasen. Im Südwesten grenzte der Blumenhof an Gebäude, die in Altplänen der nachreformatorischen Zeit zugeschrieben werden. Die Mauerreste dieser Gebäude kamen erst nach Ab-trag mächtiger Schuttschichten zum Vorschein. Bei den Schichten handelte es sich um Backstein-, Mör-tel- und Dachpfannenmaterial, das sehr wahrschein-lich zu den abgebrochenen Kloster- und Armenhaus-gebäuden gehörte und vor Ort aufplaniert wurde.
Von dem in Rede stehenden Gebäude haben sich die bodennahen Bereiche des Erdgeschosses und der Keller erhalten. Vom Erdgeschoss ließen sich noch zugemauerte Türdurchstöße, mehrphasige überein-ander liegende Backsteinfußböden und Laufniveaus nachweisen. Der darunter liegende Keller wurde durch ein nachträglich eingezogenes Tonnengewöl-be gebildet, wobei Putzreste und Fugenverstrich an den Gebäudefundamenten andeuten, dass hier mög-licherweise ein älterer Keller nachträglich überwölbt wurde. Der Bau des Tonnengewölbes kann durch die im Mörtel und der Füllung der Gewölbezwickel ge-fundenen Fayencen etwa in das 17./18. Jahrhundert datiert werden. Das Kellergewölbe war partiell stark eingesackt und zudem mit Bauschutt verfüllt.
Schon vor Abtrag des auf der Kellerdecke beindli-chen Backsteinfußbodens konnte aber der Grund für den in der Nordwestecke eingesackten Backsteinfuß-boden vermutet werden: Direkt unterhalb des abge-sunkenen Bereiches befand sich eine runde Backstein-kloake des 16./17. Jahrhunderts, welche hauptsächlich mit Fäkalmaterial verfüllt war. Im Laufe der Zeit ver-lor die Verfüllung an Volumen, schrumpfte zusam-men und somit sackte der darüber beindliche Keller nach. Ihr ehemaliger Durchmesser konnte auf etwas über 2 m geschätzt werden. Die Kloake gehört funkti-onal zu dem älteren Keller und wurde somit noch vor der Zeit des Tonnengewölbes gebaut.
Unweit der Backsteinkloake wurde die Nordwest-mauer eines alten Gebäudelügels angetrofen. Heut-zutage stützt diese Mauer einen beträchtlichen Teil des Erdreiches der Anhöhe des Burgklosters, welches sonst in das angrenzende und um bis zu 8 m tiefer liegende Grundstück Kleine Altefähre 8 stürzen wür-de. Die in dieser Außenmauer verbauten Backsteine konnten unter anderem mit Hilfe der Backsteinchro-nologie in die Zeit des 14./15. Jahrhunderts datiert werden (Gläser 1988 a). Diese neuen Erkenntnisse widerlegen bisherige Annahmen, wonach dieser Ge-bäudelügel erst in der Neuzeit errichtet worden und somit der Ausbauphase des Armenhauses zuzuschrei-ben sei. Vielmehr ist schon in der Klosterzeit ein Teil des Gebäudelügels errichtet worden. Ergänzend konnte zudem noch das Erdgeschossniveau des Ge-bäudes anhand der nachträglich zugemauerten Fens-teröfnungen und des am Fugenstrich erkennbaren Sichtmauerwerks rekonstruiert werden. Zur Funkti-on des Gebäudes innerhalb der Klosteranlage kann jedoch bisher keine Aussage getrofen werden.
Klostergebäude und Blumenhof
63Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
Im 18./19. Jahrhundert wurde im Hof vor dem Ge-bäude ein Granitbrunnen samt Brunnenhaus errich-tet. Die Blumenhofmauer hatte auch in dieser Zeit weiterhin Bestand und wurde immer wieder umge-staltet. Im Jahr 1894 wurden die Gebäude und der Brunnenkomplex für den Bau des neuen Gefängnis-ses und Gerichtsgebäudes abgerissen (Gläser 1992, 67 f.). Das Abbruchmaterial wurde einfach vor Ort planiert und für eine anschließende Gartennutzung des Areals mit Erdmaterial überdeckt.
Der Granitbrunnen und das ihn umgebende Brun-nenhaus sollen an dieser Stelle aufgrund ihrer beson-deren Konstruktionsmerkmale und der gewonnen Erkenntnisse gesondert Erwähnung inden. Dieser Befundkomplex wurde bereits in der ersten Flächen-dokumentation angetrofen und zählt somit zu den jüngsten Befunden innerhalb des Abschnitts. Der
Bau des Brunnens konnte aufgrund der vorliegenden Stratigraphie frühestens in das 18. Jahrhundert da-tiert werden. Der Brunnen besaß einen Durchmesser von gut 1,80 m und bestand aus 14 übereinander ge-setzten Lagen von zugehauenen, sehr massiven Gra-nitblöcken. Innerhalb jeder Lage besaßen die Steine eine einheitliche Höhe, wobei diese bei durchschnitt-lich knapp 0,5 m lag. Demgegenüber hatten die Gra-nitsteine selbst sehr uneinheitliche Längen zwischen 25 bis 100 cm, was einer Anzahl von neun bis zwölf Steinen pro Brunnenring entsprach. Die Innenlä-chen waren sauber bogenförmig gehauen. Die Au-ßenlächen wurden ab der dritten Lage spitz – nahezu pyramidenförmig – zugearbeitet.
Diese einem Dorn ähnelnde Fläche verlieh dem Stein zusätzliche Festigkeit und Halt im Boden. Ge-legentlich wurden Steinabschläge der Granitringstei-ne in der Brunnenbaugrube entdeckt, was auf eine Nachbearbeitung der Steine vor Ort unmittelbar vor dem Einbringen in den Boden spricht. Untereinander waren die Blöcke nicht verkittet bzw. vermörtelt. Die Festigkeit wurde durch den gegenseitigen Druck und durch die große und tief reichende, größtenteils mit Lehm verfüllte Baugrube gewährleistet. Die obersten Steinringe wurden schließlich von einer quadrati-schen Backsteinmauer umgeben. Insgesamt konnten 14 Granitsteinlagen von 10,50 m bis 2,80 m ü. NN dokumentiert werden. Die Brunnensohle wurde nicht freigelegt, da die vorläuige Endtiefe der Grabung er-reicht war. Es kann jedoch aufgrund von Bohrungen und Beobachtungen vermutet werden, dass der Brun-nen einen hölzernen Unterbau besitzt und somit von diesem Niveau aus nicht mehr allzu tief in den Boden reicht. Auf den letzten 30 cm wurden die Granitstei-ne von innen mit bogenförmigen Holzbalkenlagen „ausgesteift“, welche mit Holznägeln untereinander verbunden waren. Die dabei entstandenen Freiräume zwischen Holz- und Steinring wurden mit Backstei-nen verfüllt.
Die oberen Steinlagen wurden während der Gra-bung nacheinander abgebaut, wobei die Brunnenver-füllung entnommen wurde. Bei der sandigen Verfül-lung handelte es sich lediglich um eine Abfallschicht des 19. Jahrhunderts. Sie bestand aus allerlei Haus-halts- und Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel Keramik, Tonpfeifen und Küchengeräten aus Metall. Eine besonders interessante Entdeckung konnte ab der fünften Steinlage gemacht werden: Es ließen sich auf der Innenseite nahezu auf jedem Stein geometri-sche Einkerbungen erkennen (Abb. 10). Es handelte sich hierbei zum einen um einfache Buchstaben, wie
Abb. 10. Lübeck. Höhenschichtenzeichen im Inneren des Gra-nitbrunnens (Foto: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie, A. Dubisch).
64 André Dubisch u. a.
ein U, E oder ein querliegendes T. Zum anderen wur-den einfache Punkte sowie quer- und aufrecht stehen-de Striche in den Stein gehauen. Interessanterweise besaßen 90 % der Steine einer Lage jeweils identische, nur teilweise anders angeordnete geometrische Sym-bole. Daher kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um sogenannte Höhenschichtenzeichen handelt. Die Steine für den Brunnenbau waren meist von Steinmetzen andernorts gefertigt worden. Um ei-nen gleichmäßigen Durchmesser des Brunnens und eine einheitliche Steinhöhe innerhalb der Ringe zu ermöglichen, wurden die einzelnen Lagen mit Hilfe der Zeichen markiert. So konnten sie vor Ort wie-der passend zusammengesetzt werden. Dennoch sind kleinere Rest- und Feinarbeiten aufgrund der oben erwähnten Steinabschlagfunde wahrscheinlich.
Zu dem Brunnen und dem ihn umfassenden Back-steinmauerwerk gehörten weitere Befunde, die das Gesamtbild der damaligen Situation im Blumenhof erahnen lassen. Es handelte sich hierbei um mehrere Mauern, von denen nur noch die Fundamentierung und vereinzelt Reste des aufgehenden Mauerwerks erhalten waren. Sie gehörten, wenn auch nicht kom-plett erfasst, zu zwei Gebäuden und sollen im weite-ren Verlauf als Brunnenhaus angesprochen werden. Wie bei dem oben erwähnten Backsteinquadrat lie-ßen die sehr uneinheitlichen Steinformate auf eine Sekundärverwendung des Baumaterials schließen. Die Fundamente sowie die Baugruben grifen nicht sehr tief in den Boden ein. Zudem wurde größten-teils auf Findlinge als Unterbau verzichtet. Lediglich in den Bereichen – meist den Gebäudeecken –, in de-
Abb. 11. Lübeck. Ansicht des Geländes von Westen am Ende des 19. Jahrhunderts. Links der Marstall mit dem Turm des Burgtores im Hintergrund. In der Bildmitte das Gebäude der so genannten Reitbahn mit zugesetztem Portal. Dazwischen ist als tiefer Ein-schnitt die Senke des ehemaligen Burggrabens zu erkennen (durch schwarze Linie markiert). Rechts am Rand das Hospital des Burgklosters mit davor stehenden Nebengebäuden. Das Arsenal war zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen (Foto: Hansestadt Lübeck, Bildarchiv des St. Annen-Museums).
65Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
nen die entstehende Aulast am größten war, wurden Findlinge verwendet. Über die Konstruktionsweise des Backsteinbaus ließ sich aufgrund des Erhaltungs-zustandes nur wenig herausinden. Eine Baufuge deutete darauf hin, dass es im Südwesten eine Art Eingangsbereich gegeben haben musste. Ergänzend ließ sich anhand des Mauerverlaufs und eines Säulen-fundamentes eine Innengliederung erfassen, die auf einen Eingangsraum und einen rückwärtig gelegen Raum zur Wasserentnahme hinweist.
Bei der Brunnenkonstruktion handelt es sich um einen Wasserspeicher. Für eine solche Konstruktion wird in der Lübecker Literatur häuig der Begrif „Sod“ verwendet. Hiermit ist meist ein durch Was-serleitungen gespeister Wasserspeicher gemeint. Je-doch ist der Begrif im technischen Sinne etwas zu allgemein, da er im norddeutschen Raum häuig le-diglich für einen gegrabenen Brunnen steht (Korth 1832). Mit Frischwasser versorgt wurde der Brunnen durch die außerhalb des Hofes gelegene Wasserlei-tung, die auf die Blumenhofmauer und den dahinter
liegenden Brunnen zulief. Auf einem Gebäudeplan aus dem Jahr 1844 ist im Bereich des Blumenhofes ein quadratisches Gebilde skizziert, dessen Ausmaße zu der ergrabenen innersten Backsteinmauer passen. Eine solche kastenförmige Signatur indet sich ein zweites Mal auf dem gleichen Plan im Südosten des Burgklosters wieder.
Glücklicherweise existiert von der dortigen Innen-hofsituation eine Zeichnung aus dem Jahr 1869. Dort ist ein ehemaliger, heute durch das Gerichtsgebäude überbauter Hofbereich zu erkennen. Rechts im Bild steht eine Pumpe, die mit einer Unterbaukonstrukti-on auf einem viereckigen Backsteinkasten angebracht ist. Hier handelt es sich mit Sicherheit um eine ähn-liche, wenn nicht sogar identische Brunnensituation wie im Blumenhof. Mit Hilfe dieser Skizze erhält man eine gute Vorstellung davon, welche Funktion die innere ergrabene Backsteinmauer eingenommen hat und welche Pumpentechnik Mitte des 19. Jahr-hunderts eingesetzt wurde.
Die Entwicklung des Geländes von der Neuzeit bis heute
Bereits vor Beginn der eigentlichen Grabung wur-de bei der Entnahme eines Heizöltanks der Vorder-giebel der sogenannten Reitbahn oder Reitschule auf-gedeckt. Die beiden Namen des Gebäudes sind durch zwei Pläne des Burgklosters und seiner nächsten Um-gebung von 1844 und 1894 belegt. Aus diesen Plä-nen kennen wir auch in etwa die Form des Bauwerks: ein leicht zum Trapezoid verzogenes Rechteck. Sein Erscheinungsbild ist anhand von zeitgenössischen Zeichnungen und Fotos recht gut ersichtlich. Eine Fotograie aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt ein über dem Steilhang am Westen des Hügels errichtetes Gebäude mit einem steilen Satteldach und einem hohen Giebel zur Trave hin (Abb. 11). Rechts davon steigt das Gelände stark an, während es auf der linken Seite nur seicht ansteigt. Hier ist wieder die noch im 19. Jahrhundert das Gelände prägende Lage des ehemaligen Burggrabens zu erkennen. Besonders interessant erscheint eine vermauerte Portalöfnung, die an der am tiefsten gelegenen Stelle der Giebelfas-sade sowohl auf dem Foto zu sehen ist, als auch im Befund zu erkennen war.
Das Gebäude war bei seiner Errichtung ofen-
sichtlich an die topographischen Gegebenheiten am Abhang zum Graben hin angepasst worden: Das durch die Lage der Fenster zu rekonstruierende Fuß-bodenniveau muss 13 –14 m ü. NN gelegen haben. Es war also vom Burghügel aus ebenerdig zugänglich. Man nutzte die Hanglage des Gebäudes, das über eine etwa 2 m breite Teilunterkellerung im Bereich des ehemaligen Grabens verfügte (Gläser 1992, 88, Beil. 2), um einen Durchgang von der Hügelkuppe auf das Niveau unterhalb des Gebäudes zur Trave hin zu schafen. Der Keller konnte an dieser Seite in Richtung Arsenal durch das Portal verlassen werden. Weitere Fundamentmauern dieses Gebäudes wurden bereits früher weiter östlich auf dem Plateau erfasst und anhand der Keramik in den Baugruben vorläuig ins 16. Jahrhundert datiert, ohne dass darüber letzte Sicherheit erlangt wurde 7. Ein an der Gebäudeecke festgestellter Stützpfeiler war eindeutig nachträglich vorgesetzt worden, und musste sicherlich aufgrund des schwachen Baugrundes, den der teilverfüllte Gra-ben abgab, errichtet werden.
Die ursprüngliche Funktion des Gebäudes ist nicht bekannt. Da es zwischen Marstall und Arse-
7 Zur Datierung beachte Anm. 47 bei Gläser 1992, 88.
66 André Dubisch u. a.
nal auf städtischem Grund liegt, ist eine Nutzung in Zusammenhang mit der Stadtverteidigung oder an-deren kommunalen Aufgaben denkbar. Die in den Plänen des 19. Jahrhunderts namentlich belegte Nut-zung als Reitbahn machte es möglicherweise nötig, den Kellerraum aufzufüllen und daher den zugehöri-gen Zugang zu verschließen.
Im Bereich des Hanges unterhalb der Reitbahn blieb der bereits erwähnte Backsteinweg des 14. Jahr-hunderts für sehr lange Zeit in Gebrauch. Auf eine lange Nutzungszeit deutete zunächst das extrem ab-genutzte Erscheinungsbild der Backsteinplasterung hin. Aus einer kleinen Planierung, die den Verlauf des Weges noch berücksichtigte, stammt der Fund ei-nes Hamburger Schillings mit der Jahresangabe 1759 auf dem Revers. Das würde bedeuten, dass der Weg vom späten Mittelalter bis mindestens in die 2. Hälf-te des 18. Jahrhunderts ofen lag und benutzt wurde. Der Richtung des Weges nach zu urteilen, verlief er von Westen her kommend in der Senke des ehema-ligen Burggrabens zwischen Marstall und Reitbahn entlang, hinauf zur Großen Burgstraße beim Burg-tor. Alternativ könnte er aber auch zu dem später zu-gesetzten, traveseitigen Portal der Reitbahn geführt haben. Hinter diesem Portal lag die Teilunterkelle-rung des Gebäudes, die in das Gefälle des Burggra-bens eingebaut war.
Etwas weiter südlich, im Bereich unmittelbar vor der Blumenhofmauer, konnten weitere neuzeitliche Nutzungsphasen nachgewiesen werden: Erhalten hatte sich dort ein Backstein-Eckfundament mit rechtwinklig anschließender Mauer und einer Pfos-tenreihe. Der gesamte Befund ist als Teil einer Bin-nengliederung eines Hofareals zu sehen. Anhand der Schichtenfolge kann der Komplex grob in die Zeit vom 16. bis zum 17. Jahrhundert datiert werden.
Spätestens im frühen 19. Jahrhundert ist der Back-steinweg vor der Reitbahn wohl schließlich aufgege-ben und mit mehreren Planierschichten überdeckt worden. Der Grund dafür war wahrscheinlich eine Änderung der Nutzung des Grundstücks im 19. Jahr-hundert: Es wurde mit einer Mauer eingefasst und ein am Hang liegender Garten und Hof angelegt, der zu einem Gebäude auf dem Grundstück An der Un-tertrave 1 gehörte. Um den Hanggarten vom tiefer liegenden Hof zu trennen, wurde eine etwa 3 m hohe Mauer aus Findlingen errichtet. Diese stützte den erneut aufgeschütteten und gärtnerisch genutzten Hang, während davor ein Hof angelegt werden konn-te. An die Basis der Mauer zog eine Plasterung aus etwa faustgroßen Feldsteinen. Im Nordosten trennte
eine Entwässerungsrinne diese Plasterung von einem in Richtung Nordosten verlaufenden, ebenfalls ge-plasterten Weg. Eine in die Findlingsmauer eingelas-sene Torangel in der Verlängerung der Rinne belegte darüber hinaus die zusätzliche Trennung von Zuwe-gung und eigentlichem Hofareal. Im 19. Jahrhundert wurde die Plasterung unterhalb der Findlingsmauer erneuert; eine Torsituation und damit eine Abgren-zung des Areals waren hingegen nicht mehr nach-weisbar. Eine unmittelbar über dem Plaster liegende mächtige Schicht aus Backsteinschutt, die im Zu-sammenhang mit der Niederlegung von Teilen der Klosterbebauung entstanden ist, datiert das Ende der Hofnutzung in das Jahr 1894.
Auch danach, im späten 19. und im 20. Jahrhun-dert, wurde das Gelände mehrfach umgestaltet. Der 1894 anfallende Abbruchschutt von Teilen des Burg-klosters und der Reitbahn war in großen Mengen im Hangbereich aufplaniert worden. Der Abriss schuf damals den benötigten Platz zur Errichtung eines neuen Gerichts- und Gefängnisgebäudes, nachdem das Marstallgefängnis den Erfordernissen der moder-nen Rechtsplege nicht mehr gerecht wurde. In denk-malplegerischer Absicht wurden die Erdgeschosse des Klosters mit dem Kreuzgang, das Hospitalgebäu-de und das Beichthaus erhalten und in den Neubau integriert. Im Bereich der Ausgrabungen zeigte sich das Abbruchmaterial als eine bis zu 7,5 m mächtige Schicht aus Backsteinen und Mörtel. Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch die bis dahin sichtbare Senke des alten Burggrabens bis auf das Niveau des Hügel-plateaus aufgefüllt. Damit wurde der jahrhunderte-alte Zugang von der Untertrave hinauf zur Großen Burgstraße beseitigt und die heutige Geländesituati-on hergestellt. Die einzige noch heute sichtbare Spur der ehemaligen topograischen Verhältnisse ist die leicht erhöhte Lage des Marstallgebäudes und seines kleinen Hofes gegenüber dem südlich davon liegen-den Parkplatz.
Im Jahr 1911 wurde das Seemannsheim als eine Herberge für die Seeleute in Lübeck liegender Schife errichtet. Dazu gehörte auch die Gestaltung des Ge-ländes hinter dem Gebäude als gestufter Hanggarten, der dann bis zum Beginn der Ausgrabungsarbeiten im Jahr 2012 erhalten blieb.
Das nächste große Bauprojekt auf dem Grundstück war ein Hochbunker des zweiten Weltkrieges, für den in den Jahren 1941 und 1942 bereits eine sehr große Baugrube in die Hügellanke auf dem Grundstück An der Untertrave 1 gegraben wurde. Das benachbarte Seemannsheim stimmte dieser Umnutzung eines Teils
67Ein tiefer Einblick in die Geschichte des Lübecker Burghügels
seines Gartens nur unter der Bedingung zu, dass das Dach des Bunkers in Friedenszeiten als Terrasse oder Dachgarten und der Bunker selbst als Notunterkunft durch das Heim genutzt werden durften. Als letz-te große Baumaßnahme wurde dann im Jahre 1964 ein Um- und Erweiterungsbau des Seemannsheims genehmigt, der unter Erhaltung der Innenwände des alten Gebäudes deutlich größer geriet und nun auch den Bunker in den Bau mit einbezog. Im Jahr 2012 wurde das Seemannsheim mitsamt Bunker abgerissen, um dem gegenwärtigen Großprojekt Platz zu schafen.
Mit dem tief in den Boden eingreifenden Bau des Europäischen Hansemuseums wurden viele Spuren der Geschichte des Burghügels beseitigt. Gleich-zeitig war dies die einmalige Gelegenheit, einen beachtlich großen Grabungsschnitt in diesem sied-lungsgeschichtlich für Lübeck so relevanten Bereich zu untersuchen. Die untersuchten Befunde reichten von der slawischen Vorbesiedlung des Platzes über die Zeit der deutschen Burg- und Stadtgründung bis in die jüngste Geschichte. Sie erlauben einen Einblick in einen peripheren Bereich der Stadt, der meistens einer Sonderfunktion innerhalb des Stadtgefüges zu-geordnet war.
Zunächst gehörte er zur Burg des Stadtherrn und deren Vorfeld. Nachdem die reichsunmittelbar und damit frei gewordene Stadt das Symbol der Unter-drückung beseitigt und an dessen Stelle ein Kloster gestiftet hatte, wurden die nunmehr frei geworde-nen Areale zwischen der ehemaligen Burg und den Stadtmauern für andere Zwecke genutzt. Die verfüll-ten Gräben boten sich an, feuergefährliche und auch an abgasintensiven Gewerbe weiter an den Rand der wachsenden Stadt zu verlagern. Außerdem war hier genügend Platz für große kommunale Gebäude wie das Arsenal, die Reitschule und den Marstall, die der Verteidigung, Verwaltung, Rechtsplege und Lager-haltung der Stadtgemeinde dienten.
Das neue Museum bildet nun den jüngsten Groß-bau am historischen Ort und hat sich mit seinem Raumbedarf und seiner Ambition bereits überdeut-lich in das Bodendenkmal eingeschrieben. Es bleibt zu wünschen, dass es dem damit formulierten An-spruch gerecht werden und der Geschichte des Or-tes einen angemessenen Platz einräumen wird. Die geplante Integration eines Teils der Ausgrabungen in das Museum ist dabei sicherlich ein kleiner Schritt, kann allerdings nur der Anfang sein.
68 André Dubisch u. a.
Baltzer u. a. 1928: J. Baltzer, F. Bruns und H. Rahtgens, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Hansestadt Lübeck. Band IV: Die Klöster. Die kleineren Gotteshäuser der Stadt. Die Kirchen und Kapellen in den Außengebieten. Denk- und Wegekreuze und der Leidensweg Christi, Lübeck 1928, 167–280.
Biermann 2013: F. Biermann, Möglichkeiten und Probleme naturwis-senschaftlicher Datierungen frühslawischer Siedlungsbefunde, in: M. Dulinicz und S. Moździoch (ed.), he Early Slavic Settlement in Central Europe in the light of new dating evidence (� Interdisci- (� Interdisci-Interdisci-plinary Medieval Studies III), Breslau 2013, 11–21.
Bruns u. a. 1974: F. Bruns, H. Rahtgens und L. Wilde, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Hansestadt Lübeck. Band I. 2. Teil: Rathaus und öfentliche Gebäude der Stadt, Lübeck 1974.
Dulinicz/Moździoch 2013: M. Dulinicz und S. Moździoch (ed.), he Early Slavic Settlement in Central Europe in the light of new dating evidence (� Interdisciplinary Medieval Studies III), Breslau 2013.
Ellmers 1992: D. Ellmers, Bodenfunde und andere Zeugnisse zur frühen Schiffahrt der Hansestadt Lübeck. Teil 2: Bauteile und Ausrüstungsgegenstände von Wasserfahrzeugen aus den Grabun-gen Alfstraße 38 und An der Untertrave/Kaimauer, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 18, 1992, 7–22.
Fehring 1982: G. P. Fehring, Grabungsbefunde zum slawischen Burg-wall Bucu und der landesherrlichen Burg mit zugehörigem Brun-nen im Burgkloster zu Lübeck – ein Zwischenbericht, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 6, 1982, 77–98.
Gabriel 1984: I. Gabriel, Starigard, Oldenburg, Bd. 1, Stratigraie und Chronologie, Neumünster 1984.
Gabriel 1991: I. Gabriel, Starigard/Oldenburg und seine historische Topograie, in: M. Müller-Wille (Hrsg.), Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, Neumünster 1991, 73–83.
Gläser 1988 a: M. Gläser, Die Lübecker Backsteinchronologie, in: Lü-becker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte Bd. 17 (� 25 Jahre Archäologie in Lübeck), 1988, 210–212.
Gläser 1988 b: M. Gläser, Die Lübecker Keramikchronologie, in: Lü-becker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte Bd. 17 (� 25 Jahre Archäologie in Lübeck), 1988, 215–219.
Gläser 1989: M. Gläser, Archäologische und baugeschichtliche Un-tersuchungen im St. Johanniskloster zu Lübeck. Auswertung der Befunde und Funde, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 16, 1989, 9–120.
Gläser 1992: M. Gläser, Untersuchungen auf dem Gelände des ehema-ligen Burgklosters zu Lübeck. Ein Beitrag zur Burgenarchäologie, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 22, 1992, 65–121.
Gossler 1998: N. Goßler, Untersuchungen zur Formenkunde und Chronologie mittelalterlicher Stachelsporen in Deutschland (10.-14. Jahrhundert), Ber. RGK 79 (1998), 479– 664.
Grabowski/Schmitt 1993: M. Grabowski und G. Schmitt, „Und das Wasser ließt in Röhren“ Wasserversorgung und Wasserküns-te in Lübeck, in: M. Gläser (Hrsg.), Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum. Festschrift für G. P. Fehring (� Schriften des Kulturhistorischen Museums in Rostock Bd. 1), Ros-tock 1993, 217–223.
Hammel-Kiesow 2008: R. Hammel-Kiesow, Die Anfänge Lübecks: Von der abotritischen Landnahme bis zur Eingliederung in die
Grafschaft Holstein-Stormarn, in: A. Graßmann (Hrsg.), Lübecki-sche Geschichte, Lübeck 2008, 1– 45.
Helmold: B. Schmeidler (Hrsg.), Helmolds Slavenchronik, MGH SS rer. Germ. 32, Hannover 1934.
Kempke 1988: T. Kempke, Zur überregionalen Verbreitung der Pfeil-spitzentypen des 8. –12. Jahrhunderts aus Starigard/Oldenburg, Ber. RGK 69 (1988), 292–306.
Korth 1832: J.-W. D. Korth, s. v. Sod, in: Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz, Bd. 155, Berlin 1832.
Meyer 1993: D. Meyer, Glasurkeramik des Mittelalters von einer Töpfereiproduktion aus der Kleinen Burgstraße zu Lübeck – Ein Vorbericht, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturge-schichte 23, 1993, 277–282.
Müller-Wille 2011: M. Müller-Wille, Fernhandel und Handelsplätze, in: M. Müller-Wille (Hrsg.), Zwischen Starigard/Oldenburg und Novgorod: Beiträge zur Archäologie west- und ostslawischer Gebie-te im frühen Mittelalter (� Studien zur Archäologie und Siedlungs-geschichte der Ostseegebiete 10), Neumünster 2011, 257–266.
Radis 2011: U. Radis, Das Beichthaus im ehemaligen Dominikaner-kloster zu Lübeck gibt seine Geheimnisse preis, in: A. Falk und D. Mührenberg (Hrsg.), Beichthaus, Turnhalle, Atelier und Museum. Ein Bauwerk und seine Geschichte (� Jahresschrift der Archäologi-schen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck 6), Lübeck 2011, 21–41.
Toločko 1991: P. P. Toločko, Der Burgwall von Starigard/Oldenburg und das slawische Befestigungswesen, in: M. Müller-Wille (Hrsg.), Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mit-telalters in Ostholstein, Neumünster 1991, 103–122.
Literatur
André DubischBardowicker Wasserweg 44
21339 LüneburgDeutschland
Eric MüllerHoltenauer Straße 116
24105 KielDeutschland
Hendrik RohlandAn der Untertrave 58
23552 LübeckDeutschland
Cathrin HähnUniversität Bremen
Institut für Geschichtswissenschaft Bibliothekstraße 1
28334 BremenDeutschland
Katrin SiegfriedMühlenweg 11
59555 LippstadtDeutschland




































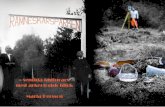



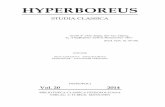

![Wie funktioniert Sicherheit ohne (viel) Staat? Befunde aus Nordostafghanistan und Pakistan [DRAFT attached - for published version see book!]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632e1c3c2be52b9c7202f98c/wie-funktioniert-sicherheit-ohne-viel-staat-befunde-aus-nordostafghanistan-und.jpg)









