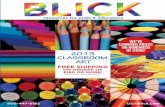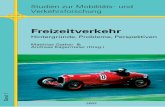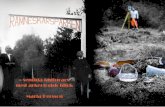Blick-Positionen, Perspektiven auf Las Meninas
-
Upload
fh-campuswien -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Blick-Positionen, Perspektiven auf Las Meninas
Blick-Positionen
Perspektiven auf Las Meninas | die Hoffräulein
überarbeitete Bachelorarbeit vorgelegt von Chris-Oliver Schulz
Seminar:„Dies ist kein Seminar, Foucault und Magritte“, Universität Wien, April 2013
1
Inhaltsverzeichnis
Eingang 3
1. Mit Foucault: Las Meninas | die Hoffräulein 5
1.1 Fluchtpunkt 8
1.2 Vor den Spiegel – das Spiegelstadium 11
2. Schleifen … 12
2.1 Faden und Fleck 16
3. Exkurs: Ähnlichkeit 19
3.1 Naturästhetik – Mimese 20
Ausgang 23
2
Eingang
In der vorliegenden Arbeit wird es sich um das Bild Las Meninas | die Hoffräulein von
Diego Velázquez aus dem Jahr 1656 drehen1. Es soll den verschiedenen
Interpretationsmöglichkeiten zu diesem Bild nachgegangen werden, um zu sehen, welche
Perspektive die schlüssigste sein könnte. Was passiert in einem Betrachtenden bei einem
Blick auf ein Bild, in dem nicht mehr sicher ist, was sich eigentlich zeigen soll und wo man
sozusagen selber steht.
Das Bild ist in Madrid im Museum del Prado zu besichtigen. Im Bild finden sich die
Infantin Margarete, nebst Hofdamen, Hoffräulein, Höflingen und Zwergen auch König
Phillip IV., seine Gattin Marianna und interessanter- oder irritierenderweise der Maler
Diego de Silva y Velázquez selbst. Unscheinbar, aber vielleicht an relevanter Stelle findet
sich noch ein Namensvetter, der Hofmarschall, José Nieto de Velázquez.
Im Folgenden soll nun zunächst mit Focuaults Um-und Beschreibungen das Bild betrachtet
werden und anschließend folgen verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und werden
gegenübergestellt. Vor allem Wolfram Bergande und Jacques Lacan werden eine Rolle
spielen. Es können leider nicht sämtliche Interpretationsmöglichkeiten berücksichtigt
werden, da es sich um eine Unmenge von 'zerbrochenen Köpfen' handelt, die versuchten,
das Bild zu deuten und zu erklären. Allein der Begriff der Perspektive könnte eine ganze
Arbeit füllen und nicht nur das, es gibt auch noch verschiedene Lesarten zu den
verschiedenen Interpretationsversuchen zu Las Meninas. Beispielsweise bestehe Leo
Steinberg auf dem Gefühl wechselseitiger Implikation, also dass die Betrachtenden zur
Familie gehören, zum Ereignis und Searle wiederum meinte, dass das was fehlt, nicht
fehlen kann, da es/etwas vorausgesetzt sei, sobald man überhaupt von Repräsentation
spreche, aber das geschlossene System, das Searle konzipiert, belasse den Spiegel dennoch
als Überschuss, außer man denke wiederum an Foucaults Interpretation2. Was zeigt Las
Meninas: Blicke, Gesten, einen Hund, andere Bilder, Gemälde im Gemälde usw - eine
Szene, die sich in ihrer Szenen-Existenz wiederum nur durch einen erzwungenen
1 im Folgenden kurz Las Meninas 2 Hubert Damisch, 2010: Der Ursprung der Perspektive, diaphanes Verlag, S. 425
3
Rückverweis auf eine andere Szene vis à vis erhalten könne3. Ein ständiges Spiel von
Verweisen, ein Kreislauf der entweder ins Leere führt oder in eine Sackgasse? Was sagt das
Bild, was will das Bild, was löst es aus. Was will der jeweilige Betrachtende und was war
eigentlich Velázqez Intention? Auch diese Arbeit wird die Wirkung, den Sinn oder die
Intention von Las Meninas nicht aufklären oder (be)greifbar machen können. Ist das nötig?
Ähnlich wie die anderen Auseinandersetzungen wird auch hier versucht werden, diesem
gewissen Etwas im Bild, am Bild oder vor dem Bild näher zu kommen. Vielleicht wird ein
Zugang geschaffen, wenn man Merleau-Ponty folgt und eben nicht „das zu Findende
urteilend vorwegnimmt“4. Werkzeuge der Reflexion und Intuition ablehnen, sich einrichten,
wo diese noch nicht unterschieden seien […] uns ein ganzes Gemisch auf einmal angeboten
würde, Subjekt – Objekt5. Ein Näherkommen, das den Ursprung, den man erfassen will im
Dunkeln belasse, da es alles Übrige erhelle, formuliert Merleau-Ponty an selber Stelle,
wenn er die Verflechtung von Sprache, Benennen und Sehen umschreibt. Somit wird kein
Anspruch erhoben, das Geheimnis um Las Meninas oder das Mystische, das es umgibt,
aufdecken zu können, oder wollen.
3 vgl. ebd. S. 4224 Maurice Merleau-Ponty, 2004: Das Sichtbare und das Unsichtbare, 3. Aufl., Wilhelm Fink Verlag, S. 1725 ebda
4
1. Mit Foucault: Las Meninas | die Hoffräulein
Abb.1:Diego Velázquez; Las Meninas,
1656
Beginnt der Maler mit dem Bild, oder ist er fertig, mittendrin? Er schaut zu (s)einem
Modell, zu uns? Zum Betrachtenden und somit vielleicht eben auf das was er malt, malen
wird? Fühlen wir uns als Betrachtende angeschaut, erblickt? Vom Maler, weil er eine
gewisse Handlungsmacht innehat, der Blick des Malers, der uns erfasse und uns einen
privilegierten und auch obligatorischen Platz zuweise6? Er würde uns anschauen, sein Blick
trifft uns, weißt uns einen Platz zu, malt er uns? Eine Unmöglichkeit, aber sobald wir das
Bild betrachten, könnte dieses Gefühl entstehen, vor allem, da wir nicht wissen, was auf der
Leinwand ist. Der sichtbare Maler „herrscht an der Grenze dieser beider unvereinbaren
Sichtbarkeiten“7. Eine Leinwand, ein Geschehen in einem Raum und das was gemalt wird,
fehlt. Das, was angedeutet ist, das es sich zeigen solle, fehlt. Der Maler fixiere es, den
unsichtbaren Punkt, der wir selber sind8.
6 Foucault,Michel, 1980: Die Ordnung der Dinge, S. 327 ebda8 ebda
5
Vielleicht prallen hier zwei Blickbahnen aufeinander. Mein Blick in den Bildraum und der
Blick des Malers beispielsweise. Wenn man sich das Bild als Raum vorstellt, erblicke ich
aus meiner Position heraus diesen Maler, diverse Figuren und so weiter, aber in diesem
Raum, bei diesem Bild, wird meine Position in Frage gestellt. Erginge es vielleicht ebenso
dem Maler? Dieser - würde er für einen Moment in seinem Geschehen real - was würde er
sehen, ebenfalls nichts? Eine Rückseite?
Zurück ins Bild: Bei Foucault erhält der Spiegel den Status eines funktionierenden
Elements, das zeige, was es zeigen solle, die einzig sichtbare Repräsentation9. Das, was der
Spiegel reflektiert, bleibt in der Luft hängen, sozusagen. Zwei Personen sind zu sehen, die
weder dem jeweiligen Betrachtenden entsprechen werden, noch sind diese beiden
Spiegelfiguren im Bild irgendwo zu sehen und ebenso wenig findet sich im Spiegel sonst
etwas aus dem ihm vorliegenden Raum und das obwohl seine Position in etwa zentral ist10.
Geht man nun davon aus, dass der Spiegel das reflektiert, was der Maler malt und sieht,
stellt er somit „die Sichtbarkeit dessen wieder her, was außerhalb der Zugänglichkeit jedes
Blickes bleibt“11. Bei Foucault findet sich diese Lesart, eine Interpretationsmöglichkeit, des
Bildes, für ihn stellt der Spiegel die „Kehrseite oder eher die Vorderseite“12 der Leinwand.
Dies wäre eine Interpretationsmöglichkeit von Las Meninas. Die Spiegelfiguren sollen das
Königspaar darstellen. Diese Interpretationsmöglichkeit wiederum zieht uns Betrachtende
gewissermaßen aus der Blickbahn des Malers, da er, wenn man so will, das Königspaar
betrachten muss oder sieht. Betrachtende werden somit quasi übermalt, mit dem was im
Spiegel sich zeigt. Der Kreis ist scheinbar geschlossen, der Maler sieht eigentlich das
Königspaar und dieses malt er auch. Dennoch bleibt eine Unsicherheit offen oder tut sich
auf, denn der Spiegel hängt nicht tatsächlich zentral, außerdem befindet sich das
Königspaar nicht im Raum der Repräsentation13 und so bleibt ein Punkt vor dem Bild
gewissermaßen leer. „Vor Ende des 18. Jahrhunderts existierte der Mensch als Subjekt der
Repräsentation nicht“14 zitiert Bergande Foucault und befindet diese Interpretation als
unzureichend. Also Foucaults Annahme, das Bild könne vielleicht die Repräsentation der
9 Foucault, S. 3510 ebd. S. 3611 ebda12 ebd. S. 3813 es ist gewissermaßen außerhalb, durch das vage Erscheinen als Spiegelfläche, was wiederum einen
Verwies darstellt, auf die deren eigentliche Repräsentation, 'vor' dem Bild14 Wolfram Bergande, 2009: Das Bild als Selbstbewusstsein – Bildlichkeit und Subjektivität nach Hegel und
Lacan am Beispiel von Diego de Velázquez´ Las Meninas, S. 167
6
klassischen Repräsentation sein und der Leere darin, also ein Subjekt und/oder dessen
Repräsentation welche fehle15.
Schließt sich der Kreis der Repräsentation, wenn das Bild so betrachtet würde, dass das
Königspaar weder Reflexion noch ein gemaltes Bild sei? Es sei zwar das Königspaar im
Spiegel, meint der Kunsthistoriker Stoichita, aber es würde vielmehr als Ausschnitt aus dem
Gemälde, welches Velázquez gerade malt, eingeführt. Es sei also eine Reflexion gemalter -
nicht realer - Personen16.
Foucault meint, dass in einer klassischen Repräsentation das Subjekt „notwendigerweise
aus dem Feld der Repräsentation“17 ausgeschlossen sei. Diese Ausschließung, dieses
Fehlen, stelle aber wiederum keine Lücke dar, denn diese höre zu keinem Zeitpunkt auf,
besetzt zu sein, denn durch die Reflexion im Spiegelbild würde die Abwesenheit indirekt
behoben18. Zeigt Las Meninas nun seine eigene Entstehung oder zeigt es eine in erster
Linie Portraitsitzung19?
Die Interpretationsmöglichkeiten und auch die Unsicherheiten im Bild sind nicht durch
sprachliche Gewissheiten zu kompensieren, die Foucault den Lesenden bietet, in dem er die
versammelten Personen alle benennt, „vergeblich spricht man das aus was man sieht: das
was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt;...“20. Das Sichtbare benennen und dadurch
(scheinbar) greifbar zu machen, engt gleichzeitig den Raum in dem diese beiden Modi statt
haben ein, denn wenn man die „Beziehung der Sprache und des Sichtbaren offenhalten will,
wenn man nicht gegen, sondern ausgehend von ihrer Unvereinbarkeit sprechen will, […]
dann muss man die Eigennamen auslöschen und sich in der Unendlichkeit des Vorhabens
halten“21. Sprache bringt uns in diesem Bild nicht weiter, „das Bild verweigert sich einer
festen Deutung“22. Was in dem Raum, „in dem man spricht, vom Standpunkt der Sprache
aus, wahr ist, ist es nicht vom Standpunkt aus der Malerei in dem Raum, in dem man
blickt“23. Der Spiegel stellt definitiv ein, oder eines der zentralen Elemente des Bildes dar,
vor allem auch bei Foucault, aber als ein imaginäres Zentrum, wie Damisch betont, um der
15 Foucault S. 4516 vgl. Bergande, S. 16617 Foucault, S. 4518 vgl. Bergande S. 16719 die des Königspaares?20 Foucault S. 3821 ebda22 Bergande S. 16823 Hubert Damisch, 2010: Der Ursprung der Perspektive, S. 87
7
Kritik, die Foucaults Interpretation erfuhr, etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen24.
Der Spiegel tlegeips etwas, das außerhalb des (Bild)Raumes ist, er zeigt, was fehlt.
1.1 Fluchtpunkt
Was bisher kaum Beachtung fand und dennoch eigentlich direkt ins Auge fallen müsste, ist
die Person in der Tür im hinteren Bereich des Bildes, „die Tür im Hintergrund, die als
Eingang, aber auch als Ausgang aus dem Bild gedeutet werden kann“25. Es soll José Nieto
Velázquez darstellen. Bei Foucault stellt er eine Figur an der Schwelle des Bildraumes dar,
die die Szene beobachte, aber selbst nicht beobachtet würde und ähnlich wie bei Bergande,
tritt diese Figur hinein als auch hinaus, eine unbewegliche Balancestellung26. Im Gegensatz
zum Spiegel wird diesem Bereich des Bildes auf jeden Fall keine besondere Funktion oder
Wirkung zugesprochen, gewissermaßen wird diese Stelle oftmals übersehen. Bergande
vermutet aber genau hier den Fluchtpunkt des Bildes27. Damit hebt er hervor, man könne
das Bild als Urszene des Lacan´schen Spiegelstadiums betrachten und auch als Illustration
einer analytischen Kur, denn die Antinomie, in die wir Betrachtende geschickt würden,
fände ihren Ausgang im Fluchtpunkt und somit eine Überwindung aus der perspektivischen
Befangenheit28. Nachfolgend dem Blick auf das Königspaar, welches Bergande mit dem
Moment des Präsent-werdens des Körper-Ichs vergleicht, also etwas Imaginärem. Von zwei
Perspektiven durchzogen erzeuge es eine illusorische Selbstgewissheit, welche wiederum
vom Blick des Malers hintertrieben (in der Position des kleinen anderen) würde, wie es
Bergande formuliert, dieser wird zum Herr über die Frage nach dem 'Ich', „sein Blick saugt
mein Ich auf, er malt sein eigenes Bild von mir auf der Leinwandvorderseite“29. Bei ihm
wäre dies der sinnvolle Deutungsversuch des Bildes. Die anderen beiden hier
angesprochenen Versuche seien Scheinlösungen. Also einerseits die Idee, Velázquez hätte
sich in die Position des Königspaares gedacht und Las Meninas wäre die Darstellung der
eigenen Entstehung und andererseits die Idee von Foucault, bei der das Selbstbild über den
24 vgl. Damisch S. 8025 Bergande S. 16826 vgl. Foucault, S. 3927 vgl. Bergande S. 16828 vgl. ebd., S. 169f29 ebd. S. 170
8
anderen vermittelt zu mir retour käme, dies eine Wissenskonfiguration darstelle30. Erstere
Idee bedeute für ein betrachtendes Subjekt, dass es quasi am imaginären Ich festhalten
würde, eine Abwehr, dass irgendeine Form der Subversion von Außen Einfluss haben
könne und der Reflex der Figuren im Spiegelbild wird somit als ein potentiell eigener
erklärt und nicht von der Leinwandvorderseite kommend31. Letztere Idee impliziert eine
Akzeptanz der Entfremdung im Blick des Anderen, also die Position des Malers, der das
betrachtende, sich etablierende imaginäre 'Ich', in Frage stelle32. Also einerseits ein
Festhalten am imaginären Ich und andererseits ein Abgeben des imaginären Ichs in die
'Hände des Malers'. In beiden Fällen eine „nicht erschöpfend reflektierte Identifizierung des
Betrachters mit dem Ich-Reflex im Spiegel“ und weiter meint Bergande, er könne
AnhängerInnen dieser Interpretationen das Bedürfnis unterstellen, „durch diese
narzisstische Identifizierung die mit Hegel formulierte »Schlechte Unendlichkeit«
zuzudecken“33. Also eine Verweigerung des unendlichen Regresses, der auf der virtuellen
Leinwandvorderseite entstehe, wenn Las Meninas als Bild seiner eigenen Entstehung
gedeutet würde, denn es würde zum Bild-im-Bild, was auch die Deutung Foucaults träfe, da
der Maler in Position des Betrachters stehen müsse um das Bild zu malen, so also den
Regress auslöse und gleichzeitig aufhebe, wenn parallel darauf insistiert würde, dass auf
der Leinwandvorderseite das Königspaar sein müsse34.
Schlussendlich kehrt Bergande wieder zum Fluchtpunkt zurück und meint, Velázquez
müsse, wenn er die Position des Königspaares eingenommen hätte, ebenso die des
Fluchtpunktes eingenommen haben. Denn dieser spanne den Bildraum erst auf und der
Maler könne mit dem Bild Betrachtende dazu auffordern, sich einerseits in die Position
Maler-im-Bild hineinzuversetzen und aber auch somit in die Fluchtpunktposition35. Diese
zwei Schritte des Hineinversetzens in andere Perspektiven bedeute eine Aufhebung der
Rollen im Bild, also der des Malers und der des Königspaares und somit resultiere ein
gegenseitiges Ineinander-hinein-Versetzen36. Also beispielsweise versetzt sich der Maler in
30 vgl. ebd., S. 17031 vgl. ebda.32 vgl. ebd., S. 17133 ebd.. S. 171f34 vgl. ebd., S. 17235 vgl. ebd., S. 17336 vgl. ebda.
9
die Postion des Königspaares und wir als Betrachtende tun dies wiederum auch, also eine
Schleife (von Mehreren) in diesem Bild entsteht. Mit der Position des Fluchtpunktes aber
findet sich eine Position, die nur mehr einem perspektivischen Punkt entspräche und
keinem Körper-Ich (figürliches Selbstbild) mehr, „mein Körper-Ich ist nur noch ein
repräsentativer Teil unter vielen“37. Halten die anderen Deutungsversuche, die bei Bergande
als Scheinlösungen interpretierten, tatsächlich an einer Art vermeintlichem Ich fest oder
übergeben es ganz dem Anderen? Hält Bergande an einer alles überblickenden Position fest
und wenn ja, an was hält er dann fest? Gibt es die richtige Deutung des Bildes und was sagt
es, dass Bergande sich als Inhaber dieser Deutung versteht? Kann man hier weitere
Schleifen eröffnen, in dem ich das Bild betrachte und mich nach 'meiner' Position befrage
und im Folgenden einige Texte diverser Autoren lese, die diese Frage beantworten zu
suchen und somit schlussendlich auch Bergande, der sozusagen die Position des Malers
einnimmt, in dem er die oder seine Antwort niederschreibt, zeichnet und mir darbietet?
Interessant ist die Argumentation der Perspektiven, die auf jeden Fall eingenommen werden
(können), sei es die des Malers oder des Namensvetters. Das Ändern der eigenen
Perspektive hat zur Folge, dass zwischen sich und dem anderen unterschieden werden kann
und markiert auch einen Prozess in der Entwicklung von Kindern38. Merleau-Ponty bezieht
sich hier auf Guillaume, der im Weiteren von einem Vor-Ich spricht, welches sich noch
nicht auf einen anderen bezieht, eine Art latentes Ich, welches „in der Unkenntnis seiner
selbst verharrt“39 und dieser Begriff sei für Untersuchungen unzugänglich aufgrund der
Ununterschiedenheit in dieser Phase der Entwicklung40. Vielleicht verhält es sich mit Las
Meninas ähnlich. Die neue Perspektive die sich mit dem eigenen Spiegelbild auftut, erzeugt
auch eine Entfremdung und ein Gefangen-Sein im räumlichen Bild41, dieses Spiegel-Ich
bereite das Ich auf die Entfremdung durch den Anderen vor42. Ein Zustand der
Entfremdung, Befremdung, Befangenheit und vielleicht Verwirrung, der anhält, bis es (das
Subjekt) sich „objektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem anderen und bevor
ihm die Sprache im Allgemeinen die Funktion eines Subjekts wiedergibt“43. Lässt Las
37 ebd., S. 17438 vgl. Maurice Merleau-Ponty, 2004: Keime der Vernunft, Vorlesungen an der Sorbonne 1949-1952, S. 53 39 ebda.40 vgl. ebda.41 vielleicht ähnlich sei die Befangenheit in der Betrachtung von Las Meninas42 vgl. ebd., S. 32343 ebda.
10
Meninas die Phase der Entstehung eines sichtbaren Ichs Betrachtende nachvollziehen? Die
Sprache, die den deutenden Betrachtern in diesem Bild keine Position, keinen Ausweg
ermöglicht, da es sich, wie bereits angemerkt, der Deutung entzieht. Ein Blick auf das Bild,
der etwas auf uns zurückwirft, das uns in den Bann zieht? Im folgenden Kapitel nun eine
Art Einblick in das Spiegelstadium, um dies und auch Bergandes Vergleich damit zu
verdeutlichen.
1.2 Vor den Spiegel – das Spiegelstadium mit Las Meninas
Es handelt sich um einen Prozess, ein Stadium, das angesiedelt wird im Zeitraum von etwa
sechs bis 18 Monaten. „Man kann das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen, im
vollen Sinne, den die Psychoanalyse diesem Terminus gibt: als eine beim Subjekt durch die
Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung“44). Es gibt hier viele Momente und
Faktoren, die dieses Bild von sich, das Körper-Ich, konstituieren und beeinflussen.
Beispielsweise der Andere, die erste Bezugsperson. Es ist ein vages Bild von sich, vor
allem auch, weil ein Kleinkind in dieser Zeit noch nicht von sich spricht. Lacan wiederum
spricht hier vom Ich im Sinne von Je, welches sich in einer ursprünglichen Form
niederschlägt (unter anderem vor der Objektivierung) und setzt es quasi gleich dem Ideal-
Ich, ein Begriff von Freud, und hebt hervor, dass dieses auch vor jeder gesellschaftlichen
Determinierung die „Instanz des Ich (moi) auf einer fiktiven Linie situiert“45. Die erste
Bezugsperson, um deren Anteil zu unterstreichen, bildet für das Kleinkind ein Feld,
welches unter anderem mit dem Bedürfnis und dem Anspruch gefüllt ist, es befindet sich
im Bedürfnis und folgend im Anspruch des anderen46. Um Bergandes Idee von Las Meninas
hier einzubetten, könnte man nun der Figur des Malers zunächst die Position des Anderen
zuschreiben, den wir ansehen und fragen, wen malst du? oder (wie) malst du mich? Wie
wirkt die Position des Malers, was 'macht' er mit uns? „Als ein erster Blick von außen trägt
er eine Spaltung an das Subjekt heran“47. Er, der erste Anderem dessen Blick im weitesten
Sinne, bilden eine Stütze für die Wahrnehmung des Kleinkindes einerseits und andererseits
44 Jacaues Lacan, 1991: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint, S. 64
45 ebda.46 Jacques Lacan, 2011: Das Seminarbuch XI, Die Angst, S. 36647 Ulrike Kadi, 2009:„...nicht so einen geordneten Blick“, S. 258
11
erscheint er aber unter Umständen als bedrohlicher, fremder Körper48. Eine Dynamik also,
zu der die 'eigene' Erscheinung hinzukommt, die sich als eine Ganzheit im Spiegel zeige,
also eine Präsenz einer Vollständigkeit, die einen noch nicht erreichten (wünschenswerten)
Zustand anzeige49. Im Falle von Las Meninas geht der Verweis scheinbar ins Leere, oder es
beginnt der Regress des endlosen Verweises. Mit Bergande lande man beim anderen
Velázquez, der hier nun aber den Ausgang darstellen könnte, die Möglichkeit aus der
Hilflosigkeit, der ungewissen Position (dem Regress oder der Leere) zu entfliehen, um Sub-
jekt zu werden.
Noch einmal zurück zum Blick des Anderen, der sich über das Gewahr-werden der eigenen
Gestalt schiebt und/oder dieses mit konstituiert, er birgt “... das […] auftauchende Fremde,
das kollektive Bild, welches sich wie eine Folie über das individuelle Bild legt“50. Also der
Blick des Anderen, dessen Perspektive, dessen Bild von uns uns zeichnet oder färbt,
unseren Blick auf uns prägt und somit unsere Perspektive. Perspicere, hindurchsehen,
hindurchblicken. Velázquez, der die Betrachtenden sieht und die Betrachtenden, die sich
fragen, was er sehe und denke und somit seine Perspektive zur prägenden wird, eben ohne
zu wissen, was er sieht.
Das Spiegelstadium und das Gemälde als Verflechtung des Sehens und Gesehen-werdens,
als Ort falscher Verfestigung, aber auch als notwendiges Interpretationsinstrument, eine Art
Horizont für das Verstehen und auch der Schirm als Phantasma51. Die Verfestigung, die sich
lösen kann im Fluchtpunkt, der ebenfalls keine Antwort bereithält, aber dennoch den
Vorhang zur Seite hebt.
48 vgl. ebda.49 vgl. ebd., S. 254f50 ebd., S. 25551 ebd., S. 256f
12
2. Schleifen
Ein weiterer Deutungsversuch findet sich bei Lacan selbst. Bergande merkt an, dass auch
dieser die Figur am Bildein-oder Ausgang nicht wirklich in (s)eine Interpretation einbinden
könne, sondern das Bild als Bild im Bild, als eine Art 'auto-portrait' deute, also das Bild als
seine eigene Entstehungsgeschichte52. Im Seminar XIII53 bezieht sich Lacan auf das Bild
und bringt die Möbiusschleife ins Spiel, bei welcher Innen und Außen ineinander
übergehen und nicht klar voneinander getrennt 'begehbar' sind.
Genaugenommen sieht Lacan in diesem Bild eher eine Art Abbild des Subjektseins (also
eigentlich eine ähnliche Perspektive zu der Bergandes´, da dieser die Grundlage des
Spiegelstadiums abgebildet sieht). So wie im Möbiusband nur eine Richtung eingeschlagen
werden kann und nicht beide Richtungen und Seiten gleichzeitig begehbar oder überhaupt
denkbar sind, so kann ich auch nicht im Bild beide Interpretationsmöglichkeiten und
Blickrichtungen auf einmal 'sehen'54. Lacan schlägt einen ähnlichen Bogen, eine Schleife, in
dem er über die Deutungsversuche des Bildes spricht, „people give themselves a headache
trying to work out the trick of construction and of the construction of perspective“55. Er
versucht etwas zu Grunde liegendes zu erfassen und die Frage, die er somit stellt ist: was
malt der Maler eigentlich, was war sein Begehr? Diese Frage 'schleifenhaft' gedacht
resultiert darin, sich zu fragen, was wir wiederum wollen würden, was wollen wir wissen,
wir wollen wissen, was Velázquez wollte und so lande man beim Begehren des anderen und
somit eigentlich auch wieder bei 'sich selbst'56. Oder anders, beim Visuellen bleibend: Das
Königspaar und der Maler können nicht gleichzeitig sichtbar sein57. Wenn man ans
Spiegelstadium denkt, wäre das so, als würde ich als reales Subjekt und mein Bild im
Spiegel ineinander fallen. Die Leerstelle, die fehlende Antwort verhindert genau dies,
gewissermaßen. Eine Schleife, notwendigerweise.
52 vgl. Bergande S. 16953 Das genannte Seminar wurde bis Dato nicht ins Deutsche übersetzt. Es findet sich eine inoffizielle
englische Übersetzung auf http://www.lacaninireland.com/web/published-works/seminars/, auf welche sich in dieser Arbeit bezogen wird und im Folgenden mit 'Seminar XIII' zitiert wird. [zuletzt abgerufen Februar 2014]
54 vgl. Seminar XIII, S. 20155 ebda.56 vgl. ebd. S. 20257 vgl. ebd., S. 207
13
Abb 2:
M.C. Escher
„Bildgalerie“
1956
„Was wir sehen ist eine Bildgalerie, in der ein junger Mann steht, der ein Schiff im Hafen einer kleinen
Stadt betrachtet, vielleicht einer Stadt in Malta, nach der Architektur mit ihren Türmchen, ihren
gelegentlichen Kuppeln und flachen Steindächern zu schließen. Auf einem von ihnen sitzt ein Knabe, der
sich in der Hitze entspannt, während zwei Stockwerke unter ihm eine Frau – vielleicht seine Mutter – aus
dem Fenster ihrer Wohnung herausschaut, die unmittelbar über eine Bildgalerie liegt, wo ein junger Mann
steht, der das Bild eines Schiffs im Hafen einer kleinen Stadt, vielleicht auf Malta gelegen, betrachtet“58.
Hofstadter beschreibt Schleifen immer in Stufen/Ebenen. Obiges Bild lässt sich
beispielsweise als zweistufige Schleife schematisch darstellen oder als solche denken. Ein
vollständiges Diagramm würde so 'aussehen': Die Stadt, Galerie, Person und das Bild als
Ebenen. Die Person ist physisch in die Galerie eingeschlossen (Einschluss), die Galerie
ebenso in die Stadt, die Stadt ist im Bild dargestellt (Darstellung), das Bild wiederum in der
Person geistig repräsentiert (Repräsentation) und das Bild ist wiederum in der Galerie
(physisch) eingeschlossen. Ein Kollaps dies Diagramms wäre folgende Darstellung: Nur
mehr die Galerie und das Bild als Ebenen, die entlang von Einschluss und Darstellung
zirkulieren. Bei dieser Art von Bildern, ähnlich wie Las Meninas, ist aber jede Ebene, jede
Markierung willkürlich, man könnte genauso gut die Stadt als Ebene hinzufügen, oder eine
der anderen durch diese ersetzen. Man kann auch „noch kollabiertere schematische
58 Hofstadter, Douglas R., 1979: Gödel Escher Bach – ein endloses Geflochtenes Band, S. 761f
14
Diagramme“59 darstellen, also nur mehr das Bild als Ebene im Zirkel von Einschluss und
Darstellung. Somit wäre das Bild in sich selbst enthalten, „wenn nun das Bild in sich selbst
enthalten ist, ist dann auch der junge Mann in sich selbst enthalten“60?
Abb 3
Enger lässt sich die Schleife nicht ziehen, erweitern lässt sie sich beliebig, beispielsweise
ließe sich noch der Bilderrahmen als Ebene einfügen und enden würde dies in vielstufigen
'seltsamen Schleifen', wie man sie sehen kann in M.C. Eschers Treppauf, Treppab oder
Wasserfall61. Hofstadter stellt sich die Frage, ob man man als Betrachtender in das Bild
Bildgalerie hineingesaugt würde, weil man es betrachtet und diese Frage ließe sich auch für
Las Meninas stellen. Für den Fall der Bildgalerie kommt Hofstadter zu dem Schluss, dass
man nicht hineingesogen würde, solange man außerhalb des Systems bliebe62. In der
Bildgalerie gibt es einen Punkt, der dies ermögliche, nämlich ein Fleck in der Mitte des
Bildes, in dem die Signatur Eschers zu sehen sei. Diese sehen nur wir - außerhalb des
Systems - nicht die Person in dem Bild, in der Bildgalerie63. Vielleicht wäre gerade der
Spiegel in Las Meninas auch so eine Art Fleck, der uns aus dem System herausstellt (wenn
die Perspektive eingenommen würde, dass das Königspaar hier reflektiert sei, welches
momentan gemalt wird, aber so gesehen dennoch etwas offen oder übrig bleibt). Der
Spiegel, der Betrachtende in seinen Bann ziehe, da sie hier vergeblich ihren Reflex
suchen64.
Oder der - wie mit Bergande ausgeführt - eigentliche Fluchtpunkt könnte so einen Fleck
darstellen. Dieser Fleck als flatternder Punkt, der sich nicht sofort erschließe, 'besetzt' von
59 ebd., S. 76360 ebd., S. 763f61 vgl. ebd., S. 76462 vgl. ebda.63 vgl. ebda.64 vgl. Damisch, S. 437
15
José Nieto, der scheinbar einen Vorhang zur Seite hebt, oder hält, „metonymisch die
Enthüllung des Bildes und der Szene […] nachahmt“65. Der Spiegel und die Tür in direkter
Konkurrenz, ebenso die beiden Velázquez, die sich im Bild finden, „den selben und den
anderen“66. Gibt es in diesem Bild(System) einen Fleck, der das Subjekt herausstellt?
Ausgeschlossen durch die Figuren im Spiegel, dieser anzeigend dessen, was fehlt, hier aber
ein betrachtendes Subjekt benötigt wird, damit die Schleife überhaupt entstehen kann?! Das
Subjekt als Fehlendes anwesend? <Nicht-Da> als eines gedacht, wie eine Möbiusschleife?
2.1 Faden und Fleck
„Es gibt nicht eine einzige Teilung, nicht eine einzige der doppelten Seiten, die die Funktion des
Sehens aufweist, die sich uns nicht als Labyrinth darstellen würde. Je besser wir die Felder
unterscheiden, um so deutlicher wird, wie sehr sich diese Felder überschneiden“67 (Lacan 1996:99).
Abb. 4: „Les Perspecteurs“
Lacan bezieht sich hier auf Das Sichtbare und das Unsichtbare von Merleau-Ponty und den
Begriff Flechtwerk, der das Gefüge von sichtbar und unsichtbar beschreibt. Lacan geht
dieses Wechselspiel von Seiten des Geometralen an, bei der, wie es scheine, das Licht den
Faden angebe, das Licht den Betrachtenden mit jedem Punkt eines Objektes verbinde und
er betont, das der Faden aber nicht auf das Licht angewiesen sei und somit seien die
Ausführungen ebenso für Blinde gültig, indem dieser sozusagen 'taktil sieht'68.
Klassischerweise stellte man sich die geometrale Perspektive wie auf folgt vor: Ein Subjekt
65 ebda66 ebd., S. 43367 Jacques Lacan, 1996: Seminar Buch XI, die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, S. 9968 vgl. ebda.
16
befindet sich im Raum, allgemeiner formuliert, einer Umgebung und erblickt aus dieser
Position heraus selbige und die Objekte, die sich vor ihm/ihr befinden. „Die »Perspecteurs«
entwickeln nach Belieben und jeder für sich ihre je eigene Sehpyramide, deren Fäden am
Augenpunkt verknotet sind“69. Also so gedacht ein geschlossenes System, Subjekt – Objekt
und die Annahme, es bestehe eine Korrespondenz Punkt für Punkt, ebenso eine
Korrespondenz zwischen dem Objekt und seiner Projektion70.
Abb. 5
Alles was wir sehen, sämtliche Objekte, somit auch Gemälde, seien nichts anderes, als zu
sehen Gegebenes und Subjekte erscheinen als geometrale Punkte, wie sie die geometrische
Optik definiere und genau dies könne aber nicht der Platz eines Subjekts sein: Denn „dass
dasselbe Subjekt ins Gemälde auswandert, das es von ihm verführt, angezogen werden
kann […] ist gerade das Gesetz des Sehens“71. Subjekte selbst sind zu-sehen-Gegebene,
„siehst du die Büchse? Siehst du sie? Sie sieht dich nicht“72 und Lacan führt weiter aus,
dass ihn diese Büchse natürlich nicht direkt ansehe, aber dennoch ihn anblicke und zwar
„auf der Ebene des Lichtpunkts, wo alles ist, was mich angeht | me regarde […] ich machte
mehr oder weniger einen Fleck im Bild“73. Was wir sehen, was sich in der Tiefe unserer
Augen abzeichne, sei zwar das Bild | tableau, aber:„Das Bild ist sicher in meinen Augen,
aber ich, ich bin im Tableau. […]. Was Licht ist, blickt mich an, und in diesem Licht
zeichnet sich etwas ab auf dem Grunde meines Auges, […] das Rieseln einer Fläche“74.
Genau dabei komme etwas ins Spiel, was im geometralen Verhältnis ignoriert würde, die
Feldtiefe in ihrer Doppeldeutigkeit, etwas, das aus der Landschaft etwas anderes mache als
eine Perspektive, etwas anderes als das, was Lacan Tableau nannte75. Zunächst: Das
Korrelat zum Tableau wäre ebenso 'Draußen', der Blick-Punkt | le point de regard und die
69 Damisch, S. 5770 vgl. ebda.71 Lacan, 1996, S. 63f72 ebd., S. 10173 ebd., S. 10274 ebda.75 vgl. ebda.
17
Vermittlung beider, stellt etwas undurchlässiges dar und zwar den Schirm | écran. „Es geht
stehts um ein Spiegeln […] Blick bedeutet immer ein Spiel von Licht und
Undurchdringlichkeit“76.
Abb. 5.1
Die Perspektive also als eine Art Folie, Werk- oder Spielzeug, dessen Künstler sich bewusst
sind, oder davon ahnen und es in Werken wie Las Meninas umsetzen, was uns 'gefangen
nimmt'. „Im Bild manifestiert sich mit Sicherheit immer ein Blickhaftes“77 und der Künstler
wisse dies, denn die Funktion eines Bildes beziehe sich auf den Blick und man wäre
eingeladen, diesen im Bild zu deponieren78. Etwas lässt uns in ein Bild hinein, etwas drängt
uns, unsere Blicke darin zu deponieren, um etwas zurück zu erhalten, um etwas zu
befriedigen? Was lässt uns unsere Blicke in Bildern vertiefen, vielleicht das, was uns zu zu-
sehen-Gegebenen macht? „Sobald ich sehe, muss das Sehen [vision] mit einer
komplementären oder anderen Sicht synchronisiert sein: mit der Sicht meiner Selbst von
außen, so wie ein Andere mich sehen würde, der sich inmitten des Sichtbaren eingerichtet
hat und dieses von einem bestimmten Ort aus sieht“79. Es wird der Begriff vision betont,
was einerseits Sicht heißt, aber ebenso auch Erscheinung, Traumbild und im weiteren Sinne
Wunschbild oder Trugbild. Wie sind wir also im Sichtbaren, wie sind wir zu sehen-
Gegebene? Wie wir gesehen werden wollen? Was wir denken, wie wir gesehen werden
könnten? Was wir meinen wer wir sind – das entspräche einer Punkt für Punkt Perspektive.
Was sehen wir, wenn wir uns im Spiegel erblicken? Unser Selbst? Oder genauer formuliert
– was sehen wir von uns? Wie wir sind, wie wir (für andere) zu sehen-gegeben sind, das ist
die Leerstelle. Der A/andere, der keine Antwort gibt, wie Velázquez in Las Meninas.
76 ebd., S. 10377 ebd., S. 10778 ebda.79 Merleau-Ponty, 2004, S.177
18
3. Exkurs: Ähnlichkeit
Abb. 6:„Phylliinae,
wandelndes Blatt“
Bei Foucault gibt es eine Art Raster der Ähnlichkeit, mit welchem er die Ähnlichkeit im
Denken im oder bis zum 17. Jahrhundert beschreibt80. Auf vier Figuren (die, oder mit deren
Hilfe Ähnlichkeiten gedanklich hergestellt oder erzeugt werden) geht er näher ein und hier
sollen diese kurz vorgestellt werden: convenientia, aemulatio, Analogie und (das Spiel der)
Sympathien. Die convenientia meint Dinge, „die sich nebeneinanderstellen, wenn sie
einander nahekommen […] die äußersten Grenzen des einen bezeichnen den Beginn des
anderen“81. Nachbarschaften, die entstehen und Ähnlichkeiten entstehen lassen, uns solche
sehen lassen, oder eher machen: “...man sieht im Geweih der Hirsche Pflanzen und eine Art
Gräser auf dem Gesicht der Menschen“82. Konjunktion und Anpassung an die umgebende
Welt, eine Nachbarschaft wie eine Kettenbildung von Ringen, die sich jeweils an ihren
Berührungspunkten ähneln, „von Kreis zu Kreis setzen sich die Ähnlichkeiten fort“83. Die
aemulatio ist im Gegensatz zur convenientia unabhängig von ihrer Umgebung, eine Art
berührungslose Ähnlichkeit, wie ein Spiegelbild, Reflektion. Foucault beschreibt dies
anhand von Beispielen wie der Intellekt der Menschen, welcher unvollkommen die
Weisheit Gottes reflektiere, also eine Herstellung von Ähnlichkeiten zwischen Dingen, die
im Grunde nichts miteinander zu tun haben müssen und auch auf weite Distanz gedanklich
verbunden, verdoppelt werden eben durch eine scheinbare Ähnlichkeit84. Was nun die
Realität sei und wo das Abbild ist, sei schwer zu sagen, oft nicht mehr bestimmbar und es
bilde sich hier keine Kette, sondern eher rivalisieren die Kreise85. Die Ringe kreisen quasi
80 vgl. Foucault, S. 4681 ebd., S. 4782 ebda.83 ebd., S. 4884 vgl. ebd., S. 4985 vgl. ebd., S. 50
19
um die Frage nach der Originalität?! Wenn jemand sein Spiegelbild die ersten Male beginnt
wahrzunehmen, was ist für diese Person das Original?
In der Analogie überlagern sich convenientia und aemulatio, aber die Ähnlichkeiten hier
müssten nicht manifeste sein, es reichen subtilere Ähnlichkeiten der Verhältnisse (rapports),
wie beispielsweise das Verhältnis von Mineral und Diamant zu den Felsen86. Umkehren
können sich außerdem Analogien, wie die Analogie zwischen Pflanze und Tier, „das
Gewächs ist ein Tier, das seinen Kopf nach unten richtet, den Mund […] in die Erde
eingegraben hat“87. Es existiere hier aber ein privilegierter Punkt und dies wäre der Mensch,
denn er ist es, der die Analogien herstellt und/oder vielmehr aufgrund seiner Position in der
Welt eine Analogie ist: “Er steht in einer Proportion zum Himmel wie zu den Tieren […]
Der Körper des Menschen ist immer die mögliche Hälfte eines universalen Atlas“88. Zuletzt
das Spiel der Sympathien, welche in freiem Zustand spiele, sie sei eine Instanz des
Gleichen (Même), habe die gefährliche Kraft zu assimilieren, die Individualität der Dinge
verschwinden zu lassen, sie transformiert und die Dinge, die einander ähneln können sich
so einander annähern89. Ein Wechselspiel von Sympathie und Antipathie, welches allen
Formen der Ähnlichkeit überhaupt Raum gebe, dadurch das dieses die Bewegung und
Verbreitung vorschreibe, also die ersten drei beschriebenen Ähnlichkeiten haben quasi in
dieser Matrix Statt90.
3.1 Naturästhetik – Mimese
Beginnen möchte ich mit Überlegungen von Roger Caillois aus seinem Werk „Meduse et
Cie“. Es finden sich hier viele Beispiele (vor allem aus 'der Natur') zur Thematik der
Nachahmung, dem Streben nach Gleichheit, Angleichung an die Umgebung, also eine Art
„Versuchung durch den Raum“91 oder auch zu Fragen nach dem Original und der Kopie.
Ein interessanter Gedanke ist der, dass Menschen im Gegensatz zu Insekten nicht mehr den
mechanischen und unvermeidbaren Verhaltensweisen ausgeliefert seien, unsere Welt sei
inzwischen die der Einbildungskraft und somit die der Freiheit, der Instinkt wirke nur mehr
86 vgl. ebd., S. 5187 ebda.88 ebd., S. 51f89 vgl. ebd., S. 53f90 vgl. ebd., S. 5591 Caillois, Roger, 2007: Meduse et Cie, S. 35
20
auf dem Umweg über das Bild92. Früher einmal absoluter unmittelbarer Mechanismus
(Instinkt), heute nur mehr Reflex, eine Art leises Überbleibsel oder Phantasma93. Er bezieht
sich hier auf das Gebaren der Mantis (Gottesanbeterin) und den Phantasieprodukten der
Menschen hierzu und versucht dies weiter auszuführen anhand weiterer Beispiele. Die
Mimikry in der Tierwelt und unser Hang zur Verkleidung, Tarnung, Travestie oder Masken
mit dem 'bösen Blick' und wiederum ebensolchen Einschüchterungsstrategieren in der
Tierwelt94. Mechanik und Fixiertheit in der Tierwelt, demgegenüber Freiheit und
geschichtliche Entwicklung bei den Menschen und diese Parallelen seien aber Teile
desselben Universums95. Caillois beschäftigt sich im Folgenden auch mit figurativer und
nicht figurativer Malerei und meint, dass die zeitgenössische Malerei ihre Gestalthaftigkeit
eingebüßt habe, der Maler vermeide es, etwas zu schaffen, das an irgendeine Form von
Wiedergabe erinnere und quasi Originalvorlagen in der Natur seien ihm unbekannt96. Aber,
Caillois wird den Eindruck nicht los, dass Kunst oft doch noch den „blind wirkenden
Gesetzen der Geologie“97 gehorchen würde. Er bezieht sich auf zunächst
Schmetterlingsflügel, ästhetische Gebilde, die nicht als individuelle Leistungen betrachtet
werden sondern als Automatismen, parallel hierzu Gesteine mit ihren natürlichen
Zeichnungen und eine Zeit, in der in der (figurativen) Malerei Landschaften oder sonstige
Szenen dargestellt wurden und man glauben konnte „dieselben Darstellungen in den
Zeichnungen des Marmors, des Jaspis oder der Achate wiederzuerkennen“98.
92 vgl. ebd., S. 5293 vgl. ebda.94 ebd., S. 5895 vgl. ebda.96 vgl. ebd., S. 7297 ebda.98 ebd., S. 73
21
Um nun für diese Arbeit diese Gedankengänge zu veranschaulichen soll Max Ernst dienen.
Folgendes Bild malte er 1946:
Abb. 7: Max Ernst „Bryce Canyon“, 1946
Wiederum ein Bekannter von Ernst erzählt in der Dokumentation „Mein Vagabundieren,
meine Unruhe“, dass sie auf einer Reise durch Arizona Halt machten und Max Ernst dort
dann die Landschaft zum ersten Mal wahrnahm, welche sich in obigem Bild findet. „Als
Max sich umsah, wurde er sichtbar bleich, er starte auf dieselbe phantastische Landschaft,
die er in […] Frankreich vor gar nicht langer Zeit gemalt hatte, ohne zu ahnen, dass es sie
wirklich gab“99.
Abb. 8: Max Ernst „Canyon?“
99 transkribiert aus dem Trailer zu "Max Ernst - Mein Vagabundieren, meine Unruhe", 1:38, http://www.youtube.com/watch?v=VSFghfyBaAo, zuletzt abgerufen Februar 2014
22
Nun findet sich dieses Bild meistens mit dem Titel „Bryce Canyon“ oder es heißt, es hätte
seinen Ursprung - sein Originalbild sozusagen - im Oak Creek Canyon. Ob nun für Max
Ernst vorab die Landschaft bekannt war, sei dahingestellt. Es geht hier vor allem um die
Ähnlichkeit zwischen Abbild und vermeintlichem Vorbild. Gibt es einen zu Grunde
liegenden Drang zur Kopie, zum Nachahmen, zur Angleichung und dies vielleicht ohne das
jeweilige 'Original' jemals wahrgenommen haben zu müssen? Ist es eine Art Matrix
(Antipathie und Sympathie), wie sie ebenfalls weiter oben mit Foucault beschrieben ist,
eine in der wir uns bewegen, mit der wir uns bewegen? Vielleicht aufgrund des Spiels der
Analogie, dadurch eine Position beziehend, die es uns einerseits erlaubt und andererseits
drängt, zu Ähnlichem und Angleichung? Mimese als eine Art Antwort? Oder vielmehr ein
Versuch zu verschleiern, dass es keine Antwort gibt?
Ausgang
„Das ist ein Widerstrahlen ohne Ende!
Dort leuchtet grenzenlos des Himmels Spiegel,
und saugt in seine silberweiten Wände
die tiefe Welt, und preßt auf sie sein Siegel.”100
Wenn man Las Meninas nun mit dem Fokus der Nachahmung und Ähnlichkeit betrachtet,
stellt sich die Frage, was hier nachgeahmt wird oder welche Verknüpfungen, Analogien wir
quasi herstellen in der Betrachtung? Oder sprengt Velázquez eben diese Systeme? Ahmt er
etwas nach und wenn ja, was. Suchen wir im Bild nach Ähnlichkeit? Gibt es im Bild eine
Ähnlichkeit im Sinne einer Vertrautheit, da, wenn es das Spiegelstadium darstelle, uns diese
Situation sozusagen bekannt vorkommt? Versuchen wir unseren 'Platz' durch das Bild zu
erhalten, wollen wir diesen zugewiesen bekommen? Fragen wir uns deshalb, was Velázquez
– der Maler – sieht oder genauer: was die Leinwandvorderseite zeigt?
Etwas, (s)eine Sicht, der wir gewissermaßen Wissen unterstellen, in oder nach der wir uns
einpassen könnten? Dann ist da der andere Andere, der die ganze Szene überblickt, gerade
in sie eintretend oder sie verlassend, aber mit Blick auf uns und Raum für uns eröffnend,
100 die Strophen stammen aus dem Gedicht „der Spiegel“ von Rose Ausländer
23
einen Fluchtpunkt?
Der folgende Satz ist falsch. Der vorhergehende Satz ist richtig. Zitiert Hofstadter diese
wohl sehr bekannte Schleife. Jeder Satz für sich alleine sei harmlos, nur miteinander
verbunden entstehe eine Schleife101. Das Gemälde Las Meninas ist alleine, ohne
Betrachtende harmlos. Doch sobald ein Mensch hinzukommt - vielleicht könnte man sagen:
(sich) zu sehen beginnt - entsteht die Schleife.
Es gibt viele Variationen von Las Meninas, Sophie Matisse erschuf 2001 eine Version, die
nur den Raum, ohne Subjekte zeigt, bei Equipo Crónica verschwinden Spiegel und
Fluchtpunkt und auch Pablo Picasso versuchte sich an Las Meninas, doch keine (mir
bekannte) bildnerische Interpretation kann dieselbe Wirkung erzeugen wie das Original.
101 Hofstadter, S. 23
24
Quellenangaben
Literatur
Rose Ausländer, 2009:„der Spiegel“ in: Es ist gewiss, du bis nicht ich, Spiegel Gedichte,
Reclam
Bergande, Wolfram, 2009: Das Bild als Selbstbewusstsein – Bildlichkeit und Subjektivität
nach Hegel und Lacan am Beispiel von Diego de Velázquez´ Las Meninas, in: Arbeit der
Bilder, die Präsenz des Bildes im Dialog zwischen Psychoanalyse, Philosophie und
Kunstwissenschaft, Buchreihe IMAGO, Hg: Soldt, Philipp/Nitzschmann, Karin,
Psychosozialverlag Gießen
Caillois, Roger, 2007: Meduse et Cie, Brinkelmann und Bose, Berlin
Damisch, Hubert, 2010: Der Ursprung der Perspektive, diaphanes Verlag, Zürich
Foucault,Michel, 1980: Die Ordnung der Dinge, 3. Aufl., Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M.
Hofstadter, Douglas R., 1979: Gödel Escher Bach – ein endloses Geflochtenes Band,
Ernst Klett Verlag, Stuttgart
Kadi, Ulrike, 2009: „...nicht so einen geordneten Blick“ in: Blickzähmung und
Augentäuschung. Zu Lacans Bildtheorie, Blümle, Claudia/Von der Heiden, Anne (Hg.), 2.
Aufl., diaphanes Verlag Zürich, Berlin
Lacan, Jacques, 1991: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie sie uns in der
psychoanalytischen Erfahrung erscheint in: Schriften I, 4. Aufl., Quadriga Verlag Berlin
Lacan, Jacques1996: Seminar Buch XI, die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, 4.
Aufl., Quadriga Verlag, Berlin
Lacan, Jacques, 2001: Das Seminar, Buch X, die Angst, Verlag Turia + Kant Wien, Berlin
Merleau-Ponty, Maurice, 2004: Das Sichtbare und das Unsichtbare, 3. Aufl., Wilhelm
Fink Verlag München
Merleau-Ponty, Maurice, 2004: Keime der Vernunft, Vorlesungen an der Sorbonne 1949-
1952, Wilhelm Fink Verlag München
Internetquellen
Jacques Lacan: Seminar Book XIII, the Object of Psychoanalyses, translated by Cormac
Gallagher: http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/13-The-
Object-of-Psychoanalysis1.pdf, abgerufen am 19.03.2013
25
Bilder
Titelbild:„Möbiusschleife“ von Hans Nübold, http://edition-strassacker.de/kuenstler/hans-
nuebold/208/moebiusschleife abgerufen am 15.03.2013
Abb. 1:„Las Meninas“, Diego Velázquez, 1656
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_Vel
%C3%A1zquez_Las_Meninas_Die_Hoffr%C3%A4ulein.jpg abgerufen am 5.03.2013
Abb. 2: Bildgalerie, M.C.Escher, 1956, in: Hofstadter, Douglas R.: Gödel Escher Bach –
ein endloses Geflochtenes Band, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1979, Seite 762
Abb. 3: Darstellung der Schleifen, in: Hofstadter, Douglas R.: Gödel Escher Bach – ein
endloses Geflochtenes Band, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1979, Seiten 763f
Abb. 4: „Les Perspecteurs“ Kupferstich aus Manière universelle de M. Desargues pour
traiter la perspective, 1648, http://trivium.revues.org/243 abgerufen am 23.02.2013
Abb. 5 und 5.1: Schema der Perspektiven, Dreieckschemata bei Lacan, in: Seminarbuch
XI, die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, 4. Aufl., Quadriga Verlag, Berlin, 1996, Seite
97+112
Abb. 6: „Phylliinae“, wandelndes Blatt, http://de.wikipedia.org/wiki/Mimese abgerufen am
18.02.2013
Abb. 7: „Bryce Canyon“, Max Ernst, 1946“, https://www.artfinder.com/work/bryce-
canyon- translation-max-ernst/ abgerufen am 22.02.2013
Abb. 8: Max Ernst „Canyon?“: 'ausgeschnitten' aus dem Trailer „Mein Vagabundieren,
meine Unruhe“ http://www.youtube.com/watch?v=VSFghfyBaAo abgerufen am
10.02.2013
bewegte Bilder
Trailer „Mein Vagabundieren, meine Unruhe“ http://www.youtube.com/watch?
v=VSFghfyBaAo abgerufen am 10.02.2013
26