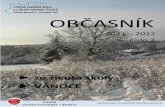AUF SAT ZE - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of AUF SAT ZE - Forgotten Books
AUF SAT ZE
KULTUR UNDSPRACHGESCHICHTE
VORNEHMLICH DES ORIENTS
E RNS T KU HN
Z UM 70 . GEBU RT S T A GE AM 7 . FEBRU AR 1 9 1 6
GEW IDMET VON
FREU NDEN U ND S CHU LERN
MÜNCHEN 1916
B R E S LA U ,V E R L A G V O N M. H. MA R C U S
1 9 1 6
Hochverehrter , lieber Herr Professor !
Die Überzeugung, daß eine große Anzahl Ihrer Kollegen ,
S ch uler und F reunde den Wunsch hege, Ihnen an Ihrem 70 . Ge
burtstage ein Z eich en der Verehrung zu geben, ließ uns zu dieser
Gelegenheit trotz der ernsten, solch en Veranstaltungen wenig
günstigen Z eiten eine Festsch rift planen ,und die rasch en und
zahlreich en Z usagen auf eine dah in zielende Anfrage haben fürdas Gelingen dieser E h rung alsbald die sich ere Grundlage geschaffen.
Wenn audzna turgemäß das Ausland in der IhnengewidmetenFestgabe nich t du rch seh r viele Mitarbeiter vertreten ist, so
dürfen S ie doch gewiß aus den vorhandenen Beiträgen den S ch lußziehen, daß die ausgebliebenen nur unter dem Z wange der Ver
hältnisse fehlen. Denn wie groß der Kreis derer ist,die S ie
durch rastlose Anteilnahme an ihren wissenschaftlichen Arbeiten,
durch Ihre gesunde Kritik, durch nie versagenden, dem S ch atze
Ihres reich en und tiefen Wissens entnommenen Rat geförder t,belehr t und ermutigt haben, bezeugt Ihnen die eigene, durch
Ihre umfassende Kor respondenz beleb te E rinnerung untriiglich .
Aus den Gefühlen der Dankbarkeit und F reundsch aft sinddie Darbietungen entsprossen, die ein Markstein an Ihrer Lebenswende sein wollen . Umfang und Ausstattung unserer Festsch rift
mußten eine Besch rankung erfah ren ; aber unvermindert sind die
herzlich en Wünsch e,die sie begleiten : mogen Ihnen noch lange
lah re in altgewohnter F risch e und Gesundheit besch ieden sein !
Ma n ch en und Heidelb e rg, E nde ]anaar 19 16.
L . S dzerman . C. Bezold.
Bei Überreich ung der F estsch rift zu E hren E r ns t Kuh ns
begliickwünsch en den ]ub ilar mit verehrungsvollem Gruße
Dr . F . Aichbichler , S tadtpfa rrer. AbensbergA . A ttenhofer , cand . phi l . , Berl inDr.Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
D r .Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .Dr .
Ch r. Bartholomae , Pro f. a . d . Un iv. He i del berg
C . H . Becker, Prof . a . d . U n iv . Bonn
G. A . v an den Bergh v an Eysinga , Priv atdoz. a . d . U n i v. U trech tEr i ch Berneker , Prof. a . d . U n iv. Mün chen
,2 . Z . beim Heere
Car l Bezol d, Prof. a . d . U n iv. He ide lb ergA . Bezzenb erger , Prof. a. d . U n iv . Kön igsbergFr. W. F re iher r v . Bissing, Prof. a . d . U n i v. Mün chenMaur i ce Bloomfield
,Prof . a . d . Johns Hopkins U niv ers ity,
Ba l timoreF ranz Boll Prof. a . d . U n iv. He ide lbergW . Ga land, Prof. a . d . U n i v . UtrechtC . Cappeller , Prof. a . d . U n iv . JenaJarl Cha rpen tier, Privatdoz. a. d . Un iv . Uppsa laA . Con rady , Prof. a . d . U n iv . Le ipzigOtto Crusius
,Präs iden t d . K . B. Akadem ie der Wissensch . und
Prof. a . d . U n iv. MünchenPau l Deussen
,Prof . a . d . U n iv . Kiel
A . Di rr, Kustos am K . Ethnograph is chen Museum ,München
Ju l ius Duto i t, Gymnasialprof. , MünchenKar l Dyroff, Prof . a. d . Un iv . München , z . Z . als Hauptmannbeim HeereS e bastian E uringer , Prof. am Lyzeum ,
Di l l ingenRichard F i ck, Oberb ib l iothekar a . d . K . Bib l iothek , Berl in,2 . Z . als Hauptmann be im Heere
Prof. Dr . Wil ly F oy , Di rektor des Museum s f . Vö lkerkunde, Co lnDr .
Dr .
R . Otto F ranke, P rof. a . d . U n iv. Kön igsbergRichard Garbe
,Prof. a . d . U n iv. Tüb ingen
Hermann Ge iger, E h renkanon iku s des Kollegiatstifts z. h l . Kaj etan,Riünchen
Dr . Wil he lm Ge iger,Prof . a . d . U n iv . Er langen
Dr . He lmuth v . Glasenapp, Ber l inDr . Ignaz Goldziher , Pro f. a . d . U n i v. Budapes tDr . Em i l Gratzl , Bib l iothekar a . d . K . Hof und S taatsbib l.
,Muncheu
Prof. Dr. Albe rt Grünw edel,Di rektor am K . Museum f. Völkerkunde,
Ber l incand . theo l . F r ied r ic h He i ler, München, z. Z . be im Heerecand . ph i l . He inz He intze , MunchenDr . August He isenbe rg , Prof. a . d . U n iv . München
,z . Z . als Haupt
mann be im HeereDr . Joseph Hel l , Prof . a . d . U n i v . Er langenDr . Gustav Herb ig, Prof. a . d . Un iv . Ros tockDr . Johannes He rtel, Gymnasialprof. , Döbe ln , z . Z . als U nterofi
'
.
beim HeereDr . Al fred Hilleb ranclt, Prof . a . d . U n i v . Bres lauDr . F r itz Homme l
,Prof. a . d . U niv . Mün chen
Dr . A . V . Wil l iam s Jackson , Pro f. a . d . Co l umb ia U n iv ers ity ,New York
Dr . Hermann Jacob i,Prof. a . d . Un iv . Bonn
Dr . Wilhe lm Jahn,Pr ivatdoz. a . d . U n iv. Züri ch
Dr . Morr is Jastrow ,Pro f. a . d . Pennsy lvan ia U n iv.
,Phi lade lph ia
Dr . K . F . Johansson , Prof. a . d . U n i v. Uppsa laDr . Ju l ius Jo l ly , Prof. a . d . U n i v. Würzbu rgDr . He inr i c h Junker, Priva tdoz. a . d . U n i v. Gießen
,z . Z . als
Militärdolm etscher be im HeereDr . Hendrik Kern, Prof. a . d . U n iv . U trech tDr . Erns t Kieckers, Privatdoz. a . d.
'
U niv . MunchenWi lhe lm Kleinschm it v . Lengefe ld , S i l s—Baselgia, E ngad inDr. S ten Konow ,
Prof . am Ko lonia l ins ti tu t HamburgDr . Bertho l d Lau fer, Curator ofAn thropo logy, F ie l dMuseum , 0hicago
Prof . Dr . Al bert v . Le Coq , Direktor ialassistent am K . Museumfür Vö lkerkunde , Ber l in
Dr . F r ied r i ch v on der Leyen, Prof. a . d . Un iv . MünchenD r. E vald Liden, Prof . a . d . U n i v. GöteborgDr . Bruno Lieb i ch , Prof. a. d . U n i v . He i de lbergDr . Ernes t L i nd l , Prof . a . d . Un iv. München
Bei Überreichung der Festschr ift zu E hren E r n s t Kuh ns
begliickwiinsch en den ]ubilar mit verehrungsvollem Gruße
Dr . F. Aichbichler , S tadtpfarrer, AbensbergA . A ttenhofer , cand . phi l . , Berl inDr .
Dr .
Dr .
Erich Berneker , Prof. a . d . U n iv . Mün chen,z. Z . be im Heere
Car l Bezol d, Prof. a . d . Un iv. He ide lbergA . Bezzenb erger , Prof. a. d . U n iv . Kön igsbe rgF r . W . F reiher r v . Bissing, Prof. a . d . U n iv . MünchenMaur i ce Bloomfield
,Prof . a . d . Johns Hopkins U nivers ity,
Dr .
Dr.
Chr. Bartholomae , Prof. a . d . Un iv . Hei del berg
C. H . Becker, Prof . a . d . U n iv . Bonn
G. A . v an den Bergh v an Eysinga , Privatdoz. a . d . U n i v. U trech t
Ba l timoreF ranz Boll Prof. a . d . Un iv. He ide lbergW . Ga land, Prof. a. d . U n i v. U trech tC . Cappeller , Prof. a . d . U n iv . JenaJar l Cha rpent ier , Privatdoz. a. d . Un iv . Uppsa laA . Con rady , Prof. a . d . Un iv . Le ipzigOtto Crusius
,Präs iden t d . K . B. Akadem ie der W issensch . und
Prof. a . d . U n iv. MünchenPau l Deussen
,Prof . a . d . U n iv . Kie l
A . Di rr, Kustos am K . Ethnographis chen Museum ,München
Ju l ius Dutoi t, Gymnasialprof.‚ MünchenKar l Dyroff, Prof. a . d . U n iv . München , z . Z . als Hauptmannbe im HeereS e bastian E uringer , P rof. am Lyzeum ,
Di l l ingenRichard Fick, Oberb ib l iothekar a . d . K . Bib l iothek , Ber l in,z . Z . als Hauptmann be im Heere
Prof. Dr . Wil ly F oy , Di rektor des Museum s f . Volkerkuude, CölnDr .Dr .
R . Otto F ranke, Prof. a. d . Un iv. Kön igsbergRichard Garbe, Prof. a. d . U n iv. Tüb ingen
Hermann Geiger,Eh renkanon ikus des Kollegiatstifts z . h l . Kaj etan ,
MünchenDr . Wil he lm Ge iger
,Prof. a . d . U n iv . E r langen
Dr . He lmuth v . Glasenapp, Ber l inDr . Ignaz Go ldziher , Pro f. a . d . U n i v. Budapes tDr . Em i l Gratzl , Bib l iothekar a . d . K. Hof und S taatsbib l.
,Muncheu
Prof. Dr . A lbert Grünw edel,Di rektor am K . Museum f. Völke rkunde,
Be r l incand . theo l . F ried r ich He i ler , München, z. Z . be im Heerecand . ph i l . He inz Heintze, MuncheuDr . August He isenbe rg, Prof. a . d . U n i v. München
,z . Z . als Haupt
mann be im HeereDr . Joseph Hell, Prof . a . d . U n iv . Er langenDr . Gustav He rb ig, Prof. a . d . U n iv . Ros tockDr . Johannes Hertel, Gymnas ialprof. , Döbe ln , z . Z . als U nteroli
‘
.
beim HeereDr. Al fred H i l leb randt, Prof. a . d . U n iv . Bres lauDr . F r itz Romm e l, Pro f . a . d . U n iv . Muncheu
Dr . A . V. Wil l iam s Jackson , Prof. a . d . Co l umb ia U n ivers ity ,New York
Dr . Hermann Jacob i,Prof. a . d . Un iv . Bonn
Dr . Wil he lm Jahn , Pr ivatdoz. a . d . U n iv . Züri chDr . Morris Jastrow ,
Prof . a . d . Pennsy l van ia Un iv .,Phi lade lphia
Dr. K . F . Johansson , Prof. a . d . U n iv . Uppsa laDr . Ju l ius Jo l ly , Prof . a. d . U n iv . Wü rzbu rgDr. Heinr i ch Junker, Privatdoz. a . d . U n iv. Gießen
,z . Z . als
Militärdolmetscher be im HeereDr . Hend r ik Kern, Prof. a . d . U n iv . U t rech tDr . Erns t Kieckers, Privatdoz. a. d.
'
U niv . Muncheu
Wi lhe lm Kleinschm it v . Lenge fe ld , S i l s-Baselgia, Engad inDr . S ten Konow ,
Prof . am Ko lon ia l ins ti tut Hambur gDr . Bertho l d Lau fer, Curator ofAn th ropo logy, F ie l dMuseum ,Chicago
Prof . Dr . Albert v . Le Coq , Direktorialassisteut am K . Museumfür Vö lkerkunde , Ber l in
Dr . F ried r ic h v on der Leyen, Prof. a . d . U n iv. MünchenDr . E vald Liden, Pro f. a. d . U n iv . GöteborgDr . Bruno Lieb i ch , Prof. a . d . U n i v. Hei de lbergD r . Ernes t Lind l , Prof . a . d . Un iv. München
Dr . Enno Littmann , Prof . a . d . U n iv . GottingenDr . He in r i ch Lüders, Prof . a . d . U n iv . Ber l inDr . theo l . E . H . Muel le r, Gun tur (Ind ien), z. Z . MünchenDr . E . Mul ler-Heß, Prof. a . d . U n iv . BernDr . Theodor Nöldeke, U niv ersitätsprof. a . D.
,S traßbur g
Dr . Hanns Oerte l , Prof. a . d . Ya le Un iv .,New Hav en
Dr . M . Phi l ipp, Bib l iothekar a . d . K . Hof u . S taatsb ibl., Münchencand . phi l . F ri tz Rabuschin , Muncheu , z . Z . be im HeereDr . Georg Reismüller , Kustos a . d . K . Hof u . S taatsbib l., Muncheu
Dr . Lucian S cherman , Di rektor des K . Ethnograph ischen Museum su . Prof . a . d . U n iv. München
F ran Chris tine S cherman, MünchenDr . Jos. S ch i ck , Prof. a . d . Un i v. Muncheu
,z . Z . als Ober leutnant
be im HeereP . Prof . Wilhe lm S chm i dt
,S t . Gab r ie l -Mod l ing b . Wien
Dr . Han s S chnorr v . Carolsfeld, Di rektor d . K . Hof u . S taa tsbibl.,
MünchenDr . Leopo l d v. S chroeder
,Prof. a . d . U n i v. Wien
Dr . Wa l ther S chu br ing,Bib l iothekar a. d . K . Bib l iothek , Berl in ,
z . Z . b e im HeereDr . Wil helm S chul ze
,Prof . a . d . U n i v. Ber l in
Prof. Dr . Ju l ius S chw ab, Bib l iothekar a . d . Un iv.-Bibi , F re iburg i . B.
Dr . C . F . S eybo l d, Prof. a . d . U n iv . Tüb ingenDr . E m i l S ieg, Prof. a . d . Un i v. Kie lDr . Richard S imon , Pro f. a. d . U n iv. Muncheu , z . Z . als Haupt
m ann be im HeereDr . Wilhe lm S tre i tberg
,Prof. a. d . U n iv . Muncheu
Dr . Ludw ig S ütter l in , Prof. a . d . U n iv . F re ibu rg i . Br .
Dr . Rudo l f T hurneysen , Prof. a. d . U n iv . Bonn
Dr . Jacob Wackernage l,Prof. a . d . Un iv . Base l
Dr . E rn st Wind isch,Prof. a . d . Un iv. Le ipzig
Dr . Mor iz Wintern itz P rof. a . (1. Deu tschen Un iv . PragDr . Georg Wo l ff
,Oberb ib l iothekar a . d . K. Un iv.
-Bib l .,München
K . G . Zistl , w issenschaftl. Hil fsarbe i ter a . d . K . Un i v.-Bib l . , München ,z . Z . be im Heere
lnhaltsverzeichnis(in a lphabet ischer Re ihe der Verfasser) .
A t t e n h 0 i e r Paral lelen zum Ksä11 tivädijätrt ka
H . B e c k e r , U bi sunt qui an te nos in 1nundo fuereG . A . v a n de n B e r g h v a n E y s i n g a
‚Tiele über Christen
tum und OrientE . B e r n e k e r
,E in slav ischer Göttername
B e z o l d und Fr . B o l l,E ine neue baby lon isch-griechische
Para l leleA . B e z z e n b e r g e r , A l tpreußischesFr W. v . B i s s i n g , Die Um schreibung der HierogiyphenMaurice B i o o m f 1 e l (1 , On tw o cases of metr ical shorten ing of afused long-sy l lab le, R ig-Veda 8 . 1 8 ,
18 and G. 2. 7
B 0 l l s. B e z o l d
W. C a l a n d,Z u den Brähmanas
C . C a p p e l l e r , Die Z itate aus Maghas Sisupalavadha m it ihrenVarianten .
Jar l C h a r p e 11 t i e 1° K leine Bemerkungen zum Phys io logusA . C o n r a d y ,
E ine merkwürdi ge Bez iehung zw ischen den
aust rischen und den indoch inesischen Sprachen0 . C r u e i n s ,
E in verschol lener My thusA D 1 r r , Die S te l lung des U bychisch en innerhalb der w est
kaukasischeu SprachenJ . D u t 0 i t , Jataka Zitate in den Jataka TextenW. F o y , Über das indische Yon i Symbol .
R . O tto F r a 11 k e, Der „Negativ ismus “ in der al ten Buddha Lehre
Wil helm G e i g e r , Hüniyam . E in Be i trag zur Volkskunde von
Cey lon .
H . v . G l a s e 11 a p p, Lehrsatzedes dualist ischenVedanta (Madhv asT at tvasam khyana) iibemetzt und erklärt . .
Ignaz G 0 1 (1 z i h e r ' ZauberkreiseA lb ert G r ü n w e d e l , Näro und ll
‘
1lo
F riedrich H e i l e r , Die buddh ist ischen Versenkungsstufen .
A . H e i s e n b e r g K1 iegsgot tesdienst in Byzanz
J . H e l l . Über den Hudhailitendiwän der Chedivialbibliothek in
KairoGustav H e r b 1 g Bargina
Johannes H e r t e l , S ieben E rzah lungen in Braj BhakhaA lfred H i 1 l e b r a 11 d t , Z ur Kenntn is der ind ischen Material istenFr i tz H 0 m m e l A l te Paral le len zu den beiden Hunden der
Saramä
21 1 — 214
69 — 73
185— 1 92
420— 422
VIIIA . V . W i l liams J a c k s o n , A S asanian S eal W ith a Pahlav iInscription
Hermann J a c o b i U ber das Verhal tn is des Vedanta zum Sankhya
Wi lhelm J a h n Aufgaben der Puräua-Forschung
K . F . J o h a n s s o n Drei e tymo logische Vermutungen .
Julius J o l l y ,Land und Wasser als S taatseigentum .
H.
'
K e r n ,E ine Lauterscheinung im Niassisch en
E . K i e c k e r s ,@w z ia g
S ten K o n o w ,Zur F rühgesch ichte des indischen Theaters
B ertho ld L a u f e r , E thnographi sche S agen der Ch inesenA . v . L e C o q , E ine dolanische Wörterl iste .
F riedr ich v . der L e y e 11 ‚Aufgaben undWege der Marchenforschung
E . L 1 d e n Z um TocharischenE . L i t t m a n n , „
F räukisch“
Heinr ich L 11 d e r s A li un d A la
E . H . Mu e 1 l e r , Dev arakum da, der Got ter t0pf. E in Bei trag zurGesch ichte der Hausgöt ter Südindiens .
E . M ii 1 1 e r H e ß Z um Kautiliya A r thaéästra
Th . N ö 1 d e k e ,E in mandäischer Tr aktat
Hanns O e r t e l E rnst KuhnG . R e i s m ü 1 l e r , Karl F riedrich Neumann. S eine Lern und
Wanderjah re und se ineV erdienste um die ch ines ischen Büchersamm lungen dcr deutschen B ib l iotheken
Lucian und Christin e S c h e r 111 a n,W ebmaster der b irnianischeri
Kach in , ihre Nam en und ihre S tilgrundl agenP . W. S c h m i d t , E in iges über das Infix n m und dessen S tell
v ertr eter in den austroasiatischeu SprachenH . S c h n o r r v . C a r o l s f e l d , E in Brief Bopps an F riedr ichTh iersch über die S tel lung des Z akonischen innerhalb der indogerman ischen Sprachen
Leopold v on S c h r o e d e r Lebensbaum und LebenstraumW i lhelm S c h u 1 z e Indogerman ische In terj ekt ionenC. F . S e y b 0 1 d A rab isch
‚salbülz F euerstein
E . S i e g , Die Gesch ichte v on den Low enmachern in tochar ischerVersion .
Wilh elm S t r e i t b e r g ,Z ur Lautv ersch iebung
L . S ü 1: t e r l i n ,Le t r éfert und in terest
Rudol f T h u r 11 e y s e n ,E tymo logica
Jacob W a c k e r 11 a g e l , My thologische E tymologikaE rn st W i n d i s c h Brahman ischer E influß im Buddh ismusM. W i 11 t e r n i t z Mahabharata I I , 68
,4 1 11 . und Bhäsas
Dütairäkya
Georg W 0 1 f f , A ch undWeb. Ein Bei trag zur Textkri tik Konradsv on Würzburg
K . G . Z i s t i,Bib l iograph ie der Schriften E i nst Kuhns
Seite215— 21 6
30— 39
305— 312
273— 279
27 — 29
74 — 76
183— 184
106— 1 14
1 98 — 210
1 52— 1 57
400 — 4 12
1 39— 146
236— 243
313— 325
437 — 456
505 — 523
457 — 474
299 — 304
Ernst Kuhn .
Z u se in em 7 0 . Geb u r tstag(7 . F ebruar
Das äußere Leb ensb i l d des Jubilare kann in w enigen S tri chengezei chnet w erden . S e in Vater, Ada l bert Kuhn , ein auf dem
Geb iete der vergle i chenden S agenforschung füh render Ge lehrter,
w ar Direktor“ des Köllnischen Gym nas ium s zu Berl in . Nach fün fj ährigem S tud ium an den U n iversi täten Berl in und Tüb ingenpromovierte Erns t Kuhn in Ha l le, w ar darauf dort und in Leipzigals Pr ivatdozent tätig, w urde 1 87 5 als ordentl i cher Professor nachHeide l berg berufen
,von w o er zw e i Jahre später (1 87 7 ) an die
Münchener Hoch schu le übers iede l te . Hier vertrat er zunächstsow oh l die ar i sche Phi lo logie als auch die vergle i chende indogerman is che S prachw i s senscha ft, für w e l ch letztere e rs t 1 909 ein
eigenes O rdinariat geschafien w u rde . Der bayeri schen Akadem ieder Wissenscha ften gehört er se i t 18 7 8 a ls Mitgl ied und se i t fasteinem ha lben Menschena l ter als S ek retär der ph ilo logisch-h istoris chen Klasse an .
Vie l schw erer ist es, aufbeschrz'inktem Raume ein befr iedigendesBi l d seiner mann igfachen w is senscha ftl ichen Tätigke i t zu ze i chnen .
Dre i E igenscha ften v or a l l em verleihen den Kuhnschen Untersuchungen ih r Gepräge. Zunächst die v o l l s tändige Durcharbei tungj edes Prob lem s in a llen se inen Verzw e igungen . Ausgerei ft
,ohne
lose E nden,vo l l ständig du rchgefüh rt und sauber abgesch lossen
l iegt es dann in der Bearbe i tung vor . Diese Behandl ungsmethodeb ringt es mit s i ch
,daß er die Gegens tände se iner w is sens cha ft
l i chen Tät igkei t n i c ht i so l iert, sondern in i hren größeren Zusammen
1) W en i g veränderter A bdruck aus den Munchner Neuesten Nach
richten “19 16 , Nr . 68 .
X
hangen behande l t ; j e t iefer er das Prob lem durch dr ingt, des tom eh r drängen s ich ihm die F äden und Verb indungen auf, des tom ehr ist es ihm um die Darlegung und Aufdeckung der kul turh istoris chen Ausstrah l ungen des von ihm b ehande l ten S toffes zutun. Eine ungew öhn l i che Be lesenhe i t gepaart m it e inem w underbaren Gedä ch tn i s is t die notw endige Grundlage e iner so l chen w e i ts chauenden Methode . E ndl i ch charakter i s iert Kuhns Ar bei ten e inenüch tern abw ägende Kritik , die den fes ten Boden des T atsäch
l i chen n i cht zugunsten verlockender Hypothesen verliert , ein
gesunder S inn für das Rea le,eine Abne igung gegen gegenstand
lose Speku lation . S o s ind a l le Aufsätze Kuhn s Muster e iner kurzen,
auf a l les Unw esentl i che bew ußt v erzichtenden,auf b rei ter Bas is
aufgebau ten und kondens ierten Darste l l ungsw eise.
Auf dem Geb iete der G ramma tik sind die 1 87 5 veröffent
l i chten „Be i trage zu r Pa l i-Grammatik “ grundlegend und auch bisjetzt n i ch t durch ein abs ch l ießendes Werk ersetzt. Den Sprachendes a l ten Cey lon, der Zigeuner und der Hindukuschstämm e sindkü rzere Betrachtungen gew idmet. Eingehende re Abhandl ungenbehande ln hinterindische Sprachverhaltnisse. Auch h ier i st Kuhnn i ch t b ei der Einze l untersuchung e ines Dia lektes stehen geb l ieben,sondern zur Aufdeckung des geneti s chen Zusamm enhanges sprachl i cher Fam i l ien vorgesch r itten
,eine Aufgabe, die dann v on Wil he lm
S chm idt auf Kuhnscher G rund lage in se inen Arb e i ten übe r diesogenann te austr ische Sprachgruppe w e i ter ausgearbei tet w orden is t .
F ür Kuhn s ku l turh istori s che Arbe i ten i s t programmatis ch dieU ntersu chung ü ber Barlaam und Joasaph , die er a l l zu bes chei den„eine b ib l iographisch-literargeschichtlich e S tu die “
nenn t,w ährend
sie in Wahrhei t ein ungeheu res w issenschaft l i ches Materia l zue iner krit is chen Gesam tw ü rdigung zusammens ch l ießt. Hier w erdendie Beziehungen von buddh isti s chen und ch r i stl i chen Legendensorgfäl tig herausgeschalt , die üb r igen or iental i schen Vers ionengeprüft und die Herübernahm e des v ersch iedenartigen Lehngutesin die abendl änd ische ch r is tl i che Literatur nachgew iesen . Ähn
l i ches b ringen dann auch die Aufsätze Über e ine zoroastrischeProphezei ung in christl i chem Gew ande “
und Buddhistis ches inden apokryphen Evange l ien “
. E in Vorb i l d kurzgefaßter, anregenderDarste l l ung is t Kuhns Rektoratsrede (1 903) über den Einfluß desarischen In diens auf die Nachbarländer im S uden und Osten
,w orin
XI
die Wege , die die indis che Kultu r in ih rer Ausbre i tung über Asiengenomm en
,und i hr du rchd r ingender E influß m it besonderer Be
rücksichtigung des buddhis tis chen E insch lages k lar erörtert w erden.
Die Ermahnung an die S tud ierenden “
,in die die Rede auskl ingt
,
mag heute manche taube Oh ren finden,hat aber an Wahrhei t
n i chts v er loren.
Das Bi l d von Kuhns w i ssenschaftl i cher Tätigke i t w ä re unvolL
standig, w enn es s ich nur auf se ine Pub l ikationen bes chränkte .
Kuhns erstaun l i che Vie l seitigkei t und ausgedehnte Kenntn i s derw is senschaft l i chen Literatur is t durchaus n i cht nur seinen eigenenA rbe i ten zugute gekommen . Lebhaft und se lbs tlos hat er s ichan der Le i tung der von se inem Vater begrundeten Ze i ts chri ft fürvergle i chen de Sprachw issenschaft (die fast immer als „
Kuhns Zei ts ch ri ft “ zitiert w i rd) w ie an b ib l iograph ischen Unte rnehmungenganz besonders der groß ange legten
„Orien ta l is chen Bib l iographie “
bete i l igt. E s i st das Los des Bibliographen, daß er,auf Dank
verzi chtend,se ine A rbe i t selbstlos für andere verri chtet : w o er
fördert,w i rd seine Hi l fe w ie Luft und Licht genossen , nur w o er
versagt, erinnert man sic h se iner. In den Jahresbänden der
Oriental is chen Bib l iograph ie ist se i t 1 892 eine gew a l t ige Arbei tn iederge legt , die Kuhn für andere getan hat. In ähn l icher Wei sehat Kuhn a ls Mi tgl ied akadem is cher Komm is s ionen n i cht nur auf
seinem engeren F orschungsgebiet gew i rkt und z . B. zu den Vor
arbe i ten für die Herausgabe von Wö rterbüchern bayer i scher Mundarteu den ersten Anstoß gegeben . Dazu komm t end l ich die
vie l se itige An regung und Hil fe , die er s tets im Gesmäch oderb r ief l i ch m it se l tener Lieb ensw ü rdigke i t den F achgenossen gew äh rthat ; vie le v on ihnen hab en s ic h in d ieser F estschri ft zusamm enge funden
,um ihren Ge füh len der F reundscha ft und der Dankbar
ke i t für se ine rastlose An tei lnahme an ih ren w i ssenschaf tl i chenArb ei ten , für seine gesunde Kritik , se ine nie versagenden Rats ch läge Ausdruck zu verle ihen.
Hann s Oer telYa le Un ivers i ty , New Haven, Conn .
,z . Z . München .
Bibl iographie der Schr iften Ernst Kuhns.
V on
Kar l G . Z ist l (München) .
Die Anordnung b ei Ab schn i tt 1 und III ist chronologisch ; bei Zei tschri ftenartikeln gi l t als E rsche inungsjahr das Jahr des Bandt.i tels. Bei A bschn i tt 11ist die A nordnung alphabet isch nach den rezensierten A u toren . Die Ab
kürzungen entsprechen den in der Orien tal ischen Bib l iograph ie üb l ichen .
1 . E igen e S chr ift en .
1 869 Kaccayanappakaranae spec imen . Ha l le (Ber l in ,Dr . v. A .
W . S chade). 34 p.
,1 Bl. (Doktordi sser tation)
Rez. T h . B enfey, GGA 1869, p. 1 5 17 — 20.
1 87 1 Kaccäyanappakaranae spec imen a l terum i . e . Kaccäyanae
Nämakappa . Ha l l e, Wai senhaus . XIV, 34 p. (Hab i l i tationss ch r i ft.)
Bez. A . Weber, Z DMG 25, p. 51 1 f. (abgedruckt in Webers
Ind ischen S treifen 3 , p. 83 f.)
1 872 S uffix KZ 20, p. 80 .
1 87 5 Bei tr äge zur Päli-Grammatik . Ber l in,Dümm ler . VIII
,1 20 p.
Bez . R . P isclzel , Jenaer Li teraturzei tung 1 87 5, p. 316 f.
E . Sm art , R ev . er . d’hist . et de l i tt. 1875, Nr . 29 , p. 33— 38 ;
A . Weber , LC 1875 , p. 1862— 65 (abgedruckt in Webers IndischenS treifen 3, p. 3168
1 87 7 Bib l iograph is che Notizen fü r die Jahre 1 87 5 — 1 87 7 : KZ 23,p. eos- 22.
1 878 Aus e inem Br iefe des Herrn Professor Ernst Kuhn an den
Herausgeber : ZDMG 32, p. 584 .
Vgl. ib . p. 7 68. Z ur Gesch ichte des Bar laam und Ioasaph .
18 7 9
1 88 1
XII I
Uber den äl testen arischen Bes tandtei l des s ingha les is chenWo rtscha tzes : S itzb . Ak. Wiss . M .
, ph i los . -phi lo l . und bist.
Kl .,18 7 9 , II, p. 39 9 — 43 1 .
U hs . v . Dona ld F e rgu s o n unter dem Titel : On t he o ldestA ryan e lem ent of the S inhalese v ocabulary : Indian A 11t iquary 12
p. 53- 6 5 (dazu p. 65 — 70 : Notes by the trans lator) .Miscellen : KZ 24
, p. 99 f.
S kr . kub_jci . 2. Päli apacasc, apacise, apac issaxe. 3 . Päli
Wurzel pum .4
. Päli-Ablativ auf -to bei Verben des fur etw asHaltens , E rkennens usw .
K u h n,E r n s t. und A u g u s t M ü l l e r. Grundsätze für die
Neugesta l tung des Jah resberi chts : Wiss . Jsb . üb . d . Morgenländ. S tud . 1 87 6 — 7 7
,I , p. lX — XV . K u h n , E r n s t, und
R . P i e t s c hm a n 11 [Jah resbericht :] Al lgeme ine A rbei ten übera l te Ges ch i chte
,u ber Länder und Vö lkerkun de , Cultur und
Re l igionsges ch i chte des Morgen landes : ib . p. 1 — 20 .
[Jahresberichte z] Al lgeme ine S prachw i ssenschaf t und ver
gle i chende G ramm atik der indogerman i schen S prachen : ib.
p. 21 — 3 1 . Z ur vergle i chenden Literaturgesch i chte : ib .
p. 32— 35 . Var ia zur or ienta l i schen Phi lo logie : ib . p. 36 — 38 .
Hinter ind ien : ib . p. 63 — 68. Tibet : ib . p. 69 f. Vo rderind ien : ib . p. 86 — 1 32. Al t-I ran : ib . I I
, p. 1 — 7 .
Miscellen : KZ 25, p. 327 f.
1 . Skr . kum bha und .Z d. klm -m ba . 2. S kr . naleccha und Päli
m ilukkha . 3 . S kr . kacchu r a und kim so . 4 . Zigena . be5ava .
[Jahresber ichte z] H inter indien : W i ss . Jsb . üb . d . Morgen land.
S tud . 1 87 9, p. 21 — 23 . Vorderindien : ib . p. 37 — 6 1 .
Alt-Iran : ib . p. 62— 68 . A rmen ien und Kaukasusländer
ib . p. 7 3 f.
1 883 [Jahresberichte z] Tibet und Hinterind ien : Wiss . Jsb . üb. d .
Morgen land . S tud ien 1 87 8, p. 1 08 — 14 . Vorderind ien
ib . p. 1 56 — 7 8 . Iran,Armen ien , Kaukasuslander : ib . 1 880,
p. 44 56 . Tibet und Hin ter indien : ib . p. 21 6— 22.
Über Herkunft und Sprache der transgangetischen Vö lker.F estrede geha l ten in der ö ffentl i chen S i tzung der Kg].Akadem ie der Wissenschaften zu Mün chen am 25. Ju l i 1 88 1 .
Mün ch en , G . F ranz in Komm iss ion . 22 p. 4 .
Bez . G . cl . Glabelen tz], LC 1884, p. 249 f. ; G ,
Ger lan cl, Geogr.
Jahrbuch 10, I , p. 318 ; W. S chott , DL 1 884, p. 82i. ; 0 . de Hurlez
,
p. 88— 93 (abgedruckt im Indian Antiquary p. 120
1 884 He inr i ch August Jaschke . (Auf Grund der A ufze i chnungene ines se iner früheren S chü ler [Th . Reicheltj) : Lbl. f . orien t .Phi lol . p. 245 — 51 1
.
S iegfr ied Go l ds chm i dt : ib . l , p. 37 9 f.
1 885 Herkun ft und Sprache der Bew ohner Cey lons . Vortrag inder außeror'dentl i chen S i tzung derMünchener anthropologischenGese l l s chaft am 2.Mai 1 885 : Korrespondenzb latt der Deuts chenGese l l s chaft für Anthr0pologie , Ethnologie undUrgesch i ch te 16,p. 4 1 — 45 .
U hs. v . D. F e r g u s o n un ter dem T i tel : Ori gin and languageof th e inhab itants of Cey lon : T he Oriental ist 2, p. 1 12— 1 7 .
1 886 Zur Klarste l l ung : LC 1 886, p. 1 340 .
Z u K . V e rn e r , Z ur F rage der E ntdeckung des Palatalgesetzes,ib . p. 1 707 — 10 .
Bei trage zu : Vo lkssagen aus Pommern und Rugen . Gesamme l tund herausgegeb en von Ulrich J a h n . S tettin, Dannenberg.
Namen tl ich p. VII If. : Li teratur zur Lenorensagc .
[Ber icht über e inen Vortrag von E. Kuhn : Über die Verw andtschaftsv erhältnisse der indis chen Dia lekte im HinduKush “
]z Beri chte des VI I . intern . Orienta l is ten-Congresses geha l ten in Wien im Jah re 1 886
, p. 8 1 .
1 887 Miscellen : KZ 28, p. 214 — 1 63.
1 .
‘
Pä A ltpers.
*R ahä. 2. A r clabur . 3. U ber Ab lei tungenv on Skr . upa
-vz'
é .
1 888 Der Mann im Brunnen,Ges ch ichte e ines indis chen Gle i ch
n i sses : F estgruß an Otto von Böhtlingk (S tuttgartp. 68 — 7 6.
1 889 Bei träge zur Sprachenknnde Hin terind iens : S itzb . Ak . Wiss . M .,
phi los .-phi lo l . und b ist. Kl . , 1 889 , I, p. 1 89 — 236.
B ez . G . v . d. G [abelentz], LC 1 889 , p. 859 f. ; G . Ger lcm d, PMLber . p. 188 f.
[Zur F rage uber die persi s chen Verw andtenheiraten]: Z DMG 43,p. 6 1 8.
Z u dem ib . p. 308 — 12 v oraufgeh endeu A rtike l von H . H ub s c hm an n , U ber die pers ische Verwandt enheirat .
1 895
1 896
[Beri ch t aber e inen Vortrag von E . Kuhn : „Die moderne
,Theosoph ie‘
und der S che in tod der indis chen F Be i l .Al lg . Z tg. 1 894 , Nr . 52, p. 6 f.
Die Theosophis che Gese l l schaft : Mün chene r Neueste Nachri ch ten 1 894 , N r. 5 1 1 .
Vgl. E rw iderung v on L . De i n h a r d ib. Nr. 5 16 .
Nach träge zu [L . E in s le r ,l Mär E ljäsf el-Chadr und Mär
Dsch irjis Z DPV 1 7 , p. 4211,65 111 : Z DPV 17 , p. 303.
Neben anderen auch kurze Notiz v on E . Kuhn .
Zur byzantin is chen E rzab lungsliteratur : Byz. Z . 4, p. 24 1 — 49 .
Vgl. ib . 5 , p. 163 f. und die M i ttei lungen 0 . v on L em m s
ib . 9 , p. 382— 87 . Bez . G . Paris , Roman ia 24 , p. 482 ; C. H .
T ow n ey, A s. Qu . Rev .
, N . S er . 9 , p.400— 402. Der Gegenstand
ist w e i ter v erfolgt in J. S c h i c k s Buch : Das G lückskind m it demT odesbrief. Oriental ische F assungen Corpus Hamleticum 1 , 1 .
Berlin,F elb er, zu dem Kuhn Be i trage ge l iefert hat ; 8 . daselbst
das Vorwort p. X .
Buddh istisches in den apokryphen Evange l ien : Gurupüjä
kaumudi (Leipzig p. 1 1 6 — 1 9 .
Bez . E . von D obschiitz,T h . Lz. 1 896 , p. 442— 46
,der s ich gegen
die Ans ichten Kuhns gänz l ich ab lehnend v erhäl t ; ihm schl ieß t sichan 0 . B ar de n h ew e r , Gesch . (1. altchr istl . Li t. 1 , p. 533. Vgl.
dagegen 0 . S t äh l in in W . v . Christs Gesch . d. griech . Lit . 5 2,2,
p. 1000 Anm .4 .
U ber die Literatur der Himme l und Höllenfab rten : Actesdu Congres in ternationa l des Orien tal i stes (Geneve
part ie, S ection l , p. 89 — 92.
Johann S everin Vater : Al lg. Deutsche Biograph ie 39 , p. 503 — 8 .
In dische Miscellen : KZ 33, p. 4 7 7 — 7 9 .
Päli L äla . 2. Präkr . pupp hä usw . 3. Päli sunhä usw . 4 . Skr .
garu da .
Die Sprache der S ingpho oder Ka-khyen : F estschri ft furAdo l f B astian zu seinem 7 0 . Geburts tage (Berl inp. ses— eo.
[Der S cheintod der Yogins]: Richard G a r b e , Samkhya und
Yoga Grundriß der indoar i schen Ph i lo logie und Al tertumskunde 3
,Heft 4 (S traßburg p. 4 7 f.
1 89 7 K u h n,E .
, und H . S c h n o r r v on Ca r o lsfe ld , Die
Trans cr iption frem der A lphabete. Vorsch läge zur Lösung
XVII
der F rage auf G rund des Genfer„Rapport de la Comm is s ion
de transc r ipt ion “und m it Berücksichtigung von Bibliotheks
zw ecken . Le ipzig, Harrassow itz. 1 5 p.
Bez . H . B oha lta . Ö s t . Lb l. 1897, p. 492f. ; K . B rut/mann ,
IFA nZ . 9, p. 1 — 4 ; G r ulich
,Cbl. f. Bib lw . 14
, p. 304— 06 ;
S [oc in], LC 1897, p. 7 79 f. ; M . S teina hneider
,DL 1899 , p. 57 5 ;
JRA S 1897, p. 653 f. ; I ra M. P r ice, Am . J . of S em . langu . and
lit . 14, p. 133 f. ; Bib l iographe moderne 189 7,Mai ; C. de H [urlez],
L e Muséon 16 , p. 290 f. ; V. H [enry], Rev . cr. d’b ist . et de l itt . 1 897
,
p. 5 18 . Vgl. F . S c e r b o , Le nuove proposte di trascriz ioneGi. S oc . A s. I t . 10, p.
199 — 205.
[Beri cht über einen Vortrag von Ma r t i n : Über psychopathiscbe Zustände bei den Malaieu “
]z Be i l . Al lg. Z tg. 1 89 7 ,
N r. 7 1 , p. 7 .
Mi t Bemerkungen v on E . Kuhn.
1 898 F r iedrich He inri c h Hugo Windischmann : Al lg . DeutscheBiograph ie 43, p. 4 1 8 — 20 .
[Beri ch t uber einen Vortrag von E . Kuhn : Die indo-ar is chenSprachen des Hindnkush “
]z Be i l . Al lg . Z tg. 1 898, N r. 1 5 6 , p. 7 .
1 899 Bier : KZ 35, p. 3 1 3 1.
Vgl. E . S c h r ö de r , A nz. f . deutsch. A l tertum 23 , p. 1 55 f. un d
M. F ör s t e r , A rch . f. d. S tudium d. neueren Sprachen u . Li teraturen 109 ,p.
1 900 E in Br ief Wi l he lm Man n h a r dt’
s an Erns t Kuhn : ZVVk 10,
p. 21 4 — 1 6 .
Mit Vorbemerkung v on E . Kuhn.
Der pa lata le Zischlaut im Kasbmiri : KZ 36, p. 4 60.
1 902 S iames isch : Marksteine aus der We l t l i teratur in Origina ls ch ri ften h rsg. v. Jobs. Ba e n s c b -Dr u gu l in . Leipzigp. 1 09 — 1 2.
Kap. 1 des Dhammapada in siames ischer S chri ft mit L . v .
S ch roeders Uh s. und b ib l iograph ischen Bemerkungen v on Kuhn .
[F riedrich Keinz und Wilhelm Hertz]: S itzb . Ak. Wiss . M.,
phi los .-phi lol . und bist. Kl . 1 902, p. 7 4 — 7 9 .
Berich t über den S tand der Arbe iten an K u h n und S c h e ru1 an s Manua l of Indo -Aryan b ib l iography “
: Verb . d .
1 3 . O rienta l i sten-Kongresses (Hamburg p. 82f.
Vgl. auch A lmanach Ak . Wiss. W. 52, p. 215— 1 7 . 224 .
Festsch rif t Kuhn II
XVI I I
1 904
1 906
Die Verw andtschaftsverhaltnisse der Hinduku sh-Dia lekteAlbum Kern . 0pstellen geschreven ter eere van Dr . H . Kern(Lei den p. 221 — 23.
Vgl. dazu G. G r i e r s o n , T he Pisaca languages of Nort hW estern India (London p. III £
Der Einfluß des ar ischen Indien s auf die Nachbarlander im
S üden und Osten . Rede beim Antr i tt des Rektorats derLudw ig-Maxim i l ians -U n i vers i tät geha l ten am 21 . November1 903. München
,Dr . v. Wol f und S ohn . 28 p. 4 .
[Edmund Ha rdy]: S itzb . Ah . Wiss. M., ph i los . -phi lol . u . bist.
Kl .,1 904 , p. 528 1.
Im Anschluß an den ib . p. 526 f. v on K . Th . v on B e i g e l gegebenen Bericht über die v on Hardy bei der Münchener Akadem ieerrichtete S t if tung.
Das Vo l k der Kamboja b ei Yäska : Avesta, Pah lavi , and
An c ien t Persian S tudies in honour of the late Peshotanj i Behrarnj i S anjana . 1 “t ser ies (S traßburg andLe ipzigp. 21 3 f .
Vgl. G. A . G r i e r s on und G . K . N a r im an,JRAS 19 12
,
p.ass— 57 .
[Außerungen über den neuen Jahresberi ch t der DMG und
se in Verhäl tn is zur OB]: ZDMG 58, p. LIX f .
B e r g h van E y s inga , G . A . v an den,Indi s che Einflüsse
auf evange l is che Erzäh l ungen . Mit einem Nachw ort von
Erns t Kuhn . F orschungen zur Re l igion und Literaturdes Alten und Neuen Testam en ts , hrsg . v. W. Bousset und
H . Gunke l . Hef t 4 .) Gö tt ingen , Vandenhoeck und£Ruprecht, 1 904 .
Kuhns Nachw ort : p, 102— 1 04 . 2. v erm . Aufl. 1 909 : KuhnsNachw ort : p. 1 16 — 1 8.
Versu ch e iner Übersi cht der S chri ften Theodor Noldeke’
s
Oriental is che S tu dien Theodor Nöldeke zum 7 0 . Geburtstaggew i dmet v on F reunden und S chülern und in deren Auftragherausgegeben von C . Bezo l d (Gießen p. XIII — LI.
Verb . und v erm . S onderabdruck u . d.T . Übersicht . ib . 1907 .
48 p. Bez . C. Bezold, DL 1 909, p. 983f.
Johann Kaspar Z euß zum 1 00 j ährigen Gedachtnis. F estrede
geha l ten in der öflentlichen S itzung der K . B. Akadem ie derWissenschaften zu München zur Fe ier ihres 14 7 . S tiftunge
XIX
tages am 1 4 . März 1 906 . München,G . F ranz in Komm i ss ion .
30 p. 4 .
[ Fr ied r ich von S piege l ]: S itzb . Akl Wiss . M.
, ph i los .-ph i lol .und b ist. Kl . 1 906 , p. 2365— 68 .
Noch e inma l S t. Hubertus : Bei l . Al lg . Z tg. 1 906,IV
, p. 270 .
Z u E . N e s t l e ,ih. p. 246 mit Hinw eis auf etwaigen bud
dhist ischen E influß .
Bessisch : ZDMG 6 l, p. 7 59 .
Z u dem ib . p. 500 f. voraufgehenden A rtikel v on E . N e s t l e ,
Bessisch .
1 9 1 0 F ranz Niko laus F inck : JGLS , N . S er . 4, p. 8 1 — 83 .
1 9 12 Zu den ari s chen Anschauungen vom Kön igtum : Fes ts chri ftVi l he lm T hornsen zur Vo l lendung des 7 0 . Lebensjahresdargeb rach t (Le ipz ig p. 21 4 — 21 .
1 9 14 Übersi ch t der S chri ften von Erns t Windis ch : F estschri ftErns t Windisch zum 7 0 . Gebu rtstag dargebracht (Leipzig
p. see- so.
Beiträge zu : Richard G a r b e , Ind ien und das Chris tentum.
Tüb ingen,Moh r
,1 9 14 .
S . daselbs t das Vorw ort p. V .
II. R e zen s ion en .
S uomalais-ugrilaisen seuran a ik ak a u sk irj a . Journa l de la société
finno-ougr ienne . l (Helsingissä Lbl. 1. or . Ph i lo l . 3, p.
P . Ba t a i lla r d , S ur les origines des Bohém iens ou Tsiganes .Les Tsiganes de l ’äge du b ronze (Pa r i s LC 1 87 6 , p. 1455 .
J . Beam e s , A comparative grammar of the modern Aryan languagesof India . Vol. 2 (London Jenaer Lz. 1 87 6
, p. 269 1.
J . F . B l um h a r d t , Cata logue of Bengal i pr inted books in the
Library of the Br i t ish Museum (London Lbl. f. or . Phi lo l . 3,p. 1 24 * f.
A. B o l t z , Das F rem dw ort in se iner ku l turhis toris chen Entstehungund Bedeutung (Berl in KZ 20
, p. 7 6 .
L . B r u ey r e , Contes popu la i res de la Grande-Bretagne (Par i s 1 87 5)LC 1 87 6, p. 1 1 7 .
XXH . B r u n n h o i e r , Über den U rsitz der Indogermanen (Base l 1 884)Lb l. f . or . Ph i lo l . 3, p. 33 *
Neuere Literatur über den B u d d h i sm u s : Beil . Al lg. Z tg. 1 89 7 ,
N r. 1 83, p. 7 .
R. C . C h i l d e r s,A dictionary of the Pal i language (London 1 875)
Jenaer L z. 1 87 6 , p. 4 1 2f.
E . B. C ow e l l,A short in troduction to the ordinary Prakrit of
the S anskrit dram as (London LC 1 8 7 6, p. 442.
Gr. C u r t i u s , Er l äuterungen zu m e iner gr iech is chen S chulgrammat ik 2(Prag KZ l9 , p. 307 — 09 .
Vgl . E . W i n d i s c h : il) . 21 , p. 4o6 f.
Ph . D i e t z , Wö rterbu ch zu Dr . Martin Luthers deutschen S chr iftenBd. 1 (Leipzig KZ 19
, p. 386 .
O . Don n e r , Pindapitryajna , das Manen0pfer m it Klößen bei denIn dem (Berl in KZ 20
, p. 7 5 f.
O . Don n e r , Der Mythos vom S ampo (He l s ingfors LC 1 872,
'
p. 96 1 .
E . En g e l,Die Aussprache des Griech is chen : Wochenschr . f. klass .
Phi lo l . 1 887 , p. 1 345 — 4 7 .
T he Jataka , together w ith its commentary . Pub l ished by V .
F au s b ö ll. Vol. 1, par t 1 (Lon don Jenaer Lz. 1 87 6 ,
p. 269 .
F . N . F i n c k , Leh rbuch des Dia lekts der deutschen Zigeuner(Marburg LC 1 905
, p. 1 506 f.
F . N . F in c k , Die Sprache der arm en is chen Zigeuner (S t. Petersburg JGLS N . S er . 2, p. 6 7 — 7 4 .
Vgl. A . 1V[ eillet,JA Ser . K, T . 13, p. 835— 37
,der über die S chrift
v on F inck und über die Rezension Kuhns referiert .R. 0 . F r a n k e , Ges ch i ch te und Kriti k der e inhe im i s chen Pal iGramm atik u nd Lexikographie (S traßburg DL 1 903
,
p. 1 590 f.
M . F r e r e , Marchen aus der ind ischen Vergangenhe i t. Übersetztv on A . P a s s ow (Jena LC 1 874
, p. 1 342.
G . G e r l a n d , Al tgr iech ische Marchen in der Odyssee (MagdeburgLG 1869
, p. 1 21 5 1.
XXI
L . G o n ze n h a c h , S icilianische Märchen (Leipzig LC 1 870,p. 598 f.
J . G . Th . G r ü s s e,Hubertusbrüder (Wien LC 1 87 6
, p. 1 1 7 .
G . A . G r i e r s o n , Bihf u peasant l i fe (Ca l cutta Lbl. f. or .
Ph i lo l . 3 , p. 8 1 * f.
J . G r u u ze l , En tw u r f e iner verglei chenden Grammatik der altaischenSprachen (Le ipzig Be i l . Al l g. Z tg. 189 7 , N r . 1 85 , p. 7 .
A . de G u b e r n a t is , L e nov el l ine d i S anto S tefano (Torino 1 869)Z . f . deu tsche Phi lo l . 2, p. 530 — 132.
F . H a a g,Vergle i ch ung des Prakr i t m it den roman is chen Sprachen
(Ber l in KZ 19, p. 1 60 .
J . G . v . H a h n , S agw issenschaftliche S tu dien. Lie ferung 1 und 2
(Jena LC 1 872, p. 9 94 f. ; 1 8 7 3, p. 1 5 1 .
K . A . H a h n,Al thochdeutsche G rammatik . Zw e i te Auflage be
arbe i tet von A . Jeitteles (Prag KZ 1 7 , p. 1 5 1 .
M . H a u g,Brahma und die Brahmanen (München LC 187 1
,
p. 1 300 .
B. H . H o d g s o n , Essays on the languages,l iteratu re and re l ig ion
of Nepal and Tibet (London Jenaer Lz. 1 87 5, p. 424 .
L . v . H ö rm a n n,My tho logische Bei trage aus W iilscbtirol (Inns
b ruck 1 87 0) : 1A3 1 87 1 , 1r 1 1 0 t
A . H o l t zm a n n, Deu tsche Mythologie (Leipzig LC 1 874
,
p. 12329 1.
Vgl. die zustimm ende Bemerkung v on E . S i e v e r s , Jenaer Lz . 1875,
p. 318 .
E . H ü b n e r , Bib l iograph ie der k lassi schen A ltertumsw issenscbaffi(Be r l in A rch iv für lat. Lexikogr . 6 p. 305 f.
Jigs-m ed nam -mk‘
a. Gesch i ch te des Buddhismus in der Mongo lei .Aus dem Tibetis chen h rsg ., übersetzt und er läutert von Gg.
H u t h . Te i l I . 2 (S traßbu rg 1 893 DL 1 894 , p. 9 9 7 f. ;
1 89R p. 1 745 £
T he Chandoratnäkara of Ratnäkaras'
änti. S anskrit text w i th a
Tibetan trans lat ion ed. by Gg. H u t h (Ber l in DL 1 89 1 ,
p. 1 232.
Gg. H u t h,Die Tibet is che Vers ion der Naibsargikapräyaécittika
dharmas (S traßburg DL 1 89 1, p. 1 232.
XXI I
M. J a h n s , Boß und Rei ter in Leben und Sprache, Glauben und
Gesch ich te der Deutschen. Bd. 1 und 2 (Le ipzig LC 1 872,p. 99 6 f. ; 1 873, p. 1 53.
J o u rn a l of the Gypsy Lore S ociety . New S eries Vol. 1 (Edinb u rgh 1 907 GGA 1 908
, p. 708 — 1 1 .
A. Ka egi , T he Rigveda, the o l dest l iterature of the Indiana.
Author ized trans lat ion by R . A r r ow sm i t h (Bos ton 1 886)Lbl. 1. or . Ph ilo l . 3, p. 1 1 6 *f.
Ka v a sj i E da lj i K an g a , Ya9na and Vispered trans lated intoGuj erati (Bom bay Lbl. f. or . Phi lol . 3
, p.
H . K e r n , Over de jaartelling der zu idelryke Buddhisten en de
gedenkstukken van Acoka den Bu ddhis t (Ams terdamJenaer Lz. 1 874 , p. 5o4 i.
Wrttasancaya , oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kaw itekst
en nederlandsche vertaling bew erkt door'
H. K e rn (Le iden 187 5)LC 1 8 7 6
, p. 1590 .
F . v. K ob e l i , Über Pflanzensagen und Pflanzensymbolik (Muncheu
LG 1 8 7 6 , p. 1 1 7 .
F . Kr eu t zw a ld,E bstnische Märchen . Übersetzt v on F . L ow e
(Ha l le LC 1 869, p. 1 246 .
B. L an gk a v e l , Botan ik der späteren Griechen v om dritten b is
dreizebnten Jahrhunderte (Ber l in KZ 16 , p. 450 .
Ch . G. L e l an d,T he Engl is h Gips ies and the ir language (London
LC 1 87 4, p. 4 64 f.
A . L u dw i g,Agglut inat ion oder Adaptat ion ? (Prag LC 1 873
,
p. 20 — 22.
A . Ma r a z z i , Teatro sce l to in diano. Vol. 2 (Milano LC 1 874,
p. 1 524 .
J . Min ay e f, Gramma ire pa l ie. Traduite par S t. G uy a r d (Par isLC 1 87 4 , p; 1 523 f.
E . M ü l l e r , A simplified grammar oft the Pal i language (LondonLbl. f. or . Phi lol . 2, p. 380 f.
Buddhist texts from Japan ed. by F . M. M ü l l e r (Oxford 1 88 1 )DL 1 882, p. 638 .
XXII
M.J a h n s , Roß und Rei ter in Leben und Sprache , Glauben und
Gesch i chte der Deutschen. Bd. 1 und 2 (Le ipzig LC 1 872,p. 9 9 6 f. ; 1 873, p. 1 53.
J o u rn a l of the Gypsy Lore S ociety . New S eries Vol. 1 (Edinb u rgh 1 907 GGA 1 908, p. vos - 1 1 .
A . K a egi , T he Rigveda, the o l des t l iterature of th e Indians .Authorized trans lation by R. A r r ow sm i t h (Bos ton 1 886)Lb l. 1. or . Philol . 3, p. 1 1 6 *f.
Ka v a sj i E da lj i K an g a , Yacna and Vispered trans lated intoGujerati (Bombay Lbl. f. or . Phi lol . 3
, p.
H . K e r n , Over de jaartelling der zu idelgke Buddh isten en de
gedenkstukken v an Acoka den Buddhis t (Am sterdamJenaer Lz. 1 874
, p. 504 f.
Wrttasancaya, oudjavaanscb leerdicht over v ersbouw in Kaw itekst
en nederlandsche vertaling bew erkt door'
H. K e r n (Le iden 187LC 1 87 6
, p. 1 590 .
F . v. Ko b e ll , U ber Pflanzensagen und Pflanzensymbolik (MünchenLC 1 87 6 , p. 1 1 7 .
F . Kr e u tzw a ld,E b stnische Märchen . U bersetzt von F . L ow e
(Ha l le LG 1 869, p. 1 246 .
B. L angk a v e l , Botan i k der späteren Griechen v om dr itten bisdrei zehnten Jahrhunderte (Ber l in KZ 16 , p. 4 50 .
Ch . G. L e l a n d, T he Engl i sh Gips ies and the i r language (London
LC 1 874 , p. 4 64 f.
A . L u dw i g,Agglutinat ion oder Adaptation ? (Prag LC 1 87 3
,
p. 20 — 22.
A . M a r a z z i , Teatro sce l to indiano. Vol. 2 (Milano LC 1 874,
p. 1 524 .
J . Min ay ef, Gramma ire pa l ie. Traduite par S t. G uy a r d (ParisLC 1 87 4 , p. 1 523 1.
E. M ü l l e r , A simplified grammar oft the Päli language (LondonLbl. f. or . Phi lo l . 2
, p. 380f.
Buddh ist texts from Japan ed. by F . M . Mü l l e r (Oxford 1 881)DL 1 882, p. 638.
XXII I
F . N er o , Les époques l i ttéra i res de l’
lnde (Bruxe l les 1 883)Lb l. o r. Phi lo l . 2, p. 35 — 37 .
H . O e s t e r ley ,Ba ital Pach is i oder die 25 E rzablungen e ines
Dämon (Leipzig LC 1 87 3, p. 85 f.
C . P a u l i,Über die Benennungen der Körpertheile bei den Indo
germanen (S tettin KZ 1 7 , p. 233 f.
Vgl. B . De l b r ü c k,Z . f . deutsche Ph i lol . p. 1 55.
E . D. P e r ry ,A S anskri t pr imer based on the Le i t faden fur den
Elementar-Cu rsus des S anskri t of Gg. B ü h l e r (Bos tonLb l. 1. or . Phi lo l . 3, p. 1 1 6 * f.
E . P i le ide r e r , Theorie des Aberglaubens (Ber l in LC 1 873,p. 1 03 1 .
R . Pis c b e l „Bei träge zur Kenntni s der deutschen Zigeuner (Ha l le
Z VVk 5 , p. 218 1.
W. R a dlo if,Proben der Vo l k s l iteratur der nodlichen türk is chen
S tämme . Tei l 5 — 6 (S t. Petersbu rg 1885 Lb l. f. or .
Phi lo l . 3, p. 1 1 3 * — 1 1 6 *
W . R . S . R a l s t o n ,Russian iolk- ta les (London LC 1 874
,
p. 429 i.
K . R e g e l , Die Ruhlaer Mundart (We imar KZ 20 , p. 72— 7 5.
F . S c h ie r n ,Über den U rsprung der S age von den goldgrabenden
Ame i sen (Leipzig und Kopenhagen LC 1 874 , p. 429 .
J . S c hm i d t , Die Verw andtschaftverhaltnisse der indogerman i schenS prachen (Weimar KZ 21
, p. 4 7 5 f.
W. S c hm i d t , S lapat rägäw an datow smim roh . Buch des Rägäw an, der Königsgeschichte (Wien GGA 1 908 , p. 94 — 98 .
W . S c hm i d t , Die Mon-Khmer-Vo l ker, ein Bindegl ied zw ischenVö lkern Zentra lasiens und A ustronesiens (Brauns chw eig 1 906)Be i l . Al lg . Z tg. 1 907 , I , p. 586 — 88 .
U nter dem Tite l :„E ine neue E ntdeckung auf dem Geb iete der
h int er indischen und malaio-po lynesischen Sprachenkunde“
C. S c h o e b e l , Recherches sur la rel igion prem iere de la raceindo— iran ienne 2 (Paris LC 1 873, p. 260.
F . S c h o l l e , Über den Begri ff Toch tersprache (Berl in 1 869)KZ 19
, p. 26 7 .
XX IVJ . K . S c h u l l e r , Be i trage zu e inem Worterhuch der s ieb enbü rgischsächs ischen Mundart (Prag Zur F rage über die Herkun ft der S achsen in S iebenb ürgen ? (Prag KZ 1 7 , p. 1 5 1 f.
M . S e sh agir i S a s t r i , Notes on A ryan and Drav i dian ph ilo logy .
Vol. 1 (Madras L bl. 1. or . Phi lo l . 3, p. 4 9 * f.
K . S im r o c k,Handbu ch der deutschen Mvthologie 3 (Bonn 1 869)
Z . 1. deutsche Phi lo l . 2, p. 374— 7 6 .
M. A . S t e i n ,Deta iled report of an archaeo logical tour w ith the
Bauer fie l d force (Lahore DL 1 900, p. 688 f.
B. W e r n ek e,Über di e Bedeutung des Lau tes in der Sprache
(Paderborn KZ 1 7, p. 1 50 f.
K . W e r n e r , Die Rel igionen und Cult-e des v orch r is tl i chen He i denthums (S chaflhausen LC 1 872, p. 9 96 .
J . W o rm s t a ll,Die Herkunft der F ranken von Troja (Münster
KZ 19, p. 7 7 1.
I. V. Z inge r l e , Kinder und Hausmärchen aus Tiro l ? (Gera 1 87 0)LG 1 87 1 , p. 1 1 1 .
HI . T ätigkeit als Her au sgeb er .
A. Z e i t s c h r i f t e n u n d Ä h n l i c h e s .1 87 3 fi
"
. Ze i ts chr ift f ür v ergle i chende Spracbforschung. Begründetvon Ada lbert K u h n . Bd 21 fl
°.
Bd. erschi enen un ter dem Ti tel Zei tschri ft für v erglei chendeSprachforschung auf dem Geb iete des Deutschen
,Griechi schen und
Late in ischen ; Bd. 23— 40 un t er dem Tite l Zei tschr ift auf dem
Geb iete der in dogerman ischen Sprachen ; Bd. un ter dem Tite lZei tsch rift Neue F olge v erein igt rni t den Bei trägen zur
Kunde der indogerman ischen Sprachen .
Bd. un ter Mi twirkun g v on E . K u h n hr sg. v on A. K u h n ;Bd. un ter Mi twirkung v on E . K u h n ,
A . L e skien und
J . S c hm i d t hrsg . v on A . K u hn ; Bd. hrsg . v on A . K u h n ,
E . K u h n und J . S c hm i d t ; Bd. hr sg. v on E . K u hn und
J. S c hm i d t ; Bd. 38— 40 hrsg. v on E . K u h n und W. S c h u l z e ;Bd. hrsg. v on A . B e z z e n b e r ge r , E . K u h n undW . S c hu l z e.
Bd. 21 — 27 Berl in , Dümm ler , 1 873— 1 885 ; Bd. 28— 40 Gütersloh ,
Berte lsmann ,1 887 — 1 907 : Bd. 4 1 — 47 Gött ingen, Vandenhoeck und
Ruprecht 1 907 — 1 9 15 .
XXV
1 87 9 ti"
. W is sens cha ftl i cher Jahresber ich t uber die Morgen l ändis chenS tudien . Le ipzig, Brockhaus in Comm i ss ion .
Von Oktober 1 87 6 b is Dezember 187 7 hrsg . v on E . K u h n und
A . S o c i n 1879 . Im Jahre 1878 hrsg . v on E . K u h n 1883. Im Jahre1879 und 1 880 hrsg. v on E . Ku h n und A . Mü l l e r 1881 und 1883 .
1 883 88 Literatu rb latt fur or ien ta l is che Phi lo logie unter Mitw irkungvon J . K l a t t h rsg . v on E . K u h n . 4 Bde . Leipzig, OttoS chu lze .
O r iental ische Bib l iographie begründet von Augus t M ü l l e r .Bd. 6 Ber l in
,Reuther und Re i chard .
Bd. 6 — 8 hrsg. v on E . K u h n ; Bd. 9 11 . hrsg . v on L . S c h e rm a n,
und zw ar Bd. 9— 17 unter Mi tw i rkung von E . K u h n ; Bd. m it
b esonderer Be ih i l fe v on E . K uh n .
Grund r iß der i ran i schen Phi lo logie unter Mi tw irkung v onChr . Bar tholomae und E . W . West hrsg. von W . G e i g e rund E. K u h n . Bd. I, 1 . 2 und Anhang. II . S traßb urg
,T rübner .
B. E i n z e l n e W e r k e .
1 875 Co r ss e n , W i l h e l m ,Über die Sprache der Etr usker. Bd. 2.
Leipzig, T eubner .
Vorw ort v on E . Kuhn .
K u h n,A d a l b e r t , Mythologische S tu dien . Hr sg . v on
E . K u h n . 1 . Bd. : Die Herabkunft des Feuers und des
Göttertranks . 2. v erm . Abdruck . 2. Bd. : Hin terlassenemytho logis che Ab han d l ungen . Güters loh , Berte l smann .
1 888 F estgruß an Otto v on B öh t lingk zum Doktor -Jub ila uru3 . F eb ruar 1 888 v on se inen Freunden . S tuttgar t, Kohlhammer .
1 893 F estgruß an Rudo l f von R o t h zum Doktor-Jub i läum 24 . August1 893 von se inen F reunden undS chü lern . S tut tgart, Kohlhamm er .
W idmung v on E . Kuhn .
1 895 Gurupüjäkaumudi. Fes tgabe zum fünfzi gj ährigen Doktorjub i l äum Albrecht W e b e r dargeb racht v on se inen Freundenund S chu lern. Le ipzig, Harrassow itz.
1 9 1 2 Fes tschrif t Vi l he lm T h om s e n zu r Vollendung des 7 0 . Lebensjahres am 25 . Januar 1 9 12 dargeb racht von F reunden und
S chü lern . Le ipzig, Harrassow itz.
XXIVJ . K . S c h u l l e r , Be i trage zu einem Worterbu ch der s ieb enbürgis chsächs is chen Munda rt (Prag Zu r Frage über die Herkunft der S achsen in S iebenbü rgen ? (Prag KZ 1 7 , p. 1 5 1 1.
M . S e sb agir i S a s t r i , Notes on Aryan and Dravidian philo logy.
Vol. 1 (Madras Lbl. f. or . Phi lol . 3, p.
K . S im r o c k , Handbuch der deuts chen Myt ho logie 3 (Bonn 1 869)Z . 1. deutsche Phi lol . 2, p. 374 — 7 6 .
M . A . S t e i n ,Detai led report of an archaeologica l tour w ith the
Buner fie l d force (Lab ore DL 1 900, p. 688 1.
B. W e r n ek e,Über die Bedeutung des Lautes in der Sprache
(Paderborn KZ 1 7, p. 1 50 1.
K . W e r n e r,Die Re l igionen und Cu lte des vorchr istl i chen Hei den
thums (S chaflhausen LC 1 872, p. 9 96 .
J . W o rm s t a ll , Die Herkunft der F ranken von Troja (MünsterKZ 19
, p. 7 7 i.
I . V. Z inge r l e , Kinder und Hausmarchen aus Tirol ? (Gera 1 87 0)LC 1 87 1
, p. 1 1 1 .
III. T ätigke it als Her au sgeb er .
A . Z e i t s c h r i f t e n u n d Ä h n l i c h e s .1 873 11. Ze i tsch r i ft fur vergle i chende Sprach forschun g. Begründet
von Ada lbert K u h n . Bd. 21 fl°.
Bd. ersch ienen un ter dem Tite l Zei tschrift fur v ergleichendeSprachforschung auf dem Geb iete des Deutschen
,Griech ischen und
Latein ischen ; Bd. 23 — 40 un ter dem Titel Zeitschrift auf dem
Geb iete der indogerman ischen Sprachen Bd. un ter dem Ti telZeitschrift Neue F o lge v erein igt mit den Beiträgen zur
Kunde der in dogerman ischen Sprachen .
Bd. unter M i tw irkung v on E . Ku h n hrsg. v on A . Ku h n ;
Bd. unter Mi tw i rkung v on E . K u h n,A . L e skien und
J . S c hm i d t hrsg . v on A . K u h n ; Bd. 25 hrsg . v on A . Ku h n ,
E . K u h n und J . S c hm i d t ; Bd. hrsg. v on E . Ku h n und
J . S chm i d t ; Bd. 38— 40 hrsg . v on E . Ku h n und W. S c h u l z e ;Bd. hrsg . v on A . B e z z e n b e r ge r , E . K u h n undW. S ch u l z e.
Bd. 21 — 27 Berl in ,Dümmler
,1873— 1 885 ; Bd. 28— 40 Gütersloh ,
Bertelsmann ,1 887 — 1 907 ; Bd. 4 1 — 47 Göttingen, Vandenhoeck und
Ruprecht, 1 907 — 19 15.
XXV1 87 9 ti
"
. lsseuschaftlieher Jah resber i ch t über die MorgenlandischeuS tud ien . Leipzig, Brockhaus in Comm i ss ion .
Von Oktober 1876 b is Dezember 187 7 hrsg . v on E . K u h n und
A . S o c i n 187 9 . Im Jahre 187 8 hrsg . v on E . K u h n 1883. Im Jahre1879 uud 1880 hrsg. v on E . Ku h n und A . Mü l l e r 1 88 1 und 1883 .
Literaturb latt fur orien tal ische Phi lo logie unter Mitw irkungvon J . K l a t t hrsg . v on E . K u h n. 4 Bde . Leipz ig, OttoS chu lze .
1 893 fl“. O r ienta l is che Bib l iographie begründet von August M ü l l e r .
Bd. 6 Berl in,Reuther und Re i chard .
Bd. 6 — 8 hrsg. v on E . K u h n ; Bd. 9 11 . hrsg . von L . S c h e rm a n,
und zwar Bd. 9— 17 unter M itw i rkung von E . K u h n ; Bd. 18 11 . m it
besonderer Be ih i lfe v on E . Ku h n .
G rundriß der i ran is chen Phi lo logie unter M i tw irkung vonChr . Bartholomae und E . W . West h rsg . v on W . G e i g e rund E . Ku h n . Bd. I
,1 . 2 und Anhang. I I . S traßburg
,T rübuer .
B. E i n z e l n e W e r k e .
1 87 5 Co r s sen ,W i l h e l m
,Über die S prache der Etrusker. Bd. 2.
Le ipzig, T eubner .
V orwort v on E . Kuhn .
K u h n ,A d a l b e r t
,Mytho logische S tu dien . Hrsg . v on
E . K u h n. 1 . Bd. : Die Herabkunft des F euers und des
Götter tranks . 2. verm . Abdruck . 2. Bd. : Hin ter lassenemy thologis che Abhand l ungen . Güters loh , Berte l smann .
1 888 F estg ruß an Otto von B o h t l iugk zum Doktor - Jub i läum3 . Februar 1 888 von se inen F reunden. S tuttgart, Koh lhamm er .
1 893 F estgruß an Rudo l f von R o t h zum Doktor-Jub i l äum 24 . August1 893 von se inen F reunden undS chülern. S tuttgart,Koh l hammer .
\V idmuug von E . Kuhn .
1 895 Gurupüjäkaumudi. Fes tgabe zum fünfzigj ahrigen Doktorjub i l äum Albrecht W e b e r dargebrach t v on se inen Freundenund S chu lern. Leipzig, Harrassow itz.
1 9 1 2 F es tsch r i f t Vi l he lm T h om s e n zur Vo l lendung des 7 0 . Lebensjahres am 25 . Januar 1 9 1 2 dargebracht v on F reunden und
S chü lern . Leipzig, Harrassow itz.
2 E rnst W indisch
e inzelner Jatakas w i chtige Pälitexte a l l geme in zugängl i ch mach te.
Von Chi l ders ’„Di c tionary of the Päli Language “
w ar Part 1 er
sch ienen London 1 8 72. Was Kuhn 1 87 5 benutzen konnte, istin dem „
Verze i chn is der vorzugsw e ise zi tierten Werke“enthal ten
,
das er p. Vll fg. seiner Ein le itung voranges te l l t hat. Dieses ist
zuglei ch ein erstes Spe cimen v on Kuhns b ib l iographischer Neigungund se iner Kenntnis der ge lehrten Literatur auf dem Gesam tgeb ieteder ind ischen Al tertum skunde, in der er seinesgleicben su cht.Möchte es ihm . v ergönut se in, im Vere in m it S chem an ba ld dasgroße b ib l iograph is che Werk veröffentli chen zu können , das diege lehrte We l t v on ihm erw artet. Daß Kuhn als Sprachforschers ich n i cht auf das In dogerman is che beschränk t
,sondern durch
se ine Un tersu chung des S inhalesischen und der transgaugetischen
Sprachen w i ch tige Beitr äge zur a l l gemeinen Sprachforschuug
ge l iefert hat,ist ein w e iteres Verdienst , das er nur m it
w enigen te i l t.S e it 1 87 5 hat die buddh isti s che Fors chung gew a l tige Fort
s chritte gem ach t,in den verschiedensten Rich tungen. Durch die
Texte der v on Rhys Davids gegründeten Päli Text S oc iety , durchOldenbergs Ausgabe des Vinaya Pitaka, Fausbölls Ausgabe des
Jataka w urden die Quellenw erke des a l ten Buddhism us a llgeme inzugängl ich . Die Lehre Buddhas und die Entw i ck lung des Buddhismus traten immer k larer vor unser Auge . Es versteht s i chvon se lbst
,daß Buddha dur ch die brahmanischeu Ans chauungen
seiner Ze i t bee influßt w orden sein muß. Welche S ch i chten der
brahmanischeu Literatur in Betrach t kommen,hat O l d en b e r g in
seinem Buche „Die Lehre der U panischadeu
‘
und die An fängedes Bu ddhi smu s “ (1 91 5) neuerd ings eingehen d Bud
dhisten und Brahmanen leb ten in Ind ien jahrbuuder telaug neben
e inander. Wenu sie s i ch au ch mehr oder w en iger fe in dse l iggegenüberstanden, mußten sie s i ch doc h gegense i t ig bee influssen.
Bis j etzt ist beson ders klar gew orden , w ievie l die Buddhisten zu
jeder Zei t von der brahmani schen Literatur ent lehnt haben. Denn
der Dhamma und der S angha w ar in se iner ersten An lage und
in se inem ursprüngl ichen Gei ste vollständig il l iterat. Im VinayaPitaka, das uns so ans chaul i ch die Einr ichtung des äußeren Lebens
1) Vgl. meine Anzeige im Li t. Z entralbl. 191 5 Nr . 4 1 .
Brabmauischer E influß im Buddh ismus 3
der Bhikkhus vor Augen führt, i st nirgends von S chre ibutens i l iendie Rede , feh l t jede Erw ähnung e ine r l i teraten Beschäft igung derBhikkhus. Dies ist im Lau fe der Ze it anders gew orden . Die in
den S angha eintretenden Brahmanen brach ten ih re Kenntni sse und
ihre l i terar is chen Gew ohnheiten m it . Die S uttas des S uttapitakam it i hrer Rahmenerzäb luug er innern an die l i teraris che Form der
äl teren Upanischadeu . Die Atthakathä entspri ch t den Bhäsyas
der Brahmanen. Während Beufey annahm,daß die Tierfabe l
in buddhis tis chen Kre isen ausgeb i l det w orden sei, hat Herte l nachgew iesen , daß das Paficatantra brahman i s chen Ursprungs ist. In
w ie fr eier Wei se aber die Buddh isten die brahman is chen S toffebenutzten und veränderten, tri tt uns nam entl i ch in den Jatakasen tgegen, w ie E . Hardy, Luders und andere an e inze lnen Beispielen gezeigt haben . Das gl änzendste Be i spie l der Überführungder brahmanischeu Literaturformen in den Buddhism us liefertA8vaghoea m it seiner durch Cow e l l b ekanntgew ordeueu kuns tvol lenDi chtung Buddhacar ita und seinem Drama Säriputraprakarana,durch dessen Entdeckung auf a l ten Pa lmb lättern aus Turfan si c hLuders und se ine Gattin ein ble ibendes Verd ienst erw orben haben .
Er v eroflentlicbte die F ragmente in se iner Abhandl ung „Das Säri
putraprakarana , ein Drama des A8vagbosa“
,in den S itzungs
beri chten der Kgl. Preuß . Ak . d . W .
, ph i l . bist . Kl . 1 9 1 1 . S ogardie Logik des Nyaya haben s i ch die Buddhisten zu e igen gemach t,w ie die von Peterson au fgefundene und 1 889 veröffent l i chteNyäyabiudutikä des Dbarmottaräcärya bew ei s t.
Innerha lb der e igen tl i chen Lehre sind die w i chtigste E ntlehuung die Mora l gebote, in denen Buddhisten und Brahmanenauf gle i chem Boden stehen. E s w ir d mit der Wich tigkeit desGegen standes zusammenhängen, daß sie im 1 . und im 2. S uttades S uttapitaka vol l s tändig m i tge te i l t s ind . Wenn auch ih re Abs tu fung in cüla majjl u
’
m a und m ahä-éilam sow ie vie les einze lnein d ieser großen Zusammen fassun g spezifis ch buddhist is ch i st, so
i s t es doch n i cht s chw er,die Hauptgebote und einen großen Te i l
der anderen Bes timmungen im brahmanischeu Dharmaéästra,in
den a l ten Dharmasütreu und im Mahabharata nach zuw eisen . Ich
muß ab er h ier auf diesen Nachw ei s verzich ten und beschränkem i ch auf zw e i legendari s che Ges ta l ten, deren Eigenart aus der
brahmanischeu Legende erk l ärt w erden kann . Verw andter Art1*
4 E rnst W indisch
i st mein Beitrag zur F estschri ft fur A. Web er : „Das T ittirajätaka
Nr.
Wenn die jetzt vorl iegenden Rezens ionen des Mahäbharata n i cht so alt w ie die äl tes ten buddhisti s chen Texte se inm ögen , so enthal ten sie doch a l ten S toff, der aus innern Gründen ,m anchma l auch schon in ähn l i cher F orm ,
in vorbuddhisti s cherZe it vorhanden gew esen se in muß. Vgl . L u d e r s , ZDMG LVII I,p. 7 13.
1 . Ma u dg a ly ä y a u a .
In der spä teren Literatur des Buddh ism us spie len v on den
Jüngern Buddhas Sär iputra und Maudgalyäyana eine große Ro l le.
Man könnte sie in gew issem S inne mit dem S t . Pau l und S t. Peterder a l ten chris tl i chen Kirche vergle i chen . Na ch dem MahävastuI I I 63
,1 7 ist der eine der erste der an We ishe i t Großen
,der
andere der erste der an Wunderkraft Großen : eko agro m ahäpra
j üänäm aparo agro m aharddlzikänäm. Maudgalyäyana w ar in den
Himme ln bekannt, se ine Wunderkraft äußerte s i ch dar in, daß er
si ch jeden Augenb l i ck in eine der anderen We l ten begeben konnte.
Als er zu früh zum Be tte ln na ch Räjagrha gekommen w ar,be
s ch l ießt er , zuvor den S uddhäväsa-Göttern einen Besu ch ahzustatten, Mahävastu I 34, 1 5. Im An fang des Mahävastu ist dem
ersten Hauptte i le der E utw icklungsgescbichte Buddhas e ine merkw ürdige Ein le i tung vorangeste l l t, die ausfüh rl i ch von d iesen Be
su chen des Maudgalyäyana in den Hölleu und in den Himme lnberi chtet. Eine ers te Bes chre ibung der acht großen Hölleu urn
faß t die S ei ten 1 4 — 8 . Dann folgt S . 9 — 1 6 ein Gedi cht glei chenInha l ts
,das dem Buddha se lbs t in den Mun d ge legt ist
,und dar
auf e ine dritte Bes ch reibung der Hölleu , an deren Ende s ic hS . 27 , 1 die U n terschri ft findet : iii S ri -Mahävastu -avadana N araka
parivar tam näma sütram samäptam. Dieser Tite l w ird s ich nur
auf die dri tte Bes chre ibung b eziehen,die ebenso w ie das Ged i ch t
v om Verfasser aus der äl teren Literatur seiner Dars te l lung zum
Be leg eingefügt w orden i st. Dem Verfasser des Mahäv astu ge«
hörte nur die erste Bes chre ibung an,denn sie hat dense lben Re
fra in w 1e w ei terh in der Besu ch b ei den Tieren,bei den Pretas ,
b ei den Götte rn . Übera l l sah er Le id,darum so l l man das He il
vo l le (kus'alam) erkennen und tun,e inen keuschen Leb ensw audel
führen, n i chts Böses tun , 1
Brahnxauischer E influß im Buddh ismus 5
Auch die Gotter s ind n i ch t ew ig,n i ch t von Bes tand
,der Ver
änderung unterw orfen : (l6 l 'ä pi anilyälr ad/w urää ripa r inäm a
dharmäno, S . 3 1 , 12.
Wie konnte man dem Maudgalyäyana d iese Besuche zuschre iben ? Nicht von allen Jüngern w i rd das gle i che be ri chtet .O ffenbar ist auf Maudgalyäyana über tragen w erden, w as im
Vauaparvan des Mahabharata, Adhyäya 260 und 26 1,von seinem
frommen Ahnherrn Mudgala ode r Maudgalya erzäh l t w i rd : S ilofzchav r ttir dharmätmä Ill udgalalz sa rgryat€ndriyalr äsid räj an Kam /c
s€tr6 satya eäg anaeüya/ralz Durc h se ine F re igeb igkei t ohneMißgunst
,auch dem als u nm atta beze i chneten Durväsas gegenübe r,
hatte er die We l ten ersiegt und den hö chsten Gang “, par t! mäm
ga tim, errungen. Der Lohn w ird ihm m it den Worten ausgesprochen : In d e i n em K ö rpe r w i rst du in den Himme l gehen“
,
sas'
ariro bhavän gan tä. svargam sucar c'
tavr a tu, 260, 29 . Dies i st genau das
,w as der Buddhis t Maudga lyayana vermag .
Dem Mudgala des Mahäbhärata br ingt ein Götterbote e inenGotterw agen (vimäna) zu r Fahrt in den Himme l
,aber Mudgala
w ünscht zunachs t zu hören, ob es neben den Li chtsei ten des
Himme l s auch eine S chattensei te gebe. Der Götterbote muß als
eine sol che bezei chnen , daß man im Himme l nur die Frucbt dergetanen guten Werke gen ieße und dann am Ende v om Himme lw ieder herab fa l le . Da verz i chtet Maudgalyäyana auf das Lebenin der We l t der Gotter . Er w i l l nur dahin kommen
,w o es kein
Le i d m ehr gib t. Der Gotterbote nennt ihm d iesen Ort : B rahmanalz
sadanäd ürd/w aa_
n lad Visp olr par amav_ n padam Si tddham sanätanam
jyotz'
lz parm_n br ahm eti yad vz
'
dub Mudgala setzt sein aszetisches
Leben fort. Das Ende i st : Dhyänan äd ba lam labdhvä präpya
budd/n'
m anuttamäm [ j agäm a éäévat7m siddhim parär_ n nirväzza-lak
sazzäm Diese Legende hatte J . M u i r,Origina l S anskri t Texts V,
p. 324 m i tge te i l t. W e b e r erklärte sie in e iner Besprechung diesesBandes
,Indis che S tre i fen Ill
, p. 39,für buddhis ti sch . E s kann
se in,daß v on denBuddhis ten benutzte b rahman i s che Legenden
später ih rerse i ts buddh isti s ch gefärb t w orden sind , w as s i ch hierin dem Ausdrucke niw än a äußern könnte
,aber die Grundlage
d ieser Legende w ar s icher b rahman i sch , denn der den Himme lbesu chende Rsi ist eine b rahmani sche Erfindung .
6 E rnst W indisch
2. A s i t a D e v a l a.
Die Gesch i chte von Asita Deva la in der Jugendgesch ichteBuddhas ist eine merkw ürdige Para l le le ‘
) zu der Gesch i chte von
Symeon in der Jugendgesch i chte Jesu (Luk . II S ie w irdam e in fachsten erzähl t in der Ein leitung der A t t h ak a th ä zum
Jataka, s. „T he Jätaka together w ith its Commentary “
, herausgegeben von V. F a u s b ö ll (London Vol. I
, p. 54 1. Der
Name dieses tapasa oder g° _si w i rd vers chieden angegeben : da asita
s chw arz bedeutet, so findet s i ch au ch Käladeva1a , und mit Weg
lassuug von devala e infach A sita oder Käla , im Nälakasutta 689
sogar Kaplzasz'
r ivhayo ist'
. In der A tthakathä w ird Käladevalaals ein F reund der Familie (ku lüpako) des S uddhodana beze i chnet.Na chdem er seine Mahl ze it eingenommen, w ar er für die heißeZeit des Tages nach der Wohnstätte der T ävatirpsa gegangen .
Dort bemerkt er die freudige Erregung der Götter und erfährt,
daß dem S uddh odana ein S ohn geboren w orden ist, der ein Buddhaw erden w ürde. Der Asket s teigt von der Himme l sw e l t herab und
begib t s i ch in den Pa las t des Kön igs. Er s ieh t die Merkma lean dem Körper des Kindes, die auf den künftigen Buddha hindeuten. In dem Gedanken „ ein w underbarer Mens ch ist dies “läche l te er ; w eil er dessen Auftreten als Buddh a n i ch t er leben,sondern zuvor s terben w ürde
,desha lb w einte er . S o erkl ärte er
sein Verha l ten den Leuten . Als er si ch überlegte, ob unter seinen
Verwandten e iner sei, dem es bes ch ieden w äre, den Buddha zusehen, kam ihm der S ohn se iner S chw ester, der junge N älak a ,
in den S inn. Er ging in das Haus seiner S chw ester und sprachzu Nälaka : „
In des Großkön igs S uddhodana F am il ie ist ein S ohngeboren, aus dem ein Buddha w erden w ird “
; „35 Jahre alt,w ird
er zum Buddha w erden “
; „ dir ist besch ieden, ihn zu sehen “
;
„noch heute w erde Mönch (ayyeva Die pabbajjäerfol gte, und er begab s ich in den Himälaya, w o er das Lebeneines S amana führte. Als der T athägata die höchste Erkenntn iserlangt hatte
,suchte er d iesen auf
,erzählte die Nälakapatipadä,
1) Für m ich ist es n icht s icher erw iesen, daß der Symeon des Lukas
dem As ita der buddh ist ischen Legende sein Dasein verdankt ; vgl. meineal lgemeinen Ausführungen über die Parallele in
„Buddhas Gebur t“ p. 213ff.
Brahmauischer E influß im Buddh ismus
kehrte in den Himalaya zurück und er los ch sch l ieß l i ch in rest losemNibbana
Die ä ltes te Que l le für diese Legende ist das Nälaka su t t a ,
im S uttanipäta, ed. F a u sb ö ll p. 1 28, Vers 6 7 9 ff. Auch das Nalakasutta beginnt dam i t, daß der Asito isi im Himme l die freu digeErregung der Götter bemerkt . Nach dem er ihren Grund erfahren
,
s teigt er vom T usita -Himme l) herab und begib t s i ch in den
Palas t des S uddhodana. Dort sagt er : „Wo ist der Knabe, auchi ch bin verlangend (ihn) zu sehen .
“ Die S akyas ze igen ihm das
Kind . Als er an seinen eigenen T od denkt, vergieß t er Tränen.
Die S akyas fragen Vers 69 1 : „no ce kumäre bhavc
'
ssati antaräyo“
(es w ird doch b ei dem Knaben kein Hindern is eintreten). In
der A tthakathä lautet i hre Frage ähn l i ch : Manu kho bhante am
häkam ayyaputtassa kocz'
an taräyo bhavissatz'
. Auch in der Antw ortzeigen s ich Anklänge : h ier athaa tarä m e bhavz
'
ssatz'
kälakz'
r iyä, dortanta rä yeva f-älam kateä. Die Ursache se iner Tränen ist : „
lch
w erde die Lehre des Meisters ohnegle i chen n i cht hören,darüber
bin i ch betrüb t,unglück l ich , le iderfü l l t. “ Er w endet s i ch dann
ohne w eiteres an den S ohn seiner S chw es ter und verw e is t d iesenauf die Lehre des kommenden Buddha. Wenn er den Ruf höre,daß dieser den Weg des Dhamma w ande le
,sol le er zu ihm geben.
Den Jina erw ar tend , leb te er , die S inne bezähmt. Als er den Rufgehö rt hatte
,ging er zu ihm und fragte den besten der Mun is
nach dem nwneyyasetflzazn , Vers 698. Es fo l gen darau f im zw e i tenTei l des Nälakasutta die Verse, die vie l lei cht Asoka auf der In
schri ft von Ba irat unter mum'
gäthä m oneyasüte gemein t hat (vgl .O l d enb e r g , ZDMG LII, p. 637 („Buddhi s ti sche Nachdem Inha l t des Ged i ch ts is t un ter m oneyya das Wesen und das
letzte Zie l e ines Muu i zu verstehen .
In A8vaghosas Buddhacarita,1 54 — 86
,ist d iese Legende
w eniger ausgeführt. Der Name des Bei ist Asita. Dur ch e inehimm l i sche S timme im Himmel sraum hat er von der Geburt desKindes gehört
,dessen Bedeutung er aus den Ze i chen an seinem
Körper erkennt. Durch die Kr aft der Askese hat er den Aufent
halt im Himme l erw orben (tridz've väsam,Vers Aber der
Aufentha l t im Himme l erscheint ihm als ein Unglück , w e i l er dieLehr e des Buddha n i cht w i rd hören können. Desha lb w eint er .
Er geht davon w ie er gekommen auf dem Wege des Windes
8 E rnst W indisch
(pavana —
pathena, 85) Den S ohn se iner j üngeren S chw esteraber verpfl i chtete er , die Lehre des Muu i zu hören
Der L a lit a v ist a r a enthä l t diese Legende in Adhyäya VI I,in der Kalkuttaer Ausgabe p. 1 1 5— 1 27
,in L e fm a n n s Ausgabe
p. 1 01 — 1 1 2. Der Um fang ist so groß , w e i l am Ende e ine äl tereDi ch tung zugefügt is t, die ofl
°eubar e ine Que l le der Prosaerzahlung
w ar,und w e i l in dieser letz teren die 32 Mahapurusalaksanäui
und die 80 Anuvyaiijauäni e inze ln aufgezäh l t w erden. Die ersterenkommen nur einem Buddha , n i cht auch einem Cakravarttiu zu(p. 106 , 6 Leim .) Der Maharsi (Devarsi im An fang des Ged ichts)Asita w ohn te mit dem S ohne se iner S chw ester, der h ier N a r ad a t ta heiß t
,in e iner Eins iede lei am Abhang des Himalaya, nach
der er am Ende w ieder zur ückkehrt. Er hat die den Buddharufausstoßenden Götter im Luftraum gesehen und mit se inem himm
lischen Auge den Grund i hrer Freude erkann t. Von Naradatta
begle itet,komm t er w ie ein räjaham sa durch die Luft nach Kapi la
vastu geflogen (p. Der Kön ig konn te s ich n i ch t besinnen ,ihn gesehen zu haben (na smarämy aha7
_nMM 9396 dars
'
ananz, p. 1 02,
Asita beze i chnet s ich se lbst als alt und geb rech l i ch . Al s er Tränenvergießt
,beruhigt er den um seinen S ohn besorgten Kön ig in der
se lben We i se w ie iu den anderen Vers ionen. Die S orge des
Königs finde t in dem S atze Ausdru ck : md khalu kiiinäi 'asya käcid
vipratz'
pattz‘
lr (p. 1 04 , Noch mehr er innert an den Wortlau t derAtthakathä und des Nälakasutta die Antw ort des Königs in demGedi chte : päpa1p. nästz
'
na cän taräyam iha bhoh S ar värthasz'
däeaaya te
(p. 1 1 1,
Dem Naradatta sagt er,w enn er h öre, daß der Buddha
aufgetreten sei,so l le er s i ch in dessen U nterw ei sung begeb en
(tasya s'
äsane pravraj elc, p. 1 08,7,1 1 1
,
In der Version des Mab äv a s t u,ed. S e u a r t
,I I p. 30— 4 5 ,
ist Asita in den Dekkhau versetzt. Er hat seinen Namen von
seiner dunklen Hau tfarbe,w i rd brä/zm azcakumär a genannt und i st
der S ohn e ines rei chen (mahäs'
äla ) Brahmanen in Ujjeni . NachVo l lendung seines Vedastudiums hat er s i ch in das Vindhyagebirgezurückgezogen und dort die vier dhyünänz' vol lendet und die fünf
1) In übertrieben scharfsinn iger We ise hat P i s c h e l die Worte ?72.&saz
c’
i/ T c_ö n v erß
‚a a n in der E rzählung v on Symeon , L uk: I I 27 , aus diesem
pavanapathena erklären w o l len . O l d en b e r g hat dies mit Recht abgelehn t,„A l tindisches und Christliches“
, ZDMG LIX, p. 625 .
1 0 E rnst W indisch
Brahmarsis bekämpft hat, daß die Brahmanen die beste Kas te,die anderen Kasten ger inger se ien . F is che l bemerkt (p. 39 Anm .
daß nach Kern, Brhatsarphitä p. 4 1 , ein Asi ta Devala einer derberühmtesten Rsi-As tronomen gew esen
,und daß er un ter dem
Namen Käladevala in die b uddh istis che Literatur e ingeführt w erdensei. Da er auf Jataka p. 54 f. “ verw ei st, hat er unsere Legendeim S inne gehab t. Auch K e r n me in t den As i ta Deva la unsererLegende, denn er bezei chne t se inen Astronomen als den Astrologen,„who cast the horos cope for the nati vity of Buddha“
,indem er
s ich auf Hinen T hsaug beruft. Dieser erw ähn t den As ita Deva lain der Bes chr e ibung v on Kapilavastu . E in S tupa beze i chnetedort die S te l le, „
w here As i ta the R ish i prognos ti cated the fortuue(took the horos cope or s igns) of the royal prince“
. E inen T hsaugerzäh l t dann unsere Legende, am näch sten der Vers ion des La l i tav istara entsprechend, 5 . S i-yu
-ki, Buddh is t Records of the WesternWor l d, by S amue l R e a l London 1 906, II, p. 1 5 ff. Aus den Wortendes Hinen Theang könnte man n i ch t m it S i cherhe it entnehmen,daß Asita ein Astronom w ar
,denn „prognosticated the for tune
of the roya l prince“w ir d s ich nur auf das vyäkarapam :r _
seb (Lal.
p. 1 1 1 , 14) beziehen , auf die Prophezeiung auf Grund der Zei chenain Körper des Kindes.
S o sin d w ir noch n i cht aus der buddhis t ischen Legendeherausgekommen. E s w ird s i ch aber zeigen, daß der b uddhis tis cheAsita Deva la in den Legenden des Mahabharata sein Vorb ild hatte .
Zu letzt hat s i ch eingehender über As i ta Deva la geäußertO lde u b erg in se in em oben erw ähnten Buche „
Die Lehre der Upanischadeu und die An fänge des Buddhism us“, besonders in Anmerkuug 1 32 p. 352. Er möchte in ihm e ine w irk l i che Persön l i chke i t“ erb l i cken, „
den Oheim eines buddh is ti schen Mönches“ .
Von dem Besu cher des Buddh akiudes, der ursprüngl ich nur As i tah ieß , untersche idet er den Bei As i ta Deva la des Assaläyanasutta,von dem j ener den später zu Asita hin zugefügten Namen Devalabezogen habe. Da i ch bei Moggalläna n i ch t bezw e i fe le
,daß d ieser
e ine h istorische Persön l i chke i t w ar,so gebe i c h die allgeme ine
Mögl i chke i t zu,daß auch dem Asita e ine sol che zugrunde liegen
könn te. Aber Moggalläna, ein w irk l i cher Jünger Buddhas,macht
doch in ganz anderer Wei se e inen h istorischen Eindruck, als der
nur in legendar is chem Gew ande au f tretende Asita. Die Angaben
Brahmauischer E influß im Buddh ismus 1 1
über seine Beziehungen lauten versch ieden. Nur in der Atthakathäist Käladevala als kulüpaka zu S uddhodana in e ine persön l i cheBeziehung gebrach t. In den anderen Versionen kennt ihn der
Kön ig n i ch t, komm t er aus der F erne , aus einer Einsiede le i imHimalaya, im Vindhyagebirge, und zw ar durch die Luft fliegend.
Wir müßten w enigstens annehmen,daß Asita n i ch t nur den Namen
Deva la , sondern se in ganzes Wesen von dem Asita Deva la derLegenden desMahabharata bezogen habe. Von e inem buddhisti s chenMönche Nälaka erfahren w ir sonst n i ch ts . Daß er der bhägineyya ,
der S ohn der j üngeren S chw es ter (anujäsuta, Buddhacar . l 86) desAsita gew esen, i s t zu einem Zuge der Legende gew orden, derau ch den Asita bestimm ter in die Ze i t des Buddha versetzt . lm
Mabävastu ersche in t er nur als ein besonderer S chüler des Asitain dessen Eins iede le i . Im Anfang des Gedi chtes des Mahävastuw ird als der Haupt inha l t der Legende die Klage des Asi ta an
gegeben .
Wie s chon hervorgehoben, erscheint in dem Gedi chte des
Mahävastu zw eima l der Name Nar a d a für Nälaka. Auch Naradatta im Lalitavistara i s t zu b eachten . Da nun Asita Deva la imSäutiparvan (XII) des Mahäbhärata, Adhyäya 276 der Kalkuttaer
Ausgabe (275 Bomb ) , als der Lehrer des Rsi Narada auftri tt,s o
l iegt die Vermu tun g nahe, daß der buddhisti s che Nälaka auf diesenlegendarischen Rei des Mahäbhärata zurückgeh t. Die a l te Legendew ir d eingeführ t dur ch den Vers : A traivodäharan tim am itihäsam
purätanam N äradasya ca samvädazn Devalasyäsz'
tasya ca AsitaDeva la b e lehrt den Narada über U rsprung und Auflö sung der
We l t, im S inne der S ämkhyaphilosophie .
Daß die buddh istis che Legende in einem gew is sen Zusammenhange mit den Itihäsas des Mahäbhärata steh t, geh t noch aus
e inem besonderen Umstande hervor . In Adhyäya 229 desse lbenParvan fragt Yudhisthira, durch die Beobachtung w e l cher Gebote ,durch w e l chen Lebensw audel, durch w el ches Wissen man die
höchste S tätte des Brahman errei che : Kir_rtä lalc kimcam äcäralz kim.
vidyalr kimparälcram alt präpnoti brahma zzab. sthänam tat param
prak;r tclr dhr uvam Bhisma an tw ortet, w er die Bed ingungen derErlö sung s treng erfü l l t
,w enig Nahrung zu s ich n imm t
,die S inne
bes iegt hat,der erre i ch t sie : Mok,sadhar me_
su m'
yaio laghvähäro
j itendriyalc und führt dann einen a l ten Itihäsa an mit einem Ge
1 2 E rnst Wind isch
sprach , in dem Asita Deva la v on dem Rsi Jaigisavya uber d ieseF rage be leh rt w i rd . Die S ch i l derung v on Ges innung und Leb ensw e i se d erer , die das höchste Zie l errei chen
,hat unverkennbare
Äh n l i chkei t mit der Be lehrung, die Buddha im zw ei ten Te i l desNälakasutta dem Nälaka über das m oneyyam u ttamazn padam gib t.Buddha geht geordneter auf die Moralgebote und dann auf das
ri chtige Verha l ten be im Erbetteln der Nahrung ein, aber be i deReden b eginnen mit dem sons t n i ch t so in den Vordergrund geste l l ten Gedanken, daß der We i se gle i chgü l tig ist gegen Lob und
Tade l . Asita Deva la hat d ies an Jaigisavya beobach tet und
fragt daher : N a priyase vand_yam äno n indyamäno na kupyase kä
te pr aj r7ä kutaécaisä Ä‘im. te fasyäla. paräyazzam Jaigisavya beginn tdarauf seine Be lehrung m it den Worten : N inda tsu ca sam ü nityargz
pras'
aryzsatsu Devala (w enn man tade l t und w enn man lob t, immers ind sie gle i ch). Dem entspri ch t der An fang v on Buddhas RedeVers 702 : S amänabhävam kubbetha gäme akku
_t
_thavanditam (glei chen
Eindruck mache ges cho l ten und ge lob t im Dorfe). Diese text l i cheÜb ereins timm ung m öchte i ch n i ch t für zufä l l ig halten
,und zwar
um so w en iger, als aus den vorausgehen den Versen ges ch lossenw erden darf, daß Nälaka s chon Asitas Lehre über d iesen Gegens tand gehört haben sol l . Am S ch luß der Erzäh l ung heißt es
Vers 698 : m oneyyaseg‘
t/zam m unz'
pavaranz apucchz'
sam aga te A sita
vlzayasäsane (er fragte den vorzüglichsteu der Mun i s nach demim Moneyya bestehen den bes ten Zustand, nach dem ihm die Unterw eisung des Asi ta Genannten zute i l gew orden w ar) . Dementsprechend beginn t Nälaka Vers 699 seine Anrede m it den WortenA üüätam etam v acmcam A sitassa ya t/zäta i/zcmz tam tav
_n Gotama
pucchäma sabbad/zammäna päragmn (bekann t ist j ene Lehre des
A s ita,die w ahrhei tsgemäße, nach der fragen w ir d i ch , 0 Gotama
,
den üb er a l le Zustände Hinubergelaugten). Nälaka l ieß s i ch von
Buddha über das Moneyya be lehren,nach dem er eine ähn l i che
Lehre schon v on Asita Deva la geh ört, der sie von Jaigisavya er
halten hatte.
In As i ta Deva la w urde einer der Rei s der Vorze i t, zu derenWesen und Lehre der Buddha die Vo l lendung geb rach t hat, indie Buddhalegende e ingeführ t. Während die im vol kstüm l i chenGlauben immer noch uns terb l i chen Götter s i ch zu jeder Ze i t überdie Geburt des Buddha freuen konn ten
,w ar en die a l ten Rsis tot .
E rns t Windisch,Brahmau ischer E influß im Buddh ismus 1 3
Für die Legendenb i l dung lag es nahe,e inen der berühmtes ten von
ihnen als a l ten Mann die Ze i t der Gebu rt Buddhas noch erlebenzu las sen . Aber se ine Zei t i s t um
,der T od steht ihm bevor
,das
Au ftreten des Buddha als Leh rme is ter kann er n i cht erleben , und
so ergab s i ch aus d ieser Lage der Dinge die Klage des Asi taDeva la.
An einer d ri tten , von Jacob i im Index zu se iner Epi tome desMahäbhärata angefüh rten S tel le , Salyaparvan (IX) Adhyaya 5 1
(50 Bomb) , zei gt Asita Deva la den Mani-Charakter,w enn v on
ihm gesagt w i rd : A krodhauo nmhäzäj a tu lyam'
ndätm asamstu tc'
lz. DieserAbs chn i tt hande l t von dem sehr merkw ürd igen Verhäl tn i s desAsita Deva la zu Jaigisavya . Bei de lagen dem Yoga ob und hattendie Wunderkraft (sidd/n) er langt. Jaigi _
savya h ie l t s i ch lange Zei tin der Eins iede le i des Asita auf
,sprach aber ke in Wort zu ihm .
Asita suchte h inter ihn zu komm en . Er flog in die vers ch iedenenhöheren We l ten auf
,in jeder fand er den Jaigisavya vor . Zu
l etzt verlor er ihn aus dem Ges i cht und erfuhr von den S iddhäh
Brahmasatrip ah, daß er nach der We l t des Brahman gegangensei : lolcav
_
n éäs'
e atam B rahm azw ga talt . Er w ol l te auch dah in auf
fliegen, fiel aber herunter, denn in die We l t des Brahman zugehen, die Jaigisavya erre i cht hatte, w ar ihm n i cht bes ch ieden .
Asita kehrt e der Reihe nach durch d iese lb en We l ten in seineEins iede le i zur ück u nd fand dort den Jaigisavya w ieder vor . Ernaht ihm mit dem Wunsche, in den Moksadharma eingeführt zuw erden . Jaigisavya un terw e is t ihn darin .
Jaigisavya w ar der Größere. Er könn te mit Buddha v er
gl i chen w erden. Das Verlangen des Asi ta aber,immer höher zu
ste igen und von Jaigisavya auch noch im Moksadharma unterw iesen zu w erden, konnte ihn für die buddh istis che Legendenb i l dung besonders geeignet erscheinen lassen.
Zur Kenntnis der indischen Materialisten.
Von
Alfr ed Hilleb r andt (Bres lau).
S o lange wir die Werke n i ch t w iederfinden,in denen die
Phi losophie der Lokayatas n iedergelegt ist, w i rd es s chw er se in,
ein k lares und dur ch die Auffassungen i hrer Gegner ungetrübtesBi ld von i hrer Lehre zu gew innen ; die S te l l ung, w e l che das Rämayana, das Mahabharata und e in ige andere Werke dem v or
nehmsten Wortführer anw e i sen,s teht zu den strengeren Texten,
die die Grundsätze der Lokayatas ernsthaft nehmen und zu w i derlegen su chen, im Gegensatz . Abgesehen von der Erörterung ihrerGrun dsätze in Brahma und S äfikhyatexten kann auf Kusumäfi jali
verw iesen w erden, w o bei Besprechung der Got tes idee sie m i tt enunter Aupanisadas, Kapi las, Pätafijalas, Mahäpäéupatas, Saivas,Vaisnavas, Pauränikas, S augute s, Digambaras , Mimämsakas u. a .
glei chberech tigt aufgefüh rtWeber hat s chon in den Indischen S tudien darauf
aufmerksam gemacht,daß in dem Värttika 7 zu Pänini VII, 3, 4 5,
v on einer vam2ikä bhäguri lokäyatasya gesmochen w ir d (im
Gegensatz zu der Bildung varnakä als Bezei chnung e ines Gew ebes) und im nächsten Värttika von einer var tz
'
kä bhäguri [okaya tasya . Bei der ersten S te l le bemerkt die Padamaiijar i (p. 818)bhägufl , vyäkhyä, ;ikäviéegdz; ferner erw ähnt Bhaskara zu Brahmasutra III
, 3, 53 ein B ;rhaspatisütrü ). S o w enig w ir von diesemoder von diesen be i den Werken w issen
,so geh t doch aus ihrer
b loßen Erw ähnung hervor, daß es s ich um e ine S chule handel t,die i hre Grundsätze in der w issenschaft l i chen Form Indiens dar
Nyaya —Ku sumäii j a l ipr ak ar an am by U dayanäcärya Calcutta. 1891
(B. I .) I, p. 1 7 ; K u sum äfi j ali ed. C ow e l l , Cal cutta 1863, p. 3.
2) C o l eb r o ok e , Misc. E ss. 1 9 427 8 .
Z ur Kenntn is der indischen Material isten 1 5
legte und sie s chon um die Zei t Patafi jalis in l i teraris cher Formvertrat. Pänini l ehrt IV, 4 , 60 die Bi l dung von ästzka und nästz
'
ka,
die auch im S inne von para lolc0’
sfitz'
yasyn m atilz und paraloko nästi ti
gebrauch t w erden. Aus dieser Erw ähnung bei Pan ini fol gt n i cht,
daß es zu se iner Ze i t e ine Ge leh rtens chu le gab , die d iese Rich tungvertrat, aber doch
,daß s chon damal s die Frage nach dem paraloka
besprochen und au ch verne in t w urde. Die Worte, w e l che in derKäthaka Up. I
,20 Naciketas an Yama ri chtet : yeya 7_n pr ete vicikitsä
m anusye astity eke nayam asüfi caz'
ke w e i sen auf e ine noch äl tere Ze i t.S eitdem me in kurzerAufsatz
„ÜberMaterialisten undS keptiker
“
ersch ien, hat das vorhandene Materia l und die Hinw ei se darau fs i c h etw as v ermehrt
, so daß i ch v ie l lei ch t den Versuch w agendarf, die S chule des Cärväka e iner e rneuten Betrach tung zu un ter
Die einze lnen S ch r i ften, w e l che benutzt s ind, w erden an
der betreffenden S telle ange führt ; h ier m ö ch te i ch noch besondersS u a lis Ausgabe und Übersetzung von Haribhadras Lokatattvanir
naya und se iner Übersetzung von dem betrefienden Kapi te l desS addaréanasamuccaya gedenken sow ie der Bemerkungen G a r b e san vers ch iedenen S te l len se iner Sähkhyaschriften ; außerdemPizzaga llis S chrift : Nas tika Cärväka e lokäyatika (Pisa
Rhys Da v i d s hat in den Buddhist S u ttas II, p. 1 7 1 am
S ch luß e iner eingehenden Betrach tung des Wortes lokayata die
Vermutung ausgesprochen , daß “about 500 B. C. the w ord Lokayata
w as u sed in a compl imentary w ay as the name of a b ranch of
Brahman learning, and probab ly m eant N a t u r e - 10m w isesayings, ri dd les, rhymes , and theor ies handed dow n by tradi t ionas to cosmogony, the e lements
,the stars , the w eather
,s craps of
astronomy, of e lementary phys i cs , even of anatomy, and knowledge of the natur e of precious stones , and of b irds and heastsand plants M ir sche in t d iese Hypothese n i ch t ri chtig. Gegensie hat si ch schon ein ungenannter Rezensen t im Athenäum ‘
)geäußert
,einma l un ter Hinw e i s auf den Ja ina Canon, der die
Lokäyatas n i cht un ter einer b loßen Liste “of b lameworthy per
sons” nenne, sondern in der sehr bezei chnenden Gese l l schaft der1) A lt-Indien (Breslau 1890) p. 1 68 ff.
9) Quel lennachwe ise bei J . J . M ey e r , Dandins Daéakumaracaritam
p. 862.
30. Juni 1900 Nr. 3792 p. 81 1 .
1 6 A lfred Hi l lebran dt
Buddh isten und frühen Sankhyas, ferner aufHaribhadra
der ihre Grundsatze dar lege und sie mit den Cärväkas identifiziere,und auf das Drama Prabodhacandrodaya, das ihnen m it Haribhadra übere ins timmende An s ich ten in den Mun d lege.
“Mos t interesting of all i s another passage overlooked in the present vol ume,and prec isely of the kind there considerated
,as i t is ‘
not the
testim ony of the opponents ’ , name the passing mention by the
Chinese pilgrim l -ts ing (s ixth cen tury A —D.) of the ambassadorWang-Houen-T sé w ho had foun d in Kashm ir a Brahman w ho
professed the Lokayata and apparently practi sed i t too as a
bran ch of ‘nature-lore’
,somew hat l ike a l chemy.
”
Wir können w oh l e inen S chritt w ei ter gehen . Cullavagga V ,33, 2 sagt Buddha mit Bezug auf die chabbagiya bh ikku ’ s na
lokäyatam pariyäpuzzitabbam n a bkz'
kkhave lokäyatar_rz väcetabbam,
w as ursprüngl ich w oh l nur von einer L e h r e gesagt w erden kann .
Wi chtiger ist eine andere S tel le , in der s ich w ie au ch sonst stattder Beze i chnung Lokayata das Wort u cch eda v ädo und für denBekenner d ieser Lehre das Wort u c ch eda v ädz
' findet. Wir w i ssenaus den versch iedenen Que l len über die Lehre der Materia l istenspäterer Ze i t, daß sie das Jenseits leugnen und a l les auf v ierElemente
,Erde, Wasser, Feuer, Wind (Luft) zuruckführen, daß
sie Opfer usw . verw erfen und keinen Lohn für gute oder böseTaten anerkennen. Das ist aber genau das, w as A51to K e s aK am b a l i Digha-Nikäyo I, p. 55 (mit einigen kle inen Abw ei chungenin anderer Beziehung) lehrt : na tthi dinnaz
_
n‚na tthi yi;flzam ,
na tt/zi
ba tarn , matt/ri suka tadu lckatänam kammä-
z_m r
_
n phala 7_n vipäko, na tthz'
ayam loko,nattl u
'
p a r a loko , natthi m ätä, n u tf/n'
na tthi sa tt/zä
Gem e int ist w ohl die S tel le in dem Mémoire sur les rel igieuxém inents tradu i t par E douard ‘
0 h a v an n e s (Paris 1894) p. 21 .
2) Vgl. unten die Rede Guna Kassapas aus den Jätakas VI, und
die Worte Jäbälis aus dem Ramayana I I , 108 : kalz kasya pur ugm bandhuh
kim äpyam kasga kena cit eko hi jäyate j an tu r eka eva vinaéyati tasmän
mätä pitä ceti räma saj jeta yo nar alr u nmatta iva sa j fieyo nästi dhi
kasga cit | na te hi kaécid daéarathas team ca ta8ya na kasaana bij amätr am. pitä j an tolr éukr a »gz s
'
ozzitam eva ca sanzyu lctam rtw nam näträ p um
_sasyeha j unma ta t | usw . Z u den \ Vor teu natthi dinnam,
natthi yit_thao‚n ist
v . 16 aus derse lben R ede Jäbälis zu v ergleichen : dänasaa_nvananä hy etc
gran thä m edhävibhile k_r tälz yajasva dehi dik
_sasva tapas tapyasva samtyaja .
Die Polem ik scheint s ich meist in denselben enggezogeueu Gedankenkreisen
1 8 A l fr ed Hi l lebrandt
näm a natthitz'
m aüfi amäno kasmä m am par ibhäsasitz'
santajj z'
tvä ä/za |ca tu n n am yev upädäya rüpam S ambh0 ti päninam ya to ca rüpam
sar_nbhoti ta ttheva anupagacchati idheva j iva tz
'
j iva peccapecca vinassa ti
u eehiz'
ja tz'
aya7_n loko y e bä lä y e c a p a zzc_1i tä u cch ijj am a n e lo
ka sm z'
m ku v z'
dh a päp en a lipp a t i.
Etw as vers ch ieden ist die S aptakäyavädalehre Pakudha Paccäyanas [Digha Nikäya I , 56 ff. 1] und Kassapas Jat. VI, 225— 226
,
der zu Erde, Wasser,Feuer
,Luft noch sukha, dukha , j ivo h inzu
fügt,al so zu den vier Grunde lementen noch dre i w ei tere 2) , sons t
aber Be lohnung und Bestrafung für guten und s ch lechten Wande l 8)sow ie ein Jense i ts Er setz t dort ause inander
,daß j ene
s ieben Elemen te n i cht zerstört w erden ; ke ine Waffe dringe in sie
ein ; man könne m it dem s charfen S chw ert woh l das Hauptab s chnei den, aber das zers töre die Elemente n i ch t 5). Kassapab i l det e ine Abart der Mater iali sten , die, in der Hauptsache darübereinig
,daß es ein Leben nach dem Tode n i cht gebe, im einze lnen
vielfach ause inandergehen,w ie man aus der S te l le des Brahma
jälasu tta I, 3 , 9 ff. s ieht, in der s ieben Ans i chten s i ch überein anderaufbauen
,die das Wesen der S ee le zwar immer feiner deu ten,
aber doch in der Annahme ihrer vö l l igen Vern i chtung nach demTode s ch l ieß li ch übere instimmen. Die S teigerung se lbst verglei ch tRhys Davids m it der Reihen fol ge anna
, präzza , m anas,mj fi äna und
ananda Tai tt. Up. II , 1— 5 und der vom sthülas
'
arira bis zum ätman
aufsteigenden Säfikhyalehre.
’
Von i hnen fällt die ers te Gruppein die Richtung des groben Mater ia l ismus, den die Späteren Texteschildern und dem Cär väka in den Mund legen : yato lcho bho ayama itä rüpi. cätum -m ahä-bhütiko m ata-
pettz'
ka-sarnbhavo, käyassa bhedä
u cehz_
'
yj ati vinassati,na hotz
'
par am m aragia, ettävatä lcho bho aya1_n
a ttä. samma samucchz'
nno kotitz'
.
Die S ch i l derung eähzmm ahäbhütiko usw . stimm t ganz m it
diesen späteren Anschauungen uberein ; die Worte der S ummi
1) F . O . S c h r a d e r a. a. 0 . p. 54 ; J a c ob i , SBE 45
, XXIV .
v . 985 : satt’
ime sassata käyä achejjä av ikopino tej o pathavi äpo caväyo sukhadukham c
’
ime\ | fi ve ca satt
’
ime käyä yesaw chettä na vijj a tz'
.
v . 980 : natthi dhammacar itassa phala r_n kalyänapäpakam .
natthz'
para loko, ko ta to hi idhägato.
E r ist also zug le ich ein Anhänger des Nityaväda (s. F . O . S c h r ade ra. 0 . p.
Z ur Kenntn is der ind ischen Material isten 1 9
galaniväsini (I , p. m ätä p1'
tunnam clan ti m ätäpettz'
kanz; kim
tum ? 8uÄ'Ä‘asonitam kann man m it denen des Jäbäli im Ramayanavergle ich en (oben S . h ier l iegen überl iefe rte Wendungen und
Worte vor . Auch die zw e i te Gruppe, die die S eele für dibbo,
r üpi , kämävacm0 , kabalz'
izkär abhakkho (Rhys Da v i d s : d iv ine,having form,
be longing to the sensuous plane, feeding on so l i dfood) ansieht
,gehört h ierher. Wir begegnen ihr un ter den vier
Cärväkas, die im Vedäntasära b ekämpf t w erden . Der ers te von
ihnen sagt 5 148 unter Beru fung aufTai tt. Up. 11,1 :
„sa vä esa puru _
sO
’
nna rasam ayalr“
, daß das S e lbst der grobe Körper sei (sthülaéarira) ;der zw eite s ieh t das S elbst in den S innen
,der dri tte im Atem ,
der vierte im Mamas . E s liegt s om i t die S tufen fol ge sthülaéarira
(w ofür man annar asa setzen kann), indrz'
ya , präzza , m anas v or .
G a r b e (Sankhya p. 123) hat die ursprüngl i che Versch iedenhei td ieser Cärvä'
kalehren bezw e ife l t. Ich glaube,h ier sind Lehren
zusammengeste l l t, die v on versch iedenen Männern und von ver
s ch iedenen Lehren in bezug auf das S e lbs t ausgingen,w ie die
Upan isads zeigen ; die Lehre der Vedäntins ist in unserem Textzu der orthodoxen S trenge vorgeschri tten, daß sie a l le m ehr oderm inder m aterie l len Deutungen auf Cärväkas
Mir scheint al so Grund zu der Annahme,daß s chon zu der
Ze i t des Pälikanons mater ia l i sti s che Ans chauungen s ic h in ein igermaßen festen F orm en b ew egten und ein Sys tem bezeugen .
In der k lass is chen Zei t gi l t Brhaspati als sein Urheber. In
dem S arva » siddhänta-samgraha heiß t es 1, 23 : Aksapäla, Kanada,Kapi la, Jaimini, Vyase , Patafijali, das s ind v edagläubige Ver
fassser von Sutt en ; Brhaspati, Arhata sow ie Buddha b ekämpfenden Vedaw eg. Alle haben in Rücks i cht auf die
,die s i ch m it
i h rer Lehre be fassen,Sästras ins Leben gerufen ; die Bauddhas,
Lokayatas und Arhatas,w el che für ih re Lehren s i ch n i ch t auf
1) In jener S tel le der Tai tt. Up. I I , 1 dar f man die A ußerung e iner
material istischen , h ier im Text in anderem Zusammenhang h in eingearbe i tetenRichtung sehen ; das ergib t sich aus den Worten der Bbrguv alli : annäd dhyeva khalu imäm
'
bhütäm'
jäyan te anneno jätäni fi van ti annam prayan tyabhisamviéan ti . E s folgt zw ar daran angereiht d ieselbe Äußerung in bezugauf den Präp a, in bezug auf das Mauss
,aber das s ind v one inander im Grunde
v ersch iedene Auffassungen , die später v on versch iedenen „Gärväkas“ getrenn t
v erkündet w erden und ta tsächl ich auseinanderzuhal ten s ind .
20 A l fred Hil leb randt
den Veda s tü tzen , s ind von denen , die die Bew e iskra ft des Vedabehaupten, gebührend zu w i der legen“
. Ob nun dieser Text aufSankara w irk l i ch zuruckgeht oder n i ch t
,jedenfa l l s s t imm t die
Angabe m it der and rer Werke übere in. Mädhavas S arvadaréana
samgraha führt ö fter Verse aus Brhaspati an und spri cht in der
Ein lei tung v on „Cärväka, der Krone der Leugner, der BrhaspatisMeinung fol gt “ Eb enso erw ähnt der Kommentar zum Saddarsanasamucca.ya, daß die Lokayatikas si ch Bärhaspatyäh nennen
Das i s t a l te Tradition . Die Ma i tri-Upan isad s te l l t Brhaspati als
den S chöpfer der Irrlehre, der Av i dya dar 3) . C o l e b r o o k e bemerkt zu seiner Angab e, Bhas kara zu Ved. S ütra III, 3, 53 nenne
das Bärhaspatyasütra :“apparent ly as the text w ord or standard
author ity of this sect or s choo l W i l s on füh rt e ine S te l le aus
dem Padmapuräna‘) an . Es darf auch auf den Har ivafiéa v er
w iesen w erden,demzufol ge Brhaspati, um Indras F einde zu v er
w i rren,das Nästikaväda-A rthaéästra schu f, „
das dem Dharm a feindl ic h i st, das b es te der Lehrb ücher des Tarka für die S chlechten ,ihrem Ge i s t en tsprechend . S ie hörten das von Brhaspati ver faßteLehrbuch in i hrem bes chränkten Vers tande und w urden zu Feindender vordem verkündeten Lehrbücher des
Es ist nun in teressan t, daß Ramayana II, 1 00, 38 lokäyatz'
ka
durch buddl n' änviksiki er läutert w ird und die zu den Lokayat ikas i c h ha l tenden Brahmanen als S chw achlinge ge l ten, die si ch fürPandi ts hal ten. Das ist die Richtung, die dem Frommen w i ders treb t und s chon in Kau tsa bei Yaska e inen Ver treter hat ; die
1) Mhaspa tz
'
matänu särüzä nästika—stromazrinä cär väkena .
2) S u a l i , L e Muséon , NS 9 (1908) p. 279 .
3) brhaspatir va i éukr o bhütvendrasyäbhay@ä3u r ebhyah k
_sayäyem äm
avidyav-
t as;rj at tayä 5ivam aéivam ity uddis'
an ty aéivava s'
ivam iti vedädi
9618trahihsakadharmäbhidhyänam asiu iti vadcmti (VII,S ei. Works I p.
12 ff.5) I , Kap. 35 (cd. Bomb . fo]. 4äh ), Vers 30 11
teaäzn ca buddhisam-moham akarod dvijasatta-mahnästivädär thaéästr am hi dhw mavidveaaztam param | 30
par am aagz tarka éfurträväm asatä»_n tanmanonugam
na hi dharmapr adhänänäm vocate tat kathän tar e 31
te tat b flmspa tikrtam gästram ér utvälpa eetasah
pür voktadhar maéästräpäm abhavan dveeizzah sadä 32
kathän tar e v . 81 : Komm . vär ttäprasm'
zge pi .
Z ur Kenntn is der indischen Material isten 21
0udd/ti änvilcaih‘i h ier en tspr i cht dem obengenannten T arkaéästrades Harivafrs
'
a.
Von Bedeutung ist in d iesem Z usammenhange die Erw ähnungder änvik,cihi im Kautiliya . I
,2 w erden als Wissens cha ften
,die
der Kön ig kennen muß,die än vilc.3ilri
,die dre i Veden, Erw erbs
leben und Verw al tung au fgezäh l t . Von den Vert retern andererAns i chten dase lbs t s ind die S chü ler Brhaspatis zu nennen , die die
d re i Veden verw erfen, w e i l sie fü r den Kenner des Lebens, denlokayäträvz
'
d,nur e ine Verhü l lung, e ine Täuschung seien, w ährend
die S chü ler Manus in der Anv iksiki e inen Zw ei g oder ein Kennze i chen der V ede u sehen Jene w eltzugew andte Richtung derBärhaspatyas s timm t überein mit dem
,w as Brhaspati im S arva
s iddhanta-sairgraha I I , 1 5 sagt, Agnihotra , die dre i Veden usw .
seien eben nur ein Lebensun terha l t fü r die Leute ohne Verstandund Kraft ; ein Kluger so l l auf der We l t ste ts durch si chtbareMitte l w ie Ackerbau
,Viehzucht
,Hande l und Verw a l tung der Genüsse
te i l haft w erden : es i s t die Leh re des re in praktis chen Lebens .Es verdien t bemerkt zu w erden
,daß im Prabodhacandrodaya
Cärväka eine Brhaspati nahes tehende Ans i ch t au sspricht : vatsa
jänäei dan c_ianitir eva vidya atraz'
va vär ttän tarbhavatfi ) : „die Dan
daniti a l lein ist die Wissens chaft ; h ier in ist die von dem Leb enentha l ten “
.
Nach dem Kautiliya ist das s trenggenomm en die Meinung derU sanasschüler : dazu_
lanitir ekä vidya ; aber der Untersch ied ist nur
einer der Defini tion,n i ch t der S achef Wie die Brhaspatischüler
sagen, daß die Veden für den Kenner des Lebens nur e ine Verbüllung se ien , so fügt Cärväka in dem Drama seinem Bekenntn i szur e inzig w ahren Wissens chaft der Po l i t ik die Worte h inzu : „
der
Veda ist nur ein Ges chw ätz von Toren “.
kaccz'
n na lokäya t ikän b r ähm ana n s täta sevase anar thakuéalä
hy etc bäläh pa1‚u_
litamäninah dharmaéästr esu mukhyesu vidyamän esu du r
budhäh bu ddh im än v i k_s i ki vz präpya n irar tham. pravadan ti te Man
sieht h ier den Gegensatz zw ischen dem Vedabrahmanen und dem Angehö rigen der rationslisierenden Systeme, der in den nachher anzuführendenÄußerungen Kau tilyas und Brhaspatis so s ichtbar zum Ausdruck komm tund schon in die Zei t des Ramayana hineingeragt haben m uß.
S chw erl ich ist der Sprach geb rauch Menue ursprüngl ich .
p. 28 in Brockhaus ’Ausgabe.
22 Al fr ed Hillebrandt
In das Mudräräkaasa w ie in das T anträkhyäyika haben dieVerfasser Zi tate aus dem Leh rbuch des Kautilya v erflochten . Wirdürfen annehmen, daß auch die dem Lokayata-Sästra v on MaharajMahämoha“ zuges chr ieb enen Worte n i ch t erfunden
,sondern direkt
en t lehnt s ind : w ir finden in Akt 2 (p. 27) die S ätze , die in Kürzeden Gesam t inha l t der Lehre ausmachen : pr thiw-ap
-tqjo-vagavas
ta ttväm'
ar thakämau pum sär thau bhütäny eva cetayan tz'
nasti para
lokah mrtyu r eväpavargah; in den un ten gemachten Versuch , e in igeLehrsätze w iederherzuste l len, habe i ch sie z. T . mit aufgenommen.
Dasse lbe Kapite l Kautilyas beze i chnet nur Sankhya, Yogaund Lokäyata
l) als „
Anv iksiki“
. E in Mann w ürde sie andersdefin ieren und hat sie anders der orthodoxe S tandpunkterfordert, daß sie die Wissens chaft vom A tmen sei
,aber der des
Ksatriya und des po l i ti s chen Le iters verfolgt mehr die Ges chäfteder Wel t. Der Gegensatz zw i schen Brahmana und Ksatriya äußerts i ch
,w ie in dem religiösen Leben, so auch in Bew ertung der
Philos0phie und zeig t die Lin ie, auf der die Ksatriyas auch relig iöszu rationa l is ieren den Gedankenkamen. Auch Kautilya , der Poli tiker,hat gewiß die Meinung gehegt, daß der Vedanta den Theologen und n i ch t dem S taats lenker Bezei chnen d istnun
,daß Kautilya-Cäp akya im Mudräräkaasa in dem großen Mo
nologe, w or in er a l le seine Taten aufzäh l t, von seinem Intim usVisuuéarman spr i ch t, der un ter anderen Dingen in a u sa n a 8yäm
dandanityäm w oh l erfahr en sei,a l so in der von Usanas gelehrteu
S taats lenkun g,von dem se lben U éan as, der nac h dem Kautiliya
Säs tra den Veda verw irft und nur die Dandaniti m it der darinen tha l tenen Värttä anerkenn t. Kautilya hat a l so als d ieser Richtung nahestehend gegol ten .
Wir dür fen som i t in neben dem der Name U éanasau ftritt
, e inen der frühesten, h inter e inem Götternamen verborgenen
W eb e r (Bhagav ati II, 248) fuhrt aus dem Anuyogadvärasütra nebene inander buddhasasanapr, kävilam ,
Zogäyatanz an (s. dazu I .S tud. 1 7 , im
S aurapuräna w i rd 38 , 52 vom cär väkabauddhikädimärgah, 88, 54 von car väka,
bauddha, j aima , yavuna , käpälika , kaulika als Heretikern gesprochen .
2) Manu VI I I , 43 z it iert bei J a c ob i , Zur F rühgeschichte der ind.
Ph il . (S itzb . KPreuß. Ak . d. w . 1 91 1 , p.
S o auch J a c ob i p. 738.
Prabodhacandrodaya nennt Väcaspaü.
Z ur Kenntn is der indischen Material isten 23
Verfasser e ines po l i ti schen Werkes sehen , w enn auch die ihm
zuges chriebenen V e r s e s chw erl i ch von ihni s tammen und schw erl i c h meh r als e ine bequeme, populare Er l äu terung seines System ss ind. Die hedon istisc he S ei te der Lehre kann nur als ein Ausfluß
der auf die We l t gestützten Ans chauungen, n i ch t als die Grundlage angesehen w erden die Gegner der Materialistenschule, m itderen Grundsätzen sie s i c h auseinandersetzten, w erden j ene Fol gemehr als nö tig und zu demonstrativen Zw ecken hervorgehobenhaben, so w ie der bekanntes te spätere Anhänger der Lehre denGläub igen als ein S chreckb i ld roher und n iederer Ges innung dargeste l l t w ird . Im Mahabharata erscheint er als Duryodhana befreundeter Räksasa, der e ins t im Krtazeitalter Buße getan und
groß es Ansehen erw orben hatte. Er naht dem Kön ig Yudhisthirain Gesta l t e ines Bhikan m it Rosenkranz
,Haar locke und Dreistab
und sagt zu.ihm im Nam en von Brahmanen :
„Web über d i ch ,
den s ch lechten König,der seine Verw andten ersch l ägt. Was sol l
d i r das Re i ch,w enn du die Verw andten verni chtest . U nd has t
du deine Gurus ersch lagen, so ist dem Leben der T od vorzuziehenC . hat dam i t eigentl i ch n i chts Böses getan
,aber die empö rten
Brahmanen,die in ihm den Freund und He l fer Duryodhanas sehen ,
töten ihn mit i hrem Zauberspru ch . Der Ge i st des s trengen Brahmani smus hat ihm d iesen Zug aufgeprägt. Nach dem S aurapurär_1aw i rd Madhu einst als verkappter Cärväka ers che inen und den
Sivaglauben stören Charakteri stischer ist Jabal i im Ramayana,dem Cärväka noch unbekannt w ar
,geze ichne t. Die S i tuat ion
w i rd sehr gu t gesch i l dert und der Materia l ist zu d em frommenRäma in so w irksamen Gegensatz ges te l l t
,daß ic h diese S te l le
n i ch t für unecht ha l tenWas w ir an Materia l zur Wiederhers te l l ung einiger S a tze
des Cärväka oder Brhaspatitextes haben , ist n i cht vie l ; es be
1) Im Prabodhacandrodaya sind die grobereu Sätze dem Cärväka
zugete il t .XI I
,39
,2 if. (S udind. Ausgabe 37 , 25 ff .)
40,61 ; W. J ah n p. XVI I .
Anders ist es mit dem folgenden , auf Buddha bezügl ichen Abschn i tt,in dem d ieser als Nas tika dargestel l t w i rd. Wie vorher S c h l e g e l (praef.I , XV), L a ss en (IAK I 2 59 1 hat J a c o b i ihn für unecht erklärt (Rämäyanap. 89
24 A lfred Hi l lebrandt
s chränkt s i ch , sow e i t i ch sehe, auf die Darste l l ungen v on Har idie k le ine Übers i ch t über se ine
Lehre in Sankaras Kommen tar zu Brahmasütra III, 3, 53 und
v ersch iedene S tel len in den S äfikhyatexten, die Garbe hervorgehob en und besprochen sch l ieß l ic h das Drama Prahodhacandrodaya. Die Grundsätze, w e l che heftige Anfe ind ung fandenund ja in der T at a l le Systeme der Gegner um zustürzen geeignet gew esen w ären, w enn sieVerehrer genug gefunden hätten, s indnichtzah lrei ch : 1 . Ers tens lehrtGärväka das Vorhandensein von vier Elementen ;2.daß die S ee le oder der Intellekt n i cht an und für s i ch bestehe, sondernaus der Mischung der Elemen te hervorgehe ; 3 . daß es ein Leben nachdem Tode n i cht gehe, ebensow en ig S chu l d oder V erdienst, sondernGlü ck undUnglü ck an demMenschen svabhäva hatte ; 4 . daß es ke inenanderen Bew e i s als den Augens che in gäbe . Das i st bekannt ;es sei mir aber der Versuch gestattet, e in ige der Lehrsätze, so
gut i ch kann,auf Grun d der Que l len herzuste l len ; i ch w e iß , w ie
unsi cher er ausfäl lt,da m it fre ien Widergaben durch die Kommen
tare und an deren Mögl i chke i ten gerechnet w erden muß ; i ch gebeihn daher mit a l lem Vorbehal t.a r t h a käm a u pu r u sär t h a u .
Prabodhacandrodaya Akt 2.
prt h iv y äpa s t ej o v äy u r i t i t a t t v än i.S o Haribhadra, LTN v . 1 1 1 als An s icht der Bhütavädins mit ganz ge
ringer Abw eichun g ebenso (w thivyaptej oväyavas t . ) Prabodhacandrodaya ;
888 v . 1 : ta ttvam bhütacatu‚s
_
tayaw p _r thivy äpas tathä tejo väyuh; SDS
prthivyädin i bhütäm'
ca tvär i ta tt väni und der Vers : atra ca tvär i bhütäm'
bhüm iväryanaläniläh ; Sahkara zu Vedäntasütra III, 3,54 : na hi bhüta
catus_tayavya tir ekena lokäyatilcah kim cit tattvam pratyeti ; Säükhyw SütraI I I , 1 8 : cäturbhau tikam (éar iram) ity anye.
1) Haribhadra, Saddaréanasamuccaya ed. L . S u a l i ‚ BI. 1905 11 . (das
Heft ist mir nicht zugänglich) und G iornale de l la S ocietä As. I t . 18,1 900
, p. 263 ff. ; S u a l i , Matériaux pour serv i r a l‘histoire du Matérial ismeIndien, Le Muséon , N. S . 9 , Louvain 1 908, p. 27 7 if.
2) the Sarvasiddhäntasm graha of Sahkaräcärya ed. w i th an E ngl ish
translati on by M. R a rigä c äry a ,Madras 1909 .
3) S chon von C o l eb r o o k e
, Misc. E ss. I 2 p. 428 ff. angeführt.G a r b e , Sä6khyaphilosoph ie p. 1 22fi . ; Sankhya-Sütra-Vr tti I I I , 1 7 — 22 ;
V ,89
,130 ; Särikhyat at tva
-kaumudi zu Kärikä 5 . Aus Sa1ikaras DigvnayaKapite l 25, habe ich Material n icht entnehmen können .
26 A lfred Hi l lebrandt , Z ur Kenntn is der indischen Material isten
mänam tu ak_sam eva SDS : pratyaksa ikapr amanaväditayam cmänader
anar'
zgikärena p rämäztyäbhävät ; S S S : p ratyak_sagamyam evästi nästi adrstam
ad_re‚
tatah. Die Ab lehnung al ler Bew eism itte l w ird e ingehend in SDS . dar
ge legt . E inzelne Andeutungen w eitergehender E rörterung finde ich Knaumäfi jali I , 370, 7 (Cow el l 27 ) cärväkas tv äha kim yoyyatäviéesägraheqca yan
nopalabhyate tan na'
sti.
u db h üt a r üpan ib an dh an am dr a vy apr a ty ak sa t v am .
Aniruddha zu Säi1khya V , 89 (G a rb e , Sähkhyaphilosoph ie p.
a drstäsiddh a u t adadh isth ät r t ayäpi n e s'
v a r a s iddh ih.
Nyaya-Kusumä‘üjali ed. BI. I, 32 Kommn äs t i pa r a lok ah.
Prab odhacandrodaya.
lo k a v y a v ah är a s iddh ah (iévarah).Nyaya-Kusumäüjali ed. BI. I , 17 ; Komm : leketi ya thä loke vyavahriya te
caturbhujädy upetadehavän na tv ad_raga ity ar thah ; Haribhadra LTN : m anda
_ir
anyasya kart;rtvam upadiéyate ; SDS : lokasidrflzo räjä parameévarah .
m r t yu r e v äpa v a r gah .
Prabodhacandrodaya.
lok o t t a r a de é e 10 ko t ta r a sr ak ca nda na v a n it ädiläb h a e v a
m u k t ih.
Anir uddha zu V,80; G a r b e , Sähkhyaphilosophie p. 125 .
Es w i rd gew iegteren Kennern der phü030phischen Literatu rvorbeha lten b leiben müssen
,d iese S ätze zu verbessern und neue
dazu zu finden .
Land und Wasser als Staatseigentum.
Von
J ulius Jolly (Würzburg).
Bekann tl i ch ga l t nach Megasthcnes das Land übera l l in Indienals königl i ches Eigentum ,
und kein Privatmann durfte Grunds tückebesi tzen : T fig dä xcbgag ,
u w &obg T SÄO ‘
ÜO'
L s tp ßam.l el did: 't Ö n äoa v
z iyv’
Ivdex1‘
3v ßaöt l tm) tt eiva c, idu bzy; 639 ,unöev i yijv aexz ij0 3 a t
xwgig öé f i) ; zezé gznv eig T Ö ßaovh xöv Man
hat die Richtigkei t d ieser Angabe bezw e i felt, w ei l in den Sm ;t isdas Privateigentum an Grund und Boden anerkann t w ird und die
Acker nur nach ihrem Ertr ag besteuert w erden . Doch is t derGedanke, daß das ganze Land dem König geh ört, ein ech t indis cher,ein Grundsatz des a l tindischen S taatsrech ts, und w i rd in den Smrtisdeutl ic h ausgesprochen. S o gebührt nach Manu 8
,39 dem Kön ig
die Häl fte von a l len a l ten S chätzen und Meta l len in der Erde,w e i l er der Herr des Bodens i st (bhamer adhipa tir hi sah). B ü h l e rerb l i ckt in d ieser Bemerku ng e inen klaren Hinw ei s auf die Lehre
,
daß das Eigentum an a l lem Land dem König zusteht. Nach Visnu3,55 gehört der gesam te Ertrag der Bergw erke dem Kön ig. Nach
Närada 7,6 geb ührt jeder S chatz dem Kön ig
,außer w enn ein
Brahmane ihn gefunden hat. Wei tere Be lege s . „Recht und S i tte “
30.
S ehr beachtensw ert für d iese Frage ist nun ein in S o r a bj is
Notes on the Adhyaksha-Pracära (Allahabad 1 9 14
,Würzb . Dis s .,
p. 55) gedruckter sloka aus Bhattasvämins Kommentar zum KautiliyaA rthas
'
ästra :
r äjä bhüm er patir d_
r‚stah s
'
ä"
straj fzair udakasya ca
ta‘
bhyam anyat tu yad dravya7_n tatr a avämyam ku tumbinäm
C. Mü l l e r , F ragm. h istoricorum Graecorum I I , p. 406 , vgl. 429 .
28 Jul ius Jo lly
„Der Kon ig w ird von den Kennern der Wissens chaft als der
Eigen tümer v on Land und Wasser b eze i chnet. Was andereGegenstände als d iese b ei den s ind
, darüber können die Bauernverfügen .
“
Zi tiert w ir d dieser s' loka 1) in dem Kapi te l über die Pfl i chtendes sitädhya/csa (2, d . h . des Ackerbaum in isters
,der das S äen
und Ern ten auf den kön ig l i chen Domänen (svabhüvmu K. A . 1 1 5,14
,
vgl . 93, 1 6) zu besorgen und zu überw achen und gem äß dendafür verabrede
_
ten Bed ingungen die Reinerträge v on den Bauerneinzuz iehen Diese Reinerträge he i ßen sitä
,wonach der
sitadhyalcsa seinen Nam en hat, und w erden K . A . 60, 5 bei der Aufzäh l ung der S teuerque l len aus dem Rei ch an erster S te l le ge
nannt . Auf sitä'
beru h t auch die Bezei chnung ardhaä tika , die auchin den Gesetzbüchern als ardha3ir in
,ardhika vorkomm t, nach
K . A . 1 1 6 , 1 9 sind es l änd l i che Arbe i ter, die das n i ch t angesäte Land bearbe i ten und da für die Hälfte des Ertrags erha l ten.
Daraus,daß das Wasser königl i ches Eigen tum ist
,erk l ärt s i ch
die Wassersteuer udakabhäga, die nach K . A . ein F ünftel, ein Vierte l ,oder ein Dri ttel der Ern te betragen so l l , je nach dem die Bew ässerungder Fe l der dur ch Handarbeit oder durch Verw endung v on Bu l lenoder dur ch Pumpw erke ges ch ieht. Vie l lei ch t w ar aber die Lehrev on dem S taatseigen tum an Wasser von den indis chen S teuertheoretikern nur erfunden
,um dam i t die Erhebung der Was ser
s teuer zu motivieren, von der in den Smrtis noch ke ine Rede i st.Nach der Au ffassung S h am a S a s t r is “
) b i l det . dieselbe eine Ergänzung zu der Grundsteuer, die nach K . A . 1 1 6
,20 bei den
svav77y0paj ivinah d . h . F eldarb eitern in der Rege l ein Vierte l oderFün fte l der Ern te betragen sol l . Die Vierte l der Ern te, die au chM. 10, 1 1 8 in Notze iten als S teuer erheben läß t, er innern an die
zezoigm b ei Megasthenes, sow ie an di e spätere Cotth , die als
Tribut erhoben w urde. Ge irr t hatte Megasthenes nur dar in,daß
er den gan zen Ackerboden für konig l i ch h ie l t, w ähr end es zwe i fellosau ch sehr v ie le Privatäcker gab , w ie n i cht nur aus den Smrtis und
den Ins chriften,sondern auch aus K . A . 1 1 6, 21 hervorgeht :
1) Vgl. dazu V . S m i t h , E arly History of India ° (19 14) p. 13 1 .
Vgl. B a rn e t t,Ant iquities of India (1913) p. 102.
IA 1 905, p. 1 10.
Jul i us Jol ly, Land und Wasser als S taatseigen tnm 29
anya tra h:rcehrehhyah svasetubhyah „außer bei schw er zu b este l lenden
Hier w i rd a l lerd ings das avasetubhyah im Kom
menta r und in der Münchener HS . 335 von hrechrebhyah abgetrennt und zum fol genden Paragraphen gezogen . Auch in der
ob igen Aufzäh lung der S teuerque l len fo lgt auf sitä direk t bhagaK . A . 60 , 5 , w om i t offenbar das nach a l l gem e iner Lehre von den
Bauern an den Kon ig zu en tri chtende S echste l der Ernte ihrerPr ivatfelder geme int i st . Auch K . A . 22
,1 9 i s t von dem dhanya
sa c_
ibhäga des Kön igs die Rede,ähn l i c h 93
,1 6 ; Grundsteuern im
a l l geme inen w erden oft erw ähnt.S o nach S h am a S as t r is neuer Übersetzung p. 11 4 , früher fo lgte er
dem Komm .
Uber das Verhältn is des Vedanta zum Sankhya 31
nannten Smrti das Sankhya ; mit Rech t, w ie aus dem 3 . S utraetena l yah pratyälchyätah
“ hervorgeh t. Denn w enn die Widerlegung cr Yoga-Smrti durch diej en ige e iner andern Smrti gegebenist
,kan m it letzterer nach Lage der D inge nur die Sankhya
Smrti gereint se in, w ie denn auch auf bei de zusammen in I V,2,3 1
mit smä.e etc. Bezug genommen w ird S o gib t also der S ütrakäraselbst z verstehen, daß er im ers ten Adhyäya gegen das Sankhyapolemisi
r t hat,und zw ar n i cht durch Wider legung seiner ph i lo
s0phischn Grundsätze denn d iese erfo l gt ers t später, im2. Päda les 2. Adhyäya sondern durch den Nachw ei s
,daß
die Ber ung des Sankhya auf die he i l ige S chrift bei r i chtigemVerstän .is der betreffenden S te l len n i ch t S ti c h hä lt 2).
Vo zw ei ten Adhyäya an verfo l gen w ir nun den Faden ru ckw arts , u . se in anderes Ende zu finden. Der 4 . Päda des 1 . Adhyäya
ist, w ie 3h ib a u t bemerk te, der Po lem i k gegen das S änkhya ge
w idmet. Deu t l i c h geh t die s aus dem ersten S ütra hervor : änu
inäm7fan apy ekesäm iti een na etc.
“ I f it be sa i d that some
I il äufig sei hervorgehoben ,daß beide Ausleger un ter den andern
Smr tis a b das Mahäbhärata nennen und daraus A ussprüche des sogenanntenepischer Sankhya z i tieren . Wäre letzteres das ursprüngl iche Sankhya gew esen , s würden s ich Sankara und die früheren Kommentatoren d iesenUmstand ei der Bekämpfung des „ph i losoph ischen“ Sankhya n icht haben en t
gehen la en ; aber sie w issen n ichts dav on . Sol l ten sie das h is torische Verhältnis i b t mehr gekannt haben ? Dann müßte dasselbe auch für denSütrakärzangenommen w erden ,
der das„epische“ Sankhya kurzw eg ignorie rt.
U nd doc stand er ihm ze itl ich noch v iel näher. Denn die A bfassung derBrahma i1 tr as w ird man spätestens gegen 500 n . Chr. , die S chlußredaktiondes MBh n icht v or 100 n . Chr. setzen dürfen . Die ph i losoph ischen S tel lendes MBh gehören überd ies nach al lgemeinem U rte i l zu den spätesten Te i lendes E pos Die mystischen Spekulat ionen des MBh . als
„episches“ Sankhya zu
b ezeichne, ist mindestens irreleitend ; w arum w ähl t m an n icht die gut
ind ische enennung Pauräp ika?'h i b au t sagt im Anschluß an die im Tex t z i t ierten Worte : What
ever the xt titude of the other so—cal led orthodox systems may be towardsthe Veda he Sankhya system is the on ly one whose adheren ts w ere anx iousand actully attempted to prove that the ir v iew s are w arranted by
scriptura‘
passages. T he Sänikhya tendency thus w ould b e to show that allthose v e c tex ts Wh ich th e Vedä
'
ntin cla ims as teaching the existence of
Brahman the in tel l igent and sole cause of the w orld,refer either to the
pradhana or some product of the pradhana , or e lse t o the purusha in th e
Sankhra case, i . e. t he indiv idual soul .
das Verhaltnis des Vedanta
zum Sankhya.
Von
Herm ann Jacobi (Bonn).
In der Einlei tung zu seiner Übersetzung der Vedanta Sutras(SBE v ol. 34
,Introd . p. XLVI) hat s i ch G. T h i b a u t
,dessen
Hins che i den unsere Wissens chaft e ines ih rer verd ien testen,durch
F leiß,Wissen und S char fs inn in se l tenem Maße ausgezei chneten
Mitarbei ters beraub t hat, über das Verhäl tn i s der Vedanta Sütraszum Sankhya fol gen dermaßen geäußert : “T he fi fth adhikarapa (des
ersten Päda des ersten Adhyäya, S ütra 5 — 1 1 ) al ready declaresi tsel f agains t the doc trine that the w or l d has sprung from a non
intel l igen t princ iple, the pradhana, and the fourth pada of the
f irs t adhyäya returns to an express polem i c aga inst Sankhya imtenpretations of certain vedi c statements. It i s therefore perhaps notsay ing too m u ch i f w e ma in tain that the entire fi rs t adhyäya isdue to the w ish
,on the part of the S ütrakära, to guard h is ow n
doctrine agains t Sankhya attacks .” Es so l l zunächst versuchtw erden, die e ins ch lägigen Tatsachen genauer festzustel len und
i hre Bedeutung zu bestimmen .
Das ers te S ütra von Adhy. 2,Päda 1 lau tet im Text m it
T h i b a u t s Übersetzung nach Sankara (p. dem S inne nachübere instimmend au ch nach Rämänuja (SBE
'
vol. 48, p.
smyctyanavakäéadosaprasanga iti een v a
’
nyasmgtyanavakäéad0mpra
sangät.‘
„If i t be obj ected that (from the doctrine expounded
hi therto) there w ou l d resu l t the fau l t of there being no room for
(certa in) Smrtis ; w e do not adm it that objection, because (fromthe rejection of our doctr ine) there w ou l d resu l t the faul t of roomfor other Smrtis.
“ Be i de Erk lärer verstehen unter der zuers t ge
32 Herm ann Jacob i
(Upan isads) m en tion that w h i ch is based on inference (i . e . the
pradhana) ; w e deny th is” usw . Die behande l ten S te l len entha l tendenn auch Ausdrücke, die im Sankhya techn is che Bedeutunghaben . Man beach te aber im Sütra das zw e i te Wort api ; es
deu tet an,daß dasselbe Prob lem s chon vorher, a l so im 3 . Päda
‚
behande l t w orden ist und jetzt nur noch ein besonderer Tei l fo l gt,
in w e l chem die vorgeb l i chen Sankhya Term ini in gew issen U panisads erörtert w erden sol len .
Der 2. und 3 . Pada w erden von den E rklarern als zusammengehorig betrachtet. Sankara sagt (p.
“Now certa in otherpassages presen t themse l ves w h i ch because con ta in ing on ly oh
s cure in di cations ofBrahman give r ise to the doub t w hether theyrefer to the highest S e l f or to som ething e l se . We thereforebegin the second and th ird padas in order to sett le those dou b tfu l points .” Rämänuja sagt : “ T he secon d pada discusses thosetexts w h ich contain somew hat ob s cu re referen ces to the ind ivi dualsou l ; the th ird pada those w h i ch contain
l
c lear references to
the same (p. In der Hauptsache w ird,sow ei t es s i ch
um das Sankhya hande l t denn a l lerle i Exkurse und Berein
ziehen verw andter Gegenstande s ind ja in Sütraw erken n i cht zub eanstanden der Sütrakära die von den Sankhyas auf pra
dhana oder purusa bezogenen S te l len als in Wirk l i chke it dasBrahman lehrend erw ei sen w o l len . Daß ihm h ier immer dasS fmkhya in Gedanken l iegt, geh t aus se inen eigenen Ausdrückenhervor, näm l i c h s mär tam in I
,2,1 9 und anum änam in I , 3 , 3 ,
w e l che be i de von den Kommentaren aufpradhana bezogen w erden.
Aber die ausdrückl ich ste Widerl egung des pradhana als We l tu rsaehe findet s ich im ersten Päda , dessen 5 . Adhikarana ganzd iesem Gegenstande gew idmet i s t. Der Rest des Päda
,über
dessen Tendenz die Ans i chten der Kommen tatoren auseinandergehen
,behande l t m ehrere S chr ifts te l len , die auf den ersten Bl i ck
etw as Ungei stiges als We l tursache hinzuste l len s che inen,
abernach dem S ütrakära auf das Brahman bezogen w erden m üssen .
Wahrschein l i ch w aren sie von den Sankhyas als S tützen für ihreGrundans ich t benutzt w orden ; doch geben uns die Kommentatorendarüber keinerlei Auskunft. Denn Sankara und den Späteren lagn i ch t so sehr daran , den ursprüngl ichen S inn der Sütras festzus te l len , als vielm ehr sie zuguns ten ihrer eigenen Lehren auszu
Über das V erhältn is des Vedanta zum Sankhya 33
deuten . S o gibt Sankara manchma l zw e i Erklä rungen desse lbenS utra. von denen die bevorzugte seine e igene, die andere diejenige älterer Erklärer se in dürfte . In der T at mach t die Ratnaprabhzi , ein Komm entar zum Bhäsya, in e in igen Fäl len (zu denS ütras 12, 1 9 , 3 1 ) die Vrtti als Que l le nam ha ft. In v ie l en Fällenist die eigen tl i che Me inung des S ütr akära bei se iner aphor isti schen ,oft geradezu eni gmatis chen Ausd rucksw e i se n i ch t mit S i cherhe i tfestzustel len. Von besonderer Wich tigkei t w ürde d ies gerade beiden ersten fünf S ütras des ersten Päda se in . Denn
,w ie oben
gesagt, beginn t m it dem fün ften S ütra die Widerlegung des pradhäna als We l tursache ; j edoch erfah ren w ir aus d iesem S ütra
se lbst n i cht,daß h ier die große Po lem ik gegen das S fmkhya an
hebt. Es steh t daher zu v ermuten,daß die Losung des Rätse l s
in den vorausgehenden S ütras zu suchen ist , die w ir darum unterdie Lupe nehmen w o l len .
Ich setze zunachst den Text und T h i b a u t s Übersetzung derfunf ers ten S ütras h ierh in, und zw ar für S utra 3 — 5 sow oh l nachSankaras a ls auch nach Ramauujas Auffassun g.
1 . athä’
to bra/unajzj fzäsä. Then there fore the enqu iry intoBrahman.
2. j am nädy asya yatalz. (Brahman i s that) from w h ich the
origin, etc. (i . e . the origin, sub s is ten ce, and disso l u tion) ofth i s (w or l d proceed) .
3 . éästr aym z
'
tvät. S a n k a r a : (T he omnisc ience of Brahmanfo l low s) from i ts be ing the source of S cripture. Ra
m än uj a : Because S c ripture is the source (of the know ledgeof Brahman).
4 . ta t t u sam anvayät. Sa n k a r a : But that (Brahman i s to
b e know n from S cripture), because i t i s connected (w i t hthe Vedanta texts) as the i r pu rport. R ei m än u j a : But that(i . e . the author i tativeness of S cripture w i th regard to the
Brahman) exis ts on account of the connexion (of S cr iptu rew i th the highest aim of man).
0 . ik,sater nä’s’
abdam . S a n k a r a : On ac count of seeing (i . e .
th inking be ing attributed in the Upan isads to the cause of
the w orl d ; the pradhana) i s not (to be identi fied w i th thecause ind i cated by the Upanisads ; for) i t i s not founded
Festsc h rift Ku hn . 3
32 Hermann Jacob i
(Upan isads) men tion that w h i ch is based on inference (i. e. the
pradhana) ; w e deny this” usw . Die behande l ten S te l len entha l tendenn au ch Ausdrücke, die im S i mkhya techn is che Bedeutunghaben. Man beachte aber im Sütra das zw e i te Wort api ; es
deu tet an,daß dasse lbe Prob lem s chon vorher, a l so im 3 . Päda
‚
behande l t w erden i st und jetzt nu r noch ein besonderer Te i l fol gt,
in w e l chem die vorgeb l i chen San khya Term in i in gew issen Upani5ads erörtert w erden sol len .
Der 2. und 3 Pada w erden von den E rklarern als zusammengehorig b etrachtet. Sankara sagt (p.
“Now certain otherpassages present them se l ves w h i ch because con ta ining on ly oh
s cure indi cations of Brahm an give r ise to the doub t w hether theyrefer to the highes t S e l f or to som ething e l se. We thereforeb egin the second and th ird padas in order to sett le those dou b tfnl points .” Ramanuja sagt : “ T he second pada discusses thosetexts w h i ch con tain somew hat ob s cure references to the indivi dua lsou l ; the th ird pädai those w h ich conta in
.
c lear referen ces to
the same (p. In der Hauptsache w ird,sow e it es s i ch
um das Sankhya hande l t denn a l lerle i Exkurse und Berein
ziehen verw andter Gegenstande s ind j a in Sütr aw erken n i cht zub eanstanden der S ütrakära die v on den Sankhyas auf pra
dhi ma oder purusa bezogenen S te l len als in Wirk l i chkeit dasBrahman lehrend erw e i sen w ol len . Daß ihm h ier immer dasSankhya in Gedanken liegt, geh t aus se inen e igenen Ausdrü ckenhervor, näm l i ch s mär tam in I
,2,1 9 und anumänam in I
,3,3,
w e l che be i de von den Kommentaren aufpradhana bezogen w erden.
Aber die ausd rückl ich ste Widerl egung des pradhana als We l tursache findet s i ch im ersten Päda
,dessen 5 . Adhikarana ganz
d iesem Gegenstande gew idmet i s t. Der Rest des Päda,über
dessen Tendenz die Ans ichten der Kommentatoren ause inandergehen, behande l t mehre re S chr ifts te l len, die auf den ersten Bl i cke tw as U nge istiges als We l tursache h inzuste l len s cheinen , abernach dem S ütrakära auf das Brahman bezogen w erden m iissen .
Wahrschein l i ch w a ren sie von den S fmkhyas als S tützen für ihreGrundans ich t benutzt w orden ; doch geb en uns die Kommen tatorendarüber keiner lei Auskunft. Denn Sankara und den Späteren lagn i ch t so sehr daran , den ursprüngl ichen S inn der Sutras festzuste l len , als vielm ehr sie zuguns ten ih rer eigenen Lehren auszu
Über das Verhältn is des V edanta zum Sankhya 33
deu ten . S o gibt Sankara manchma l zw e i Erklärungen desse l benS utra
,von denen die bevorzugte se ine e igene, die andere die
jenige äl terer E rkläre r se in dü rfte . In der T at mach t die Ratnaprabhä, ein Kommentar zum Bhäsya , in e in igen F äl len (zu denS utras 1 2
,1 9
,3 1 ) die Vrtti als Que l l e namhaft . In viel en Fäl len
i s t die e igentl i che Me inung des S Ütrakitra bei se iner aphoristis chen ,oft geradezu enigmatis chen Ausd rucksw e i se n i c ht m it S i cherhe i tfestzustel l en. Von besonderer Wich tigkei t w ürde d ies gerade beiden ersten fünf S utras des ersten Pada se in . Denn
,w ie oben
gesagt, beginn t m it dem fün ften S utra die Widerlegung des pradhana als We l tursache ; jedoch erfahren w ir aus d iesem S ütra
se lbst n i cht,daß h ier die große Polem ik gegen das S ankhya an
he bt. Es steht daher zu v erm uten,daß die Losung des Rätse l s
in den vorausgehenden S utras zu suchen i s t , die w ir darum unterdie Lupe nehmen w o l len .
Ich setze zuna chst den Text und T h i b a u t s Übersetzung derfün f ers ten S ütras h ierhin , und zw ar für S utra 3 — 5 sow oh l nachS ankaras als auch nach Ramänujas Auffassung .
l . a thä’
to brahmajzj r'
zäsä. Then there fore the enqu iry intoBrahman.
2. j amnädy asya ya tala (Brahman i s that) from w h ich the
origin,etc . (i . e . the origin, sub s i stence, and d isso l u t ion) of
th is (w or l d proceed).3 . éästray0m
'
icät. S a n k a r a : (T he omni s c ien ce of Brahmanfo l low s) from i ts be ing the source of S cripture. Ra
m än nj a : Because S cripture i s the source (of the know ledgeof Brahman).
4 . ta t tu sam anuayät. S a n k a r a : But tha t (Brahman i s to
be know n from S c ripture), because i t i s connected (w i t hthe Védfmta texts) as the ir pu rport . Ram an u ja : But that(i . e. the author itativ eness of S cripture w i th regard to theBrahman) exi9ts on account of the connexion (of S criptu rew ith the highest aim of man).
5 . ik,sater nä’s’
abdam . S a n k a r a : On ac count of see ing (i . e.
th inking be ing a ttr ibuted in the Upan i sads to the cause of
the w orl d ; the pradhana) i s not (to be identified w i th thecause ind i cated by the Upanisads ; for) i t i s not founded
Festsch r ift Kuh n . 3
34 Hermann Jacob i
on S cripture . Räm än u j a : On a ccount of see ing (i . e.
th inking) that w i ch is not founded on S cripture (i . e. the
pradhana) i s not (w hat is taught by the texts referring tothe or iginat ion of the w or l d).Rämänujas Erklärung des 3. S utra w i rd au ch von Sankara
gegeben , aber an zw eiter S telle . Zw ei fe l los w ar sie die äl tere.
Die zuerst gegebene i s t verm utl i ch v on ihm se lbst erdacht, und
zw ar w e il er die Defin i tion des Brahman in Sutra 2 als We l tursache einer Ergänzung fäh ig, w enn n i ch t gar bedürftig erach tete ;denn das Brahm an ist die U rsache n i cht nur der materie llen We l t,sondern auch des Veda.
“
S o erk l ärt er : Brahman is the sour ce,i . e . the cause of the great body of S cripture, consi sting of the
Rgveda and other bran ches etc . (p.
Im 4 . Sutra steh t tu nach Sankara, um den pür vapaksa , nachRämänuja, um e inen Einwu rf abzu lehnen , ohne daß das e ine oderdas andere in den vorhergehenden Sutras auch nur im le isestenangedeutet w äre ; sondern be ides i st freie Erfindung, die nur im
Kommentar s teh t.Was die be i den Ausleger
,jeder in seiner We i se, in das
5 . S ütra h ineintragen , i st mit dessen Wort lau t s ch lechterd ingsun vertr ägl i ch . Man kann nur übersetzen : „
Wegen des S ehens istes n i cht schriftw idr ig“
,oder
„das S chriftw idrige
“
, je nachdem man
aäabdam als Prädikat oder S ubjekt bzw . Prädikätsnomen auf
faßt. Wir kommen nachher auf d iese Frage zurück .
Die vorgetragenen Bedenken sowie der unvereinbare Widerspru c h der über l ieferten A us legungen untere inander b erechtigenund n ö tigen dazu , die in F rage s tehenden S utras ohne Rücks i chtauf die indis chen Aus legungen aus s i ch se lb st zu erkl ären .
Das Sütra : j anm ädy asya yatalz enthäl t e ine Defini tiondes Brahman . Aber ist es die des Vedäntin ? Diesem hättevielm ehr e ine andere nahege legen : astc
'
tävad l) Brah ma m'
tya
éuddhabuddham uktasvabhävazn sarvaj fzam sar vws'
alctt'
samanvitam,w ie
Sankara ad I und ähnli ch an zah lre i chen andern Ortensagt. Wo l l te aber der Vedäntin ja von dem Begriff der We l tursache”bei der Defin i tion des Brahman ausgehen
,so durfte dabei
1) Das einraumende tävad ze igt , daß es sich um etw as al lgeme in Be
kanntes und Anerkanntes handel t,sow ei t w enigstens die Vedäntins in Be
tr acht kommen .
Über das Verhältnis des Vedanta zum Sankhya 35
als notw endige Bes timmung Al lw i s senhei t und Al lmach t n i ch tfeh len, w ie denn auch Sankara ad I l , 4 sagt : (ad B r ahma sar va
j üa r_n sar vaéakti j agadu tpa ttisthitz'
layakär azzar_ n Vedäntaéästräd evä'
’
vagamyate. Ein fach als causa materia l ie der We l t defin ieren aberdie Sankhyas das Brahm an. Denn bei i hnen i st
„B rahm a
“
ein Synonym von prak_
r ti. S o sagt Gaudapäda im Kommentarzu den S änkhyakärikäs , v . 22 : pr al
v
_
r tilz pradhänam brahm a
avyalctam bahudhänakam m äyé°
t-i paryäyälc S om i t ist das 2. S ütra
der pürvapaksa, den der Sankhya-Phi losoph vertri tt. Die S uche
i s t also fol gendermaßen zu denken. Nachdem im 1 . S ütra die
Forderung der Brahma-F orschung ges te l l t ist,tri tt der Sankhya
Phi losoph mit dem An spru ch auf, das Brahman er forsch t zu haben.
„Das Brahman ist die Causa materialis des Al l s ; denn das i stdurch Aussprüche der He i l igen S chri ft begründet. “ éästrayom
'
tväi.
Hier ist éäst ra n i ch t Veda überhaupt, w ie Sankara es zun äch s terkl är t, sondern „Upanieadausspruch
“
,w ie er es in seinem
Kommentar öfters gebrau cht und so auch schon in unsererS te l le : éästr am udähgtam pür vasütze „ya to na imäm
'
bhütäni
j äyante“usw . In derse lben Bedeutung verw endet der S ütrakära
se lb s t das Wort éästra in I I,3, 33 kar tä s
'
äsh är thavattvät (der j iva
ist ein Agens , w e i l nur so vedis che Aussprüche w ie yaj eta usw .
S inn haben) ; vie l le i ch t auch in I 1 , 30 . Die Upanisadstellen
(éästr a) , auf die s ich die Sankhyas f iir die S chriftgemäßheit ih rerLehre ber ie fen, w aren kosmogonische Beri ch te, namen t l i ch der inChändogya Up. VI
,2,der im Mitte lpunkt der w ei teren Polem ik steh t.
Hiergegen trit t nun mit dem 4 . S utra der Vedäntin auf: Die
Erkenntn is des Brahman ergib t s i ch n i c ht aus einer einze lnenS tel le, sondern (tu) aus der Üb ere ins timm ung a l ler
,aus ihrer
geme insamen Tendenz (samanvayät) . S o komm t die Partike l t uzu voller Bedeu tung ; denn der v on ihr ge forderte Gegensatz i s tnun w irkl i ch in den be i den vorhergehenden S utras ausgesprochen .
A l lerdings w ird n i ch t gesagt, w as das Wesen des Brahman nachdem übereinst immenden Zeugn i s der Upan isads sei; denn jederVedäntin w ei ß es : das Brahman ist etwas Ge is tiges
,n i cht aber
1) S elbst ein so später Schriftste l ler w ie Viraräghava bemerkt in se inem
Komm . zum U t t . RÄmacar . (p. 23 N. S . P . Ausgabe br ahma para
mätmä pradhänam ca . Die Bezeichnung des Brahman als pradhä'
nam
in 11 1 3, 1 1 hat w ohl n ichts mi t unserm Gegenstand zu tun .
Hermann Jacob i
die un in te l l igente Materie , das pradhänam ; auch als We l tursachei st es a l lw issend und a l lmächt ig. Hierauf, so ergib t s i ch aus dem
w e iteren Zusamm enhang, erhebt der Gegner den Einw urf : Aberdavon steht in unserer S te l l e n i chts
,da heiß t es nur sad eva
somyä’
dam agra asit,ekam evä
°
dvz'
tiyam . Die Antw ort des Vedäntingib t das 5 . S ütra : iksa ter na sabdam . Wei l es w e iter heiß t : tad
aiksata bahu syäm praj äyeye’
tz'
, tat tejo’
n ata , so i st unsere Behauptung von der In tel l igenz des Brahman n i cht w i l l kürl i ch ,sondern ist im Wortlau t der Hei l igen S chrift begründe t.
Die Kommen tatoren lassen die Po lem ik gegen das Sankhyaers t m it dem 5 . S ütra anheb en
,das sie verstehen, als w enn es
lautete : ik,sater nä”
n umäm'
kam oder v ie lm ehr, bei der sons tüb l i chen Wortfo l ge , n ä
”
numänikam iksateb. „Das pradhana i s t
n i cht das Brahm an“
u sw . änum änika i st gle i ch pradhana ; ni ch taber as
'
abda . Dies Wort komm t sons t in den S ütras n i cht m ehrv or ; es kann daher kaum e ine techn i s che Bedeutung gehab thaben , und die ihm von den Kommentatoren beige legte ergibt s i chn i ch t aus se iner Etymo logie . Der S ütrakära geb raucht ganzgew öhn l i ch , so s chon im fol genden Sütra, s
'
abda im S inne von
„Wortlaut der Hei l igen S chri ft, ein tatsäch l i ch geb rau chtes Wort “ .
aéabda b edeute t daher das, w ofür die Worte der Hei l igen S ch r i ftn icht angeführt w erden können. Der Zw eck der Po lem ik ist h ier,zu zeigen, daß pradhana n i ch t das Brahman der Upan isads se inkönne, daß es a l so as
'
abdam sei. Es w äre vol l ig ungereim t, daspradhana mit ds
'
abdam zu beze i chnen , w o erst erw iesen w erdenso ll
,daß es as
’
abdam i st. Faßt man dagegen aéabdam als
Präd ikat,das h ier vernein t w ird , so muß das S ubjekt erganzt
w erden ; dasse l be ergib t s ich aber aus dem abs i ch tl i ch v orausgeste l l ten ik,sateä ohne größere S chw ierigke i t, a ls sie der S ütrastil
zu läß t.Du rch me ine , w ie i ch glaube, ungezw ungene Auslegung w fid
der Zusammenhang der fünf ersten Sutras un tere inander durchausverständ l i ch und k lar ; j a man muß s ich sogar w undern , daß derdurchaus einfache Zusammenhang von Sankara und den Späterenso gründ l i ch fa l s ch gedeutet w erden konnte. Dam i t hatte es aberw oh l fol gendes Bew andtn is . Sankhya-Yoga w aren lange berei ts ,w ie w ir jetzt aus dem Kautiliyam w i ssen
,als ph i losophi s che
Systeme anerkannt,ehe es noch eine w issenscha ftl i che Upan isad
38 Hermann Jacob i
dem Zeugn i s des 5 . S ütra f ür die S chriftgemaßheit se iner Lehrev on der materie l len We l tur sache berief
,ist der 6 . Prapäthaka
der Chändogya Upanisad , der für den Vedanta die a llerhöchsteWichtigke i t hat, da in ihm die Vedanta-Maxime tat tv am asi“
n i cht w en iger als neunma l vorkomm t ; und zw ar k l in gt daraufjeder Khamla der zw ei ten Häl fte des Prapäthaka aus. Die ers teHäl fte ber ich tet zuers t über den Ursprung der We l t aus dem
einen, ze i tlosen S eienden, w orunter die Sankhyas ih r Brahman ,das pradhana, v erstehn. Dann fol gt die Lehre von den dre i Ure lementen , tejas äpas annam
,w e l che, w ie man l ängst erkannt hat,
Vorbil der und Vorgänge r der drei gunas des Sankhya sind . DieseLehre wird von Uddälaka, der im 6 . Prapäthaka als der Sprechendeersche int
,n i ch t als die se in ige, sondern als e ine s chon ura l te
b ezei chnet (VI 4 , 5 Dieses fürw ahr w ar es,w as die Al t
v ordem ,die Großen an Re i chtum
,die Großen an S chriftkunde
,
w ußten,w enn sie sprachen : ‘Nunmehr kann keiner uns etw as
vorbringen , w as w ir n ich t [s chon] gehört, n i ch t [s chon] verstanden,n i cht [s chon] erkannt hätten ! ’ Dies w ußten sie aus jenen [Glut,Wasser, Nah rung]; denn w as glei ch sam ein Rotes w ar
,das w ußten
sie als die Gesta l t der Glu t,und w as glei chsam ein We ißes w ar ,
das w ußten sie als die Gesta l t des Wassers,und w as glei chsam
ein S chw arzes w ar , das w uß ten sie als die Gesta l t der Nahrun g ;und w as gle i ch sam ein U nbekanntes w ar , das w ußten sie als
e ine Zusammense tzung eben jener Gotthe i ten (Glut , Wasser,Nahrung)
Diese a l te Lehre von den d re i U relem enten ist zw e i fe l loseine m a te r i a l i s t i s c h e Theor ie , die auf ih re Anhänger d iese lbeWirkung ausgeüb t hat, die a l le mater ia l istischen Theorien dankih rer platten Verstandesmäßigkeit haben m ögen ihnen nun als
Endursachen Atome und leerer Raum ,Kra ft und S toff
,oder w as
sons t immer ge l ten daß nam l i ch auf Grund e iner derart igenTheorie i h re Nachbeter glauben
,nun a l les
,a l les zu v erstehn .
Unser Upanisad-Ber icht gibt uns a l so n i ch t nu r Kun de von e ineru ra l ten rationali stis chen sondern l äßt auch deutl i cherkennen
,daß sie Eigen tum einer Art von S chule b i ldete.
1) Deu ssen ,
Sechzi 'g Upan ishads, p. 1 62.
Diese Tatsache ist v on großer Bedeutung, insofern sie die an s ichwunderl iche A ns icht w iderlegt, daß die al ten indischen Denker durchaus
Hermann Jacob i , U der das Verhal tn is des Vedanta zum Sankhya 39
Wir dürfen annehmen , daß e ine rational i st is che Theorie,die
e inen so l chen Anklang fand, s ich auch w ei ter in der i h r e igenen,
bei ih rem ersten Auftreten k lar ausgesprochenen Richtung ent
w i cke l te. I c h bin der Überzeugung, daß d iese Entw i ck l ung zum
Endziel die eigent l i che Sankhya-Philos0phie hatte, die R . G a r b esehr ri chtig als
„ind ischen Rationa l ismus“ gekennzei c hnet hat. Für
meine Ans ich t w ir d s ic h a l l erd ings kaum ein quellenmäßiger Be
w e is führen lassen , w ei l ja a l le a l ten Que l len der re l ig iösenLi teratur angehören und darum über den Rationa l ismus nur
dü rftige und entste l lende Zeugni sse entha l ten . Aber so sehr auchdie Re l igion zu w e l t l i chen Phi losophen im Gegensatz stehenmag, so l iegt es i hr doc h nahe
,sol c hen w ei tverbrei teten Phi lo
30ph ien die begriffl i che Unterlage ihrer Theologie zu entnehmen ,w ie s i ch dies denn au ch b e im Katho l i zismus gegenüber Aris tote lesund Plate
,beim Protestanti smus gegenüber neueren Philoswhen
gezeigt hat. S o hat au ch der indis che Myst iz ism us , der Trägerdes Upanisad-Gedankens, es n i ch t verschm äht
,den S toff zu seinen
Speku lationen aus der ze i tgenöss is chen„w issens chaft l i chen“ Phi lo
s0phie zu ent lehnen : in Chänd. Up. VI die Lehre von den dre iU relementen aus der rat iona l is ti s chen Theorie auf der erstenS tu fe ihrer Entw i ck l ung, im Käthaka und Sveta
'
évatara aus der
schon w ei t fortgeb i l deten Lehre, und in den ph i losoph ischen Te i lendes MBh . end l i ch aus dem fert igen S änkhyasystem . Dieses stoffl i cheAbhängigke i tsverhäl tn is des Vedanta vom S änkhyasystem m ußteden a l l gemeinen Glauben erw ecken, daß das S änkhya auf den
Boden der Hei l igen S ch r i ft gegründe t sei. S e in „Atheismus “konnte ihm dabe i ni ch t ernstl i c h h inder l i ch se in, da j a auch dieorthodoxe Mimärpsä-Philos0phie nach Kumärila bekanntl i c h in
dem se lben S inne atheisti s ch ist w ie das Sankhya .
vom Ideal ismus und Myst izismus b eherr scht gew esen se ien,und uns der ein
geb i ldeten Not wendigke i t überheb t , die indische Philosoph ie überal l an dieUpanisad-Lehren anzuknüpfen .
Sieben Erz ählungen in Braj Bhakha.
Von
J oh annes Her tel (Döbe ln ; z . Z . be im Heere).
Al s Ende Ju l i 1 9 l5 an den Verfasser die Aufforderung erging,zu gegenw ärt iger Festschr ift e inen Be i trag zu l iefern , “
m uß te er,
da er die Ehre hatte, als felddiensttaugliches Mitgl ied dem deu tschenHeere anzugehören, jeden Augenb l i ck gew ärtig se in, mob i l zu
w erden. Wo l l te er a l so n i ch t gänz l i ch auf e ine Te i lnahme an
der Hul digung für den großen Ge lehrten verzi ch ten, dem dieseBl ätter gew i dmet s ind, so konnte er nur einen Be itrag be is teuern,der in kürzester Zei t und ohne li teraris che Hil fsm it tel, die ihmin se iner Garn ison feh l ten
,abzu fassen w ar . Darum en tschloß er
s i ch,die Urs chri ften der Erzäh lungen herauszugeb en , v on denen
er auf p. 55 — 5 7 seines Buches Das Pafi catantra, se ine Ge
s ch i chte und se ine Verbre itung“nur kurze Auszüge gegeben hat.
Die Texte dieser Erzäh l ungen s ind genau nach den buchstabengetreuen Abs ch r i ften gegeben, die s i ch Verfasser seinerzeitaus der e inzigen b ekannten
,jetzt w ieder in Ind ien befind l ichen
Handsch r i ft genommen hatte . Aus rein äußerl i chen Gründen er
s cheinen sie in Um sch ri ft. Diese Um s chri ft ist g r aph i s c h , n i c h tph o n e t i s c h , so daß a l so das han dschriftl i che für lautl i ches Ichübera l l be ibeha l ten i st. Dabe i s ind die stammen 0. ü b e r die Ze i lengesetzt. Die orthograph ischen S chw ankungen zw ischen e /ai,zw i s chen ü/o/au , zw i schen y und j sind ebensow en ig b ese i tigt, w iedie S chw ankungen im Gebrauchs des Anusvara. hivai und havaz,m a ti und m at“
,talava und taräv“
usw . stehen nebene inander. Die
sog. Dati v-Postposi tion lautet me ist [com,se l ten kaum und kau . Die
1 . und 3. pl ur. aor . hat gew öhn l i ch ke inen Anusvara. Dagegentritt der Anusvara man chma l auch an S te l len auf
,w o man ihn
n i cht erwartet. Re i chli cheres handschr i ft l i ches Materia l könn te
S ieben E rzählungen in Braj Bhakha 4 1
v i e l l e i c h t e ine E ntsche i dung da rüber ermoglichen, w e l che Formende r Abs ich t des Ver fassers entsprechen , w e l che etw a durch dieMundart oder die Nach läss igke i t von Abs chre ibern entstanden sindund w e l che s ic h e tw a herkömm l i cher S ch re ibung ans ch l ießen .
Wahrsche inl i c h w ar aber schon der Ve rfasser der Erzäh l ungenn i ch t ganz fo l ger ich tig. Denn die tertiären Präkrts sind n i ch t
„grammat is ch norm iert “
,und w as im Mrcchakatikam von
den südl ic hen Mundarten gesagt w i rd,das gi l t auc h von den „
neu
ind is chen “ Sprachen des Nordens . Wenn Zei t und Umstände es
er laub en,hofft Verfasser später e ine Anzah l von Texten in a l te r
Kajasi-häni und in Braj Bhakha herauszugeben,die n i ch t nur für
die Gesch ichte der neuindischen S prachen, sondern auch für diedes S anskrit w i ch tig s ind .
Z um le i chteren Vers tändni s hat Verfasser in den fol gendenE rzablungen
'
eu ropäische Interpunktion verw endet und s inngetreueÜbersetzungen beigegeben . S ie en tha l ten an einigen S tel lenBesserungen der in me inem oben genannten Buche gegebenenAuszüge.
I,9 : D e r S c h a k a l , s e i n W e i b u n d d e r L ö w e .
Tha li des“ m ai Las i namm“van“
. tin“van
“ visai Bodhunamma
syär“
am Podhi namm“syär
“ni rahai . sau ek“ din“
syara ni kom ati trsä bhai . tab“ syarani pam ni pivni kon_1 ca l i .tab“ syär
“ bolv au : , bhad re, kahärn jat“ hau ?“ tab“ un“ kah i
„mai pamni pivn i korn jat“ baum“
. tab“ bhar“ tär“ bolyau : „ ake l ikaisai jat
“ya van
“ mai? terau rüp“ des
“ koü pak“r i le jät“hai. ta tai sari rahau . me teri säth“ äüm.
“ tab“ ve donumca le . mar“g“ jäte tab“ syär
“ni „ aho pty
“,tum“ mai
ketok“ paräkram“ hai? “ tab“ syär
“ kahi : „merai gut “ ki dat
caust“ tan aka la hai ; nur“ tin“
som sathi yuddh“ simgh“pratim
na jatyau“
) hün_1 a isa i vät“ kar“ t“ ek“ ta lav“ äyau . tab“ un“
taräv“ m em ek“ s i-mgh“ baithyau desyau . tab“ eyara kahi : „agn itan simgh
“ baithyau hai !“ tab“ syär
“ni bo l i : simgh
“ tem laräi karl
1) Hs . chüjhi .
D ie L esa r t is t unsicher . Die Handschr ift hat jatyai, an da s ein. 5
so angehängt ist, daß der obere i-B ogen die beiden ai-S tr t'
che von un ten nach
oben durchzieht. E s ist auch m öglich , daß jatyi gemein t, also das 5 getilgt
se in soll. J edenfalls liegt ein A qua-ivalen t von Hindi j ity
avor .
42 Johannes Herte l
mari lehü ! “ tab“ syar“ kahi : „m ai to sum kah i thi , so par
“pari .
pai ab“ tan m e ri gämd“ phat“hai . “ tab“ syär
“ni boli : „
tum pai
guru ki dai caust“ mit“ hai. tan yä simgh
“ kom ka i se i hhay“
mam nat“ hau ? nisamk“ ca lau ! “ tab“syär
“ kahi : „m eri tanmat“ hü ca li jat“ hai. “ tab“
un“ kahi :
„kaisai ca li jat“ hai? “
tab“ syär“ kahi : „ batrisau ek“
säth“ hi cali . ta pi cha i, desan,have? ) cyär
“ jat“ hai. b i va i doya jat“ hai. ' hava i ek“jat
“ hai.
ab“ tan ek“ hi rahi hai. “ tab“ syär“ni boli : „jan ek“ mat“ hai
,
tan sah“ vat“ hai. nit“ mai kahi hai: » ek“ mata i to gadh“ lijat“hai. ek“ mata i to gadh“ bhagäy
“ det“ hai. » ta tai tum“ ca lau !pamni piyai ! “ tab“ syär
“ bolyau : meri tan mati ek“ hü gai . “a isa i kah i bhümi par i baith“ gayau . tab“
syär“ni bo li :
darau j in“ ! m ere pichai pichai calyau äv“ l“ tab“ syär“pichai calyau
2 ava i . syär“ni v icäryau : „dar“ pai g
“yäm dar
“ bhäjai.“ tab“
a i sau jämni simgh“ ki d is i cale . tab“ simgh
“ in“ korn avat“jämni v icäri : mem bhüsan hüm; mo kom bhee“ ani m i lyan . ni t“
m ai kahi hai : «jan j ogeévar“ hai, bhisyä nämh i karat“ hai. van“
visai ake le rahat“ hai » . tin“ hüm kom karmm“j og“ tai bahut“
sevai kom ämni m i lat“ hai. ta tar mo kaum b ethai hi kom bhae“
ani m i lyan hai. pai yah“ tan moh i pai ärnvat“ hai ; na jämniyai,kaumn“ kärau“ hai. ta ta irn mai in“ kom pichern märumgau .
“
aisai mai syär“ni syar“ simgh
“ kom ämni damdaut“ kari ; aru
syär“ni kahat“ b hai :
„abo v an“ ke raja
,hamarau ek“ jhag“rau
n iverau l“ tab“ simgh“ kahi :
„kai san jhag“rau hai? mo pai kahau ! “
tab“ syär“ni kahyau : „yau mero bhar“tär“ hai. ab“ m era i am
in“ kai vanat“ nämhi hai. ab“ in“ tai dür“ rahi cähat“ hau . so
in“ ke vir“j“ kar l m era i 3 putr“ bhae hai. ab“ yau
hai : «doy“ hüm Iehüm» . aru hüm jämnat
“ hüm: «doy“ hüm
lehürn.» ta tai tum“ hamäre raja hau. tumari day“ ava i . tyaun1
ham“ kom putr“ baihac“ dyau !
“tab“ mat“mamd“ simgh
“jämni :
doy“ tan e
,aru tin“ hvern. e pämcommarom,
tan man nai ketek“din“
naci t“ rahüm.
“tab“
simgh“a isi v icärikai kahi :
„bha li vat“
hai. v e bälak“ kahärn hai?“ tab“ syär
“ni boli : hamat an ghar“ tan
pas“ hi hai. pai tum
“ kom hajär“ pimd“ hvaihai. pai ap
“ne
sevag“jämni nham lagi caliyem .
“ tab“ simgh“
nham tai uthyau .
S ieben E rzählungen in Braj Bhakha 43
tab“ syär“ni kahi : „
tum“ ca lau ! pämni piyat“
pichainham tal tinun
_
r ca le. tab“ syar“ ke ghar“ pas“ äyau . tab“
syär“ni minrs
“ kari syär“ tai kahi :„j ahan i ghar“ tai bälak“ le
ävau l“ tab“ syär“ tan ghar“ mai jay“ baitho. ghari doy“ vatit“
bhai . tab“ simgh“ kahi : „
aj om kyom ae nämhi? hamärai bahu t“kamm“ hai.“ tab“ syär
“ni bo li :
„yau mahä n i har“ hai. jamnat“hai: «maim ti num hi rasom» . ta tem tumb“ agya karau , tan maipak“ri lyäüm .
“ tab“ simgh“ kahi :
„j ähü ! veg“ lyäv
“ l“ tab“
syär“ni h ir ap
“ne ghar“ jay“ baithi . ket ik“ vär“ picha i simgh“
kahi :„avat“ kahe nämhi?
“ tab“ syär“ni ghar“ v isa i baithi bo li
„ab“ tan yau mere kaba i mai bhayan. tum“
jävau ! tumhärai
kon kamm“ hai.“ tab“ simgh“ kahi
dohä : jan kokari kaum“
) chärndikai
asä dhara i as“,
ja kaum rasa i ramm“ j ü,so phir“ jay“
n i ras“ . 1 .
i ti kathä.
H,I : B e s t r a f t e r B a r b i e r (p.
pur“b“ deé“ memPat“nä namm“
nagar“ . tahämHam“ namm“
sati rahai . ta kai äyau gayau sadhu cugau päni pava i. tab“ ek“
semem sädh“ ämn“ cugau maungyan. tab“ säti sädh“nai
dai. baisämn“ kai ghar“ bhitar“ jay“pat“ni som kahyan : „
sadh“äyau hai ; kach u rasoi tayar“ hai?“ tab“ etri kaha i :
„tayar“ to
nämhi ; nai vanai hvaihai.“ tab“ sati kahi : „veg
“ karau ! sadhubhüso hai.
“ tab“ etri bo li : „imdhan“ hai nämhi . kähi tai“) lyävau !
“
tab“ sati imdhan“ kom gayau . vi car“ kiyau : „v an
“ visem kab“
j e hum aihurn? ta tai ibam hi tai dhümdh“ lijiyai !“ tab“
phirat“
ek“ Devi ko asram“puranan desi sosan“ lägau . tab“ Devi boli
„kau “
) hai?“ tab“ un
“ kahi :„mem säti hürn; sädh“ ki rasoi
nimat“ imdhan“ lehüm.
“tab“ Devi vä kom6
) pürv“ sukrt“ dharm“
jamu“ sanrtust“ bhai aru kahyau : „
j äh“ ! aju pachem terem1) S o Hs. sta tt baum .
Hs. kan .
Hs . äsäs“nä.
L ies kah i tai H . kahinp tem )?
L ies ko oder kai?
4 4 Johann es Hertel
imdhan“ ki bhari sada äy“hai. sati ap
“ne hi ghar“ säli *) hi
äyau . tab“ gharäm amu“ dese, tan Devi kai jog“ taim ghara iimdhan“ bahüt“ dharyau hai. etri raso i tayär“ kari hai. ta taimsädhü j imäyau. vi da kiyai . aru imdhan“ ki vat“ jyum thi
,tyum
as tri sum kahi . a isi m em sati kai pas“värai Chüdhar“ namm“
näi rahai. son vä näi ki stri aru sati ki stri ati m itt “ . tab“ satiki stri imdhan“ ki vat“ näin“
som kahi. ta. ta im ni°)2
)dohä : pa t“ni som kahiyem nahi
gupt“ vata kar“ mel“ ;
jyom phelem tal j ag“ mamb i ,
tyom j al“ par“ tel“ . 1 .
vat“ : ta tem gupt“ vat“ s“tri som na kahiyem. tab“ ägai
näyan“
näi sau sah“vat“ sati ki kahi, aru kahyau : „
tum“ hi
Devi kai thän“ja imdhan
“eos
-au l tyom äp
“ne hüm Devi imdhan“
pahucar dai.“ tab“
näi matimamd“ s“tri kai kahai Devi ko thäu“
sosan“ lägau. tab“ Devi boli : „kan hai?“ tab“
un“ kahi :
„mai
näi; Chüdhar“ mera namm“ hai. tum“
sati kai imdhan“pahu
hau . taisem mere hü poh“cävau l“ tab“ Devi uth“ lagi .
dhar“ti par“pat
“kyau . acet“ hva i paryan . tab“nagar“ ke lok“
vä kom jamu“ jholi mem ghäl“ ghare pohacäyau . tab“ devi
v anäyak“ sri Devi ji pratem ghani v in“ ti kari. tab“ Devi ji bo li
yä kom jo chorüm, yä Bern
“sati kai sada nity
“ imdhan“ ki
bhari ämni puh“cävai. nämhi, tan chorum nam hi, jiyämmärihüm.
“
näi arü nain“ imdh“ni ki bhari deni ad“ ri äre kari
, j ab“choryau .
i t i katha .
K ö n i g u n d A f f e (p.
Sävamti namm“nagar“ . taham kom Gambhir“ nammai raja.
tin“ kahn vädigar“pai vämnar
“ m ol“ dekai l iyan. so vä vämnar“
kaum a isai sisäyau , j ü sabhä mai nämgi tar“vär“ hath“ me l eka i
raja kat pas“
nity“ thädhau raha i. j ab“ raja ki kähüm par i
kudist“ jämnai, tab“ vä kaum sir“ tar“vär“ tem ched“ dara i . ta
tai raja vä som maya kar“ sonä ke rat“n“ jada t“ alamkär“
pahiräe. a isa i rahat“ ek“ din“ raja sar“bat“ piyan . tin“ kom°)
1) d. l. Gujaräti khali „
leer
Abkwrzu ng für nita mai kahi hai.Hs. chü1ndak
“.
In der Hs. au s pahucavau takan n
L ies kan ?
4 6 Johannes Hert e l
car“vai kom lägi . a isa i carat“ rat i ai jamu“ sur“t“ kar i ap“nai
ghar“ kom ca li . tahäm ävat“ paida mai ek“ simgh“ m i lyan .
tin“gaü sum kahi : „
ah e,m em to ähär“ pidat“ hom. to posem
baum tab“gan man“ ma1m v rcaran
“ lägi : „mem äju yä dust“
ke pämnai kaham tai pari ? yo mo kom chärai nämhi. tan mai
mero sat“dharm“n a gamäüm. ta tai kahi hai :
dohä : dharm “ kiyäm dhan“ sampajai,dharm“ kiyäm sus
“ thay“;
hom ba l ibari sädh“vä
sag“ lem dharm“ karay“
.
vät“ : ta tai m ar“nau tan hai hi . param deh“ samkalp“kai“)
mariyai, to yukt“ hai.“ tab“ a isau vicär“kai gan simgh
“som
kahi :„abo
,av“ l mero bhasan“ karau ! tum“ bhüsai hau . ta tai
yau grbi kan dharm“ hai, jü bhüsai kaum posai . ta kan mahäpuny“
hai. param meri ek“ tum“ som vin“ti hai.“ tab“ simgh“ kahi
„kahau ! “ tab“ gan boli : „
m ere ghar“ vach“ro h ai. sau choto hai.tr in“
namhi sät“ h ai. düdh“ hi piyat“ hai. ta tai v o bhüsau
hvau hvaihai. so me vä kom ap“naum düdh“ päy
“kai anm.
näm, tan yau düdh“ vrithä yau
8) hi jäy
“gau , j aisai v an
“ ke rumkh“
kan phül“ vrtba jay“
. ta tai jo vas“t“ kähn kai karl)“ avai , so
bhali .“ tab“ simgh“ kahi :
„tai niki vi cari . param tai na ävai
,
ta kan komm“ tab“ gan kahi : „meri to som sarv
“thä
Vaca hai :„j o näy
“haum,tan Kumb hi nar
“k“ mem parihom.
“ tab“
simgh“ ki agya pay“
gaü dor i ekai sas“ ap“no ghar“ äy
“ vach“rai
som kahi : „äv“ , putr
“ ! düdh“pi lehu ! “ tab“ v ach“rai mata kaum
aimei pa ra i desi mata som kahi : „aju tara i ‘) ka i san vi car“ hai?
mo kom kahi ! näm,tan mai düdh“
cosom nahi .“ tab“ vachar emko sarau hath“ jamu“ gan päch
“li sah“ vat“ kahi,am kahi :
„putt “ , tem v eg“ caus“ lehu ! mo kom simgh
“paijämnan hai.
“
tab“ vach“rä kahi : „
mem to aisau väcä kan bädhau,düdh“ nam
causom. w em hü teri säth“ aihüm. näm, tan tairai due“ ) kar ijiy
“vai kom
“) nämhi . yä tai kahi hai : „yo éarir“ anity
“ kahn
L ies bhogai baum ? Oder bhasihaum (d. i . bhaksih aunm)Hs . samkap
°kai.
d. i . yaum.
L ies terai oder tairai ?S o die E s.
L ies jiy‘vihom , d. i. jiv ihaum ?
S ieben E rzählungen in Braj Bhakha 4 7
ke arth“ ävai,to bha lo hai. param yau bi vyarth
“ jäyai, ta mai
komu“ gun“ hai?“
ab“ aisaim vi car“ gau aru vach“rä donumsimgh
“pai gae , aru kah i : äv“
,simgh
“ ! tal bbüsau hai. ham“
kom sabu l ap“ui deh“ daikai äg
“lai kan kär“j“ sudbär“ vau , yo
grbi kan dharm“ hai. ta tai kahi hai :dohä : kaj
“v irämnau sädb“ hi “)
je sat“pnr“s“ sadhir“ ;
kabat“ sabe Har“ chamd“ kan
bharyau nic“ ghar i l .
vät“ : tab“a i si vät“ sun i simgb“ kahi : abe
, gan! tum“ dhan“
bau, jü äp
“ni deb“ chodi nik“
räsi , pai sat“ dharm“na
chodyau . ab“ jabu l tai taum meri bbag“ni hai, aru yau merobhämj
“ hai. ab“ m em tum“ kom na sembom .
“ tab“gau vach“
ro
donum kusa l“ som jay“pai ap
“nem ghar“ äe. i ti kathä.
IV,3 : H a h n ,
G a r u da u n d Y a m a (p.
ek“ kük“rai aru Garud“ mäbomämhi m i trai . sau ek“ sama i
donum aus“ som haithe kathä kar“ j ab
“ Yam“lok“ temkähü kom lernn
“ kom Yam“nikare. so in“ kuk“ra kaum des
“kai
hasai. tab“ Garud“ v rcari :„e Yam“ ham“ kan 5) des
“kai basai . sau
kahä? tan jämniyat“ hai. meri tan mau t“ na hai. amar“ born. to in“
m ere m i tt“ kom desi base. tan in“ kai kon met“ kan v icär“
hai. ta tai mo sarrso") yä ke m i tt “ jo j at“n“ kariyai, tan niki
hai. ab“ ai sau jat“n“ karum, jan Jam“ kukara 7) hi pay“ saka i
nahi.“ tab“ aisau v icär“ kar i Gurud“ kükadä kom utbäy“ S umer“
gir“ par“bat“ tin“guphä mai le jay
“ dharyau . adi silä dekai
äp“hi j abam kan tahäm ämn“ baitbau . tab“
a i sa i mai behum Jam“
phir“ ämn“nikare. so Gurud“ kum akelau baitho deal Jam
“
bhi base . tab“ Gurud“ man“ mai v icäri : „jü e Yam“ jäte hibase aru äv“te hi base, so käran“ kahä? “
jab“ Gurud“ Yam“
kom püchat“ bhayau : abo
,Yam“ ! tam“ ham“ kom desi base
Hs. ai.
L ies hai(m ) ?L ies hol“ ?Hs. bute ‚
L ies kom oder kaum .
L ies särisai oder sär ise ?
7) In der Hs. aus sumkara kan n
48 Johannes Her te l
ta kan m ohi v icär“ kabau ! “ tab“ Yam“ kahi : j äb“ ham“ vida
bhae, tab“ tumare mitr“ kük“dä kan j iy“ learn
“ kum S um er“ ki
gupbä v isa i aur“ mamjär“rüpi Jam“ kom vida karyan baum. so
ham“ kük“dä kom tumärai päs“yaham baitbo desikai sri Par
“
m esur“ ki lilä kom basat“ bhae, jü : «kahäm S umer“ ki gnpbä,
aru kaham yau kük“däl so ab“ kai se i j og“ m i la i ? S umer“ kai
am in“ kük“dä kai v ie“ bi s“ jej an“ amtar“ hai » . sau tab“ tan
ai sa i vicär“kai basai the.
“
„ab“ base ; so käran
“
Jam“ kahai : „aur“ tum“
v inäm düjau a isau sak“t“vamt“ kaumn“,
jü kük“dä kom uhäm le jay“ rasar. sau te le jay“ räsyau . ta
tai jämni , jü Sri Par“m esur“ ki li lä var“ni na jat
“. ta tai base.
so desan ! un“ kük“dai kom mamjär
“ Jam“ märyau hai.“ tab“
Gurud“ jay“ desai : tan maryan paryan hai. i ti kathä.
IV,5 : D e r n ü t z l i c h e F e i n d (p.
cyär“
van“k“
putr“ m i l i par“deé“ dhan“ kamävan“ bet“ gae.
so dhan“ghanau kamayan . susi bhae . ab“ ap
“nai des“ äy“vai
ki sur“ t“ bhai . tab“unäm cyärom v icäryau : „yo dhan“ kai se i
kari niväb iyai ?“ tab“ ap“ni mat i ke anusärai mumh“gä mol“
ka mamnak“ bi rä dhan“ dekai m ol“ liyä am v icäri : „in“ kom
pet“ mai rasiyai, tan bhali ; para i niv“ 1
) da i hai . “ tab“ ve cyäromvan
“ mem j ay“
ekem nimb“ ke rums“ tara i baitb“vah“ dban“
udar“ mai utäryau , aru ca lat“ bhae. ab“ a isai mai ek“ dust“vä nim b“ par
“pamu“ kai b et“ cadhyau hu tau ; tin“
yau van ik“putr
“ni kan caritr“ sab“ desyau , aru v icäri : „yau dhan“ un
“
kom“
) mar ika l m e lebu .
“ tab“ vah“ dust“ picha i tai äy“ van i
k“putr
“ni ke samg“ bhayan . a isa i ca lat“ rati kaum ekai gämva
'
imän
_
m“ ut“ rai. so ve pänw on_r hi ek“thau r“ soe. tab“ vanik“
putr“
cyärom anyo any“
v icäri ,f‘
jü : „äpan“ mai kahn ke le jamu“ kom
kon dhan“ tan na hai ; to it paubar 2 ki jan“ -janau cauki dai
,
tan bha l i hai. “ tab“a i sai bi karyan. ab“ ca le 2 babut“ dür“
äe. pa ram dust“ kan dav“ na lägau . tab“
ek“ din“paida mai
a v“ tu un
“pämcom kom caur“ uthe . so nerai ämn“ desai , tan
nnäm pas“ kachu nambi . tab“ kahi : e bha le rativamt“ desat
“
hai,äru in“
pai dhan“ kach u na nikaryau . ta tai jämniyat“ hai,
(l. i. nav i„n icht
2) Hs. dhan
“kaun
°kom , kan dur ch S chr eibern
*
eiß nachtr aglich get-ilgt.
S ieben E rzählung en in Braj Bhakha 49
inäm dhan“ udar“ mai rasyan hai. so inan“ kan udar“ phar“desau .
“ tab“ dust“ jämnyau : „ab“ in“ kai sätb“ meri hi mot“
ai he.
“tab“ dust“ a i si jamu“ uban
_i tai bhägau . ta tal cor“
jämny au : „yo bhagan hai; to yä ke pet“ ma im na samdeh“ mäl“
hai. “ tab“cau räm dor“ vä kom maryan am udar“ phäryau . so
kachu nikaryau näm hi . tab“cam “
jämni : in“ kana i kachunämhi . v rtba käbe kom märau ?“
tab“ yum jan i cyarum kunt
chor“ dae . gharäm ae .
I, 9 . D e r S c h a k a l,s e i n W e i b u n d d e r L ö w e.
Im Lande Thal i b efindet s i ch ein Wa l d , w el cher Lakhi heiß t,und in dem Wa l de w ohnten ein S chaka l namens Bödhu und ein
S chakalsw eib namens Pödhi . Eines Tages nun kam über dasS chakalsw eib e in großer Durst. Da mach te es s ich auf
,um
Was ser zu tr inken . Der S chaka l aber sagte zu ihm : Woh inw o l l t Ih r gehen
,m e ine Ho l de?“ S ie entgegnete : „
lch w i l l Wassert rinken gehen .
“ Da sagte ihr Gemah l :„Wie kanns t du m utter
seelenallein in diesem Wal de gehen ? Wenn i rgende iner de ineS chönhei t sieht, so häl t er di ch an und entfüh rt d ic h . Ble ib ’
m ir al so treu ; i ch geh m it dir ! “Drau f machten si ch die bei den auf den Weg. Unterw egs
aber fragte die S chakalin : Wiev ie l K räfte stecken in dir,Ge
l i c hter?“ Da sagte der S chaka l :„In m ir stecken nur die 64 Lis ten
m e ines Lehrers ! Mit d iesen aber bin i ch se lbs t in 60 Kämpfenm it dem Löw en unüberw ind l i ch .
“
Wäh rend sie so redeten,kamen sie an e inen Te i ch ; in d iesem
Te i ch aber sahen sie e inen Löw en s itzen . Da sagte der S chaka l„Da vorn sitzt doch ein Löw e ! “ Die S chakalin sprach : „
S o kämpfedoch m it ihm und töte ihn ! “ Der S chaka l en tgegnete : „
Was i chm it dir geredet hatte, dam i t i st ’ s jetzt vorbe i ! Jetzt aber w i rdm ir gle i ch der Hintr e platzen Die S chakalin sagte : „
Du has tdoch de ines Lehrers Listen , 64 an der Zah l ! Wie kann d ich dav or d iesem Löw en Furch t bed rücken ? Geh
’
nur zu und fürchted i ch n i cht.“ Der S chaka l erw i derte : „
Auch m eine Listen machens ich davon .
“ S ie sprach : „Wie machen sie s i ch denn davon ?
Der S chaka l sagte : „32 sind auf e inma l w eg; und h inter ihnen
Spr ichw ort lich zum Ausdruck großer F urcht .Fe stsc h r i ft Kuhn .
50 Johannes Herte l
drein, s ieh nur , gehen jetzt v ier ; j etzt gehen w ieder zw e i , und j etztgeht eine ; und j etzt i s t nur noch e ine übr ig.
“ Die S chakalin me inte„Hast du noch e i n e List
,so ist ja a l les da. In der Klugheitslehre
heißt es : Mit e i n e r Li st l äß t s i ch e ine F estung nehmen ; mite i n e r List kann man e ine Festung retten .
“ Drum geh nur zu
und laß uns Wasser trinken Da sagte der S chaka l : ‚Auchm eine letzte List i st jetzt dahin .
“ Sprach e und setzte s ich auf
die Erde n ieder .Da sagte die S chakalin : Fürchte d i ch n i cht
,Gemahl ! Komm '
nur , un d geh m ir immer nach ! “ Da ging der S chaka l m it, immerh in ter ih r drein.
Die S chakalin dach te :„Geht man auf die Gefahr zu, so
fl ieht die In dieser Erkenntn i s ging sie auf den Löw enlos. Als der Löw e merkte, daß sie kam
,dachte er : I ch bin
hungrig : da s te l l t s i ch auch s chon die Spe i se ein . In der Klugheitslehre he iß t es :
‚Wer den Yöga beherrscht , geht n i ch t bette ln .
Einsam b le ib t er im Wa lde.
‘ Wei l i ch nun den Karmayöga
fromme Werke]übe, komm t vie l zu m ir , w as i ch verzehren kann .
Da r um hat s i ch eben bei m ir , obw oh l i ch s itzen geb l ieben bin,die Speise e ingeste l l t . In w e l cher Ab s i cht ab er jene zu m ir komm t,das w eiß i ch n i ch t. Darum w i l l i ch sie hernac h erst töten .
“
Inzw i s chen w aren des S chaka l s We ib und er se lbs t vor denLöw en getreten und fiel en v or ihm n ieder . Die S chakalin aberhub an und spra ch : Vern imm
,0 Kön ig des Wa l des , und ent
sche ide e inen S tre i tfa l l zw i s chen uns ! “ Der Löw e sagte : Was
i s t das für ein S trei t ? Tragt ihn m ir vor ! “ Die S chakalin sprach„Dieser is t m e in Gemah l . Nun aber treten keinesw egs er und
i ch m it ergebener Bi tte vor Euch ; drum is t er je tzt fern geb l iebenund hat s i ch auf die Lauer ge legt. Aus seinem S amen näm l i chs ind m ir dre i S öhne en tsprossen . Nun me int er :
‚Davon w i l l i ch
z w e i hab en .
‘ I ch aber me ine : ,I c h w ill zw e i davon haben .
“
Nun se i d Ih r un ser Kön ig. Da We i she i t Euch erleu chtet,so te i lt
piyai ist v ersch iedener Deutung fahig : I ) 3. sg. aor . pass ; 2) 1 . plur.imperat . (statt piyai1;n) ; 3) ob liquus des ptc . pi. statt piyai hau r_ n. In jedemder dr ei m ögl ichen F äl le b le ib t der S inn derselbe.
2) Dieser ob l iquus auf ei ne statt auf e oder a i komm t auch in 0 v or .
Ich not iere daraus : pämni vin° piyänz (Läl : päni Din a piye) ; s ind pänrnü
piyäv_n kämen “paryäm,
‘
ninä kahyänt ; läthi liyäm,
‘
sonänz ke sütr ° kar i.
S ieben E rzählungen in Braj Bhakha 5 1
die S öhne unter uns ! “ Da dachte der Löw e, bei dem es mit der
Klughe i t haperte : Da s s ind zw e i,und jene ‘
) s ind d re i : die w i l li ch tö ten a l l e fün f. Dann kann i c h etl i che Tage sorglos leben .
“
Nach d ieser Über legung sagte der Löw e : S chön ! Wo s ind d ieseKnaben ?“ Die S chakalin sprach : „U nser Haus steht ganz in derNähe . Tausend Manenspenden w e rdet Ihr Doch gerubet in Erw ägung
,daß w ir Eu re D iener s ind , b is dorth in zu
gehenf‘
Da erhob si ch der Low e von seinem Platze . Die S chakalin
aber sprach : Geht nur zu ! I ch w i l l erst Wasser trinken ! “Darauf gingen sie a l le dre i v on dannen
,bis sie ans Haus
des S chaka l s kamen . Die S chakalin ab er sagte trüglich zum
S chaka l : Geht, und bo let die Kinderchen aus dem Hause ! “Nun ging zunächst der S chaka l ins Haus und setzte s i ch
dr innen n ieder. Eine ha l be S tunde verging, und noch Da
fragte der Löw e :„Wesha lb komm t er noch immer n i cht ? Auf
Uns ruhen vie le Ges chäfte ! “ Die S chakalin sprach : „Er i s t ein
ganz versch lagener Bu rs che und denk t :,I ch w i l l sie a l le d re i
beha l ten .
‘ Wenn Ihr a l so befeh l t, so w i l l i ch ihn packen und
ihn Euch bringen .
“ Der Löw e sprach : Mach t schne l l und b r ingtihn ! “ Nun ging auch die S chakalin in i hr Haus und b l ieb dr innens i tzen .
Nach einiger Zei t rief der Löw e : „Warum komm t I hr n i cht
w ieder ?“ Die S chakalin aber b l ieb im Hause sitzen und rie fEr hat s i ch jetzt m einem Wil len gefügt. Gebe t I h r nur w ieder ;denn auf Euch ruhen a l ler le i Ges chäfte .
“
Da sagte der Low e(S trophe) „
Wer e ine Petze ‘) entw i s chen l äßt und auf eine
Spei se hofft,die Gott bes chützt, der geht hoff
nungslos v on dannen .
“
Iw an steht w oh l fur ne oder ist daraus verderb t. Oder ist zu lesenIwäm=vahäz
_n
„dort“ 9
Dies sol l w oh l ein v iele S obne v erheißender Segenswunsch se in .
Moglich auch : „Tausend B issen“. Dann l iegt nur Versprechen e iner reich
l ichen Mahlze i t v or .
Wörtl ich :„Zwe i ghar i vergingen“
. 1 ghar i akt . ghafi) = 24 Mi
nuten“.
Verach tlieh m it Bezug auf den w eiblichen S chakal .
50 Johannes Herte l
dre in,s ieh nur , gehen j etzt v ier ; j etzt gehen w ieder zw ei , und jetzt
geht e ine ; und j etzt ist nur noch eine üb r ig.
“ Die S chakalin meinte :„Hast du noch e i n e List
,so i st ja a l les da. In der Klugheitslehre
he iß t es : Mit e i n e r List laßt s i ch eine Festung nehmen ; m ite i n e r List kann m an e ine Festung retten .
“ Drum geh nur zuund laß uns Wasser tr inken Da sagte der S chaka l : Auchm eine letzte List i st j etzt dahin .
“ S prach’
s und setzte s ich auf
die Erde n ieder .Da sagte die S chakalin : F
"
drehte d ich n i cht,Gemah l ! Komm ’
nur,un d geh m ir immer nach ! “ Da ging der S chaka l m it, immer
h in ter ih r drein.
Die S chakalin dach te : ‚Geht man auf die Gefahr zu , so
fl ieht die Ge fahr In dieser Erkenn tn i s ging sie auf den Löw enlos. Als der Löw e m erkte, daß sie kam
,dachte er : Ich bin
hungrig : da ste l l t s i ch auch schon die Spei se ein . In der Klugheitslehre he iß t es :
‚Wer den Yöga beherrscht , geht n i ch t bette ln .
Einsam b le ib t er im Wa l de.
‘ Wei l i ch nun den Karmayöga
fr omme Werke]übe, komm t vie l zu m ir , w as i ch v erzehren kann.
Da r um hat s i ch eben bei m ir , obw oh l i ch s itzen geb l ieben bin,die Spe ise eingeste l l t . In w elcher Abs i cht ab er j ene zu m ir komm t,das w eiß i ch n i ch t. Darum w i l l i ch sie hernach ers t töten .
“
Inzw i s chen w aren des S chaka l s We ib und er selbst v or denLow en ge treten und fielen vor ihm n ieder . Die S chakalin aber
hub an und sprach : Vern imm,0 Kön ig des Wa l des , und ent
s che i de e inen S tre i tfal l zw i s chen uns ! “ Der Löw e sagte : „Was
ist das für ein S trei t ? Tragt ih n mir vor ! “ Die S chakalin sprach .
„Dieser i s t me in Gemah l . Nun aber treten keinesw egs er und
i c h m it ergebener Bi t te vor Euch ; drum ist er j etzt fern geb l iebenund hat s i ch auf die Lauer ge legt. Aus se inem S amen näm l i chs ind m ir dre i S öhne entsprossen . Nun m e in t er :
‚Davon w i l l i ch
z w e i haben .
‘ I ch aber m eine :,I c h w i l l zw e i dav on haben .
“
Nun seid Ihr un ser Kön ig. Da We i shei t Euch erleu ch te t,so te i lt
1) piyai ist v ersch iedener Deutung fahig : 1 ) 3. sg. aor . pass. ; 2) l . plur.
imperat . (statt piyaiw) ; 8) ob l iquus des ptc . pt. statt piya i kaum . In jedemder drei m ög lichen F äl le b le ib t der S inn derselbe.
2) Dieser ob l iquus auf äv
„n statt auf e oder a i komm t auch in 0 v or .
Ich notiere dar aus : pä7_nni vim piyär_n (Läl : päni Din a p iye) ; vinä pänn_z£
piyäz_n ; kä1,rwnflparyäm,
‘
vinä kahyäm; läthi Ziyä-r_n ; sonä7_n ke satr a kari .
52 Johannes Herte l
II,I : B e s t r a f t e r B a r b i e r (p.
Im Ostlande l iegt e ine S tadt namens Patnä. In d ieser w ohnteein Zimmermann namens Häm . Von dem e rh ie l t ein Mönch , derbei ihm aus u nd ein ging
,Spe i se und Wasser. Eins t kam der
Mönch w ieder und hat um Spe i se. Der Zimmermann bew ill
kommnete den Mön ch , ging ins Haus , um ihm e inen S itz zu bere itenund sagte zu se iner Frau : „Der Mönch is t da ; hast du etw as zum
Essen fertig?“ S e ine Fran sagte : „F e rt ig hab ’ i ch gerade n i ch ts ;
doch ba l d w i rd fri sche Spe i se bere i tet se in .
“ Der Zimmermannsprach : Mach ’ s chne l l ! Der Mönch i st hungr ig.
“ Die F rau sag te :„I c h hab kein F euerho l z . Hol
’
m ir w e l ches i rgend w oher ! “ Da
ging der Zimmermann nach Feuerhol z und dachte : Wann so l li c h w iederkommen, w enn i ch in den Wald gehe ? Drum ist es
besser, i ch su che m i r ’ s h ier zusammen.
“ S o ging er denn um her ,gew ahrte ein a l tes He il i gtum der Devi und s ch i ckte s ic h an
,v on
ihm Hol z abzubrechen . Da fragte die Gö ttin :„Wer b i st d u ?“
Er erw i derte : „I ch bin ein Zimmerm ann und w i l l m ir Hol z holen,
um e inem Mou ch das Mah l bere i ten zu können .
“ Da nun die
Gött in erkannte daß er s i ch dur ch frühere l ) Guttaten re l igiö sesVerd iens t erw orben hatte, freute sie s i ch und sagte zu ihm :
„Geh
nur ! Von heute ab w i rd e ine Tracht Hol z stets zu dir kommen .
Der Zimmermann kehrte leer nach Hause zur ück .
Al s er ins Haus trat und nachsah,fand er dar in durch
F ügung der Devi e ine Menge Ho lz herbeigeschatft, und seine Frauhatte das Mah l b ere i tet. Mit diesem w ard der Mön ch gespe is tund v erab s ch iedete s i ch . Der Zimmermann aber erzäh l te seinerF rau
,w ie s ich ’ s mit dem Feuerholz verhie l t.Nun hatte der Zimm ermann e inen Barb ier zum Nachbarn
,
w elcher Chüdhar h ieß . Die F rau dieses Barb iers aber und die
Z immermannsfrau w aren eng b efreundet. S o kam es, daß die
Z imm ermannsfr au der Barbiersfrau die Ges ch i chte m it dem F euerho lz erzäh l te . Heißt
’
s doch in der Klugheitslehr e
(S trophe) S e in er F ran so l l man ke in Gehe imni s m i tte i len ,indem man sie ins Vertrauen zieht. Denn v on
da aus verbre i tet es s ich in der We l t, w ie auf
dem Wasser ein T röpfchen Öl .
d . h. in e in er fr uheren E xistenz getane .
S ieben E rzählungen in Braj Bhakha 53
(Prosa) Desha lb sol l man einem Weihe kein Gehe imn is an
vertrauen .
Darauf erzahlte die Barb iersfrau dem Barb ier die ganze Ges ch i ch te
,die der Zimmermann e r lebt hatte, und sprach : Geb et
auch Ihr an die S tätte Dé vis und brechet Hol z davon ab . Dannw i rd sie auch uns das Feuerho l z zukommen lassen .
“
Darau f sch ickte s ich der Barb ie r,e infäl tig
,w ie er w ar
,auf
Geheiß seiner F rau an,Dem S tätte abzu brechen. Die Gött in
sagte :„Wer b i s t du ?“ E r sagte :
„I c h b in ein Barb ier ; me in
Name i s t Chüdhar . I h r sende t beständig dern Zimmermann Brennhol z ; so bringet es mir denn eb enso ! “
Da fuh r die Göttin auf und schm etterte ihn auf die Erde ;und besinnungs los fie l er n ieder. Leute aus der S tadt , w e l cheihn erkannten, steckten ihn in e inen S ack und trugen ihn in se inHaus . Darauf beteten sie inbr iinstig zu der hei l igen Devi , derGöttin, die die Hemmn i sse bese i tigt, und die Göttin sprach : „
S o l li ch d iesem verzei hen
,so muß er stets und immerdar dem Zimmer
mann Hem se ine Trach t F euerhol z bringen . S ons t verzei he ichihm ni cht
,sondern w erde sein Leben verni ch ten.
“
U nd als ihm verziehen w ar, l ießen es sich der Barb ier und
se ine Frau gar sehr ange legen sein,die Trach ten des Feuerhol zes
zu b ringen .
III,4 : K ö n i g u n d A f f e (p.
In der S tadt S ävam ti herrs ch te ein Kön ig namens Gambhir .Der kaufte einem Musikan ten e inen Affen ab . Diesen Affen nun
l ieß er so ab r i chten,daß er im Thronsaa le immer m it b loßem
S chw ert dem Kön ig zur S ei te stand . Wenn er merkte , daß derKönig auf jemand e inen b ösen Bl i ck w arf, so s ch lug er d iesemdas Haupt ab . Dafür w ard ihm der Kön ig so gnädig, daß er ihm
gol denes , m it Juw e len besetztes Ges chmeide an legen l ieß .
S o s tanden die Dinge, als der Kön ig e ines Tages Zuckerw asser trank . Von d iesem fiel ein Tropfen auf se ine Kle i dung .
Dann ging der Kön ig in den Thronsaa l und setzte s i ch . Der
Ges chmack des Zuckerw assers lockte e ine Fl iege an, w e l che sich
auf das Gew and n ieder l ieß . Der Kön ig verscheuchte sie w iederund w ieder ; trotzdem kam sie aberma l s und setzte si ch . Da w ardder Kön ig zornig und w arf der Fl iege e inen bösen Bl i ck zu . Der
54 Johannes Hertel
Affe aber dachte : „E in boser Bl i ck des Kon igs ruh t auf der Fl iege .
U nd e i l igs t s chw ang er auf diese se in S chw er t. Dadurch aberh ieb er den König m itten entzw ei .
Daher he iß t es :„Durch e ines Toren Liebe w i rd m an sein
Leben ver l ieren .
“ S o die Erzäh lung.
III,5 0 : G e h m i t k e i n e m B o s e w i c h t (p.
E in böser Mens ch ging auf dem Wege dah in. Da gewahrteer e inen Guten , der vor ihm ging : es w ar ein der
gle i chfa l l s dahinging . Diesem gese l l te s i ch der Böse . Der Bösesagte :
„Bruder
,laß uns bei de zusammen gehen ! Ei le n i cht so ! “
Während nun die be i den so w anderten,gese l l te s i ch ihnen noch
ein Bauer,w e l cher e inen m it S chme l zb utter gefül l ten Krug auf
dem Kopfe t rug und Sprach : Heda ! Wohin geh t ihr denn ?“ Der
Wanderer sagte :„Wir s ind auf dem Wege nach Gujarat.“ Da
sagte der Bauer : Nehm t auch m ich auf eurem Wege m it ! “ Der
Wanderer sagte :„Komm ’ unbesorgt ! Was hättes t du v on uns zu
b efürchtenS o gingen sie denn zusamm en . Als es Nacht w ard
,kamen
sie in eine S tadt. Da sie bedach ten , daß es Nacht w ar , rastetensie am Kai und sch l ie fen gemäch l i ch ein . Z ur Ze i t der Mitternach ts tand der Böse auf und verzehrte die S chme l zbutter des Bauern .
E in w en ig dav on aber nahm er und s tr i ch es dem Wan derer an
den Mund. Dann s ch l ief er w eiter . Als es Morgen w urde, er
w achte der Bauer ; und als er zusah,w ar ke ine Butter mehr in
Se inem T opiz dagegen k leb te Butter an des Wanderers Hand und
Mund. Da sprang der Bauer schre iend auf. Daraufh in kamendie Diener des Po l ize imeis ters herbe igee i l t. Der Bauer sagte :„Dieser Wanderer hat me ine Butter gegessen . S eh et
,an se iner
Han d und an se inem Mun d k lebt Butter ! “Da nahmen die Diener den Wandersmann fes t und prüge l ten
ihn gehorig; dann aber nahm en sie ihn m it und setzten ihn gefangen . S o die Erzäh l ung .
III , 8 : K u h u n d L ö w e (p.
Eines Tages entfernte s i ch e ine Kuh v on ihrer Herde und
begab s i ch ans U fer der Jamnä, um Wasser zu trinken . Als sie
dort grünes Gras fand, b egann sie,es ab zuw e i den . S ie w ei dete,
S ieben E rzählungen in Braj Bhäkha 55
bis sie m erkte,daß die Nach t here inb rach
,bedachte das und machte
sich auf den He imw eg . Während sie dah inging, tra f sie unterw egs e inen Low en . Dieser sagte zu der Kuh : „
E i,du fiillst m ir
a ls S pe ise zu . Ich w erde d i ch v e rzehren .
“ Da begann die Kuhin i hrem Ge iste zu überlegen : „
Wie hin i c h d iesem Bösew ich t indie Hände gefa l len ? De r l äßt m i ch n i ch t fre i . S o w i l l i ch m irdenn me ine Rech t l i chke i t n i cht rauhen lassen . Hei ßt es doch
(S trophe) Wenn man rech t l i c h hande l t,so ste l l t s i ch Re ich
tum ein ; w enn m an rechtl i ch hande l t, w i rd mangl ück l ich . Woh lan ! Die ganze Rechtliehkeit
erw e ist man,indem man Opfer darbr ingt .
(Prosa) Nun i st der T od unverme id l i ch . Also i s t es auge.
brach t,w enn i c h dadurch sterbe , daß i ch me inen Leib vers chenke .
“
S o dachte die Kuh und sagte zum Löw en :„Komm t nur und
verzehret mich ! I hr sei d hungrig. Denn da rin bes teht des Hausvaters Recht l i chke i t, daß er Hungrige spei s t . Dam i t gew innt ergroßes re l igiö ses Verd ienst . Doch r ichte i c h an Euch eine demütigeBi tte.
“ Der Löw e sagte : „Rede ! “ Die Kuh sprach : Ich habe
zu Hause ein Kalb . Das i st noch k le in und kann noch ke in Grasfressen
,sondern trinkt nur Mi l ch . Darum w ird es hungrig ge
w orden se in . S o w i l l i ch es denn m it me iner Milch träuken und
dann w iederkomm en . S ons t w ird d iese Mil ch vergehens ebensodahingehen
,w ie die Bl ü ten e ines Baumes , der im Wa l de s teh t.
Nur das aber is t gut,w as irgende inen Nutzen s ti ftet .“ Da sagte
der Löw e : De in Gedanke is t r ichtig . Aber du w irs t n i ch t w iederkommen . Wie kann i ch a l so daran denken?“ Die Kuh ent
gegnete : Ich gebe dir jeden fa l l s me in Wort : Komme i ch n i chtw ieder, so w i l l i c h in die Kumhhihölle s türzen .
Da gab der Löw e seine Zustimmung,und die Kuh l ie f in
e inem Atem nach ihrem Hause und sagte zu ihrem Ka lb :„Komm ’
her,m e in S ohn
,und trinke de ine Mil ch ! “ Als aber das Ka lb
se ine Mutter so von ferne sah,sagte es zu ihr : „
Was has t duheut für S orgen? S ag m ir ’ s
,oder i ch sange die Mi l ch n i ch t.“ Da
die Kuh nun sah,daß der Eigens inn des Ka lbes ech t w ar
,erzäh l te
sie ihm a l les , w as vorgefa l len w ar,und sprach : „S auge s chne l l ,
me in S ohn ! I c h habe dem Löw en me in Wort gegeben .
“ Das
Kalb sagte : „ I ch bin durch deine Rede so betrüb t,daß i c h ke ine
Mi l ch sange. I ch w i l l auch gehen,m it d i r. S ons t w erde i ch aus
5 6 Johannes Hertel
Trauer um di ch ja doch n i c ht am Leben b le iben . Denn es heiß t‚Es ist gut
,w enn d ieser vergängl i che Le ib irgendeinen Nutzen
br ingt ! Was aber ist er w ert,w enn er nutz los w ird ?“
Nach d ieser Überlegung gingen be ide, die Kuh und das Ka lb ,zum Löw en und sagten : Komm her
,Löw e ; du b ist hungrig. Ver
zehre un s ! S e inen Le ib dahinzugeben und dadurch e ines andernNutzen zu fördern, das ist die Pfl i ch t des Hausvaters . Darumhe ißt es
(S trophe) Anderer Arbe i t verri chten die, w e l c he gute, stan dhafte Männer s in d . Al le sagen von Haris
'
candra,
daß er in e ines n iedrigen Mannes Hause Wassertrug
(Prosa) Als der Löw e d iese Rede vernommen hatte, sagte er
Liebe Kuh ! Ihr sei d gl ü ckl i ch,daß Ihr unter Hingabe Eures
Körpers Euer Wort geha l ten,n i cht aber Eure Rechts chaffenhei t
preisgegeb en hab t. Jetzt geht ! Du b i st jetzt m e ine S chw ester,und d ieser ist m ein S chw estersohn . Jetzt w erde i c h Eu ch n i chtverzehren.
“
Darauf kehrten bei de,die Kuh und das Kalb
,als S ieger
w oh lb eha l ten in ih r Haus zurück S o die Erzählung.
IV,3 H a h n
,G a r u da u n d Y a m a (p.
E in Hahn und Garuda w aren m ite inander befreun det. Eins tsaßen d iese be i den gemäch l i ch be i sammen und erzäh l ten e inander
,
als aus der Yama-We l t Yama herauskam ,um jemand zu ho len.
A ls d ieser den Hahn erb l i ckte,lachte er .
Da da chte Garuda bei s i ch : „Dieser
.
Yama hat bei unsermAnb l i ck ge lacht. Wesha lb ? Nun
,es l äß t s ich denken . Mi c h
kann ja der T od n i cht tr effen ; denn i ch bin uns terb l i ch . Folg l i chhat er beim Anb l i ck dieses me ines Freundes ge lacht. Al so beabsichtigt er
,ihn irgendw ie zu tö ten. Darum ist es recht, daß
i ch m i ch fü r d iesen mir eb enb ürtigen Freund bemühe ; und i chw ill schon dafür sorgen
,daß Yama den Hahn n i cht erre i chen
kann .
“
Darauf hob Garuda nach d ieser Über legung den Hahn empor,trug ihn mit s i ch in e ine Höhle des Geb irges Sumerugir i und
1) König Hariécandra diente als Sklave im Hause eines Candäla.
S ieben E rzählungen in Braj Bhäkhä 5 7
steckte ihn da hine in . Z um S chutze deckte er sie m it einemFe l sen zu
,flog se lbs t nach dem Orte zurück
,w o er s i ch vorher
b efunden hatte,und
_setzte s i ch . Da ersch ien Yama abermal s auf
dem Rückw eg nach se iner Höh le . Al s er Ga ruda a l lein s itzensah
,lachte Yama w iederum . Da über legte Garu da in se inem
Ge i ste : „Warum hat d ieser Yama ge lach t,als er ging
,und ge lach t
,
als er kam ? “ U nd er hub an und fragte ihn :„Ei Yama ! I hr
habt b ei unserm An b l i ck ge lach t ; sagt mir, w as I hr Euch dabe igedacht habt ! “ Yama an tw ortete : Al s w ir uns verab s ch iedeten,entsandte i ch e inen anderen Yama in Katergestalt in e ine Höh ledes S umöru , um Eurem F reunde ,
dem Hahn,das Leben zu
rauhen . A ls i c h nun den Hahn hier an Eurer S ei te s itzen sah,
m ußte i c h über das S pie l des hei l igen Paramés'
vara ö lachen,indem i ch dachte :
‚Wo i s t die Höh le des S umé rn
,und w o ist
d ieser Hahn? Wie sol l er heute dorth in kommen? Zw i s chen demS um éru und d iesem Hahn l iegt ein Zw is chenraum von 1 00 000
Yöjana .
‘ Al s w ir d ies überlegt hatten,m ußten w ir lachen .
“
„U nd w eshalb hast du j e t z t ge lacht?“ Yama sagte : „We l cher
andere außer Euch ist so mächtig,daß er den Hahn m it s ich
dorth in zu nehm en und zu s ch irmen vermö chte ? Ihr nun hab tihn h ingefüh r t und ges ch i rmt. Daran haben w ir erkannt
,daß des
he i l igen Param é s'
vara Spie l ni ch t zu b es chre iben ist ; und desha lbhaben w ir gelach t. Nun sehet nach : j enen Hahn hat der KaterYama getöte t. “
Da ging Garuda hin und sah nach,
und w i rkl i ch lag derHahn tot am Boden . S o die Erzäh lung .
IV,5 : D e r n ü t z l i c h e F e i n d (p
Vier Kaufmannssohne taten sich zusammen und w andertenin die Fremde, um Ge l d zu verdienen ; und w irk l i ch erw arbensie rei ches Gu t und w urden glü ck l i ch . Da dachten sie daran , indie He imat zu rü ckzukehren
,und a l l e vier h ie l ten Rat :
„Wie so l len
w ir dieses Ge l d befördern ?“ U nd w ie es i hnen i hre Klughe i teingab, so kauften sie dafür kostbare Rub inen und Diaman ten
Der Name bedeutet „der h ochste Herr“ und ist je nach der S ekte ,
der die G läub i gen , die ihn gebrauchen , angeboren,e ine Beze ichnung v er
schiedener Hindn—Gotter. Gemeint ist h ier w ahrsche inl ich Brahman .
58 Johannes Hertel , S ieben E rzäh lungen in Braj Bhäkhä
und dachten :‚
E s is t am besten,daß w ir sie in unsern Bauchen
au fbew ahren , dam i t w ir sie n i cht v erl ieren .
“
Darauf gingen die vier in den Wa l d , se tzten s ich unter e inenNimba—Baum und v ersenkten d ieses Gut in i hre Leiber . S odannmachten sie s i ch auf den Weg.
Zu r se lben Zei t w ar ein Bösew i cht auf j enen Nimba ge
kl e ttert, um Blätter zu ernten. Der hatte alles gesehen, w as dieKaufmannssohne taten , u nd dachte : ‚
I ch w i l l sie ermorden und
d ieses Gut an m i ch br ingen .
“ Darau f g ing er h inter den Kau fm annssöhnen dre in und gese l l te s i ch zu ihnen .
Während sie so w anderten , kam en sie bei Anbru ch der
Nach t in ein Dorf und mach ten da ha l t . Al le fün f legten s i chnun an e iner und derse l ben S te l le sch lafen . Die vier Kaufmannssöhne aber ber ieten s i ch untereinander : Wir haben zw ar ke iner l eiGut bei uns
,w e l ches man uns steh len könn te ; trotzdem is t es
geraten,daß w ir abw echse lnd Mann für Mann Wache hal ten .
‘
S o taten sie auch ; dann gingen und gingen sie w ieder, bissie e ine w eite S trecke zurückge legt hatten. Der Bösew i ch t ab erfand keine Ge legenhe i t.
Eines Tages nun,als die F unf i hre S traße dahinzogen , tra t
i hnen pl ö tz l i ch ein Räuber entgegen . Er trat an sie heran und
unters u ch te sie. konn te aber gar n i chts bei i hnen finden . Da
sagte er : S ie sehen gut und w oh l habend aus,und doch is t bei
i hnen keiner lei Gut zum Vorschein gekommen . Daraus l äß t sic hs ch l ießen, daß sie ih r Ge l d in ihren Le ibern verborgen haben .
Drum w il l i ch ihnen die Bäuche aufschne i den und nachsehen .
“
Da dachte der Bösew icbt :, Jetzt i st mit der i hren auch
m eine Todess tunde gekommen .
“ U nd w ei l er so dachte, rannteer dav on. Darum dachte der Räuber :
‚ Er re iß t aus ; a l so hatohne Zw e ife l er den S chatz in seinem Bauche.
Darauf l ief der Räuber ihm nach, ermordete ihn und s chn it t
ihm den Leib auf. Aber ni chts kam zum Vorschein .
Da dachte der Räuber : „Diese Leu te haben n i c hts bei s ich .
Warum so l l i ch sie für n i chts und w ieder n i chts tö ten? ‘
S o dachte er und l ieß die vier andern lau fen ; und sie ge
langten jede r in se in Heim .
60 Leopo ld v . S chroeder
Als umgekehrter We l tbaum,w urzelaufw arts
,zw eigeabw arts,
tr i t t uns der ew ige Fe igenbaum (aévatthah sauätanah) in der
Käthaka Upan isad 6 , 1 entgegen ; und so l ebt er noch fort in denerhabenen Versen der Bhagavadgitä, zu Anfang des 1 5 . Gesanges .Mit Rech t erinnert Kuhn auch an die e ind rucksvo l len Verse, di eMadhusüdana zu der Bhagavadgita-S te l le anführt ; Verse, die denBrahman-Baum (brahmavrkga) s ch i l dern , „
dessen ausgeb rei teteZw eige die Elemente, dessen Bl ätter die S innesgegenstände s ind ;der als B l üten Recht und Unrecht, als Früchte Glück und Le idträgt“ usw . ; ebenso w ie auch an die Beze i chnung
, die Samkarazu Kath . Up. 6
,1 dem Baume gib t. Er nennt jenen Aévattha
geradezu samsäravrksa, d . h . den Baum der We l t,die un s ge fangen
häl t,des Lebens , das ü berw unden w erden sol l denn das i s t
ja der S amsara. We l tbaum und Lebensbaum zugle i ch,das ist in
der T at d ieser ew ige Aévattha,der somaträufelnde ; derse lbe
Baum w oh l im Grunde, der uns s chon,in e iner noch mehr
myth is chen F orm ,in dem großen Rätselliede RV 1
,1 64 , 20
— 22
en tgegentr itt, w o er durch seine Frucht pippala eb en fal l s als ein
Aévattha gekennzei chnet w i rd , w ährend die ihn besuchenden madhvadah suparnäh ihn als e inen Hon ig oder Met spendenden Baumerkennen lassen w ie der Baum des armen Mannes im BrunnenHonig spendet, zu se inem U nhe i l . Und w enn der brahmo vrk5ah,w ie Kuhn bemerkt, späterh in das für unsere Parabe l in teres santeBeiw or t v iprabhramarasev itah erhäl t
,(1. h . „von Brahmanen als
1) S chon A dalbert K u h n hat mit Recht diesen myth isch-mystischen Baum
des Rgveda mit dem ew igen A9vat tha der Upauigmden zusammengebracht,in seinen v on E rn st K u h n herausgegebenen Mythologischen S tudien I , p. l l2f. ;
und er i rrt w ohl nur darin, w enn er di esen Baum a . a. 0 . p. 1 17 als Wolkenbaum zu best immen sucht. Übrigens b in ich der Meinung
,daß auch der
umgekehrte Wel tbaum ,m it der Wurzel nach oben , in einem Liede des
Rgveda einstmals seine S tel le hatte, w enn er auch j etzt n icht mehr deutl ich darin hervortri tt. Der w idersmuchsvolle Vers 7 des bedeutsamenLiedes RV 1
,24 w i rd
,w ie ich glaube, erst dann recht v erständlich
, w enn
man statt stü’
pam v ielmehr mü'
lam l iest. Dann ist aber auch der umgekehrte Wel tbaum sogleich erkennbar, dessen nach oben ger ichtete Wurze l(ü
’
rdhvani mu’ lam
,vgl. das ürdhv amüla der Upan ishad und der Bhagav ad
gitä) Gott V aruna selbst drohen im boden losen Raum festhält. Nur dann
paßt dazu das folgende : n ici’ nälz sthu r updr i budhnä. esäm . Verständl ich istauch , daß e ine spätere Ze i t durch T extäuderung dem Baume die normale,sche inbar einz ig v ernünft i ge Lage zu geben suchte.
Lebensbaum und Lebeustraum 6 1
Bienen besucht“ , so erkennen w ir auch da noch das U rb i l ddes honigspendeuden Baumes w ieder.
Mit gutem Grunde abe r w i rd d ieser Baum Kath . Up. 6 , 1
als ein umgekeh rter gekennze i chnet ürdhvamülo, aväkéäkhah‘)
denn er i s t ja n i c hts anderes als die We l t,das Leben
,deren
Wurze ln drohen im ew igen Brahman ruhend gedacht s ind . E in
tie fs innige r Gedanke Poes ie und Philos0phie zugle i ch : das gesamte We l tw esen
,a l les Leben im Bi l de eines mäch tigen Baum es
gefaßt,der drohen , im Himme l , im Ew igen w u rzelnd
,abw ärts
,in
die We l t der Ersche inung h ine in s i ch en tfal te t hat . Darum,im
Lichte der Upanisad-Erkenntn is betrachtet, das Ew ige oder derEw ige
,das Brahman, der F aru _
sa se l ber . Das Bi l d begegnet unsnoch ein paarma l in den Upanisaden. S o in den erhabenen VersenSvetäévatara Up. 3
,8 und 9 °
8 . I ch kenne jenen Purusa, den großen,Jense i ts der Dunkelhe i t w ie S onnen leuchtend ;Nur w er ihn kennt
,entr innt dem Re i ch des Todes ;
Nich t gib t es einen andern Weg zum Gehen.
9 . Hoher als der n i ch ts andres i s t vorhanden,Nichts Kle ineres und n i chts Größeres , w as auch immerA l s Ba um im H imm e l w u r z e l n d s t e h t de r e i n e ,De r P u r u sa , de r d i e s e g a n z e W e l t f ü l l t ?)Das t iefs innige Bi l d enthä l t die hochste Erkenn tn is , i s t Inbe
gri ff der Erkenn tn i s se lber . Das tri tt deutl i ch in jener , s chonm ehrfach erw ähnten S te l le der Kath . U p. 6 , 1 zutage, die i chfo lgendermaßen deutsch w iedergebe
Wurzelaufwärts, zw eigeabw arts,
S teh t d ieser ew ige F eigenbaumDas is t das Lich te
,das i s t das Brahman ,
Das nennt man das U nsterb l i che ;A uf dem beruhen a l le We l ten,Über das geht n iemand hinaus
D ies,w ahr l ich , i st das !
Bhagav . 1 5 , 1 sagt dafur adhah éäkha.
2) Nach De u ss e n s Übersetzung (S echz ig Upan ishads des Veda p.
Der letzte eindrucksv o l le Vers 9 findet sich ebenso auch MahäuarayanaUp. 1 0 , 20 w ieder .
52 Leopold v . S chroeder
Die myst is che F orm e l am S chlusse dieses und e iniger andr erVerse der Kath . U p.
„etad väi ta t “ hat s chon De u ss e n (a. a. 0 .
p. 265) ganz r ich tig als ein Ana logon erkannt zu der berühm ten ,n eunma l in der Chänd. Up. 6 w iederho l ten Forme l
,die den Kern
und tiefs ten Inha l t a l ler Upan isad-Weishe i t in s i ch sch l ieß t : ta t.
tuam asz‘
“ das b i st du ! Nur unter d ieser Voraussetzung hegrei ft man au ch die fe ierl i che Vers icherung Kath . Up. 5, 1 4
Dies ist das ! “ Wer so l ches denkt,F üh l t unb es chreib l i ch hochstes Glück
Doch es i s t Ze i t, daß i ch j ene S te l le der Kuhnschen Ahhand l ung b ezei chne
,zu deren Bes tätigung und Bestärkung ich
h ier e inen Bei trag zu l iefern su che .
In den ind ischen Fassungen der Parabe l v om Mann im
Brunnen erschein t als das verfo l gende , Angst und S ch recken ein
flößende Tie r n i ch t ein w ütend gew ordenes Kame l , sondernw e i t eindru cksvol ler und natürl i cher ein w ütender Ele fant .Nach dem Erns t K u h n auf p. 7 0 seiner Abhand l ung dessen ge
dacht hat,daß Samka ra zu Kath . Up. 6 , 1 jenen h imm l is chen
A évattha geradezu samsäravrksa nenn t,fährt er fort : Daß w e i ter
Verfol gung durch e inen Elefanten und Hinabstürzen in Grubeoder Brunnen s i ch im Vorste l l ungskre i se der Inde r nahe berühren ,ze igt z . B. e ine S te l le Brh ad-Arany aka-Up. 4
,3,20 2 a tha ya träi
nam ghnan iiva j inantiva has ta vicchäpaya tz'
gar tam iva pa ta ti yadeva
j ayru d bhayam pas'
ya lz'
tad a iräv idyayä m anyaie S acred Booksof the East XV
,1 6 7 f. (es i st von einem T räumen den die Rede )
„Now w hen
,as i t w ere
,they ki l l him
,w hen, as i t w ere
,th ey
overcome him , w hen, as i t w e re, an e lephan t chases him ,w h en
,
as i t w ere, he fa l l s in to a w e l l,he fan c ies , through ignorance ,
tha t danger w h i ch he (common ly) sees in w ak ing.
“ Auch stehtder Elefan t zum F eigenbaum in enge r Beziehung, da er die
B lätter sow oh l v on Ficus ind ica als v on F i cu s re l igiosa gernf riß t“ usw .
Die . letztere Bemerkung i s t kaum von großem Be lang ; um
so w i ch tiger das,w as vorausgeht der Hinw e i s auf di e S te l le
tad stad iti m anyan te (a) n irdeéyam par amar_n sakham. De u s s en
a. a. 0 . p. 265 übersetz t und erklärt die F ormel etad väi tat demen t
smechend : „Wahrl i ch dieses (w ov on v orher gesprochen) ist j enes
64 L eopol d v . S chroeder
man ihn s ch inde,als ob ein Ele fan t ihn in die Enge
als ob er in e ine Grub e (resp. ein Loch) 2) fiele, w as er w achendals e ine Ge fahr ans ieh t, das häl t er dort (im T raume) aus U n
w issenheit für e ine (w ir kl i che) Ge fahr . Wenn er dann aber w ieein Kön ig, w ie ein Gott (s ic h vorkomm t) , meint : ich bin d iesA ll ! das ist für ihn dann die hö chste S tatte.
Es s ind ganz deutl i ch typ i s c h e A ngs t t r äum e,neben ty
pischen Wonneträumen , w ie sie in um gekehrter Re ihenfo l geerst Wonneempflndungen , dann das S chauen von Gefahren auchder ob en ange führte Ve rs (Br. Ar . U p. 4
,3,1 3) erw ähn t.
Zur Er l äuterung ist Obänd. Up. 8,1 0
,1 — 4 heranzuziehen.
Dort hat Praj apat i dem als S chü ler b ei ihm w e i lenden In d raverkün de t : Jener (Ge i st), der im Träume s ich freuend umherw ande l t
,das ist der Ätman, das i s t das Uns terb l i che, das Furcht
lose ; das i st das Brahman .
“ Zunächst b efr ied igt,kehrt Indra in
der Fol ge doch m it e iner Z w eifelfrage zurück . Wenn der Träumendeau ch n i ch t in Wirk l i chkei t getö tet w i rd oder ge l ähm t w ird
,w ie
der Traum es ihm vorspiege l t, so i st es ihm doch so, als ob man
ihn tö te,als ob man ihn in die Enge trieb e, als ob er Un l iebes
erführe,als Ob er w eine (ghnan tt' tv iväinam ,
vicchäyayan tiv a , apr i
yavetteva bhava ti, apz'
r odz'
tiva) . Das nützt ihm a l so n i chts (nähama tr a bhagam pas
'
zyäm iti) ; er lei det eb en doch dabei . Das Getötetw erden und das In-die-Enge-Getriebenw erdcn s ind w esen tl i chdie gl e i chen Angstzustände im T ranme , die in der Br. Ar. Up. 4
,
1) Das Verbum v icchäyayat i K uh n schre ib t v iechäpayati ist
das Causat iv um v on chä und bedeutet eigentl ich„abschneiden “
. E s ist ,
als ob ein E lefan t ihn ab schn i tte,d. h . offenbar ihm den W eg abschn i tte ,
ihn in die E nge triebe , bedrängte . Vgl . Chänd. U p. 8,10
,2 und 4 v icchä
yayanti, in ähn l ichem Z usammenhange . E in typischer Angsttraum . In
m e inen Knab enjahren hatte ich e inen öfters w iederkehrenden Traum ,der
darin bestand , daß ein hochgew achsener russ ischer Pepe in dunk lem Talarv or den Zugang der Z immerabteilung trat , in der ich schl ief , auf d ieseWe ise m ir j ede Mögl ichkei t der F luch t a b s c h n e i de n d. E r nähert s ich mirl angsam ,
die Qual w ächst,ich erw ache. Die Ro l le des E lefanten spiel te
b ei mir der russische Pope als S chreckgestal t . Auch pl ötzl iches, erseh reekendesF a l len in die Tiefe ist m ir aus der E rfahrung als häufiges E nde v on Angstträumen b ekannt .
garta heiß t Grube , Loch . E s ist h ier also noch n icht e igentl ich v on
e inem Brunnen die Rede, w ie in der Parabel . Das Wesentl iche aber st imm tzusammen.
Lebensbaum und Lebenstraum 6 5
3. 20 neben dem Geschundenw erden und dem Id die-Grube—Fa l lenerw ähnt w erden, w enn auch der Elephant h ier n i ch t genannt w i rd .
Zu der ganzen t ie fs inn igen Vorste l l ung ist aber noch das berühm te Gespräch zw i s chen Ajätaéatru, dem Kön ige von Kasi , unddem s tol zen Brahmanen Baläki Gärgya zu verglei c hen. das uns
Br . Ar . Up. 2,1 erha l ten In erhabener Entw i ck l ung führt
der König h ier den Brahmanen z u der Erkenntn is,daß die We l t,
das Leben n i chts i s t als ein Traum des A tman-Brahman,
e in
Traum der We l tsee le die dem recht Erkennenden w ie w ir
h inzu fügen m üssen als die e igene S ee le s ich ersch l ießt, daherdenn der Untersch ied von Makrokosmos und Mikrokosmos ganzin Wegfa l l komm t 3) .
Wie s ich nun aber d iese Vorste l l ung v om Welttraum,resp.
Lebenstraum, ,zu der anfangs besprochenen Vorste l l ung vom We l t
b aum,resp. Lebensbaum
,verhäl t
,das lehrt uns am deutlicbsten
E ine andere Rezension dieses Gespräches, Kaush . Up. 4 erhal ten, erw nhnt gar keine T ranmvorstellungen, komm t dah er h ier für uns n icht inBetracht.
2) Vgl. mein Buch „ Indiens Li teratur und Kul tur “
p. 222— 225,w o ich
den Grundgedanken von Calderons b er iihmtem Drama„Das Leben ein Traum
dem Upanisad-Gedanken an die S ei te stel le. Brh . Ar . Up. 2, l , 18 (bei
Böh tlingk 1 9 und 20) heiß t es : „Wenn er dann im T raume w andel t, dann
sind das seine W el ten ; dann ist er gleichsam ein großer Kön ig , bald g leichsam ein großer Brahmane ; geht g le ichsam in Hohes und N iederes ein ; und
gl e ichw ie ein großer Kön ig , se ine U n tertanen fassend (mit s ich nehmend)im eigenen Re iche nach Bel ieb en sich umher bew egt, so bew egt s ich auchd ieser, die Lebensorgans fassend (mit s ich nehmend) , im eignen Le ibe nachBel ieben nmher .
“ E igentliche Angstvorstellungen s ind h ier, w ie man s ieht,n icht erwähnt.
Der M ikrokosmos , der Mensch , w ird in ausfuhrlicher S ch i lderungBrh . Ar . U p. 3
,9 am E nde als ein Baum gefaß t , dessen ew ige Wurzel das
Brahman ist (vgl. De u s s e n a. a . 0 . p. 456 Auch die schönen Versed ieses V ergleiches w erden dem Yäjfi avalkya zugeschrieben. Ich glaube denText am S chluß durch geringe Änderung n icht unw esentl ich b essern zu
können ,indem ich fur v ijfi anam änandam ein Bahuv rih i - Komposi tum
v ijüänänandam se tze. Die b edeutsame F rage :„Der Mensch , w enn ihn der
T od gefäll t , aus welcher Wurzel wächst er auf?“ erhäl t nun die nochb edeutsamere An tw ort
„Das in E rkenntn is sel i ge Brahman ist es,Das höchste Ziel des w i l l igen Gebers,Der fest steht und das E w ige kenn t. “
Festschr ift Kuhn .
66 Leopold v . S chroeder
und jedes Mißverständn i s auss ch l ießend die Kathaka Upanisad .
Bevor sie 6,1 den ew igen Feigenbaum sch i l dert, sagt sie 5, 8
Jener Gei s t (purnea) , der in den S ch la fendenWach t, s i ch gesta l tend Wunsch auf Wuns chDas ist das Li ch te, das i st das Brahman ,Das nennt man das U nste rb l i che,Auf dem beruhen a l le We l ten,Über das geht n iemand hinaus
D ies,w ahr l i ch
,ist das !
Der Ge ist, der in den S ch lafenden w acht und s i ch e inenWuns ch um den anderen se lb s t gesta l tet, das ist ja der träumendeGe ist, und d ieser w ir d hier mit unzw e i deutiger Klarhe i t demew igen Feigenbäume gle i ch gesetzt, denn er w ir d genau m it dense lben Worten beschr ieben . Um h ier ganz deutl i ch zu sehen ,muß man die bei den Verse der Upan isad im O r igina l neben
e inander ha l ten.
Kath Up. 6 , 1
ürdl wam ülo (a)väks'
äkha eco (a)s'
vattlzah sanätanalz tad eva
s'
ulerar_n tad brahm a tad evämy*tam u cya te tasm im Zloka
'
h s'
ritäh sarve
lad u nätyete'
kas'
cana | eind väz'
tat
Kath . Up. 5,8
ya esa supte‚su jägar ti käm am kam am puru,so nirm imäzw lz lad
eva s'
ukra7;n tad brahma tad evämr tam ucyate tasm z'
m llokäh ér itäh
sar ve tad u nätyeti kas eana etad väi tat
E s kann gar keinem Zw ei fe l unter l iegen : Der ew ige Fe igenbaum
,dessen Wurze ln drohen s ind
,und der Ge ist, der in den
S ch lafenden w acht,der träumende Ge i st, sind s i ch h ier völ l ig
gle i ch gesetzt. We l tbaum und Welttraum,Lebensbaum und Lebens
traum sind e ines und dasse l be,oder r i ch tiger : es s ind versch iedene
B ilder für eines und dasse lbe,für das ew ige unsterb l i che Brahman,
das si ch zu d ieser We l t der Ers che inung en t fa l tet oder zu entfa l tens chein t ; s ic
_
ane si ch erw achsen l äß t w ie e inen Baum ; aus s ic hw erden läßt w ie e inen Traum . Z um Überfluß vgl . man noch denträumenden , Wuns ch auf Wuns ch s i ch gesta l tenden Purnea in
Kath . Up. 5 , 8 mit dem F urasa in der Svetäév . Up. 3, 9 und
Mahän. Up. 1 0,20
, der , als Baum ‚ im Himme l w urze lnd, die ganzeWelt fü l l t. Ist der Baum ein sarmäravrksa, so könnte man m it
68 Leopo ld v . S chroeder, Lebensbaum und Lebenstraum
anderes w ar als der S amsaravrksa, der umgekehrte We l tbaum,
der n i ch t nur n i cht in e inem Brunnenloche w ächst,sondern
,w ie
die Svetäév . Up. so s chön sagt, als Baum im Himme l w urze lnd,die ganze Welt fü l l t . Von den Angstvorste l l ungen des Lebenstraumes ges chreckt und gejagt
,l äßt s ich der l e i chtfertige, im
S amsara befangene Mensch dennoch an dem Honige des Lebensbaumes behagen und über die Gefahren
,die ihm drohen
,h inw eg
täus chen .
Ohne Zw e ife l hat K u h n vo l l kommen recht, w enn er p. 7 1
von der Parabe l bemerkt, daß sie „als selb ständige Di chtun g v on
Anfang an bew ußte Al legor ie “w ar . Doch i ch m eine, daß die
Elemente d ieser Al legor ie erst ganz vers tändl ich w erden,w enn
w ir e ine kühne Verschme l zung der bei den großen Bi l der derUpanisad-Literatur, Lebensbaum und Lebenstraum ,
darin erkennen .
Diese kühne Verschme l zung w ar gew iß der gen ia le Wurf einesechten Di chters und Denkers ; sie hatte ab er ih re S chw ierigke itund b rach te Gefahren m it si ch
,die s ic h in der Fo lge, bei den
späte ren Bearbei tungen des Gegens tandes , in gew i ssen U nstimm igke iten ge l tend machten . Der große und t ie fe Gedanke der ur
sprünglichen S chöpfung ist aber dadur ch trotzdem n i cht w esen tl i chb eein trächtigt w erden . Er hat seine s iegre i che Kraft durch dieJahrtausende
,bis in die Gegenw art h ine in bew ährt.
Zu den Brahm anas.
W. Ca]and (Utrech t).
Im Kathaka (I I . 3 : 9 , 1 7 und XXII I . 4 : 7 9 , 6) sol l es nachdem S chroederschen Texte ein Adjektiv sw nanasya geben. Diesi st gew i ß unri chtig ; es l iegt v ielmehr das b ekannte sus asya v or ,
w ie aus dem Texte des Kathaka se lber hervorgehtf v . S c h r o ede rl ies t II. 3 : lcg *
_syai tvä s umanasyäyaz
'
kr sz'
rfz suscuryäm u tkrdhz'
. S im o n
v erze i chnet in seinem Index v erborum h ier irrigerw e i se sumanasyäm
s tatt des al le in ri chtigen sumsyäm . Es ist a l so statt sum ana3yä'
yai
in II. 3 und °yäyc
'
z“
in XXIII. 4 zu lesen : susasyä'
yai und susasyäyä‘
.
Zu Kathaka VI. 3 : 5 1 . 1 6 ff. : na ksir epa pr atz'
5ifi cen nodalcena
ya t 7r;siren a pr a ti,sifzeed apr atisz'
ktam Syäd yad udakena samoyed
dokane samsrävam u cchisyeta nodakamz'
érep a pra tisz'
ücet tan n a
kflr ep a pr ati_siktam bhava tz'
nodakena skannam väva ta t pari sed
äkar oti s sthä ly agnüzotr a tapani tayä duhyäd iga 7_n vai m äna t)ä'
im äm iha nehätiskanda ty anayaiv0pasida ti tad asyäiskannam bhava tz'
.
Diesem Pas sus ist ke in befriedigender S inn abzugew innen . Was
so l l 2. B. samsrävam ucchisyeta he ißen ? samsr a vam i s t Acc . mas c.,und dazu paßt das passive Ze i tw ort gar n i c ht. Was bedeute tferner iyam vai m änavä ? Nach S im o n (Index, p. 1 5 1 ) s tehtm änava für m änaväs . Das h i l f t un s aber n i ch t w ei ter. Zu b e
achten ist jedoch,daß ucchi
_syeta e ine S chroedersche Konjektur i s t,
da die Hs . zwehi_syatd hat. Was m daoud angeht , so lese i ch m it
e iner ganz lei ch ten Änderung da für sänavä,d . h . sä na so? . I ch gehe
jetzt die ganze S te l le noch e inma l und füge die S atztrennungbei: na ksire7
_za pra ti,siücm ,
nodakena ; ya t k,fi r ena prati_sifi eed, apra
ti,riktmh syad yad udakena (s c . s'
am ayed : dolzane sam
cravam u cchi‚sya, tenodalcamzlirena pr a tisificet ; tan na ksirena pr a ti,sik
70 W. Ga land
tam bhava ti, nodakena . Skannam väva tat , pari sed äkarotz'
; yä
sthäly agnilzotr atapan i , tayä duhyäd; iyam vai aa ; na vä im am iha
n ehätiskandatz'
usw . ; i'
ya7_n v ai sd heißt natürl i ch :„d iese (irdene
S chüssel ) i s t ja die Erde“. I ch glaub e
,daß jetzt die S te l le
deutl i ch ist. Z um Ganzen ist zu verglei chen Ap. VI . 6 . 7
dohanasamksälanam era va aniya tena pratisifi ca tz'
; besonders aberMaitr . S amh . I. 8 . 3 : 1 18
,1 7 ff. : ya
’
d adbhfla. pr a tz'
gifi céd dhdro
vénayed ; gam dohasam-nej anena pra ti,sé0yam ; tad dhif nä
'
po nai pa’
yas.
tcid aba lz: Skcindati vc'
f etcidi ya'
rhi vä‘
etaid do'
hanät paryäkfiydi6 ,
tdrhi skanncim usw . Auch d ieser Text fre i l i ch enthält e inenFeh ler
,da offenbar statt gäz_ndoha ° zu lesen ist : godoha°, vgl . Hir .
ers. III . 7 : godohanasargm ej anena pra ti,sicyam .
Noch zw e i S te l len desse lben Kathaka-Kapi te l s s ind zu ber ichtigen : 52. 9 : yad apra ti,silctavz na juhoti brahm avar casi bhavati l iesyad apratisiktena j u/zoti, und Vgl. Ms. I. 8 . 3 : 1 1 8. 10 : apr a tise
kydm syät tej askämasya brahmavar casakämasya . End l ich muß
Kath. l . 0 . Z . 12 m ayas'
ca feh lerhaft statt payas’ ca se in,w ie
deutl i ch aus dem Zusammenhang hervorgeh t.In dem uns vor l iegenden Kathaka so l l neben dem rege lmäßigen
rsävayati auch sravayatz' vorkommen, und zw ar XXIX . 3 : 1 7 1 . 2 :
sthävaräs sr avayan ti. Diese Über l ieferung (w e n n das Ms. Chamb ers w i r k l i c h so l ies t) gib t ke inen S inn. Da aber die Kapisthalasainhita sthävarälzsvavayar_n ti b ietet, so ist an unsererKathaka-S te l le zw e i fe l los sthnvam ev avayantz
' herzus te l len.
N i ch t r i ch tig hergeste l l t s che int mir Kath . XXXIV. 3 : 37 .
1 2 : yady akritam (sc. som am) apahareyu r anyolz kri tavyo (ri ch tigw äre kr etavyo , w ie XXIV. 3 : 9 1 . yadi kfl tam, yo nedi,sthariz
e_i; ät sa ahg
: tyäbhisutyo ; r äj ähär äya tu kiz_n cid diyate nasya sa
parikrito obov a ti. Daß der so kons tr uier te Wort laut n i cht ganzin der Ordnung ist
,geht aus den S ch l ußw orten : „
er i st vonihm n i cht erkau ft“ hervor. Die Hs. l iest aber diym _
nte näsya
statt diya te nasya . Mit le i chter Änderung erhäl t man das ri ch tige :deyaw ; tenäsya sa pam
'
krito bhavate'
. Durch die b loße Herbeischafi'ungv on anderem S oma ist a l so der ganze Kauf er led igt und brauchtn i cht noch einma l stattzuhab en . Zu verglei chen i st Jaim. Br. 1. 354
yadi kritam apahar eyur yam eva kamcadhz'
ga tyäbhisuziuyur ; yena i
vasya pürvakr ayagzakfi to (i c h verm ute : pür vakr ayepa kr ite) bhava ti,tenaiväsyäyam krito bhava tz
'
; somakrayz'
zze tu kim ce'
t ka7_n deyam .
7 2 W . Galand
dhapaya tz'
, bes tä tigt unsere Auffassung. Welche Bedeutung mat):
in der Zusammensetzung präcinamätä hat, i s t s chw ierig zu sagen .
Zu Apastambas Zei ten w ar der Ausdruck s chon außer Gebrauchgeraten, da er das Wor t näher um schre ib t : ürdhvaväsyam br uvate.
F reil i ch ist auch ürdhvaväsya („ au fw ärts anzuziehen “
) n i ch ts i cher gedeutet. Nach Rudr adatta ist ein Kle i d geme int, dessenF ransenteil man oben trägt, andere erk lären es
,nach Rudradattas
Mitte i lung, e in fach als Obergew and . Man denk t bei präcinamätäunw i l l kür l i ch an präctnatäna und präcinätäna, deren Bedeu tungjedoch ebensow enig ganz erm i ttel t ist.
Man l iest im T aittiriya-Brahmana (I . 1 . 9 . level so’
gm’
lt
karyo yö’
sm az'
pr aj ä'
r_n pas
'
ün pr aj andyati'
tz'
; .s'
dlkais täm r ä'
trim
agntm indhita,tdsmz
'
nn upav_yu,soim ara'
zü m’
,stapet. ydtharsabhä'
ya
väéz'
tä'
nyävichä'
yati tädyg evd tdi. Wie verhäl t es s i ch mit,
nyävichäyatz'
Das Petersb . Wörterb . (IV, 1 4 30) zer legt es in : n i—ä—vi-chäyati.
Bekann t l i ch aber (vgl . D e l b r ü c k , A ltind. Syn tax 236) i s td iese Reihen fo l ge der Präpos it ionen
_ unerhört, w en igstensh ö chst se lten : w enn ein Verbum m it mehreren Präposi tionenzusammengese tzt w ird
,v on w e l chen e ine die Prap. a ist, geht
d iese letzte immer dem Verbum unm i ttelbar voran . Es ist dahervie lmehr a i-ä-vz
'
chäya ti zu zer legen ; so mach t es au ch Bhaskaramiéra zu dieser S te l le : er v erw e is t auf Pan. III. 1 . 28
(praes . viclzäya ti) . Die S te l le w ürde i ch übersetzen : Wo sol l mandas Feuer h intun
,w e l ches ihm Nachkommen und Vieh erzeugt ?
Er erha l te das Feuer d iese Nach t in Flammen und w ärmegegen Tagesanbruch den Feuerb ohrer an ihm . E s ist dies genauso als ob e ine rindernde Kuh sich vom S tiere bespringen l ieße“
(das brähmaudanika F euer befru ch tet also glei chsam den Feuerbohrer) . ni-ä-vz
'
ehäya ti bedeutet nach m einer Au ffassung al soungefähr : subz
'
r e. Die im Petersb . Wörterbuch unbe legte Wurze lvich hat zuers t G a r b e aus dem Apastamba
-sütra nachgew iesen .
Ich selber habe früher (WZKM. 23 p. 7 0) die Richtigke i tdavon angezw ei fe l t, gegenw ärtig bin i ch anderer Meinung, dam ir inzw i schen außer der S te l le aus dem Ta itt. Br . nochm ehrere . Be lege dieser Wurze l bekann t gew orden sind . Das
Satapatha-Brahmana näm l i ch in der Kaum -Rezens ion hat zw e iw e itere Be lege ; IV. 2. 4 . 1 2 lautet : athä
'
parar_n caturgrhitam
äi am : grhiwähéhi yaj am äne'
te'
; ta'
t purcisiät somalcr ciyaay üpati,stha8e ;
Z u den Brahmanas 73
pra tydsyanfi dr a"rom ; tü
‘
m «Thum: u'
di cim a'
tiv ichäga téii ; täm üdic‘
im
abhz'
m antrayaß (die Akzente sind hie und da v on
m ir r i chtigges te l l t). Dem Ausdruck a tivichäyata (2. Pers . Imprt.pl.) entspri cht in der Madhyandina—Rezension (III. 2. 4 . 22)a tyälcu r van ti. In der Kanva-S te l le haben w ir al so a tiviohäya ta
(führet vorüber) und a tivicham äm'
i,w ofür vie l lei ch t ativichüyayata
(Kansat.) und a tiviclzyam ct nä zu l esen ist (Praes . pass . vom Kane. )
S o erw ei sen s ic h Baudhayana ’
s ativz'
tsayantz'
und Hiranyakeéins
a tiv itsa -ntz
'
als,fre i l i ch sehr a l te
,Korruptelen . S ch l ieß l ich is t
dasse lbe vi clz auch für Sat. Br . XIV . 7 . 1 . 20 hastiva viclzäyaya ti
anzunehmen , w e l ch es der Komm . zum Kanvatexte m it vidrävayatz'
(dhävaüty ar t/mb) erl äu tert , w ahrend Sayana es r i ch tig zunich zieht .
Eine Lauterscheinung im Niassischen.
Von
H. Kern (Utrecht).
Es gib t im Niassischen man che voka l i sch an lautende Wörter, die unter bestimm ten Um ständen ein 9 vor s i ch nehmen .
S o l che Wört er s in d z . B. : eu,Hol z ; u tu , Laus ; afosi, Baumw ol le ;
ana’
a,Go l d ; ör öbao Büfl
‘
el; abe,Fuß ; andre , Ge lbw urze l ;
und/m, e ine Art Kürb is ; osa lz' Geme indehaus ; olo, fes ter Wi lle usw .
Man s ieht gle i ch,daß d iese Wörter in den verw andten
Sprachen mit k an lau ten,mit Ausnahme von osali und ölo
"
,
w el che m it g anfangen . Also : eu , jav ., mal., daj. kayu ; a lu , mpu .
ku tu ; afasz'
, jav . ,m al. kapas ; ana
’a,a . und n . jav . kana/ca (urspr.
ör öbao,mal. kerbau ; abe
,dair. kae ; andr e
,mal. kufiz
'
t ; undr u,mal.
kundur ; osalz'
,a. j av .
,sund . gosalz
'
; a. und n . jav . gélém .
Im ganzen gi l t die Rege l,daß an lauten des k vor e inem Voka l
ab fa l l t, w ie auch inlau tendes Ic zw i schen Voka len . Be ispie le sind
i’
a,Fisch
,mal. usw . ikan ; a ta
’
u,beängstigt
,ajav. atak at ; si
’
a, El len
bogen,ajav. sika
,njav . siku t ; fa
’
a,Präfix
, mpn . paka . Das w eitverbre itete Präfix [ca k zur Bi l dung von Ko l lek tiven und Ab
strakten,besonders mit suffix an
,verl iert rege lm äßig den An laut,
sodaß es oft s che inbar zusammeufällt mit e inem ganz andernPräfix
,nam l i ch a ; z. B. aan, leb endig, ajav. abam
'
p ,aus Prai.
hum'
p ; dagegen aumj'
a (resp. gaumfa), Lebensm i tte l , aus Präf.
ka,hum
'
p S ufl"
ix an . A öndro,s i ch b iegen
,aus a ondrö ;
aöndröm a (resp. gaöndröma) Biegung, aus ur sp. ka öndröm
S uffix
1) M it 0 bezeichne ich den eigentümlichen Laut, der meistens auf
al teres Pepet zurückgeht.E s sol l n icht v erkannt w erden
,daß die Regel manche Ausnahmen
erleidet ; die meisten erkennt man leicht als E nt lehnungen . E s ist hier
7 6 H.Kern , E ine Lautersch einung im Niassischen
n i cht vers chw unden ; der Grun d ist unklar, nur kann man sagen,daß diese lbe Abw e i chung ö fter vorkomm t. Bei neueren E ntlehnungen l äß t s i ch die U nrege lmäß igke it am lei chtes ten erkl ären
,
z. B. in Wörtern w ie bago , Tabak, doch tagö i s t ohne Zw ei fel ein
ura l ter Besitz der Sprache ; übrigens beruht die Vertretun g von
an durch 6 h ier nur auf Ähn l i chke i t des ö m it dem Laute des
0 . E in anderes Bei spiel i st fananu w andr u, aus f. n-fandru,das Mit te l zum Anzünden der Lampe. Dagegen fananu fondr a ,das Anzün den der Lampe, da fondra h ier das d irek te Objekti st . Im Deutschen w ir d das Obj ekt e ines nem . actionis (Ver
balsubstantivs) m it dem Hauptw ort verm itte l st eines Gen i tivs(Gen . obj .) verbunden , doch das Niassische verw endet in sol chemF a ll keine Genitivpartikel. F anunu ist Verba l sub s tantiv des Verb um s m am ma
,S tamm mpu . tunu .
Ursprüngl iches k w ird nach Nasa l erw ei cht zu y; z . B. hogu
gen, der Wipfe l des Baum s aus h . n -
geu, w eiter n-geu , s ch l ießli c hgen . Daß die Lautverb indung ng vereinfacht w i rd zu y, ist
ausnahms los Rege l . S o w ir d aus mal. (pers .) angur , Wein imNiassischen agu ; aus mal. pihggan w ird figa usw . E s ist zubemerken
,daß in e igent l i chen Kompos ita die j etzige, im Sprach
gefüh l normale Form e ines S ub s tant ivs zutage tritt, z. B. figa
e a, Hol zte l ler. Regelmaßig w i rd auch das a l te Possessivsuffix der1 . Ps. sg. nlcu
,ajav. usw . izku , zu ga ; amagu , ajav . ramariku .
Werter Kol lege Kuhn ! Empfangen S ie diesen w inzigenBe i trag zu Ihrer Fes tschri ft als ein Zeugni s
,daß i ch m i ch herz
l i c h freue,S ie zu Ihrem s iebzigsten Gebu r tstag begl ückw üns chen
zu können . Mögen noch vie le, gl ück l i che Jahr e Ihr Te il sein,
w obe i S ie zurückb l i cken können auf eine unermüdete,fru chtbare
w is senschaftl i che Tätigke it ! j iva s’
ar adah s'
atam .
Ein Brief Bopps an Friedr ich Thiersch uberdie Stellung des Zakonischen innerhalb der
indogermanischen Sprachen .
Mi tgetei l t v onH . S ch nor r v. Carolsfeld (München).
Hochverehrter Herr Gehe imer Rat !Wenn i ch der Aufforderung
,m it einem k leinen Bei trag an
der Ihnen zu w idmenden F ests ch r i ft tei l zunehmen,Fo l ge leis te,
so tue i c h d ies freudigst, um I hnen dam i t ein Zei chen des Dankeszu geben
,den i ch I hnen fü r Jah rzehn te dauernde Un ters tützung
s ch ul de . Als m ein S ommersemester 1 885 in der Hauptsache m itder Vo rbere itung auf e ine bevors tehende ph i lo logische Prüfungausgefü l l t w ar
,durfte i ch ihm du rch Te i lnahme an I hrer schönen
A v esta-Vor lesung einen erfreul i chen Einsch lag geben, und als i chm i ch dann dem b ib l iothekar i sc hen Beru fe zuw andte , w aren S ie
mir ungezäh l te Ma le He l fer und F reund . An Ihrem s iebzigs ten Geb urtstage kann i ch Ihnen , vo l l ausgefü l l t dur ch die Pfl i ch ten m einesAmtes
, eine e igene Ar bei t aus Ih rem F orschungsgeb iete n i ch tre i chen, darf aber annehmen
,daß der nach fol gend abged ruckte
Brief Franz Bopps bei Ihnen, dem gründl i chsten Kenner derGes ch i ch te der Sprachw is senschaft, Interes se er regen w i rd ; er i s ten tnommen den unerschöpf l i chen Beständen der E gl. Hof und
S taatsb ib l iothek,die Ihnen aus langjähriger Benu tzung so w oh l
b ekannt i s t und für Ihre F orsch ungen so oft s ich zur Verfügungstel len d urfte .
Der Br ief ist ger ichtet an den Phi lo logen Fried r i ch T h i e r s c h ,den späteren Präs identen der baye ri s chen Akadem ie der Wissens chaften , der Bopp den 1 835 ersch ienenen ers ten Band der „
Ab
hand l ungen der ph i losophis ch-ph i lo logischen Klasse der König l ichBayer i schen Akadem ie der Wissenscha ften“ üb erm i t te l t hatte und
dabe i den Wunsch aussprach , Bopp m öge ge legentl i ch e inen Beitrag zu der neuen Reihe der Abhand l ungen l iefern. Wel c he För
7 8 H . S chnorr v . Carolsfeld
derung der vie l se itige Thiersch ihm w i dmete, i s t aus L efma n n s
Biograph ie ‘) bekannt, w ie denn auch Bopp schon 1 820 Mi tgl ied der
Münchener Akadem ie w urde, ein Jahr b evor er die Berl iner Professur erh ie l t
,der dann im f ol genden Jahre die Aufnahm e in die
dor tige Akadem ie fol gte. Der Wuns ch von Th iersch,Bopp unter
die Mitarbe i ter der Münchener Veröffen t l i chungen zäh len zu konnen,i st n i cht in Erfü l l ung gegangen
,dieser hat nie etw as für die
bayer i s che Akadem ie der Wissens chaf ten gesch r ieb en .
U n ter den zah lre i chen Aufsätzen die der stattl i che Bandenthäl t, mußte Bopp in erster Lin ie die Ab handlung von Thierschse lb st Über die Sprache der Z akonen“ interess ieren . Er stimm tdiesem sofort darin b ei
,daß das Z akonische keine s law i s che
Mundar t sei,w ie d ies K0pitar angenommen hatte ; später s cheint
er ab er,sow ei t i ch sehe
,auf das Z akonische nie mehr zurück
gekommen zu sein . In letzter Ze it hat über die in teressante SpracheT h um b in seinem Handbu ch der griech is chen Dia lekte (1 909)p. 90 gehande l t.
H . S chnorr v. CarolsfeldDirek tor der Kgl. Hof und S taatsb ib l iothek Muncheu .
Der Boppsche Brie f lautetHochverehrter Herr und Freund !
I ch sage Ihnen und durch Ihre geneigte Verm ittelung der
ph i l . .
-
ph i lologischen Classe m einen inn igsten Dank für den
m ir gütigs t übersandten seh r rei chha l tigen Band akadem is cherAbhandlungen sow ie für die m ir seh r ehrenvo l le Aufforderungzur Mitar beitung für den künftigen Band, der i c h gerne en tgegenkommen w erde, w enn s i ch mir ein w ü rdiger Gegens tan d und Mußezu seiner Verarb e i tung darb iete t. Die s chätzbare Zusendung ist erstse it e in igen Wochen in meinen Händen und i ch habe bis jetztnur lesen können , w as m i ch am m e is ten anzog‚
näm l i c h Ihrevortrefl
°liche Abhandl ung über die Sprache der Z akonen, die für
m i ch v on höchster Wi ch tigke it i s t und w ovon in der Fol gem anches an me ine sprach vergle i chenden U ntersu ch ungen si ch an
re ihen w ird . An eine d ir ekte Her le i tung d ieser Sprache vom
S law is chen,die b ei der früher nur fragmen taris chen und mange l
1) L e fm an n , F ranz B0pp‚ p. 55 ff. , Anhang, p. 120 .
Etymologica.
Von
Rudolf T hurneysen (Bonn) .
1 . I dg. b h ü r b h a r
Der etymo logische Fors cher, der über die Einze l sprachen hinausgeht, ist b ei Verb en und Ab strakten m eist gezw ungen , s i chm it e iner b lassen, sehr a l l geme inen Bedeutung zu begnügen
,die
zw i s chen den äl testen h is torischen Be legen verm i tte l t. Das mach tj a d iese Fors chung oft so uns chmackhaft
,daß es nur so se l ten ge
lingt, der engeren ursprüngl i chen Bedeutung, des w irk l i chen Ausgangspunktes habhaft zu w erden . E in sol cher Ausnahmefa l l s cheintm ir bei den fol genden Wörtern vorzu l iegen , die im e inze lnen s chonvon anderen zusammengeste l l t s ind .
Nie zeigt s i ch der S tier herrl i cher und gew a l tiger, als w enn
er zorn ig b rü l len d m it den Vorder füßen die Erde aufw üh l t unddie S cho l len nach h inten über den Rücken w irft ; es ist der
Augenb l i ck , w o der Wanderer auf der Viehw e i de si ch sch leun igstnach einer S i cherun g um zusehen pflegt. Diese Tätigkei t des
S tiers w ird im älteren Iris chen durch die Wurze l bür ausgedruckt.Spezie l l das Aufwüh len der Erde b eze i chn et der ursprüngl ichn eutra le o-S tamm bztrach, oft als inneres Objekt mit Verben desGrab ens und Wühlens verbunden, z . B. im großen S tierkampf inder S age Tain Bo Ottailnge : foc lassa bür ac/z do
’
a
'
b “ein bürach w urde
von ihnen (den S t ieren) gew üh l t Daher noc h heute im Gä.l ischen(nach Ma c d on a l d s Gae l i c Dic tionary) bür ac “ search ing or turn ingup the earth , de lving, digging”
. Das Verb,altir . büim
'
thir,bezei chnet
m ehr das Brü l len,n i ch t nur v om S tier gesagt
,sondern z. B. auch
1) In W in di s c h s Ausgabe 6 144 , der überhaupt zuerst die e igentl iche
B edeutung dieser Worts ippe aufgeklärt hat .
E tymo logica 8 1
von der K r iegs fur ie Bodb ; so gäl. (nu r“ roar
,be l low ,
as a deeror bul l". Dazu das Ab straktum altir . bt
2
riud und davon das Adj .bu
'
r edach b rül lend “. Das kürzere Adj ekti v bür w i rd m it
„zorn ig
,
w ütend“ üb ersetzt, dazu das Abstr. bzir e, bu'ra Zorn,in unseren Texten i hrer Natur nach me is t aufHe l den und
Heere übertragen ; aber zugrunde l iegt immer die Erinnerung an
den w ütenden S tier, w ie denn das w e i ter abge le itete Adj . bü(i)r echin der Tain B. als Be iw ort von bai
„Rinder “ ersche int.
Nun hei ß t auch im Le tti s chen baurüt„brü l len (vom S tier,
nament l i ch w enn es mit E rdaufw erfen verbunden alf-baura’
t
f in'
us vom S t ier gesagt, der brü l lend Erde a l so genaudem Irisch en entsprechend , und dazu ste l l t T o rp (z . B. F i c k III 427 5 ) neunorw eg. büra b rül len (vom An e ine Ent lehnungist namentl ich im Letti schen n i ch t zu denken
,ebensow en ig
an e ine zu fäl l ige paral le le Bedeutungsen tw i ck l ung, sondern w ir
haben h ier offenbar die U rbedeutung des S tammes v or uns. Mitd iesen Wörtern verb indet man nun mit größerer oder geringererWahrschein l i chke i t russ . bur zina
„e inj ähriger S tier ; Brandung ;
S turmw ind “
, gemeinslav . bu r'
a S turm ,S turmw in d “
,bum
'
tz'
je nachdenDia lekten „ du rche inanderw erfen , s ch leudern ; toben , tosen“
l i tauisch bziris „ungeordnete, w i rre, tosende Menge ; Herde, Hau fe
lat. f urere rasen “
, fmvia ; altind. bhürqülc „ heftig , zorn ig, w i l d, e i fr ig ,
rührig “
,bhmw
’
ti ) cw bhnri ti „zappe l t, zuck t, zünge l t, s ch ieß t dahin
gr . n ogqv-égezv „w a l l en , in unruhiger Bew egung se in“
, mögen » „be
spri tzen, besude ln ; durcheinandermischen, ein rühren “. Man m ö ch te
sagen , j e w ei ter man s i ch vom Norden und Wes ten entfernt, um so
vo l l ständiger verb laßt die Erinnerung an den w ütenden S tier und
se ine w üh lenden , die Erde schleudernden Vorderbe ine .
Die Wurze l s chein t s i c h ursprüngl i c h nur zw is chen den F ormenbhür und bhar bew egt zu haben fa l l s die kurzvokalige F ormn i cht ers t durch Einm is chung etw a von bhur Ablau tsform zu
K . M ey e r , Contributions to Irish Lex icography s. v v .
E d. S t r a c h an -O ’Ke e ffe 964.
3) B e z z e n b e r ge r in seinen Beitr . 26 , p. 1 87 .
B e r n ek e r s . W .
T r au tm a n n GGA 1 9 1 1, p. 246 .
Z ur angeb l ichen avestischen Wurzelform bar vgl. T r au tm a n n
a . a. O .
Fest sc hr ift Kuh n .
82 Rudol f T hurneysen, E tymologica
bher u„sieden , w a l len “
en tstanden i st j eden fa l l s n i ch t zu derrege lmäßig ab lau tenden u -Re i he zu geboren
,in die sie ers t im
Ba l ti sch-S law i s chen geraten ist . S ie w ird eben ursprüngl ich eno
matopoetisch gew esen se in .
2. L a t. b i r r u s.
In der romischen Kai serze i t tritt ein K le i dungsstück auf,das
birrus (byrrus), p’ iggog genannt und CGL V 4 1 0, 1 3 als cuculla breuz°s
erk l ärt w ir d . Nur zw e i feln d habe i ch im Thesaur us L. L. das
ke l ti s che Adjektiv altir . ber r,kymr is ch äl ter bgrr , später byr , breton.
herr,korn . ber „
kurz“ zur Erkl ärung herangezogen,erm utigt da
durch,daß neben anderen Hers tel lungsorten im Maximaltarif des
Diokletian ein ßiggog N egßzzo'
g, ßiggog Mel w o,u ayrjazog, p
°iggog
Bgeza vvuco'
g erw ähn t w ird , und daß S chol . Iuv . 8,1 45 die No tiz
bringt : ap ud S antonas oppz'
dum Gallz'
ae conficz'
un tur . Das hat auch
H o l d e r bew ogen,das Wort in se inen Altceltisch en Sprachschatz
aufzunehmen . Me ine Zw eife l rührten daher,daß man dam a l s
a l l geme in als Grundform des keltischen A djek tivs *ber sos ansetzteDur ch die Un tersu chungen von H e s s e n ,
Z . f. Ce l t. Phi l . 9 , H i .,besonders 4 2 hat s i c h das aber als unr ich tig erw iesen . Die Um
färbung des 0 zu a im Kompos i tum m ittelir . cambaa'
r cu-mm air kur z“
und nam ent l i ch in altir . cumbre cuz'
m re Kürze“erkl ärt s i ch nur
,
w enn die fol gende S ilbe al tes z'
enth ie l t. Die in se l ke l ti sch e Grun dform i s t a l so *bir ros (die aus
*birsos en tstan den sein kann). Dam i ts chw inden a l le Zw eife l . Wenn ein k u r z e r Kapuzenmante l , derhauptsäch l i ch in ehema l s ke l t is chen Ländern angefertigt w i rd,bi7m heißt und birr os das ke l t ische Wort für ku rz“ i s t
,so i st
S ache un d Nam e ke l ti s ch,w oh l gal l i sch .
1) Vgl. S t ok es bei F i ck 11 4 p. 1 73 ; H en ry ,
Lexi que etymol . du b retonmoderne p. 32 ; M a c h a i n , E tym . Diet . of the Gaelic language se p. 33 .
84 Ignaz Goldziher
J e z i d? Wenn du dam i t, w as du ausgesagt hast,oder w as du
beanspru chst, im Rechte b is t, so Spri ch : ,I ch w ill aus dem Kre i s
des Jezid heraus treten m it der Vers icherung,daß a l les , w as i ch
gesagt habe, die re ine Wahrhei t Wiederhol t nun der im
Kreise S tehende seine Behauptung, so hat m an die S i cherhei terlangt
,daß er die Wahrhe it ausgesagt hab e. Hat er aber n i ch t
den Mut , im Kre ise s tehend die Worte nach zusprechen, so gi l tdie Lügenha ftigkeit se ine r Aussage als
2. Die w underbare Hervorb r ingu ng v on Wasserque l len durchdas Geb et des he i l igen Mannes oder e ine dasse lbe beglei tendemechan i sche Handl un g (das S ch lagen rn i t e inem S tabe
,e iner
Lanze, das S tampfen des He iligen oder se ines Re i tt ieres u . a. rn .)is t ein häufiger Typus in den He i l igen legenden des
Im Koran (38 v. 4 1 ) he iß t Gott den Hiob mit se inem F uß
s tampfen, um dadurch zu se iner He ilung „ einen küh len Badeortund e inen Trank “ hervorsprude ln zu lassen .
Neben d iesem gew öhn l i chen Typus findet s i ch vere inze l t auchdie Anw en dung des Z a u b e r k r e i s e s als Mitte l zur w underbarenHervorb r ingung e iner Wasserque l l e. Der basrische Gottesge lehrteE j j ü b a l - S i c h t ijän i (st . befand s i ch e inma l m it e inerPilgergesellschaft auf dem Wege nach Mekka. In der Wüstene iw erden sie lange v on Dur st geplagt ohne auf e ine Wasserqu el lezu stoßen . Angst und Verzw e i fl un g überfiel die ermatteten Leute .
Da sprach E jj üb : Wenn i hr m ir das Versprechen geht, m e in Vorgehen geheim zu ha l ten, w i l l ich eu ch he l fen . Nach dem ihm die
Geheimha l tung zugesi chert w u rde, zog Ejj üb e inen Krei s (daww aradä
’
iratan), verr i ch tete (in dem Krei se stehend) ein Geb et,und
darauf sprude l te e ine Quel le hervor, die zur Labung der Leu teund ih rer Kame le h inre i chen d w ar . Nachher s tr i ch er mit der
Hand auf den Ort, an dem er dies Wunder bew i rk t hatte,und
die S te l le nahm w ieder ihre frühere Gesta l t an ; die Que l le v er
Wir können natürl i ch n i cht ents chei den, ob bei d ieser Legende
1) Ar ab ische Zei tschrift a l -M asr ik II , p. 732.
2) Die Varietäten dieses Typus erfordern eine besondere Darstellung .
3) Bei Dah a b i T adkirat aI-lgufi ä_
z (ed. Haidaräbäd) I p. 1 18 nach denSamä‘il al-zubbad von Ib n
‘
Aki l (st. der sich auf äl tere Nachr ichten beruft .
Zauberkre ise 85
ein Einfluß der j üd ischen Erzäh l ung vom Wundermann Ch ön i
dern „Kr e iszi eh e r “ vorauszusetzen sei,der zur Zei t einer
Regennot e inen Kre is zog, in den er s i ch ste l l te,
um se ind r ingendes Gebet zu verrichten , das auch re ic h l i chen Wassersegen zum Erfol g hatte
3 . Zauberkre i s zur Abw endung e iner von fe ind l ichen Machtendrohenden Ge fahr . Z u b e j r b . a l -
‘Aw w am (e ine r der zehnGenossen
,denen der Prophet s chon bei Lebze i ten das Parad ies
verbürgte) beglei tet den Muhamm ed auf einem näch tl i chen Be
su ch bei e iner Abordnung der Dsch inn . Außerha lb Medinas gelangen sie an einen w üstcn Ort, w o sie hochgew achsener Leu te
,
als ob sie Lanzen w ären,ans i chtig w erden ; „
Als i ch sie
erb l i ck te “erzäh l t Z ubejr „ ergriff m i c h gew a l tige Angst, so
daß m ich vor F urcht me ine F üße n i ch t m ehr trugen. A ls w ir
uns den Leuten näherten, z e i c h n e t e de r P r oph e t m it s e i n emF u ß e i n en K r e i s auf den Boden und l ieß m i ch in den Mi tte lpunkt desse lben n ieders itzen . Darau f verl ieß m i ch das Ge füh l ,das m i ch vorher beherrs ch t hatte. Dann entfern te s i ch derProphetund rezitierte ihnen den Koran bis zum Anb ruch des Morgens .Hernach kam er zu mir zurü ck
,und w ir machten un s auf den
Weg. Nich t w ei t von unserer S te l le h ieß er m i ch umw enden,und i c h sah n i ch ts anderes als vie l S chw arzes . Der Prophet abernahm von dem Boden e ine Handvol l Unrat 2) und s ch leuderte ihngegen
In d iese Rei he gehört auch eine sagenhafte Mi t tei l ung desSahrastäni “
) in b ezug auf den von se inen Anhängern (‘Isäw ijj a)als Wundertäter verehrten jüd is chen S ektenstifter A b ü
‘
I sä
Ishäk a i- I sf a h an i (zw e i te Häl fte des 8 . Jh . n . Wenn
er kriege ri s ch angegriffen w urde,zog er um se ine Genossen mit
T alm . b . T a‘
anith tel. 1 9 ° vgl. O rientalische S tud ien (Nöldeke-F estschri ft) p. 308.
Über Verw endung so lcher Dinge bei Z auberübungen vgl. JohnB u rk e , Compi lation of Notes and Memoranda upon the use of humanordur e in r ites etc . Wash ington 1888. In E ideskreisen werden E xkremente ge legt : Mu s i l , A rab ia Petraea III , p. 342.
a l—Muh i b b a I-T a b a r i,
al-Rijäd al-nadira fi manäl_rib al-
‘
asara(Kairo 1327 ) I I , p. 268. (In diesem Werke sind die Tradi tionen über dieVorzügl ichkei t jener zehn frommen Genossen gesammel t.)
E d. C u r e t on 1 68 p. 5 ff.
86 Ignaz Goldziher , Zaub erkre ise
Myrtenholz e i n e n K r e i s (chatta ‘
alä asliäbihz'
chattan bz üd al-äs)und ste l l te sie inm i tten desse lben. Dadu rch w ur den die Fe indeverscheucht ; sie w i chen vor dem Zauberkre i s zurück .
4 . Auf Zauberkre ise bezieht s i ch w oh l auch e ine Na chr icht,die w ir un ter den Bräuchen v on S erendib (Cey lon) b ei Kazw in i
‘)
fin den . Wenn s i ch ein S chuldner der Erfü l l ung seiner Verpfl i chtungen tz iehen w i l l , läßt der Kön ig e inen Kre is um se inen S tandortziehen , w o er s i ch au ch immer b efinde. Niemand hat den Mut
,
aus e inem so l chen Kreis herauszutreten , ehe er die S chu l dsummebezah l t hätte oder m it dem Gläub iger sonstw ie ein Abkommenträfe . Wenn der S chu l dner den Kre i s ohne Erlaubn i s verl äß t,verurtei lt ihn der Kön ig zur Entr i chtung des Drei fachen der S ch u l d,w ovon der Kön ig zw e i , der Gläub iger ein Dri tte l
1) E d. Wu s t e n f e l d II, p. 28 .
Vgl. den m agischen Kre is zur Ru ckbringung flüchtiger SklavenDo u t t é
,Magie et R el igion p.
244 ff.
88 C . H . Becker
v erfluche ihn ? U nd w enn ihr das n i cht glauben w ol l t,w o s i n d
eure Väter, die früheren und späteren ? “
11 .„Wisset, ih r Leute Gott erbarm e s i ch eur er daß die
We l t vergängl i ch ist und vergängl ich ihr Inhal t und hütet euch .
Denn die We l t und i hr Inha l t ist n i chtig,und hütet euch ; denn
die We l t und ihr Inhalt i st w en ig, und hü tet euch ; denn dieWe l t und i hr Inha l t ist l ügneris ch . U nd w enn ihr das n i chtglaub t
,w o is t S alom o, der S ohn Davi ds , w o i s t Dhu ’ l-Qar nain
und Nimrod usw . (w ie oben) . W o s i n d die früheren und
späteren, w o (die rechtgläub igen Ka l ifen) Abu Bekr, ‘Omar,
‘Othman und‘
A li ? S ie a l le haben die We l t beherrscht und ihrenInhalt gesamme l t und s ind gestorben . Gott habe sie se l ig. IhreTugenden l iegen im S taube.
“
A ls i ch das las,
fiel m ir sofort der an die Spitze d iesesAufsatzes ges te l l te Vers des G a u d eam u s ein und die WorteH am l e t ’ s in der F riedhofsszene“
(Akt V, „Al exander
died, Alexander w as buried , Alexander returneth into dust ;the dus t is earth ; of ear th w e m ake loam ; and w hy of that loamw hereto he w as converted m igh t they not stop a beer-bar re l ?
Imper ious Caesar , dead and turu ’ d to c lay,Might stop a ho le to keep the w ind aw ay
O,that that earth w h i ch kept the w orl d in aw e
S hould patch a w a l l to expe l the w in ter’ s flaw !
Was hat S hakespeare, w as das G a u d e am u s mit den
Kameruner Predigtformularen gem ein ? Kl ingt es n i cht w ie Aberw i tz
,h ier l i teraris che Verb indungs l in ien ziehen zu w ol len ? U nd
doch b estehen sie,und sie führ en uns in ganz große h istori s che
Zusammenhänge zw i schen Ost und West. Wel ch se l tsameWanderungen li teraris che S toffe und F ormen manchma l durchmachen
,w eiß n iemand besser als der Me i ster, dem d iese
Festschr ift gilt.
Uber Gedanken und Bi l der,die bei S hakespeare vorkommen ,
läßt s i ch s chw er etw as Neues sagen, da die rege S hakespeareerklar ung m eist alle Be lege und Beziehungen nach vor und
U bi sunt qu i an te nos in mundo fuere 89
rückw ärts s chon zusammengetragen Daß das Moti v des
U b i s u n t in Verb indung m it der Au fzäh l ung vieler berühmterToter auch in neuerer Zei t noch l i terar i s ches Geme ingut ist, dasbew e is t für die heitere Muse Ko r t üm s J 0 bsiade, I. Kap. 37 ,
und für die ernste Lord By r on s Don Juan (Canto I l th 7 6Da bei letzterem ,
w ie in vie l ä l teren Texten , Menschenklassenund ind ivi due l le G rößen getrennt ersche inen, se ien die zw e iers ten S trophen angefüh r t
“Wh e r e is the W orld ? ” cries Young, “at e ighty. Wh e r e
T he W orld in w h ich a man w as born ?" A las !Wh e r e i s the w orld of eight years past ? ’
t w as thereI look for i t —
’t is gone, a globe of glass !
Crack’d
,shiv er ’d
,vanish
’d,scarecely gazed on
, ere
A si l en t change disso lv es the gl ittering mass.S tatesmen , ch iefs , orators, queens , patriots, kings ,And dandies all are gone in the w ind’
s w ings.
Wh e r e i s Napoleon the Grand ? God know sWh e r e l i ttle Casltler eagh ? T he dev i l can tel lW h e r e Grattan, (lar rau, Sheridan all thoseWh o bound the bar or senate in thei r spel l ?W h e r e is the unhappy Queen, w i th all h er w oes ?
A nd w h e r e the Daughter, whom the Isles lov ed w el l ?Wh e r e a r e those m artyr ’
d sain ts the F ive per Cents ?And w h e r e oh
,w h e r e the dev i l are the R ente ?
Das Thema selb s t ist aber vie l a l ter. Das lehrt uns ein Bl i ckauf die Ges ch ic hte des G a u d e am u s . Das G a u d e am u s geh t,w ie s chon sei t Jahrzehnten bekann t ist, in seinen äl testen Bestandteilen auf ein m i tte lal terl i ches Buß l ied zurü ck . S chon für1267 hat Creizenach “
) fo l gende Verse b e legt„V ita brev i s, b revitas in brevi fiuietur ;
More v eni t velociter et neminem veretur ;
Omn ia mors perim it et nul l i m iseretur .
Surge,surge, v i gila, semper esto paratus.
1) Ich hatte m ich h ierbei der tatkräfti gen Hil fe meines Hamburger
Ko l l egen D i b e l iu s zu erfreuen , dem ich auch h ier nochmals dafür dankenm öchte.
C r e i zen a c h , Verhandl. der 28. Vers . der Ph i lo logen und S chulmanner
,Le ipzi g 1 872
, p. 203 ; G . S c h w e t s c h k e ,Z ur Gesch ichte des
Gaudeamus i gi tur , Hal le 1877 ; B o l t e , V ierteljahrsschrift für Literaturgesch .
I p. 248.
90 C . H . Becker
U b i s u n t , qui an te nos in hoc mundo fuere ?Ven ice ad t umulos , si eos v is v idere
C i n e r e a e t v e rm e s su n t , c a rn e s c om pn t r u e r e .
S urge,surge
,v i gila, semper esto paratus . “
Das unser S tudenten l ied e in le i tende G a u d e am u s m it dembeze i chnen den i g i t u r i s t ein a l ter Protest gegen die m itte la l terl i che Predigt von der Vergängl i chkei t a l les S e ienden . Gegenüberder Askese und We l tf l u ch t w ir d der Lebensgenuß gepriesen .
Die ganze m i tte la l ter l i che Lateinpoesie, der d iese Verseen tstamm en, i st nach Creizenach vo l l von typis ch w iederkehrendenWendungen . A ls e ine sol che ab er, als e inen s tehenden Versanfang haben w ir in erster Re ihe die Frage U b i s u n t zu be »
ze i chnen . S ie w i rd ungem ein häufig geb rauch t,w o das E nt
s chw inden früherer Große durch Be i spie l e , nament l i ch durch Aufzähl ung berühm ter Männer, verans chau l icht w erden sol l . Wo b efindens i ch nun
,w ird gefragt, die Hel den , Di chter und Weisen der
Vorze it ?U b i Plato
,a b i Porphyrius ?
U b i Tul lius au t Virgilius?
A lexander u b i rex m ax imus ?U b i Hector T roiae fortissimus ?
OderDic u b i S alomon ol im tam nobil is,V el S amson u b i est dux inv incibilisf
“
(Creizenach)
E in anderes Be ispie l , das i ch dem F ranziskanerpater CajusTrossen verdanke, stamm t aus dem 1 3. Jahrhundert und ist
v on dem berühm ten Dichtermönch J a c 0 po n e da T o d i verfaß t.I c h zitiere nach der Üb ersetzung v on S ch l üter und S torck(Münster 1 864) aus dem ersten Gedi ch t fol gende Bruchs tücke
Sprich , w o i s t S alomon mit aller se iner Pracht ?U nd Samson
,den der F e ind zum We ichen nie gebracht ?
Der schöne Absalon in re icher Kleider trach t ?U nd Jonathan , des Herz für fi em deslieb
’entfacht ?
U nd w o i s t Casar nur , der hoch als Feldherr stand?U nd Xerxes, der nur Lust am Zechgelage fand?W o Tul l ius , dessen Mund im Reden so gew andt ?U nd Aristote les , so einzi g an Verstand?
92 C. H . Becker
A don is amasius V eneris formosissimus iuuenis ? u b i pulch errimus Abso lonaut v enustissima T halam on : u b i Hector for tissimus : au t Hercules robustissimus? u b i P lato ? u b i P laton ic i sub tilitate praecipui , Proc lus , P lotinus,Porphy rius, A t ticebron ,
Apul e ius atque Macrob ius? a b i Cicero ? u b i Ciceron ic i rhetor ica eloquen tia tum idi ? Demosthenem ,
Xenoph ontem ,C tesiphon
t emqne loquor . u b i nano famos i astronom i A lbumazar , A lmyon , A lbategni,Alfagranus , T h ebid et a l i i ? u b i iam studiosissimns Ar istoteles Pr incepsphilosoph or um ,
cum omn i scho la et secta Peripateticorum , A uicenna, Andron ico
,A lgazele , T hemistio, Auerroé
'
,A lphorabio, T h eoph rasto, S impl icio ?
u b i iam imper atores, reges ac principes, olim praepotentes et inclyti, A lexander ,Cyrus ac Dar ius , Octauianus, Hann ibal , Nimroth , ac Jul ius atque Pompeius ?u b i Cresus dit issimus ? u b i A ch i l les magnanimus? u b i egregius poetaV irgilius? u b i J osh callidissimus ? ubi iam v i ri antiquissimi, qui antediluuium plusquam nongentis annis v ixisse leguntur ? E x his v ide, disce ,cons idera
,quod decor, honor et gloria mundi , for titudo , agilitas corporis ,
n ob ilitas generis, principatus, imperium ,opulent ia, eloquentia, ingen ium ,
Iongiturnitas temporum ‚ acqu is i ta sc ien tia absque humilitate et grat ia eine
ch aritate et cordis munditia, nul l i prosint ad salutem ,imm o innumerabilibus
fuerun t et sunt occasio ad condemnationem
Die Vorb i l der für d iese m i tte la l terl i chen Predigten l iegen inden S chr iften der a l ten Kirchenväter vor uns. In m e inemMaterial w erden w as w oh l ein Zufa l l is t keine ind ivi duel l enNamen genann t
,sondern nur Ab s trakta oder ganze Mens chen
k lassen aufgezäh l t. S o s chre ib t Cy r i l l u s A l e x a n d r inu s 2) in
se inem T raktat De exitu animae et de secundo adventu“
(MignePatr. Gr. 7 7 , Sp.
T o'
ze n o r? ij za u'
xr,ozg t o-ö xo
'
oy ov zoür ov ;
17 0 17 ij xevoöoäia ,
‘
n ow? ij r q nj ,‘
H 0'Ü ij än o
'
l a vozg: 75 0 17 ij azcar ofln;
17 0 5 ij q>a vza oia ; 7t 0 17 ij ävofzt a v cng;17 0 17 5 xo
'
oy og; n o r? r d: xpij,u aza ; n o r? ij eöyéveza ;
[ 1 0 6 ij dv va azeia xa i ij zvgo s'
g,‘
U m? 1 6% ßa cn l ev’
g; n o r? ägxw v ; n o r? ijyoöy evo'
g;
17 0 5 ij oo <pia z cöv oomcöv ,’
H o i n ur énr ön ij eöyl w zz loc xa i zä „dr aw aözo7v n a vovg
yev'
zwzzoz;
1) Dies Zi tat hat durch die v ielen arab ischen Gelehrtennamen auch
kul turgesch ichtlich ein erheb l iches In teresse.
2) Auf dies und das folgende Zi tat wurde ich aufmerksam dur ch
Roman ia XX (189 1) p. 13 und 545, w o noch w ei tere Parallelen zu finden sind.
U bi sunt qui an te nos in mundo fuere 93
Oda l,oöo u
'
! éragofx3 noozv , Eocr).eö& naa r (h; ö y el) u'
w v,za i n äoa ij
oorpia «Evq za r ert o'
f) n.
[ Io ü oo rpo'
g,’
.r o ü 7r o ö oq r firng zoö a id mog r ov’
zo u ;
An den ausge lassenen S te l len geh t die gle i c he rhetor ischeFrageform noch w e i ter
,doch genügt w oh l der ob ige Auszug
,
um S chema und Gedankengang k larzumachen . Nach Formund Inha l t gehört h ierher e ine S te l le aus E ph r a em S y r u s ,Opera omnia ed. A s s em a n n i III
, p. 309 (syr . et S ie sei
h ier in einer neuen Verdeutschung gegeben, da die a l te latei
n is che Übersetzung gerade den uns w i chtigen rhetoris chenAufbau v erw is cht
Gehe und betrachte die S tädte oder den W e isen ,w as befa l len hat die
schone Pracht ihrer Ordnungen ?W o s i n d die Kön ige, w e lche die ganze Wel t besassen und sammel ten
und ihre S chatzhäuser m it al len S chätzen fül l ten ?W o s i n d die berühm ten
„He lden der Vorzei t“ , die l iefen und erreichten
hohe S tufen in ihrem Heldentum ?
W o s i n d w eiter die W eisen , w elche Worte schrieben und die W el terfül l ten m it dem Inhal t ihrer Bücher ?
W o s i n d die, w el che die Menschen herabstürzt en und v ertrieben und
deren Bes i tz sich ‚aneigneten und zu ihren S chätzen legten ?
W o s i n d die,w elche die We l t in Verw anderung setzten durch ihre
Zungen und Lippen und sie gefangen h iel ten m it ihren Theorien ?W o s i n d die , w e lche sich brüsteten in schönen Gewändern und s ich
besuchen l ießen auf Betten v on S charlach ?W o s i n d die
,w e lche herrl ich w aren in der Pracht des Angesichts ,
und w as hat die schöne Pracht ihrer Angesichter befal len ?W o s i n d die Hälse , die Ketten aus pol iertem Golde trugen , und die
Bande, die m it Perlen geschmückt w aren ?W o s i n d die
, w el che schnel l w aren in ihren Befehlen und die E rdeknechteten durch die Maj estät ihrer Tyrannis ?
Sprich zur E rde, und sie -w i rd dir ze igen
,w o sie s ind, und frage die
U nterw e l t , und sie w i rd dir offenbaren , w oh in sie gesetzt s ind .
S iehe , sie sind al le zusammen in die E rde gew orfen , und sie s ind S taub ,und der S taub des Reichen ist n icht getrennt v on dem S taub des A rmen .
S ind w ir m it Ky r i l l und E ph r a em schon auf or iental is chemBoden
,so fol gen h ier als letztes Zi tat in dieser Reihe einige Verse
aus dem arab is chen Di chter ‘A di b . Z a i d (um ca. Obw oh luns se ine Verse nur in is lam i schen Que l len erhal ten s ind , w ar
‘
A di ein Christ . Über ihn sagt Nöldeke, Ges ch ich te der Perserund Araber, p. 3 1 9 , Anm . 1 :
„Die Gedichte s ind größten te i l s
94 C . H . Becker
schw ermutig und ernst, vo l l E inw e i sungen auf gefa l lene odergestorbne Großen der Vorze i t.“ „
Adis Sprache ist u ns durchw egle i ch ter verständ l i ch als die der Beduinendichter
,deren ganze
We l t uns eb en w e i t fremdartiger i s t als die des geb i l deten ,ch r i stl i chen S tädters .“ Es is t eben die We l t
,die aus den
vorangeste l l ten Zitaten zu uns spri ch t, und es i st natürl ichke in Zu fa l l , daß
‘
A di n i ch t nur die G e d an k e nw e l t,sondern
auch die r h e t o r i s c h e n A u s d r u c k s f o rm en de r c h r i s t l i c h e nP r e d igt übernimm t, w enn er in se inem berühm ten Liede s ingt ‘)
Der du v ol l S chadenfr eude (deinem N ächsten) sein S ch icksal vor
w irfst b is t du (v om S ch icksa l) fre i und unerre icht ?2. Hast du e inen festen Vertrag über die Dauer deiner Tage , oderb ist auch du (nur) ein U nw issender, ein Getäuschter ?
3, W en kennst du
,der ew ig ge leb t hatte, und w er w are sicher, daß
n icht sein Beschutzer zu S chande w ürde ?4 . W o is t Kesra, der Kesra der Kön ige , Abu S asan (m eist Anüscb ir
w än) oder w o vor ihm S chapor ?
5 . (U nd w o s i n d) die Bann ’l A sfar
,die F reigeb i gen , die F u rsten des
R omäerlandes ? Keine E rinnerung a n sie ist geb lieben .
6 . U nd (w o i s t jetz t) der Mann v on Hadr, der es doch ein st erbauteund das Land am Tigris und am Chaboras besteuerte ?
7, E r baute ein Marmorsch loß
,m it Gips überzogen, in dessen Gipfeln
die V öge l n isteten .
8 . N icht fürchtete er das U nglucksgeschick , und doch gin g ihm die
Herrschaft v er loren und vereinsam te se ine Pforte .
9 . Denke nach üb er den Herrn des Chaw arnaq , w ie er einst hinabschaute die (göttl iche) Lei tung ofin et ja den B l ick (des Ge istes) .
10 . Ihn erfreute se in Z ustand, die Größe se iner Herrschaft , das Meer,w e lches s ich dah inzog, und S adir (ein S chloß) .
1 1 . Da. aber erschrak pl ö tzl ich se in Herz , und er Sprach : „Was fur eine
Lust hat denn ein Lebender,der doch dem '
T ode zugeht ? “
12. Dann nach dem G lück , der Herrschaf t und dem W ohlsein habendie Gräber sie dort v erhül l t .
1) Der U bersetzung liegt zugrunde D e G o e j e s E dit ion in a
Qotaiba, Liber poesis et poetaram p. 1 1 1 f . ; vgl. wei ter Agh . I I . 36 ;A l B u h t u r i , K . al-Hamasa 1 29 f . ; Tortüsch i , sirädj al-mulük (ed. 1 319)
p. 9 ; B . Hischäm I , 47 ; J äq ü t , mu‘djam I I , 492 ; T ab a r i I , 853 f. 830 ;
S a c h e n , Gawäliki’s Almu‘
arrab p. 8 und sonst . Die Übersetzung fügt zuDe Goejes Text noch e inen Vers aus Tabari . Die s ieben letzten Verses ind in der Übersetzung v on N ö l dek e a. a . 0 . p. 40 (=T ab . 1 . 830 )u . p. 84 (=T ab . I , 853) gegeben . Die
‘A dische Rhetorik ist dann im Islam
oft nachgeahm t w erden,z . B. Agh . IV ,
95 .
9 6 C . H . Becker
aufbau und F orm v o l l i g an d e r s . Nich t die Vergängl i chke it der We l t und des Einze l s ch i cksa l s w ird an den
‘
Ad und
T hamüd i l l us trie rt,sondern der U ngehorsam früherer Vö lker
gegen die zu ihnen gesandten Propheten und ih re Bestrafungdur ch Gott. Auch die Würmer des Grabes sind Muhamm ednoch fremd , und die rhetor is che F orm des U bi sunt feh l t demQoran vö l l ig.
Diese F es tste l lung is t w i ch tig ; denn w enn w ir nun in der
spä teren islaniischen Bußpredigt die gle i chen Gedanken und
die gle i che F orm w ie beic
A di,Ky r i l l und E ph r a em finden,
so gehen diese S te l len eben n i c h t auf den Qoran,sondern auf
die christl i che Bußpred igt und i hre Aus l äufer zurück . Es w ürdes i ch hier a l so w ieder von neuem bes tätigen , w as auf so vie lenanderen Gebieten s chon nachgew iesen w urde daß s ich dieEn tw i ck l ung der qoränischen Pred igt nach dem Tode Muh amm eds in s teter Berüh rung m it der christ l i chem Umw e l tv o llzogen hat .
Die Ähn l i chke i t der chr is tl i chen und is lam is chen Buß
predigt und Betrach tung der Vergängl ichke i t des Dase ins ist so
groß,daß die Abhängigke it der , is lami schen ohne w e i teres in
die Augen spr ingt. S tre i cht man die gerade in diesen Ab
s chn i tten n i cht besonders hervortretende chris tl i che Dogmatik , so
könnten die zit ierten Predigten eines Ky r i l l und E ph r a em auchvon
‘Omar II. oder irgendeinem ande ren Bußprediger des Is lamgeha l ten w orden se in . Neben der l i te rar is chen F orm des U bi
sun t,auf die s i ch die fo l gende Zusammenste l l ung b es chränkt
,sei
besonders h ingew iesen auf die Be l iebthe it v on„F r iedhofsszenen
‘b
auf Mono loge an S chäde l,auf das Wählen in Verw esungserschei
nungen kurz , w ie es in dem m i tte la l terl i chen Urtext desGaudeamus so tre ffend he ißt
Ven ias ad tumulos, s i eos v is v idere
Cineres et vermes sun t,carnes computruere .
Es mogen nun e in ige Be i spie le aus der i s lam is chen Li teraturfo l gen, die le i cht vermehrt w erden konnten . Dem ers ten Kal i fen
1) Vgl. me in „Christen tum und Islam “
und Z . f. A ss. XXVI , p. 1 75 ff.
(Christl iche Po lem ik und islam ische Dogmenbildung) und die dort genannteLi teratur .
U bi sunt qui ante nos in mundo fuere 97
Abu Bekr w erden nach dem Kanz al-‘ummal VIII, 205 No. 3490
,
fo l gende Predigtw orte in den Mund ge legt dann gedenkt, ihrKnechte Gottes, derer, die vor euch w aren. W o w a r e n sie
gestern , und w o s i n d sie heute ? W o s i n d die Könige,w e l che
die Erde erschütterten und sie bebauten ? S ie s ind vergessen, und
vergessen ist ih r Gedächtn is . S ie s ind heute ein Nichts , und jeneHäuser l iegen in Trümmern, w ährend sie in den F insterni ssen derGräber w e i len.
‚Hast du auch nur von e in em von ihnen etw as
vernommen oder ein Geräusch von i hnen gehört? ‘
(S üra 1 9
v . U nd w o s i n d die, die I hr kennt von euren Genossen und
Brüdern ?In e iner anderen Pred igt (ib . 206 No. 3492) h eißt es in
ähn l i chem Zusamm enhang noch w eiter : „W o s i nd die ‘He lden
der Vorzei t’,w e l che die S tädte erbauten und sie mit Mauern
umgab en ? S ie s ind jetzt unter S te inen und Grabdenkm älern .
Die Erw ähnung der „Hel den der Vorze it“ (dj a b b är ün ) ist mir
besonders w i chtig. S ie kommen mit dem gle ichen Term inus außerim Qoran au ch in der zit ierten Predigt E ph r a em s vor. E in
anderes Beispie l l iefert uns al-‘
q al- farid (ed. 1 293) II, 1 62, 29 ff. :
W o is t der , der da l ie f und s i ch anstrengte und sammel teu nd zäh l te und bau te und err ichtete und schmeckte und e inri chtete
,
w ährend er doch von dem w en igen keinen Nutzen und von dem
vie len keinen Genuß hatte? W o is t der , der da Heere führte und
Fahnen en tfal tete? S ie s ind Lei chenres te unter der feuchten Erde,Tote
,w ähren d ihr aus ih rem Becher tr inkt und auf i hrem Wege
w ande l t.“Besonders zah lr ei ch s in d d iese Ausführun gen in den Heiligen
l eben,so vor a l lem in der Vita ‘Om a r s II. : E s fol ge h ier im Aus
zuge e ine S te l le aus a G a n z i e Manäqib ‘Omar a‘
A bd
c l-‘Aziz (ed. Be c k e r p. 1 27 die auch einm al eine arab i scheF riedhofsszene
“verführen m öge. (Omar Spr i ch t auf dem Fried
hof z) „Ich kam zu den G räbern der Ge l ieb ten, me iner Ver
w andten und entbot i hnen den Gru ß ; aber n i ch t kam der
G ruß zurück . A ls i ch m i ch w egw andte da rie f der S taubm i ch an und sprach : ‚
‘Omar,fragst du n i ch t
,w as aus den Ge
l ieb ten gew orden ist?‘ Da sagte i ch : ‚Was ist aus den Ge l iebten
Zur Übersetzung v on w ,} s iehe T abariglossar sub voce.
Festsc hri ft Kuhn . 7
98 C. H . Becker
gew orden ?‘ Der S taub antw ortete : ,Zerrissen s ind die Lei c hentü cher und die Körper zer fal len.
‘ U nd als i ch m i c h w egw andte ,
rief m i ch der S taub an und sprach : ,
‘Omar,frags t du m ich
n i ch t,w as aus den Augen gew orden ist ? ‘ I ch sprach : ‚
Was ist
aus i hnen gew orden ? ‘ Er antw or tete : ‚Zerbrochen s ind die
Angapfel und zerfressen die Pupil len .
‘ Dies F rage und Ant
w ortspie l w iederho l t s i ch dann noch w eiter, und der Zerfa l l desKörpers w i rd ges ch i l dert. S ch l ießl i ch empfieh l t der S taub ‘OmarLe i chen tü cher, die n icht vergehen, und diese s in d Gottes fur chtund Hande ln in Gehorsam gegen Gott. Nachdem ‘Omar d ieserzäh l t hat
,b eginnt er zu predigen : „ S iehe die We l t
,ihre
Dauer ist gering,und ihr Vorzügl i ches ist verä ch tl i ch
,und i hr
Re i ch tum ist Arm ut,und ihre Jugend is t Hinfäl l igke i t, und w er
in i hr leb t stirb t, und n i cht täusche di ch ihre Nähe, da dudoch die S chne l l igke it ih res S chw indens kenns t, und getäuschti s t
,w er si ch von i hr täus chen l äßt. W o s i n d ihre Bew ohner,
w elche ihre S tädte bauten und ihre Kanäle gruben und ihreBäume pflanzten ? S ie b l ieben auf ihr w enige Tage Was
hat der S t a u b mit i hren Le ibern gemacht und der S an d m it
ihren Körpern und die Wü rm e r mit i hren Knochen und ihrenGl iedern ? S ie leb ten in der We l t auf w ohlbereiteten Ruhe lagernund aufe inandergesch i ch teten Teppi chen, umgeb en von Dienern , diei hrer w arteten , und Leuten , die sie ehrten , und Nachbarn
,die
ihnen ha l fen . Jetzt, w enn du vorbeikomm s t, spr i ch zu i hnenoder rufe sie an und frage den Re i chen aus i hre rMi tte, w as von se inem Re i c htum geb l ieb en is t
,und frage den
Arm en , w as von se iner Arm u t geb l ieben ist,
und frage sie nachden Zungen
,m it denen sie redeten
,und nach den Augen
,m it
denen sie nach den Lüsten zu schauen pflegten , und frage sie,
w as die Wü rm e r gemach t haben aus ihren zarten Händen und
i hren schönen Ges ichtern usw . U nd w o s i n d ihre Hochzeitskammern und Kuppe lbauten , und w o s i n d ihre Diener und
S klaven und i hr S amme ln und i hre S chätze ? Wie vie leMänner und Frauen haben im Woh l se in ge leb t
,und jetzt s in d
i hre Ges i ch ter verw es t und ihre Körper von ihren Häl sen getrenn tund i hre Gl ieder zerri ssen ; i hre Augäpfe l s ind auf ihre Backen
1) Hier ist der Text v erderben.
H. Becker
Bahn und I sjesfl t ? W o s i nd die , welche die Schlössen dm mitSeide u d M ? W o s ind die, vor denn die Erde sich tied
'
inn m e: u d l im ? W o m a die. mm. am , m „g,hehe. mit Gewalt und U IW CN g? ‚Bu t du euch nun am „
ihnen ein . veruommen oder a m von ihm gehen r m« sa m m e a ns de e ict m ea vmm u e sen t deram der Knoche1 Und hat sie len-gefu n s Beam,des 8c hläeset end hs t sie ' oh eo lu sen in des k ge der ßri r nndnnmSe i— M Y“ Ds lndu t sur sech ihn Wohu tß z
, md aefW i n. serfrißt ihre ia iber u d nimmt ihre Bl eche sis M i tte IhreA l gen fließen heraus auf ihre Wangen, und im um sind mitWi r-en M üll! , und ihn fl leides h liee sh, u d ihre flsnt s l m essenund in "d oeh m m und ihre Bh ehe snigm hnifi en. u düd n um
irgend ein da s »
sie m io !
Naeh dienen: Bdspiel durien wir uns also die Iit *
ariseheBußpredigt des h im vorstellen. Sie steht in “ tierischerHinsich t dm hsns sul der S tufe de r christlichen OpredigtDie populäre Form in: den Alltag tri tt uns in den nummerPredigtformularien en tgegen. Es ist w ir zurzeit nich mögl ich,seitgt nöesische Pn dßü geoden ens anderen Teilen d Orientsdnmhsnsehcn : e her gewiß findet sich dieser Stoß s h heute
noeh sn nndcren Onen. Daß er sn gewinsen 2eit ch
w ar für die islamische Predigt, geh t daraus hervor, iß sogur
die Predigt pe r s ifls ge unser Motiv beh um. In den v Jacobhm nsgegebm cn. so überaus wich tigen Besten von Sch Fen8piel
etlich en i b n Den ijs ls aus der Zeit Salsdins findet in auch
eine bnrleske Predigt , und in ihr kommt der S ek vor : „Wo
is t der Erbsner der Pyramide, und wo ist Ad u Iran ?
Za stöfl haben sie die Hände der T rennung, und sf ginmdorthin, w o es kein Wo mehr gibt . “
3.
Dam i t ist der Ring geschlossen und die li terarische i “
ziehen;" M en dm Kamer uner Predigttexten‚ dm Gm dea nic ad der
im H am le t festgestt Es scheint in damiteher nach ein neuer Bew eis für die Abhängigkeit des is! nischen
SW oben p. 07 .
'l h h Originalt ext bei J s eoh . S tücke aus IhnDit üfl T“
n-n gm, a. um p. ae
U bi sunt qui an te nos in mundo fuere 1 01
Ku ltus v o ch r ist l i chen gew onnen. An anderer S telle hatte i chnachzuw e en versu ch t, daß das Ritua l des i slam i s chen Fre itagsgottes enstes dem S chema der chris t l i chen Messe ent lehntist (Islam II
,374 Die j üd is chen Einflüsse, die m e in Frennd
Mittw oc h achgew iesen hat spie len in der is lam i schen Pflichtenlehre ge iß die ers te Ro l le
,aber es l iegen unzw eife l ha f t
auch star s chr is t l i che Einflüsse vor ; manch Jüdi sches mag auchüber d as orien ta l i sc he stark j udaisierende Christentum in den
Is lam g zommen se in . Für den Ausbau des i s lam i s chenGottesdre ates m ö chte i ch nach w ie vor in erster ' Lin ie das
Vorb i l d as christ l i chen Kul tus zur Erk l ärung heranziehen. Die
v orangeg ngene Betrachtung stützt m e ine These insofern , als
sie nebe1 dem forma len auch e inen inha l t l i chen Zusammenhangzw ischen elamischer und chris tl i cher Predigt aufdeck t und s i chzw angloseinreih t in die zah lre i chen Verb in dungslin ien, die vom
Christentm zum Is lam h inüberführen .
U nv llkürlich fragt man aber nun w ei ter : Wo hat die
christlicl Pred igt d ies Motiv her ? Der e igentüm l i c h künst ler is cheAufbau ei s t in die S chu le der g r i e c h i s c h en R h e t o r i k . Ky r i l lbeginnt eine oben zit ierte Predigt mit dem gle i chen rhetoris chenKnifi
'
de Wiederholung, in dem er eine endlose Re ihe von S ätzenmit e in le ite t und später e ine eb enso
° charakteristi scheGegenul rstellung S atz um S a tz von of ö£ xo uoz u . 02 äyagzw l oi
durchfüi t. Wei st so die äußere Form in die griech is che Kunstrede hir ber , so tu t es der Inha l t noch vie l mehr. Die a ltchristl i che P digt fuß t, w ie üb rigens indirekt durch sie au ch die
ganze in m ische w ie w oh l überhaupt diegröß ten Fe i le der arab i s chen Adabliteratnr , auf der gr iech ischenPopular rilosoph ie , in sbesondere der kyn i s c h e n D i a t r i b e.
Nach c w ie Inhalt liegt das Vorb i ld des i s lam i s ch-christli chenU bi sm in fol genden v on P l u t a r c h (Consolatio ad Apollonium
1 1 0 D ) zi tierten und e inem moralphilos0phischen Jambographen
etw a di 2. Jh . vor zuzuschreibenden Versen vor
ugen M i t tw o ch ,Z ur E ntetehungsgeschichte des islam ischen
Gebet e l d Kultus, Berl in 19 13 (E inzelausgabe der A K P A W) .'
awä‘
iz im Gegensatz zu chu_
tab,den e igentl ichen Predi gten .
'
as G . A . G e r h a r d in einem besonderen Aufsatz nachw eisen w i rd.
B isher d‘hte man me ist an einem Tragiker als A utor ; an Menande r denktA . G o d n a u , angeführt v on J . W. B r i gh t in dem Ar tikel “T he
‘u bi sun t
’
100 C . H . Becker
Ruhm und -Majestä t ? W o s i n d die , w el che die S chlosser belegten m itS e ide und S toff ? W o s i n d die, v or denen die E rde sich ern iedrigte in
E hrfurcht und Zittern ? W o s i n d die , w elche die G läub igen ern iedrigthaben mit Gew al t und U nterdrückung ? ‚
Hast du auch nur v on einem von
ihnen etw as v ernommen oder ein Geräusch v on ihnen E s hat
sie , bei Gott, v ern ichtet der Vern ichter der Vö lker und zerstört der Z er
störer der Knochen . U nd er hat sie herausgeführt aus dem Re ich tumder S chlösser und hat sie w ohnen lassen in der E nge der Gräber und unterS teinen und F el sen . Du findest nur noch ihre Wohnstätten, und der
Wurm zerfrißt ihre Le iber und n imm t ihre Bäuche als Ruhestätte. IhreAugen fl ießen heraus auf ih re Wangen
,und jene Münder s ind m it
Würm ern erfül l t,und ihre K leider fa l len ab , und ihre Haut w ird zerrissen
und ih r F leisch zerstreut und ihre Bäuche aufgeschn i tten , und n icht nütztihnen
,w as sie gesamme l t, und nicht erspart ihnen i rgend e twas das, w as
sie erworben .
“
Nach d iesem Be ispiel dürfen w ir uns a l so die l i t e r a r i s c h eBußpredigt des I slam vorste l len . S ie steht in künst lerischerHins ich t dur chaus auf der S tufe der chri stl i chen Bußpredigt.Die p0puläre Form für den Al l tag tr i tt uns in den KamerunerPredigtformularien entgegen. Es ist mir zu rze i t n i ch t mögl i ch ,zeitgenöss ische Predigtagenden aus anderen Te i len des Orien tsdur chzusehen ; aber gew iß findet s i c h d ieser S toff auch heutenoch an anderen Orten . Daß er zu gew issen Ze iten typi s chw ar für die i s lam i sche Predigt
,geh t daraus hervor, daß sogar
die Predigtpe r s iflage unser Motiv b enutzt. In den von J a c o bherausgegebenen
,so überaus w i ch tigen Resten v on S chatten spie l
stü cken Ib n Dän ijäls aus der Zei t S a ladins findet s ich au cheine bur leske Predigt
,und in i hr komm t der S atz
„W o
is t der Erbauer der Pyram ide, und w o ist Ad und Iram ?Zers tört hab en sie die Hände der Trennung
, und sie gingendorth in
,w o es ke in Wo mehr gibt . “
3.
Dam i t ist der Ring ges ch lossen und die l iterarische Beziehungzw is chen den Kameruner Predigfl exten , dem Gaudeamus und der
„F riedhofszene“ im H am l e t festgeste l l t. E s s che int m ir dam i t
aber au ch ein neuer Bew ei s für die Abhangigke it des is lam i schen1) S iehe oben p. 97 .
2) Islam IV ,
68 ; O riginal tex t bei J a c o b , S tucke aus Ibn Dänijäls Taifal-hajäl, 3. Heft p. 26 .
1 02 C . H. Becker
170 5 yc‘
xg r d: ocpvä astr a , n ai) dä /l vdiqg
Méyag dvv oiorwyg Kpoloog E ég€qg ßagz‘
w
Z ev’ *g'
ag &a l ciamyg aöxév’ ‘
E l lnon ovzia g;‘
Hn avzeg°
.4 i'
da v fil&ov na i A d3 ag do'
y ovg.
Dieser Gedanke ist aber in der griech ischen Literatur durchaus n i cht etw a isol iert. Es b i ldet vie lmehr so s chre ib t mir
mein F reun d G. A. Gerhard au ch m it der Anw en dung auf
b esonders b erühm te , mächt ige und rei c he Konige der S age, sow ieder äl teren und neueren Gesch i chte
,v on denen e iner oder
mehrere m it Namen aufgefuhrt w erden , in der popularphiloso
phischen (vorw iegend, aber n i ch t aussch l ieß l i ch kyn ischen)Mahnrede oder Predigt der he l len istis chen Ze it e inen festen
,
geläufigen Topos .Hedonisch gerichtet, d. h . zum Leb ensgenuß auffordernd , be
gegnet die Erw ägung schon in der k lass is chen Ära . S o sagtm indestens bere i ts im 5 . Jahrhundert der üppige S ardanapal inse inem als typi sche Losung des praktis chen Materia l ism us b ekanntenGrab epigramm (G e r h a r d , Phoinix v on Kolophon p. 1 83, V. 3)
Denn auch ich bin Asche,der großen Ninos Beherrs cher.
S o hört man ein Jahrhundert später in der m itt leren Kom ö die(Phoinix p. 1 90
,
De in b le ib t, w as du gegessen und getrunken hast ;der Rest ist A sche . Kodros, Kim on , Perik les .
Im entgegengesetzten mora l is chen S inn w ird dann das Argumenthäufig in der a lexandrini schen Literatur verw endet. Gerade als
Gegenb il d j enes S ardanapal benutzt kurz nach 300 der mora lph i losophi sche Choliambendichter Phoinix von Ko lophon den
assyris chen Ninos mit seiner Grabs chr i ft zum w arnenden Beispie l .In der überl ieferten Fassung lauten die, w ie es s che in t
, e inerb i l l igen späteren Z udichtung zuzuschr eibenden S chlußverse (Pho inix p. 1 82
,V. 22 - 24)
Das Gold, die Pferde und den Wagen aus S ilber ,das konnte ich n icht in den Hades m i tnehmenmuß trotz der Krone j etzt als A sche dal iegen .
Etw a gle ichzeitig hat der S atiriker Men ippo s von Gadara in
seiner plasti schen S ch i l derung des Hades dem ganzen Motiv eineF ormu la”
, Modern Language Notes VI I I p,187 f. Dortselbst auch andere,
w eni ger charakteristische Zitate aus Ov id und C icero.
U bi sun t qui ante nos in mundo fuere 1 03
l ebend ige , halbdramatische Ausgesta l tung gegeben,die in der
ganzen F o lgezei t nachw i rkt und uns am besten in den Dia logenLukians
,vor a l lem in se iner Nekyomantie, in der Nicderfahrt
oder dem Tyrannen“und in den „
T otengesprachen“ zugängl i ch
is t (vgl. das gute Buch v on R . H e lm ,Luc ian undMenipp,
Als typi s che Vertreter des im Tode gern auch zu der n ied r igenA rmut eines S chusters Mikkylos oder des Kyon Diogenes in
Gegensatz geste l l ten Kön igtum s ersche inen h ier und in andernpopularphilosw hischen S chri ften hel len isti scher und röm i s cherEpoche vorab w ieder der Assyrer S ardanapal, dann der PhrygerM idas
,die Lyder Gyges (Leon i das von Taren t : s . Phoinix p. 1 90 , 3)
und Kroisos (vgl . noch Ge ffc k e u ,Kynika und Verw andtes
1 909 p. die Perser Dareios und Xerxes , von Griechen der
A lkinoos des Homer und Agamemnon , der Tyrann Polykrates,
endl ich auch der große Alexander (H e lm p. 55 .
Allgemein gefaßt b ietet s i ch der fragl i che Gedankengangdeu tl i ch z. B. in einer iambischen Partie j üngere r Herkun ft
,für
die der berühmte attis che Kom iker und Gnom iker Menandr os denNamen hergeben m ußte (G e r h a r d , Phoinix p. 265 und in
P a u l y -W is s ow a , Realenzyk10p. IX, p. 6 7 6 ; Geffck eu ,
NeueJahrbücher f . d . k l . Al tert . XXVII p.
W i l lst du dich w irkl ich kennen lernen. w er du b ist,so schau vorüberw andernd auf die Gräber h in .
Dort liegen die Gebe ine und der leichte S taubvon Königen, Tyrannen , weisen Männ ern drinund Leuten ,
die s ich mit dem Ade l und dem Geld,m it ihrem Ruhm und ihrer S chönhe i t b rüsteten .
Doch n ichts dav on h iel t in dem Z eitenlaufe stand ;gemeinsam w ard der Hades al len S terb lichen .
Darauf den Bl ick gerichtet , merke, w er du b i st » (Gerhard)Bei d iesen engen gedankl ichen Beziehungen durfen w ir
w oh l w agen , die Herkun ft sfrage zu en tsche i den . Betrachtungenüber die Vergängl i chkeit des Dase ins gehören a l lerd ings zum
Motivenschatz jeder re l igiö sen Predigt . E s komm t auf die innerenund äußeren Besonderheiten an . S o sind die nahe l iegendenBeziehungen zur persi schen, spezie l l mystis chen Poes ie m it
Absi ch t beisei te gelassen , da h ier b ei a l ler äußeren Ähn l i chke i tganz andere gedankl i che Ausgangspunkte vorl iegen . Nur um den
Untersch ied hervorzuheben , sei auf die Verse ‘O m a r Ch a j j am s
1 04 C. H . Becker
hingew tesen, die _F . R o s en in „Die S innspruche Omars des Ze l t
machers “ so s chön verdeutscht hat (p. 29 S o z. B. der Vierzeiler :
O Topfer, n imm dich etw as mehr in acht,Behandle deinen T on mit mehr Bodach -t !
Du hast v ie l leicht den Finger F eridunsU nd Cyrus’ Hand m it auf dein Rad gebracht .
Das s ind Gedankengänge, die gew iß an Ham lets Worte er innern ,ab er eben doch aus e iner anderen Gedankenreihe stammen. Fre il i ch hat auch die mystis che Poesie das U bi sun t Thema übernommen (ebenda). N i c h t die V e r g ä n g l i c h k e i t , sondern der
Pan th e ism u s is t a l so das Mot iv d ieser Di chtung.
Entlehnungen l iegen h ier nur in der Form vor,w ahren d zw i schen
hellen isti s cher, chris tl icher und i s lam is cher Pre digt formale und gedankliche Beziehungen bes tehen. Gew iß ist auch das Al te Testamentvoll von ähnli chen Gedanken ; man denke nur an die Psa lmen,an Hiob oder den Prediger S alomonis ; aber trotzdem ist unserGedankengang doch w ohl n i c h t j ü d i s c h , sondern eben g r i eob i s c h . Daran kann m i ch auch die fol gende S te l le des syris chen Baruchbuches (L a g a r d e , Libri v eteris tes tament i apocryphisyr iace p. 9 7 ; Kap. III
,1 6 ; zi tiert nach K a u t z s c h ’ Apokryphen
I, p. n i ch t irremachen
,auf die m i ch A . J . W en s in c k
dankensw erterw e ise h inw e ist : „W o s i nd die Geb ieter der
Vö lker und die da herrs chten ü ber die Tiere auf der Erde,die
mit den Vöge ln unter dem Himme l spie l ten und S i lber in Haufensamme l ten und Gol d, w orau f der Menschen Glauben s ic h stützt,daß ohu Ende ihr Bes i tz ? W o s i n d
,die das S i lber schm iedeten
und s i ch m üh ten , daß unergründbar i hre Werke ? S ie s indvers chw unden und zur To tenw e l t h inabgestiegen
,und andere
traten an ihre S te l le.
“ Der Baruchbrief s tamm t aus so starkhellenistis cher Zeit , daß die w i rkl ic h j ü dische Herkunft d ieses Gedankens und der spezie llen Form erst noch erw iesen w erdenmüßte Wie schw ierig diese Beziehungen s ind, erhe l lt auchdaraus, daß gerade dies Ba r u chzitat zw ei fe l los den E ingang derPredigt des Diony s i u s C ar t h u s ia nu s (siehe oben p. 9 1) bestimm t hat. Die christ l i c hen Prediger fußen in Form und Inhaltauf dem Griechen tum ,
b e legen dann aber d iese griechischen Gedanken mit irgendw ie dazu passenden Be legen aus der Bibel.
Zur Frühgeschichte des indischen Theaters.
S ten Konow (Hamb urg) .
Bis v or w enigen Jahren w uß ten w ir n i ch t mehr v on dem
indischen Dram at iker Bhasa,als w as aus vere inze l ten Noti zen
in der späteren Li teratur ges ch lossen w erden konnte . S o w ar
es b ekannt, daß er äl ter w ar als Kal idasa,der ihn als e inen
berühm ten Di chter bezei chnet. Aus dem Versedes Räj aéekhara
B häsanc'
z'
takaca/we°
pi chelcailz lc,sipt6 paril;sitw n
S vapnaväsavadattasya dähako’
bhün na'
pävakdh
hatte man den S ch luß gezogen, daß Bhasa ein S chauspie l nam ensS vapnavasav adatta ges chr ieben hatte. P is c h e l ‘) hatte al lerdingsgegen d iese F ol gerung Einspru ch erhoben . Er übersetzte den
Vers : „Obgle i c h Kenner den Diskus in Gestalt der S tücke desBhasa gew orfen hatten, um es zu prufen , verbrannte das Feuern i cht das S vapnavasavadatta“
,und fol gerte
,daß das S vapna
väsavadatta das Werk eines unbekann ten Dichters sei Daß es
aber ein Werk des Bhäsa w ar, v on dem man s ich erzäh l te, daßes die Feuerprobe b estanden habe, zeigt eine Tradit ion aus dem
zw ölften Jahrhundert, die Pandi t Chandr adhar Guleri m itgetei l tund w ir s ind som i t b erechtigt, das S vapnavasavadatta für
ein Werk des Bhasa anzusehen . Als nun ein S chauspiel namensS vapnavasavadatta ungefähr gle i chze i tig von R. Narasimhachars
A ssistent PanditA n an da lv a r 3) und v onPandit Ganapa t i 8äst r in")
1) GgA 1 891
, p. 364 .
2) Indian An ti quary 1 913, p. 52.
A rchaeological Sur vey of Mysore. Annual Report for the year endingJune 19 10, p. 46 .
T rivandrum S anskrit S eries, No. XV, Triv andrum 1 912, Int roduction .
Z u r F r iihgesoh ich te des indischen Theaters 1 07
gefunden w urde,haben die ind is chen Ge leh rten mit v ol lem Rech t
ges ch lossen,daß es s i ch um das Werk Bhäsas hande le
,und e ine
Re i he v on anderen Dramen , w e l che Ganapat i gle i chze itig entdeckteund die deu tl ic h von demsel ben Verfasser herrüh rten
,m uß fo l gl i ch
auc h Bhäsa zuges ch r ieben w erden .
Unter d iesen findet s ic h e ins , das ers t d ies Jahr nach Eur opagekomm en is t, das aber ein besonderes Interesse hat . Es i s t d iesdas Daridracärudatta, das vier Akte en thäl t
,deutl i ch aber nu
vo l lendet ist Die vorhandenen vier Akte w urden aber von e inemanderen Verfasser
,der sechs neue Akte h inzud i chtete
,üb er
arbe i tet,und das so entstandene Werk ist b ekannt l i c h die Mrccha
katika.
S ei tdem d iese S ach lage bekann t gew orden,i s t auch die Frage
nach dem Verfasser und der Ze i t der Mrcchakatika i n cm neuesLicht getreten .
,
Die a l lgeme ine Ans icht ‘) in früheren Ze i ten w ar w oh l die,daß die Mrcchakatikä das äl teste ind is che Drama sei
,das auf
uns gekommen i st . Später aber w ar man gene igt, sie z iem l i c hspät anzusetzen . J o l ly ?) ze igte, daß das im neunten Akte gesch i l derte Rechtsverfah ren zu der Leh re der Gesetzbü cher dessechsten und s iebenten Jahrhunderts s timm t. P is ch e l
,der früher 3)
der Ans icht w ar, daß der Verfasser Bhasa sei,kam später ‘) zu
dem Resu l ta te,daß das Drama v on Dan din 5) herrühre . L ev i
sprach s i ch auch fur e ine späte Z eitansetzung kam aberspäter 7) zu anderen Resu l taten .
Was w ei ter den Verfasser b etri ff t, so s che int man allgeme inder Ans ich t gew esen zu se in, daß die Angaben des P ro logs, w onach das Werk von dem Könige Südraka herriihre, n i ch t glaubensw ert seien . Nur J a c o b i°) h iel t dafür, daß der Verfasser w ahr
Cf. W i l s o n , S elect Spec imens I , p. 6 ; W i n d i s c h , Der griech ischeE influß, p. 12fl .
2) Tagore Law Lectures 1883, p. 68 11 .3) GgA 1 883
, p. 1 229 11.
Rudrata,Introduct ion p. 1 6 ff.
5) Nach G aw r on sk i , Sprachl iche U ntersuchungen über das h1r ccha
kat ika und das Daé akumäracarita (Le ipzig 1 907) findet diese Annahme keineS tütze in sprachl ichen E igentüm l ichke i ten .
Theatre , p. 198 ff.
7) Journa l A siat ique 1 902, I , p. 1 23.
8) Literaturblatt f iir oriental ische Ph i lologie III , p. 72f.
1 08 S ten Konow
scheinlich ein Konig, und dann w ohl gerade Kön ig Südraka sei.
U nd in der T at haben w ir w oh l ebensow en ig Veran lassung die
Verfasse rs chaft des Südraka als die des Kön igs Harsa für dieihm zuges chriebenen Dramen anzuzw eifeln .
Die Frage nach der Persön l i chkei t des Verfassers ist aberfür die Zei tbestimmung w en iger w i chtig. Jeden fall s m üssen w ir
annehmen ,daß die Mrcchakatikä w ährend der Regierun g des
Kön igs Südraka ges chr ieben w orden . An der h istoris chen Rea li tätdieses Königs zu zw ei fe ln, haben w ir näm l i ch ke inen Grund .
Dazu S lnd die An gaben des Pro logs vie l zu bestimm t. Eine Bem erkung w ie die, daß der König vom S tars (denn das bedeu tetdoch s i cherl i c h timz
'
ra in V. 4 w ie in dem Bow er -Manuskript)geheilt w orden
,ist so spezie ll, daß sie ni ch t auf Erfindung be
ruhen kann . Kon ig Südraka hat w irk l i ch existiert .Über seine Zei t i st es schw er
,zu si cheren Resultaten zu
kommen. Er ist aber s icher ä l ter als Kal idasa. Unter den berühm ten Dichtern
,die dieser in dem Prologe des Mälav ikägnimitra
nenn t,
findet s i ch nämli ch au ch S aumilla,und d ieser ist w ohl
s i cher mit dem S omila iden ti s ch , den Räjaéekhara ‘) m it Bhasa
und einem anderen Dichter Rämila zusammenste l l t. S omila und
Rämila w erden in e inem anderen Verse des Räiaéekhara*) als
die gemein samen Verfasser e iner Südrakakathä genannt. Dam i tnun Südrakas Leben in e iner kathä behande l t w erden so l l te
,muß
e ine geraume Zeit nach seinem T ode v erflossen sein,und der
Zw ischenraum zw ischen Kal i dasa und Südraka muß noch gr ößersein. Fal l s nun das Mälavikägnimitra die po l i t i s chen Verhäl tn i sse seiner Ze it w iderspiege l t, w ird es gesch rieben w orden sein,als die Herrs chaft Candraguptas in Ujj ayini noch n i cht ges i chertund als die Erinnerung an S amadraguptas Pferdeopfer noch lebendigw ar
,a l so w oh l im letzten Vierte l des vierten Jahr hunderts, und
die Ze i t Südrakas könnte kaum später als Ende oder Mitte desdritten sein .
Nun w i s sen w ir,daß e ine ind is che Tradi tion “
) den Namen
1) Cf. A u f r e c h t , ZDMG 35, p. 540 ; P e t e r s on ,
Subhäshit'
a'
v ali , Introduction p. 81 .
Cf. L ev i , Theatre, p. 1 60 ; P e t e r s on a. a. 0 . p. 103.
Cf. B h au Da j i , Journal Bo. Br. R . A . S . 8, p. 240 fl . ; J a c ob i , Indische S tudien 1 4 , p. 147 3 .
1 1 S ten Konow
e inem der w estl i chen Ksatrapas ge leb t haben . Nun w erden imAusgang meh rerer seiner Dramen Wüns che ausgesmochen füre inen gew issen Räjasimha. Wir können h ier versch iedene S tufenunterschei den . Im Pafi carätra lau tet der S chlußvers :
han ta sam e pr a mnnäh sm alz pr avrddhaku lasamgrahä‘
h
im äm api m ahim kr tsnäm R äj asir_nhalz praéästzt nah.
Die letzte Häl fte findet si ch ebenso im Abhisekanätaka, Avimäraka und Pratijr
'
iäyaugandharäyana, in w e l chen D ramen die
erste Ha l fte lautetbhavantv araj aso gävalz paracakram praéämya tu .
Endl i ch in Bälacar ita , Dütaväkya und S vapnavasavadatta
finden w ir die fol gende Formim äm sägarapazyan täzn Him avad Vindhya
-kundaläm
m ahim ekätapaträrikäm R äj asim halz praéästu nah.
Daß die h ier aufges te l l te Re ihenfo l ge auch chronologis chri ch tig ist
,geht daraus he rvor, daß das S vapnavasavadatta s icher
j ünger ist als das Pratiifiäyaugandharäyana, da es gel egentl i chauf den Inha l t desse lben verw ei st. Dann aber w erden w ir den
fol gen den Vorgang ers ch l ießen können. Der F ürs t, der als Räja
simha beze i chnet w ird, regierte anfängl i ch in Ruhe. Dann kam
e ine Fremdherrschaft (paracakra) und schw ächte se ine S te l l ung.
Es gelang ihm aber,w ieder die Oberhand zu gew innen , und der
Di chter w üns cht fortan,daß s i ch se ine Herrschaft über das ganze
Land,das nach Manu I I . 22 Aryävarta h ieß ausdehnen möge .
Al les dies w ürde für den w es tl i chen Ksatrapa Rudrasimha I. zutrefl
‘
en. Er regierte als Mahäksatrapa in den Jahren 1 8 1 — 88
und w iederum 1 9 1 — 96, w äh rend er in den dazw i s chen l iegendenJahren die n iedr igere S te l le eines Ksatrapa b eklei dete. R aps o nhat w oh l m it Recht verm utet 2), daß diese Un terb rechung in se inerRegierung durch e ine frem de Eroberung veran laßt w u rde
,w as ja
zu der aus Bhasa gefol gerten S ach l age s timmen w ürde. Nachder Kar ika zu Pänini V . i i i. 83 könnte nun Rudrasimha zu S imhaabgekü rzt w erden
,un d Bhäsas Räjasimha könnte sehr w oh l eine
1) Hierdurch erledigen sich m eine Bedenken Indian An t iquary 1 914 , p. 66 .
2) Catalogue of the Coins of th e Andhra Dynasty, th eWestern Kaatrapas,
the T raikütaka Dynasty and the“Bodh i” Dynasty (London 1908) p. cu vi.
Z ur F rühgesch ichte des ind ischen Theaters 1 1 1
Anspie l ung auf diesen Namen entha l ten . Jeden fa l l s s che in t m irn i chts en ts che idendes der Annahme entgegenzustehen , daß BhasasZei t das l etzte Vierte l des zw e i ten Jahrhunderts is t .
Fa l l s d iese Annahme s i ch als r ic htig erw eisen so l l te, so w ürdesie uns auch he l fen
,die Ze i t des Bharatiya Nätyas'ästra nach unten
zu bes timmen .
Uber das Al ter d ieses Werkes gehen die Ans i chten ziem l i c hw e i t ause inander . B e g n a u d ‘
) ver legt es in die ers ten Jah rhunderte unserer Ze itrechnung
,P is c h e l ? ) denkt an das sechste
oder s iebente Jah rhundert,N o b e l s) zeigt, daß Bharata der äl teste
der uns bekannten indi s chen Poetiker ist, und R. Bh a n da r k a r “)
sucht es w ah rs che in l i c h zu machen,daß Bharatas mus ika l i sche
Ause inandersetzungen kaum a lter se in können als das vier te Jahrhundert, al lerdings auf ganz ungenügender Grund lage .
Im An fang des zw ei ten Aktes von Bhäsas Av imäraka komm tnun e ine S zene vor
,die für d iese Ze i tfrage v on Bedeutung i st .
Der Vidüsaka w i l l einer Zofe gegenüber seine Ge lehrsamke i tdokumentieren und erk lärt, er habe in w en iger als e inem Jahrefünf s' loka aus dem nätyaéästra Ramayana ge lernt. Wie sonstm ach t s i ch der Vidüsaka hier du rch se ine Verw echs lung berühm terWerke lächer l i ch . Er verw echse l t das Ramayana m it dem Mahä
bharata und dies v. lederum m it dem Bharatiya Näty aéästra. Daß
d ies letztgenannte Werk aber zu Bhäsas Zei t bekann t w ar , geh taus der S te l le deutl i ch hervor, obgle i ch w ir natü rl i ch n i cht ents che i den können
,in w e l cher F orm es verlag.
Die obere Grenze l äß t s ich n i ch t so le i cht ziehen . Die
kom i s che Wirkung in dem Avimäraka w urde ja natü rl i ch größersein, fa l l s es s i ch um ein m odernes Werk hande l t. Und fur e inesol che Annahme lassen s ich ei nige Gründe an führen .
In seiner ausgeze i chneten Abhandl ung über das Säripu traprakarap a
“) zeigt L ud e r s , daß As
'
vaghosa im Ausgang seinesDram as den von Bharata XIX . 9 7 ge lehrten Kavyasamhära n i chtkenn t, w as dafür sprechen w urde
,daß Bharata j ünger ist als
Im Vorw ort zu G r o s s e t s Ausgabe.
7) GgA 1885, p. 763 f.
3) Bei träge zur äl teren Gesch ichte des A lamkäraéästra (Berl inIndian An tiquary 19 12
, p. 1 57 ff.
6) SE AW 19 1 1
, p. 401 .
l 1 2 S ten Konow
A évaghosa. Auch in mehreren Dram en des Bhasa feh l t er und
fi ndet s i ch uberhaupt b loß in A v imäraka, Pratijfiäyaugandharäyana,Bälacarita und Dütaväkya . Die Regel hatte si c h som i t noch ni chtfestge legt, als Bhasa s chr ieb .
Auch m it Bezug auf die in den Dramen v erw endeten Sprachens che int Bharata Bhasa und M vaghosa nahe und zu den späterenAutoren in e inem bedeuten den Gegensatze zu stehen . Die Ar dhamagadhi
,die Bharata vors chre ibt, komm t b loß bei d iesen b e iden
Dramatikern v or , und keiner von i hnen verw endet die Mähärästri ,die auch Bharata n i ch t vors chre ib t . Wenn Brhannalä in Pafi carätra
b ei der Bes chr eibung e ines Kampfes auf Aufforderung des Viratavorn Prakri t in s S a'
nskr i t übersch lägt, so ist di es in Übere ins timmun g m it Bharata XVII. 38 , n i cht aber mit der späteren Praxis .
S onst lehren b ekannt l ic h Bharata und die v on ihm abhängigenspatereu Theoreti ker die Verw endung einer Re i he von S prachen ,die in keinem Drama vorkomm en . Diese Tatsache l äßt s i chm einer An si ch t nach nur so erk l ären , daß se in Lehrb uch s i chn i cht nur auf das w irkli che Kunstdrama
,sondern auch auf den a l ten
Mimus bez ieht. Daß das der Fa l l i st, s che in t mir auch aus der
a usfüh r l i chen Bes ch re ibung des Pürvar ariga hervorzugehen . Wirw i ssen aus Banas Harsacarita V . 1 6 , daß Bhasa den Sütradhära
im An fang sem er Dramen auftreten l ieß,daß heiß t w ohl
,daß
schon er den Pür varafiga jedenfalls s tark abkürzte. Das Sähitya
darpana, VI. 27 , im Komm entar, bezeugt ja ausdrückl ich,daß die
Besei tigung des S thäpaka im Anfang der Dramen eb en dieserKür zung zu verdanken sei Der Pürvarahga gehort überhauptn i cht zum klass is chen Kunstdrama, Er ist ein Bes tandte i l desa l ten Mimus
,der dem se lben ze it l i c h voranging. Daß Bharata den
P ür varariga ausführl i c h bes ch re ib t,ze igt, daß er in den Anfang
der Gesch i chte des Kunstdramas gehö rt .Gegen e ine so l che Auffassung kann n i ch t ge l tend gemacht
w erden,daß Bharata e ine ganze Reihe von verschi edenen Unter
a rten kenn t und untersche i det. Die Bes chre ibung des S amavakära,XVIII
,w o die genaue Zeitdauer j edes Aktes angegeben
w ird,ze igt
,daß es s i ch um ein einze lnes We rk und ni cht um
e ine Gattung hande l t, und ähn l i ch w i rd es auch in e inigen anderen
Vgl. P i s c h el , Die He im at des Puppenspiels (Halle 1 900) p.10.
1 1 4 S ten Konow ,Z ur F rüh gesch ichte des indischen Theaters
und auch Bharata steht im An fang d ieser Entw i ck l ung. Als
Patafij ali schrieb , exis tierte das w irk l i che Drama ans che inend nochn i ch t. In se iner bekannten Auseinandersetzung zu Päniui Il l
,i,26
erw ähn t er nebeneinander die éobham'
lcas (oder éau bhz'kas) und die
granthz'
kas. Nach der dor t gegebenen Beschre ibung w aren die
s'
obhanz'
kas oder éau bl n'kas r ichtige Gauk ler,für sau bl n
'
ka geben jaau ch die Lexikographen diese Bedeutung an . Auch der Mime istj a von Haus aus ein Gauk ler. Die grantl n
'
kas aber w aren Rhapsoden
,die gelegent l i ch in Kostüm auftraten . Aus der Ver
s chme l zung dieser bei den Kunstarten ist das ind ische Kunstdramahervorgegangen , und d iese Verschme l zung kann n i cht
,nach dem
w as heute bekann t ist,vie l früher als um den Anfang unserer
Zeitrechnung angesetzt w erden .
Die Umschreibung der Hieroglyphen .
F r . W . v . Rissing (Mün chen) .
Eine v ollige Ein igung über die bes te Art der Um schre ibungder Hieroglyphen ist noch immer n i cht erfol gt : n iemand bes tre itetzw ar w oh l , daß die v on E rm a n - S e t h e - S t e i n d o r f f in un sereWissens chaft e inge führte Art eine gute Grund lage ges chaffen hat(zu der H . B r u g s c h übrigens den Unterbau gegeben ha tte) ; aberabgesehen von kleineren Abw ei chungen der e inze lnen F orscherbei seiner Anw endung hat das Ber l iner System den sehr starkenNachte i l , unaussprechbare , j a für Nichtsemitisten un lesbare Wortbil der zu ergeben , die se ine Anw endung ni cht nur in popu l ären ,
sondern in gem einw issenschaftlichen Werken zu e iner U nmögl i chke it machen . Das hat m it gew ohn ter Unbefangenhe i t E . M ey e rerkannt und daher in se iner Neubearbe i tung der Gesch i chte desAl te rtum s ein eigenes Umschreibungsalphabet aufgeste l l t
,das
me in er A uffassung nach einen en ts ch iedenen F ortschritt bedeute t.Er erk lärt
,daß in allen Pr inzipien im w esen t l i chen zw i schen ihm
und E rm a n,S c h ä f e r
,S t e i n d o r f f E inigke i t geherrsch t habe,
n i ch t aber dem praktis chen Einzel fa l l gegenüber. Da i ch nun
sei t Jahren m i ch bemüht habe , e in en praktischen Ausw eg zu findenund in ein igen Punkten ihn auch gefunden zu haben glaube
,
m ö chte i ch im fol genden m e ine Vorsch läge ku rz darlegen.
I ch gehe dav on aus, daß bei der S chre ibw ei se der a l tenAgypter (mit Wort und S ilbenzeichen , Buchstaben und Determinativ en je nach Laune und Mode) eine Um s ch re ibung in europäischen Buchstab en n iemal s das Wor tb ild w iedergeb en kann
,
sondern im b esten F a l l den lau tl i chen Bes tand . Hier m uß - abergle ic h die Einschränkung gemacht w erden, daß auch dieser in
1 1 6 F r . W . v . R issing
sofern nur hö chst unvol lkommen gegeb en w erden kann, w eil in
al l zuvie l F a l len die Voka l isation e ines Wortes gar n i cht odernur sehr ungenau erm i tte l t w erden kann . Denn die berühm tenZei chen L], s ind ursprüngl ich s icher keine Voka lein un serem S inne, hö ch stens Vokalträger . und w o sie im Lauf derEn tw i ck l un g mit dem Vokal zusammengefa l len sind , ist dies w ederein im vorhinein zu bes timmender, noch bis ins späte neue Rei chh in ein auch nur der e inzige und Hauptvoka l . Wir können a lsoim besten Fa l le davon sprechen, daß e inzelne d ieser Zei chen, w ie
q oder eine besondere Vor l iebe für die Verschme l zung mitbes timm ten Vokalen haben. Bei den Königsnamen und
,w enn
einmal die nö tigen Vorarbe iten aus den griech ischen Papyris usw .
getan sein w erden, auch bei sehr vielen O rte Gött er und Per
sonennam en w erden w ir in der Lage sein, die grie ch ischen Ums chriften e inzu führen . Da diese mehr nach dem Gehör als nachder S chr i ft die ägypt is chen Worte w iedergeben
,so erha l ten w ir
b ei diesen Um s chriften w oh l das Lautbild, aber häufig n i ch t denr i cht igen Lau tbestand, und es w ird e iner von Wil l kür n i cht immerfre ien Übereinkunft zw i s chen den Fachgenossen bedürfen, w el cheim Griech ischen überl ieferte Form als
“ kanon i s ch ge l ten sol l , ob
z. B. der Erbauer der größ ten Pyram ide m it Herodot X émp odermit Manetho 2 0 15n genann t w erden sol l . Für die Königsnamenund die häufigeren Götternamen w äre e ine sol che Fes tsetzungs chon jetzt m ögl ich , und in vie len Fällen ließe s ich bei Namen
,
die zu fäl l ig in den griech ischen Que l len n i ch t vorkommen,nach
Analogie eine r i ch tige Form erm i tte ln . Bei d iesem Verfahr enw ürde unsere Um s chri ft den ägypti schen Namen und Worten dasAussehen geben
,das sie etwa in späterer he l len ist ischer Zei t
hatten. Ich ha l te das für keinen S chaden ; denn einmal dürfenw ir dann ohne zu große S cheu die um e inige Jahrhunderte j üngerenkoptischen Bildungen für die S cha ffung v on Analogieformen heranziehen und hoffen, auf diesem Wege a l lmähl i ch das Lautbild a l lerTexte für jene Spätze i t einhei t l i ch zu erha l ten. S odann aberscheint mir die Errei chung ges icherter a l terer Wortb ilder nur in
so se l tenen Fäl len mögl i ch , daß sie prak tis ch n icht in Betrachtkommen. In grammatis chen Arbe iten w ird es notw endig se in, denLautbestan d aus der Pyramidenzeit festzuha l ten und genau dar
1 1 8 F r . W. v . R issing, Die U mschr eibung der Hieroglyphen
k (k)u s (s) Wt (t) M(t) y
suchungen erwünscht . In altester Zei t hat bekann tlich zudem den
Laut é ; a lle e inen und denselb en Laut bezeichnenden alphabetischen Zeichenbesonders zu umschreiben, v ermag auch die Berlin er Umschrift n icht
,sonst
müß te sie für die sekundaren Ze ichen (u) , g/(n) und E : : (rn) be
sondere Umschriften haben und andrersei ts auch mit l w iedergeben .
1) F iir den Lautwert v on in pto lemäischer Zei t vgl. die j etzt
gesicherte W iedergabe der S tadt m it S i le und der S tadt
1 j mit Z eßév v v r os.
Naro und Tilo.
Von
Alb er t Gr unwedel (Berl in).
1 . Ti lo oder Til i als Mahäsiddha F ig. 2. Ti lo oder Ti l i , die F ischedem Parivära des Vajrasattva, den lebend b ratend, Randfigur von
Fisch als A ttr ibut hal tend. e inem B i lde der Vajravärähi aus
Chara Choto ; vgl. S . v . O l d enb u r g
, Mater ialy po Buddijskojikonografii Charachoto (Peters
burg T ab . IV.
Z u den gefeiertsten Vertretern des Mouchtums des äl terenLama i smus gehört der ge istige Urheber der bKa rgyud pa
-S ek teNaro l ) s chon desha lb , w ei l die bei spie l lose Hingebung, die er
1) Der Name w i rd bald Na ro pa, bald Nä ro pa oder Nä ro ta pa
gesch rieb en , w as einem *Nädapäda en tsprechen sol l . Daneben s teht eine
1 20 A lbert Grünwedel
seinem Guru gegenüber bew ies, immer und immer w ieder als
Vorb i ld aufgeste l l t w ird . Durch die Verb indung der bKa rgyud
pa-S ekte m it den rNifi ma pa und anderen Gruppen der Rot
mützen einersei ts, w ie durch se in Übertreten zum Kälacakra
System 1) und durch se ine S chüler Atisa und Sänti”) w ird er für
den ganzen Lama i smus e ine w i ch tige Persön l i chke it. KeinWunder a l so, daß ihn ein ganzer Kranz von Legenden umgib t.T äranätha te i l t in den be iden bis jetzt übersetzten Büchern„Ges ch ich te des Buddh ism us in Ind ien “
und der Ede l s te inm ine “
einen - ausführl ichen Bericht über ihn m it, den der bekannteHistoriker Ye ses dpal offenbar ganz nach T äranätha al so zusam inengefaßt hat ?)
„Den Naro, w e l cher das Am t eines nördl i chen Torwartsversah , machen e in ige zu e inem S ohn des Königs des Ost landesSäkyaéubhaéäntivarmä, geboren im Feuer-Drachen-Jahrew ährend andere erzählen, er sei ein T irthika-Pandita aus Bräh
mana-Gesch lech t in Kaémira gew esen . S päter w äre er zu den
tibetische Übersetzung rT sa head pam it der mongol ischen U bersetzungUndusuninomlakci. Als Ab t v on Nälanda h ieß er Abhayakirti : so unten in der
Tex tprobe . S e in Lehrer,der h ier T i lo pa heißt, wird anderw e i ti g T i li pa,
T il li pa, T e 10 pa, T ai 10 pa genannt ; sein Name w ird oflenbar manchmalmit dem des tugendhaften Ö lhändlers Grub t
‘
ob No. 62 verwechsel t. E ineAbb ild. des Ns ro Veröffentl. Mus. f. Vö lkerkunde 2
, p. 50,52 No. 16
B ibliotheca Buddh ics V, No. 16 . Das erstere Bi ldchen ist von L . A . W adde l l,
Buddh ism of T ibet (Load. 1899) p. 1 6 Wiederhol t. Über Nä ros Werke
w issen wir n icht v iel . Öfters w ird sein „Luftw andel“ genann t,vgl. G . H u t h ,
Gesch ichte des Buddh ismus in d. Mongole i , Übers. (S traßburg p. 109 ,
1 1 5, 884 ; eine bestimm te Form der Buddhadäkini (Vajrayogin i) he i ßtgeradezu Nä ro mk
‘
a spyod „die Luftwandlerin des Na ro
“ F ünfhundertGötter von sNar t
‘
ar'
1 F 0 1. 25 Mitte ; ferner die „ Sechs Vorschriften “ H u t h,
p. 1 70 , 1 7 1 , 180,1 97 und B. L au t e r , A rch iv f. Religionsw issensch . IV
p. 8 ; vgl. auch P. C o rd i er, Catalogue du F onds Tibétain , 2° p.
Index du b8tan hgyur (Par is p. 16, 4 ; p. 238 , 57 ; E . S c h lagin tw e i t ,
Sureqamat ibhadra, Abb . K. B. Ak . Wiss . 1 Cl. XX ,III p. 14 (602) (München
Nä ro als Vorb i ld „E delsteinm ine“
p. 1 53. 1 7 1 — 2.
1) JASB. 11 (1833) p. 58.
J. Buddh . Text S oc. I , pt. 1 , 1898 p. 18. T ib . rtse b6ad rtse bla ma.
Peg Sam Jon Zang, History of the Rise, Progress and Downfal l ofBuddh ism in India by S um pa Khan po Ye ce Pal jor ed. (}ri S ar a tC h an dra Da s (Cal c. Pt. 1 , p. l l 7 f. Im Index ist Na ro in zwe iPersonen zerlegt .
1 22 A lbert Grünwedel
kaufen , um sie ihm zu bringen ; vom T empeldache Sprang er
herab ; se in Bl ut sprengte er als Opfer, die Finger s chn i tt er s i chab , um das Bucket dazu zu machen ; so b ere itete er das Man
da la usw . Na ch dem er zw ö l f so schw ere Bußen innerha lb zw ö l fJahren fur ihn vol lbracht hatte, gab end l i c h Til l i ihm seineUpadeéas. Nach sechs Monaten hatte er se ine Dharmatä vö l l igerrei ch t und w ard er l öst. Nun arbe i tete er am Hei l al ler Lebenden ,s iegre i ch in Wortgefech ten mit den T irthikas. Lange Zei t hausteer auf dem Phullahari ; end l ic h im e i sernen Drachenjahr (1039) 1)erlangte er den Regenbogenkörper . Es w ird erzäh l t
,Atisa hätte
se ine Geb e ine gesamme l t und nach Tibe t gebracht,er hätte Sänti
und Atisa als S chüler gehab t und außer ihnen noch vier S chü ler,
w e l che die Bannkräfte der Pitr und Mät-r-tan tras b esaßen.
S ein Nachfol ger als Torw art w ar Bodhibhadr a S thavira aus
Kgatriya-Ges ch lecht von Odiviéa, der den Ava lokites' vara leibhaf
tig gesehen hatT äranätha zahl t in der „Ede l ste inm ine“
e ine Reihe se inerS chü ler auf; darun ter aber den n i ch t
,der uns h ier am me i sten
interess iert,den Mar den e igentl i chen Begründer der bKa
rgyud pa S ekte der der gefe ierte Lehrer Mi la ras pas
(1 038 — 1 1 22 n . Chr.) w ar .
Den kurzen Text, den i ch im fo l genden gebe, habe i c h einera l ten t ibetis chen Hands chri ft entnommen
,die w ahrsche in l i ch aus
Hemis s tammt und den rNam t‘
ar des Näro enthäl t. En tgegendem kurzen Ber icht des Grub t‘ob (Naro i st der zw anzigste in
der Re ihe der Mahäsiddhas) stimm t der rNam t‘
ar im w esent l i chenmit T äranätha ü bere in .
Was uns nun an dem rNam t‘
ar trotz seiner Übertre ibungenso anzieh t
,i st
,daß das Buch ents ch ieden dense lben Charakter
hat,w ie die Lebensbes chreibung des Mi la ras pa und seine
Gesange . Die außerordent l i che Werts chä tzung,
w el che d iesereizvo l len Texte gefunden haben , w ird auch das Interesse an so
1) Der rNam t
‘
ar gib t dasselbe Datum ,laß t ihn aber 1 1 5 Jahre alt
w erden ; dann wäre er 925 geboren .
Bertho ld L au t e r , A us den Gesch ichten und L iedern des Mi la ras
pa, Denk schr . Kais . Ak. Wiss. W ien, ph . b ist . Kl. 48 p. 5.
8) JASE (LI) 1882, p.
126 ; B. L a u t e r , Zw e i Legenden des Mi la ras pa,A rch iv f . Religionsw iss . IV (l901) p. 2.
Näro und Ti lo 123
nahe verw andten, w enn auch asthetisch w en iger schonen Literatu rprodukten w ach erha l ten, b esonders w enn d iese uns die Mögl ichke i t geben könnten
,für die s che inbar exzeptione l le S te l l ung
e iner Ersche inung, w ie sie Mi la ras pa b ietet, e ine Brücke zufinden. Niemandem ,
der m it den ind is chen Kavyas vertrau t ist,w i rd entgangen se in, daß die sche inbar vol kstüm l i che Sprached ieser Texte doch ohne ind is che Vor lagen undenkbar i s t. Aberauch die An lage des Werkes w i rd mutati s mutand is “ nach demKsetra des He i l igen d iese l be se in, und i st d ies der F a l l
,so b ietet
der rNam t°
ar des Na ro die Brücke zu den a l ten indis chenS i ddhas und Sädhakas, und daß uns auch h ier eins t eine F l u tw e l le un bekannten ind is chen Vo l ks lebens zuströmen w ird w ie b ei
Mi la ras pa tibe tischen davon bin i ch überzeugt. Im rNam
t‘
ar des Nä ro sehen w ir genau d iese l be An lage, w ie sie die Legendena l ler anderen S i ddhas entha l ten ; S ch r i tt vorschri tt treten die e inze lnenS tu fen der Befre iungsaktion ein, die durc h Propheze iungen ein
ge l ei tet w nrden ; Täuschungen und S törungen oft der tol l sten Artsteigern das Ar bei tsberei ch (Kecira), b is die S i ddh i erre i ch t w ird ;je w ie das S tadium es verlangt
,s ingt der Sadhaka se ine Dohäs
oder tanzt mys tis che Tänze, übt im Term in ieren, b is inm i tten einer U nsumme v on Täuschungen der Mom ent der Erlö sung einsetzt. Die starkb rahman ische Unterlage dieser Dinge brauch t kaum betont zu w erden ;es genügt, an das Buch Pausya des Mahäbhärata zu erinnern.
F O]. 27 B 3 1 B des rNam t‘
ar‘) (Text um s tehend)
U nd w iederum s tieg bei Sri Abhayakirt i der Gedanke auf,
just j ener Mann müßte der ehrw ürdige Ti lo gew esen se in ; daer aber n i cht w ußte
,ob es w irk l i ch so w ar
,beunruh igte ihn
doch diese Vorste l l ung. Darum meinte er , er könn te w iederkommenund in e inem Kloster auftauchen , w egen des Vorkommens des Ausdrucks : „Morgen heiß t es Gaben samm e ln.
“ In d ieser einen Ab s ichtsprach er a l so e ine Pranidhi aus und begab s i ch auf die S uche.
S o ge langte er an die Pforte eines K losters . Als er nun un
m i tte lbar vor der Pforte stand, w ar innen a l les sauber in Ordnung ;nur s ch ien ihm im unteren Raume einer rußig schw arzen Küche
,
Die Szenen,w elche dem fo lgenden Tex tstück v orhergehen , erinnern an
die bekannte Gesch ichte v on der „Gerechtigke it Gottes , “ die M. Schw ind einst
so prächti g i l lustrierte, vgl. Gesta Roinanorum übers . v on J . G. T h . G r äs s e
(Dresden 1905) 89 , p. 137 ff.
1 26 A lbert Grünw edel
b ei glühenden Koh len, deren Hitze w ehte,ein Bett ler zu sitzen
,
ein s chw arzb lauer Mann , der s i c h am F euer bähte. E in Klosterschafl
°ner kam heraus
,um S treu0pfer zu br ingen . Sri Abhaya
kirt i merkte, daß er gesehen w orden w ar . Als er nun ganznahe gekomm en w ar , sagte der S chaflner zu den Mönch en des
Klos ters : „Da s cheint ja w irk l i ch der große Abt
,der nördl ic he
Torw art von Sri Nälanda Abhayakirti gekommen zu sein und
an unsrer Pforte zu stehen .
“ Aber die Mönche antw orteten :Da irrst du dich aber, w ie so l l te denn Sri Abhayakirti, denman zum Abt von Nalanda gemach t hat, h ierher kommen ? “ Worau fder Verw a l ter versetzte : Dann s chaut nur selbst nach ; i ch habenur gesagt, w as i c h w irk l i c h gesehen habe.
“ S o sahen sie nachund w underten s i ch seh r. Darum r iefen die Mou che : „
Du,ein
Mahäpandita, eine Leuchte für T ag und Nach t,w ie S onne und
Mond , der du Ab t von Sri Nalanda b is t, komm s t uns besu chen !Du
,dessen heißersehnter Guru Ti lo ein zw ei ter leibhafter Buddha
i st,glaubs t w oh l gar , der S trol ch h ier ist Ti lo? Wer so ausschaut
,
i st nur ein Wärmesch inder,der auf uns rer S chw elle s itzt. “ Un ter
diesen Worten gingen sie zum Bettler hin . Ab er an dem Feuer,an dem das Essen der Mön che gekoch t w erden sol l te, b egannder Bet tler Fis che lebend ig zu rösten . Da w urden die Mönchew ütend und s ch lugen ihn . Er sprach : Das freu t euch w ohln i cht ?“ Al s nun die Mönche antw orteten : „
Wie kann m an s i chüber e ine S ache freuen
,die für Mönche e ine S ünde i st?“ sagte
der Bett ler b loß : Lohiva gaja, s ch lug ein S chn ippchen , und die
Fis che w ur den w ieder, w ie sie zuvor w aren. Darob festigte si chbei Sri Abhayakirti die Vors te l l ung : „
Jus t d ieser ist es“
,darum
ging er zu ihm hin,machte seine Reverenz vor ihm und um
w an de l te ihn in Ehrerb ietung. Dabei b etete er : „Wenn du Ti lob is t, erbarme d ich m einer und gew ähre mir deine U padeéas.
“
Aber der Bett ler sprach : „Wenn d ies Zei chen zur Verzierung
dien t,so n imm es und w irfs ins F euer “ und w ies ihn au f e ine
Laus l ) auf se inem Ärme l . O bw oh l dam i t gesagt se in so l l te :
In ähn l icher We ise w ir d die para l le le Szene mit der „Laus“
,als
Tsori k‘
a pa sein e Gegner n iederschmetterte vgl. 0 . F . K öppen ,
L amaisch e Hierarch ie und Kirche (Berl in p. 1 10 nur eine allegorische gew esen sein . die v ielle icht an unsere Legende, w enn sie so alt w ar ,
anknüpfte .
Karo und Ti lo 1 27
Inm i tten des mächtig um treibenden Weges , der si ch ergi bt aus
den Charaktere igens chaften al ler Lebew esen,die im S amsara
kreisen. laß Zw ei fe l , Gier und S chmerz vergehen, indem du sie
tö test,“ dachte doch Sri A bhayakirti bei s i ch : „Wie könnte es
s ich passen, daß i ch , der i ch doch ein Mönch bin, eine Laus imFeuer tö te
,
“und tötete sie n i ch t. Aber der Bet tler sagte : „
Wo
könnte der einen Guru finden,der n i ch t tö ten w o l l te die . müßige
Laus n i chtsw ürdigen Zw e i fe l s ? Nun m orgen he iß t es w ande rn,
Erscheinungen zu s chauen ! “ und just unter d iesen Worten zerfloß
der Bettler in Regenbogenlicht und w ard n i ch t meh r gesehen .
Nun empfand Sri Abhayakirti sofort w ieder b i ttere Reue und in
einer S timmung,in w e l c her die Bes chämung v orherrschte, b rach
er auf,den ehrw ürd igen Tilo zu suchen . U nd so mußte er in
einem w e i ten Geb iete ein S chauspie l erleben an vie len Leuten ,die doch n i cht d iese lben w aren, daß einer ohne Augen dochseine Gesta l t sah
, einer ohne Ohren hö rte,einer ohne Zunge
redete, ein Lahmer um die Wette l ief,ein Toter Lebensze i chen
gab . Als er dies al l es sehen mußte,ger iet er in e ine S timmung
,
in der seine gekn i ck te und zerr issene S eele s chw i rrend summ te. Erdachte a l so bei s i ch , den Guru , den er gesu cht hätte, habe er
n i ch t ge funden,die v on ihm n i cht gesuch ten, in ha l ts losen S chau
gesta l ten hätten ihn b e irr t,und als er s ich vors tel l te
,es könnte se in
Ents ch luß w ankend w erden , den Guru zu suchen , da fragte er sie
a lle :„Hab t i hr denn den ehrw ürdigen Tilo gesehen ?“ U nd sie a l le
an tw orteten : „Den ehrw ürdigeu Ti lo haben w ir n i ch t gesehen ;
r ichte es so ein,daß du den ehrw ürd igen Ti lo aus deinem Herzen
herausfindest ; zum w ü rdigen Gefäß eines ergebenen S chü lersw ird nur der
,w e l cher die Wahrhei t in gläub i ger E rgebung aus
s i ch heraus erkennt ; er w ird des Zusammenhangs teil ha ft ig,w e il
der Guru den Faden ha l t ; zücke die Wafl°e ge i s tiger Errungen
s cha ft deiner Arbe itsart ; e i le ein m änn l i ch Boß2) zur K larhe i tse l iger Verzückung ; l ö se den Knoten des S iege l s , w e l chesum sch l ießt
,w as der Inha l t deines Term in ierens ist ; dann w ir d
1) Vgl. hlezu die Verse des Sivaväkkiyar bei K . G r au l , Indische
S innpflanzen und B lum en (E rlangen p. 182 f .Der Ausdruck „
Hengst der S eele“ T ib . rta p‘
o , der seinen Wettlaufglückl ich v o l lenden so l l , ist auch den Liedern des M i la ras pa geläufig,
vgl. B . L a u t e r , Denkschr . Kais . Ak. W iss. W ien 48 p, 55, No. 23.
1 28 Albert Grünw edel
als Lohn S onnen l i ch t dein Herz erhe l len . Denn sonst feh l t dieEmpfindung da für, ob du auch ein Auge hast ; s chauen aber mages der B l inde, dem doch das Auge feh l t
,es hört davon der
Taube , dem das Gehör versagt i st, es redet davon der S tumme,
ob er auch n i ch t sprechen kann, es eil t hin der Lahme, w enngle i cher n i cht zu gehen im s tande ist, es regt s ic h danach der des
Odem s Beraub te, ohne w iedergeboren zu w erden . Trotzdem es
so heißt, b is t du zu der We l t Enden gestre i ft, aber deinen Guruhast du n i cht gefun den. Aus de inem Herzen heraus ho le den Glauben ,die Ehrerb ietung und ergebene Ge lassenhe it, s chaffe K larhei t indir und ruhst du dann ganz dar in
,w ird au ch der Guru s i ch
einste l len ; denn dam it der Lei tfaden zur Vo l lendung, den dochder Guru häl t, n i ch t abrei ßt, bedarfst du des Guru als S tütze.
Während du die Erkenntni s d ir zu eigen machen sol l test,daß
a l les,w as der Formenw e l t angehört, w esen los ist, hast du sons t
ein geist iges Resu l tat im Kopfe, das nur e ine trügerische Methodedafur b ietet. Du muß t ein Einsehen erre i chen
,das d ich begierde
los erhält,
. w ähreud de in Ge i st in Verzückung is t. Du b edarfs tder Los l ösun g, um n i ch t ha ften zu b le iben am Objek t
,das du
b egre i fen w i l l s t,und an der Nachprüfung des Resu l tats im Grübe ln,
das den Kern erfassen w i l l . Um end l i ch den Lohn in F r iedenzu genießen, bedar fs t du der endgü l tigen Gew ißhe i t für deinHerz
,daß es n i ch t m ehr bange
,den S amsa ra dur chkreisen zu
müssen . S ei e ingedenk der Wirkungs losigke i t in a l len körperl i chen Form en, die der nur m it (irdischem) Auge Begab te hat ;
so l iegt a l so die Bedeu tung der Mahämudrä dar in,daß der
Le ib l i chke i t eines B l inden, w enn er au ch n i ch t sehen kann,
dur chaus n i cht entgeht,daß die Eink le i dungen (samskara) keine
Wirkl ichke it hab en ; ferner l iegt die Bedeutung der Mahämudrä
dar in,daß durch sie der S tumme, anges i ch ts se iner Un fäh igkei t
zu reden , beredter w ird, als die Rede se l bst ; so l iegt die Bedeutung der Mahämudrä dar in
,daß der Lahme demgegenüber
,daß
er n i ch t gehen kann,si ch ausze i chnet dadurch
,daß se in Fort
s chre i ten deutl i ch b emerkbar w i rd, und end l ich l iegt die Be
deutung der Mahämudrä darin, daß die S krupe l über Begre i fenund das zu Begreifende w e i chen m üssen und se lb st der Toteauf dem Lei chenacker aufleb t. Auf diese Worte hin überlegteSri Abhayakirti bei s i ch . Kaum aber w ar ihm dabe i die Vors te l l ung
1 30 A lbert Grünw edel, Naro und Ti lo
vergoß in der Erregung se ines Herzens Tranen, und auf die Kn iegesunken, sprach er mit gefa l teten Händen : Wie die w esen loseWol ke am Himm e l su chte i ch den Frieden , w o sollte ich ihn
finden ? Web ! Erbarmen sah i ch n i cht,v on nun an fasse m ich
das Erbarm en an ! “ Da kamen aus dem Munde des ehrw ürdigenTi lo die Worte : Als du zuerst mit der Leprakranken zusammentrafst
,folgte i c h dir stets , w ie der S chatten dem Körper ; einma l
sahst du m i ch als Hündin,
“
ein anderma l , w ie i ch auf dem
Hundehofe Vater und Mutter tö tete,und sol ch unre ine Begeg
nungen hattest du vie le ; denn durch die Verfinsterung, die de insch lechtes Karman verursa ch te, kam es
,daß du m i c h n i cht sahst.
Leuchtend , ohne Make], bere it als w ürd ig Gefäß au fzunehmen,erlange den Ede l s te in
,der a l le Wünsche erfü l l t ; le i ten w i rd er
di ch zum gehe imn isvo l len S choß der Dakinr. “S ei ten s des Guru
,der den Zusammenhang der vier Aufträge
in der Hand h ie l t,und se itens der Jnana-dakini in U dyäna hatten
s i ch nun a l le Tantras und Sutras mit den Upades' as bei ihm in
e inem Herzen gesamme l t ; es w ar al le Mögl ichkei t dafür und ke inZufa l l mehr dagegen vorhanden
,in se iner Körperl i chke it w ährend
seines Mens chen leben s den Rang eines Buddha zu er langen ; so
w ar seine Ge i steskra ft durch ausgieb ige Gew ährung, daß er der
Sri Dakim münd l i che U n terw eisung vernehm en durfte, ers tarktund erfri s c ht ; denn se in Inneres w ar flüssig gew orden w ie Öldurch die S egensw orte : „Me in S ohn
(Marathi Diet .) aufgeführt w ird. Daß netrapinda auch „Katze“ he ißt , paßtvor trefi lich zur S i tuat ion .
1) Durch die Anrede
„Mein S ohn “
erhal t der Sadhaka die Aufnahmeals S chüler und dam i t die S icherhe i t, daß er die S iddh i er langen w i rd, vgl.E del ste inm ine p. 65 , wo Jälandhari den Ausdruck dem E rsp acäri gegenübergebraucht . Nach dem Grub t
‘
ob erhäl t Na ro diesen Ti te l sch on nach der
E rbeutung der herrl ichen „grünsüßen“ Gemüsesuppe . Nach T äranätha und
dem v orl iegenden Text erlangt Na ro die S iddh i erst im A ntaräbhäva (T ib .
bar do), nachdem er s ich selbst b lutig geopfert hat . Die Vorstufen dieserAufopferung se ines Lebens z iehen sich durch die ganzen vorhergeh endenS zenen . Die S te l le, w e lche dies B lutopfer beschre ib t, habe ich in Übers.
mit dem Texte in den Noten zur „E delsteinm ine“
p. 1 72 1 74 m itgete i l t .
Ein mandamcher Traktat.
Übersetz t v onT h . Nöldeke (S traßburg).
Übersetzungen mandäisch er S chr iften w erden immer nuvoll
kommen b le iben. Al l zuv ie l Rätse l b i rgt für uns d iese ver
schlungene und'
w i derspru chs vo l le T raumw e l t, und dazu sind dieTexte sehr nach l äs sig über l ie fert. Das ze igt ja auch gerade dieäußerst dankensw erte Übersetzung des Johannesbuches von dem
berufensten Ge lehrten , L idz b a r sk i , der immer w ieder ausd ruckl i ch oder andeutungsw ei se zugibt, w ie man ches er n i cht oder dochn i cht s icher v ersteht. Aber eben L idzbarskis Werk gibt m ir denMut
,m ic h auch w en igstens m it der Übertragung e ines kurzen,
m erkw ürdigen Abs chn i ttes hervorzuw agen, trotzdem mir dar in d iesund jenes dunke l b le ib t .
Der Traktat des S i dra Rabbä oder Ginza 1 , 278 — 282 ze igtuns den Dua l i smus
,der in der mandäischen Leh re ba l d s tarker
,
bal d s chw ächer hervortr i tt und zuw e i len ganz vor dem Monothei sm us verschw indet
,rech t deutl i ch . Abe r an innerem Widerspru ch
feh l t es au ch h ier so w en ig w ie in al len Lehren, w e l che das bösePrinzip stark betonen, es j edoch n i cht ganz dem guten gle i chzuste l len w agen . Der F ürst der F instern i s i s t ungeheuer mächtigund w issensreich, aber im Grunde doch ohne Einsich t, da er ni chterkenn t , daß seine Kraft der des Lichtkönigs n i ch t gew ach sen ist.Das Spiege l t s i ch auch darin
,daß se ine dämon is chen Geschöpfe
tei l s sehr ge fährl i ch und versch lagen , tei l s sehr bes chränktDaß der Kön ig der Finsterni s in dem von ihm begonnenen Kampfen i cht s iegen kann , w ir d ausgesprochen , aber w ie der Weltprozeß
A l so kluge und dumme Teufe l .
132 T h . Nöldeke
w irk l ich ver lau ft, erfahren w ir h ier n i ch t. Andere mandarscheTraktate b ehande ln die Vorgänge der Mis ch ung und Entm is chungv on Gutem und Bösem ,
die Mäni w en igstens gedankenvol l und
systemat is ch , w enn auch sehr phan tasti s ch , dars te l l t , in a l l er le imärchenha ften Erzäh l ungen , die natürl i ch l ängst n i ch t al le m it
e inander im Eink lang sind .
Wie s chon der U rsprung des Mandaismus kaum e inhe itl i chist, die S ekte dann aber die versch iedens ten Einflüsse erfahrenhat, so zeigt au ch unser S tück m ehr fach Berühr ung mit anderenReligionsparteien , namen tl i ch mit den Man i chäern
Außer P e t e rm a nn s Text benutze i ch für das S tück nochmeine Ko l lat ion e iner Münchener Han dschri ft , sow ie die v on
E u t i n g gem achte zw e ier Handschr i ften des Br i t. Mus. und des
Anfangs einer d r i tt en (bis Pet. 27 9 , Die Kollationen habenm ir abe r so gut “
w ie gar n i ch t geho l fen . Jene Cod ices habennoch m ehr Feh ler als Pe termanns Text und versagen durchw eg,w o d ieser und se in
,lei der n i ch t immer ganz vol l s tändiger, Apparat
versagt. S e lbstverständl i ch b evorzuge i c h in der Übersetzung,sow e i t es s ic h um Lesarten versch iedenen S innes hande l t, immerdie
,w e l che mir als die beste ersche in t.Fü r König des Li chts “ , „
We l ten des Li chts “, „Erde des
Li chts “ hätte i ch l ieber Lichtkönig ,Lichtw el ten , Lichterde
“
gesagt,ab er i ch h ätte dann auch F insterniskönig
“usw . sagen
m üssen , und das s chien m ir sch lech t zu k l ingen .
1) Ich hab e m ich nach langen Jah ren e inmal w ieder etwas in den
Quel len der m anichäisch en Lehre umgesehen ,w enn auch keine t iefe S tudien
darüber gemacht. Merkw ürdig v ersch ieden ist das S ch icksal dieser beidenKi rchen . Die manichäisch e. v on e inem bei al ler Phan tastere i j edenfall s sehrbedeutendenMenue begrün det
,hat trotz schl immer F eindschaft und Verfo lgung
länger in ihren He im atländern eine Ro l le gespiel t, dann aber e ine noch v ielgrößere t ief im innern A s ien
,um jedoch schl ieß l ich gänz l ich verdrängt zu
w erden , namen tl ich durch den für j ene V ö lker w e i t angemesseneren Islam ;heutzutage ist sie,w enn n icht a l les trägt v ö llig v erschwunden (3. besonders
C h a v a n n e s et P e l l i o t , U n trai té man ichéen retr ouv é en Ch ine. ParisDie Mandäer s ind dagegen w ohl n iemals zahlre ich gew esen ,
haben auchkaum in höheren Volkssch ichten Boden gefaßt
,b e inahe immer Not und Be
drückung erfahren und doch den Man ichäismus überleb t. Jetzt schein en sie
fre il ich im Aussterben zu sein .
1 34 Th . Nöldeke
in der Weise jener, sie, die von der Erde des Li chts versch iedenund abw e i chend ist, denn sie w e i chen in jeder Rich tung und
Gesta l t voneinan der ab . Die F instern i s ist da durch i hre eigneböse heu lende Finsterni s , ödes Dunke l , kenn t n i cht dasErste und Letzte . Aber der Kön ig des Lich ts
,der kenn t und
versteh t das Ers te und Letzte, w as gew esen und w as se in w ird,hat erkann t und vers tanden, w as der Böse ist
,w il l ihm jedoch
n i ch ts Üb les tun , w ie er gesagt hat : Tu dem Bösen und Feinden i chts Üb les
,bis er von se lb s t Üb les tut . “ S e ine Natur ist aber
b öse v on An fang an und in a l l e Ew igke iten . Die We l ten der
Fins tern is sind w e i t und endlos. Er ”) hat gesagt : We i t und tiefist der Aufentha l t der Bösen ; ih re Völ ker haben ke ine Treuebew iesen an e inem Orte
,da ihr Aufen tha l t end los ist
,sie, deren
Re i ch v on ihnen se lbs t “) her ist . Ihre Erden s ind s chw arzesWasser, i hre Höhen finstre Finstern is . Aus dem s chw ar zen Wasserw ard geb i l det und kam hervor der Kön ig der F instern is dur chseine e igne böse Natur und w u chs (p. w ard groß und
m äch tig,r ief hervor “) und breitete aus tausend mal tausend böse
Gesch lech ter ohne Ende, zehn tausend mal zehntausen d häß l icheKr eaturen ohne Zah l . U nd groß und w ei t w ard die Finstern isdur ch Dämonen") Teufe l , Gen ien, Gei ster, Amulettw esen, Lili ths,
1) S tark b etont w ird h ier
,daß die We l t der Finsternis n icht v om
Herrscher des guten Prinzips geschaffen ist . E r läß t sie auch in Ruhe, bisihr Fürst selbst den S trei t beginnt.
S ie.
8) Wörtlich „
voneinander “ , d. h. aus ihnen selbst entsprangen , nichthimm l ischer Herkunft .
Rufen„hervorrufen“ ist im Mandaischeu „schafi en
“. 80 schon
bei den Manichaern : „dein e gesegneteu Wel ten,die du g e ru f en hast“
(da‘
au tahum ) F ihrist 333, 1 9 , vgl. P ogn on Inscr . mand. 185 ann . 1 . Da.
nach „Gerufenes“
„Geschöpf, Kreatur“ .
5) Der Katalog b öser Geister kann natür l ich nur annahernd dur ch
deutsche Ausdrücke w iedergegeben w erden . Z u beachten , daß Gegenstände,die anderen Religionsgenossenschaa he ilig
,den Mandäern aber eben deshalb
unhe i l ig s ind (w ie Kapellen , Amulett e) , als von Dämonen beseel t und geradezuals Dämonen angesehen w erden ; so betr achteten die Christen ja v iel fachauch die heidn ischen Gö tterb i lder. Die L i l i t h
,j etzt als al tbabylonisch
erkann t, spiel te im jüdischen Aberg lauben e ine Rol le, die ‚A r c h on t en“
e ine noch w eit bedeutendere in Mänis Lehr e ; vgl. schon den neutestament
l ichen ägxw v 1 a'
m 3az,u öv w v , 1 0 17 ada,n ou 1 779 é£ o v oia s 7 0 6 äégos. F iir
E in maudäischer Traktat 1 35
Tempe l und Kapellenw esen, Gotzen, Archonten, Enge l , Nach tmaren, S chädiger, Unhe i l sti fter, Lähmer , Unho l de, S atane,lauter häßl iche Gesta l ten der F ins tern i s von mancher le i Farbeund mancherl e i Art, m änn l i che und w e ib l i che Wesen der F insterni s ,finstere , s chwarze , s chm utzige , w i derspenstige , zorn ige , übermutige , gi ftige, töri chte, fau lende, ab s cheu l i che, unreine ,stinkende . Ein ige v on ihnen sind stumm ,
taub , ra t los,s totternd
,gehörlos
,sprach los, verw i rrt
,ohne Wissen ;
e inige frech , h itzig, s tark , s charf, j äh zorni g, w o l l ü stig, l ügnerisch ,Kinder des Bl uts , entflammter Lohe und fres senden Feuers ; e inigeZauberer, Betrüger, Lügner, Unw ahrhaftige, Räuber, Argl is tige,Bes chw ö rer
,Wahrsager. Baume i ster a l ler Boshei ten
s in d sie,Ans ti fter v on Not
,so da Mord b egeben und Bl u t vergießen
ohne Mit lei d und Erbarmen. Künst ler a l les Häßlichen s ind sie,
kennen Spra chen ohne Zah l und sehen, w as vor ihnen l iegt. S ie
hab en a l ler lei Ges ta l t. Ein ige v on ihnen kr iechen auf dem Bau ch,
e inige krabb eln im Wasser,e inige fliegen
,e inige haben viele
Beine w ie das Gew ürm der Erde, e inige S ie haben Backenund S chneidezahne im Mau le. Der Ges chmack ih rer Bäume istGift und Ga l l e
,ihr S aft Naphtha und Pech . Jener (p. 280) König
der F instern i s hat s ich a l le Ges ta l ten der Weltbew ohner berei tet :den K0pf des Löw en, den Leib des Drachen, die Flüge l desA d lers , die S e i ten der Hände und Füße des Un
zwe i G l ieder der Reihe w eiß ich ke ine Deutung ; das zw e i te konnte „Lockige“
sein,aber was sol l te das heißen ?Der Text „w iderspeustige
“
; das kann n icht richt i g se in ,da das
W ort ja kurz vorher schon vorgekommen . M i t le ichter Änderung läß t sichdaraus das „b i ttr e“ bedeutende Wort machen ; für die Richtigkeit der Verbesserung stehe ich aber n icht ein .
2) Das heiß t w ohl : „n ichts merkend, unfäh i g, E indrücke zu empfangen“
.
V ie l leicht pieqé fur peye zu lesen .
Der Vo lksname , der im Westen die Bedeutung „Astro log“
(oft mit
despektierl ichem Nebens inn) bekommen hatte, ist so in seine Heimat zuruckgew andert .
5) Die handschr i ftliche Überlieferung sche int auf dmä där
‘
z‘
„tragen
Blut“ zurückzuwe isen, aber das ist doch schw erl ich r icht i g .
Mäui vom Satan : „se in Kopf ist wie der: e ines Löw en , se in Le ib w ie
der eines Drachen (tinnin), seine F lügel w ie die e in es Vogels, sein S chw anzwie der eines F isches“ F ihrist 329
,1 2f. A lso nur das letzte Glied verändert .
1 36 Th. Nöldeke
ho l des Er geht, krabbe l t, kriecht, fl iegt , schre it, ist frech , droht,b rül l t, pfei ft, w inkt und flötet. Al le Sprachen der We l t kennt er .
Jedoch ?) ist er töricht und verw irrt , se ine Gedanken sin d ge
hemm t, und das Erste und Letzte kennt er n i cht. Er w eiß (aber) ,w as in a l len We l ten ist und w as s ich an a l len Enden befindet.Er ist größer “) als all seine We l ten
,mächtiger und w ei ter als
all se ine Kreaturen und s tärker als sie . Wüns cht er ’
s,so verb irgt
er s i ch vor i hnen, daß sie ihn n i ch t “ sehen,k ennt ab er den S inn
des,der vor ihm s teh t. Fl 'iehen die Ges ch lechter vor ihm
,so
füh rt er sie durch sein (b loßes) Wort (w ieder) herbe i, und die Teufe l ,die er w i l l
,fesse l t er Wüns ch t er ’
s, so dehnt er seine Gestalt aus
,w üns ch t er ’
s,so macht er s i ch k lein . Er zieht se ine
Gl ieder (nach Gefa l len) ein und steckt sie heraus ; er hat männ
l i che nnd w eib l i che. Er m erkt a l le Geheimn is se. U nd wird e r
zorn ig °) m it S timm e, Wort,Gluthauch
,Atem
,Augen
,Mund , Händen,
F üßen,S tärke, Gift, Zorn und Rede
,da erbeben a l le We l ten der
F instern is mit Furcht,S chreck
,Beben
,Zittern und Gebrü l l . S eine
Gesta lt i st häßl i ch und se in Le ib stinkend , se in Antl itz verdreht.S e ine Unterl ippe ist 144 000 Parasangen Durch seinesMundes Hauch w ird Eisen glühend, und der S tein w ir d durchseinen Glutatem erh i tzt. Heb t er se in Auge, so erzi ttern Berge,und durch seiner Lippen Geflüster kommen Ebenen in S chw ingung.
Er betrach tete s i ch se lbst,beriet s ich in se inem tör ichten
Herzen und überlegte in se inem argl i st igen S inne . Da s tieg er
empor, sah die We l ten der F instern is, die w ei ten und en d losen,und w ard sto l z
,hob s i ch über sie a l le und sprach : „
Gib t ’ s e inen,der größer als i ch ist? e inen (p. der mir gew achsen ? einen,
Der Text kaum richtig.2) Lies ellä.
Ich w eiß mir n ich t zu helfen als durch die etwas m ißliche Verbesserung mr auraß für mm urßé.
Ich m öchte $ämed für säm ar lesen und die be iden fo lgenden Wort eals unr ichtige W iederho lung aus der Ze i le vorher fassen . Sonst müß temqaij em stehn , denn das Part iz ip w äre n ö tig.
15) Ich setze wzad „
et quum v or räyez statt v or rayeä.
Sodaß er eb en gewal ti ge Massen verschlu cken kann,z . B . Berge .
Der manichäische Fürst der F instern is verschluckte ja sogar den v om Lichtkön ig gesandten „
ersten Menschen “, Fihrist 329 , 27 usw . ; vgl. ib. lin. 14.
E ine Parasange ungefähr Kilome ter.
1 38 T h . Nöldeke, E in mandäischer Trakta t
Jahren legt er in e iner Tagere ise zurück l) . Als er nun j enes chimmernde Gesta l t sah, such te er s ich zu erheben (p. 282) und
aus dem heu lenden , öden Dunke l zu jener leu chtenden Ges ta l temporzuste igen fand ab er ke ine Tür, dadurch e inzutreten,ke in en Weg, darauf zu gehn, ke inen Au fst ieg, darauf emporzuste igen , w ei l jene Gesta l t, die er sah , in der Höhe, er aber inder Tiefe War w ie die Mens chen
,das Wild u nd das zahme Vieh
,
die n i cht zur Himme l shöhe emporsteigen können . Da erh i tzte er
s i ch und ergl ühte w ie ein h itziger Löw e gegen die Herde (dieer zu erbeu ten denk t), ruh te und rastete ni ch t in seinem e ignenAufentha l t. Er rief
,w ieherte und pfifi
“ laut, und die Welten desLichts
,die se ine S timme hörten, sahen die Gesta l t des ratlosen
Teufe l s . U nd das s inkende Heer “) samme l te s i ch ; sie sahen und
betrachteten e inander w ie ein Körper, des sen Glieder pl ö tz l i ch insZittern geraten s ind
,und erklangen w ie eherne Ge fäße. Und da
ging von dem hohen König des Lichts eine S timme aus,und er
sprach zu den We l ten des Li chts und den Wohns itzen der U thras :„S e i d ruh ig, i hr U thras, und b le ib t in euren Wohnsitzen ; ängstigteu ch n i c ht vor dem Zorn des rat losen , bösen Teufe l s, der hef tigerzürn t ist. An se inem e ignen Ursprungsorte ‘
) so l l er gefangenw erden , gefangen w erden an seinem e ignen Ursprungsort ; all
se ine Gedanken w erden vere i te l t, vere i te l t all seine Gedanken,und seine Werke kommen n i cht zustande.
“
U nd Leben für unsre Wissenden u nd Leben für unsre Ver
stehenden ! Und gepriesen das Leben , und das Leben ist s iegre i ch1) S o mag der S inn der korrupten S tel le sein.
2) Ähnlich schon Basilides (Acta A rchelai ed. B e e s o n LXVII
,8 p. 97)
und Mäni (F ihrist 329 , 1 5f. Theodoru s bar Chon i bei P o g n o n a. a. O . 127 , 23 ;
S ev erus Antioch enus bei C um o n t et K u g en e r,Recherches 2, 1 32f.
Das s ieglose, U nglücksh eer .T rotz der Ausführung L idzb ar sk is (Johannesbuch 4
, Anm . 4)schein t m ir KANA als Bezeichnung des U rsprungs immer noch das syrischekannä
„Basis“
zu sein . Dasselbe Wort bedeutet auch„ S tamm ,
S tenge l“(wie im Mandarschen S . R . 2
,84
, während das „Kanne“ bezeichnende
im Mandäischeu wohl nur zufä l l ig den gle ichen K lang hat .
Diese und ähn l iche F ormeln schl ießen immer die e inzel nen Traktate
Zum
Von
E vald L iden (Go teborg).
1 . w a r t o‘G a r t e n ’
B wär to,w ar to (w ar tto)
‘Garten, Ha in”) s te ll t s ich zu aengl.
w eord, word n .
,m . (idg.
*
yér-to
‘Gehege am Haus,Hofs tätte,
S traße ’
; alb . vaö e f. (idg.
*uor -tä
‘Gehege, Hof um das Haus,
Hürde, apreuß. w ar te neutr. pl.‘Haustür ’
,l i t.
var'
taz'
pl.‘T or, Tür ’ , abulg. vrata neutr . pl.
‘n v
’
Äou’
(idg.
*y or-to
Vgl . ai. vg=-ti f. ‘Zaun
,Einzäunung ’
,forme l l i dentisch m it
asachs . wu r th f. ‘Boden ’
mudd . war t, w or t (w urde, w er de) f. ‘Garten,F e l dstück , Wa l dmark ; Hofstätte, Hausplatz ’ ; abulg. vo m
‘saepi
m en tum ’
, air. fer onn (aus*g en ano
‘Land,Acker ’ , osk.
-umbr .
Die tocharischen Sprachform en des Dia lektes B entstamm en fastausschließ l ich den Veröffen t lichungeu v on Sy lvain L ev i und A . M e i l l e t[Abkürzung L .
,Das W en ige, w as aus dem Dialekt A herangezogen
w erden konnte , b eruht auf der inhaltreichen v orläufigen S chrift v on E . S i e gund W. S i eg l ing ,
Tocharisch , die Sprache der Indosky then [AbkürzungS S .] oder den Mi ttei lungen v on S i e g bei F e i s t
,Kul tur, Ausbr . und Her .
kunft der Indogerm .
E s sch ien mir angemessen , h ier am Namen 'Tocharisch’ für die
Sprache(n) indogerman ischer n ichtarischer Herkun ft im al ten Ost turkistaufestzuhal ten, ohne daß ich dam i t über die h istorische Berechti gung des
Namens etwas ausspräche.
2) wär to mm
‘aus dem Garten ’
,w artto n e
‘im Hain ’ L .-M. , MSL 18,
19 , 1 60„
J ok l , S tudien z . alb . E tym . p. 94 (S itzb . Ak. d. Wiss. W ien , ph i l.b ist . Kl . ,
Bd.
1 40 E . Liden
ver o‘
porta ’ zur WZ . y er ai. vg°-
zt o’
ti, l it. veriü, abulg. vzr a lat. op
eriö (aus -veriö)‘sch l ießen ’
.
Die s chw ankende Beze i chnung m it a und a des S tammsilb envokals des toch . Wortes sche int e ine reduz ierte Aussprachew
“r tö (war to
’
) anzudeuten ; vgl . z . B. w lo neben w a lo‘Kön ig’
und
den tota len Vokalschw und in s'
no neben A s'
en‘Ehefrau ’
(abulg.
éena , got. gino, Me i l l e t MSL 1 8,25
,A . 1
,S i e g b ei F e i s t ,
Indogerm . p.
Z u derse lben Wurze l gehort me ines Erach tens au ch fol
gendes Wort .
r uw‘ö f f n e n ’
.
3. l dg. u r u n d ;aL i m T o c h .
An den voraufgehenden Abs chn i tt über war to ‘Garten ’ sch ließei c h e ine Besprechung v on B r uw
‘öfinen
’
(l . sing. opt. r uwz'
m ) an ,das mir aus der Be legstel le ner väzzä5,sai r ittse ruwz
'
m yetme
‘
pu isse-j e ouvr ir l’entrée de la vi l le du n irvana’ L ev i -Me i lle-t,
MSL 1 8,401
‘bekannt i st.Hinsi cht l ic h der Bedeutung erinnert es an lit . verz
'
ü vér -tz'
,
l ett . vefa ver -t,das n i c ht nur
‘s ch l ießen, (eine Tür) zum a chen ’
,
sondern au ch ‘ofi
°nen , aufmachen’
beze i chnet, w as den Gedankennahe legt, daß toch . m w antekonsonantisch —*m aus idg.
*
ar-ü hervorgegangen sein dürfte .
Der Wurze l u er ai. var usw . komm t b ekann t l i ch von
Anfang an nur erstere Bedeutung zu Die Bed.
‘öflnen
’
w ar (8.
besonders B r u gm an n,IF 1
,1 74) zunachst in Zusammen setzungen
w ie l i t. ät-verz'u , ai. apa-v ar lat. ap
-eriö aufgekommen,die s i ch
w iederum ers t nach trägl i ch neben l it. üz' -verz'u,ai. api
-var lat.
op-er iö ‘s ch l ießen ’
eingeste l l t hatten . Aus ersteren Kompp. hat
s ich end l i ch im Lit. und,w ie i ch meine, im Toch . ein unkom
poniertes Verbum m it der Bed.
‘öflnen’ losgemacht.
Der Umstand,daß die Wurz e l geer ‘s ch l ießen ’
in w ar to‘Garten ’
(‘um s ch lossener
,eingefriedigter Raum ’
) vorhanden ist, erhöht n i ch tw en ig die G laubw ür digkei t der jetzt befürw orteten U rsprungsdeutung .
1) Die F orm ‘äen
’ bei F e i s t w ohl Versehen fur Sen .
1 42 E . Liden
An laut zu r gew orden i st E in w e i teres Bei spiel d ieses Vorgangs w ir d soglei ch unten zur Sprache kommen . Das Te char ische ste l l t si ch in d iesem Punkte den verschiedensten idg.
Sprachen , w ie dem Ba l t is ch Latein i schen , Hochdeuts chen und Altisländischen
,zur S e ite.
Für die an s i ch m ög l iche Annahm e, daß tech . raw zunachs taus äl terem *
w“raw (idg.
*y erü en tstanden sei
,spr icht ke ine mir
b ekann te Tatsa che ; gegen so l che Annahme sprechen u . a. B
w r attsaz'
‘
prati ’ , w r otse (neben er otse usw .)‘groß ’
(vgl. A w ras° zu w ir
‘Mann’
usw .
,S S . w o w erst sekundär
,durch tech . Lautw ande l ,
m it -r zusamm engetrofi'
en i st.Auch ist m i r ni chts zu Ges icht gekommen, w as auf eine tech .
Metathese v on u r zu 7'
;t (a l so ev .
*a r -i zu *
rp-i,
r“w -i-m ), w ie
im Aw estisehen oder in schw ed. und norw . Mundarten , hin
deuten könnte.
Die Glaubw ürdigke i t der behaupteten En tw i ck lung von
idg. ar zu tech . r w ird dadur ch be trächtl i ch erhöh t,daß der
para l le le Wandel v on idg. y l zu te ch . Z konstatiert i s t. Er komm tzum Vorsche in in B län
_
t,län ie ‘Kön ig’
(läntsa län t ‘Kön ig der
Kön ige’
,oroece [ärzte
‘mahäräjä
’
) neben B w alo,w lo , A (nach S S . 931
,
A 1 ) wa_
l ‘Kön ig’
,zolä-izlca t ‘Fürstgott = 1ndra
’
zu lat. valeö ; air .
flaz'
th (u rkelt .*yla
— ti ‘He rrs cha ft,Herrscher ’ , flaz
'
th—em‘Herr ’ , cymr .
gw a l-aär ‘Herrscher ’ ; got. w a l-d-an
‘w al ten ’
,a llw aldands ‘
n a vzo
abulg. v ladg, lett. w al'
a‘Gew a l t’ ; phryg. p
’ah jv .
aw . U r vatat-nar a s. E . S m i t h a. a. 0 . p. 1 9,43 ; F e i s t a . a. 0 .
p. 1 21 , w o län t eben aus*vlän t erklärt w ird ?)
1) F e i s t , Indogerm . p. 1 21 e inem zegernden Hinw eis v on Pis c h e l
bei S S . 933f. fo lgend läß t tech . A r ake [B r eke,r ekij
‘Wort ’ w egen an
geblicher Verw andtschaft m it zigeun . raker,vaker (aus
*oraker) ,
sprechen ’
aus *w ruke en ts tanden se in . Mit R echt aber gib t P i s c h e l der Verb indungv on tech . m ks m it abu lg. r ekg ‘
sprechen’
, r éc'
i ‘W ort’ [vgl. got . rahnjan usw .,
Z u p i t z a ,Die germ . Gutt. p. 136] den Verzug ; so auch S m i t h , Christiania
Vid.—S elsk. Skr . 1 9 10, II, Nr. 5 , p. 14 .
L i den , E in hal t.-slav . Anlautgesetz p. 1 fi . (Goteborgs HögskolasA rsskrift 1 899
,IV ) .
M e i l l e t , Idg. Jahrb . l , 18 (vgl. Journ . D, p. 149, 631 ;
Z um Tocharischen 143
Der Nom . pl. läüca von der auf e inen idg. Nom . pl. auf
-n t-es (g r. -vr 4 g) s ch l ießen l äßt (M e i l l e t,MSL
Jahrb . s che in t m ir dazu zu berech tigen,a ls Grund form des
Wertes ein Part . * i_
t l—pi (vgl . ai. glnu at ‘tö tend ’ u . dgl .) oder *yle-n t(vgl. zu r Wurzelgestalt air . {la
-iti; ‘Herrs chaft ’,u rkelt. *
;cla -ti an
zusetzen .
Die sekundär entstandene Lau tverb indung w l b le ibt : B
w läm oym ar (3 . unten). Über A putiiéparam ) zz*lesä
_
t, (pu ttiépa rsinä
‘
s)w lesan t w lesä t usw .
‘er übte (die Buddhasehaft) aus S S . 929 , 93 1
w ußte i ch n i ch ts Bestimm tes zu sagen
Der gemeintecharische Ausdruck für ‘S tad t’ is t A r i,vor
voka l is cher Endung r iy Pl . mi s ; BS m i t h a . a . 0 . p. 1 5 n imm t unter n i cht st ichha l tiger Be
gründung Entlehnung aus t ibet. r is ‘a quarter ’ an
,w as offenbar
v erfeh l t i st, w e i st aber nebenbe i (p. 43) m it s tärkerem Vorbeha l tauf thrak. p
’
gia kurz hin . Den tech . Lautw ande l a r zu r einma lals begründet zugegeben , verd ien t me ines Erach tens le tztere Komb ination (üb rigens s chon früher au ch von mir erkann t und mundl ic h vo rgetragen) erns tl i che Beach tung .
T hrak.
-
phryg. ßgz’
a w ird in griech . Que l len n o'
l rg, zb zelxog‚
f; e
’
7r’
äygoig x rb,m ) gloss iert. Es komm t, a l le in oder in Zusammen
setzungen,a ls Name zah lrei cher S täd te und O rts cha ften auf thra
kischem w ie auf ph rygischem Geb iet vor,und zw ar unter den
Formen p’gia , p’géa , in Kompp. auch Bet -ßgt , -p’
gieg, z . B. 2 1;Ävyßgia ,Bei
-750190 9, Koe oxa E a l s-ßgieg, s . T om a s c h e k,Die al ten
Thraker II,1,6 ; II, 2, 62f. ; K r e t s c hm e r
,E inleit. in d . Gesch . d .
gr. Spr . p. 203 .
Bezügl ic h des Wechse l s p’gia — p’
ge‘a w i l l W a c k e r n a g e l
,IF
25, 335 f., der mit T om asc h e k von der F orm 5950: als der an
MSL . 1 7 , 292) v erb indet t ech . w alo m it B walke ‘de longue durée ’
,abu lg.
velifi'groß ’
und mit tech . A wä_
lis, B yalfse, yältse, yiltse‘tausend’ .
1) S iche r falsch zu r E tymo logie E . S m i t h a . a . 0 . p.
19 . Ob zu
waL ‘h erm cheu’
, deutsch (seines Am tes) w alten ??S S . 923 ; L ev i und M e i l l e t passim .
1 44 E . Liden
s che inend fruher bezeugten ausgeht,die F orm ßgia e inem früh
ze i tigen griech . I tazismus zuschre ib en. K r e t s c hm e r , Glotta 3, 321w endet gegen d ieses Be i spie l ein
,daß das Verhäl tnis von ßgz
’
a
zu ßgéa vie lmehr sehr an das von maked. A eovüg zu Aw’
v veog u . a .
erinnert . Er könnte unter Berufung auf seine „Einlei tung “
p. 225 ,
234 , 24 1 h inzuge fügt haben , daß das S chw anken der griech . Überl ie ferung w ahrsche in l i ch d irekt in der phryg.
-thrak. Aussprachese lb st w urze le , denn sow oh l im Phryg. als im T hrak. ist ein
Wechse l von i und e,w e i das ursprüngl i che i st, gerade in ante
voka l is cher S te l l ung w ah rzunehm en,z . B. in neuphryg. Ins chri ften
dmg u nd dem;‘deos ’ 5, in thrak. Namen Die dies u nd d ee
D eos Die Form ßgia kann m an demnach als die etymologischu rsprungliche ge l ten lassen .
Auch die Auffassung von,6’gia als Fgux ist dur ch den phryg
thrak . Lau ts tand gerechtfertigt,denn die E rhal tung von 14 vor r
ist u . a . du rch das Wort Feexv v auf einer bekannten altphryg. In
s chri ftDie Gle i chsetzung ‚Sgia , ßge
’
a und te ch . rt U rform *
yn _tä
(oder *yri l äß t sich daher forma l gut behaupten. Man be
m erke , daßm Be iw orte in t em i n i n i s c h e r F orm erhä l t (MSLDie a l te Bedeutung w ar se l bstverständl ich n i ch t ‘S tadt’
,sondern
‘befestigter Platz,F este ’
Die rea le Berechtigungdes Ansatzes eines ura l ten Wortes mit d ieser Bedeutung i st jan . a . durch die bekann te G le i chung ai. pur lit. pibs gr.rro
'
h g‘Burg ’
, im Ai . und Griech . sodann auch ‘S ta d t’ , zu r Genüge erw iesen .
Mit Rücks ich t auf mbd. berg, air . brig arm . barj r‘B e r gh o h e
’
,
aw nerd. berg‘naeh e iner S e i te hin s te i l ab fal lende Bergterrasse ;
m it Mauern oder Verhau befestigter (hochgelegener) Platz ; befestigte Burg ; S t a d t ’ , ahd. burg
‘Bu rg, S tadt ’ , got. baurgs ‘S tadt’
empfieh l t es s i ch , h ier hom . éiov‘Be rghöhe
,Vorgeb irge’
mit in
Erw ägung zu bringen . A n durch Natur und Kuns t befes tigte
1) Vgl. M e i s t e r , IF 25 . 318 A . 2. Anders uber die Bedeutung T o rp ,
Z u den phryg. Inscbr . (Lhrist iauia 1894) p. 16 f.
Über d ieses Wort M e i s t e r , IF 25, 317 , A . 3 ; T o rp a. a. 0 . p. 6
und„Z um Phrygischen “
(Christ ian ia 1896) p. 1 1 .
1 46 E . Liden , Z um T oeharisehen
Beispie l w läw ogmar dus'
cam'
t m em que j e me dé tour nede la mauva ise condu i te“ L .
-M.
‚MSL 1 8
,Vgl. gr . bh i
‘er w and
,kr ümmte s i ch ’
,Perf. e’
ilb,u a t arm . gelw m
‘drehen ’
;
lat . voluö, volü-tus ; got.-w a l an
‘w äl zen ’
,w a lwison ‘s i ch w äl zen ’
,
aisl. vglr (*w alu ‘runder S tab ’
usw . An den Angehörigen derWur zel nel yelu haftet zum e i st die Bedeutung ‘
voluo (ro llen ,Winden m ehr ere aber
,z. B. ai. vala tz
'
, i r. fillz'm (tillz‘m , pillim ),
b edeu ten auch ‘ad a t e-verto, -verter ’ .
Die tech . S tamm form w läw s teh t zunachst für *w
° läw Den
vorstehenden Erörterungen gemäß (p. 1 42f.) kann w l keinesprüngliche Kontak tgruppe se in.
Die Geschichte von den Low enmachern in
tochariseher Version .
V on
E . S ieg (Kie l).
Diese aus dem Pafi eatantr a bekann te Fabe l findet s i ch au ch
in den tocharischen Handschriftenresten (Gruppe A), w e l c he durchdie III . T urfanexpedition unter G r ü n w ede l und von L e Coq
nach Berl in gekommen s ind, und steht in den Nee 1 1 — 1 3 unsererS ie b i l det aber h ier e inen Bes tandte i l des Punya
vantävadäna, das in der durch die tocharis che Übersetzung üb erl ieferten Version v ie l ausführl i cher und künst leris cher dargeste l l tw ird als im Jeder der fün f Freunde (in der tochar isehen Vers ion s ind es Prinzen) : Rüpaväm,
Viryaväm , Silpaväm ,
Prajfiaväm undPunyaväm such t näm l i ch h ier die in se inem Namenzum Ausdruck kommende Tugend als die der anderen Tugendüberragende te il s durch S prüche , te i l s durch Erzäh lungen zu er
w e isen, w ährend der Bew e i s durch eigene Lei stungen,der in
der Mahävastuversion die Hauptro l le spie l t, h ie r nur ganz ku rzam S ch lüsse abgetan w ird . U nsere Ges ch i ch te von den Löw enmachern w ird natürl i c h von Prajüavän als Bew eis für die Überlegenheit des Vorstandes über die Kunstfertigke i t erzäh l t. Auchdiese Erzäh lung is t kunstvo l ler und ausführl i cher dargeste l l t alsdie sie w e i ch t von der letzteren aber auch
Genauer 1 1 h , 13 8 5.
S . Mahävastu 111 p. 33— 4 1 .
So die tochariseh en Namensfermen, w obei na 11 zu lesen ist .
S . auch B e n fey , Pantschatan tra 2, 535 ff. ; He r t e l , Das Paiieatautra,
s. Gesch . u. s . Verbr . (19 14) 37 1 ff.
1 48 E . S ieg
nament l i ch dadurch ab , daß h ie r a l le vier F reunde glei chmäß igan der Dumm hei t bete i l igt w erden . Das ist indessen zw e i fe l lose ine Verw ässerung der Ges ch ich te
,die s i ch als unursprünglich
s chon dadurch kennzei chnet, daß die Le istungen des ersten und
zw e i ten h ier ziem l i c h i den tisc h sind, und daß nur für den ersten ,zw e iten und vierten das Mitte l angegeben w ird
,dur ch w e l ches
die Wiederherste l l ung des Löw en zuw ege gebracht w ird . Wärennur dre i Küns tler an der Dummhe it bete i l igt
,so w äre a l les in
s chönster O rdnung.
Da die von m ir in Gemeins chaf t m it Dr . S iegling b esorgte,bere i ts im Dru ck b efindl i che Ausgabe der tocharisehen Texte Adu rch den Kr ieg s i ch verzögert hat, sehe i ch m ich lei der genötigt ,den t ocharisehen Text h ier nochma l s m i tzu te i len
,doch habe i ch
zur Vere infachung des Dru ckes die Fremdbuchstaben im Innerndes Wortes ’
) dadurch verm ieden , daß i ch den den be tr. Aksarainhä r ierenden Voka l durch ä w iedergab
,w ährend F remdbuchstaben
am An fang einer Ligatur und am Ende e ines Wortes durch diegew öhn l i chen Ze i chen ersetzt w urden . Das klangstützende ä desAuslau ts und die Vir ämas w urden gänzl i ch w egge lassen , auch dieu rsprüngl i che Ze i lenanordnung w urde n i cht b e ibeha l ten
,die in
b e igefügte Z eilenzählung d ien t nur zu r Kon trol le der Übersetzung.
Für den genauen Handschriftenbefund muß i ch einstw ei len auf
unsere Ausgabe p. 1 0f. vertrösten . Die Hands ch ri ft ist le i derte ilw e ise b es chädigt, so daß b i sw e i len Aksaras feh len bzw . un
leserl ich gew orden s ind . S ow e i t leidl i ch s i chere E rgänzung möglich w ar
,w urden sie in runder Klammer ergänzt
,sonst durch
w agerechten S tri ch mark iert.In der Übersetzung habe i ch m oglichste An lehnung an das
Origina l , auch in der Wortfo l ge, ers trebt. Fre i l i ch hat das
Deutsch darunter lei den müssen,aber i ch hoffe
,man w ird das bei
dem ersten Versu ch e iner Übertragung aus d ieser b isher unbe
kannten Sprache verzei hen , zuma l für w eitere Erk l ärungen an
dieser S te l le naturgem äß ke in Raum w ar .
(1 ) amokise penu knänm unega ,s w ar cetsw ätsu(negä) a(mo)k ‚sur
(2) m a.gz'
k m e prast s'
ol nälcsefzc m amtne älge'
ikyäm prastar_n s'
iw ar
(3 ) am oktse älakar_nearp (ype)gac gtsi kä7y atsumäs oem tmar
_n ‚sfu
'
,sfi t'
1) S . Sitzb . Ak. W iss. Berlin 1 908
, p. 9 18 f .
1 50 E . S ieg
(ihr) Leben zugrunde r ich ten, w ie zu e iner anderen Zeit die vier(3) Künstler, die nach e inem fremden Lande zu gehen beab
sichtigten. Diese dort j e i hrer (4) Künste Fert igkeit (und) Vorzugrühmend (w aren). Der e ine spr i c ht : Durch meine (5) Kunst(habe i ch) diese Fähigkeit : w enn i ch v on e inem Toten se ineKnochen, auseinander (6) sogar gefa l len , bekommen w ürde, diesei ch w iederum 1
) zusammensetzen w erde.
“ Der zw e i te (7) spri ch t :„Ich indessen eb en d iese Knochen v on a l len S ei ten m it S ehnenzusammen füge i ch .
“
(8) Der dri tte spr ic ht : „Ich indessen eben
diese Knochen mit Fle i s ch,Bl ut, Haut, Nase und Haar (9) w ie
zuvor genau so ganz i ch ihm herste l len w ü rde.
“ Der viertespr i cht : „U nd i ch (1 0) w iederum lebend ig ihn ma chen w ürde“
.
Darauf diese (ihre) gegensei t igen Künste (l l ) klar zu bew e i sen beabsichtigend, in S chulterfolge gehend, in e ine fremde Gegend 2
)des Himavant-(l 2)ß erges gegangen se iend, dort sie Löw enknochengefa l len (13) sahen. Darau f der e ine in der Handfläche w äßrigeFlüssigke it 3
) bere itete, auf die Knochen spr itzte er (sie) (1 4) nur .
Dadurch eben diese Knochen Nikoipandurärikar_n
(1 5) auseinander auf dem Lokalok-Berge ge fa l len in ein Röhri ch t(1 6) aus der Tiefe w ahr l i ch gingen heraus, springen d g le i chsam
gingen sie zusamm en,
(1 7 ) w ie l iebende alle vere inigten s ich ;(1 8) es kam zustande ganz und gar ein aus Knochen bestehender
König der Tiere 1
(1 9) Darau f der Zw e ite e ine w äßrige Fl üssigkeit bere itete.
Auf jene Knochen spr itzte er (sie), (20) dadurch eben d ieseKnochen m it S ehnen zusammen er fügte . Der Dr itte w ah r l i ch ebenj ene (21 ) Knochen mit Fle isch
,B lu t, Nase und Haar ganz und
gar ihm herste l l te. S o er (22) um diese Zei t anzusehen w ar , w ie
ein im S ch la f ruhender bew egungs loser (23) Kesar-Löwe i st.S algp m al/ceyarn
5)
1) w ad wohl v erschrieben für w tä, s. spater w täk.
lyu tanam ist ein .
wränes set,nur h ier u . Z . 1 9 ist in se iner Bedeutung unsicher,
w raa cs dürfte aber j eden fal ls m it wär,Wasser“ zusammenhängen ; daß es
s ich um etw as Nasses hande l t,w ird ja aus dem F olgenden k lar.
Ist Name e ines Metrums v on S ilben m it Zäsur nach der
fün ften S ilbe.
Name e. Metrums von S ilben mit Zäsur nach der siebenten S i lbe.
Die Gesch ichte v on den Löwenmachern in tochariseher Vers ion 1 5 1
(24) Angezogen a l le vier F üße, zw is chen die We i chengesteckt
(25) ruhend auf den rechten Rippen, setzend das Haupt auf diel inke Hüfte
(26) die Ohren ein w en ig,hangend, (aber) die Spitzen “
)hoc h gerichtet
,
(27 ) v on einem lebenden, ruhenden Löw en w ar nur das Lebender U n tersch ied d ieses 1
(28) Darauf der Vierte durch eine Röhre Wasser auf diesenDadurch eben er U n tersche i dungskraft (29) be
kommend , m it Gähnen v on (seinem) Lager aufgestanden se iend ,hungrig (und) durstig sah (30) j ene Küns t ler. (Und) da er s ichin der Nähe befand , eben jene a l le vier
, S ch l äge m it der
Tatze (3 1) ausgete i l t habend, säm tl i c h ers ch lug er und fraß ’) (sie)
auf Ylam ’) u
(32) Gut j ener Kuns t w ar , aus den zerbrochenen Knochen den
Löw en l ießen sie hervorgehen(33) (aber) des Löw en Gier n i ch t bedach ten sie
,sie w urden die
Nahrung (ihres) e igenen Löw en, aus U nvers tand,(34) die zerbroeheuen Knochen samme l ten sie v on dem Low en ,
mit Kunst s te l l ten sie ihn her ,
(35) die e igenen Knochen (an S te l le?) der Löw enknochen fie len,
sie gingen zugrunde 1
lya5kn awn ist än .Äey .
,sieht aber aus w ie ein lee. du .
, ywär ckä heißt„m i tten in , zw ischen “
; si ist eben fal ls ein . l.ey .
2) kelyeyac, v on kelye, ist Dat . ag.
,der im T ech . die R ichtung bezeichnet,
das Wort ist ein . ).ey .
äiér i,der F orm nach N om . pl. , i m.
kulmc'
irgttßy0 , der F orm nach Instr., ist ein . Äey.
pampär s natürl ich S chreib fehler für papars.
6ä1käs,der F orm nach acc . pl. , ist ein . Äey,
täpap w oh l Schre ib fehler für täp, 3 sg. aor . v on täp „fressen“
,
Name eines Metrums v on 4X 18 S ilben, Zäsur nach der s iebentenund v ierzehnten S ilbe.
Eine dolanisehe Werterliste.
Von
A . v . Le Coq (Berl in) .
Gerne hatten w ir dem Ve rfasser v on „Barlaam und Joasaph
“
eines der Bl ätter der manichäisehen Bodisavlegende gew i dmet, w iew ir sie un ter den tü rkischen MS S . aus Chotseho gefunden haben.
Lei der hat e ine w iederhol te S i ch tung d ieser MS S . uns überzeugt ,daß w ei tere F ragmente dieser Legende n i ch t mehr vorhandens in d ; w ir müssen uns daher ents ch l ießen
,e ine b ei unserer letzten
Reise nach Ost-Turkistan aufgenomm ene Liste angeb l i ch nur bei
den Dolanen v on Mara lbas ch i gebräuch l i cher türk is cher Wörterals bescheideueren Bei tr ag darzubringen.
Das„Dölän“
(o öj o ) genann te Volkchen bew ohnt das
ganze Geb iet zw i s chen Faiz_
äbäd (östl. von Kasehgar) und Aqsu ;am stärksten vert reten s ind sie in der k leinen S tadt Mara l bas chiIhr U rsprung ist dunke l ; n ach ein igen sol len sie Kipts chak-Kazaksein (G r en a r d) ; an dere schreiben ihnen einen mongo l is chen Ursprung zu (F o r sy t h).
Forsyth bringt die ausführliehsten Nachr i chten über diesedem An s chein nach sind d iese Nachrichten aber n i ch t bei
den Dolanen selbst,sondern hauptsäch l i ch bei der tü rkischen Be
1) Naeh Gr e n a r d , Mission seient ifique dans la Haute-A sia (Paris 1898)
II , p. 306 sollen Dö län auch in Yärkänd, Käshgar , S chäh-yär und Kuda,sowie in der Gegend von Köria vorkomm en. E r nennt sie
„douläu“
. W ir
haben deren nur im oben angegebenen Geb iet angetroffen . S h aw , Reisenach der hohen Tatare i (Jena 1876) p. 28 , nennt die „
Duläns“einen musel
man ischen S tamm räub erischer Halbnomaden . Heute s ind sie j eden fal ls som ilde w ie die üb rige türkische Bev ö lkerung.
S ir T . D. F o r s y t h , Report of a M ission to Yarknnd in 1873 (Cal
cutt a 1875) p.
1 54 A . v . Le Coq
ges ch i l derten unterirdi schen Hütten , aber diese w erden ebensogutv on Kaschgarern als von Dolanen benutzt. I hre Abs tammungvon den „
Qalmaq “oder Mongo len w i rd zwar legendenmäßig über
l iefert,aber es feh l t an jedem Bew e i s dafür. Die Frauen unter
sche i den s ich von den ü brigen e ingeborenen We ibern, die als
K0pfbedeckung die k leine türkis che e tw as spi tzige Mütze (börlcel fi ) bevorzugen, durch die Benutzung w e ißer oder farb igeropftücher .
Der Name „Dol“ (für Döläu) und se ine Bedeutung ist uns n i cht
bestät igt w erden . Auch haben w oh lhabende Dolanen,deren es v ie le
gib t,ke ine S chw ierigkei t, s i ch m it T ürkhWeib ern zu vermäh len.
S ie Sprechen den in Mara lbasch i üb l i chen Dia lekt der türkischenSprache ; er en thäl t e ine Anzah l Wörter , die uns als dolauische
Wö rter beze i chnet w urden und deren Aufzah l ung fol gt. D arunteri st besonders der von den Dolanen bew ah rte a l te Name der S tadtMara lbasch i
,näm l i ch Baröuq , von Interesse. Die S tadt Baréuq
w ir d von den ch inesi schen Geographen in die Gegen d v on Maralbasehi ver legt ; vie l le i cht s ind die ausgedehnten u nd z. T . e inerfrühen Ze i t angehörenden nördl i ch und süd l i ch v on der Landstraßezw i schen T schär-Bagh und T um schuq ge legenen Ruinen die Restedes a l ten Baröuq, dessen Name in der Mongolenzeit als Name(oder vie l le ic ht Ti te l ?) e ines u iguris chen Fürsten Der
Name Baröuq , als e iner im Distrik t Yarkänd ge legenen S tadt w ara l so den Chinesen b ekann t au ch findet er s i ch aufä l teren modernenKarten als Synonym für Die S tadt m uß e ine gew i s se Bedeu tung gehab t haben , denn der Colophon e ines spätentürkis chen b uddh is tis chen Textes ausMurtuq (III . Turfan-Exped i tion)besagt, daß dieser Text aus dem S anskri t in die „
Baröuq-Sprache “
überse tzt w erden sei.
Die sog. delanischen Wörter s ind, abgesehen von Lehnw ortern,
augens chein l i ch eben fa l l s türkis ches Spra chgut.B r e t sc h n e ide r , Mediaev a l Researehes I, p. 269 if. Nach dieser
Quel le w urde Chotseho damals v on e inem Gouverner der Kara-Kh itai verw altet, so daß viel le icht Maralbasch i in d ieser späten Ze i t noch einmal e inewicht i ge S tadt w ar .
P l ay f a i r , Geograph ical Dict ionary of C h ina (Tokyo s . a .) p. 255.
L an ds de l l,Ch inese Centra l-A sia, London 1898, Karte in Bd. I .
Ferner A l l g em. H an da t l a s , We imar (Geograph. Inst .) 1846, Karte v on
A sien von Wey l an d und K i e pe r t.
E ine dolauische Wörterl iste 1 55
W o r t e r l i s t e .
c iliqa a l te re S chw ester (sie ! ) Li .xb larsla
’
n junge Ka tze (Löw e srr p.
a'
sgö, dsqü Hängedr eieck zum Abste l len von Mi l chtel lern etc. (Kaschgar ki lak M )
öta’
S ommerlager (sonst yailaq u. ?ilgig )öta
'
n Brennho l zör u
'
nsäl gesteppte Decke (zum Darauflegen)usqä
‘
q g roßer Löffe löyä
'
l S ohnägdüdü
-m i ch habe geschla fen (sons t uxladum)els‘it Hun d
bäöuq Name der S tadt Maralbas chia rougbäsqö bäsqü Le iterbäyäq Bindeband am Rock (äapdn), sonstbötulä
‘
g junges Kame lbürdlgi der Kaschgar er
bezü‘
q Ka lb
tdka (sie ! ) ausgew achsener Ziegenbocktälla jeder in Tuch , Papier etc. gew icke l ter Gegens tandtöya
'
m S atte l decke (F il zunter lage) (sie ! )
1) Dies W ort kommt in der F orm „asiän
“auch in Tur fan in derselben
Bedeutung vor .
E s ersche int fraglich , ob die E rsetzung des Voka ls „u
“ durch „a
“
in so lchen W er ten w ie otun, 0yul , toyum , qozuq etc . eine E igentümliehkeit
des dolauischen Dialektes ist w ir haben otäu auch in Güma (Qarghal i q)gehört.
1 55 A . v . Le Coq
t üizgürak Pferdeglocke
Nage l (F inger, Fuß) (sons t t'1'rnaq
EZ
gügdn j unge F rau (mit e inem[dies Wort w ir d in Kaschghar au ch äölccin
,äauka
’
n
gesprochen, von Geb i ldeten aber geme inh inof);
ges ch r ieben . Es sche in t das persi s che gawan —j ungzu sein mit dem Wechsel , im Turk i, von zu
06786,66 317 um den Leib getr agenes Tuch (sonst gaylig
c'
dpta (sie ! ) großer Brotfladenorltc
' f/c Hemdbesa tz der F rauen
o'
r'
illa Zimmerdecke (sons t 533 1)
hffdda a l tere S chw ester
ze'
rda gekochter Reis (Pers . vgl.
de lla a l te F rau ‚J.)
ddfigalc'
ag F is ch (sonst balig, (sie ! )
sciiganc'
zilc Wiege (S ie ! ) VJ) -.
S \3xw
soyu öag e . A rt Hol zeimer (aus e inem S tü ck)soipä
'
q, qöza’
g hö l zerner Nage l , Pfloc-k
525ä roher Baumw ollstofi° (sonst xäm , Ls
1) Auch in Turfan geb rauehlich ; im Westen von Kutsehä an ist sonst
die Aussmaehe tökäu,(zaukän gebräuch lieh .
Mythologiscbe Etymologika.
Von
Jacob Wackernagel (Base l) .
1 . aweet. ap a o é a
bezei chnet e inen Damen der Dürre, der den Regenspender T 1stryab ekämpf t und im Kampfe s ch l ieß l i ch unter l iegt. (J a c k s on ,
Iran .
Grundr . H 66 1 5 57 , J u s t i,Handbuch 23 und Ba r th o lom a e ,
Altiran. Wörterb . Sp. 7 2) ste l len den Namen zu der indogerm .
Wurzel zur die w ie in griech is ch &cpeöw m it dem Präverb ium
indog. apa verbunden w are . Hiergegen spr i ch t zw e ie rle i :l . Die Wur zel as feh l t dem Irani schen sonst vö l l ig ; denn
daß iran.„U ntergang, T od“
(neupers. bei) dam it zusammenhange, w ie eins t s chon Bu r u ou f annahm
,ist ganz un
glaub l i ch .
2. Übera l l , w o as vorkomm t,bedeu tet es n i cht
„dörren,
trocknen“
,son dern b rennen, sengen“
(ai. ö_sa ti gr. offer lat . ürit) ;
die S ippe von griech . azieg „
dür r,trocken“ hat b ekann tl i ch n i ch ts
dam it zu tun.
Wenn der Name e ines Damons,der (w enn au ch in negat iver
Wei se) m it den h imm l ischen Gew ässern zu tun hat, mit ap be
ginnt, w i rd m an an Zusammenhang mit ap „Wasser“ denken ;
so ist er dann au ch im Dätastän i Dänik als äp 65„Wasserted“
gedeutet. Dies l etzte geht nun freil i ch ni ch t. Aber soba l d w ir
das angeb l i che des Namens w ie in as“
a usw . als Entste l l ungvon uhr (aus indoiran .
_
r t) betrachten un d apaoäa demgemäß in7 11 1152< zurückumschreib en
,ist e ine ganz e in fache, sofort ein
leu ch ten de Etymologie zur Hand . J u s t i (Handbuch 23) hat r i ch tigbem erkt
,daß Apaoéa die Ro l le des vedi schen Vrtra spie l t. v
_
r tr a’
ist nach dem Zurü ckhal ten (vr der Wasser benannt : RV. VI 20, 2 °
Mytho logische E tymologika 1 59
effr a'
m apd ra ur im msam (dasse lbe , nur m it anderer Wo rt fol geI I 1 4
,I V 1 6
,7 IX 6 1
,22 r
_
r tr <'
iya brinta ve vacm°
vä°r_nsam m ahir
apcib. En tsprechend he ißt es v on ihm apd v_
r tv'
i rdj aso
bud/m a'
m (féaga t. Umgekeh rt w ird zu Indra gesagt RV .
dvä,s_rj o nivr tü'
h sa'
r tami aprili und IV tvdm v r tän ar inä indra
slndlzün . Demgemäß he iß t Vrtra RV. 1 und VIIInadi vf
-t S tröm e hemmend“. Ebenso gu t hätte ihn ein ved ischer
Dichter aba_
ft (analog geb i l det w ie ap-se
‘
ab-j ci oder *apavft
(ana log m it AV . dpa-v an t nennen können. Und so, d . h . altiranisch
etw a hieß in Wirk l ichkei t der T rockenheitsdämon der
Zoroas trier. Daß im j üngern Aw esta neben dem Akkusativ apao.fam,
w orin die ursprüngl i che S tamm form erhal ten se in kann, der Nom inati v apaes
'
ö,a l so Übergang in die a-Dekl ination, vorl iegt, macht
natürl i ch ke ine S chw ierigkei t.Den Weg zu d ieser Deutung hat m ir A n d r ea s gew iesen.
2. A p s a r ei s
Für den N amen der Apsarasen erw ähnen B öh t l ingk und
R o t h v ier Etymologien . Wirk l i ch in Betracht kommen e in zig diezw e i ers ten : ap saräs
„im Wasser laufend“ (so O l d e nb e r g
,
Re l ig . des Veda 25 1 und Pis ch e l,Ved. S tud . 1
,79) und a -
psara'
s
„gestal t los“ (so e inst W eb e r
,Vaj. S an. spec . pr im . 1 8 A . Ind.
S tud . H o l t zm an n,Z DMG Später auch P is c h e l ,
Ved. S tud . 3, 1 97
Gramm atisc h mög l i ch i st nur die zw e i te. Kompos ita m it e inemHintergl ied auf -as s ind nur oxyton, w enn das Vordergl ied aus
dem privativen e(u ) bes teh t,und sind es dann me istens ; die Bei
spie le und Gegenbe i spie le aus den akzentu ierten Texten bei
Kn a u e r,KZ 27
,20 fi
’
. Außerha lb dieser e in en Gruppe hat -as
in Komposita nie den T on . Im Griech is chen hat von den Derivati vkompos i ta aus die Oxytonese d ieser Bi l dungen w ei ter um sich
geg ri ffen . (Ve r f. , A ltind. Gramm . 11 5 1 1 5 (1. Anm . neb s t 295,g 1 1 4 bp
’
; Gött inger Nachr . 1 9 1 4 ,
Neben pedr as „Gestal t“ gab es schon in v edischer Ze i t ein dem
präkrit ischen ohara entsprechendes psara w ie das v on L a nm a n,Neun
Inflexion 546 und P i s c h e l,Ved. S tud . n icht richti g beurte i l te sap sarä'sah
„gleichgestaltet“RV . I 168
,9 ° erw e ist ; vgl. A ltind. Gramm . 11 5 1 15
(1. Anm .
1 60 Jacob Wackernagi
e l
Begr ifi’
lich v o l l ig ev i dent ist fre il i ch auch d iese zw e ite Deutung n i ch t. Man könnte „
ges ta l t los“ auf die Fäh igke i t der Apsarasens ic h zu verw ande ln und pl ö tz l i ch zu vers chw inden bez ieh en. Ab erpaßt ein derar tiger Nam e für Weiber, die gerade du rch ihreS chönhe i t berücken ? S o m ag, immer mit F es tha l ten an der not
w endigen Zerl egung a -
psar cis e ine w e i tere Mögl i chkeit w en igs tenserw ähn t w erden .
Die Deutung „ges ta l tlos“ hat den Vorzug, daß sie an e ine
in Veda und Präkrit lebendige Bedeutung v on psa'
ra(s) anknüpft .
Imin erhin kommen als Grundlage für e inen myth is chen Namenauch so l che Bes tand te i le des indogerman i s chen oder indoi rani s chenWo rts chatzes in Betracht
,die dem Indischen ver loren gegangen
s ind . Nun bes itzt das I ran is che e inen S tamm f3a“rm a“
„pudor“(jAw est. fäaram a phlv . äarm neupers. 5erm css. äfsarm : H o r n ,
Grundriß der up. Etym . n“ Indoiraniseh konnte es neben
psa“rm a
“au ch ein psci“ra“
s in glei cher Bedeu tung gegeben haben .
S ind die Apsarasen , w ei l verfüh reris ch und s ich fre i h ingehend,
als die des S chamgefühl s en tbehrenden beze i chnet? Vgl . Mbhär . Iap ea r a. m ena lrä nirdagä n i r ap a t r ap ä.
Die eroti s che S ei te ihres Wesens tr itt in der spatern Literaturbeson ders stark hervor. H o l t zm an n
,Z DMG 33
,644 : „
Das Vor
b i l d zu den Apsaras des Epos s ind die frei lebenden,kunst
erfah renen Hetären“. Danach kann man s i ch vors te l len, w as das
vom Vär ttikakära zu P. IH ge lehrte apsar äga'
t€„si ch w ie e ine
Apsarase benehmen“ bedeutet haben w i rd , und man ge langt, w enni ch recht sehe, zu r r i chtigen Deu tung e ines s cheinbar w e i t ab
l iegenden a l t indis chen Wortes . Das U nädis . kenn t ein sons tn i ch t bel egtes
_
r colmrä,das nach dem Kommentator „
Hure“ bedeutet.Eine Etymologie für dieses
— verhäl tn ismäßig alt und gut b ezeugteWer t ist bis j etzt me ines Wissens n i ch t gefunden. Nimm t manan
,nach dem Muster v on präkr . acche ti aus ai. roohati (P is ch e l ,
Präkn'
tgr . 340 S 480) und ha lbw egs nach dem von präkr . aooha
neben r iecka aus ai. ;‘ksa Bär“ sei
_
r ooharä aus e iner m it acc];
an lautenden Wo rtform fa l sc h präkritisiert, so erhal ten w ir als
dessen Ur form aoobarä,und dies i s t eben die Präkritform für
apsarcis (P is ch e l , ZDMG 52,
Präkritgramm . 225
Von Einfluß auf diese fa l s che Umsetzung könn te das a l te vedis cheW ort für „
Fesse l“ gew esen se in : g'l‘
5dlä in der VS .
, 3'
CC/t ti7‘ä AV.,
Zum Kautiliya Ar thaéastra.
Von
E . Muller —Heß (Bern) .
Jul ius J o l l y hat ZDMG 68, p. 35 1 if. e ine Anzah l A hnlichkeitendes Kautiliya arthas
'
ästra mit Vätsyäyana’
s Kamasutra zusammenges te l l t
,aus denen ge fo l gert w erden kann , daß das letztere sie
aus dem ersteren en tlehnt hat,da das Kämasütra zw eifel los das
jüngere v on den be i den ist.Auf p. 354 b efinde t s ich ein kurzer Ab schn i tt
,betite l t „Kuuste
und F ertigkei ten “
,der s ich m it den 64 Kaläs der Inder beschäftigt.
Da die Literatur über die Kaläs eine ziem l i ch umfangre i che ist,so m ö chte i ch zu den von Jo l ly h ier angeführten techn is chen Ausdru cken aus dem Kautiliya arthas
'
ästra und aus dem Kärnasütra
die Paralle l s te l l en aus den üb rigen h ier in Betrach t kommendenTexten ergänzen d beifugen
1 . r a tnapariksä die Kun st Edel steine zu schatzen“ findet s i chals 25 . Kalä. auf der Liste der Kadambari (ed. P e t e r s o n p.
In der Jainaliste des S amaväyasütra entspr ich t der Ausdr uck m anilakkhanam (Nr .
2. dhätuéästr a en tspri cht offenb ar dem dhätuväda des Kämasütra.
Auch in den andern Listen findet s ich der Ausdruck dhätuväda ‘)
„Probierkunst
,Meta l l urgie “
(S amaväyasütra N r . näm l i c h in
Rämacandra’
s Liste (Nr . 22) und in den Kalpäntarväcyäni (Nr.Das S amaväyasütra h at dhäupägam (Nr.
3. västukam des Arthas'
ästra entspr ich t der väst uvz'dyä des Kamas .und dieses findet s i ch noch in der Liste der Kadambari (Nr. Die
Bedeu tung be ider Ausdrü cke i st „Baukunst “ . Vgl . auch vastupagäkgä
Divyävadäna p. 26 .
1) dha tu vädin (Metal lurgist) Mahävyutpatt i 186 . 84 .
Z um Kautiliya A r thuéäst ru 1 63
4 . Iak.«-/am
_
u nga a l le in komm t in den Listen der Kalzi s n i cht v or,
sonde rn nu r in Ve rb indung m it pum ,< a
,stri usw . im S amaväyasütra,
dagegen findet es si ch al le in im Brahmaj z'rlasutta p. 9 und Jat. I . 87 4 .
Rhys Da v i d s übersetzt„fortune- te l l ing from marks on the body “
und d iese Bedeutung paßt au ch für unsere S te l le .
5 . afigu vitlyä komm t in der L i ste der Ka lds eben fa l l s n i chtvor, dagegen Brahmajfrlas. p. 9
, Jat . I . 290 , II. 200,250
,Divya
vadana 630 . 22, Varähamihira’
s Brhatsarnhitä cap. 50 . Die Be
deutung is t „Vorhersagen der Zukun ft e iner Pe rson “. ahgavz
'
jj äpätlzaka
Prophet “ s teh t Jat . I I . 21 u nd a7'
4yq ja Kacc . ed. S e n a r t p. 1 9 1 .
6 . j amb/zal'
a vidyä s teht n i ch t unter den Ka läs . Im S anskrithaben W ir die Form j am b/taka und j _mnb/zaka ‚ nach P. W .
„e ine
Art Zauberspruc h zur Bannung der in Waffen hausenden Gei ste r “ .
Vgl . Nayadhammakahä 1 30 .
7 . an taracakr a s teh t n i ch t unter den Kaläs,komm t aber in
Varähamihira’
s Brhatsam hitä cap. 86 vor . Die Bedeu tung ist :„Al les w as zu den 32 Zw ischenräumen der Wind rose gehört “ .
8 . gitam „,Gesang“ steht in Yaéodhara’
s Liste (Nr. I) und inden Kalpäntaraväkyäui (Nr . Das S amaväyasütra hat giyam (Nr.
9 . vädyam „ Spielen musika l ischer Instrum ente “ steht in Yaéodhara ’ s Li ste (N r . das S amaväyasütra hat vä
'
iyam (N . Vgl .Mahävyutpatti, 21 8 . 7 .
1 0 . 7rr iyam „Tanz ”
Yaéodhara Kalpäntarväcyäni (N r .Das S amaväyasütr a hat na tta 7
_
n (Nr. ebenso Nayädhammakaha1 1 9 .
1 1 . nägyam „e ine andere A rt Tanz “ Lalitav istara (Nr .12. güdlzalekhyasamj fzä im Kautiliya en tspr i cht dem m lecchz
'
tam
güdhavastuman trär tlza eine v erab red ete Sprache, die bei gehe im en Beratungen d ien t “ im Kamas . p. 39 Nr . 4 6 (S c hm i d t ’ s Übers . p.
Vgl . güdlzam an ira (Pläne gehe im ha l tend) Srr'1gäratil. I. 39 .
1 3. P ä;hya im Kau tiliya entspri ch t dem sampä_tlzya im Kämas.
(Nr. Im Kata log der Bodleyana von A u f r e c h t p. 21 7 3 16
hab en w ir da für e ine ande re Lesart, näm l i ch samväCyam ,die vie l
l e i ch t sogar vorzuziehen ist,denn die Bedeu tung des Wortes i s t
ohn e Zw ei fe l „die Kunst der Konversation “.
1 4 . aksam des Kautiliya entspr i ch t dem aksar amugtikäkat/zanam
des Kamas (Nr. S c hm i d t (p. 44) übersetzt : Das Erzäh lenverm i tte l s t der F ingersprache“
1 64 E . Müller-Heß, Z um Kautiliya Ar thaéästra
1 5 . viqu'
z„Lau tenspie l “ findet s i ch n i cht im Kamas .
,dagegen
im Lalitav istara (N r. 36) und in den Kalpäntarväcyäni (Nr.1 6 . venu F l ö te “
und 1 7 . m_
rdanga „Tromm e l “ finden s i ch
n i ch t im Kamas.1 8. gandhamälya „
Berei tung von Woh lgerü chen “ im Kautiliya
entsmicht gand/zayuktz'
im Kamas . (Nr . 18) und Lalitav istara (Nr.Das Samaväyasütra hat gandhaiu ttz
'
(Nr. Be i de Ausdr ückefinden s i ch auch Mahävyutpatti 286 . 6 und 245 . 696 .
1 9 . sampädana des Kautiliya hat ke in A equivalent im Kamas .noch in den ande ren Listen . Die Bedeutung ist eine a l lgemeinedas Z ustandebriugen, Bew irken .
“
20. sam vähana „Massage “ findet s ic h n i ch t im Kamas ., dagegenin Yaéodhara
’
s Liste (Nr . Vgl . Mahävy utpatti 245 . 37 7 , 38 1 .
21 . vaiéz'
kalcaläj flänäni im Kant. entspri cht veéyäyogäéca vaiéz'
ke
tm Kamas . p. 364,6 .
S c hm i d t übersetzt diese S te l le ganz ri chtig : Die Beziehungzu den Hetären ist im Abs chn i tt üb er die Hetaren ges ch il dertw orden .
_
Ganz versch ieden davon ist das Wort v es’z'kam,w e l ches
w ir als Nr. 7 4 auf der Liste des Lalitavistara finden . P.W. korrigiertdies m it Unrecht in vais
'
ikam . Veéz'
lcam bedeutet en tw eder „die
Beschäft igung e ines Va1sya “oder es ist die Bezei chnung eines
philosoph is chen Sys tem s w ie Käv ilam,logäyatam,
satthitantram .
In der ers ten Bedeutung finden w ir das Wort Mahävyutpatti 21 6 . 2,
w o der fol gende Ab schnit t (21 6 . 3) das synonyme värttä b ringt .22. samj fi äbhäsäntaraiflä; ca stziyas im Kant. entspr icht dem
deéabhägäm; fi änam „Kenntn i s fremder Sprachen“ des Kämas . (Nr.Das Wort findet si ch au ch in Rämacandr a’
s Liste (Nr.Die Listen der Kaläs s ind zusamm engeste l l t in der Dis sert ation
v on Dr. A. V e n k a t a su b b iah : T he Kaläs. Madras 1 9 1 1 . .Vg1. auch
JRAS 1 9 1 4, p. 355— 367 .
1 6 6 G . A . v an den Bergh v an E ysinga
w oorden . Nu is het vacantie en ofsehoon ik m ijn voor en na
m iddagen besteed om eens hard te w erken , in den avond kan i knu m ijn aehterlijke eorrespondentie inha len .
Ik begin m et U hartelijk te danken voor Uw goede w enschenOp m ijn geboortedag. Ik ben m ijn laats te vo l le jaar als Professoraan de U niversiteit ingetreden . Nog een c ursus en dan is het
nit . Ik kan’
t m ij nauw elijks zelf verb eelden . Maar de w et
spreekt en men moet gehoorzamen.
Al v indt gij v oor Uw onderw erp n iet al les w at gij geh0 0pthad
,toch zal het v erblijf in Munchen en het hooren van zulke
mannen als Kuhn en Krumbacher voor U v an groot nut zijn .
Be i de ontmoette ik m et groot genoegen te Rome, Kühn als oudenbekende en m etKrumbac-her maakte ik daa r kenni s . E en hoogst
in teressant man . Aardig dat gij zijn S em inarium moogt b ijw onen.
Z et er UW beste beentje maar voor.Kuhns onbekrompenheid had i k w el v erwacht.
’
t Is voor Ueen schat
,w aaruit vr ij w at te l eeren is. Ik ben geheel met hem
ecus,dat Indische invloed Op het oudste Chr istendom door Perzi'e:
„verm i ttel t“ kan zijn, en ik ga nog verder, namelijk daarin, dat
ik vooral een machtigen inv loed van den perzischen , doch inWest-Azie zeer gew ijzigden Mithradienst Op het Christendom hoogstw aarschijnlijk ach t. Vooral in de apokryfe Evange l ien kom t datnit. In elk geval w aren Mithracismus en Chris tendom heftigemededingers in
’
t heele Romeinsche Rijk. Mogelijk heeft de Gnos isin Kle in-Az ie daar ook w el den invloed van ondervonden . Maarik moet b ekennen , dat i k v an de Gnosi s te w e in ig studie hebgemaakt om h ier met eenige zekerheid te spreken , en ik zou
daarom Kern ’ s gevoelen n iet durven bestrgden. De Logos i s in elk
geval meer perzisch dan ind is ch . Denk aan Honover (Ahuna vairya).Intusschen ik gee f nu ju ist in dezen cur sus co l lege over
het Buddhisme w ord ik w eer s terk getroffen door de w onderbare overeenkomsten tusschen de b uddh isti s che traditie en de
christelijke, m eer dan in de leer der be ide godsdiensten. E n het
grootste dee l v an die buddhis ti sche traditie is to ch ouder dan hetChri stendom . T oevallig kan dat a l les n ie t zijn .
Met m ijn bes te w enschen voor 1 900 en voor Uw verdet estud ie'n , steeds gaarne
de U w e 0 . P. Tie le.
Tie le über Christentum und Orient 1 6 7
Der vors tehende Brie f w eckt in m ir die Erinnerung an ein
Privatgesprä ch , das i ch später m it Tie le in se inem A rbe i tszimmerübe r Joh . 1
,V . 4 6 ff. führte . Tie le hatte die fes te Überzeugung
die m i ch ganz besonders frappierte, w ei l er s ich immer als
höchst vorsich tiger und gew i ssenha fter F ors cher zeigte daß
Nathanae l kein anderer als der verhü l l te Buddha is t . In me inereingangs genannten Arbe i t habe i ch auf diese Ans i cht kurz angeSpie l t, ohne i hr jedoch be is t immen zu können .
Der Bedeu tung nach s ind diese Namen Nathanae l undDevadattaGo ttesgab e) vo l lkommen glei ch . Devadatta he iß t in der bud
dh istischen Überl ie ferung der Riva le und Verräter Buddhas . Tie ledeutete d ies dah in, daß Devadatta ursprüngl i ch der Bu ddha e inerkonkurrienden S ekte gew esen i s t. Nathanae l un ter dem F eigenbaum (ficus re l i giosa) w äre dann Buddha unter den Bodhibaume .
Bei d ieser Erk l ärung is t zugle i ch die Wil lkür S ey de ls (Das Evangelium Jesu p. 1 69 f.) verm ieden, der Jesu Worte övza 157t ö m)vo vz r]v ohne den ger ingsten An laß in (br dm) r ip! o vmjv veränderte.
Als Buddha noch um die Erleuchtung rang,w ar Ch r istus bereits
im vol len Bes i tztum se ines w underbaren F ernblicks und Tiefb l i cks.Desha lb hat Bu ddha si c h ihm unterzuordnen . Inzw is chen ist demBuddha in vornehm s ter We i se als e inem ‘Israe l i ten ohne Fa l s ch ’
gehu l d igt : der S ieger bringt dem Bes iegten e in en hoflichen Gruß .
Wenn die Z a h n sche Hypothese , nach der Nathanae l =Bartho lomäusis t
,das Rich tige getroffen hat
,so ste l l t der auf Pantänus zurü ck
gehende Beri ch t E useb . H . E . V 1 0,3, w onach Bartholom äus den
Indem das Christen tum und das Evange l i um des Matthäus inhebräischer Fassung gebrach t haben so l l , Nathanae l gle i ch fal l smit Indien in Verb in dung.
Auch w enn man m it m ir immer noch me in t, daß die Nathanae lperikope kaum Anha l t für e inen derartigen Erk lärungsversu chb ietet
,kann man n i ch t verkennen, daß T ieles Annahme etw as
für s ich hat . Jedenfa l l s lehrt das Mitgetei l te uns man ches überdie S te l l ung , die der große Re l igionsh is toriker am Ende seinesLebens zu der F rage : „Christentum und O rient“ e ingenommen hat.
Lat . r éfer f und z'
nfer es f.
Von
L . Su tterlin (Fre ib urg i .
Trotz der mann i gfachen Versuche, über die B r ugm ann , I dg.
Forsch . 8,21 8, und S k u t s c h , Arch . f. lat. Lexikogr . 1 5 , 47 , kur z
und bequem un terrichten, s ind lat. r éfert und in terest noch n icht ganzb efriedigend gedeutet : tei l s h ins i cht l i ch der Lautform (m eä als
Nom inat iv nach S kutsch), te i l s h ins ich t l i ch ihrer Verw endung imSatzganzen (Akk. des Ziel s nach Brugmann), te i l s aber s chon hins i chtli ch ihrer Grundbedeu tung.
1 . Ich kehre daher bei räfert w ieder auf den S tandpunktFritz S ch ö lls zur ü ck (Arch . f. lat. Lex. 2, 213) und sehe in
dessen ers ter S i lbe re den Ab lativ v on res,fasse aber fer t und
desw egen au ch den Ab lati v re in anderem S inne : id m eä rä-fer t
heißt n i ch t „vom S tandpunk t meiner S ache b ringt es etw as ein “
(S ch öll a. a. O . sondern umgekehrt „von meinem Bes itz(von meinem Verm ögen) tr ägt es etw as w eg
“
; es ist a l so gle i chb edeu tend m it unserem „
me iner S ache tut das Ab trag “. Der Ab
lativ beze i chnet al so den Ausgangspunkt (S chmal z, Lat. Syut.und fer re heißt h ier n i cht „ h e r tragen“
,sondern im Gegentei l
D iesen S inn '
haben j a sow oh l die Entsprechungenv on ferre in den . verw andten Sprachen (gr. zbv d’
äg éza lgov xegolv
äslga vzeg q>égov éx n dvzov II. 14 , 429 ; [é'
n og] rpégocev ävagn d€aoazd'
el l ow Od. 8 , 409 ; altind. bhdra tz'
„im Lauf mit s ic h führen ; etwas
fahren, irgendw ohin bringen ; entführen, w egnehmen“
,BöhtI.-Roth
5,205) als auch das lat . ferre se lbs t (P ergam a Verg. ; tefa ta wie:/vum
das j a noch dem gr. (pégew za l äyew an die S e ite ste l ltferre et agere, bei Vergi l auch rapere et fer re. Als S ubjekt zu
denken s ind ursprüngl i ch Ausdrücke für verheerende Ereign isse
1 7 0 L . Sütterl in , Lat . refer t und in ter est
es l iegt dazw isc hen “
(mu ltum in terest„vie l l iegt dazw is chen, is t im
S p i e l , s t e h t in Dann hat zunächst auch der Nom inative ines gew öhn l i chen Gattungsbegrifi‘
es se ine Berechtigung (non guom eä in ter esset loci natura Cie. Att. noch mehr aber der Genet ivder beteil igten Person, der u rsprüngl ich neben dem neutralenNom inati v eines Pronomens oder Adjekti v s
,unter Um ständen auch
neben dem Nom inati v e ines sol chen gew öhn l i chen Gattungsbegrifi‘
es
den Bes i tzer anzeigte (1 heodori niki! in terest „v on Theodoruss teht n i ch ts auf dem Spie l “ , vgl. Cic . T usc. 1 , 43, 1 02 ; si n iki!
interest r egis Curt .) oder das gete i l te Ganze (quan tum rei publicae
in teresset„w ie vie l s tände auf dem Spie l von dem S taate “
; m u l
tum interest rei fam iliaris tuae„ viel s teht auf dem S pie l von de inemVermögen “
,Cie .
‘
fam . 4 , 1 0, der a llmäh l ich aber auch a l leins tehen konnte (inter est Omnium recte facer e Cie. fin . 2
,22 Ganz
in derse lben We i se erklart s ic h s ch l ieß l ich aber auch w ieder derGeneti v des Wertes (anfängl ich mu ltum m agni in terest „
n i chts Bedeutendes i s t in F rage“
,dann non magni interest von Bedeutendem
i st n i ch ts in F rage“
,später auch illud m ea m agni in terest, te u t
videam Cie. Att. Nur das ablativ isehe m ea,tuä usw .
hat interest v on dem glei chbedeutendem räfer t ü bernomm en, m it
dem es s ich ja abgesehen v on a l lem S on stigen gerade auchim Geneti v der bete i l igten Person deckte. Daher heiß t es auchh ier m agis nu lliu s interest quam tua Liv . 24
,8,1 7 ; non iam sud quam
r ei publicae interesse S uet. Caes . 86 , und end l i ch ein fach ohneGenetiv daneben vesträ hoc m ax ime interest Cie.
Gustav Herb i g (Ros tock).
Den Zusammenhang der latein is chen Gattungsnamen barginna ,ba rgina , barginus , bargéna , bar cus, bargus m it den e truskisch - lute in is chen Eigennamen B arginna , Bargonius, Par coniu s, B angias‚
B argus hat W . S c h u l z e,Z GLE 7 3 — 7 5 erkannt und
au ch die etruskische Herkunft der b isher ganz dunkeleu lateini
s chen Worter i st dam i t s i chergeste l l t. Viellei ch t kommen w ir im
e inze lnen noch ein paar S chri tte w ei ter.Was w ir an latini s ierten -n -Bi l dungen vom etrusk is chen
S tandpunkt aus zunächst erw arten, i s t in Gle i chungen ausgedrücktfo l gendesba rgi -na Porsi » na T arqut niu s Caeci-na efl i -cere
* bargén na F orsen -n a T a rgu én-na Caesén—ninus efi éc—tus
Mit andern Worten : bei etrusk is chen Typen w ie tarxnci,tar cna
,kai/ma
,ceicn a und darnach auch *
parena ,*(pursna ((plire-e3 na
W . S chu l ze 90) w i rd die als unlateinisch empfundene Lautve r
b indun g Kon sonan t pl u s n,genau w ie in la tini s iertem m ina , tee/t ina
aus gr iech is ch_u va
,zéxvn, du rch Vokalentw ieklung zw i s chen Kon
sonant und n dem la te in ischen Munde angepaßt, und zw ar w i rdd ieser Murme l voka l in se iner Färbung, w iederum genau den ech tlate in i s chen unbe tonten Mittelsilbenvokalen entsprechend , nachdem Ve rhältn is von eßt-cere : efl
'
éc-tu s in ofiner S i lbe m it i , in
Belege für die v on W. S chulze n icht besprochenen F ormen barginns„peregrinus“
CGL V 492,34
, „a lien i generis , peregrinus“ V 562
,28 ;
barcus (mit etr . T ennis neben der Media im latin is ierten bargns) „tardus,
s ine l ingua“ IV 585 , 1 9 , „stultu s, eine l ingua“cod. Casio . 439 5 nach
CGL VI 1 30 .
1 72 Gustav Herb ig
gesch lossener m it e w iedergegeben . Das vorausgesetzte etru sk is chlate in is che Adjekti v-S uffix -enna findet s i ch neben dem häufigerb e legten , im Grunde m it ihm iden ti s chen Gentilnamen-S uffix —enna
,
ein paarma l 1) in der latein i sc hen Überl ieferung, a l so* bargenna levenna sociennns
bargus levis socius
Neben den zunachst zu vermutenden F orm en barg‘
ino,
* bargénna
und dem vo l l ständig zu einem la te in i s chen Masku l inum gew ordenenbarginu s finden w ir nun auch barginna , bargina und bargéna .
Können w ir sie erk lären oder m üssen w ir sie als bedeutungsloseorthographis che Varian ten h innehmen ?
Z n barginnc'
t,B arginna s tellen s ich Typen w ie Am innas ,
A linna,A u linna und noch w eiter latin i s ierte F ormen auf -innins
w ie Aminnius, A linnius, i4 0 ivw og, A tinnius. Erklären können w ir
d iese F ormen gut,le ider s ind sie aber m ehrdeutig
,so daß grund
sätz l i ch zw e i E rklarungsmöglichkeiten offen stehen ; daß uns die
En tsche i dung für die eine oder andere n i cht immer ge l ingen w i l l,
hängt m it unserer Unsi cherhe i t über die Quanti tät e truskis cherMittelsilbenvokale überhaupt zusammen . Denn c tr. -lat . -inna
,
-innins kann aus etr .-ina entstan den se in w ie littera. aus li ter a
dur ch Konsonantendehnung und dam i t verknüpfte Vokalkürzung,es kann s i ch aber auch neben e inem etr .
-ina entw i cke l t habendur ch b loße hypokoristische Konsonantendehnung
?
) Das eineist der Fa l l bei A tinnius
,w o die ursprüngli che Länge für
A ti nius und som i t auch für A tina,A tinas bezeugt ist ; der zw e i te
Fa ll l iegt vor bei°
A olw w g, W O A sinius,und dam it w oh l auch
A sina,m etr is ch ges i chert ist. Zw e i fe l haft b le iben A linna und
A u linna : h ier w e i sen A lienus und A u lienus auf kontrahierte und
daher lange Mittelsilbenvokale bei A lina und A ulina, und hierw äre auch unser bargina e inzuste l len
,w ahren d ctr. alnia l und
1) Z u leoenn a hama levis hama Laber. com . 80 1 bei Geil. 1 6, 7 , 1 1
vgl. S c h u l z e ZGLE 75 . 283 ; zu sociennu s b ei P lant. Anlul. 659 s. S to l z,
Bist . Gramm . I , p. 489 und W a l de s . v . sociu s ; W. S chulze erwähnt 233,w o er die E igenamen S acenn iu s, sncnei
,zugna samt S ippe behandel t, die
Zwitterb i ldung n icht.2) Verf. , Kleinasiat .-et r. Namengleichungen (München 19 14) p,
31 f. und
W . S c hu lz e , ZGLE 422 ff.
1 74 Gustav Herb i g
Also : bar -gem he ißt es (w ie indi-gena , alieni-gena), n i ch t barginna(oder bargina), von e in em
,der einem bar —(ba ric um) gen -(a s) en tstamm t.
Beachte dabe i au ch den‘
die Bevorziehung v on bar -géna vor
barginna begründenden Konj unktiv des re lati ven Nebensatzes inden codd . B und C . Heutzutage w ürde Caper sagen : bar-gäna i s tdur ch Haplologie oder S ilbendissim ilat-ion m it nach folgender Synkopierung des m ittelsilbigen
-i aus*bar -bar -i-géna ents tanden , und
er w ü rde v ie l lei ch t als ge lehrter Mann noch auf das barr i-genae
„per egr inae“ im CGL . IV 590
,4 3= V 59 1 , 68 als e ine gl ück lich
erha l tene Übergangsform Mir sche int d iese „Übergangs “ -form
,w enn auf sie überhaupt Ver laß i st, vie lm ehr erst! der
fal schen Etym o logie i h r ephemeres Dasein zu v erdanken,oder
w iederum modern ausgedrückt : sie hat den i hr gebührendenWarnungsstern (
*bar -i-gena) ver loren und i st m it e iner w eiterenEn tste l l ung -rr statt -r ) unter die Glossen geraten . Wie dem
au ch sei : die S chre i ber der Handschri ften B und C, die bargi-
na
an die S tel le v on bar -gäna setzten und an der zw e i ten S te l lezw isehen bargina und barginna s chw ankten, haben zw ar den S innv on Capers Hexameter n i ch t vers tanden und uns se in Verständni sers chw ert
,uns aber gl ei chze itig die Para l le l formen über l iefert aus
denen deutl i ch hervorgeht,daß Capers late ini sch-indogermanrsche
Etym ologie bar -gäna eben fa l s ch“ i s t,
w ei l j a gerade d iesesS ehw anken in der S uffixform neben anderm die etruski s che Herkun ft erw e is t. Ob dabe i Caper oder se ine Gew ährs leute ih rbar -gäna neb en dem üb l i chen bangina der Etymo logie zu l iebekonstruierten, oder ob sie ihr eine w irk l i che zw i s chen bargina
und * bargenna s chw ankende orthographi s che Varian te bargéna zugrunde legten
,ist verhäl tn i smäß ig gle i chgü l t ig .
Ob m it Capers Etym o logie v on bar -gina aus* barbart-géna
auch die Bedeutung bar baras zu fa l len hat,d . h . a l so, ob diese
ledigl ic h auf der fa l s chen Etymo logie beruht, w is sen w ir n i ch t.Wenn das Grundw ort bar cus
,bargus „
tardus,eine lingua“
oder
1) Im T hea glass. emend CGL VI , 130 setzt G . G o e tz
,w ie ich nach
traglich sehe, an den S chluß des A rt ikels barginn s ein„bar bar igenae?
“ E r ist
w ohl durch die Zwischenform barr igena und Umschre ib ungen w ie alien i
gene zu der g leichen E tymo logie w ie Caper gekommen . Nettlesh ip, Con tr .
393 und -Boensch,Co l l . ph i l . 201 , die er z i tiert, s ind m ir h ier n icht
zugän gl ich .
Barginu 1 7 5
„stultus“
, ..mgenio carens " bedeutete (CGL VI a l so etw adasse l be w ie lat. ba lbu s stamme lnd , la l lend “
,so w ar von ba-rcus
,
bargus zu ba rba r as ja auch der Bedeu tung nach ke in größererS ch r itt als v on ba ibus zu ßagp
’agö
-
q vog „von undeutl i cher
S prache “. Die E igennamensippe B arginna usw . mag dann auf
e inem a l ten Spi tznamen beruhen, der si ch m it nhd. S tamm ler,
lat. B a tbzw , Balbins und dem ai. Mannesnamen B albüthala. psychologisch v ergle i chen l äßt . I st die fü r barginna w ei ter üb er l ie ferteBedeutung range
-mögog, fa l l s sie auch dem Eigennam en zukam,
etw a ein Beru fsnam e gew orden w ie das nhd. T räger , das ja , w ie
Gräber me ist auf ] b tengrfiber , au ch auf T oten — tw yer zu rü ckgehenBei der s
’
7.q agcé w urde die Lei che auf dem selben leotu sh inausge tragen , auf w e l c hem die rrpo
'
ö earg s tatt fand . E in Wagenw ar w enig üb l i ch , r exgo
- rpa'
goe w aren in der Rege l freige lasseneS klaven. Hat man nach der grausamen Auffassung füherer Ze i tenba rgi, d . h . Bl öde und Ha lb i d ioten , zu d iesem Ges chäft verw en det ?Die Bes chäftigung m it den Toten mach te unrein. A ls Beru fw u rde sie dann naturgemäß nur ausgeübt von hom ines vitiasae
gen tis, von „ unehrl i chen Leuten “
,als w el che in der oben ausge
sehriebenen Glosse zu Capers Hexameter die barginnae beze i chnetw urden . Es träfe s i ch n i cht übe l
,daß
, w ie i ch an anderer S te l lezeige , auch die lanista0- lanistr ae, die als Glad iatorenme i ster und
Henker gle i ch fa l l s ein unehrliehes Gew erbe betre iben, nach Überl ieferung und Wortb i l dung ebenso auf Etrurien h inw ei sen .
He in t z e , Deutsche F am i l iennamen 3 (Hal le p. 1 50. 26 1 .
Ein slavischer Gottername.
Von
E . Berneker (München).
Die U berlieférung vom rel igiösen Leben der he idn is chen S lavenist trümm erhaft. Chroniken und andere a l te S chri ftw erke
,von
Christen und zume ist von Landfrem den , Sprachunkundigen ver
faßt,nennen zw ar e ine ganze Anzah l von Gö tternamen
,beri ch ten
aber w en ig vom Kul t dieser Gö tter u nd noch w en iger über ihreArt. Die Etymologie , die s i ch dort
, w o die mythologischenQuellen re i cher fl ießen
,mit e iner Nebenro l le bes che iden muß,
darf h ier,w enn sie Erfo l g hat
,auf e inen Ertrag hoffen, der über
die unm i tte lbaren Nachri chten h inausführ t.Un ter den Göttern der Ostslaven w ird S tribogs genannt. S e in
Name finde t s ich in j ener für die slav ische My tho logie so w i chtigen S te l le der Kiever Nestorch ronik (aus dem zw ö l ften Jahrhundert
,a l so rund zw eihundert Jahre nach der Christiauisierung
Ruß lands) unter dem Jah re 6488 980 (Povést’
vremennych lét
po Lavr . sp.
,Izd. Imp. Arch . Komm. 1 9 1 0, p. I nac
”
a knj aéiti
Voladim era va Kieve edin s,i postavi kumiry na cholm u one
”
dvor a
ter emnago : Per una dr evj ana , a glavn ega srebren u,a usa zlats
,i Chorea ,
Daäsboga (v. i Dai sbaga), i S tr iboga, i S imar sgla , i Makaäa. érj aehu
im o,nari c
'
j uäc'
e j a bogy, i pr ivo$achu syny svoja i dsääeri, i érj achu
bésomz,i oskvernjaclzu sem tin trebam i svaim i
,i oskver nisja krovsmi
eem iia R uska i cltalm 0 —ts.„ Und es begann Volodimer (geme int ist
Vlad imir S vj atoslav iö, nachma l s ‚der He i l ige‘
,Groß fürst von Kiev,
980 — 1 01 5) a l le in in Kiev zu herrs chen,und er erri chtete Götzen
b i l der auf e inem Hüge l außerha l b des Hofes des Pa lastes : den
Perun,aus Hol z, doch m it e inem Kopf aus S i lber und einem Bart
aus Gold,
“
den Chors,Dai bog, und S tribog und S imargl und die
Mokos. U nd man Opferte ihnen , indem man sie Götter nann te,
1 78 E . Berneker
Einw ände fes t, daß das Wort für hundert “ (s lav. seta) w ie v on
den F inno-Ugriern und den Krimgoten au ch von den S laven aus
dem Iran ischen übernommen w orden ist . Dem ai. bluiga in der
zw e iten Bedeutung „Woh l stand, Gu t, Glück “
entspri ch t ein s lav.
bogo das nur in We i terb i l dungen und Kompositen erhal ten ist :bogats „
re i ch “
; u -bogs, ne-bogs „arm “
;*ss-boésj e (geb i l de t w ie
*ss-c
'
estsj e „Glück “ zu c
'
est» „Te i l “) in ukr . zlnfäe „Getre i de ; Hab
se l igke iten “
; tschech . soaei Verm ögen “
; poln. ebaée alt „Re i ch tum “
,
heu te Getrei de“
; osorb . zboäe „Glück “
; nsorb . zböi o „Vieh“.
Dieses zw e i te bogo l iegt nun offenbar auch in dem Imperativkompos itum Daäsbogs v or ; dieses bedeutet „Geber des Gutes “
,
Dispensator div itiarum ,w ie esMik lo s ich
,Lex . palaeosl. 1 52 treff end
erklärt hat . Keinesfall s vorzuziehen i st die Auffassung des Namensals „
Deus dator “,w onach das zw e i te Gl ied boys „Gott“ w är e
(J agi c '
,A S IPh . 5 , 3 ; vgl . dagegen K r e k , E in]. in d . s lav. Litg. 39 1
,
Anm . Denn in a l len a l ten und ursprüngl i chen idg. Imperativkompositen steht der zw e i te Te i l in e inem Obj ektsverhältnis zum
ers ten ; der Typu s serb . pj evidrug „ S ingbruder“
,sm rdi-vrana
„ S t inkkrähe “
, poln . burczymucha „Brummbart“
,die wie
e ine Z usammenruckung v on Imperati v und Vokat iv aussehen , istunursprünglich und dur chaus j ünger. Dies lehrt auch eine Durchs i ch t der slav ischen Personennamen (Mik lo s ieh DWienAW . 10,
sow e i t n i ch t deutl i ch mechan i s che Neuschaffung im Spie lis t (w ie e tw a in tschech . Bdihost), herrs ch t in den Imperativkompositen durchaus das Obj ektsverhältnis.
Wie Perun so sche int auch der Gott Daz' bog a l len S lavenb ekann t gew esen zu sein. Wen igs tens findet s i ch im Po ln is chenDadzba
'
g in alter Ze i t als Personenname (vgl. K u n i k — J agi c'
,
AS IPh . 5,665 ; Br ü c k n e r , Bist. jez. po l sk . 29) und in e inem
serbi schen Märchen aus Loj an i ce (vgl . J agic'
a. a . 0 . M it .) er
s che int ein Dabog als „Fü rs t dieser We l t“ dem Gospod B ag, dem
Hen gott, gegenübergeste l l t. In d ieser Vo lk ssage klingen die kosmogonischen Ans chauungen der Bogom ilen nach ; Dabog sche int dervo l k stüm l i che Name für den S atanae l d ieser S ekte zu sein . DieseÜberl ieferung ist nun fre i l i ch ganz Doch liegt b isher
S erb .
-kr. däbo, scherzhafte Benennung des Teufe ls , ist schw erliche ine hypokorist ische B i ldung zu D abog, sondern v ie l eher eine euphemist iu heWort entstellri ng von davo
„diab olus“
.
E in slav ischer Göttername 1 7 9
kein tr i ftiger G rund vor, die Ech the i t d ieser Vo lk serzäh l ung zubezw e i fe ln. Auch in des C a e s a r iu s v o n H e i s t e r b a c h Dialogusmiraculorum (XIII. Jh .) is t der a l te deutsche Wodan zu e ine r Teufe l sgesta l t gew orden (H . E. Mey e r , Myth . d . Germanen und der
Rostocker Pred iger N ico laus G ry s e spri ch t in se inem „8pege l des
antiehr istischen paw estdoms“ 1 593 vom
Dazu kann als Wor t das südslavische Dabog, das kaum aus daj -bogzu erk lären ist
,e inen noch ä lteren Typus vertreten als das russis che
Dai sbogs. Denn es h in dert n i ch ts, ein s lav.
*da —bags anzusetzen,
dessen ers tes G l ied noch die Imperativform ohne die Part ike l-dhi (bzw . deren slavische Umb i l dung) zeigt di-dw
,l i t.
da-k). Das w äre dann eine Bi l dung w ie gr. T in-n öl s,u og, tschech .
Da-mi’
r,kroat. Da-sla v
,und Daboga ve rh ie l te s i ch zu Daz
'
cbogs
w ie s lov. B ra-sla v,tschech . Z —bra -sla v zu serb . B er i-slav .
Daß Da z'
obogzs ein Name des S onnengo ttes w ar, ergibt s ic h
m it hoher Wah rs chein l i chke i t aus der Hypatiuschronik (2. Ausg.
(1. Archäogr . Komm . 1 908 , p. 27 8 f.) in einer aus der We l tch ron i kdes Johannes M'
a la la s üb ernommenen Erzäh lung von den a l tenÄgyptern : i po sems carstv ava Sync ego imenema S elm a egoäe naric
'
j u ts
Daésboga „und na ch d iesem herrs chte se in S ohn m it Namen S onne(übs. w e l chen m an Dai bog nennt “ . Diese Gloss ie rungw iederho l t s i ch an e iner späteren S te l le (Nähe res bei J agi c',AS IPh .
War Chors der S onnengott, so könnte
Dai bog e ines seiner Epi theta gew esen sein,vie l le i cht e ine Be
nennung aus euphem i stis chen Gründen. S o w u rde denn der
slav ische S onnengott als S pender des Gutes gepriesen und an
geru fen,geradeso w ie der a l te S onnengott Indra
,der m aghavan
„F re igeb i ger, Spender “ , der v asupa ti „Herr der Güter “ , bei den
lndern .„S o b ringe, du Gepriesener, uns hochbe rühm tes Gut
herbei,du guter Geber zum Bes i tz ! “ (RV. VIII
,24 ; nbs. v on
G r aßm a n n) ; „denn dich
,0 S ch leuderer
,kennen w ir
,als w ahren
Geber a l les Gute und als der S chätze Spender d i ch “
(RV. VIII,Im Gegensatz zu Daésbogs sche int S tribogs a l lein bei den
Ostslaven bekannt gew esen zu se in . Weder bei den S üdslavennoch bei den Westslaven findet si ch se ine Spur. Erw ähn t w irdse iner nur in der Chron ik und im Igorslied; außerdem findet ersi c h noch in Rußland in geograph ischen Namen, w ie z. B. S tr iboz
'
e
Ozer0 S tribogsee“
(vgl . A f a n ase v , Poetiöeskija v ozzrénij a slavj an
12*
1 80 E . Berneker
na prirodu I , 320 Anm . 2 mit Uber se inen Char akter me l detdie Chron ik n i chts. Doch das Igorslied nennt dle Winde „Enkeldes S tribog
“: se vetr i‚ S tr iboz
'
i vnuci, viju ts ss m orj a str ilam i
chrabryj a plsky Igor evy (ed. T ich on r av o v p. 4) „da w ehen die
Winde, des S tr ibog Enke l , vom Meere her w ie Pfe i le gegen Igorstapfere S charen“
. Das e inst m it Unrech t als Fäl schung v er
dächtigte Igorslied i st, w ie e ingehende Forschung w ahrs chein l i chgemach t hat, ein Denkma l der Kiever Rus ’
und w oh l von einem
Ze i tgenossen des Heerzuges Igors gegen die Polovzer (1 1 85) v erfaßt. Es ist also ungefähr zur gle i chen Ze i t entstanden, w ie dieNestorchronik. Der Di chter dürfte ein Druäinnik, ein fürst l icherGefol gsmann
,gew esen se in , doch ke in Ge ist l i cher. Zw e i fe l los ein
Chri st,bed ien t er s ic h doch als poet i scher Bi l der auch he idn is cher
my tho logischer Vorste l l ungen , die ihm bekannt w aren glei chw iedie Volkspoesie, an die se in S til mannigfache und starke Anklängezeigt. Bemerkensw ert ist
,daß er bei se iner mythologis chen
Genealogie immer die zw e ite Generat ion überspringt . E n k e l , n i chtS öhne : die Winde s ind S tr ibogs Enke l , der Fürst O leg Gorislavliöist Dai bogs Enke l (p. der S änger Bojan des Ve les (des Herdengottes) Enke l . Wenn in d iesen Anspie l ungen auch n i ch t mehrzu suchen i st als d ichteri s cher Au fputz, so w i rd man ihnen fürdie F rage nach dem Wesen des S tribog doch n i ch t a l len Wertabsprechen dür fen . Perun der Gew i ttergott, Chors-Daibogder S onnengott ; w erden nun die Winde „
Enke l des S tr ibog“ge
naunt, so w ird w ahrsche in l i ch S tribog ein Windgott se in . Wahrscheinlich , aber n i ch t gew iß . Denn auch im Rigveda ersche inendie Maruts als S öhne des Rudra
,obw oh l dieser s i cher ke in S turm
gott w ar (mag man ihn nun mit Oldenb erg als einen Gott der
Berge und Wa l der oder mit Hi l lebrandt als e inen Gott derS chr ecken des tropis chen Kl imas au ffassen). Doch der Di chterdes Igorsliedes w en det die hei dn i sche Remin iszenz als Kunstm i ttelan, als „épithéte rare“
,n i cht als Epi theton om ans ; er w ürde die
Winde n i cht gerade S tr ibogs Enkel nennen, w enn d iese Anspie l ungfür se ine Hörer n i ch t deutl i ch gew esen w äre ; in der Tradi tion m üssendaher w oh l S tribog und die Win de eng verknüpft gew esen sein.
So w ird denn S tribog au ch a l l gem ein als Windgott angesehen,
und die Etymo logie hat b i sher frei l ich ohne Er fol g versucht,
diese Anschauung zu erhärten. Rech t gew a l tsam verfuhr der
1 82 E . Reracker, E in slav ischer Göttername
zu vejg, viti w inden“
,so setzt stroj s „
Verw a l tung eins tiges *strn ,
str-iti „verw a l ten“ voraus (dessen Grundans chauung e inma l e ine
konkre tere gew esen se in mag) . Sa bedeutete S tr t-baga „Wa l ter
des G utes“. Es ist ein Imperativkompositum vom T inn a'
l sy og
T yp, der auch im S lavischen w ohlbezeugt ist ; vgl . außer den beiDabog geb rachten Bei spie len nament l i ch tschech . U bi-slav , polu .
U bi-slow ,
“
poln. I-OÖi-sfaw (abiti , pabiti und slava) ;*]zby
-
gné'
va in
poln . Z bygniew ,später Z bigniew , tschech . Z byhnév (izbyti „
be fre i tw erden“
und gneus
Die Deutung als Wa l ter des Gutes“ w i derspr i cht n i cht demWesen des Windgottes ; denn a l l geme in schre ib t a l ter Vo l ksglaub edem Winde n i ch t nur zerstörende Gew a l t zu . Vom Winde hängtdas Gede i hen der S aat ab („ohne Wind v erscheint das Korn“
)und dam i t Woh l stand ; der Win d s chafft glückl i che Fahrt. Im
Rigveda w ird Vata„der We l t Fruchtkeim‘f genann t (RV . X
,1 68 ;
vgl. O l d e n b e r g , Re l igion des Veda die Maru ts,die S turm
götter, s ind die „trefi
'
lich spendenden“
,und es he ißt von ihnen , „
sie
h aben a l len Bes i tz und w ohnen im Re i chtum , sie s ind voller Kr aftund geben im Uberfluß“
(RV. I , 64 ; vgl . H i l l e b r a n d t , Liederdes Bgveda Zeus , der Herr über Win d und Wetter, führtdas Be iw ort söofvs,u og; &ya l l o’y erac A u) ; az
’
igcp sagt O dysseus 8 1 7 6von den S chiffen. Nicht anders bei den Germanen (vgl . G r imm ,
DMyth . I,529 ff. ; H . E. Mey e r , Myth . d. Germ . 390 f. ; G o lth e r ,
E dh . d. germ .Myth . 290 Ihnen w ar der Windgott auch ein
Acker und E rntegott . Der nordi sche Odhin erregt den Wuns chw ind, öskabyrr . In S chw eden l ießen die S chn itter für Odhins Roßna ch der Ernte e ine kle ine Garbe zur ück . Ähn l i ch Opferte man
noch im 1 8 . Jahrh undert in Bayern dem „Waudlgaul
“
(Wodans
BOB) ein Ährenbüsehel; in Meck lenb urg richtete man im 16 . Jahrhundert dem Wodan e inen Kornbusch auf und rief :
Wade, ha le -dinem rosse nu voder,
nu .distel unde ' dom,
tom andern jar beter kam !
@tmi o:
E . R iech er s (München).
Der auf den heraklerschen Tafe ln bezeugte Eigenname<Dw u
'
ag ist zunächst aus der anderw ärts bezeugten Namens form<Dt l n
'
0zg en tstanden . Über den Wande l von M zu vr ist s chonö fters gehan de l t w orden ; Literatur findet man be i B r ugm ann
T h um b,Griech . Gramm .
‘
p. 95,zu letzt habe i ch IF 35
, p. 288 f .eine Erklär ung versuch t. Der genannte Lautw ande l sol l uns h iern i ch t in teressieren ; es komm t vie lmehr auf die Entstehung des
Namens an .
F i c k -Be c h t e l ste l len in i hrem Buche Die gr iechis chenPersonennamen 2 (Göttingen 1 894) p. 280f. eine Anzah l Namenzusammen
,w e l che das Element Q t l r o (d ia lektis ch @w r o auf
w e isen,näm l i ch Ö rl r oye'vng, (Del t a'doqu ag, QMM-
q, Ö ilzeaag, Q il r ar og,
s äg, Ö t l zéc‘zg, @ivu g,(P t lz ig, ®t l r iag, ©t l t t o
'
cdng, Ö t l zir ag,
Ö ivr vg, Ö LW ÜÄOQ, Ö il r w v,(Devzu3. Hinzufügen kann m an noch
i u og. Be legstellen für die e inze lnen Nam en findet man a. a. O .
,
ferner bei B e c h t e l , Die atti s chen F rauennamen (Göttingen 1 902)p. 36 und bei J o h a n s s on , IF 8
, p. 1 82. Das Element d h).r a<Dm o stellen F i c k -Be c h te l zu *rpzl r o
'
g, das seinersei ts zum
Aoriste (pil o t (pt lfi0m ) geh0 re.
Nun ist aber ein Verba ladjektiv <p tl r o’
g se lbs tändi‘g im Posi ti vnirgends bezeugt
,und auch in der Namenbilduug sche int das uh
l i che rptl r;r o'
g verw ende t w orden zu sein , denn es begegnen z . B.
E öq>ilnr og‚ Geomilmog, ®ilnzog, Q i l f)t ä; , Q t lnzddag, Ö t t d»,
s. F i c k -Be c h t e l a. a. 0 . p. 280, B e c h t e l , Die att is chen Frauennamen p. 35 und Be c h t e l
,Die Personennamen im 4 . Bande der
In sc riptiones Graecae im Genethliakon (Berlin 1 910) p. 73. Des
1 84 E . Kleckere , <b m n’
a ;
halb mö chte i ch l ie ber annehmen , daß das Element Q el za @w r o
in den aufgezäh l ten Namen durch Haplo logie aus*@t l r ar o
*d hvr ar a ents tanden ist . Außer den Pos itiven w erden ja auchKomparat ive und S uperlative zur Namenbildung benutzt, ö il r egagund Ö il r a r ag s in d bere its oben genannt ; und daß cpi).og überhauptzu denjen igen Adjektiven gehört, deren Komparative und S uperlative Personennamen l ie ferten , bew e isen noch Ö t lxt égtr , (Dt l cat éga ,dülw zog, Ö t l idt n, Ö t l t 0
‘
r a’
1,Ö LÄLO‘
T iQ, w oraus Q il r r;auf
die genannte Art en tstanden ist,Ö t l r d’
t t 0 1',
s. F i c k -B e c h t e la. a. 0 . p. 27 9
,Be c h t e l , Die att i schen Frauennamen p. 43. Man
kann a l so verglei chen Q t l r éag mit ’
Agw r e'
ag, Q t l t t’
0zg und d hvr iag
mit’
A gw n'
ozg, Mey_
w ziag, Hl sw u'
ag, Q w r äg mit Msyw r äg, Ö il zw v
mit’
Aaiorw v , Kal l iar w v , Hi siom w‚did n
'
a m it’
A gw r ivag, {Divn g
m it’
ßlaw u g, Q il znmit Ö t l i0 fl ; , Ka l l iarn, Hdiorn,%giarn, Msyiar n,dh vr a
’
: mit’
A aw u b, Ka l l eozaß, Koau ozaö,Hl ecor a3, Natür
l i ch wird in d hi r oyévng nnd (Dek a'
dayag derse lbe dissimilatorischeS chw und vorl iegen, sodaß w ir in dem ersten Bes tandtei l dieserzusammengese tzten Namen wieder einen S uper lativ erb l i cken dürfenw ie in
’
A gw r oyévng, Ka l lw r oyévng und’
A gw r a'
dqyog, Meyw zo'
dcmog.
1) Vgl. noch A ct ion » , ’
A,u siv argv (
°Azzew ias, Kall ia w,
’
Agw r os,
Kgdn ar os, Kdl l wr os, Ü le tor os,‘
Hdicr t r; usw .
1 86 W i lhelm Geiger
se tzung aus hun oder sun„pu lversierte S ub stanz “ (skr . cürzza , p.
c u 7_ma) und aus yam a
,dem Namen des Todesgottes . Die Deutung
ist in sach l i cher w ie in form e l ler Bedeutung unbefriedigend Man
s ieh t n i ch t,w ie das Komposi tum zu e iner vernün ftigen Bedeutung
ge langen kann . Au f die Länge des 12 i st bei der E tymo logie überhaupt ke ine Rücks i ch t genommen.
Ich m ö ch te nun meinerse i ts das Wort in hü-m'
yam zer legenund m it
„S chnurverfahren “ übersetzen . Über Imist me ine „
Etymol .des Sgh .
“ N r. 1 640 zu vergle i chen : es ist skr . sütr a,hat aber
,
entgegen p. sutta e ine Zw ischenstufe *süta zur Voraussetzung
, w ie
au ch mü „Urin“
skr . mütra n i ch t auf ein m utta,sondern auf
e in *müta und r a
„Nacht“ rätn
'
n i cht auf ein r atta‘
,sondern
auf ein *räti zu rü ckgeht Das Wort niyam ,
für das C lo u g h die Bedeutungen
„appoin tm ent, fixing, sett lement ; ord inan ce, re l igious
ob servance usw . angib t,i st p. ni
_yama „Art und Wei se“
. Vgl .z. B. gihinz
'
yäm e na paridahz'
tva nach Laienart s i c h k le i dend“ im
t . Comm . ed. N o rm an 1 6 1 0 oder den ph i losoph is chen T erm inus cittanz
'
yäma „Order of Thought“ bei S hw e Z a n A u n g
,Com
pendium of Ph ilosophy , PT S 1 9 10, p. 25 . I ch bemerke noch , daßhü ein El u-Wort i s t (vgl. z . B.
hü-lanava„str ing of thread“ , Sgh .
Ummagga Jätaka, ed. S . de S i l va p. das in der Verkehrssprache durch nül ersetzt w u rde . Wir haben es a l so b ei hüm'
yam
m it e inem a l tertüm l i chen Worte zu tun.
E s fragt s i ch nun,ob v on der Bedeutung
„S chnur verfahr en
s i ch zu der de s Zaubers im a l l geme inen und des S chadenzaubers
im besonderen ein Üb ergang finden läßt. Die Frage darf, w ie
ich glaube,bejah t w erden. Der Zauber w ir d in Cey lon als ein
B inden“ der Dämonen aufgefaß t,und eine b estimm te Form des
ham'
gam heißt geradezu bandana . Bei einem Zauber, dur ch den
die Teu fel veran laß t w erden so l len, ein bewohntes Haus so langeunausgesetzt mit S te inen zu bew erfen, bis die Insas sen es verlassen,heißt es in dem S pruche : Euch Teu fel und T eufelinnen alle b indei ch . Ich b inde euch dur ch die Macht des Gott es Lokanäth a ; i chb inde euch durch die Macht des glorre i chen Gottes Vi9nu ; i chb in de eu ch durch die Mach t der w eltb erühmten G ottheit Pattini .“U nd in der gle i ch en F orme l geht es dann w e iter unter Nennun g
Vgl. me ine Li tt . und Spr . der S inghalesen , 1 5. 5 b .
Hüuiyam 1 87
anderer Gotthe i ten b is zu dem S ch luß : I ch b inde euch du rch dieMach t a l ler d ieser Götter Tut
,w ie i c h tue ! S tehet, w o i c h euch
stehen he iße ! Gebet, w o i c h euch gehen heiße ! F resset, b rennet,zerstöret, w o i ch euch fressen
,b rennen
,zerstören he i ße. S o m öge
geschehen E in anderer Zauberspruch , der an den Riri-Yaksayä,den geri ch tet i st, s ch l ießt m it den Worten : „
Darum ,
durch die Mach t des Visnu und kra ft der Nieder lage, die er di rbe igebrach t an j enem Tage, zw inge i ch d ich, d ich b inden zu lassen
,
du Teufe l R .-Y
„durch me inen Spruch . I ch b inde d ich ! S ei ge
bunden, gebunden , gebunden ! Ich geb iete di r, sofort die Krankhei t zu he i len , die du über d ieses Mens chenw esen gebrach t hast.Möge so geschehen
Dieser Auffassung von dem Wesen des Zaubers entspr i cht esnun auch , w enn das Bindem i tte l , das Band , die S chnur oder der Faden ,be im Zauber im Al lgeme inen , w ie auch in der Hüniyampraxis
im besonderen außerorden tl ic h häufig Verw endung findet. E s
hande l t s i ch dabe i me i s t, oder vie l le i cht immer um kanyä—nül,d . h .
um e inen Faden , der von e iner Jungfrau gesponnen w orden.
Zunächst w ird S chnur oder Faden als Am u le t t geb raucht.Das ist ural ter Brau ch . Bere i ts im Jätaka-Buche (ed. F a u s b ö ll
I. w ird neben pam'
ttavälikä ‘) als Mitte l zur Abw ehr
dämonis che r Einflüsse das„S chutzschnur , Zauber
schnur “erw ahnt. Der Bodhisatta bedient s i ch seiner zum S chutz
gegen die im Wa l de hausende Yakkhini . Nach dem Mahävamsa7 . 8 — 9 s ch i rm t der Gott . Visnu den Vijaya und se ine Gefährtennach i hrer Ankunft in Lankä vor den dase lbst w ohnenden Yakkhasdadurch
,daß er sie mit (gew e ihtem )Wasser besprengt und e ine S chnur
an ihrem Handge lenk b e festigt (su ita fz-ca tesa7_n hattlzesu laggetvä).
Die S chnur bew ahrt denn auch (7 . 1 4) in der Fol ge die Leutedes Vijaya vor dem S ch i cksal , v on der Yakkhini Kuvannä auf
ge fressen zu w erden. S e lbstverständ l i ch hande l t ‚
es s i ch immerum S chnüre, die dur ch irgendw e l che Riten und Z ermonien zauberkräftig gemacht w erden s ind .
Dds. G o o n e r a t n e , JRAS Ceylon Branch, IV (Nr. p. 66 .
r irz'
f ikiri skr .
, p. m dhira : E tym . des Sgh . Nr. 192.
JRAS C . Br. , a . a. 0 . p. 64.
„Z aubersand“
. Auch bei den heut igen S inghalesen gi l t S and v on
e inem Platze , den noch kein menschl icher Fuß betreten hat . als w irksamesZauberm i ttel . Vgl. P a rk e r, Vi l lage F o lk-Tales of CeylonH, p. 3 l2, 3 l3 , 321 , 826 .
1 88 Wilhelm Geiger
U nd ahnlich in den modernen Riten. In dem bei C a l l aw ay ,
Yakkun Nattanaw ä and Kö lau Nattanaw ä p. 1 6 fl3 m itgeteil tenpo lem is chen Ged i ch t „T he Pra ct ices of a Capua“ verhe iß t derKapuvä, der S hamane, dem Gesu chste l ler, der ihn in einem Krankheitsfalle um se ine U n terstü tzung angeh t, er w erde den Krankenm itte l s e iner S chnur heilen (v. S eine erste Hand l ung b es tehtdann darin
,daß er e ine S chnur nimm t
,un ter Gemurme l und
Drohungen sieben Knoten knüpft , die S chnur dann m it S ah an
gelb färbt und um den Kopf des Kranken b in det (v. Wirktdas n i cht, so komm t der Z aubertanz der Teufe l s tanz“, w ie
in der Rege l der Ausdruck in den europaischen Beri chten lautetan die Rei he (v. Die S iebenzah l w e is t h ier auf die s iebenPlaneten und die ge lbe Farbe gil t neben der roten und
der w eißen als besondersDas Tragen von Am uletten
,die m i tte l s e iner S chnur um den
Arm geb unden w erden,ist bei den S ingha lesen, namentli ch bei
den Frauen,ganz a l lgeme in Brauch . Das Amu le tt selbst besteh t
aus einem kle inen in e inem kupfernen Röhrchen untergebrachtenPalmblattstreifen
,auf den ein magischer Spru ch ges chr ieben ist.
N icht se l ten trägt e ine Person zehn bis zw anzig sol cher Amu lettebei si ch , die gegen den b ösen Bl i ck (sgh. äs-valza
„Augengift
“
)s ichern
In einer singha lesi s chen Volkserzäblung‘) komm t e ine Frau
vor, die e ine (neun fach oder sieben fach) geknotete S chnur, diedurch magische Sprüche b ezaubert ist, gegen die von i hr vorgegebene kagiavar a-Km nkbü t verw endet. In einer anderen ‘
) w irde inem Kind , das an bösen Träumen le i det, eine Z auberschnur um
den Arm gebunden. Das Knoten von S chnüren (nül-bäcüma) istferner in Cey lon üb l i ch bei schw angeren Frauen, da ja S chw anger
1) V ielfach ersche int aber bei Z auberriten in Ceylon die Neunzab l, da
neben S onn e,Mond
,Mars
, Merkur, Jupi ter, Venus und Saturn auch Kotaund Rähu
,wel che S onnen und Mondfiusternis bew irken, als (unsich tbare)
P laneten gel ten . Vgl. das Gedicht N av agr ah a t än t iy a (Colombo in
dem 1 10 S tr ophen den neun P laneten gewidmet sind.
Auch in Nordindien w ird daher S afr an als apotropäisch cs Mi ttel verw endet : C r o ok e , Popular Religion and F olklore of North ern India II,p. 28 f .
S . C a l l aw ay a.. a. 0 . p. VI .P a rk e r a. 0. II, p. 204 f. , 207 .
1 90 Wi lhelm Ge iger
vo l l zogen zu w erden pflegt Auf einem Tische steht ein
Re l iqu ienkästchen, auf e inem anderen liegt das Parittä-Buch . Die
Piritscbnur verb indet zunächst Re l iqu ie und—Buch,ist dann durch
einen Ring in der Decke geführt und l äu ft von h ier rund um
den ganzen Raum,w o ihn die sämtl i chen Bhikkhus
,die imK rei se
si tzend an der Zeremon ie tei lnehmen,w ähren d ihrer ganzen Dauer
in der Hand ha l ten .
Man s ieh t deutl i ch,daß h ier die S chnur neb en der b in denden
zugle i c h auch die verb indende Kraft h at. S ie le ite t d ie Zauberkraftv on der Rel iqu ie zunächst zu den Sprüchen und v on h ier auf die
ganze Versamm l ung,deren Te i lnehm er dadurch a l le zu w irkenden
Zauberern w erden. Die Piri t-Zeremon ie i st ein Exorzismus._S ie
w ird angew endet in e inem Krank he i ts fa l l oder bei einer S euche,die natürl i c h dur ch Teufe l verursach t ist, auch zur Austreibungder Gev ala-Yakeayä , der Gei ster , w e l che die menschli chen Be
bausungen unsi cher m achenBe ides
,die b indende w ie auch die verb inden de, den ganzen
Zauber zu e iner w irksamen Einhe i t zusammens ch l ießende Kraftder gew eih ten S chnur, ze igt si ch nun ebenso au ch in den Zeremonien des Berufszauberers aus Laienkreisen . Bei e inem Zaub err itus
,durch den die Ratten v on den Re is fe l dern‘ ferngeha l ten w erden
so l len,w ird ein kanyä
-nül s iebenma l gekno tet und b ei jedemKnoten ein bes timm ter Zauberspru ch gesprochen Die geknoteteS chnur b indet den Teufe l , der die Ratten s ch i ckt.
Der Spru ch an den Ri ri-Yaksayä, den i ch ob en erw ähnt habe,hat den Zw eck , eine S chnur (kanyä-nül) zauberk räftig zu machen.
Die S chnur w i rd dann e inem Kranken , der an e iner der vom
Blutteufel verursachten Krankhe i ten le i de t und_
von ihr gehe iltw erden so l l
,um Arm oder Ha l s gebunden. Auch h ier hande l t
es s ich um die b indende Wirkung der S chnu r . S ol ch e ine He i lsc hnur ist n i cht ohne w e i teres dasse lbe w ie eine als Amu lett getragene Die letztere w i rkt ledigl i c h präservativ und
ihre Bezauberung i st w e it w en iger s chw ierig und um ständ l ich .
1) A short A ccoun t of the princ ipal R el igious Ceremon ies observ ed by
the Kandians in Cey lon , JRAS C . Br . VI I , Nr. 28, p. 38 .
JRAS C . Br . IV,Nr . 1 3, p. 37 Anm. und p. 68 Anm . Vgl. auch
S e ide n s t ück er,Khuddaka—Pätho. übers. p. 3, Anm . 1 .
A . K . Clo om a r a sw am y ,JRAS C . Br . XVI I I , Nr . 56, p.
S ie heiß t äraksä-nül. Vgl. JRA S C . Br . IV, Nr. 13, p. 60.
Hüniya 1 9 1
Wich tiger noch ist fo l gendes : Krankhe iten w erden n i ch t nurdurch die Yaksayä, sondern au ch durch die Planetengött er , dieGraha , verursach t . Der He i l ung so l cher Lei den d ienen die Ba l iZeremon ien. Es w ird bei i hnen der ganze fü r die Zeremon ie bestimm te Platz m it einem d re i fachen kan
_yä-nül um spannt. Das e ine
Ende der S chnur i s t ob en an dem aufgestel l ten Bi l dn i s des
Planetengeistes be fe s tigt, das andere Ende, an das ein Bünde l derroten Bl üten v on Ixora cocc inea, im Sgh . r a t-m a l rote Bl ume “
gehe ißen , b e festigt ist, häl t der Kranke in der Hand Der Grundgedanke is t hier ein ganz ähn l i cher, w ie bei der Pirit-Zeremon ie .
Auch bei der Netra-mafigalyaya genann ten Zeremon ie w i rd um
den ganzen Raum ein kanyc'
u nül
S ch l ießl ich e iniges über die Hüniyam -Z auberriten im engerenS inn
,über die DdS . Go o n e r a t n e ”
) w ertvol le Mi tte i l ungen ge
macht hat. Es gib t zah l re i che Zeremon ien d ieser Gattung. S ie
unterschei den s ich je nach dem Zw ecke durch Einze l hei ten, habenab er, außer der Verw endung eines Bi l des oder Phantom s, manchesgeme insam . Hierzu gehört der Gebrau ch der rat-mal-Bl üten , der
v on Räucherw erk , die Errich tung von zw e i a ltarartigen Geste l len.
Das eine bei ß t MaLbu la t— ta_tuva
„Bl umen und -Bete l-Al tar “ . Hierw erden , w ie es s che int
,die bei jedem Zauber nötigen gehe imn i s
v o l len Gegenstände n iederge legt. Der andere w i rd P idénnw tagfu vaDarbringungs
-Al tar “ genann t. Auf ihm l iegen die aus Re i s,Fle i sch , Eiern usw . bestehenden Spenden, die für die Dämonenb es timm t s ind
,w e l che ers cheinen , um den Zauber zu stören und
den Zaubernden zu schädigen. Der Platz,auf dem ein Hüniyam
Zauber vol l zogen w i rd,ist in der Rege l ein Grab .
Bei einem Hüniyam ,durch den das Opfer dem Wahns inn
v erfa l len sol l , w i rd das Bi l d auf e ine Areka Blüte ge legt und be i desdann s ieben fach m it der s iebenma l geknoteten S chnur umw i cke l t.Das Bi l d ist h ierau f an e iner b estimmten S tel le des Hauses n ieder
Eine andere Hüniyam -Zeremon ie gil t e inem E hepaar,dem sie S tre i tsuch t
,l rrs inn und T od b ringen so l l . Hierbe i w erden
die be i den Bi l der auf S tü cke Tierhaut geze i chnet und die S tü ckeW . A . de S i l v a , JRAS C . Br. XX I I, Nr . 64
, p. 143.
H . W . C odr i n g t o n , ebenda XXL Nr. 6 1 , p. 249 .
3) Demono logy and Wi tchcraft in Ceylon , ebenda IV ,Nr. 13, p. 68 fl°‚
A . a. 0 . p. 63.
1 92 Wi lhelm Geiger, Hüniyam
dann m itte l s e ines s iebenmal herumgeschlungenen kanya—nül, überdem 49mal ein bes timm ter Zauberspru ch gesp rochen w erden, zu
sammengebunden . Die Hüniyam -Figur, deren Abbildung N e i l
veröüentlicht ist eben fa l l s mehrfach m it e iner S chnur um
w i ckel t.Ebenso kommt die verb indende Kraft des kanyä
-nül beim
Hüniyam zur Ge l tung . Bei e iner Angam-Zeremon ie es ist das
eine Abart des Hüniyam w ird ausdr ück l ich vorgeschrieben,den Raum so m it einem kanyä
-nül zu umgeben,daß dadurch die
be iden ta_tava und die Person des Z auberndeu e inges ch lossen
Bei einer anderen Zeremon ie , die uns ausführl i c h bes chriebenist der Pidénna -ta
_tuva s ieben fach mit e iner w e ißen S chnur,
die kanyä-nül se in muß
,zu umw inden.
E s l ießen s ich die Be ispie le l e i cht w eiter vermehren . Goo
u e r a tn e (p. 60) sagt ausdrück l i ch , daß vier Dinge bei ke inerZauberhand lung feh len : die m agische S chnur
,die be iden Altäre
,
B l umen,sow ie ein Feuertopf mit Räucherw erk . Das Mitgetei l te
dürfte ab er für den Nachw e is genügen,daß es bei der bedeut
samen Ro l le, w e l che die magische S chnur bei a l len Z auberritenund beim Hüniyam im besonderen spie l t, gerech tfertigt erscheint,w enn dieser als S chnurverfahren “ bezei chnet w ird.
1) A hüniyam Image, JRAS C . Br . VII , part 2, Nr. 24 , zu p. 1 18.
JRAS C. Br. IV , Nr. 13, p.
Monthly Li terary Register, New S er. III,'
p. 251 f.
1 94 W i lhelm S chulze
zuo den hun den er do sprach‘zuz u
’
und gun d sie s chupfen :do gerieten si in rupfen.
Landh . 57 ‘da kamen sie (die Hunde) a l le auf einma l ge laufen ;i ch sagte : zschu ! zsclzu ! und tr ieb sie a l le m ite inander in den
Hinzufügen kann i ch aus dem S . 1 93 Anm . zit iertenAufsätze T r e ic h e ls , Provinzie l le Sprache zu und von Tieren und
ihre Namen 1 92 : ‘schu .
’ schu ch ! ist der S cheuchruf des Hundes .tschüh ! ist Anfeuerungsru f b e im lautj agenden Jagdhunde. Ebensotschüh bün !
’ Vie l bedeu tsamer aber ist es,daß w ir die Spur dieser
Rufformen bis nach Indien verfol gen P l a t t,Dictionary
of U rdü, Hindi and Engl i sh 4 65 : chü ; chu used to exc ite a dog
on to h is prey. Mo l e sw o r t h,Marathi and Engl is h 301 : chü
the sound used in setting on a dog; chuchu the sound u ttered indriving offa dog, opp. to yuyu ; yü ca l l ing a dog Dieser Gebrau chl äßt si ch glü ck l i cherw ei se schon aus dem Prakrit des Jaina—Kanonsb e l egen : im Ayäramgasuttam (ed. J a c ob i 1 , 8 , 3 4) w ird erzäh l t
,
w ie von den Leuten im Lan de Ladha die Hunde auf den Heiligengehetzt w urden un ter dem Rufe chucchü
,den i ch nach all den
h ier verein igten Nachw e isen kein Bedenken trage, schon für dieidg. Urze i t in Anspruch zu Der denkw ür dige Zufa l l ,der d ies w i ch ti ge Prakritzeugnis aufbew ahrt hat, mahnt uns zugle i ch , daß h ier se i t dem Ers cheinen der Deu ts chen Grammati k
,
die an An regungen und Forderungen für,
die sprachgeschicbtliche
Beobachtung bis heute uners chöpf l ich ist, ein von der indogerma
n ischen Wort fors chung arg vernach läs sigtes Geb iet des kundigenBearbeiters vergebens harrt, obw oh l es genügen d ausgedehnterUm schau lohnenden Ertrag verhe iß t.
2. S ]. sesati ‘saugen ’
(r. sosdte, p. ssaé) verhäl t s i ch zu arm .
Vgl. das v on R o e t h e dem 4 . Bande der DG. beigegebene Quel lenv erze ichn is XL : ‘Das Landhaus, ein Lustspiel in e inem Aufzuge nach demE nglischen ’
,Le ipz i g 17 70 (von Kar l Christian Heinrich Rost, geb . zu Dresden
1 742,gest. in Leipzig 1 798, s . G o ed ek e , Grundri ßIn neuind. Wor tern setze ich 0 , w ie in der üb l ichen Transcription
des Al t und Mi tt elindischen , für den Laut 6 ; ok für die zugehörigeA spi rata äh .
F r . S c h u l t h e s s ,‘Zurufe an Tiere im A rab ischen' (Berl . Ak. Abb .
1 91 2) h at n ichts lautl ich E ntsprechendes.
Indogerman ische Interjektionen 1 95
ccem‘sauge ein , auf
’
(aus*cuce m) i t. docciare
, prev. port .ö. cacati (cucla li ; cucm a ti), nel. c zica ti (cu
'
zati) nhd. mundartl. zuzeln ‘)
(w oh l zu unters che i den von den anders v okalisier ten Formen m it
und e bei Be r n e k e r,S lav. Et. Wb . 128 f.) genau w ie die
Variationen des gle i chbedeutenden l i t. Verbums siulpz'
u und éiu lpz'
u,
die in S zyrw ids Wörterbuch s . sarkam neben e inander s tehen “)
und gew i ß mit unserem zulpen (Z u lp‘Lutschbeute l ’) i den ti sch
Russ . sosök und i t. cioccia bedeuten be i de Brustw a rze.
Dazu stimmen überras chend die Entsprech ungen des engl . nipple
oder breas ts, die aus den neu ind. Volkssprachen angeführt w erden :beng . cuci hind . panj . cüci zigeun . Die ind is chen Lexiko
graph en f üh ren cücu lca mit der Bedeu tung ‘Brustw arze ’
als S ansk ri tund Paliw ort auf; i c h vermag n i ch t festzuste l len
,auf w e l chem
Wege das n e u ind. cucz'
au ch in Wi l s o n s S a n sk r i tw örterbuchgelangt ist : aus der Literatur sche int
,nach den modernen Hilfs
m i t te ln zu urte i len,w eder das e ine noch das andere be legt
zu sein.
Zur Erl äuterung all d ieser Formen d iene e ine Noti z aus dem
Voc . degl i Accadem i c i de l la Crusca 51 : cz'
occz'
a Voce con la
qua le bamb in i ch iamano la mamme l la de l la madre . Ich denke,
auch hind . chocho ‘nurse ’
,
‘bosom ’ darf man,trotz des Hinzu tritts
der Aspi rat ion, in d iesen Zusammenhang e in beziehen . Vgl . F a lle n ,
Hüb s c h m an n,A rm . Gr. 498 .
M ey e r -L ü b k e , Rom . E t . W b . nr . 2452.
Vgl. nal. cal a t i ‘schaukeln'm it gle ichbedeutendem serb . cüca ti, w orüber
unten noch ein Wort zu sagen sein w ir d.
S c h m e l l e r 2 2,1 168. S t e r z in ge r , Bohm .
-deutsches T asch enw b . 58
dundati ‘saugeu , zutschen ’
(dafür ‘zulpen ’ 22 s. cum la ti) . zu tzel ‘S auglappen
'
L e x e r , Mbd. W b . 3,1 203 (schw erl ich ri chti g v on F a l k - T o rp , Norw .
-dän .
W b . s. T aa te, T ud, T addel beur te i l t). Mit leichterem An laut t iro l . das S azele,suzelen K . S c h ö n h e r r , S chuldbuch (Leipz ig, S taackmann 1 9 13) 63 (in der
E rzählung ‘Fuhrmanns
Vgl. Ku r s o h a t s. czz'
älpz'
u und sin lpz'
ü,L a l i s s. äiu lpti und sulptz
'
,
Mi e t i n is s. cziulpti .
Trotz F a l k —T o rp s . T ylde, w o die lit . F ormen ebensow en i g be«ru cksich tigt w erden w ie im neuen W e i g a n d oder bei K l u g e .
Vgl. dazu noch B i d du l ph , Tribes of the Hindoo Koosh Append. 50
(Shine) chachi und L e i t n e r , Languages and Races of Dardistan Part I , 1(S h ine , A stori) tshuß ho , (Kalasha) tshatshu ; Append. 10 (S hine , Ghilghiti)tshütshe (neben mdme, d. i . lat . m amma).
1 96 W ilh elm S chulze
New Hindus tan i-Engl i sh D ic tionary 522 cuckärnä ‘to cheep (a childor an ima l), to kiss any thing or chuck as a mark of respect’ m it558 chu ckär nä ‘to cheep a dog
’
(w as w ieder er l äu tert w ir d dur chP l a t t a. a. O . 427 cuckär ‘
a su cking soun d wi th the l ips by w h i chan im a l s are ca l led or Ers t mit Hil fe d ieser ind. Para l le lenverstehe i c h den Gebrau ch des lit . Verbums öz
’
ülpti oder sülptz'
r. c'
m o'
kate, p. smokaé w ie ihn J uäk e v ié 1
,27 6
b es chr e ib t : das öz‘
ülpti su lüpomz'
s (d . h .
‘mit den Lippen’
) ist ein
Mi ttel , Tie re zu locken oder zu rufen . Zugle i ch l ie fert der
Artike l in den r . p. A equiv alenten des l it. öz'
ülptz'
(sülp tz) ein
neues Beispiel der Anlautsvariation .
Es hande l t s i ch eben übera l l um schallnachabm ende,den
Interjektionen‚ve rw andte oder unm itte lbar aus ihnen hervor
gew_
achsene Geb i l de, deren lautl i che Behand l ung außerha lb dere igen t l i ch gesetzmäßigen Entw i ck lung steht. F ür das Verhäl tnisv on sesati und cacati
,Giocciare kann i ch noch eine fast genaue
Pa ra l le le aufze igen : l i t. .éiuéiü und czz'
u czz'
zi,Interj ektionen zum
Eins ingen der Kin der in den S ch laf, w ie Ku r s c h a t sagt (L e sk i e nB r u gm an
,Lit. Vo l k s l ieder und Märchen lett .
_/chufchindt
‘S usu machen’
(beim Eins ch l äfern der Kinder), tschu tsclzina’
t‘ein
s ch l äfern ’
,tschu tsclzét ‘s chlummern ’ l i t . czuczz‘itz' J uäk e v .) B i e l e n
s t e i n , Lett . Gr . 1 94 . 202 (zu e r l äutern aus S t e u de r s Lett . L ex.
253. 330 : [ aha/aha‘i s t das S usaninne bei der Wiege’
,tschu tschu
behrnin ‘so w iegt man die Kinder ein
’
und V u k , S erb . Wb . 844
cücu ‘Wort,Kinder
Das von dem eben erw ähnten serb . cücu abge le i te te Ze i twortcücati bedeu tet ‘
auf dem Kn ie w iegen ’
; ihm entspr i ch t im S lov. caza le'
,
mit dem gle i chen Wechse l , den w ir s chon oben in s lov. cu’
catz'
cüza tz'
‘saugen ’beobachten konnten. Das s ch lägt die Brücke
hinüber zu skr . ca._sa ti ‘saugt’ , dessen Verw andtscha ft m it sl. m a ti
und öech . caca ti s chon J u n gm a n n in se inem Böhm is chen Wör terbuch m it Rech t b ehauptet hat.
Das aus S t e n d e r e Lexikon ausgehobene ‘S usaninne’ zerlegt
s i c h in mwa —m'
nne. Der zw e i te Bestandtei l erschein t man cherortenin Liedern
,m it denen die Mütter ihre Kleinen in den S ch laf
s in gen . Er ist auch den indis chen Ammen n i ch t fr em d, w ie ich
einer Mi tte ilung G r i e r s on s , ZDMG 50, 23 en tnehme : Angl'
o-Ind ianm others soothe their ch ildr en to s leep w i th a croon ing song be
Ethnographische Sagen der Chinesen.
Von
Ber thold Laufer (Chicago).
Ursprüngl i ch w aren die Chinesen ein Bauernvol k des Binnenlandes , das mit dem Meere in ke iner lei Verbindung stand . Erstin a l lmäh l icher Ausdehnung ihr er Macht nach Osten und S udos tgew annen sie Füh l ung m it den Küstengeb ieten
,und gegen Ende
des dr i tten v orehr istlichen Jahrhunderts unter den Ts‘in regte s ichder Drang
,unbekannte Lande im öst l i chen Ozean zu entdecken .
U nter den Han nahm d iese seew ärts geri ch tete Expans ion e ineungeahnte Entw i ck l ung, w ährend s i ch gle i ch ze i tig Zentra las ien und
Indien den Ch inesen zu ers chließen begannen und ihr regerHande l sge i st sie mit den Ländern des he l len isti schen Orients inVerb indung b rachte. China nahm dam a l s seinen Platz in der
We l t ein und w uchs s i ch zu e inem We l tr e i ch in dem S inne aus,
daß alles zu jener Ze it bekannte Gute b ere itw i l l i g Aufnahme fandund fr emde Kulture lemente die e inhe im i schen Gedanken b e
fruch teten und vertieften . Zu diesen charakteristisc hen En tlehnungenaus dem Westen gehören n i c ht in letz ter Re ihe die sagenhaftenMot ive der Wundervölker u nd der s i ch an d iese ansch l ießendenWundermären . Die in der ch ines i s chen Literatur über d iesenGegenstan d hande lnden Que l len haben s chon viel fach den S charfs inn der S ino logen in Anspruch genommen , ohne daß ein allge
m e in be fr iedigen des oder annehmbares Ergebn i s erzie l t w ordenw äre. Vor a l lem hat G. S c h l e g e l (Problémes géograph iques, Lespeuples é trangers chez les h istor iens ch inois, Le i den 1 892 ; zuers tin den Bänden III— VI des T‘
oung Pao) m it e inem Aufw andgroßer Ge lehrsamkei t, aber m it mange lnder Kritik sow ohl in derBehandlung der Que l len als in ihrer Interpretation , eine Reihe
E thnograph ische S agen der Ch inesen 1 99
jener Wundervölker von geograph is chen und cthuographiscben
Ges ich tspunkten behande l t und sys tem at is ch k lass ifiziert. Von
dem Glauben er fü l l t,daß die e ins ch l ägigen ch ines ischen Nach
r i chten aus der Anschauung und Beobachtung w i rkl i cher Zuständehervorgegangen seien
,versuch te er dieses angeb l i che Wi rkl i ch
keitsbild zu rekonstruieren und ein fes tes geographis ches S chemazu zei chnen
,in dem fas t a l le gegenw ärtig lebenden Vö lker des
nordöstl i chen Asiens , w ie die Ainu , Kam tschadalen, Korjaken und
T schuktschen , den a l ten Chinesen bekannt gew esen se ien. Überden a l l geme inen Mißerfol g d ieses Versuches hat w oh l n iema l sMeinungsverschiedenb eit geherrsch t . Einma l können die m e i s tenTex te, auf denen s i ch S ch lege l s Ans chauungen gründen
,ke ine
gesch i chtl i che Glaubw ürdigkei t beanspruchen, sondern gehören dertaoistiscben. zu einem geringeren Te i le der buddhis tis chen Wunderl i teratur an. S odann is t es uns l ängs t bekannt, daß die cthuo
graphis chen u nd ku l turh is toris chen Verhäl tni sse im nordöst l i chenS ti l len Ozean in a l ter Ze i t w e i t von denen der Gegenw art vers ch ieden w aren
, so daß w ir die heutigen Zustände n icht in a l teBeri chte h inein lesen können. Was aber das Wichtigste i st, dieIn terpretation dieser Dinge i st ganz andersw o zu su chen als in
der vergeb l i chen Bemühung, sie m it geograph is chen und ethno
graph is chen Nam en gle i chzusetzen. Wer die ch ines is chen Be
r ich te mit e iniger Au fmerksamke i t und Kri tik l ies t und w er m it
dem Bi l de de r Wundervölker v ert raut ist, w ie es unter ind is chemEinfluß die griechi schen Ber ichters tatter über Indien, S kylax,
Hekataios, Ktesias undMegasthenes den He l lenen verm i tte l t haben ,w ird ba l d zu der Überzeugung ge langen
,daß h ier auffäl l ige Über
e inst immungen vorw a l ten, die s i ch in e iner Anzah l von Fäl lenauch als histor is che Zusamm enhänge na chw e isen lassen . Wie die
Kunde der indo-he l len ischen Wundervölker durch Verm itt l ung desAlexanderromans sow ie des Pl in iu s und se iner Nach fo l ger dasgesam te Abendland durch das Mi tte la l ter bis in den Beginn derNeuzei t mächtig angezogen und die S agen der seefahrendenAraber bee influß t hat
,so hat sie auch auf die Phan tas ie der
Chinesen e ingew irkt. Die fol genden Ausführungen w ol len nur
als ein Programm ge l ten ; sie s in d der Auszug aus e iner größeren,
noch unveröfl"
entlichten Abhandlung,in w e l cher das Thema auf
b rei ter Grund lage darges te l l t ist .
200 Berthold Lauter
Um die Abhangigkei t ethnographis cher S agen der Chinesenvon w es tl i chen Vorstell ungen zu erw eisen , w ird es am bestensein, von fest ums chriebenen Ta tsachen auszugeben. A ls ge
w i chtigstes Bew e isstü ck b ietet s ich die S age v on den Pygmäenund ih rer Kämpfe m it den Kran i chen dar (Il ias 111 3 ; Hekataios,fr . 266 ; Herodot II 32; Ktesias 1 1 , p. 8 1 h ; Aristote les, Hist.animalium VIII 1 2 A u b e r t undW imm e r , Ar istote les Tierkunde,H, p. 1 5 1 ; Megasthenes b ei S trabo XV 1 g 57 ; Pl in i us VII 25 26 , X 30 58 ; vgl . W . R e e s e
,Die griech is chen Nachri chten
über Ind ien p. 1 01 f . ; 0 . K e l l e r , An tike Tierw e l t II, p. T u
Y u (7 35 — 8 1 2) erzäh l t in seinem zw ischen den Jahren 7 66 und
801 ve rfaß ten T‘ung tieu (T ‘
ai p‘ing yü lan, Kap. 7 96 , p. 8) die
fo l gende Vers ion dieser Legende : „Die Zw erge leben im S üden
v on T a Ts‘in [der he l leni sti s che Orien t]; i hr Wuchs beträgt nur
dr ei Fuß . Während sie der Bes tel l ung ihrer Fe l der nachgehen,fürchten sie v on den Kran i chen vers ch l ungen zu w erden. Jedesmal, w enn T a Ts‘in ihnen in ihrer Bedrängn is Be i stand leiste t,vergel ten die Zw erge diesen Dienst du rch eine S endung w ertv o l lerWaren Tu Yu hatt e einen Verw andten namens Tu Huan, derim Jahre 7 51 von den Arabern in der S ch lacht bei T ales gefangengenommen w ur de
,dann Zentra las ien und arab is ches Geb iet
bis zum Mi tte lmeer durchw anderte und end l i ch im '
Jahre 7 62 auf
dem indis chen S eew ege nach Kan ton in China zurückkehrte . Dorts chrieb er ein Werk über se ine Abenteuer
,das lei der ver loren
gegangen ist,v on dem aber Fragmente im T‘ung t ieu seines Ver
w andten Tu Yu au fbew ahrt s ind . Da w ir in d iesem Buchearab is che Überl ieferungen finden
,die mit guten Gründen auf
B i r t h (Ch ina and the Roman Orient p. 87 ; 202) z i tiert diese Sagenach dem Wen b ien t‘ung k
‘
ao des Ma T u a n — l in v om Jahre 1319,der
j edoch in diesem F al le das äl tere T‘ung tieu w örtl ich ausgeschrieben hat .F . W . K . Mü l l e r (Z . f . E thnologie 38 , 1906
, p. 750) bez ieht sich aus
schl ieß l ich auf die j apan ische Ausgabe v on 17 13 der ch ines ischen Buzyklopädie S an ts
‘
ai t‘
u ha i v om Jahre 1607, ohne selbst Ma Tuan-l in ’
s zu
erwähnen . Dieser Passus sam t der schw achen Illustrat ion war üb rigenslange v orher v on F . de Mel y (Le «de Monstr is » ch ino is, Revue archeo l .1 897
, p. 353) v eröff entl icht w orden . E s bedeutet natürl ich w enig , he llen ischeoder andere westl iche S tofie in der ch inesischen Literatur nachzuw eisen ;die Hauptsache b le ibt, dieselben auf ihre äl testen Quel len zurückzuführen und
zu zei gen, wann und auf w el chen Wegen sie nach Ch ina eingedrungen sind.
202 Berthold Laufer
sie gehen,und legen an e in em Tage tausend Mei len (li) zurück .
S ie s ind alle geb il det und s cheuen davor zurück , einander zuk ränken . Die e in zigen Ges chöpfe, die sie fürch ten, s in d die
Kran i che,die vom Meere her kommen . Diese Kran i che, die mit
einem einzigen Fluge tausend Meilen machen, können sie v er
s ch l ingen ; doch die Leute, die dre i Jahre alt s ind,erliegen n i cht
ih rem Angriff. “ Das S chén i king gehört zu den s chw er datierb aren Werken . Die Verknüpfung m it dem Nam en des Tung-fangS o (zw e ites Jahrhundert v . Chr.) i st n i ch ts anderes als e inetaoistische Legen de ; die Annahme , daß das Werk im vierten oderfün ften Jahrhun dert n . Chr . entstanden sei
,ist w ahrscheinli ch , und
das Al ter unseres Textes w ird durch sein e Aufnahme in die imJahre 983 vol lendete Enzyklopädie T ‘
ai p‘ing yü lan (Kap. 7 97 ,
p.
f
9) gew ähr le i stet. Im dritten Jahrhundert ber i ch tet Y ü H u a nin seinem Wei lio von e inem Z w ergenreich im Nordw esten von
S ogdiana (K ann ü)‚ w o Männer und Frauen dr e i F uß hoch s ind(C h a v ann e s , T‘
oung Pao 1 905 , p. Im T‘ung tieu des T u Y u ,der di esen Text kopiert hat (T ‘
ai p‘ing yü lan , Kap. 7 96 , p. 7 b) ,
i st der Zusatz en tha l ten,daß d ieses Land kostbare Ede l s te ine
sow ie die in der Nach t leuc htenden und die mondhe l len Per lenhervorbringe ; bei d ieser Vors te l l ung hande l t es si ch um eine denChinesen aus dem he l len ist i s chen Orient verm itte l te Trad i tion, dieVerfasser in se iner Abhandlun g ‘T he Diam ond
,a S tudy in Ch inese
and He l len is ti c Fo l k-lore’
e in gehend darges te l l t hat . Y ü Hn an
hat üb erd ies den Ch inesen das Bi l d der antiken Kentauren odervie lm ehr Hippopoden zuge führt : „
Gre i se unter den Wu-sun er
zähl en,daß s ich das Lan d der Leute m it Pferdescb enkeln bei den
nörd l i chen Ting-fi ng befinde ; ihre Sprache glei che dem Ruf w ilderGänse und En ten ; ob erha lb der Kn ie hätten sie e inen mens chli chen Körper und Kopf ; un terha lb der Kn ie hätten sie Haarw u chs
,Pferdeschenkel und Pferdehufe ; sie s t iegen n i ch t zu Pferde,
son dern lie fen s chne l ler als ein Pferd ; sie se ien tapfere und kühneLeute im Wenn s i ch nun d iese nur aus dem He lle
In Anbetracht der Tatsache,daß die Pygmaen , Amazonen ‚ Hunds
k0pfe und an dere W undervölker v on der ch inesi schen Sage in den ostli chen
Ozean v ersetzt w erden, ist es interessan t , daß in der E nzyklopädie S an ts‘
a it
‘
u hui die e inen Katalog der W undervölker enthäl t, auch die Tingl ing bewohnenden Pferdefiißler im Meere anges iede lt w erden . Man sieht an
E thnographische S agen der Chinesen 203
n ismus zu erk l ä rende Vors tel l ung im S chau hai king befindet,w orauf C h a v a n n e s h inw e i s t, so i s t es ohne w e iteres kla r (und d iesw i rd du rch vie le andere Texte bestätigt), daß d iese m erkw ürdigeKosmograph ie n i ch t das fabc lhafte Al tertum beanspru chen kann ,das i hr ch ines ische Ge leh rte und in i hrem Bann befangene europäische S inologen zuschre iben ; in der uns vor l iegenden Textgesta l t i s t das Buch zur Han-Ze i t red igier t w orden und hat
,w as die
Wundervölker betriflt, s tarke Einflüsse vom He l len ism us erfahren.
Wenn die Chinesen und S inologen an dem Versu ch ges che i terts in d
,se inen Inha l t und se in Wesen zu deuten
,so l iegt d ies daran
,
daß i hnen d iese Zusammenhänge fremd geb l ieben s ind : nachm e iner Au ffassung is t das S chau hai k ing nur aus dem He l lenismus zu erk l ä ren und geradezu als he l len istis ches Produk t aufzu fassen. In dem se lben Werke begegnen w ir auch e iner Andeutung betreffs e ines Pygmäenlandes, das jense its des östl i chenMeeres in e iner großen Einöde proj iz iert w ird . S c h l eg e l (T‘
oungPao IV
,1 893
, p. 324) b emerkt, daß die ch ines ischen Anna lendiese Zw erge ”
des äußersten Nordos tens n i ch t erw ähnen ; d ies i stin dessen ein Irrtum ,
denn im Nan shi (Kap. 7 9 , p. 3 b), das die
Ges ch i chte Ch inas vom Jah re 420 bis 589 behande l t und das inder ers ten Häl fte des s ieben ten Jah rhunder ts v on L i Y e n - s c h o nverfaßt w erden ist, w i rd im Ansch l uß an e inen Ber i ch t über Japanunter dem Namen Chu -éu ein Land der Pygmäen erw ähnt
,die
d iesem Be ispie l , w ie h ier die Legendenb ildung nach e iner S chab lone arbe i te tund Geograph ie und E thnograph ie fabriz iert . Nach S olinus gab es ein
Volk Hippopodes im S kytb enlande ; die Hereford-Karte gibt e ine A bb i ldungmit der Bem erkung „
equinos pedes b ebent “ und verlegt ihren Wohnsi tz indie Nähe des kaspischen Meeres (vgl. L. E . I s e l i n , Der m orgen länd ischeU rsprung der Grallegende p.
E ine al lgeme ine Beze ichnung für Zwerge (L e g g e , Ch inese C lassics V ,
p. 422; Nach den Bambusannalen (d. h . auf Bambustafelu geschriebenenA nna len) so l l ein Häuptl ing der Zwerge s ich bereits dem myth ischen KaiserY an unterw orfen und im Wasser untersinkende F edern als T ribut dargebrachthaben (L e g g e , Ch inese C lass ics III , Pro l . p. Diese F edern sind an
s ich recht v erdach tig. Die Bambusannalen,die im Jahre 299 v . Chr . in
e inem Grabe geborgen und im Jahre 281 n . Chr. aus Licht gezogen wurden,
s ind , w ie C h a v an n e s (Mémoires h istoriques de S e-ma Ts‘ ien V, p. 446— 479)in e iner ausführl ichen S tudie nachgew iesen hat , ein authent isches W erk,aber w ie Chav annes se lbst zugib t, ist die Möglichke i t späterer U marbei tungenn icht ausgeschlossen. Die Pygmaen als In terpolation aufzufassen , l iegt um
so mehr G rund vor , als dasselbeWerk von zw e i anderen Wunderv olkern be
204 Bertho ld Lauter
vier F uß lang sind . S c h l e g e l hat d iese Pygmäen mit den Korepokguru i dentifiziert, die in den S agen der Aion eine Rol le spie len ,nud ens der Kraft seiner Phantasie e ine Pygmäenrasse gescha ffen,die in unterirdischen Wohnungen ge lebt u nd die Küsten des
Japan i s chen Meeres vom Amur, die Inse ln des Japan is chen und
Ge lben Meere s sow ie die Ku r i len bis Kam tschatka bew ohn t habenso l l . Diese
„Rasse “ hat natü r l i ch nie exis tier t
,w ie Verfasser
bere its (Zentra lb la tt fur An thropo logie 1 900, p. 321 — 330) geze igthat . Der vagen Anw e i sung der Pygmäen im nordöstl i chen Meerekomm t ebensow eni g ein geograph ischer oder ethnograph is che rWert zu als z. B. den Pygmäen , die Odori c von Pordenone an
den Yang-tee v er legt (Y u l e , Cathay, neue Ausg .,Vol. II, p.
Es hande l t s i ch vie lm ehr um einen Nachha l l he l len i sti s cher S age,denn n i ch t nur die Pygmäen , sondern auch die Amazonen und
Hundemenscben s ind mit jenen von den Chinesen in den nordöst l i chen Ozean versetzt w orden . Der Fa l l der Hundemenscbenist besonders s ch lagend .
S ieht man v on e in igen zusammenhanglosen Noti zen bei Hes iod,S imm ias von Rhodos und Aischy los sow ie v on Herodots (IV 1 9 1)etw as vagen norda frikan is chen xv vozérpa l oc ab
,so i st Ktesias in
seinen In di ca 20,22— 23) der erste, dem w ir e ine ausführ
li che Bes ch re ibung eines indis chen Vo l k sstammes unter dem Namender Hundeköpfe verdanken, die Klauen w ie Hunde haben , aberl änger und run der
,und noch größere Zähne. Männer und Frauen
haben e inen S chw anz über den Hüften w ie ein Hund, aber größerund d i cker
,und begatten s ich nach Art der Vierfüß ler. S ie be
si tzen ke ine Sprache, sondern be l len w ie Hunde und verständ igens i ch auf diese We i se. Im Verkehr mit den übrigen Indem v er
stehen sie diese zw ar,sie se lbst aber können n i cht sprechen,
sondern machen s i ch durch Gebe l l und Gebärdensp ache ver
richtet , den Menschen mit durchbohrter Brust und den Langbeinen (L egg ep. v on denen sonst erst zur Han—Ze i t die Rede ist (A . F o rk e . Lun
héng, pt . I I , p. 263 und C h a v an n e s , La sculpture ä l’époque des Han p.
Der Name der v on F o rke erwähnten T an-érh , deren Ohrlappen bis auf die
S chul tern herabhängen,ist gew iß ein Nachhal l der ’
v z oxo tr a c des Ktesias
undMegasthenes , der Kargapravarm_
m,Kam ika, Lambakarpa, Mahäkarna usw .
der Inder. Im San ts‘a i t‘u hui (1607) ersche in t ein Vo lk der Langohre,die ihre bis auf den Gürtel herabhangenden Ohren auf dem Marsch mit denHänden festhal ten.
206 Berthold Laufer
l i che Wo-tsü, eines S tammes an der Ostküste Koreas : Man erzäh ltferner , daß s i c h im Meere ein Frauen land befinde t
,w o es nur
Weib er, aber keine Männer gib t. In diesem Lan de gibt es e inenw underbaren Brunne‘
n : w enn die F rauen in diesen h ine ins chauen,so gebären sie a l sba l d Kinder . “ Es is t von großem Interesse,daß Ma Tuan-lin in seinem Ber i ch t über T a Ts‘in (H i r t h , Chinaand the Roman Orient p. 84) von e inem Amazonenreich im
Wes ten spr i cht und anfügt,daß die Frauen dort unter dem E in
fluß des Wassers Kinder gehären. Diese Tradit ion muß a l sow ohl
, w ie auch Hirth (p. 200) fol geri ch tig ann imm t, unm i t te lbaraus T a Ts‘in geflossen sein und in China bere i ts zur Han-Ze i tbestanden haben
,w ie der ana loge Text der Han -Annalen zeigt
und es w ar b ere i ts in der Han-Periode , daß un ter dem Einflußder taoistischen Wundermänner die he l leni sti s chen Wundervölker
in den nordöstl i chen Ozean festge legt w urden . Z um Te i l,w ie
w ir noch sehen w erden, setzten d iese Bestrebungen schon unterder vorausgehendeu Ts‘in—Dynast ie im dritten Jahrhundert v . Chr.
ein. In der von K l apr o t h (Apercu généra l des troi s royaumesp. 149) nach der chines i s chen Reichsgeographie übersetzten Bes chre ibung Koreas w ird jene S age e inem Gre i se v on Wo_ tsü in
den Mun d ge legt, der noch h inzusetzt,daß diese auf e iner Insel
im Meere der We-tsü lebenden F rauen nur m it einem Gew andeaus Zeug bekleidet die S ee durch schw immen
,daß sie in i hren
körper l i chen Eigenschaften Chinesinnen gle i chen und daß die
Ärme l i hrer K lei der dre i Klafter lang seien . Im Ling w ai tai ta
des Ch en K‘
ü -fe i v om Jahre 1 1 78 w ird e ine Amazoneninsel imOsten von Java erw ähnt, w o die Frauen, w enn der S üdw ind w eh t,s i ch en tk le i den und vom Winde konzipieren, aber nur Mädchengebären (P e l lio t , BEFE O IV, 1 904 , p. 302 ; H i r t h und R o c k h i l l ,Chan Ju-kua p. Brunnen und Windmotiw vere inigt er
s che inen im S an ts‘a i t‘u hu i . Ebenso erzäh l t Qazw ini von e inerFrauen insel im Chines is chen Meere, w o die Frauen vom Windeempfangen und nur Mädchen zur We l t bringen
,w ährend sie nach
anderen v om Genuß e iner Baumf rucht schw anger w erden (G. F e r
r an d,Textes re la t i fs a l’E xtréme-Orien t p. S odann findet
s i ch diese Form der Legende bei Japanern und Ainu (B. H . C h amb e r la in ,
Language, Mythology etc . of Japan view ed in the Ligh tof Ainu S tu dies p. 22 ; B. P i l s u d s k i
,Materia l s for the S tudy of
E thnograph ische Sagen der Chinesen 207
the Ainu Language and Fo l k lore p. 9 1 , Verö ffent l i chung der
Kai s . Akadem ie von K rakau). Üb r igens hat die S age von der
F rauen inse l n i chts m it der von P i i s u dsk i m itgete i l ten Ainu-LegendeNr . 5 zu tun, w ie er me in t
,noch ist die von ihm vorgetragene
med izin is ch-pa tho logische Erklärung auf letztere anw endbar ; es
hande l t s i ch h ier v ie lm ehr um e ine a inu-giljakische Ent lehnungeines nordw estamerikauischen Mythus , den s chon F . Bo a s (Indian is che S agen von der Nord -Pazifischen Küste Amerikas p. 24
,66)
behande l t hat und der unter dem Tite l vagina den tata den Am erikanisten in vie len Var ianten bekannt ist. F . de M ely (Revuearcheol . III, 1 89 7 , p. 37 2) hat w oh l m it Rech t bemerkt, daß dieVors te l l ung von der Konzept ion durch den Wind in der ch ineeis chen T radition auf den Einfluß griech is cher S age zurückzu führenist ; dasse lbe gi l t w oh l auch v on dem Brunnenmetiv . In dem
berei ts erw ähnten Nan sch i (Kap. 7 9, p. 4) finden w ir nun die
Hundemenscben unm i t te lbar an die Amazonensage anges ch lossen,die der berü chtigte Sramana Huei S chön w ieder in Um lauf setzte .
Wie bekannt,so]! derse lbe im Jahr e 4 99 nach China zu rück
gekehrt sein und e inen Beri cht über das fabe l hafte Land F u-sangerstattet haben
,der zu der sensat ione l len Hypothese einer ch ine
s iseh-buddhistis c hen Entdeckung Amerikas Veran lassung gegebenhat (9 . zu letzt T‘
oung Pao 1 9 15, p. Huei S chön w ar n i chtsanderes als ein l i teraris cher Betrüger, w ie sie zu j ener Ze it inChina b l ühten , der l ängst bestehende Traditionen zusammenschw eißte und durch n i ch t einma l sehr ge istre i che Um formungenund Umdeutungen e inen cthuographiscben Roman zusammenb rau te,den nur mit gle i cher Phantas ie begab te Ge ister fü r bare Münzehinnehm en konnten. Der Text des Nan s ch i lautet fo l gendermaßen : „Über tausend Mei len (Zi) östl i c h v on Fu- sang l iegt dasFrauenreich. Diese Weiber haben regelmäßige Körperform en und
e ine w e iße Hautfarbe, doch ihr ganzer Körper ist m it Haarenbew achsen, und ihre Kopfhaare sind so lang, daß sie auf die
Erde herab fa l len. Im zw e i ten oder dritten Monat baden sie in
e inem Pl usse und w erden davon s chw anger ; im se chsten oders ieben ten Monat gehären sie Kinder. Diese We iber haben ke ineBru stw arzen
,sondern Haare hin ten am Nacken ; die w e ißen Haare
entha l ten eine F l üssigkei t, mit der sie i hre Kinder säugen . HundertTage nach der Geb urt können die Kinder gehen, so daß sie im
208 Bertho ld Lauter
d r i tten oder vierten Jahre erw achsen se in durften . Beim Anb l i ckvon Männern e rgre i fen sie en tsetzt die Flucht
,denn sie v erab
s cheuen jeden mannlicheu Verkehr. Wie w i l de Tiere l eben sie
von sa l zha l t igen Pflanzen (Genus S a l sola), deren Bl ä tter denender Pflanze sie han (S ese l i l ibanot is ; G . A . S t u a r t , Chinese Mater iaMed i ca p. 4 05) gle i chen , die angenehm duft en
,ab er sal zig von
Ges chmack s ind . Im sechsten Jahre der Periode T‘ien-kien (507n . Chr.) der Liang-Dynas t ie w ar ein Mann von Tsin-ngan (inT s
‘
üan - chou,Prov inz F u —kien), der das Meer durch fuhr u nd v on
e inem S turm auf e ine Inse l versch lagen w u rde. Als er se inenF uß aus Land setzte , tra f er auf die Bew ohner, unter denenFrauen und Manner s ich scharf unters ch ieden : nur die Frauengl i chen denen von China, redeten aber e ine unvers tänd l i che Sprache .
Die Männer besaßen e inen m ensch l i c hen Körper, d agegen den
Kopf e ines Hundes , und i h re S timme tönte w ie Hundegebe l l .K le ine Bohnen b i l de ten i h re Nahrung
,und i hre Klei dung sch ien
aus Zeug gemach t zu se in . Aus ges tampfter Erde w aren die
Wände i hre r Wohnungen verfertigt, die in Kreis form erbaut w arenm it höhlenartigem Eingang.
“ Hier haben w ir a l so diesel be klareS che i dung zw is chen mens ch l i ch geform ten Frauen und hundeköpfigen Männern innerha l b e iner sozia len Geme ins chaft w ie beiAdam von Bremen . Diese au ffal lende Übereins timmung kannn i cht auf Rechnung e ines bl inden U ngeiährs gesetzt, sonde rn sie
kann nur so erk l ärt w erden , daß der europäis che und chines is cheCh roni s t aus e ine r geme insamen Que l le geschöpft haben , und d iesw i rd e ine aus dem A lexanderroman gefiossene oder dam i t in Verb indung stehende he l len i stis ch-or ienta l is che Quel le gew esen sein
In d ieser Fo rm ist die S age den Chinesen b is ins dre i zehnteJah rhundert lebendig geb l ieben , denn der armen is che Kön igHaithon erzahlt, daß es jense its von Khata i ein Land gebe , w odie Frauen m en sch l iche Form haben und mit Vernun ft begab ts ind
,w o dagegen die Männer die Ges tal t von Hunden haben,
vernunftlos , groß und b ehaart s ind . Diese Hunde erlaubenn iem andem ,
i hr Geb ie t zu betreten ; sie l iegen der Jagd ob und
nähren s ich w ie die Frauen von dem erbeuteten Wi lde (vgl .Ktesias) . Die Knaben , die aus der: Verb indung dieser Hun de m it
den Frauen ents tehen,gle i chen Hunden , dieMädchen aber Frauen
Vgl. K lap r o t h ,Apercu des entreprises desMongols '
en Géorgie et
en Arm énie (Nouveau J. A .
,Vol. XII
,1833, p. 287
,w o K l ap r o t h auf die
21 0 Bertho ld L auter , E thnograph ische Sagen der Ch inesen
U rkunde “ des Euh emeru s, in dessen Gruppe glucklicher Inse lnsi ch dre i besonders ausze i chneten, um zu der Überzeugung zuge langen , daß der ch inesi sche Gedankenkre is n i ch ts anderes als
ein Reflex gr iech is cher I deen ist,die durch den he l len i stis chen
Orient und Zentra las ien verm i tte l t w u rden . Dem he l len i schenVorb i l d ge treu haben die Chinesen die Wunder inse ln und Wun dervö lker in i
den östl i chen Ozean ge legt, nur daß natu rgemäß fü rsie, w as den Hel lenen der Indis che Ozean w ar
,der S ti l le Ozean
w erden mußte. Diese geographi sche Versch iebung ab er, die gle i chze itig m it der Ausdehnung ch ines i s cher Mach t im Pazifischen
Meere in Verb indung steht, darf uns n i cht verh indern an der Erkenntn is der w irkl i chen his toris chen Zusammenhänge, die den
H el len ismus m it dem Chinesentum verknüpfen . Die rea le Grundlage für d iese U n tersu chungen l iefern uns die auf das Land T aTs‘in
,den he l len isti s chen O r ien t, bezuglichen Texte der ch ine
sischen Anna len : sie ze igen uns v or a l lem,daß m it den Handel s
artike ln des vorderen O r ients und Ind iens auch he l len is tis chorien ta l is che S age nach China e ind rang und daß insbesondere dieKenn tn i s der Ede l s te ine und ihrer Eigen s cha ften v on dor t eingeführtes Gut ist . Die ch ines i s che Minera logie (von einer so l chenkann nur in b es chränktem Maße die Rede sein), Alchem ie, Astronom ie und Astrologie (w ie insbesondere F. B o l l geze igt hat)w u rze ln im Hel len i smu s ; ebenso aber zah lre i che F ab e l u , Wunderges chi chten und re l igiöse Vors te l l ungen , w ie Verfasser in e inerRe ihe v on Einzel s tudien zu ze igen hofft. Die gesam te frühetaoistische Literatur m it ih ren Mi rake ln
,Zaubern
,Natu rw undern,
se l tsam en Mens chen und Moustern i st s tark v om He l len i smusangehau ch t : n i ch t nur äußerl i ch , sondern auch innerl i ch is t sieder a lexan dr in is chen Literatur der Wunderbü cher, den 3 avydow ,
n agdö‘
oäa und iöcoq wfi eng verw andt (F . S u s em ih l, Ges ch i ch teder gr iech is chen Literatur in der Alexandriuerzeit I, p. 463
Auf dem Geb iete der Mechan ik und techn is chen Erfindungen l äßts i ch ein gle i ches Maß he l len i sti s cher Einflüsse nachw e i sen : dieGlasur der T ongefaße, die a l lm ähl i ch zu r Herste l l ung des Porze l lansführte und die da für notw endige Vorbedingung s chuf, i s t aus demvorderen O r ient nach Ch ina ge langt
,ebenso das Glas . Die
Mechan i k und Ingen ieu rkunst der Han-Zei t s teht vö l l ig im Bann
der großen Me i ster v on Alexandria.
On two cases of metrical shortening of a
fused long syl lab le, Rig-Veda 8. 18. 18 and
6. 2. 7.
By
Mau r i ce Bloom fi eld (Ba l timore).
In JAOS XXVI I, p. 7 2ff. ,
I proposed to read in RV , 8 . 1 8 . 1 3
r im'
sis_
täyur for 7virisista yzZr of the tr ad i tional tex t, and
,further
,to
cons ider 1"ir isfsfz@u r as changed in de ference to m etre (cadencefrom T he stanza reads w i th ou r emenda tion
,
yo'
nah ka'
s‘
cid r i7'iksati r alcsastuéna nuir tyalr,suäz
°
h S ci éväi r ir isi ,stäyu r j c'
mala,
‘T he m 0 r tal w ho w ith demon i c practi ces desires to harm usmay that person bv h is ow n do ings injure hi s l i fe ! ’ ProfessorO l d e n b e r g in bis exce l len t Rgveda Noten to the passage i snot at all convinced by th i s treatm ent of the text. Because thestem dunya
’
occurs in the tw o fol low ing stanzas, he w ou l d fo l lowthe Pet . Lex . in changing yair in 8 . 1 8 . 1 3 ° to dvayzir , thus ob
tainiug, svä'
z
'
lz _sci éväz
'
m'
m'
sista dvayzir j dnalz,‘May the treacherous
man come to harm by h is ow n pract i ces ! ’F i rs t
,as to the accent of yzir in the text of the redactors .
T his proves noth ing,because the redactors w ere bound to furn i sh
thi s (to them) mouosyllab le w ith an accen t,w hether they assoc iated
any mean ing w i th i t,or not . Rather w e may ask
,w hy shou l d
they hav e cu t off the firs t sy l lab le of the to them fam i l iar w orddvayd, w h ich they had under the ir very eyes in the next tw ostanzas ? T he cruc ia l poin t, how ever, is th is : m'
r isista i s causative,
‘do harm ’
; not neuter, ‘take harm ’
. I t requires an accusative as
in 6 . 5 1 . 7 : svaya'
m r ipzis tannc‘
w_
n‘May the ras ca l inj u re
14*
212 Maurice Bloomfield
h is ow n person l’ O l d en b e r g seem s to recogni ze th is ob s tac le to
the ol der explanation , b ut the w ay in w h i ch he obv iates i t seem sto m e rather s tra ined . I cite . bis w ords : „ (E S ) ist nach h in
re i chenden Ana logien doch '
Z usammenfallen der Bedeutungen‚s ich
beschädigen‘und
‚etw as (dem e igenen Ich Gehö riges) beschädigen‘
in dem se lb en Med ium n i ch t zu b eanstanden .
“ But the pla in fa cti s that the redupl i cated stem rin
'
,s i s causat iv e and trans i tivew i thout except ion in the Ved i c language, and that r iri,si‚sta in the
sense of ‘take harm ’
,is contrary to Ved i c usage , no matter how
justifiable by antecedent logie.
Ne i ther O l d e n b e r g nor myse l f had noted that the com b inat ions rimi,s c7
'
yulr, and rim'
_
s tanv c‘
un oc cur e l sew here . T bus RV.
1 . 89 . 9 , m ä'
no m adhyä rim'
szüä'
yur gain tofz,‘do no t inj u re our l i fe
in the m i dd le of i ts cou rse ! ‘ RV. 1 . 1 1 4 . 8, m a'
nas toké tdnaye
m a na äyffu rir isalz,‘do not inj ur e us in chi l d , pos t-erity , or
l i ving thing ! ’ RV . 1 . 1 14 . 7 , m ä'
nah paz'
yä'
s tanvö m dr a fi ri‚sal
_
r‚
‘do not, 0 Rudra,injure our dear (ow n) bodies ! ’ AV . 1 1 . 2. 29
,
swim tanväm r udr a m a'
r iriso nal»,
‘do not, 0 Rudra, inju re us in
our ow n body ! ’ Cl. a l so RV. 1 0 . 1 8 . I , 77c nah pr q iäz_n 1'27*i80
m ötci vi r ä'
n ,
‘do not inju re our offspr ing, nor yet our heroes (sous) ?And I w ou l d repeat that the suggestive para l le l RV . 8 . 9 7 . 3
a l so conta ins a causati ve : svä'
il_
c sd éväir m zmm r a t pö‚sia1_n m yim ,
‘m ay be (the impious man , a'
devaynlz) by h is ow n do ings destroythe th ri ft of h is w ea l th ! ’
T he s ingu lar ity of the m etri ca l shor ten ing of the fused vow e lin 8. 1 8 . 1 3 i s reflected in the perplex ity of the redactors . ‘
It
i s,indeed, so singu lar that they do not know w hat to do w i th
i t ; hence the ob vious need of m ending th e text. I canno t seethat the m etr i ca l practice at the bottom of ou r explanat ion ismore v io lent than that w h ich under l ies the format ion fci;sama ,
rhythm i c iamb i c d ipody for 7‘ci-säm €
g
‘he for w hom the saman rs
made upon the ;rlc’
or, even more obv ious ly, virä,sff_t2) for v ir a
_
sä'
t‘conquering meu ’
. Ci. a l so O lde n b e r g’
s note on supräyap ci, RV.
Noten to 2. 3 . 5 , and, perhaps, con tras t AV. 12. 1 . 4 7 8
, yé te
pa’
n thäno baha'
vo j anä'
yanälr (m etr ica l for j ana -
yänälo.) w i th T S .
1) S ee the author
,JAOS XXI , p. 50 ; WZKM XVI I , p. 1 50.
2) On the short i of v iräsät see my remarks, IF XXV , p. 1 94.
214 Maurice B loomfield, On tw o cases of metrical shorten ing
i s very frequen tly jus t the Opposi te, aj dr ale, or ajw :yoilz (of. ayasra ,frequent epi thet of Agn i) ; see, e . g. ,
10 . 88 . 1 3.
Päda 6 . 2. i s to b e read me tr i ca l ly, r azwdlz purivqj üriydlc.But i t cons ists of the separate w ords
,razma
'
lt pum’
iva ajun'
dlz,fused in to r azwdlz purä
‘
väjur ia'
lz, w hi ch required for caden ce ’ s sakethe now es tab l is hed metathes i s of quantity in the thir d and four thsy l lab les from the end
, y ie l d ing r azwdlz purivaj ür icilz. This thetrad it ion
,in c l uding the Pada-kara d i d not understand , and w ere
not in the posi tion to treat otherw i se than by abs tracting theapparen t w ord j ü
'
7yalr w rong in the abscence of the negativ eprefix ; changed metr i caussa in the quant i ty of i ts root—vow e l !changed as to ac cen t w h i ch seemed natura l to the form of
the word ; and,
fina l ly , a ein . key. devo i d of sense. Trans latethe second d is ti c h ‘
(Agn i) love ly , as if in a cas tle imperishab le,l ike a son sure to b e protected ’
.
A Sasanian Seal w ith a Pahlav i Inscription .
By
A . V. W i lliam s Jackson (Co l umb ia U n i vers ity, New York City).
I t i s a pleasu re to comm un i cate som eth ing in the vol ume tobe pub l i shed in honor of Professor Kuhn’ s seventieth b i rth day ; andh is b road interes t in I ran ian as w e l l as Ind ian s tudies a l low sme to choose a b r ie f topi c from the Mi dd le Persian doma ina note regarding a S asanian gem employed as a sea l and adornedby an inscript ion in Pah lavi .
T he gem i s sa i d to have been found among some ru ins inancient Baby lon ia and i s now the property of Dr . George F . K u n z ,of the noted firm of Tiffany and Company, New York City .
Dr. Kunz ’ s pub l i shed w orks on pearl s, ivory, and prec ious stonesare w e l l know n to students of art in the jew e ler ’ s l ine . I t w asdue to him that the gern under cons i deration cam e to my attention.
As the reproduction here given w i l l show , the sea l i s of
the ova l form fam i l iar in S asanian gem s of the kind and ispierced by a s tr ing-ho le for the conven ience of its origina l ow nerin carry ing i t for signature purposes . T he mater ia l of w h ich itis made i s a beauti fu l transparent aquamar ine, and i t measures ,
21 6 A . V . W i l l iam s Jackson , A S asan ian S eal w ith a Pahlav i Inscription
in length , b readth , and depth , 2.0 X 1 .8 X 1 .7 cm . T he sea l ishandsome ly car ved w i th the figure of a zehn , or humped bu l l , as
is common in the case of su ch gem s, and th is device i s surroundedby a c learly inci sed ins cription as the reproduction proves .
Al though I have never specia l ized in the subjec t of Pah lavigem s and sea l s, I have been ab le to dec ipher the legend uponi t, with the exception of the first w ord , w h i ch rema ins to medoubtful . I leave the read ing of that one w ord
,w hi ch I have
rendered w i th a query for s cho lars be tter qualified than myse l fto determ ine.
I t is c lear that the las t four w ords are to b e read as Rästi
Apastän‘
al Yazdän,
‘Justi ce, He lp of God’
. This sam e supers cr iption is foun d on sim i lar Pah lavi sea l s (cf. H o r n and S t e i nd o r f f , S asanidische S iegelsteine, Berl in 1 891 , p. 37 f. , No.
T he firs t w ord , as a l ready s tated, rema ins to me uncertain , thought he in tern a l letters of i t are sure -5n i On the w hole I amin c l ined to read i t as daéni/z, an ab s tra c t from the Pah lavi adject ivedaén
,
‘r ight’ (of. W e s t and H a u g,Glossary and Index of the
Pah lavi Book of Ar da V irai, Bom bay and London 1 874 , p.
If th is b e correct the Pah lavi legen d on the sea] w ou l d b einterpreted as B asnik R ästi Apastän
‘
al Yazdän ‘Right,
Jus ti ce, He lp of God’
.
21 8 J . Hel l
D i ch tungen und in der Zuerkennung der Autorscha ft von der
Handschrift der Überl ieferung Abü S a‘
ids abw e i cht . Wir en t
nahmen nun aus ih r , w as n i cht in der Über l ieferung Abü S a‘
idsvorhanden i st, te i l ten das in dre i Tei le näm l i ch in den ersten ,
sechsten und achten und ergänzten so d iese (vor l iegende) Hands ch r i ft
,indem w ir j edes Ding
,sow ei t es m ögl i ch w ar
,an die ihm
zukommende S te l le b rach ten . U nd bei A l lah dem Erhab enen istdas Ge l ingen ! Ich hab e d iese Anordnung übernommen v on der
Vor lage (au sbat al—asl) , von der abges chrieben w urde ; sie stamm t,w ie in d ieser Handsch r i f t festgestel l t ist, v on der Hand des Jahjäb . al-Mahdi al-Husaini und i st datiert v om Jahre 882. U nd me inDatum i s t das Jahr 1 284
,in der gl änzenden S tadt (Medina) . Über
dem,der ih r den Glanz verl ieh
,sei der b este der S egensw üns che
und das He i l ! “Diese etw as schw erfallige Ein le i tung zerfa l l t außerlich n i cht
erkennbar in zw e i Tei le : in den Vermerk des U rhebersder V o r l a g e , Jahjä b . abMahdi
,und. in e ine Hinzufügung des A b
s chre ib ers M . b . T alämid as-Sinqiti . S chon der erstere hat a l sodie S amm l ung der Hudhailitenlieder in der Rezens ion as-S ukkaris
n i ch t m ehr ganz auffinden können und s ich m it e iner anderen Überl ieferung behol fen , deren Gevv'
ährsmaun er n i ch t nenn t, w oh l w e i l erihn se lb s t n i cht festste l len konnte . Die acht Te i le, aus denendie Vor lage kompi l iert ist, s ind durch Randve rmerke kenn tl i ch gem ach t. Es i st ohne w e i teres zu ersehen
,daß die S ukkari -Rezens ion,
die Jahjä b . aI-Mahdi vor s i ch hatte,fragmentar isch w ar ; n i ch t
,
daß sie w ie der Le i dener Kodex e inen Te i l vo l l ständig und
den anderri gar n i ch t en tha l ten hätte, nein, es b es tanden an v er
s ch iedenen S te l l en z u f ä l l i g e L ü c k e n ,die oft m i tten in e inem
Ged ich te einsetzten . Eben dieser Ums tand ermoglichte es Jahjä
b . al—Mahdi,die Eintei l ung in a cht Te i le aufrech t zu erha l ten und
das aus der zw e iten Handsch r i ft Übernommene m it e inem gew issenGrade v on Wahrsche in l i c hke it an der r i ch tigen S tel le der S ukkariRezens ion einzu fügen .
Un ter Zugrunde legung me iner Paginierung der Kodex Cah irensis ist n i cht paginiert versuche i ch den Inha l t unserer neuenQue l le u nd. se in Verhäl tn is zu den b isherigen Edit ionen in nachfo l gender Tabe l le darzuste l len
U ber den Hudhailitendiwän der Chediv ialbibliothek in Kai ro 219
Di chter E d iert 1 )
1 . Abü Du’
a ib 525
2.„alid b . Zuhai r 23
3 . Sa‘ i da b . Gu ’
aj ja 27 1
Al-Mutanahhil‘
AbdManäf b . Rib‘ W 1 39
,1 4 3
,1 42
,144
S ahr al—Gajj K 2, 3 , 1 6 , 1 7 , 18 ;
4,6,8,1 0
Habib al-A‘lam K 2 1,22
,23
Abu Kab i rAbu Hiräé
Umajj a b . abi‘
A’
id K 92,90
,96
U säma b . al-Hari tAbü
'
l-Mu tallim
Abn’
l-‘
Ijal
Badr b .
‘
Am irMal ik b . Hal i d
Hudaifa b . Anas[Gunäda b .
‘Am irA bu Qiläba w 1 54 , 1 55 , 1 53
A l-Mu‘
attal K 1 28 , 1 29 , 1 30
Al-Buraiq W 1 7 0,1 69
,1 68
,
b . Huw ailid) 1 66, 1 65 , 1 6 7
Ma‘
q i l b . Huw ailid K 6 1 , 53, 49 , 56 , 46
22. Qai s b .
‘
A izära 32
23. Mal ik b . al—Har it 1 9
W E d. Wellhausen ; K E d. Kosegarten ; die Zahlen beiW und
K beze ichnen die Num m e r des Gedichtes in diesen Ausgaben . Die laufendenNummern entsprechen der Re ihenfolge der Gedichte im God. Geh .
K e i n Hudhailit !
K 5,7,9,1 5
K 67 ,
69,7 1
,7 3
K 66 , 68, 7 0 , 7 2
K 7 7 , 7 9 , so, 89 ,
8 1,82
,85
K 1 06,1 03
220 J. He l l
Di ch ter Ed iert
Abü Gundub K 32 w con - cv
35, 36, 37 , 38
A bü Butaina 6 W 1 59 Vers 1 ; 1 60Anonymus 7‘
Amr b . Dahil 20
Sa‘ ida b . al-
‘
Aglän 23
Anonymer Zafarit 2
Ku laib 2
AI-‘Aglan 3 W 1 7 5
‘
Amr dü’
l-Ka lb 22 K 1 07
Gunüb 40 K 1 1 2, 1 1 0 1 1 1
S umme der unedierten Verse
Die G r e n z e n de r a c h t T e i l e “ in die s chon die
erste Vorlage Jahjä’
b . al-Mahdis zerfiel und die v on ihm un terHeranz iehung e iner zw e i tenHandschri ft aufrech t erha l ten w urden ,las sen si ch in vorstehender Tabe l l e ni ch t genau beze i chnen , dasie zum Te i l m i tten in ein Ged i ch t
,zum Tei l zw i s chen zw e i
Di chtungen des gle i chen Dichters fallen . Die nachstehende Übers i ch t dürfte, mit der ob igen Tabe l le zusammengeha l ten, vol le Klarhe i t b ringen
Um fangf. 1 ' — 9 ' Z . 1 6
11 f. 9" Z. 1 7 — 1 7" Z . 9 as-S ukkari111 f . 1 7 ' Z . 1 0— 22" Z . 1 0 as-S ukkariIV f. 22" Z. 1 1 — 26" u l t. as-S ukka riV f. 27 ' Z . 1 — 37' Z . 1 1 as-S ukkariVI f. 3 7‘r Z . 1 2— 4 7 ' Z . 1 6 XVII f. 37 r Z . 1 7 — 5 7 ' Z. 9 as-S ukka riVIII f. 5 7 ' Z . 10 — 64" Z. 1 1 X1) Die Handschr ift , die v on Jahjä b . 11 1-Mehdi zur E rganzung der Lücken
der S ukkarß R ezension herangezogen w urde,bezeichne ich
,da w ir den U r‘
heber n icht kennen , als „Rezens ion X“
.
222 J . Hel l
Der Wert der be i den Rezens ionen, aus denen die neue Que l lezusammengesetzt i s t, dü rfte s i ch sow ei t i ch das b is jetzt b eu rte i lenkann ziem l i ch die Wage hal ten
,um so m ehr als am Rande und
zw i schen den Ze i len der ganzen Handschri ft au ch noch Var iantenno tier t s ind .
Der Kommentar , der die ganze Gedi chtsamm l ung umrahm t,
ist n i ch t identi sch m it dem von Kosegarten edierten Kommentaras-S ukkaris und
,sow e i t es s i ch um Abu Du
’
aib handel t, auchn i cht m it dem Komm en tar der S onderhandscbrift (AdabOb der Kommen tar s chon aus den Vor lagen üb e rnomm en odervon as-Sinqiti h inzugefügt ist, vermochte i ch b is jetzt n i cht zuents che i den .
Wichtiger als die Vers ch iedenhe i t der Rezen s ionen is t die
Tatsache, daß unsere neue Quel le trotz der Verschw e iß ung zw e ierRezens ionen w en iger um fangre i c h i st als der Le i dener Kodex . Die
verhäl tn i sm äßige Knapphe i t tr itt in d re i facher We ise zutage :1 . Die G e d i c h t e , die bere i ts bei Kosegarten oder Wellhausen
ed iert und au ch im Kodex der Chedivialb ib liothek en tha l ten s ind,
sind h ier m e i s t en s um einen oder ein ige Verse kü rzer als in
den Edi tionen . 2. Von den D i c h t e r n,die berei ts bei K . u nd W.
ed iert s ind , i s t in der neuen Que l le vie l fach e ine w e i t geringereZah l von Gedi chten angefüh rt, so z . B. von
‘
AbdManäf b . Rib‘
4
(W : v on Umajja b . abi‘
A’
id nur 3 (K : von Abu Qiläba nur 3
(W : al-Buraiq nur 6 (W : 1 0) Qa is b .
‘
Aizära nur 2 (K : 9) usw .
Nur der Diw an des A buDu’
aib ist in unserer Que l le ebenso um fangre ich w ie in der S onderhandscbrift (Adab 3 . Eine großeAnzah l v on Di chtern und Di ch tungen , die w ir aus den Editionenberei ts kennen, feh len in der neuen Que l le vol l s tändig . S ie w arena l so offenbar w eder in der fragmen tar is chen S ukkari -Rezens ion
,
noch in der vo l l s tändigen Rezens ion X vorhanden . Da s i chin unserer Que l le Te i l II, I I I, IV , V lü cken los ane inander s ch l ießen(Bez. S ukkari und au ch innerhalb d ieses Te i les die verhäl tni sm äß ige Knapphe it festzus te l len ist, so kann es s i c h n i cht um L ü c k e nhande ln , sondern um die Existenz knapperer Über l ieferungen. Bei
genauer U n ters uchung finde t m an denn auch,daß die in unserer
Que l le feh lenden Gedichte im Le i dener Kodex zw ar angeführ t s in d ,aber m it dem Vermerk : nur v on al-Gumah i “ (s c . über l iefert) oder„nur v on Abu
‘
Amr und Abu‘Abda l lah ‘“ u . dgl . Es ist som i t in
U ber den Hudhailiteudiwän der Chediv ialbib lio th ek in Kai ro 223
unserer Que l le ein strengere r Maßs tab an die Echthe i t der Ged ich teange l egt a ls im Le idener Kodex . A ndererse i ts können a l le rd ingsauch Lücken vo rhanden sein , zuma l in der zw e i ten Vorlage (Rez. X)über deren Herkunft
,Um fang undBeschafle11heit s i ch der Abs chre iber
Jahjä b . 21I-Mahdi le i der vol l ständig ausschw e igt. Für das Vorhandensein sol cher Lücken sprich t die große U n rege lmäßigke i t dera ch t Te i le “
. Wie ein Bl i ck auf die zw e i te der ob igen Tabe l lenze igt
,um faßt von den dre i e ingefügten Te i len (Rez. X) der ers te
und zw e i te ungefahr je 1 0 S e i ten , der d r i tte nur 7 S ei ten unsererHandschri ft. Noch größer ist die U nrege lmäßigke i t der Texte derS ukkari -Rezens ion : Te i l 11 um faßt ca. 8 S ei ten, Te i l III 5 S ei ten,Te i l IV c . S e i ten, Te i l V c . 1 0” S e i ten
,Te i l VII c . 20 S e i ten !
A nges ichts d ieser au ffa l lenden Unrege lmäßigke i t der Te i le muß m itVerl usten des U rbestandes b e i d e r Vor lagen unserer Que l le ge
rechnet w erden .
Gle i chw oh l bedeutet die neue Que l le v on Hudhailitenliederu
mit i hren beträcht l i chen neuen Bes tänden mit i hren Para l le lenund Var ianten zu dem berei ts Bekann ten und i hrer Ausscha l tungungenügend verbü rgter S tücke e ine w esentl i che F ö rderung unsererKenntn i s d ieses kostbaren Te i les der a l tarab i schen Literatur.
Arabisch s af5äß Feuerstein.
C. F . S eyb old (Tub ingen) .
In m e iner e ingehenden Besprech ung von Ku ska s Ausgabeund Übersetzung des sog. S teinbuchs des Aristote les ZDMG 68 ,
606 — 623 habe i c h p. gesagt : „Petermanns S te in S albüchist meines Wissens noch n irgends lexika l is c h gebucht. “ Die
S te l le in Petermanns Reisen im Orient II, 1 33 lautet a l so :„In
der Nahe von S chuschter und Disful [Dizfu l], dem a l ten S usafindet s i ch ein S tein, ähn l i ch dem Feuers te in, w e l cher S albüchgenann t w ird. Dieser w i rd im Feuer zu fe iner Asche geb rannt ,und gibt dann mit Eiw eiß verm is cht e inen guten Kitt. Er finde ts i c h an und in dem Wasser, in kle inen und großen S tücken v on
versch iedener Farbe. S ie ve rm is chen dam i t auch S ernich [Z irnih](Arsen ik), und brauchen diese Mischung zur Verti l gung der Haare.
Den geb rann ten S albüch nennen sie Nura [Nura]. Mit Hol zas cheund Wasser verm i s ch t gibt d iese Nura ein prächtiges Baumater ia l .Al les
,w as im Wasser gebau t w ird, Dämme, und der Grund v on
Häusern ,w i rd dam i t gebaut. Auch die obern S ch i chten der
Dächer und die Dach r innen bestrei chen sie dam it,auf daß das
Regenw asser n i cht durchdringe. Da aber die Ho l zasche teuer is t,so kostet d ie s vie l . In der Nacht, so berichten sie, gibt d ieserS tein in Disful einen T on von s i ch
,und sie sagen , d ies sei das Ge
s chre i der Geb urtss chmerzen oder der Kinder der S teine, da d iesea l le Nächte neue gehären . Denn trotzdem ,
daß so vie le d ieserS teine w eggeb rach t w erden
,nehmen sie doch n i cht ab .
“ S onsthabe i ch den Namen d ieses S teins nirgends als in der kurzenNoti z E n t i n g s (Tagebuch e iner Re ise in Innerarabien) I, 1 1 6gefunden : „
E in unverfäl s chter S cheräri namens S a lbukh (S alhun
Eine neue babylonisch-gr iechische Paral lele.
C. Bezold und F r . Boll (Hei de l berg).
Im S ommer 1 889 las i ch bei der Kata logi sierung der Bib l iothek A sur banipals ein 32 zeiliges F ragm ent (K . das die
Bes chre ibung zw e ier Gotthe i ten en thäl t u nd als so l ches eine neueT ex tklasse der a l ten assy r is chen Büchere i z u unserer Kenntn isb rachte. Darin w ird z . B. ein Wesen ges ch i l dert m it zw e i Gaze l lenhörnern
, eines h inten und e ines vo rn (am Kopf) , m it dem Ohree ines Lammes und der Hand eines Mens chen , das mit be idenHänden Nahrung n imm t und zum Munde führt usw . Es ge langdann im w ei teren Ver lauf j ener Arbei t, den Text dur ch die Anfügung zw eier Bruchstü cke zu erw ei tern und e ine Reihe ä hn l i cherIns chri ften aufzufinden . Der Index des Cata logue (Vol. V, p. 21 1 6 b)verze i chnet elf Fragmen te, darunter ein Dupl i kat zu dem Haupttext K . Letzteren
,nebs t dem Dupl ikat, sow ie dr ei Bru ch
stücke habe i ch in ZA 9, p. 405 ff. veröffen tl i ch t, tran
skr ib iert und paraphras iert. In der offi zie l len Pub l ikation des
Br it is chen Museum s CT 1 7,42 fi
"
. ist diese Edition nachgedrucktun d um die Texte zw eier der von mir en tdeckten Bruchstücke ,K . 1 3 843 (vgl . Catal . p. und 81 — 7 — 27
,1 09 (vgl . Ca ta l .
1) Davon scheiden jetzt w ohl die S tucke K . 10 951 , K. II S 1 1 und
Sm . 1 72, deren Zugehörigke i t zu unserer T extklasse schon Cat . p. 1 126 , 1 19 7 ,
1 386 als fr agl ich bezeichnet w urde , w ieder aus. Die gelegentl iche Angabe ih einem Beschw örungstext CT 1 6
,1 9
,15 u 5umga llum 5a pi
—5 u
pitu „ein Riesenmolch U n gn a d ‚ Texte und B i lder I , p. 22) mit
geöfinetem Maul “ erinnert w ohl entfernt an solche Texte, s teht aber dam i tschw erlich in di rektem Zusammenhang.
a) [ina] ki » la —ti-c*u .s'
a77zi-i [5apis ?] b) 5umu -5u (iin) T i« (T ei lstrich) c) qaqqadu qaqqad ki
-is—su d) ina r i—it-ti—5ü e) im itti
E ine neue baby]onisch-griech ische Para l le le 227
p. vermeh rt. Dazu en tdeckte H o l m a noc h ein w e iteresFragment , K . 1 9 164 , das er in ZA 25
, p. 37 9 ti . pub l izierte, um
s ch r ieb und überse tzte .
Diese Insch r i ften erregten begre i fl i cherw e i se die Aufmerk
samkeit der Assyriologen und anderer Ge leh rter . Transk riptionenund Übersetzungen a l le r Texte gaben R . C . T h om ps o n ?) und
m it Ausnahme der letztgenannten d re i F ragmente P .
Von Besprechungen e inze lner Te i le s ind m ir noch die von
P e i s e r 7), J a s t r o w s
) und P r i n z ”) bekannt gew orden . Und P u c h s t e in kom b in ierte e inige der Be
s chre ibungen m it den Erze ugni s sen der E b e r s m itso l chen der agyptischén
Der Zw eck d iese r Ins chri ften w ar ab er b isher n i cht klar .
I ch glaub te sie als„Vorsch r i ften für die assyr i schen
auffassen zu müssen,die e ine bestimmte S tab i l i tät der küns tleris ch
w iedergegeb enen Göttera ttrib ute und e ine s trenge Überl ieferung
mit seinen beiden (Händen) [packt er ?) den Himme l . S einNam e (ist) Ti (T eilst r .) Der K0pf (ist) der Kopf eines (dasselbeWort w ie in Z z . 49 und 7 1 der J e n s e n sch en Zahlung
,die im folgenden
zugrunde gelegt ist) ; m it seiner Hand sein(er) rechteng) tu h) 5*umu «äu (oder : Ja) (T eilstr .) i) qaqqadu ku
ltb—th'
t j ) ina ilil k) (du ) N in . kiä. tir . r a per-mo am ilu.
m ) bu r-za-za n) r i-it- ta -äü o) [ina] kHa -ti-s‘ü p) bu -r a
S e in (oder : ihr) Name (ist) Der Kopf (ist) e ine K0pfbinde auf (oder : aber) W i ldschw e in J a s t r o w , R ef. 1 1 , 720)
das Gesicht (ist) .ein‘ Mensch (dasse lbe W ort w ie bei J e n s e n ,
Z z . 3,7 6) seine Hände [mit] se inen be iden (Händen)
52) T he dev i l s and ev il spiri ts of Baby lon ia II (London p. 146 11
Texte zur assyrischb abylouischen Rel igion (Berl in 1 9 1 5) p. 211.
PSBA 1 6, p. 278
,note : Z z. 4 — 22
,29 f. Me ine Textausgabe hat
S t r on g dort ignoriert. A l lerdin gs ist auch J e n se n se iner Gew ohnhe i t, diejew e il ige E di tio pr inceps neben der neues ten zu z it ieren , gerade bei diesemAbschn i tt se iner w ertvol len Bearbe i tu ng (p. 2, N. un treu gew orden.
5) KAT 429 : Z z. 6- 8.
Rev . d’A ss. V II
,12 : Z z. 5 — 8.
or. 12,370
,N . 1 : Z z . 7 — 8.
8) Re l igion 1 1, 876, N. 3 : Z. 16 .
A l toriental ische Symbo lik (Berl in p. 143,N . 2 : Z z . 6 — 8 .
10) Z A 9
, p. 4 10 11H) ZA 10
, p. l o1 ff.
Nin ive und Baby lon° p. 1 22.
228 C . Bezo ld und F r . Bol l
der Formgebung zur Voraussetzun g hatten und J e n s e n “
) i st derAns icht
,daß die h ier beschriebenen Bi l der vermu t l ich bei Be
schw örungen verw andt “ w urden .
Indessen s che in t nunm ehr v on ganz ungeahnter S e ite Lichtauf die Texte zu fal len : A ls mir im Feb ruar 1 9 14 me in FreundBo ll den vierten Korrekturbogen seines Bu ches „
Aus der Offenbarung Johann is“ (Berl in 1 9 1 4) zu lesen gab , fiel m ir b ei der
Durchnahme von p. die nahe Beziehung der dort m i tgete i l tenProben griech ischer Texte zu den assyrischen Bes chre ibungenauf, und näheres Zusehen überzeugte m i ch
,daß letztere m it den
Z a lpew xwrxd oder Z a lyeoxrw axoi au fs nä chste verw andt se inmüssen . A ußer dem In h a l t w ar dafür besonders die Wendungxa l elr a r de‘ (bei B o l l , p. 52, N. l ), die dem Assyris chenen tspri cht, auss ch laggebend ; auch J en 8 e n s Ve rm utung zu Zei le 4 1etw as E rsehenes (der E reäkigal für u-tu-tz
'
(ilu ) E red—ki-gal
erinner t an das griech is che 39aorg (Bo l l ,Wir haben demnach e ine B e s c h r e i b u n g v o n S t e r ngo t t
h e i t e n v or u ns,und es w äre n i cht ausges ch lossen , daß, w ie im
gr iech ischen , so au ch schon im assyrischen Text so l che „v on j e fünf
Graden oder Tagen“ vorl iegen, da die Fünftagezah l ja gerade auchin dem berühm ten astro logi sch-astronom is chen Lehrbuch CT 33, “T. ,
von dem in der Bib l iothek Asur banipals glei ch fa l l s Kopien erha l tens ind , eine bedeutende Ro l le In der T at feh l t es in unserenTexten n i ch t an as tro logis chem Einsch lag. S o gehören Z . 7 3
„Lahmu ’ s“ (h ier und Z z. 25 , 6 1 w oh l Appe l lati vum ,
n i cht Eigenname)
5) ‚des Himme l s und der Erde“
ebenso zum E a d. h . dem
südl i chen Bez irk des Himme l s w ie die Z . 1 5 ff. beschriebene Ges talt, und letztere, deren Körper ein „
subur —Fisch,vol ler S terne“
,
i s t,entspri c ht offenbar unserem C apr i c o r n us; vgl . s chon J e n s e n ,
a . a.. 0 . p. 5* f. Aueh die S eesch lange“
,den baému
,der Z . 1 8
m it e inem Te i l d ieser Gestalt vergl ichen w ird,hat bere i ts J e n s e n
1) Vgl. Die Ku ltur der Gegenw art 1 , i i i 1 2 p. 54.
A . a . 0 . p. 2 f. , N. 1 .
8) A . a. 0 . p. 5, Z . 4 1 .
Vgl. me ine und B o l l s Bemerkungen , S it zb . Heidelb. A k. 19 13,
N r . 1 1 , p. 54 f.
5) S . J en s en a. a. 0 . p. 1 1* un d vgl. z. B. auch K . 3182, I,
'
38 ; IV,3 ;
K . 7 592 o 37 (J en s en p. 98, 106 , 1 12) und Assur 75 r 24 (S itzb . Heidelb .
Ak . 19 15 , Nr. 8 , p.
230 C . Bezo ld und F r . Boll
Die b i sherigen Versu che, das Wort Z a l_u eoxzw ac -nyaw
e ine andere H ands ch ri ft) so Hephaes tic und ein Te i l der Hands chr iften des Jamblich de mysteriis, der auf Porphyr ios und dur chihn auf Chairemon zurückgeht oder Xa l
,u ew xw zci so ein
anderer Te i l der Jamblichhandschriften und, mit durch Haplo
graphic entste l l tem An fang,iv r ot ; äly evz;gra zolg Euseb ios eb en
fa l l s aus Porphyrios zu erk lären ,w aren n i ch t zu v o l lem
Erfo l g B e z o l d s ob ige neue Etymo logie gib t mit derEinführung des Begriffes B i l d e r “ die treffendste Bezei chnungdes Inha l ts : in der T at s ind h ier n i cht b loß S terngötter , sonderngenauer S tatuen, B i l der der S terngötter , bes chrieben. Die zw e i teHäl fte des Wortes nach dem nun erk lärten ca ly e geht in derÜberl ie ferung auseinander ; aber -ox(o)t v t a zd muß, da es in b e i d e nZw eigen der Über l ie ferung, bei Hephaestio u n d b ei Porphyr ios,vorkomm t, als das Rich tige ge l ten ; die andere Form ist durche ine Übersehreibung der S i lbe axt üb er der Lin ie lei ch t zu erk lären :
XX !
E A /1ME NIAKA
Was dem ox(o)w t zugrunde l iegen mag, b le ib t nochdunke l ; s chw er l i ch oxom fov , w onach es das
„Buch der S chnur
oder Re ihe v on Bi l dern “w äre .
Den S almeschoiniaka des Hermes T rismegistos, v on denenein glückl i cher Zufa l l ein größeres Papyrusfr agmenfi ) hier mit I
A quiv alen t ; und die Transkription eines zu supponierenden ALAM (bzw .
N U) HI . A in Z a l ,u en z; a anzun ehmen,w are doch ein bis j etzt beispiel »
loser Gew al takt .Ich kann h ier aus Raumrucksich ten das einze lne n icht noch einmal
v orführen und b i tte den nachpriifenden Leser an folgenden S te l len nachzuschlagen : S almasius de ann. olim . p. 604 f. ; G a l a ad Jambl. de ntyst .
p. 304 ; Part hey’s Ausg. dieser S chrift p. 266 ; B o l l , Sphaera p. 376 f. ;
ZA S 39, p. 1 52 ; Oxyrh . Pap. III
, p. 162111, Catal. codd. astro l. graee . V I II 2p. 87 , 1 ; endl ich B o l l . Aus der Off. Joh . p. 1 5, 5 1 , und dazu neuestensG r e s sm a n n . Theo l . Lit. Z eitg. 19 15 , p. 485 .
2) Die Identifizierung, die ich Oxyr h . Pap. a . a. O . vollzogen habe
,ist
wohl un zwe ife l haft , da die Salmsach. nach Chairemon eben v on jenen„sog.
xga z aw i. 7}yezzo'
v es“ hande l ten , die im Papyrus ebenfal l s als xga r azoi bezei chnet,
mit Namen genannt und beschrieben w erden . Z u dem Ausdruck xga‘
r au o i
sei noch auf We ss e l y , Z auberpap. (1888) v . 1 349 des großen Par iserPap. (w as xga n a zo z
‘
xs ägxtd‘
a iy o r a s) , auf die v on P e r t h ey 1865 edierten Berl .
E ine neue babylonischg r iechische Paral lele 23 1
beze i chnet, aus Licht geb racht hat, steh t nach dem Inha l t. als
Besch re ibung phan tas tis cher Mischgesta l ten von S terngöttern. am
nächsten (11) die Dekanliste des Hermes T rismegistos (T o r?7rgbg
’
o l qm bv ij isgr‘
z ‚fip’l og) sodann (111) eine ind ische
Dekanliste , die m it dem unten genann ten T eukros zusammen insA rabi sche
,von da ins Mi tte lgr iech ische überging, aber auch ind is ch
bei Varäbamih ira noch im O rigina l vor l iegt ?) S ie is t m it vie lS päterem vermengt, l äß t aber doch den U ntergrund da und dorterkennen . F erner s ind (IV) e in ige Ze i len aus einem von P a r t h ey
herausgegebenens) griech is chen Zauberpapyrus (I v. 1 42) hierhe r
gehörig,w o
,ebenfal l s unter der Bezei chnung ävdgta'g, e ine l öw en
köpfige S t ierg estal t, die von e inem si c h in den S chw anz beißendenDrachen umw i cke l t w i rd
,zum Eins chne i den in e ine Gemm e be
s chrieben und später als S terngott (v. 1 54) und zgar a t ög äyyel og
oder aeg. rrdgeö'
gog erklärt w i rd (v. 1 7 2. 180 . Die Ges ta l thei ß t w oh l A A O (v . Ähn l i cher Art is t (V) e ine Besch re ibungin e inem der Lei dener Z auberpapyri (ed. D i e t e r i c h , Pap. mag.
Lugd.) p. 80 1,00 1. IV 1 6 ff. Wei tere Z auberpapyr i heranzuziehen
habe ich vorläu fig verm ieden, um den h ier gegebenen Raum ni ch tzu überschre i ten .
Die nahe Z usammengehorigkeit d ieser Texte I H (111) IVm it der baby lon i s chen S terngötterliste leuch tet bei dem ers tenBl i ck auf die übereins timmende Methode der Bes chreibung ein
und bes tätigt sich bei näherer Prüfung. Nicht als ob es i dentis cheTexte w ären : aber sie sind in ih rer ganzen A rt zw e i fe l los zu letztnur Var ianten gl e i chen Ursprungs und Wesens . Die Bes chre ibunggibt j edesmal Näheres über Kopf, Ges ta l t und Extrem i täten, i hreAktion , Attr ib ute, Kle i dung, Name (n i ch t in III ). In der fo l gendenZusammenste l l ung sind m it arab ischen Ziffern nach I
,II und IV
,
Pap. I V . 207 (zu interpungieren deza woüs, xga r a w üs za l ägxayyéß.o v s) II V . 9
und auf den v on D i e t e r i c h hgg. Le id. Pap. IV 31 und VII 8 v erw iesen ;vgl . auch die oben im Text z i t ierte S telle .
1) Zuerst hgg. von P i t r a
,Anal . sacra V
,neuerd ings ein w en ig besser
v on R u e l l e,Rev . de ph i lol . 32 p. 247 ff.
2) Der arab ische Text, aus Abu Ma
‘
äar, in meiner
„Sphaera
“ hgg. und
übersetz t v on Karl Dy r off (p. 482 nähere M i tte i lungen über dasindische Original , m it Ausgabe der m it telgriech . Übersetzung im Cata l . eodd.
astrol . graee. V 1 p. 1 56 ff.
Abb . Berl . Akad. 1865, p. 1 24.
232 C . Bezold und F r. Bol l
V die Z e i l en des be treffenden Textes, nach III die S ei ten meiner„Sphaera
“ bezei chnet, mit b l o ß e n arab is chenZiffern dieParagraphendes baby lon is chen Textes in Jensens Ausgabe, mit „ tr . nov . I IIII I “ die dazu sonst noch bekannt gew ordenen baby]. Textfragmente.
1 . K0pf. Menschengesich t 7 5, 9 1 : I 202 ; S chlangenkopi
1 5 : I 1 7 , II 1 59 ; Löw enkopf fr. nov . III : I 1 62, II 1 06 , IV 1 42; Haarbüsche l an der Backe 20 : Haare am Ohr III 5 1 5 ; Locke (, adl rov)an K0pf 11 6 1 ; Bart fr. nov . III : III 535 u . o. ; Horn oder Hörner2,27
,28
,43
,7 5
,9 1
,fr. nov . III : zw e i Mondbörner II 1 1 2. Hörner
I I 1 32,V 20 .
2. G e s t a l t : Mens ch 4 usw . : äyö‘
n t oezde'
g V 1 7 . Weib 1 0,1 1 1 , 1 1 9 : I I 40, 1 08 ; Körper e ines Löw en 4 7 : III 503 ; „
mit
S chuppen [glei ch] einer S ch lange versehen “ fr . nov . 111 : 11 85
(„der gan ze Körper schuppig [glei ch] einer ebenso11 vgl . 11 256 ; Flüge l 45 , 1 09 f. : I 1 8
,11 so, 92, 1 66 ,
V 1 7 ; Löw enfüße 7 1 : 1 1 9 ; F üße „gekrümm t “ 67 : vgl . Finger
und Ges ich t „krumm “ III 507
,V 1 8. Arm e herabhängend 1 1 7 f
II 1 85 ; F leisch im Maul 30 : III 5 1 3. Zu 3 : (Fl üge ln ? oderHaut?) der E rd(staub)fliege mag man die Haut e ines Käfersö agog) verglei chen, mit denen s ic h e ine dieser Gesta l ten I I 206die Brust um gürtet hat ; zu 6 : ihre Brust is t geöffnet “ vgl.
„die rechte Han d auf dem gesch lossenen Magen “ V 21 .
3 . K l e i du n g . Mit einem Wams an se iner Bru st bek le i det 7 7n egceé
'
woy évog 75 892 T ?) oz rj 3 og I I 206 , n egceé'
w oy e'
vog divb _u a ozä w
y éxgt äozgayoilw v I I 1 7 8, 225 , 230 , 236 , 243 ; Gürte l genanntb e im Baby lon ier unge fähr 1 1 mal, m indes tens 1 4 mal in I I ; gek le i det in „
großes “ Linnenkleid 1 20 : „großes “ w eißes Kle id III
4 97 , 5 ; na ckt 1 0,59
,11 1 1 1 , 24 9 , 111 5 1 9 , 523. Kopi
binde 2,25
,42
,104 : 111 505
,11 1 86 (Kopfnetz),
‚
unzäh l igeMal Kranz oder Diadem in I II III.
4 . A t t r i b u t e . S chlangenumw ickelt 1 2, 39 : I 202,I I 85
,
1 00,III 523, IV 1 45 ; Wil ds chw e in auch unk lar
, ob Attr ibutoder Körperteil) fr. nov . II:
°
Hinter [gesicht] eines S chw e ines I 62,Diese schuppenbedeckte F igur hat w e i terh in im Baby]. e inen Löw en
k0pf mit Ohr eines Bundes, im Griech ischen e inen Hundskopf ; h ier stimmenalso zw e i Charakteristika fast v öllig überein . Auch im Gr iech . w i rd h ier,wie oft im Babylon , das „
gle ichw ie “w eggelassen .
Hat ebenfal ls Löwenangesich t .
234 C . Bezold und F r . Boll
Span ien *
) trägt . Bei T e u k r o s”) findet s ich au ch
,in I s is um
ges ta l tet, jene das Kind s ti l lende Göttin,die im Baby loni sc hen
v on e iner S ch lange umw i cke l t i s t die Parthenos m it der Hyd ra,w ie i ch anderw ärts gezeigt habe 3) .
Es w äre zuvie l gesagt,w o l l te man j etzt unsern baby lon is chen
Text kurzw eg nach der griech is chen Paral le le Z a l u eozzw axo? taufen :w e is t doch in letzte ren die di rekte Nennung v on Typhon, Krokod i l ,S karabäus , ägyptis che Monatsnam en und die Namen Ägyptense l bs t und Herm upol is m indes tens auf ägyptisierende Anpassung,w enn n i cht Umges tal tung bin
,bei der dennoch N eßv , d . h . w oh l
N ebo,s tehen geb l ieben i s t. Die Anordnung und Einze lbedeutung
der S terngötter unseres baby lon is chen Textes is t m ir . noc h w en igk lar
,so sehr die ersten Bes chre ibungen auf die Gegend von
Löw e — Hydra — Jungfrau zu führen s cheinen . Aber so vie ls che in t s i cher, daß es ursprüngl ic h S terngötter sind , die nache inem babylon is chen S chema in den S almesch . und den verw andtenTexten beschr ieben und auf der Marmortafe l des Bianch in i dargeste l l t s ind . Das i s t w i chtig fü r die Herkunft d ieses m erkw ürd igen Kuns tw erkes ; indes darauf kann i ch h ier ni cht w e i te r
Wie s chon angedeu tet . sind es unzw e i fe l haft B i l d e r oderS ta tuen (&vdgaoivu g, y ogrpa c’ , idéa t ) , um die es s ich m indestens inGriech is ch 1 II hande l t ; und so s ind au ch die baby lon is chenTexte s tets aufgefaßt w erden . Dadurch aber, daß es B i l d e rb e s c h r e i b u n g e n s ind , tr i tt das alles in ein besonderes Verhäl tniszu B e r o s s o s . Dieser hat, w ie w ir durch das Exzerpt bei Synkellos(FHG II 4 9 7
, 5 4 ) w i ssen, j ene „ se l tsamen Geschöpfe “ der Urzei tbes chrieben
, geflügelte , zw eigesiehtige , m it Z iegenhornern oderPferdefüßen, Hunde und Pferde mit F ischsehw änzen „und ande re
E bd. abgeb ildet p. 433 .
E bd. p. 210 ,
E bd., vgl. „
Aus der Off. Joh .
“
p. 1 10 , 2 und P u e h s t e in , Z A IX(1894) p. 4 17 5 . E s ist nach P u c h s t e in s Ansicht Derketo oder A targatis ;und nach E ratost-h . catast . v . 9 glauben die e inen v on der V irgo caelestis,
sie sei A t a r gat i s , die andere, sie sei I s i s.
Vgl. e instw eilen „Aus der Off. Joh .
“
p. 54 , w o ich auch auf baby
lon ische B i lder solcher A r t h ingew iesen habe. E s müssen auch, was schon
D i e t e r i c h begonnen hat (Pap. mag. Lugd. p. 7 70) , die „gaestischeu“ Gemmen
herangezogen w erden,eine große A rb ei t für s ich .
E ine neue babylonisch-griechische Paral le le 233
Geschöpfe m it den Ges tal ten von a l le r le i Die Bi lde rdie se r Mischgesehöpfe stehen noch j e tzt
,sagt Berossos
,im T empe l
des Be i,w ie er auch 5 3 v on dem B i l d des Oannes spri ch t ,
das noch erha l ten sei. Gerade so l che S tatuen oder Bi l der von
Mischgesehöpfen aber be schre iben auch unsere gr iech ischen Texte.
die S almeschiniaka und der He rmes an Ask lepios . M . a . W . : in jenenS almeschiniaka, die, w ie ausd rück l i ch gesagt w i rd
, e ine Que l lefür das n i ch t nach 1 50 v . Chr. ersch ienene Buch des Nechcpso
Petosir is w aren,is t e i n e s de r Z w i s c h e ng l i e d e r zw i s c h e n
der „Ofienbarung des Bel“,die Be r o s s o s den G r iechen e r
öti'
nete,
u nd de r iigy pt is c h- g r i e c h i s c h e n A s t r o l og i e de s
N e c h eps o—P e t os ir is und der ganzen F o lgeze i t gefunden . E s
b rauchen desw egen n i ch t d iese Hermetika di rekt aus Berossos zustammen ; es genügte, daß Be rossos das Interesse der Gr iechenauf j ene se l tsam en Mischgesehöpfe und ihre baby loni schen Bes ch re ibungen ge lenkt hatte , um sol che besonderen Bücher w ie dieS almesch . zu veranlassen . Die daß Berossos ers t durchAlexander Po lyh istor undPoseidonios bekannt gew orden sei, müssenw ir som it h ufgeben : se ine Wi rkung auf w e i tere he l len i st ischeKre i se ist offenbar sehr rasch erfol gt und hat die einflußreichste
as trologische Offenbarungsliteratur des He l len ismus mit aus Lich tgeru fen F r . B.
Diese Tiere können dann das L i c h t n icht ertragen und gehen zu
grunde ; erst dann b i ldet Bel S onne, Mond und S terne. Hier ist,w ie ich
nebenbe i bemerke , der Punkt, w o der sonst nur gelehrt erkiiustelte „chal o
däisehe“ S chöpfuugsmythus Cata l . codd. astro l . V 2 p. 1 30 fi . offenbar w i rk
l ich an al te Tradi t ion anknüpft : da fl iehen (p. 132,
geradeso dieP laneten vor der S onne, deren Licht sie n icht ertragen können .
D i e l s , E lem en tum p. 10 .
Bemerkt sei noch , daß der in me iner Sph aera p. 39 1 , 2 _erw ahn t e
L i b e r i m ag i n a m des Ps.-P to lemaeus im w e iteren S inne auch h ierhe r
geh ört, insofern er auf den Dekanste rnbildern beruht ; aber der Ausdruck„imagines “ erklärt s ich
,w ie ich dort bemerkt habe , in d iesem Bucht i te l
etw as anders .
234 C . Bezold un d Fr . Boll
Span ien ‘) trägt . Bei T e u k r o s”
) findet s i ch au ch,in I s is um
ges ta l tet , jene das Kind sti l lende Göttin,die im Baby lon i schen
v on e ine r S ch lange umw i cke l t i s t, die Parthenos m it der Hydra,w ie i ch anderw ärt s gezeigt hab e 3) .
Es w äre zuvie l gesagt,w ol l te man j etzt unsern baby lon is chen
Text ku rzw eg nach der griech is chen Para l le le Z a l u eoxw w xd taufen :w eis t doch in letzteren die di rekte Nennung v on Typhon, Krokod i l ,S karabäus
,ägypti s che Monatsnamen und die Namen Ägypten
se l bst und Herm upol is m indes tens auf ägyptisierende Anpassung,w enn n i ch t Umgesta l tung bin
,bei der dennoc h N eßv , d . h . w oh l
Nebo,s tehen geb l ieben ist. Die Anordnung und Einze lbedeutung
der S terngötter unseres baby lon is chen Textes is t m ir . noc h w en igk lar
,so sehr die ersten Bes chre ibungen auf die Gegend von
Löw e — Hydra — Jungfrau zu führen s cheinen . Aber so vie ls che in t s i cher, daß es ursprüngl ich S terngötter sind , die nache inem babyloni schen S chema in den S almesch . und den verw andtenTexten b esch rieben und auf der Marmortafe l des Bianch in i dargeste l l t s ind . Das i st w i chtig fü r die Herkunft d ieses m erkw ürd igen Kunstw erkes ; indes darauf kann i ch h ier n i cht w e i ter
Wie s chon angedeu tet s ind es unzw e i fe l ha ft B i l d e r oderS ta tuen (ävögwivzeg, „
u ogma i , idéo u) , um die es s ich m indestens inGriech isch 1 11 hande l t ; und so sind au ch die babylon ischenTexte s tets aufge faßt w erden . Dadu rch ab er, daß es B i l d e rb e s c h r e i b u n g e n s ind , t r i tt das a l les in ein besonderes Verhäl tn iszu B e r o s s o s . Dieser hat, w ie w ir durch das Exzerpt bei Synkellos(FE G II 49 7 , 5 4 ) w issen, jene „ se l tsamen Geschöpfe“ der Urzei tbes chrieben
, geflügelte , zw eigesiehtige , m it Ziegenhö rnern oderPferdefüßen
,Hunde und Pferde m it F is chsc hw änzen „und andere
E bd. abgeb ildet p. 433.
E bd. p. 210 ,
E bd., vgl. „
Aus der Off. J oh .
“
p. 1 10 , 2 und P u c h s t e in , Z A IX(1894) p. 4 17 5 . E s ist nach P u e h s t e i n s Ans icht Derketo oder A targatis ;und nach E ratosth . eatest . v . 9 g lauben die e inen v on der V irgo eaelestis ,
sie sei A t ar ga t is , die andere, sie sei I s i s.
Vgl. e instw eilen„Aus der 0 11 . J oh .
“
p. 54 , w o ich auch auf baby
lon ische B i lder solcher A r t h ingew iesen habe. E s müssen auch, w as schon
D i e t e r i c h begonnen hat (Pap. m ag. Lugd. p. 7 70) , die „gnostischen “ Gemmen
herangezogen w erden,e ine große A rbei t für s ich .
Frankisch .
Von
E . Littm ann (Göttingen).
Im Orient w erden bekannt l i ch die E uropaer als „F ranken“
beze i chnet, und fränkiseh “ i s t g le i chbedeutend mit eur opäis ch .
Erst in neuester Ze i t ist d iese Beze i chnung h ier und da etw asa l tmod isch
,man m öchte sagen „ a l t fränk isch “
,gew orden. S o
pflegen, w ie m ir m ein S chü ler Herr Abdus sa ttar S i d d i q i mitteilt, in Ind ien die a l ten Leute die Engländer noch als firäng zubeze i chnen ; aber die Engländer l ieben den Ausd ruck n i cht sehr.In der Türke i hört man auch s chon oft m apa la neben fr eak, in
Syrien und Ägypten ür ub(b)rizoi bzw . am bbäwi (oder orobbi) neben
franä-i bzw. afrangi. Manch e iner w ar und ist der Ansi ch t,
daß d ieser Name von Frankrei ch und den F ranzosen auf die
übrigen Europäer übertragen sei. S o sagen B i an c h i und K i e f f e rin ih rem Di ct ionnaire ture-franca i s II p. 37 5 : Ce nem
géné rique date apparemmen t du temps des Croisades 0 11 les
F rancai s se son t su rtout d istingué s . U nd M on t a n d on sagt p. 4 1 5
seines Werkes „Au Pays Gh im ir ra “: „fi rendj z
'
etranger (le met
der ive de Fre i l i ch w i rd sogar Karl der Große v on
den Franzosen als Franzose in Anspru ch genommen. Mag Kar lder Große auch manchma l
,so namen tl i ch den S achsen gegenüber
,
eher „französ is che “
als deutsche Pol i t ik getrieben haben,so w ar
er doch ein ech ter F ranke u nd w urze l te im germani schen Vo l k sstamme der F ranken. Eben nach diesen und i h rem Rei che, demzu jener Zei t mäch tigsten Re i che Europas, haben au ch die Araber
,
F riinkisc h 237
a ls sie m it den Eu ropäe rn in nähe re Beziehungen traten,
a l leEu ropäer, m it Ausnahme der S laven und Griechen
,als , F ranken “
bezei chnet. Und gerade zur Ze i t des Frankenkönigs und
Ka isers Kar l s des Großen w a ren die Beziehungen zw i schen Europaund dem Chalifenreiehe lebend ig. F ür die „F ranzosen “
und
„Iranzösiseh “ hat man in neuerer Zei t besondere Worte geschaffen
so arab is ch und zum Te i l abessini s ch fr am d (amharis ch faränsäs),türkisch fränsaz, fränsmfi , fr änsa la, u . a. m . Die al te Bezei chnungder Europäe r als Franken, die a l so auf die Ze i t des Frankenre i ches vor den Kreuzzügen zu rückgeht
,hat sich dann über den
ganzen vorderen Orient zu Arab ern,Abessiniern
,Türken
,Persern
,
Indem usw . verbre i te t.Das Be iw ort fränkisch “ kann s i ch nun natü r l i c h in se iner
Bedeutung mannigfach verändern, je nach dem es auf Personen
,
deren Art und Re l igion, oder auf Dinge
,Pflanzen
,Krankhe iten
bezieht,die aus Europa in den Orien t gekommen sind . Hier sei
e ine kurze Übersicht über d iese Bedeutungen gegeben, sow e i t siemir bekann t gew orden s ind . Eine genaue Einze l untersu chungüber Ort und Ze i t der Ents tehung j eder Bedeutung lag nicht inm e iner Ab s i cht ; e ine so l che w ü rde viel l e i cht noch manche interessante Re sul ta te ergeben.
„F ränkis ch “ bedeute t a l so : „ europäis ch “
,h ie und da w oh l
a l l geme in „fremdl ändisch “
; 2. bei den Mohammedanern „chr istl i ch “
bei den orienta l ischen Christen „ röm is ch—ka tho l isc h “
; 3. „kl ugv on Pe rsonen , „
feingearbeitet“
von S achen ; 4 . zuver l äss ig “
;
5 . die „fränkische K rankhei t “ i st die Syphi l is ; 6. a l lerhand be
sondere Arten von Mas ch inen , Pflanzen,Früchten , Produk ten , die
dann me ist m it e inem einhe im i schen S ubs tantiv bezei chnet w erden,zu dem dann das Adjektiv fränkisch “ h inzutr i tt.
1 . F r än k i s c h e u r opäi s c h . Die Bedeutung ist a l l gemeinbekann t ; die F orm des Wortes i s t nach den Ländern vers ch ieden .
Wir haben die pers is ch- türk is che Form mit k oder 9 am S chlusse
und ohne vorgesetzten Voka l , und andererseits die arab i sche Formmit 3 am Ende und me ist m it vorgesetztem a
,i oder u . Bei den
Türken hat aber naturgemäß auch die arab is che F orm Einganggefunden, so daß w ir in der Türkei den größten Formenrei chtumbei d iesem Worte finden ; ebenso ist die arab i sche Form auchnach Abessin ien ged rungen. Anderersei ts w ird j a im ägyptisch
238 E . Li ttmann
arab is chen Dia lekt das z iem l i ch gemein—arab ische w ie 9 ge
sprochen, und so haben w ir in Ägypten die F orm mit g und m it
Vorschlagsvokal. Für das Arab is che w äre a l so die gew öhn l i cheF orm afm n£ (i) oder daneben findet s i ch farang(i) oder
In Ägypten w ird afr ang(i) oder ufmng(i)In Abessin ien w ir d in der äl teren Literatur die Form ’
afi *ang
'
r b e
v orzugt ; daneben findet s ich aber auch z . B. fan—
mg und für dene inze lnen ’
afrangäwi , so in der von P e r e i r a herausgegebenenChron ik des Ka i sers S usneos, Text p. 259 , Z . 25 . F ür das Am
harische führt G u i d i in se inem Vocabo lario Amari co-Ital iano dieF ormen ’
afrané , far ang, faran£ r , fareng'
r an und bemerk t (Sp.
daß heute j arang die gew öhn l i ch s te Form sei. Im Tigré findet sic hheute ’
afrang'
i neben farang'
i . Ersteres steht,w ie w ir unter 3 . sehen
w erden, in speziel ler Bedeutung ; letzteres findet s i c h z. B. in
me inen Tigré -Liedern (Pub l i cations of the Princeton Expeditionto Abyss inia III, IV) Nr . 266 , V . 4 , w o die s chw ed is chen Miss ionarealsfarang
'
i bezei chnet w erden , w as man am ehes ten durch F rem de “
w iedergeben könnte. F ür das Persische gibt V u l le r s im Lexikondie Form faräng; daneben hat er färän£ rä und firäné ä als NamenEuropas m it Ausnahme von Griechen land . In Ind ien spr i ch t m an
nach A . S i d d i q i me i st fir ang und firängi . Für das Tü rkis chefinden si ch nach B i a n c h i -K i e f f e r efrendj , efr endj z
'
, efrenk, fr endj ,
frenk, firenk, j'
rengfi ), fe rner frenlec'e auf fränki sch “
, fr engz'
stän
„Europa“
; frendj vilä'
ieti i s t„ europäische Provinzen m it Ausnahm e
von Griechen land“. Dazu se ien h ier au ch noch das ägyptis ch—ara
b i sc he Verbum itfarnag „ eu ropäische S i tten annehmen “
,mit dem
Part i zip m itfarnag und d em Verba l substant iv far naga angeführt.Besonders zu nennen s ind auch die slav ischen Formen , die Ma r k e ,Deutsche Lit.-Ze itung 1 9 14
,Sp. 1 6 1 5 augibt : kirchenl. frgge,
altserb . fr age, frage, fr anaga, altr uss. ffaza, fi azina,nen bulg. frag,
freak „der F rem de “
(w esteuropäischer A us länder) .2. F r än k i s c h a) c h r i s t l i c h , b) R öm i-s c h — k a t h o l i s c h .
a) V u lle r s gibt in se inem Lexikon unter farc'ing a u ch die Be
Fiir Nich t sem it isten sei bemerkt, daß die F orm ohne am S chlusse
ko l lekt iv ist , die m it (i) das E inzelwesen bezeich riet .2
) Vgl. auch J a c o b , Sul tan S ol iman des Großen Div an (Berlin 1903)
p. 26 ;’ derselbe‚ Der Divan S ultan Mehmeds des Zw eiten (Berl in
türk. Text, A nm . zu Nr. I I I .
240 E . Li ttmann
beim Wasserholen m e ine eur0päische K le id ung in i hrem Brunnenl iede als 553 äayätz
‘
n „Kle idung v on Teufe ln “ besangen. Vie l le i chte rs ch ien i ch ihnen als „
w ei ßer Dämon“w ie der Hexe v on
Cohaito ; vgl. Deutsche Aksum -Exped it ion I , p. 25 .
Als feine, kos tbare Arbe i t gi l t die fränkische Arbei t bei Arabernund Ab ess in iern. In 1 00 1 Nach t (102. Nach t) kämpft Afr idün m it
einer Lanze „ von kostbarer fränkischer Arbeit “ . In den v on mir
herausgegebenen Tigris-Liedern w ird das ’
Afmng‘
i -S chw ert oft b esungen ; es gi l t als kostbares Erb stück , w ie z . B. in Lied 266 ,V. 14 . Man nenn t es
’
Afrang'
fi ohne ein erk lärendes S ubstantiv ;e ine genauere Beschreibung der ’
Afl'
ang-z-S chw erter findet s ic h in
Pub l . of the Princet . E xp. to Abys s in ia, Vol. II, p. 206 . Im Tigréhat s i ch a l so die Bedeutung m it der Form d ifferenziert : ’
Afrang'
i
i st nur das „fränk i sche “ S chw ert ; sonst heiß t „
fränkisch “
färänfi .
We i ter gib t auch M u r k e a. a. 0 . Sp. 1 6 1 5 bu lgar. frengzj &fe ine Arbe i t“ . Über kos tbare fränk is che S chw erter bei den
S kandinaviern in Ruß land beri chtet der Araber Ibn Fadlän(10 . vgl . T h om s en
,Ryska Rikets Grundläggning genom
S kandinaverna, ofversatt af S öderberg, p. 38 (nach J äqüt II,
p. J a c o b s o h n ,Rußlands Entw i ck lung und die uk ra in i s che
F rage,1 9 1 6 , p. 1 4 .
Ferner hat Vu lle r s noch für das pers is che färäng die Bedeutungen „
rub r i coloris ; gratus ; iucundus“. Wie s ich diese Be
deutungen zu den übrigen verha l ten und w ie sie entstanden s ind,kann ohne e ingehendere U ntersu chung n i cht fes tgeste l l t w erden .
Es w äre w i chtig, zu bestimmen, ob „fränkischrot“ auf die Farbe
von europäis chen S toffen, die etw a in Pers ien be l ieb t w aren, oder
auf die Farbe der Menschen zurückgeht. Denn „rot
“von Mens chen
bedeutet bei Ägyptern , Arabern und Abess in iern sovie l w ie hel lfarb ig“ (etw a w ie die „
Ble i chges ichter“ bei den amerikani s chenIndianern) ; so i s t im T igré lied 67
,V. 1 1 der Bote“
„der
Europäer“ .
4 . F r a nk i s c h z u v e r l ä s s i g. In Syrien und Agypten habei ch mehrfach gehört , daß kilm e frané
*iy6 bzw . kilm a (a) frangiya
„ fränkisches Wort “ sovie l bedeute w ie ein zuverl äss iges Wort “ ,
Vgl. Nöl dek e , Der w e iße Dev von Mäzandarän. A rch iv fur Rel igionswissenschaft 18, 1 9 15 , p. 597 ff,
F ränkisch 24 1
oder be im Fe i l s chen etw a sovie l w ie „fester Pre i s “ . Es s che int
aber, a ls ob d ieser Ausdruck eher von den im Orien t ansässigenEuropäern als von den Orienta len se lbs t ausgegangen ist. I c hhabe ihn hauptsäch l ich v on Europäern gehört
,die a rabi s ch v er
standen , auch in eu ropäis chen Zei tungen des Orien ts ge lesen .
Die Araber selbst w ol l ten n i cht v iel von ihm w i ssen ; für sie is tdie Anw esenhe i t der Eu ropäer und i hrer Sprachen immer nur ein
notw endiges Übe l,
zw ar notw end ig, aber doch ein Übe l . E in
amhar isches Spric hw ort besagt : Die F ranken dringen ein w ie
ein Faden im Nade l ö hr,
ab er sie bre i ten s ich aus w ie e ineSykomore “
; vgl . G u i d i , Vocabolar io, Sp. 874 . Die Sykomoreu
haben in Abessinien oft e ine Krone von ungeheurem Umfang .
5 . F r ä n k i s c h e K r an k h e i t S yph i l i s . Die Syphi l i s und
zum T eil auch andere venerische Krankhe i ten heißen bei Arabern ,Persern, Türken und S laven a l l gemein „
fränki s che Krankhe i t “ .
Hier l iegt w ahrschein l i ch eine Verw echs l ung v on „ fränkisch “und
„französisch“
v or , w ährend sons t, w ie w ir gesehen haben,d iese
Begritie zu'
scheiden sind . Denn d iese Krankhei t heißt und h ießauch bei den Deutschen die „F ranzosenkrankhe i t“ , und ein S tadtte i l von S traßbur g, der das kle ine F rankrei c h “ genannt w ird
,
so l l se ine Bezei chnung daher haben, daß dort früher ein Spi ta lfür Gesch lechtskranke w ar . Im I ta l ieni s chen heißt d iese Krankhei tmorbo gallico . Wah rsche in l i ch haben die Orienta len den Namenv on den I ta l ienern überkommen , _
da die Ku l turbeziehungen nachI ta l ien im Mitte la l ter sehr eng w aren, w ährend sie zu Deutschland damal s nur sehr lose w aren. Die Frage nach der urSprünglichen Herkun ft der Krankheit kann hier na tü r l i ch n i ch terörtert w erden ; über den Ursprung des Wortes „ Syphi l i s “ ist diev ortretfliche Untersuchung von F . B o l l im XXV. Band der NeuenJahrbü cher für das k lassis che Al tertum , p. zu vergle i chen .
Ich gebe hier nun die arab i s chen, pers i s chen, türki schen Namen zum
Te i l nach münd l ichen E rkundigungen, zum Tei l nach den Wörterbüchern (Dozy, Spi ro, Vullers, Bianch i-Kieffer, Heintzs) . Arab is chalq narac
_
l cal—fama (nach Do zy glei chbedeutend mit al-marad al
kabir „die große Krankhei t“ und m aragi an-nisd
’
„die Krankhei tder Irabb farang
*i (oder afranj i ) „fränkis che Körnchen “
(D o zy II, p. in Ägypten : habbe frangi oder el-‘aya el-ufr angi
letzteres nach S pi r o „venerea l in Syrien : [zabbFestsch rif t Kuh n . 16
242 E . Li ttmann
fr angi . Persi sch : m am a-i farang; abilä—i färäng „fr änki sche
Puste ln“. Be ide Namen sche inen ab er mehr l i teraris ch zu sein ;
da ätiääk Feuerchen “ die volkstümlichere Bezei chnung ist,w ie
m ir A . S i d d i q i m i tte i l t ; vgl . Vu ll e r s s. v . ätiääk. T ürkischs m k
illati, fr enlc zahmett fränkische Krankhei t “ ; fr eule ngaz u
„fränkische
Krätze“. E in Syphi l i tiker heißt fr enk zahm etlz
'
. Während B i an c h iK i e f f e r s . v . fi enk d iese Bedeu tung geben haben sie 8 . v . zahm et
für fr enk zahm etz'
die Bedeutung„la v é ro le Für das S lav ische
gib t Ma r k o a . a . 0 . an : serbo-kroati s ch franca , fran c, fram e, fr ancuz,
slovenisch francozi, tschech is ch francouzc, poln i sch fr anca , francozy,russi s ch fr an cu skaj a baleari ; a l so auch h ier findet s i ch der Wechse lv on
„franzosisch" und
„franki sch“
. Vie l le i cht i s t erstere F orm überDeuts ch lan d, letztere über die Türke i gekomm en .
6 .
„F r än k i s c h e “ G e g e n s t än d e , Pr odu k t e , Pfla n z en usw .
Do zy und Va ll e r s geben firan£ iya , färäng'
iyä, ifr ané-iya „
die
F ränkische “als Namen e ine r Kriegsmaschine. Vullers hat
äfranj muäk, färanä-muäk
, fälän£ rmuélc „fr änkis cher Mos chu s “ .
B i a n c h i —K i e f f e r : freule elm asa fränkis cher Apfe l “ ; freule em'
gi
(„ fränk is che Pflaume“
) prunes confites av ec du euere ; fr engi
seräser fränkischer S eidenstofi “
) brocard ; frengi ragam („frän
kischer ges tre i fter agate ; fr eak uzüm ü („ fr änkischeWe inbeere“
) Johann isbeere ; efr endj im iék „Tamar in “
; frendjm uälc
„Mé l isse sauvage Im Amharischen bedeu te t nachG u i d i
,Vocabo lario
,afmng
'
r neben„Europäer“ auch roter Pfeifer“ .
Die serbokroatis che frendz'
j a i s t nach Ma r k e a . a. C . e ine nacheuropäis cher Art gebaute Ku la. Gerade d iese Aufzäh l ung l ießes i ch noch ganz bedeutend vermehren . Nur darau f sei noch hingew iesen, daß die Münze , die letzten Ursprungs auch nach denFranken benannt ist
,in neuerer Zei t übera l l im Orien t
,bei A rabern,
Türken, Persern, Abess in ie rn Eingang ge funden hat . Der Namefrank, faraah (im Tigré au ch farankai) hat dabe i den Nam en deri ta l ien i s chen lim verdrängt und w ird auch für d iese geb rau ch t .
Das h ier Mi tgetei l te i st nur ein sehr k le iner sprach l i cherAuss chnitt aus den mann igfachen Kul tur beziehungen zw i schenMorgen und Abendland
,und zwar diesma l in der Richtung v on
West nach Ost. In manchen der h ier angefü hrten Reden sartenSpr i cht s i ch die Werts chätzung des F ranken . bei den Orien ta lenaus. E in syris cher Araber sagte e inma l zu Graf L an d b e r g : „
Bei
Kriegsgottesdienst in Byzanz.
Von
A . Heisenb erg (Muncheu).
Im Winter des Jahres 1 9 14 hie l t i ch im kle inen Betsaa l derevange l i s chen Gemeinde von Jo l imon t, n i ch t w eit von Char lero i entfernt
,Fe l dgottesdienst für die Leute unseres Lands turmbatai l lon s .
Der freundl iche Pfarrer des Ortes nahm se l bs t daran te i l , und als
w ir nach der Predigt in se iner behagl i chen S tube zusammensaßen,
kam das Gespräch auch aufKriegsgottesdienst in a l ter und neuerZe it. S e i tdem hat das Thema m i ch immer w ieder bes chäftigt, und
als i ch aus dem S chützengraben he im gekehrt w ar,habe i ch zu
sammengesucht, w as über die Pflege des Gottesdienstes im byzan
tinischen Heere über l iefert ist. Jetzt gib t der s iebzigste Gebu rtstagdes hochverehrten Mannes
,der Orien t und Okzident
,Sprache und
Glauben und S i tte der Vö lker mit gle i cher U n iversa l i tät umspann tund dem auch die byzan tin i s chen S tu dien so vie l verdanken, diew i l l kommene Ge legenhe it, die w ich tigsten Ta tsachen in einer v or
läufigen S kizze darzulegen.
Lies t man die kriegsw issenscbaftlichen Bücher der Byzantinerin einem Zuge du rch , so bemerkt man bei a l ler Abhängigke it derjüngeren Werke von den äl teren doch e ine a l lmäh l i che
,sehr be
s timm te Versch iebung des Gesam tcharakters d ieser Literatur . S ietr itt insbesondere nach zw e i Ri ch tungen ein, und zugle i ch so augenfäl l ig , daß man den Versuch w agen m ö chte
,danach e ine Lin ie
der En tw i cklung zu ze i chnen, ohne erst in andere und e inze lneUntersu chungen e inzu treten. Der Gebrauch der late in i schen Sprache ,der noch dem Werke des Pseudo-Maurikios seine eigentüm l i che
Kr iegsgot tesdienst in Byzanz 245
F ä rbung gibt, tri tt bei j eder Umarbe i tung der F ol geze i t immermeh r zurück
,ist ab er au ch aus den spätesten Nachläufern noch
ni ch t ganz verschw unden. Umgekeh rt dringt der re l igiös-kirchl i che Gei s t, der a l lem byzantini schen Wesen
,von Jah rhundert zu
Jahrhundert w achsend , sein charakteristisc hes Gepräge gib t, auchin die m i l i täri sche Litera tur immer s tärker ein
,aber s chon das
genannte große Buch über die Kriegskunst, das am Eingang dieserLiteratu r beginnt mit den Worten : ‘
Hyeioäw r oä Aa'
you za l
1 l it'
gyw v : ra vayia 1 91 029, 5 3 50 9 aa ). ow r v‘
yg ßep’a ia
£ Ärrig za l &wpd). eza n ö v ö eiw v 7rgayydr w r .
Die kriegsw issenschaftlichen Werke geben dam it üb r igens nur
ein getreues Spiege lb i l d der ges ch i ch tl i chen Zustände,die sie
s ch i l dern . Auch im Heere se lbst gehen die a l tröm is chen Trad it ionenn iema l s ganz ver loren. S ie gew ährle isten bis in das späte Mi tte la l ter den byzantini schen Waffen die Überlegenhe i t über a l le Gegner,die dem Rei che nacheinander entgegen treten . Daneben aber w irktder k irch l iche Gei s t au ch auf die Einr i ch tungen des Heeres und
die Lebensgew ohnhe i ten der Truppen a l lmähl i ch umgesta l tend ein .
Es is t in Wahrhe i t nie so w e i t gekomm en,daß kirch l iches Wesen
den kriegeris chen S inn un tergraben hätte a l le in w ie in der m i l itär ischen Li teratur m it der Zei t immer m ehr v on kirch l i chen und
re l ig iösen Dingen die Rede ist , so zeigten s ic h auch die Gew ohnhei ten der Truppen a l lmähl i ch starker von re l igiösem Ge i s te beeinflußt. In der Taktik des Ka isers Leon i s t sehr vie l die Redev on den re l igiösen Eigenscha ften der Heerführer
,w ovon man bei
Pseudo -Maur ikios noch n i chts l ies t, e ine w e i tgehende Rücksi chtw ird den Diene rn des Herrn zu te il, Kirchen und Klöster
,in deren
Bere i ch das Heer marsch iert, er freuen s i ch ganz b esonders rücksichtsvoller Behand l ung. In dem Epilog , mit dem Leon se ineTaktik schl ießt
,spri ch t er über den re ligiösen Gei st im Heere
noch e inma l im 62. Kapi te l zusammen fassend : T fig dä isgau x ijg30°n v zb za l cbg r d 3 570: xpfi0 3 c u. za l za ür a €n czel elv ädw l eizrzw g
Diesen P latz w ird die Takt ik des Pseudo-Maurikios behaupten, gleichv iel , w o kün fti ge F orschung ihr die zeitl ich genaue S te l le anw e isen wird.
Hierüber hat gegen Renan e in ige treffende Bemerkungen Car l N e um an n gemacht : Die Wel tstel lung des byzantin ischen Re iches v or den Kreuzziigen (Leipzi g 1894) p. 37 ; dort findet s ich p. 33 f . auch anderes, w as mit
unserem Thema zusammenhangt .
246 A . He isenberg
zb: 0 zga zev’
_u aza eöaeßcb g ze m i &eagéozw g xazbc zbv n agaöoß évza
3 50y bv a vw 3 €v z e ig eöoeßofioz xn w volg, den? z e iego l oy u a v
xa i i sgo v gyza'
i v z a l z cöv öl). l eöxa3v z a l de rjo ew v 7r g‘
og
z b v Ö ebv éxz e v cög yw o,u é v w v z a l zzpbg z bv n a v dxga v z o v
ozöz oö y a; z éga z a l & s o z o'
x o v z a l z o b g o‘
zyz’
o v g a öz oü 0 5 0 02
7t o v z a g' 55 (in ! Zl eoüza z zb xab dab: z r)v n iozw zfig 0w zr;giozg
a i 1pvxa i z röv ozga zu uzai v edgw azo'
zega z n gbg z obg xw öv'
vovg
n aga ousv oiä'
ovzaz.
Demgegenüber muß man darauf h inw e i sen, daß die praktis cheAusübung der religi ösen Pfl ichten, sow e i t die m i l itärw is sen schaftl i che Li teratur es erkennen l äßt
,au ch in den späteren Jahr
hunderten ke inen b rei teren Raum in dem tägl i chen Leben des
byzantinis chen Soldaten beanspru cht als in der ers ten noch ganzunter röm is chem Einfluß s tehenden Ze i t. Nur an den F e l dherrnist die Vorschri ft gerich tet
,die Maurikios VIII 2 gib t (p. 1 82
Hgb zäru m vözivw v ö 0 zgaznybg &agarrev ézw zb &eiov‘
&aggn‘
iv
ybzp év zolg m vöv'
vorg chg 7 t gbg (pil ov adzb zb &elov zäg iaec n’
ag
n onjoezaz. Ka iser Leon empfieh l t auch se inen S ol daten das Be ten(XX xazbc zbv xa tgbr zoö n ol éy ov 615€ mit» eöxc
‘
rg a gb; ß ebv
xazorßa l éaö az. m i 0 15,1gu axor éxelvov xa l elv
,aber nachdrü ck l ich
fügt er h inzu : pi; ,u évz or zu
'
w n goxezy e’
vw v xazay el.elv ijzcöv öq>ecft o,u évw v zcgdSew v xazol cn elv
, „denn mit Gott muß man
au ch die Hände rühren “. Bei de Vors chr iften beziehen s ic h n i cht
auf diens tl i che Verri ch tungen. Dagegen ist es d ienst l icher Befehl,
daß am frühen Morgen vor dem Beginn des Tagew erks und am
Abend nach dem Essen und dem l e tzten Appe l l das Trisagion gesungen w ird
,
"A )/o 5 3 569, ä
'
ycog Zoxvgo'
g, ä'
yzog ä3 é vazog, €Äéqoov
7‘
präg. Die Vorschrift lau tet bei Pseudo-Maurikios VI I 1 7 (p. 1 69
X gr‘
; si'
ze év (p0 0 0dc öw'
:yez zb ßoivdov ijz 0 1 zb zäyy a e’
ize na i
aa&°
e‘
a v zb än lnxev'
ez ön ovdrj7t oz s, 7rgcuiag eig a-özbv zbv 593 90 1»
yrgb n a vzbg zzgoiyy az og za l sig éorréga v öy oz’
wg y ezbz zb dei7r vov
aa ). zäg ,u iaoozg zb zgw dyrov rpdl.ft eo&w z a l z b: Äozrrä xaz c
‘
r z ip» o mni
3 ewzv . Nahezu w ortlich i st der Be feh l bei Leon XII 1 15 (c. 837D Migne) und sons t w iederho l t. Es ist w oh l se lbstverständ l i ch ,daß das Trisagion von der gesch lossenen Abtei l ung gesungenw urde. Dagegen b le ibt zw e i fe l ha ft, w ie man den Zusatz aa ). zb:
Äou zöz xazöz z1‘
2v 0vv rj&swzv vers tehen so l l . An e inen förm l i chenGottesd ienst jeden Abend w ird man n i ch t denken dürfen, die Er
248 A . Heisenberg
singu lär ist die Beze i chnung xavo'
v eg. Mit der besonderen Liedform,
die Kanon he iß t, hat das Gedi cht n i chts zu tun ; so w irdman zur Erk lärung an jene obengenannten zavo
'
veg v r zzegzvoi denken,zu denen au ch dieses Lied
‚ gehört haben w ird ; v iel le i ch t gedachteder S chre iber noch m ehrere der Art zu notieren und w äh l tedesha lb den Plura l . Das S tück steh t in der Handsch r i ft natür l i chals Prosa ges chrieben , i ch habe h ier die rhy thm i sche Gl iederungangegeb en .
Kavo'
veg 1110 11 0'
y evoc eig fixog d.
‘
0 7t dl a t’
Inooü z 0 5 N orv fj o vyy crx1joagäyyél ov moßsgd za l <pgtn j n agov oig,
mi
zbg €Qa rzo'
ozu l ov
0779 sigrjwyg zbv äyye?.ov
5vwxüovzoi 0 0 0 zbv Äa bv év n o).é,u ozg
za l rm péxor.g w'
xng ärjzzryzov zgo'
7ra cov
eig öo'
äa v nov .
Der Gedanke, den das Gebet ausspri ch t, i s t fromm und
s ch l i cht,der al te Wunsch al ler w ackeren Krieger
,der au ch j etzt
unsere Fe l dgrauen besee l t : Der Herr, der eins t Josua ha l f,sol l
se inen Enge l des F riedens senden , aber der Enge l sol l zunächstdem Vo lke im Kampfe den A rm starken und der Herr ihm den
S ieg ver le ihen .
S tand ein Treffen bevor,so w ar der religiosen Vorberei tung
m ehr Raum gegeben als an anderen Tagen . Z ur Zei t des PseudoMaurikios (II 1 7 , p. 7 2f. S ch .) fand in der Frühe des S ch lach ttages im Lager ein Gottesdiens t statt, der immerh in ein fach gew esen sein muß
,da ihn n i ch t nur P riester
,sondern ,
w o sie
feh l ten , au ch der Fe l dher r se lbs t oder die F ührer der einzelnenAbteil ungen abh ie l ten. Er w ird auch nur eöp j
'genannt,w as in
dessen n i ch t aussch l ießt,daß die be im Morgengebet üb l i chen
Psalmen auch d iesma l gesungen w urden . An das Gebet s ch loßsi ch das Kripte él ép0 0 v , das anha l tend von a l len Mannscha ftengesun gen w u rde. S oba l d dann die Ab te i l ungen das Lager ver
l ießen , s t imm ten sie im Ausrücken dreima l den a l ten S ch lachtrufNobiscum Deus an
,dann aber mußte bis zum Zusammentreffen
mit dem F e inde S til le herrschen. Durch diese l etzte Bes timmungw urde die früher herrschende S itte abgeschaflt, daß w ährend des
Kriegsgot tesdienst in Byzanz 49
Vormarsches fortw ahrend das Nob iscum Deus gesungen w urde,
denn es sei rrdv v do é; urogor zu ) (fa ir eza t xa i.
n go'
q mn r ;fz'
veaö‘a t öm ).é0 u ug T ]? 7ragazciEu zb zaz’
.s’
xer'
vyv zbv
digen» r aün ;r (sc . z i,v (fw r ip
’) agri tl ea‘
0 1;ufia ivu ybzgdz’
aöz rjg zong
,u bv det ).0 zégo r g zürv or gazu uu b v u
°
g ‚11 5 1
'
C0 va &;fdr if0: éy rrirrz ovzag
€r a rr 0y e'
vu v 7 rgbg z i,v ögrn jv , z e ig di 3 ga o vze
'
go ug 7rgbg ögy-
bv
dreyu goy ér o rg n go : rezez‘eoäaz zu ) £ Ségxeo ll a z z :}g zdé
'
ew g, Etw asv erändert lauten die Vorschri ften im S trategikon des Ka isers Leon(XIV 1 und XII 68 f.
,In der Nacht v or dem S ch lachttage
sol l durch die Ge i stl i chen ein fe ierl i cher Gottesd iens t abgeha l tenund den Truppen die Ab so l ut ion erte i l t w erden . Dann so l l S ti l leherrschen , auch be im Verlassen des Lagers . Erst im Augenb l i ckdes A ngr i ffs
,w o Pseudo-Maurikios nur das äl a ldé‘ ew und cbgv
'
5 0 0 a t
v orgeschrieben hatte, insbesondere von sei ten der rückw ä rt igenAb teil ungen
,w i rd j etzt von a l len Truppen der üb l i che S iegesru f
des Kreuzes anges timm t , zi;v 0 1'
p1j0 1; w zyzrfgzov zo-ö 0zc wgoö (pww
‘
jv
äva xgciCew dei .
E ine„
E rklärung aus der Praxis b ietet zu d ieser Vorschri ft dieErzäh l ung Kedrens aus einem F e l dzuge des Ka isers Basileios I.(II 21 1 , 1 0 ed. 0 zzp
’agg
"
r 7r c ua vc'
0 czvzec za l zb‘
0 za vgbg
r ev lz qze’
ovyßor,'
oa vzec ém zc'
0 w zca ze ig éx&golg, ov verca l ozl aé‘
o'
vzw v
(1
750 zu r? ogov g: za l zürv Äowu b v .
‘
Das ist a l so der S ch lach trufdes byzant in is chen Heeres im Mi ttela l ter, E za vgbg veviq e
,der
an die S te l le der lateini s chen Invokation Nobiscum Deus get reten
Genauere Nachr ichten a ber den Ver lauf eines so l chen Gottesd ienstes am Morgen vor der S c hlacht feh len uns. Zw ar sind beiGoar im E uchologium zw e i ausfüh r l i che eöxa
'
i 5752ém ögoy bg 3:9 väw
m i tgete i l t (p. 8 1 7 von denen s i che r die erste von MakariosChrysokephalos, Erzb i schof von Philadelpheia in der zw e i ten Häl fte
Vgl. das sehr w i rre, aber unterha l tl iche Buch v on Go ttfried E phraimMü l l e r , Historisch -ph i lo logische A bhandlung v on den Feldpriestern der
V ö lker al ler Zeiten (Dresden und Leipzi g insbesondere p. 3 1 1 . Der
auch seh r strei tbare Zei tgenosse des Hamburger Hauptpastors Goeze , der v on
sich rühmen durfte, daß er„die E hre hat der erste und vörderste F eld
pred iger eines großen und Iöb l ichen Kriegsheeres, m it A chtung undVor theile,zu seyu “
, scbopft übrigens seine Kenn tn isse v or allem aus Justi L ipsi Dem i l i t i a Romana l ib ri quinque (ed. ul t ima Ant verpiae
250 A . Heisenberg
des 1 4 . Jahrhunderts , verfaßt is t. Aber es b l e ibt zw e i fe l haft,ob
sie w irkl i ch im Heere gebetet w urden . S k izziert ist ferner ein
Gottesdiens t ebenda p. 812f. :’
Ä xol ov ß ia eig e’
7t é). t v ot r ßa gßdnr a r. ém ögoy bg é.9 v cb v . Hier feh l t die im S trategikon Leons aus
drücklich verlangte Der Gottes dienst bes teht im w esentl i chen aus Gesang v on w en igen Liedern und Psa lmen und dem
Verlesen von S tücken aus dem Briefe Pau l i an die Epheser und
dem 1 3. und 1 4 . Kapi te l des Lukasevange l ium s . Außerdem teiltGoar e inen Kanon m it
,den ein sons t n i ch t w e iter bezei chneter
Johannes verfaßt hat (p. 8 1 3 Es is t du rchaus w ahrscheinlich , daß d ieser Kanon e inma l w irk l i ch gesungen w urde, aber esgeschah in e ine r Ki rche der Haupts tadt, n i ch t im Feldlager desHeeres . E s ist auch der Kanon von vornherein für den Gottesd ienst in Kons tantinope l best imm t gew esen , w ie z . B. die dritteOde der sieben ten S trophe verrät, die den S chutz der Theotokosfü r die S tadt erfleht :
Kocru oo rözezgoz ßa oi).zooa n a vv'
y v r;ze,
z ip» 7ro'
l w zav'
zqv q w'
Äa zz e,
ßa o rl eriovza ßa ozl e'
w v z e; a oa n zo'
w
äl a'
mew g ).v'
zgw oaz zr 1 7.gag,
a ixya ).w oiag zzgovo,u f;g za zaögoy fig zd w £ x3 gröv ,
Noch deutl i cher w e i sen auf e ine Be lagerung von Kons tantinope landere S tel len hin
,w ie z. B. Ode 8 , 1 : A iy oßo
’
ga 3 r; gia za l Minor
ä'
g7rayeg z obg oobg 50 151 0Q 7r oz
'
y rnv fragt ezv'
z l woa v oder 8 , 3
Z zgazcag oöga v io-v n ageyßolyj m ega} züx).cuoo
'
v 0 0 0 z ip» za l
n egrzec'
xcoov za l zäg zd m éx3 gä m én qgsz'
ag _u a zo u
'
w oov u . a . Wenn
ferne r mit dem Namen der Agarener bes timm t die Turken als
die Fe inde b ezei chne t s ind, so w i rd man die Entstehung des
Kanons in die letzten Zei ten von Byzanz setzen m üssen,etw a in
die Jahre 1422 oder 1453 . Dama l s aber hande l te es s ich n i chtmehr um e inen Gottesd ienst fur das siegesbew ußt ausmarschierende
Heer, der Kanon ist v ie lmehr der verzw e i fe lnde Hi l feruf des ohn
m äch tigen Vo l kes,das Rettung n i ch t mehr von der e igenen Kraft
erw arte t.Noch eine Einri ch tung des byzan t in is chen Heeres muß in
d iesem Zusammenhang erw ähnt w erden,obw oh l sie n i cht kirch
l i ch en Charakter tr ägt . S ie is t aber an s i ch m erkw ürd ig genug
252 A . He isenberg
können , um zum Kampfe anzu feuern . Denn haufig vermag e ineso l che Ansprache , im rechten Augenb l i ck geha l ten, die S ee lenstärker aufzurü tteln als ein Hau fen Go l des .
Das sind die Grundgedanken , die in jeder Fe l dpredigt zua l len Ze i ten w iederkeh rten . Bei den Byzantinern ist sie bere itsvo l l ständig entw i cke l t
,s teh t aber noch außerha lb der Liturgie.
Ers t dem Ab end land b l ieb es vorbeha l ten , sie in den Mitte lpunk tdes Fel dgottesdiens tes zu s te l len.
Im Z eremonienbuch b esi tzen w ir eine ausführl i che S ch i l derungdes kirch l i chen Gepränges, mit dem der Triumph des Ka isers nachs iegre i cher Beend igung eines F e l dzuge gefe iert w ur de (II 1 9 . 20
,
p. 607 — 6 1 5 ed. Das Gegens tü ck dazu,die gottesd ienst
li chenFe iern b e im Auszug des Heeres,sin d dort n i cht m i tgete i l t.
Zw ar gib t es ein paar Noti zen, in denen bezeugt w i rd, daß derKa iser v or dem Abmars ch fe ierl i ch Gotte sdiens t h ie l t (vgl . p. 4 50
,
1 2 und es w ird auch das Gebet überliefert (p. 4 7 5 , mit
dem Kaiser Basileios einma l be im Ab sch ied seine S tadt demS chutze des Höchsten empfah l ; ab er sonst feh len im Zeremon ienbu ch die gesu chten Angaben. Im übrigen gib t es Nachr i ch tengenug über die Tatsache e ines Go ttesd ienstes v or dem Ausrückendes Heeres . Auch ist uns ein Geb et erha l ten, das bei e inersol chen Ge legenhe i t entstanden ist. E s ist das letzte unter denGebe ten des Patr iarchen Kallistos (1 350 — 54
,1 355 die
Goar im E uchologium p. 821 — 827 m itte i l t, e ine m üde verzw ei fe lndeKlage aus der Ze it des untergehenden Byzanz, die, led ig a l lerei genen Kraf t
,nur noch von einem göttl i chen Wunder die Rettung
erw artet.E in deutl i ches Bi l d e ines sol chen Kriegsgottesdienstes in Byzanz
gib t uns ein Text im God. Laur entianus graecus pl u t. 7 5 cod. 6 fo ll .1 20 " i ch habe ihn vor Jahren abgeschrieben , kann ihnaber m it Rücks i ch t auf den verfügbaren Raum h ier n i ch t im vo l lenUm fang m itte i len . Der Ti te l lau tet : ’
A xol ov3 ia rba l l oyéw; é7t i
xazev oörboez za l ozga r oü erg r s 1 611 31 15n 15v’
Iq0 0 5r
n r o'
v,zip» rin e
'
gayvov S eozo'
xor,zobgdowydzovg, zobgän oozo
'
l ovg
z al eig r oeg ‚adgzvgag. Es ist ein"
0 93 90 9, ein Frühgottesd ienst,
dessen F ormen im ganzen streng gew ahrt s ind . Wie immer inso l chen Texten
,in Hands chri ften w ie in gedruckten Büchern
,ist
nur dasjen ige im Wortlaut m i tgetei l t,w as als Zuta t fü r die be
Kriegsgo t tesdienst in Byzanz 253
sondere Ge legenhe i t ode r als Anderung von der üb l i chen F ormdes Gottesd ienstes abw e i cht, a l les übrige i s t nur durch die S ti chw ö rter der Anfänge angedeutet. S o beginnt die F e ie r w ie jede
aber an S te l le der l etzten sechs Verse des 1 40. Psa lm ss ind d re i kriegeris che or q ngä äram i. rza
' getreten , die von jedemder be iden Chöre nache inander gesungen Es sindGebete an Gott fü r den S ieg im bevorstehenden K r iege
,das
drit te lautet9 n
0 v o*
za vu w:: z‘
cp 7rgm r q: zgcdn a rw v p’a 0 ut u
r' I ( I
m:a rgov z ov Ö szor du ; ag o rga vo ze (pr;0 trg‚l.J agn ev z ov n ; » u na
ob (3 S ehr
m E orm rgoö r i; ör vdy u z u ) väv
w'
znv za l éu'
nnyv z a ) “) u'
cw b'
r n og ivzi“
r
mp or ga zqi 0 0 0 öög dm
Es fo l gt die Doxo logie und ein Gebet des Pr ies ters in Prosa,das w ieder den S ieg erfleht, dann nach dem bekannten GebeteKa t aäz
'
w o‘
ov d re i ou xqgc‘
z civa zol zxd an die Theotokosvo l l des gle i chen k r ieger i schen Ge i stes . Die Wiederho l ung derDoxo logie w i rd unterbrochen durch die Anru fung des Kreuzes und
der Theotokos , dann folgt das berühm te Apo lytikion 4) :S cöoo v
,n igra, zöv ).a o
'
v non
za l eöl o'
yqoov T i p! z l qgo vo,u lav vo r,
w'
zag 1 029 ßam l söm. za zc‘
z ßagp‘cfn dmgov
'
y evog
za l zb O'ÖV q=v l oizzw r
da?: 1 0 5 azavgoü oov 7rol ir sv,u a .
Nach e inem w ei teren T heotokion s ingen die b ei den Choredas Hauptstück des F rühgottesd ienstes in der m i tte la l terl i chenZe it, den Kanon . Er zäh l t neun Oden, die zw e ite feh l t w ie
üb l i ch,jede Ode besteht aus fünf
,die achte aus vier S trophen .
Außer dem immer noch n icht ersetzten E uchologium von Goar (Lu tet .
Par . 1 647) vgl. über die byzant in ische Liturgie z . B. F . E . B r i g h tm a n
Li turgies eastera and w estern I (OxfordVgl. C h r i s t -P a ra n ik as , A nthologie graeca carm inum christianorum ,
Pro legomena p. LXVIIf.
C h r i s t -P a r a n ik as a. 0 . p. LVI,der Text ebd. p. 39 .
Vgl. G o a r a. 0 . p. 66 .
254 A . He isenberg
Es ist immer die glei che Dispos it ion gew ahrt : die erste S tropher i chtet s i ch an Gott, die zw ei te an die E ngel , die _
dritte an die
Apos te l , die vierte an die Märtyrer, die fünfte ist, w ie fast injedem Kanon die letzte S trophe jeder Ode, der Theotokos gew idmet. Nur die ach te Ode w e i cht w ie in der Zah l der S trophenso auch inha l t l i ch insofern ab , als die zw ei te S trophe si ch an
Petrus,den xogv rpa iog t mv o
’
um ar o'
l w v , die dritte an die Apostelund Marty rer geme insam w en det
,w ahrend die Enge l h ier n i ch t
genann t s ind . Hinter der dri tten Ode i st ein Kath isma, h in terder sechs ten ein Kontakion und dann der sog. Ofxog, ein Gebetin s treng rhy thm is cher Prosa, e ingeschob en, das fol genden Wortlaut hat :
’
E xz emög u p de0n a'
r y ßovj0wpev ,xpr0 1 w vv
'
yw v zb odomy a , 0fi; regov°
év xw d'
v’
vozg za l 0'
v r a g ém'
0xs c,ba r,
7 0 139 er 0 02 0 09 é/l 7r idag éx ‚dpéq>ovg 0 0 Ä8150 1/t t719,
xa i zb mgüaypa xa r a’
r0 n‘
a 0 ov
äl a ozo'
n dv0y svcöv
ixe0 z'
c ug zfig zexov'
0ng 0 6,
zcöv ä'ö'
l l erz ovgyé v ,
zui v Üeoa v'
zw r xa l lw ixw v y apzv'
n z e‘
é7t i. yäg n oi é,u ovg égt éva l. ßov l äy sv oz
'
zöv y o'
vov 039 aga zo u.öv äv n ol éy org
p’oqüöv 7rgoaxa l oüy eß a ,
év aol yäg öl ooxegcög n en oc9 0’
z eg
0 02 xa vxaß,u e.90c
xgé l'
ov r eg' do
'
50c n gé7r ez zc,ö xpdzea 0 0 0 .
Auf den Kanon folgt noch ein E xaposteilarion und dannmehrere S chlußgebete, die n i ch t ganz m it dem ü b l i chen Ausgangdes
"093 90 9 üb ereinstimmen .
Das Haupts tü ck des ganzen Gottesd iens tes i st der Kanon,dessen Oden mit ein ige r Freiheit im Rhythm us und in der Me lod ieb ekannten Hirmen fo lgen . A ls Verfasser ist in der Überschr iftein Theodoros genannt. Wir kennen m eh rere Meloden diesesNamens, von denen Theodoros S tu d ites der berühmteste w ar .
Aber gerade ihn als Dichter anzusehen,feh l t es an jedem Be
w e ise! In se ine Ze it oder doch in die uh inittelbar darauf fol gende
256A . He isenberg
Xzoa zer u a za 0 zeogb: u a gn‘gw tg
xgt 0 r cuvéu o r 0 zga zzä .
‘
za ).
zäg n ogez'
ag ifh‘ra r e .
3 äi.a zza r
za l z i,v ;nj v za zorgzz-o r r eq
l
7rgb mgo0«örro r a özw r 1 7. 80 1m ; r u w v
Fa l rjv r; g rm;r fig : rl r o o foa zb: : ra'
r za ,
oa ig Äzza ig (i) ; äya fh‘
, ya i r,'
v r; v a ir3 3 v;z i, v
€v 3 0 ).d0 0 3; 0 0 u .
‘
fl é0 t 0 0
dido r z :p m ou p o rga c 0 0 r .
za ? év y;j U l ' l'OÖEÜO L'OO
é; er éd‘
oag za ? dl d0 0)
In die große Ze i t by zant in is c her Ges ch i c hte nach dem Bildersturm w ei sen auch die anderen Merkma le . Heer und Flotades Ka isers. der sie se lbs t beglei ten w i l l
,s tehen vor den
Au fbru ch zum Kampf gegen e inen Fe ind, der noch nicht zuo
Christentum s ic h bekehrt hat . Das w aren nach dem 10. Jahrhundert nur die Diener Mohammeds , Araber oder Türken, abe
gerade sie s ind n i cht die Feinde. gegen die der Fe l dzug gehtDenn ke in Wort findet s i ch
,das auf den fals chen Glauben an der
Prophe ten zu deuten w äre,
und die bei ke inem byzantinischenS ch r i ftste l ler feh lende Beze i chnung der Mohammedaner als Agareueund Ismaeliten su ch t man h ier vergebens . Die Fe inde, die hiergemein t s ind , k ennen ü berhaupt noc h ke inen Gott, sie sind HeidenAuf barbar is che Vö lkers tämme , die unte r e inze lnen Häuptlingerstehen und noch zu ke inem fes ten S taa t s ich zusammengesehlossethaben s cheint der An fang de r se chs ten Ode h inzuw eisen : ’
Avriywt
€3 vcb r ze za l z rgdw w v wir zur) ).abv za l 7zo'
l ezg xa3 uzt o'
zaém
zgdzez oov ß eiq» , aber w eder d iese Andeutung noch die Bemerkungin der siebenten Ode, daß die Fe inde e inen Te i l des Rei ches besetzhaben (yfiv , i,‘v z r gaw ig 5x zoü
‘
Pwya lwv zj ßdgßd ?°9lges tattet e ine genaue Best immung i hres Namens . E s könne!Bulgaren oder andere slav ische S tämme, auch die Russen selbstgem e int sein , der Text erlaub t ke ine Fes ts tellung .
Vie l le i c ht hat der Di ch ter abs i cht l i c h all zu deutl i che Hinweiseauf Einze l he i ten der damaligen po l i t is chen Lage verm ieden. Dem
w enn auch ein b estimm ter Fe ldzug den Anlaß zur K ompositioß
Kriegsgottesdienst in Byzanz 257
des Kanons gegeben haben w ird, so ist er doch im ganzen so
geha l ten, daß er ö fter bei der glei chen Gelegenhe i t gesungenw erden konnte . V ie l lei ch t i st er mit der ganzen Ordnung diesesKriegsgottesdienstes noch im 1 4 . Jahrhundert in Geb rauch gew esen
,
als die Handschr i ft en tstand . Denn sie enthält außer medi zini s chenAbhand lungen au ch die Tak tik des Ka i sers Leon (ff. 7 2 '
auch w aren die S tü cke aus dem Mi l itärstr afgesetzbuch,die der
S chreiber (ff. 1 1 6 ‘neben d ieser Gottesdienstordnuug als
e ine Art Anhang zur Taktik m i tte i l t, dama l s ebenfa l l s noch inGeltung .
Aber der Ge i st, der aus dem ganzen Offizium spri cht, w ar
jetzt aus dem kaiserli chen Heere gew i chen. An Frömm igke it zwarfeh lte es den Byzantinern au ch in diesen letzten Zei ten des Rei chesni ch t, aber die al te Kraft und Tapferkeit w aren dahin. S ie hattendie a l te Wei shei t vergessen : 0 131» 3 3@ dei nai zäg xelgag
oa l ev'
ew
F estsc hr ift Kuhn .
256 A . He isenberg‘"
zgozz ev'
y a za 0 zeggö: 75 0 10 023 1 40 1» y agzv’
n ,
xgz0 zw vv'
_u ov 0 zgazzäg za l sz
’v0 eb
’oög
zözg n ogec'
ag
ä oil azzav yaÄq cb vzeg
za l zbv ;njw zazagzzgovzsg
a gb zzgo0 rbzzo v aözcb v ixeoiazg 15u cb v
F ah jw ;g vor;zfig zzÄqgoü0 a zb: zrofv za
0 a ig l zza lg ya l rjq a 1’
0 3 qz 1;v
év Ö a l oi0 0n 0 0y zzl e'
ou0 a
didou z rp 7u 0z@ 0 zga zq'
» oau ,
za l év 7 37 0 uvodev'
ow a
é; évéö'
gag za l dzd0w é'
e.
In die große Ze i t byzan t in ischer Ges ch i chte nach dem Bi l dersturm w eisen auch die anderen Merkma le. Heer und Flottedes Ka isers, der sie se lbs t beglei ten w i l l
,s tehen v or dem
Au fbru ch zum Kampf gegen e inen Fe ind , der noch n i cht zum
Christentum s ic h bekehrt hat. Das w aren nach dem 1 0. Jahrhunder t nur die Diener Mohammeds, Araber oder Türken, abe rgerade sie s ind n icht die F e inde, gegen die der F e l dzug geht.Denn ke in Wort findet s i ch , das auf den fal s chen Glauben an den
Propheten zu deuten w äre, und die bei ke inem byzantin is chenS chri f ts te l ler feh lende Beze i chnung der Mohammedaner als Agar enerund Ismaeliten such t man h ier vergebens . Die Fe inde
,die hier
geme in t s ind , k ennen überhaupt noch keinen Gott, sie s ind He iden .
Auf barbaris che Vö lkerstämme, die un ter einze lnen Häuptl ingens tehen und noch zu ke inem festen S taat s ich zusammengesch lossenhaben, s che int der An fang der sechsten Ode h inzuw ei sen : ’
A vo'
yw v
38 vü'
w ze xa i z vgdvvw v yf; v za l Äabv za l zzo'
Äezg zaä vzzözozéov
xgdzez 0 ov 3 5 c'
zp,aber w eder d iese Andeutung noch die Bemerkung
in der s iebenten Ode, daß die Fe inde e inen Te i l des Rei ches besetzthaben (yfiv , ijv ärpei ).e z egav vig 5x zoü xl q
'
gov‘
Pw,u a iw v ßoigßagog),
gestattet e ine genaue Best imm ung ihres Namens . Es könnenBulgaren oder andere slav ische S tämme, auch die Russen se lbstgeme int sein, der Text erlaub t ke ine Festste l l ung.
Vie l le i ch t hat der Dich ter abs icht l i ch a l l zu deut l i che Hinw e iseauf Einze l he i ten der damal igen pol it is chen Lage verm ieden. Dennw enn auch ein b estimm ter Fe l dzug den An laß zur K omposition
Altpreußisches.
A. Bezzenb erger (Kon igsberg) .
Der Güte Dr . W. Z i e sem e r s , der für das im Auftrage derBerl iner Akadem ie v on ihm un ternommene preußis che Wörterbuchdie m itte lalter l i chen deu ts chen Sprachque l len des K ön igsbergerS taatsarch ivs herangezogen hat, verdanke i ch ein ige urkundl i cheS te l len aus Kammerrechnungen die a l tpreußis che Wörter ent
hal ten. Der Zuw achs, den der a l tpreuß is che Sprachschatz dadur cherfährt
,ist zw ar nur kle in , aber bei der Iü ckenhaften Über l ieferung
des Altpreuß i schen will kommen , und da a l le diese S te llen an ihm
Anteil haben, setze i ch sie h ierher und w erde dann versu chen ,die Fragen , die sie aufw erfen
,zu beantw orten .
1 . Lunenburg im somergerichte 1 5 . anno v isitationis MariePor repz
’
l ingemanet 7 m .
,dy hat der s chub ert usgegeben.
2. Im fas ten geri chte czu Pel len Margarethen im somer 1 5 °der kemerer hat ingemanet im por r [epil] 8 m . und sc? )
3. Im fastengerichte czu Lunenburg camerampt 1 5°
kemerer hot ingemanet porr [epil] slusz'
m sorgalio 1 9 m .
m inus 9 sc .
sunde ge fa l len 3 m . m inus 1 sc.
4 . Cam erampt Nattingen herbestgericht
der kemerer hat ingemanet im p0r r [ epil] m .,do von
1) Ordensb riefarch iv , 14 17 , 1420. Außer Nr. 8 aus den Jahren 14 14
bis 14 1 7 . Bei späterem e i gnen Nachsuchen fand ich n icht w enige S tellen ,welche die ob i gen Nr . 2— 7 ph ilo logisch bestätigen
,sprachl ich aber nichts
neues b ieten. Ich sehe von ihnen ab .
Hier,in Nr . 3, 4 , 5 und sonst immer ist porrepz'l abgekürzt . Die
Aufl osung rührt v on Dr . Ziesemer her .
A l tpreußisches 259
hat her usgegeben m . v or fissche,vor eyer, vor cannen.
i tem slusim sorga lz'
o ge fal len 1 9 m . aus 4 so].
amade gefa l len 4 m . 1 0 sc. usgegeben 14 sol. rotmannen
pagmoren, dw arniken .
5 . Im fastengerichte Bar thensteyn anno ingemanet im
pmv{epil] slusim sozgalz'
o 24 m . m inus sol. , v or amade
2 m . sol., acln'
zpolleide m . und 1 ferto,herschaw
9 m . und 1 ferto.
6 . Im fastengerichte S inthen camerampt anno etc. 1 5 °
kemerer hat ingemanet 40 m . 7 sc . ane 6 d . slusz'
m sorgalz'
o,
i tem 7 m . m inus 4 sc. simde und herschaw,i tem 8 sc. vor
7 . i tem 1 0 sc . usgegeben rotluthen, pagmoren , dw arni/cen und
sust kellerkneeht.8. Gerdauen . um 1 420
v on pflugkorne und dass ump tin .
Von den h ier ers che inenden preußis chen Wörtern s ind schonbekann t slusz
'
m,sorgalz
'
o, pagmoren , s ende und (ackir)polleide, neu
dagegen por r epz'
l,dw arm
'
lcen und dassumptz'
n . Die be i den letztens ind ohne w ei teres k lar : dwam z
'
ken i st deutscher Pl ura l e ines dempoln. dwor zm
'
k,dw 0rm
'
k Hofmeier , Vogt “ (vgl . russ . dvo’rnz'lc Hausknech t “
,l it. dw arz'ninkas „Mann v om Hofe “
) entsprechenden, w ahrscheinlich h ierau s en tlehnten Wortes und dassumptz
'
n gehörtoffens ich tl i ch zu preuß.
'
desstm ts, dessympls „zehnter “
, bedeute t„Dezem ,
Zehn te“un d entspri c ht dem l i t. deszz'm tine' „
Zehn te l “ . Da
alle ob igen S te l len auf hands ch r i ftl i chen Noti zen zu beruhen s che inen,kann es sein befremdendes u dur ch e inen Kopi s ten erha l ten haben.
S ein a dagegen ist glaubw ürdig (T r a u tm an n,Die a l tpreußis chen
S prachdenkmäler p. 1 04 f. Zu r Sache bemerke i ch,daß
das Pflugkorn und der Zehnte als preußis che Abgaben bekannts ind (L ohm ey e r, Ges chichte von Ost undWes tpreußen3 I , p. 1 90,
1 95 ; Lotar We b e r,Preußen v or 500 Jahren p. Fü r die
Ent lehnung von dw am z'
lcen bzw . seines preuß. Nom in. Sg.
*dw arnz'
ks
i s t ge l tend zu machen,daß sein S tammw ort (poln. dwör
,russ . door
„Hof“ l i t. dwäras) in den a l tpreußi s chen Que l len, die Eigennamen
1) Wegen des daneben stehenden pagmoren s. N e s s e lm an n , Thesaurusun ter podkamor und B rü ckn e r, S lav . F remdw örter p. 1 14 un te r pakamor é.
1 7*
260 A . Bezzenberger
e inges ch lossen, n i cht vorkommt und auch dem Letti s chen fehlt,die
Echthe i t von l it. dwäras aber m indestens verdächtig ist. Al lerdingssehen w ir den nackten Begri ff „Hof
“ in Willents Katech ismusüb ersetzung sow oh l in der Erk lärung der vierten Bitte
, w ie in
der des ersten Glaubensartike l s mit dwäras übersetzt (in Bechte l sAusgabe 1 0
„in dessen an dense lben S tel len b ietet dafür das
preuß. En chiri d ion das auf deu tsch Vorwerk („Landgut, besondersherrschaft l iches “ S c h i l l e r und L ü b b e n) zurückgehende burw alkan(KZ XLIV, 320 Anm . und der letti s che Katech ismu s von 1 586
(meine Ausgabe 1 2„
das aus dem Livis chen (m oiz Gutsgebäude, Hof“ , P lur . „Landgu t “) oder Russ is chen (myza „Landhaus,Vorw erk“
; T h om s e n , Beröringer p. 270) ent lehnte m a i/chez „Gut
,
Ede l hof“ , und'
da ebend iese Bedeutung dem lit . dwäras vorzugsw e ise innew ohnt (vgl . die Wörterbü cher und die Redensart an t
dwäro eitz'
„aufs Amt
,zur Pol i ze i so i st es mehr als
w ahrschein l i ch , daß w ie h ier,so dort ab s icht l i c h n i cht die Vor
s tell ung „Bauernhof“ (l i t. käm as
,lett. séta , m djas), sondern „
Herrenhof
“ausgedrückt ist vermutl i ch in jedem Fa l le
,w ei l die ech t
b a l ti s che Bezei chnung e ines b äuerl i chen Anw esens l i t. kämas preuß.
kaimz'
s,lett . ze
’
em s (Bielenstein Ho l zbau ten I , 1 40) w ar, so aberau ch „
Dorf“ h ieß , und ein Mißv erständn i s verhütet w erden so l l te .
Den Begriff „Herrenhof“ aber w erden die Litauer w oh l erst spät
kennen gelernt und mit ihm se inen Ausdru ck v on i hren slavischen
Nachbarn empfangen haben.
Von Neben fragen abgesehen, steh t es a l so um dwam iken und
dassumptz'
n sehr e in fach . Was aber ist pow epil? Um eine Antw ortdarauf zu erm ögl i chen, muß i ch auf die koordin ierten Ausdrückeslusz
'
m und sorgalio e ingehen , wi l l aber,um die ob igen S te l len
tun l i chst klarzuste l len, auch die Term ini sunde, herschaw und
ackizpollez'
de behande ln. Dabe i erinnere i ch daran, daß Bernekerund Trautmann die a l tpreußis chen E inzelreste grundsätzl i ch ni chtberücksi chti gt haben.
slusz'
m w ar gle i chbedeu tend m it Diens tgut“ oder Dienstgeld“
,
e iner Abgabe, die nach T öppen ,w e l cher d ies nachgew iesen hat
(Altpreuß. Monatsschri ft IV ,nur von preußischen Bauern
gezah l t und vermut l ich zum Zw ecke des Kr iegsdienstes “ erhobenw urde . Da se lb stvers tändl i ch das Wort slu sim ,
das auch als slusem
und sluszen vorkomm t,zu dem aus dem l i t. szlü.éyti stammenden
262 A . Bezzenberger
Wort für „S trafe “
,von dem in Wil l s Katech ismus als Akk. Sg.
sündan und sündin,als Gen. Sg. sündis vorkomm en. T r a u tm ann
a . a . 0 . p. 44 1 s ieht darin ein Masku l inum,aber sündz'n
,sündz
'
s w e isenauch auf
_
*sünde
,und ebendies F emin inum w ird du rch die ob igen
S te l len 4 — 6,Altpreuß.Monatsschrift IV
,1 38 (se nde) und andere Be lege
an die Hand gegeben . Auch sündan hat desha lb für e ine preuß.
F em ininform zu gelten,aber trotzdem ist Trautmanns Me inung n i ch t
ganz unr i ch tig,son dern das fragl iche Wort w ar ursprüngl ich w irk l i ch
dem Poln is chen gemäß Masku linum un d sündan sein rege l rechterAkkusati v. Da aber mehrere Kasusendun gen der ä-Dek l ina tion(s. galw as, dlgas ; m érgan ,
ränkan) der ä-Dek l inat ion entsprechen,w urde sündan
‚
fäl sch l i ch als F em ininform au fgefaß t , in der
Fol ge aber die Dekl ination von sgd*sündas in die -Dekli
nat ion überge le ite t (vg l . m odlan m adlz'
n ; m ij lz'
n my lan und
T r a u tm an n a. a . 0 . p.
' Einer Berücks ich tigung des -is ‚
w e l ches das Elb inger Vokabular für -as im Nom in . S g. der d
S tämm e zu zeigen pflegt, bedarf es bei der Klarhe it dieser E ntw icklungsreihe n icht
,und e in e Heranziehung von deutsch sande
„S ünde“
w äre un zu l ässig, da dies Wort v on *sünde S trafe“ ton is ch
vers ch ieden gew esen se in w ird (KZ XLIV, S ach l i ch i sts
'
unde als Ge l ds trafe,-buße aufzufassen (s; L o hm ey e r a. a. 0 . p.
und n i chts anderes als eine sol che sehe i ch in herschaw (Nr . 5 ,in dem i ch darunter die Buße verstehe, die der zah l en mußte
,der
s i ch bei der Heerschau oder , Heerschauunge“
(preuß. kazige-wayte,
ca1ya-w oytz
'
s) durch Nich tersche inen oder mange l hafte Bew affnungsträfl i ch erw iesen hatte. Vgl . Ak ten der S tändetage Preußens V,31 6 (auch H ,
An eine a l lgeme ine S teuer zu den geme inenLandes und Verteidigungsbedürfnissen (s. das Grimm s che Wörterbuch un ter Heezbann) ist n i cht zu
- denken, da w enigstens e ineder sol chen Zw ecken d ienenden Landesauflagen als slusz
'
m deutl i ch spezifiziert i st.
polleide, von T öppe n a. a . 0 . p. 1 40 in dieser Form (polleydeges chrieben) und als polayde, palayde‚ pa lleyde, ballayde nachge
w iesen und als„Hinterlassen scha ft des Untertanen , die, w enn er
keinen Leibeserben h in ter l äß t, an den Grundherrn fäl lt“,erklart
,
ist von N e sse lm a n n r i chtig zu lit. pa-léisti, lett. pa —la’
z'
st„ los lassen“
gestellt. E in anderer im Ordenslande bekann ter Ausdruck desse lben Begrit‘fes w ar das aus dem poln. pus
'
cz'
zna en tlehnte puscina
A l tpreußisches 26 3
(N e s se lm a n n,Thesaurus) . Aus me inem Nachw e i s Gott . Nachr .
1 905 , p. 455 f. folgt , daß der ers ten S i lbe pa zukommt, aber auchpo hier n i ch t zu verw erfen is t . Ob die zw e ite S i lbe m it ei oderai zu s ch reiben i s t, l äß t s i ch n i cht ausmachen
,da das Preußis che
leid las sen “und se ine Ab le itungen sonst durch w erp verdrängt
hat. Neu is t die Verb indung acAz'
r -pollez'
de. Viel le i ch t i st „ ackers chu l d u nd palleyde
“
(T öppe n u . a. als„acker-schul d und
-
palleyde“au fzu fassen. Wahrscheinl i ch ist unter ackizp ollez
'
de e ineerbrechtl i c he Geb üh r zu verstehen, w e l che die Herrscha ft erhob ,w enn sie auf Hinter lassenschaft an Acker land verzi ch tete. Ver
sch ieden davon w ar das auch v orkommende „E rbgeld“
.
Al les die s vorausges ch i ckt, kann es kaum zw e i fe l haft sein,
daß porrepil e ine Abgabe w ar,und zw ar e ine Abgabe von ähn l i ch er
A rt, w ie slusim,a l so v ermutl i ch e ine S teuer, die e inem m i l i täris c hen
oder ähn l i chen Zw ecke diente . Hieran darf der Ausdru ck „ ingemanet
im porrepil“n i cht bein en
,denn in „
ingemanet im porrepil slus im
sorgalio“ b ezieh t s ic h „ ingemanet im
“auf a l le dre i Wörter, und
es he ißt auch nur„porrepil ingemanet
“
, „ingemanet porrepil sia s im
sorgalio“ Um d iese Abgabe aber e in igermaßen zu bestimmen ,
bedar f es einer annehmbaren Etymologie von por repil, und e inesol che glaube i ch geben zu können . Da das Wort näm l i ch so
gut w ie gew i ß eine preuß ische Neub i l dung und für seine Erk lärung a l so nur preußis ches Sprachgut zu benutzen ist, komm tfür sie nur eine ger inge Zah l von Wö rtern in Betrach t, denn an
Anklängen b ietet der preußis che Sprachschatz außer dem deu tschenFischnamen rapzls „
Rapfen “und r opena „
junge S tute “
,das h ier
ke inerle i Anha l t gew ährt, ledigl i ch : rapa. „Enge l “ , r aples „
Zange“
und ripaz'
tz'
„folget
“
(Part . Präs. Fem . zipintz'
n), ser r ipz'
m az'
(aus sen-r°)
„w ir erfahren “
,d. h . aber e ine Gruppe von Wörtern, deren Zu
sammengehörigkeit m ir außer'
F rage steh t, obgle i ch B r ü c k n e r ,Arch iv f . s lav . Phi l ologie XX ,
5 12 me ine Erk lärung von rapa als
„fy l gja, guard ian ange l “ Auch w egen der etymo
1) Nach B ru ckn e r , den ich h ier an Vulfilas und des Helianddich ters
Ub ersetzungsart erinnern muß, „hätte der g läub ige Verfasser des Voka
bulare [das mit dem h eidn ischen deyw is beginnt] s ich w ohl gehütet, aus
heidnischem Teufelszeug E ngel zu machen“
,w äre aber vor der Blasph0mie
nicht zurückge®hreckt ‚ E ngel zu „Knirpsen“zu stempeln : „
vgl. lett . räpt
und räpöt kriechen , räpainis räpzdis räpucz'
s ein Kind das noch kriecht ; es
264 A . Bezzenberger , A l tpreußisches
logis chen Verw andts chaft d ieser Gruppe bin i ch ni cht im Zw ei fe l,
denn raples deckt s i ch mit lit. r é'
plés, r tp (s . T r au tm an n a. a . 0 .
p. 121 b) mit l i t . rép in ap—r éptz
'
„erfassen , um fassen, b egr e i fen “
(„ob chvatiß , ogarnaé“ J uäk-
e v iö, Lit. S lov. ; aprepiam i BB III, 73
und die Begriffsen tw i ck lung fassen fol gen verm itte l t„ haschen “
Al so der Begriff „fassen“
oder „ fol gen “ i st in por repil zusuchen , und nach dem , w as i ch über das Wesen der so b enanntenAbgabe erm itte l t habe
,bevorzuge i ch den letzteren . Ich sehe
daher in porrepil „Folge “
,jedoch n i ch t im S inne „
Heeres fol ge“
,
der mit slusim genügend ausgedr ü ckt i st, sondern in dem der
„persecutiones hostium genera les , quae volge nominantur “
(G r imm ,
Rechtsaltertümer p. oder vielle i ch t noch besser im S inne„Gefol ge
,Ge le ite“
,so daß porrepil eine S teuer behufs Ausrüstung
und Besoldung der Gefol gs chaft gew i s ser Re isender, z. B. e inesKaufmannes (vgl. Ak ten der S tändetage Preußens V , 107 ) gew esen w äre.
Als r i chtige Form von por repil setze i ch pa-repilas oder par ép
'
t lä an,indem ich w egen des or
r auf pollez'
de und w egen derBildung auf lit. stowylas, otowyla (L e sk ie n a. a . 0 . p. 484) verw e ise.
könn te sogar Zusammenhang mit dem Namen fur Kröte [poln. r 0pu cha,
lit . rupuz'
z'
é] v erb le iben“.
„Zu diesem r apa gehört dann auch preuß . rapeno
junge Kobel A1s ob ein F ül len jemals kröche ! Brückner w eistzwar auf die Putten der chr istl ichen Kunst hin , aber für den Anfertiger desVokabulars handel te es sich doch wohl nur um den b ib l ischen Begriff
„E ngel “ ,
und ob er neue Ausdrücke geprägt hat , b leib t nachzuweisen .
266 Wi lhelm S treitberg
Aber schon Joh . S c hm i d t hat durch seinen Hinw eis auf ved.
nadbhyas (p. 495 Fußnote) dieser Bew ei s führung den Boden ent
zogen . Und w enn W . S c h u l z e s Etymologie zu Rech t bes teh t, dienipj is ganz von nepit trenn t und zu a ind . nitya ste l l t (KZ 40,
4 1 1 so i st bei dem gotis chen Wort überhaupt n i cht m it demVerlust e ines oder f zu rechnen Für w e l che dieser bei denErkl ärungsmögl i chke iten man s i ch auch ents che i den möge, zum
Bew e is für die Versch iebung v on t in der idg. Verb indung pt taugtm
'
pj is auf keinen Fa l l .M ö l l e r s Bew e iss tü cke hat Mi c h e l s einer Prüfung unter
zogen ; i ch darf desha lb darauf verz ichten, auf a l les Uns ichere odervö l l ig U nhaltbare nochma l s einzugehn. In der Hauptsache frei l i chsind Mö l ler undMi che l s trotz a l ler Meinungsversch iedenhe i ten imeinze lnen ein ig : da übera l l
,w o im German is chen durch jüngere
Entw i ck l ung 3 und zusammenstoßen, das I) in t übergeh t, so
glaub en sie h ieraus folgern zu dürfen, daß auch im U rgermanischeneine so l che Rückverw and lung des verschobenen p nach 3
, f, 26
s tattgefunden habe. Ob ein so l c her S chluß be'rech tigt sei, w ir d
Später geprüft w erden . Vorerst m uß i c h auf die Bew eis führun gv on Mi che l s näher eingehn.
Mi c h e l s glaub t durch den Para lle l ismus von ahd. brunst und
cumft die Annahme ur sprüngl icher Versch iebung auch nach Spiransw ahrs che in l i ch m achen zu können. Wie oumft aus
*
gumpiz, so sei
br emst aus*brunpz
'
z ents tanden. Mit andern Worten : es hab e s ichzw ischen dem Nasa l und der folgenden (verschobenen) den talenSpi rans ein Übergangs laut en tw i cke l t, dessen Charakter durch dieArtikulationss te l le des Nasa l s bes timm t w orden sei. Angenommen die Form *br unpiz bot laut l i che Unbequem l i chke i ten,so daß s i ch etwa bei ras chem S prechen die
‚Gelegenheitsform
‘
*bm n*
piz mit paras i tis chem s e in ste l l te,so begre ift man i hre Dur ch
führung auf dem Wege der Ana logieb i l dung sehr le ich t, w enn mandie w eitere Annahme machen darf
,daß daneben e inmal *durspi: ,
vie l lei ch t au ch *r unspiz,
*anspiz bestand“
(p.
Man erkennt an der vors ich tigen Ausdrucksw e ise des Fors chers,
w ie sehr er s ich der Unsicherhe i t des Bodens bew uß t ist, auf den
er baut. Aber n i cht nur, _
daß die Fol gerungen in hohem Gradeuns icher sind
,auch die Voraussetzung un ter l iegt s chw eren Be
denken. Vor a l lem muß m an s ic h fr agen : ist denn der behauptete
Z ur Lautv‘
crschiebuug 26 7
Para l lel ismus zw ischen bm nst und c umft w i rkl ic h vorhanden? I chglaube, die Frage is t rundw eg zu verne inen . Das 3 in got.
-br unsts‚
ahd. br unst kann unmögl ic h als Übergangs lau t zw i schen n und
au fgefaßt w erden. Wäre es ein so l cher,so müß te man 3 auch
sons t zw is chen n und finden. Das i s t aber bekann t l i c h nie derFa l l : außerhalb des Kre ises der Verbalab strakta und der Präteri
toprasentia begegnet n i e m a l s der angeb l i che Übergangs lau t .U nd w enn neben aisl. gf-und ein ahd. abm nst, neben got. ga
-mu nds
ein mbd. mu nst steht,so hande l t es s i ch ebensogut um e in fache
Analogieschöpfungen w ie in den Präteritis ahd. konsta, gi
-onsta
u . dgl . Es kann daher n i ch t zw ei fe l ha ft se in,daß -sti für idg.
‚ ti
auf einer Lin ie m it -s ni für idg.-m
' s teht,daß es si ch in b e iden
F ä l len um,Konglutinate
‘ hande l t, vgl . B r ugm a n n s Grundriß“ 2,
288 ; 4 37 . Dam i t aber sche i det -sti aus der Re i he der Bew ei ss tü cke aus.
Wesent l i ch anders l iegen die Dinge bei c um/t und Genossen .
Hier ist das f ursprüngl ich w en igs tens tatsäch l ic h als Übergangslaut zu erk lären . Es lohnt s ich , die Ges ch i chte des f etw asgenauer ins Auge zu fassen. Es w ird s ich a l s dann ergeben
,daß
die S te l lung, w e l c he die Bi l dungen auf -mfti in der Entw i ck l ungder Vérbalabstrakta auf -ti e innehmen , in der Rege l n i ch t r ich tigbeurte i l t w orden ist .
B r u gm a n n,Grundriß 2 l , 38 1 ; 385 f. ste l l t das Lautgesetz
auf, daß urgerm .-md -m t zu -nd -n t gew orden sei, daß -mp
dagegen sein m unverändert erhal ten habe. Aber d iese letzteAnnahme
,die auch v on phonetis chem S tandpunkt aus betrachtet,
w en ig befriedigend ers che int, beruht meines Bedünkens auf e inerir rigen Ein schätzung des Verhäl tn is ses von got. ga
-
gumps und ahd.
cumft und auf e iner Verkennung der got . Form anda-num ts.
B r u gm an n s Lautgesetz von der Erhal tung des -mp ist
l edigl i ch auf got. ga-gumps aufgebaut. Woher aber w eiß Brugmann ,daß diese und nur d iese F orm die ungestörte laut l i che Entw i cklungb ietet ? Gew iß
,es hande l t s i ch um e ine a l le instehende Bildung,
und an a l le ins tehende Bi l dungen w enden w ir uns m it Vor l iebe,w enn es gil t
,die von analogischen Einflüssen n i cht berührte Laut
entw ick lung fes tzuste l len . Aber man braucht gagumps nur e inma lm it gahugds zu vergle i chen , um zu erkennen
,daß jenes n i cht
glei c h d iesem ein Zeuge des Alten se in kann. Währen d gahugds
268 Wi lhelm S trei tberg
aus jedem Sys tem herausfäl l t,dunke l und b e fremd l i ch erscheint
,
gl iedert s i ch gagumps aufs vo l l kommens te ein, ist v on außer
ordentl i cher Rege lmäß igke it und Durch si chtigke it. Der Verdach t,
daß w ir es desha lb b ei gaqumps m it e iner Neuschöpfung zu tunhaben , w ird durch anda-num ts zur Gew ißhe i t. Dessen t w e istun zw e ideutig auf ein ursprüngl ich vorausgehendes f hin, das hats chon K . v. Bah de r (Verbalabstrakta p. 72) r i chtig erkann t. Die
Lautform des Wortes aber ist uns durch e ine Beobach tung W .
S c h u l z e s (KZ 42, 92) verständ l i ch gew orden. Dieser hat näm l i chin der S chre ibung fim tiguns (Luk. 1 6
,6) für das zu erw artende
fimf tiguns e inen zw e iten Zeugen für die s chw ache Arti ku la t ionvon f in der Gruppe mft nachgew iesen . Wenn dem aber so is t,w enn auch für
,
das Goti s che durch — nam te aus*numfts das Vor
handensein von f-Formen festgestell t i st, die den deutschen f-Formenentsprechen, so i st es n i cht mehr mögl i ch
,in gaqumPs die a l ter
tümlichere Form zu sehn . Wer das tun w o l l te,müßte die F rage
beantw orten , w arum si ch denn das ursprüngl i che gumpi n i chtebensogut zu gumfj n
'
qumfti (qum ti entw i cke l t habe w ie das
ursprüngl iche numpi Die An tw ort dürfte um so s chw ierigerfal len
,als uns in aisl. sam -kund
‚Fes t
,Bankett‘
,e igent l i c h
‚Zu
sammenkun ft‘ die ursprüngl i chste Form e ines Verbalnomens zu
giman noch erha l ten is t.Auf die r icht ige Erk lärung ha tte s chon der An laut von -
gumbs
h inw eisen können. Daß 9 statt des lautgese tz l i chen k vor u sr
s cheint im Gegensatz zu aisl. sam -kund lehrt uns,w ie
lebendig in diesem Fa l le das Gefüh l für die Zugehörigkei t desNomens zum Verbum war . Übera l l aber, w o das Bew ußtse in von
der engen Verknüpfung zw eier F ormenreihen vorhanden ist, pflegenvere inzelte S törungen, die durch lautl i che Entw i ck l ungen hervorgeru fen sind , durch Umb ildungen w ieder beseitigt zu w erden . S o
konnte auch nach demMus ter von gabaz'
ran :gabaurps, gatairan :gataurps
u . a. m . zu gagz‘
m an ein Verbalnomen gagumps an S te l le des ursprünglichen
*
gakunds ohne jede S chw ierigkeit neu geschaffenw erden. An laut und Aus laut der Wurze l haben s i ch be im Verba lnomen nach dem Verbum geri chtet.
Gle i ch gaqumps s ind auch die Formen w ie got.-nam te ahd.
numft Neuschöpfungen, nur gehören sie e iner w esentl i ch älteru
Bi l dungss ch i cht an . Ihre Lautform w ird nur dann verständl i ch‚
27 0 Wilh elm S tre itberg
w i ck l ung n i chts zu tun,vie lmehr ist ererb tes -m t überal l zu -m
gew orden,durch Ana logiebildung später neu en tstandenes zu —mpt
en tw i cke l t.Geht aber, w as phoneti sch a l lein glaub haft ist, das -mft der
Verbalnom ina auf -mp t älter -m t zurü ck,so fäl lt die Mögl i chkei t
w eg, das f d ieser Formen zum Zeugen für das einstige Vorhanden«
se in von p anzurufen und in dem über l ie ferten t das Ergebni s e inerRückverw and l ung zu erb l i cken .
S o b le ib t s ch l ieß l i ch als e in zige S tü tze der Verw andlungs
theorie die bekannte Tatsache übrig,daß der postdenta le Spirant,
der nachträgl i ch h inter 3 zu stehen kommt,zum Versch lußlaut
w ir d . Wie h ier ein nach s in t übergeht,so soll auch im
U rgermanischen nach 3, f, ein in t zur ü ckverw ande l t w orden
sein. Ist aber dieser S ch luß zw ingen d? Mir s chein t, m it bessermRecht kann man aus dem Tatbestan d grade das Gegenteil fo l gern.
Wenn ae . hafas pu zu hafastu, die 3. S ing.
*forliesz} im West
sächs is chen zu forüest w ird, w enn dem ru nischen reispi (gegenübergot. r aisz
'
da) ein späteres reisti entspr i ch t und w as dergle ichenFäl le m ehr sind
,so bew e ist d iese Verw and lung der Spirans in den
Verschlußlaut dem unbe fangenen Beobach ter vorers t n i chts w ei ter,als daß die Verb indung sp für den Germanen s chw er sprechbarist, daß sie übera l l dort, Wo sie dur ch spätere En tw i ck l ung ent
steht,mogl i chs t ba l d w ieder beseit igt w i rd . Diese durchgehende
Abne igung gegen die Lau tgruppe sp ist in me in en Augen der
Annahm c einer urgermanischen Vers ch iebun g v on st zu sp n i ch teben güns tig.
Noch b edenkl i cher ab er w ir d d iese Annahme, w enn w ir ver
suchen, uns das Wesen der T ennisv erschiebung klar zu machen.
Wir b rauchen dazu n i cht in die urgermanische Zei t zurückzugehn ,w ir finden d iese lben Vorgänge b ei der hoch deuts chen Lautversch iebung ; ja sie s in d bei der b eginnenden dän ischen Tenn isversch iebung unm i tte lbar der Beobachtung zugängl i ch . Wenn
irgendw o, so i st h ier die Projek tion der Gegenw ar t in die—
Ver
gangenheit er laub t, ja geboten .
Die Voraussetzung der T ennisverschiebung i st die starkeAspir ierung der re inen Tennes . Diese s tark aspir ierten Tenues„w erden so geb i l det, daß, w ährend der Luftweg versperrt i s t,die S timmbänder die ganze Ze i t w e it vone inander abstehn (e
Z ur Lautv ersch iebung 27 1
da immerzu Lu ft aus den Lungen getr ieben w ird,sammel t s i ch
Lu ft hinter dem Versch l uß an ; und in dem Augenb l i ck , w o derVersch l uß gel ös t w ird , i st der Luftdruck h in ter dem Versch l uß so
viel s tärker als der äußere,daß e ine starke ,
Explosion‘entsteht
und ein s tarker K rach oder Kna l l gehört w i rd ; a b e r n o c h e i n e nA u g en b l i c k n a c h de r S pr e n gn u ng de s V e r s c h l u s s e s f ä h r tde r L u f t s t r om f o r t a u s z u s t r öm e n , o h n e daß die S t imm
b äu de r e i n a n d e r w e s en t l i c h n ä h e r g e k omm en s i n d a l s
in de r B la s e s t e llu ng (s vgl. J e s pe r s en , Lehrbuch derPhoneti k 2 p. 103. Diese s tark aspir ierten Tenues oder, w ie Jespersensie nennt
, „beblasenen Verschlußlaute “ stehen den Affrikaten nahe
und w ech se ln l ei ch t m it i hnen, w enn der Übergang zu der S te l l ungdes folgenden Lau tes verlangsam t w i rd . Das tri tt im Däni s chenbei der Aussprache der Tenues vor hohen Voka len (i, u) am
m erklichsten zutage.„S o w i rd T ivoli von F remden oft als
tsivoli au fgefaßt. Die Dänen sind s icher auf dem Wege zu e inemähn l i chen Lautübergang w ie die sog. zw ei te Lautversch iebung“
(J e spe r sen a. a. Und ganz entsprechend ist im ir is chenEngl is ch 1 v or pa latalen Voka len ziem l i ch deutl i ch Affrikata,vor andern stark aspir ierte T ennis“
(S i e v e r s , Pau l s Grundriß 2 1 ,
S chw ächer aspir iert s ind die Tenues in der norddeutschenAus3prache und im Engl i schen sow ie die norw egischen und schw e
dischen Tenues im Anlau t vor Voka len . J e spe r s e n nenn t sie
zum Untersch ied von den „b eblasenen“ Verschlußlauten behauchte “
Verschlußlaute .
Die aspir ierte Aussprache der Tenues ist fast der ganzengerman is chen We l t eigen ; in s charfem Gegensatz h ierzu sprechenRomanen w ie S laven reine, nichtaspirier te Tennes .
Daß auch für die Versch iebung der indogerman i schen Tenuesim German i s chen s tarke Aspirierung die Vorausse tzung b i l dete
,
daß die stimmlosen Spiranten des Germani schen n i ch t etw a durchein fache Lockerung des Versch lusses aus den idg. Tenues ents tanden s ind
, läßt s i ch aus folgendem entnehmen : Dort,w o die
Lockerung des Mundverschlusses am nächsten läge,bei den idg.
Med ien , i s t sie n i ch t eingetreten, vie lmehr hat eine Vers tärkungdes Dru ckes stattge funden
,w odurch sie in Tenues gew ande l t
w urden . Den glei chen Entw i ck lungsgang w ie die idg. Tenues
272 W i lhelm S tre itberg, Z ur Lautversch iebung
haben dagegen die a s p i r i e r t e n Medien genommen ; auch sie
s ind zu Spiranten verschoben w orden .
_Wir dürfen h ieraus sch l ießen , daß dort , w o die Vorbed ingungzur V ers ch iebung, die starke Aspiration, feh l t, auch die Ver
s ch iebung unterb le iben m uß.
Nun können w ir aber an der leb enden S prache beobachten,daß die Aspiration zu feh len pflegt
,w enn der T ennis e ine Spirans
(s, f, x) vorausgeht. Nach 8 ers che inen an S te l le der gew öhn
li chen schw ach aspirierten Tenues der norddeuts chen Aussprachesow ie der stark aspir ierten Tenues der däni s chen in der Rege lnichtaspirierte Verschlußlaute, und zw ar s timm lose Medien, vgl .J e spe r s en a . a . 0 . p. 104 2, B r em e r
,Deutsche Phonetik p.
und namen tl i ch S i e ve r s,Phonet ik ° 825 .
Diese lbe S chw ächung des Tenues begegnet uns auch im
Al thochdeutschen,w ie die n i ch t se l tenen S chre ibungen b, d, 9
(statt p, t, k) nach 3, f, lehren . Vgl . h ierüber B ra u n e s Ahd.
Grammatik 5 1 33 Anm . 2, 5 1 46 Anm . 3 und 5 1 63 Anm . 3 — 5
und die dor t angeführte Literatur, besonders Kögel PBB 9 , 31 3 11.Diese Besonderhe it in der Aussprache der Tenues nach
Spiranten ist zw e i fe l los der Grund dafür,daß sie in dieser
S tell ung bei der hochdeu tschen Lautvers chiebung anders behande l tw orden s ind als sonst. Von e iner u rsprüngl ichen Versch iebungund spätern Rückverw andl ung kann vernünft igerw e ise keineRede sein . Wie h ier in a l thochdeutscher Zeit die Versch iebungunterb l ieben i st, w e i l i hre Vorb ed ingung n i cht erfü l l t w ar
,so w ird
sie auch im Dän is chen bei den s—Verb indungen unterble iben, w enndort die Afl°rizierung der Tenues e inst w ei tere F orts chritte macht.
Die Nutzanw endung auf das U rgermanische ergibt s i ch von
selbs t. Wir haben som it ke in Rech t, von einer Vers ch ieb ung und
Rückverwand lung der idg. Tenues nach S piranten zu reden . Das
se lbe gi l t von den idg. Tenues aspiratae, deren Hauch laut nacheiner Spi rans verloren gehn mußte.
274 K . F . Johansson‘nahen’ geh ört ; das geh t s chon da raus herm . n. sov iel als
‘S trah l ’ ist und oflenbar mitZüge l ’ fast iden ti s c h ist. Zur Bed. vgl. an
und ‘S trahl' . Die v on den Leu . au fgehtk an n aus den Texten ziemli ch w illkürlic
jedenfall s aus '
l‘
apona t syünm‘S trahl ' bergel
hat aber zu r Anse tzung e iner Bed.
‘S on
e ine s e inmal i gen '
süna (vgl.‘
l'
sün u‘S on1
könnte s i ch zum S t [vgl. av . gen.
r an t x°3n-r an t got . ann
-na sun -nö usw . ver
zu 's(ä)ye-l
Die unte r 1 . und 2. e ine rse its und 3 :
Bedeu tungen s ind s chw er zu verein igen.
außerdem spärli c h . Unter Be tonung der ac
su ch te n A . K u h n,RZ 3
,433 und A s c o l
m it got darum zu ve rm i tte ln, w as nat ürli chVajas . S amh. Spe c . II. 1 6 7 ; G r a ßm ann ,
suchten Anknüpfung an sfr syü abe r w ie e
entw i ck lung gedach t, i s t n i c h t aus den 11
ersehen. Zu küns tl i c h w är e e ine E ntwicge fertigt, geordnet : s c hön geo rdne t : s chön‘
Eher dann von der sub s tan t i visc hen RedentPo l ste r (s . un te n) : Ruhes tätt e : Ruhe : (undgenehm '
. Letzte res e tw a w ird w oh l H o rner GiPh I. 2, 27 . 43 syönn
'‘w ei c her S i tz '
11
gle i chs tel l t. Daß indessen diese Z usammersa che r i ch tig ist , w ird w e i te r unten erhärü
Um ein adj . s(1)yöna' kommen w ir nie
achtens hat W a c k e r n a g e l , KZ 46 , 266 6 .
gefunden indem er es aus e inem ursprünglic
Wohns tätte b ietend'
av . Im-
yaom Beiw .
S ub s tantiv iert : ‘Ort. der gute Wohnstätte bNur glaube i c h n ich t
,daß h inre i chende
ganges 'm -
yönd in’si-yäna
' gegeben ist : dZ ur Bildung J o h an s s on , BB 18
,32i . ;
Grundr .
’ I I,1 , 503. 687 .
Vgl . O l den b e r g,GN 19 14
,169 fi ,
der d.
mit w ei teren Be ispielen stutz t.
Dre i etymo logische Vermutungen 275
ie p. 27 0 in Anspru ch genommen w erden,s ind m ir n i ch t s t ich
l.ltig; un d sind w e i ter z . B. s u-yzij cu —
yödhana u . dgl . w egenr etymologis chen Durchs i ch tigk ei t intakt geb l ieben, so sehe i chch t ein, w arum dies auch n i ch t für *su -
yöna (*su -
yön i ge l ten so l l ,L es n i ch t undnrchsichtiger i st, um so vie l w en iger als es neben
ch ein ebenso du rch si ch tiges Gegensatzw ort dur -yözzci hat .
I ch g laube,es gab e inen assozia tiven F aktor
,der für die
nderung*su —
yönci zu siyöna' verantw ortl i ch ist. Dieser Faktor ist
1 e inem an dern Wort zu su chen , dessen semasiologische und
mtliche Glei chhe i t eine umb i l dende Einw irkung ausüben konnte.
Das sub stantiv i s che *suyönci konnte s i cher ‘
(gute) Ruhestätte ’
edenten . Wenn es nun aber au ch ein s(z'
)yönci etw a m it der Bed.
3ett’
gab, w ar s i cherl i ch die Mögl ichke it der gegense i tigen E invirkung vorhanden . I ch glaube , es laßt sic h w en igs tens etymo
ogisch erw ei sen , daß es ein so l ches Wort gegeben hat : es ist
forhanden in der an fangs aufgeführten dri tten Bed. Tsyöna‘S ack ’
.
[ ch setze näm l i ch voraus,daß es au ch e ine Bedeu tung ‘Bettsack
,
8ett’ gehab t hat. Die Bettanordnu ng frühe r Ze i ten ebensow ohl
wie heute erforderte s i cherl i ch der Ruhe und Bequemli chke i t ha lberebensol che m it mehr oder w eniger w e i chen S toffen gefü l l te S äck eals Matratze
,Po l s ter
,Kissen u . dgl . Man vgl . z . B. die für die
Beze i chnung ‘Kissen , Pol s ter ’ geme insam e Benennung, die auf e ineWz. bhelg
“
h zurü ckgeht : s. barhz'
s‘Opferstreu
’
(oder eher ‘ein Bü n d e l
von Kusa-Gras ’ p'
o ls t e r artige Unter lage als S i tz der Gö tte r),upabcirhazza
‘Po l ster,Kissen ’
,apr . poba lao, balsz
'
m'
s‘Kissen ’
,serb .
blazina ‘Kissen,Po l ster ’
,s lov. blazz
'
na‘Federbett’
,aisl. bolstr ‘Po l ster,
Kissen ’
,vgl. auch ir . bolg ‘S ack ’
,ga l l . bu lga ‘lederner S a ck ’
. Im
Hinb l i ck auch auf das,w as un ten ü ber die germ . Wörter (für Bett
ste l le) aisl. scéz'ng usw . ausgeführt w erden w ird , zw ei f le i ch n i ch t, daßdie Bed.
‘S ack ’ zur Bed.
‘Po l s ter,Bett’ übergeben konnte und
auch d iesen Übergang tatsachlich gemach t hat. E in g epo l s t e r te sB e t t w ar in früheren Ze i ten w ie jetzt ein Inbegriff von R u h eund W o h l s e i n
,w ar m it andern Worten ein O r t de s W o h l
s e in e, Be h a g e n s . Ich me ine
,die Mögl i chke i t i s t vorhanden,
daß nebene inander ein *su —
yönd‘Ruheort
,-s tätte ’
und s(i)yöna' ‘Ruhe
bett ’ u . dgl. gestan den haben . Eine Umw and lung von*su-
yöna zu
siyöna oder ein Zusammenfa l len der be i den Wörter w ar dadur chnatürl i ch oder fast unausb le ib l i ch .
274 K . F . Johansson
‘nahen ’
gehor t ; das geh t s chon daraus hervor, daß auch T syüm a
m . n . sov iel als ‘S trah l ’ ist und offenbar mit syüman‘Band
,Riemen,
Zügel’ fast i den tis ch ist. Zur Bed. vgl . au ch ras‘mi ‘Band
,Zügel’
und ‘S trah l ’ . Die v on den Lexx . aufgeführte Bedeu tung ‘S onne’
k a n n aus den Texten ziem l i ch w i l lkü r l i c h ersch lossen sein und
jedenfa l l s aus Tsyöna Tsyüna‘S trah l ’ herge le i tet w erden. Vie l lei ch t
hat aber zur Ansetzung e iner Bed.
‘S onne’
das Vorhandense ineines einma l igen *
süna (vgl . 1‘ sunu ‘S onne’
) beigetragen. Dieskönnte s ich zum S t. *8(ä)y6-71 [vgl . av . gen . x
”5ng aus*sy an-s
,a:
”an
van t a:”5n-vanß, got. sun
-na sun-nö usw . verhalten w ie süra‘S onne
’
zu *s(ä)ye-l
Die unter ‚ 1 . und 2. einerse its und 3 . an drerse i ts aufge führtenBedeu tungen s in d schw er zu vere in igen . Äl tere Versu che s indaußerdem spär l i ch . Unter Betonung der adjektivis chen Bedeutungsuch ten A . K u h n
,KZ 3, 433 und A s c o l i , KZ 1 6
,449 syönci
m it got . shauns zu verm i tte ln,w as natürl i ch n i ch t angeht. W eb e r ,
Vajas . S amh . Spec . II, 1 6 7 ; G r aßm a n n , KZ 1 1 , 5 . Wb . 1 6 1 6
suchten Anknüpfun g an sic sya aber w ie sie si ch die Bedeutungsen tw i ck lung gedach t, ist n i cht aus den kurzen Andeutungen zu
ersehen . Zu küns tl i ch w äre eine Entw i ck lung w ie ‘genäht : an
gefertigt,geordnet : s chön geordnet : s chön ’
od. dgl . anzunehmen .
Eher dann von der sub s tan t ivis chen Bedeutung ‘genähtes (w e i ches)Pol s ter (3 . un ten) : Ruhes tätte : Ruhe : (und adjektiv iert) ruh ig, angenehm ’
. Letzteres etwa w ird w oh l H o r n gemein t haben, w enn
er GiPh I, 2, 27 . 4 3 syönd‘w ei cher S i tz’ mit up. yün
‘S atte l decke’
glei chstel l t . Daß indessen diese Zusammens te l l ung in der Hauptsache r i chtig ist, w ird w e i ter un ten erhärte t w erden .
Um ein adj . s(i)yönai kommen w ir n i cht herum . Me ines Erachtens hat W a c k e r n age l , KZ 46 , 266 ff. die ri chtige Etymologiegefunden indem er es aus e inem ursprüngl ichen *
su -
yöna‘e ine gute
Wohns tätte b ieten d’
av . hu -
yaona Beiw . der F rav aéis, herlei tet.S ubs tan tiviert : ‘Ort, der gute Wohnstätte b ietet, gute Wohnstätte’
.
Nur glaube i ch n i ch t,daß h inre i chen de Begründung des Über
ganges *su -yönci in
*si—yönci gegeb en ist : die lautl ichen Para l le len,
Z ur Bildung J o h an s s on , BB 18,32f. ; Br u gm an n , IF 18
,423 f.
Grundr .
” H,1,503
,687 .
2) ‚Vgl . O l den b e r g , GN 1 9 14 , 1 69 fi . ,
der den Gedanken Wackernagels
mit wei teren Be ispielen stutz t.
27 6 K . F . Johansson
Es heiß t RV. IV, 5 1 , 1 1r ayz
'
m divö dubitd rö vib/zät'
z‘
lz
pr ajävantam yachäsm ä'
su dévilz
syönä'
d ä'
valz pratz'
btidlzyamänäh
süvi’
zyasya pcitayalz syäm a
‘Re i chtum mit Kin dern, 0 Töchter des Himmels, o Gö ttinnen
,
gewähr et un s bei eur em Aufleuchten , indem Ihr von e u r emR u h e l a g e r erw achet ! Wir m ögen Herren se in v on Heldenkraft !
’
Oder , mit praü'
büdhyam änäh zum S ubjekt in sgam a s tatt zu devik,‘indem wir euch zuliebe von u n s e r em R u h e l a g e r ’) aufw achen ’
.
Man m ag die eine oder andere grammati sche Beziehung annehmen,so paßt ke ine andere Bedeu tung v on syöna
'
besser als etw a ‘an
genehmes,behagl iches Ruhe lager ’ , d . h .
*3u-
yönci und
s ind in e ins zusammengeflossen .
Eine S te l le w ie RV. VI, 1 6, 42
c7'
j äta'
m j äta'
v édasi
pm'
ya'
m éiéi tätithim
syöna'
ä’
gg*ha
'
pa tim
‘Den neugeborenen l ieben Gast fachet an b eim Jätav édas am
s chönen S itz des Hausherrn ’
(vgl . O l d en b e r g , ZDMG 55,31 6.
Rgveda. T extkr . u . exeg. Not . I , 37 7) könnte freili ch e ine Einsetzungvon
*suyöna empfeh len ; aber man w ir d gestehen, daß ein s(z
'
)yöna‘Ruhelager , -bett ’ w enigstens m ö g l i c h w äre.
Von so l chen S te l len aus w ie die genannten ist e ine Verm ischungv on zw e i bedeutungsähn l i chen sub s tant i vischen Wörtern w ie
*eu -
yöndo und s(z
'
)yönci verständl i ch ; und zw ar dürfte i ch ver
m uten , daß ur sprüngl i ch an der ers ten S telle und an etw aigendami t verwandten S te l len ein sz
'
yönci stand. Von da dranges in S tellen w ie die zw e ite ein. Die S chre ibung w uchertew ei ter und erfaßte auch das adjek tiv.
*su-yönd
Das in der vorigen Auseinandersetzung vorausgesetzte s(i)yönd‘Bett ’ ist meines Erachtens m it dem tatsächli ch bezeugten T 8yöna‘S ack ’ i dentis ch . Es gib t h ier ke inen An laß
,an den Angaben der
Leu . zu zw eifeln ; es ist außerdem b estätigt dur ch 1‘ 5‘yüna ‘S ack ’
1) H i l l eb r an d t , Vedachr . 127 ahnl ich B igv . ubers. p. 4 möchte
e in syönd‘Gun s t’ (‘infolge eurer Gunst w iedererw eckt ’) ansetzen , w as mir
n icht einleuchtet .
Dre i etymo logische Vermutungen 27 7
sow ie durch T syöta und '
i‘
fsyüta dass . Die Formen + syüua und
T syüta sind j a offenbar pp. zu sin syn a l so para l le le Bi l dungenzu T eyöna und ‘
j'
83/öla die fre i l ich auch a l te pp. se in können,aber als i sol ierte S ub st. aus dem Rahmen der pp. herausfa l len ;ers t sekundär traten dazu T syüna + syntu als S ub stantiva. E in
Vorhandensein von‘
j'
8yöna w i rd ana logisch ges tützt v on J
r s_yötä
das außer durch die ind. Lexx . bezeugt is t durch die etymologischeZusammenste l l ung m it aisl. sj a
'
dr ‘S aek , Beute l ', ags. séod ‘Beute l ’,
mbd. ez'
uz (neben si d)‘Naht ’ (F i c k 8 III
,325 . III
,Zu dem
angeführten stimm t nun auch ap. yün‘S atte l decke ’
aus ap.
*hyauna
Bezügl i ch des Bedeutungsw echse l s ‘S ack Pol s ter) : Bett ’i s t au ch zu vergle i chen das zur se lben Wur ze l gehörige
2. S anskr . T sévaka
E in T sévaka m .
‘S ack’
ist nur in Lexx . bezeugt : B . an. 3, 1 1 0.
Med. k . 1 70 . Verm utl i ch gehö rt dazu der Pflanzennam e + sévakäluniéäblzafigä, dugdha
-
pucchi , vgl . T sevi n . und T sém'
ta n .
‘Brustbeere ’
Räj an. im Sam e.
Die Etymologie zu siv i s t durch si chtig,und es gib t
keinen An laß,an der Richtigke i t der Angabe der Lexa . zu zw e ife ln .
Es fäl l t auf,daß man
,sovie l i ch w eiß
,dam i t noch n i ch t das
nordi s che Wort fü r Bett : aisl. seeiug s(eing f. ‘Bett,Wochenb ett ’ ,
aschw . adan. «eng, aschw . siang, siceng, adän . siang, alt. dän. siceng,
nschw ed. sang, dän .—norw .
sang zusammenges te l l t hat, obw oh l F a l kund T o rp, Norw .
-dän . et . Wb . 959 . 1 539 den ri ch tigen etymo
logi schen Zusammenhang m it der idg. Wz.
*saje-u
‘nähen ’
ver
mu tet hat. Daß das nord . Wort e ine ursprüngl iche Bedeu tung‘S ack ’ gehab t hat
,dafür hat man e inen Fingerze ig in dem ags.
swea°
ny‘
Bett ’
,urspr . w oh l ‘Bettsack ; m it Heu oder anderem Materia l
gestopfter S ack , der als Matratze d ien t’,das ofienbar eine Kom
pr0mißbildung ist v on same und e inem ev . aus dem Nord is chen
1) Z ur Bed.
‘Satteldecke’vgl. lit . bainas
‘Sa tte l ’ : l. follis ‘Sack’
(aus*bhol-m i neben balgn as, apr . balgnan v on e in er E rwei terung mit 3(h) vonderselben Wurze l , vgl. auch zum parallelen bhd -äh i r . bolg ‘S ack
’
,
gall . bulga‘Ledersack ’
, got . balgs‘S chlauch ’
usw .
An Zusammenhang m it päl seväla ‘th e aquat ic plant Val l isneria’ istkaum zu denken . Dann jedenfal ls präkritisch aus sanskr . éeväla éaiväla
278 K . F . Johan sson
en tlehn ten *scéz
'
ng; d . h . sow oh l scéz'ng w ie saece konnten die
spezie l le Bedeutung ‘Bettsack ’ hab en,w ofür noch ein Zeugn is
vorl iegt im engl. sackz'
ng‘S ackleinw and für Bettböden ’
; e ine Erinnerung vom sackart igen Charakter des nordi s chen Wor tes dürftenoch der Bed.
‘Federbett’ °
für nnorw . seng, nis]. soeng anha ften.
E in andres ags. Wort auch dem nord . en tlehn t ist song
(north) ‘Bett ’ . Dies setzt ein nord. *säng voraus , w as w oh l aus
*saz
'
w ang (s. un ten) zu deuten ist. Dem Nord. ist auch das i r.sceang, soeng ‚
Bett S chlafz immer ’ ent lehn t, v on da als Imjpaomg
(gl .) ins Ags . e ingedrungen . Wie au ch die nordis che Flexionals Konsonant—S t. zu erk lären ist, s icher hat man v on e inemgerm .
*saiw an5 und m it S uffixaustansch auch *
saz'
wz'
n3 (vgl .N o r e e n , U rgerm. Laut]. 48) A us saiwän5 en ts tandun ter Bedingun gen, die h ier n i ch t zu erör tern s in d
,nord .
*säng,
das im Ags . (north ) als so ng sub sti tuiert ist ; aus *saz
'
wz'
n5 dagegensäaing und aus einer Kompromißform *
sä ang en tstand siang (resp.
siceng)2
).Als idg. Grundform i st anzusetzen : *
saiy eng(o)Ab le itung m it -
g(o)-S uffix v on einem -n -S t . *saz
'
y -(Qn
w ie z . B. s . udaka zu uda’
n usw . E in dam i t w echse lndes *smc—(c)n
ist vorhanden im themati s chen T syöna (s . oben). Zugrunde l iegtein Wz.
-Nom en *saz
'
y - z*s_iey (
*sazen zur Wz. s . sic syü (sfvyati :
syü sya-té
, _
infigiert si-n-ö-ü
' komb in iert *sa_ie von
*say (e)
‘nähen ; b inden ’
, d . h . ein EineErw eiterung m it - t(o)-S uff. ergab *
egleu-to s . ‘
j'
8yöta (s. oben).S o l l te w irkli ch H u l tm a n recht behalten mit se iner Annahm e
(Halsingelagen I , daß die nord is che Flexion (als Konsonantstamm)Pl . säeingr ur sprüngl ich ist , so hätte man ein w e iteres Bei spiel des
1) Über die Behandlung v on -aiw in v erschiedenen S tellungen gibt es
e ine ganze Literatur , w ov on ich h ier nur die spätere, w o die v orl iegende S ippe erw ähnt w ird, anfüb re : N o r een , A sehw ed. Gr. 88 ; K o ck , A £ nF 1 7
,364 (vgl.
20,255 v . F r i e s en ,
K . Human . vetenskapssamfundets skrift er VII,2,
49 (vgl. IX ,6 , H E ) ; H u l tm an
,Halsingelagen I , 72. 103 (vgl. Aa 1 7
,
P ipp i n g , Neuphilol. Mi tte i lungen 1 904 , N. 7 — 8, p. 18 f. (vgl. Gram
mat . studierVon den b isher v ersuchten E tymologien z . B. J e s s e n ,
Dansketym . ordb . 204, w ozu w ei ter die untere inander zum Te il v erwandten v on
P ipp i n g , Neuph ilol. Mi ttei lungen 1 904 N . 7 — 8,18 f. und H u l tm a n
,
Hälsingelagen I , 72 (nur als uns ichere Mögl ichke it) h inzukomm en be
friedi gt keine.
Kleine Bemerkungen zum Physiologus.Von
J ar l Ch arpentier (Upsa la).
Auf p. 6 1 6 . se ines ausgeze i chneten Buches „Indien und das
Chr istentum “ hat G a r b e dankensw erterw ei se die b i sher festst ehenden Entlehnungen des äl testen Phys iologus aus ind ischenQuel len zusamm engeste l l t. Dazu habe i c h ZDMG 69
, p. 44 2
auf e ine s chon v on L au c h e r t , Ges chi ch te des Physiologus p. 35 f.
angeführte Paral le le, die si c h n i ch t bei G a rb e findet,h ingew iesen.
E s kommen demnach folgende S te l len des griech is chen Phys iologusin Betrach t :
I. zgiz1; (pv'
0 t g zoö Äéovzog. ozav ).e’
aw a zbv oxv'
yvov yevvg'
z,
vexgbv aözbv yevva‘
db Macr o: äm zngel zb ze'
xvov,é'
wg 05 ön a zi;g adzo-
Ü él&w v zy'
; zgc’
zy; fi,u égg éy <pvmjoy ég zb n göawzrov
aßzoü za l äyeigyy aßzo'
v . G r ün w ede l ‘) füh rt d iese Ges ch ichteauf das Epi thet des Buddha simhanäda (stha
°) „der mit Löw enbrüll
rufende,der kühn sprechende “ 2
) zur ück, w as m i ch n i cht überzeugtzur Erk lärung genügt me ines Erach tens vö ll ig
,w as L a u c h e r t
a. a. 0 . p. 6 aus Aristote les angeführt hat.III . ä
'
ozz‘
n ezezvbv l eyo'
y evov xagadgw'
g, chg év u pJ ev zegovoy c'
qr
ye'
ygouzzaz. ö v ol o’
yog é'
l e£ e n egi aözoü,ö'
n öl öl evxo'
g éou ,
m) €w m;dey ia v y el avia v*
za l zb: drpoöev’
yaza aßzoö S egan eüa.
z obg äyßl vwzzoüvzag Ötpß a ly oüg. za l €v za l ; eröl a lg zcb v ßa ozl éw vedgioxezac. xo u
‘
. ädv z tg voafi, ég aßzoü yw ußo*zov ozv ij äyro&vfioxaij öyza ivec ö vooob v . mégovow azizbv zoö voooüvzog év
zfi xl ivy°
zal 3°s 75 vo'
oog zoö o’
zv&gcbrrov 7rgbg &dvazov , o’
wzo
ozgé<pez zb 7zgo'
ow n ov aözoü o’
m:b zoü vooo-üvzog ö xagadqco
'
g, m i
1) ZDMG 52
, p. 460 A . 5 ; Myth. d. Buddhismus p. 128 ; 209 A . 84 .
2) Vgl. F r ank e , Dighanikäya p. 131 .
Vgl. G a r b e a. a. 0 . p. 62f.
K le ine Bemerkungen zum Physio logu s 281
ym bouo vaw n dvr eg ou än oö v :j<mu . m v die M oog zm‘
v &v09a3
7rov a gb; e v &zevc'
fer“
Ö xagaögzbg z(7; voooöv u,za l Ö vomDv
f (ö zagaöpuß‚za l. zar am
'
vec xagaöpzbg z r) v r o'
oov zoü ÖPÜQLÖ
n au za l owogm gu a ör r,
'
v,
za l 13)/t a i rai. ö vomb v . S chon
lange hat man d ies Kapi te l m it der indis chen Vorste l l ung überden Voge l häridrava als Hei ler der Ge lbsuch t (RV. 1
,50
,1 2
AV. I , 22, die Übereinstimmung geh tso w ei t, daß man in Indien den Voge l aus Lager des Kranken
w ährend der Phys io logus sagt : (pégovow a özbv äiwrgooäev
1 0 5 voooövzog iv zfi xl lv;r; . Es l iegt som i t w ahrsche in l i ch sogard irekte l iterarische Entlehnung vor . Was die Wörter : za l. év
ze ig cr z röv p’a ozl éw v edgc
'
oxezca b etri fft,so w ei ß i ch darüber
n i ch ts Bestimmes zu sagen ; doch verglei che man, w as Käut. p. 40 f.über das Ha l ten gew i sser Vöge l
,die Feuer
,S ch langen
,Gift usw .
abw ehren,im Pa las te des Königs erw ähnt.
XXII . Was der Phys io logus uber das Einhornberi chtet
,w ur de von F . W . K . M ü l l e r , F estschr. Bas tian p. 53 1 ff.
und L üde r s,GN 1 897 , p. l l 5 i. ; 1 90 1 , 53 A . 2 ein leu chtender
w eise m it der bekann ten Ges ch i chte d es Réyaérfiga zusammenauch hier ist die Übereins timmung (za l a
’
c'
gu aßzb [ f)n äg&evog] eig zb n a l otzw v zq
'
5 e ine so detai l l ierte,daß
w ohl an Entlehnung auf l i teraris chem Wege gedacht w erden muß.
XLIII. Die Gesch ichte vom Elefanten w ir d von L a u f e r,
T‘
oung Pao XIV, p. 361 f. durch Verglei chung mit dem
,w as in
einer ch ines ischen Que l le v om Nashorn erzäh l t w i rd,als indis ch
Der latein ische Text gi bt folgendes zur E rfül lung der Lücke : et
vola t in aära con tra solem , et conzbw it infirm ita tem eine, et dispergit cam .
Auch andere V ögel werden genannt, wie Papageien usw .
Vgl. A . K u h n,KZ XI I I , p. l l 3ff.,
1 55f. ; S on n e, KZ XIV , p. 321 fi . ,
433fi . 462; E . K u h n bei v . d. B e r g h v . E y s in ga , Ind. E inflüsse “p. 1 18
A . 1 . Ob der Name xagaö‘
gzde nach E . K u h n s geistreicher Vermutungeinfach aus häridrava entlehnt ist
,ist mir n icht v ö l l i g klar. Jedenfal ls
l iegt Umgesta l tung nach xagciö‘ga v or .
Vgl. Käu. Sü. Z imm e r,A i. Leben p. 92 ; B l o om f i e l d
SBE XLI I, p. 264 , 266 ; J o l l y , Mediz in p. 87 ; M ac d on e l l & K e i t h , Vedic
Index II , p. 502.
Vgl. auch Verf . , IF XXIX , p. 400 ff.
Man beachte speziel l, daß es u p flam l et hei ßt, nicht 1 0 5 ßa m l éw sRsyasrnga w ird ja direkt dem Könige zugeführt.
282 Jarl Charpent ier
erw iesen ; durch G a r b e a. a. 0 . p. 66 erfahren w ir,daß d iese
Ges chi ch te sogar zu Cäsars Ze i t in Europa e ingebürgert w ar .
Le ider l äß t s ic h aber e ine indi sche Que l le me ines Wissens n i ch tnachw e isen .
XLIV. m b ; dä yevvazo u ö y agyagt'
zng, a xovaov. eozz xo'
yxog
év zfi &a l ctaoyy Äsyo'
,u evog oozgeog
' är égxezaz db éx _
zfig 3 a ).doov;gza l ; ögßgw ozig c
‘
ögaog'
za l &voz’
yez ö xo'
yxog zb ozo'
yoz aßzoü xo u‘
.
xaza7u'
ver. zr)v oögdw ov ögöoov, xa b z i2v &xziva zoü na i zfigoelnjw ;g za l zcöv c
’
r'
0zn eig zäg 7 t zzixag än oxl eioa oa , 3:x zä w a vw
mw azwjn éyxvyovei zbv yagyagz'
zm. 5 db xo’
yxog ä'
xec n ze'
gvyag
du'
o 37r ov eögioxezc u ö Daß d iese bei den Al tengeläufige Vorste l l ung von der Ents tehung der Perle auf indi scherGrundlage beruh t 2), i st s chon von L a u c h e r t a. a. 0 . p. 35 f. dar
ge legt w orden ; vgl. auch L üde r s,KZ XLII
, p. 1 93 6 . Üb r igenss che int derse lbe Aberglaube noch immer unter den Perlfischern
in S üdind ien lebendig zu sein,w ar es jeden fa l l s v or etw a
hunder t Jahren,vgl . L e B e c k , Asiati c Researches II, p. 1 080 11.
Wenn w ir nun a l so die oben erw ähnte Ges ch i chte von dem
Low en ausscha l ten , die me ines Erachtens n i ch t h ierher gehört, sohaben w ir doch n i cht w en iger als vier Erzäh l ungen des Phys io logus ,die offenbar aus indis chen Que l len stammen . Z u beach ten s ind,w ie i ch glaube, besonders derartige Klein igke i ten , die auf un
m itte lbaren li terarischen Einflüssen zu beruhen s che inen,w ie sie
s ich w oh l b eim xagadgw'
g und Einhorn finden. Denn es w i rddadurch w ahrschein l i ch gemach t
,daß die Vorlage des Phys iologus
jeden fa l l s m i tte lbare Kenntn i s indis cher l iterar is cher Que l lenw oh l buddh ist is cher Erzäh l ungen und Zauberbücher hatte.
Nun w ird s i ch w oh l,w ie i ch im fol genden aufzuzeigen versu che,
innerha lb des Werkes noch mehr derartiges finden.
S ehr sonderbar m utet es uns an,w enn der Phys iologus
Hier l ieg t offenbar e ine Verw echslung der Perlmuschel mit derNau tilusschnecke v or .
Man leitet bekanntl ich und w oh l m it Recht gr. pa'
gyagov ,
pagyagi5‘
, p agyagi‘
t ns aus ai. manj ar t ab ; w enn aber dabe i dieses Wort inder Bedeutung „Perle“ dafur in Anspruch genommen w ird, so ist dies n ichtganz sicher. Denn m afijari „
Perle“ ist ein spätes , lexikal isches Wort ; früherkommt aber maäjart in der Bedeutung „
Perlenschuur “
(maM-mafij aräkir azca
°) v or.
284 Jsrl Charpen tier
zu ziehen,daß die Kobras zu aller Zeit in Indien besonders in
den Wohnhäusern eine Landesplage gew esen sind, und daß man
a l so dort w irk l i ch e ine derartige Beobachtung gemach t zu habenglauben könn te, w as in Griechen land kaum der Fa l l sein dürfte.
Daß die an tiken S chr iftste l ler a l so h ier aus ind ischen Que l lenges chöpf t haben , sche in t mir n i cht zw eife l ha ft .
Höchst sonderbar ist nun auch die Gesch i chte v om Achat(XLIV) : 3zozv oi z exvlza t q cöcn zbv
,u agyagiznv , ÖLÖ zoü äxoizov
aßzbv edgéoxovoc‘
öeo,u eüov cn 7629 ezr
i
s on agzz'
zp ozeqeq'
i za l
xal cöow aözbv eig z i;v .9dl aooav . egxeza r. mir 5 äxoizng. érri zbv
pagyozgizqv m i. oz :jxez 5e za l 0 15
odl ezieza c ’
m i eöö e‘wg vooü<n v
of. vaöza c zbv zo'
7m v zoü dxofzov , za l äzol o&oövzeg zq'
i on agziry
edgioxov rn zbv . yagyorgiznv . Nach L a u c h e r t a . a . 0 . p. 36 istdiese Gesch ichte bei ke inem klassi s chem Au tor zu finden ; dabeiglaube i ch ab er für Lucan Phars . VI
,6 7 7 f. eine Ausnahme m achen
zu m üssen ; h ier lesen w ir
innataque m bm'
s
(equorz'
bus custos pretiosc€ ce'
per a concha9
Nun w ird man frei l i ch e inw enden,die von Lucan erw ähnte
ce'
pera könne unmögl i ch mit dem dxdzqg iden tisch sein ; i ch glaubeab er
,daß man die be i den S te l len w egen der Ähn l i chke i t der Ge
danken unmögl ich voneinander trennen kann ; au ch s chein t es
mir w en ig k lar, w as im Phys iologus un ter dem Namen äxé zrjg
zu verstehen i st ob der Achat oder irgend ein Tier Vie l le i chtfestgehal ten hat . Daß man jedenfal ls durch E ssen v on Pfauenfleisch be
sondere W irkungen zu erz ie len g laub te, zeigt z . B. Jataka II, 33ff. (vgl.J oh a n s son , S olfägeln i Indien [Upsa la p.
H a sk i n s , Lucan i Pharsa l ia p. 220 w eiß diese Geschichte aus keineranderen Quel le zu belegen. Die vipera , die bei Lucan die Perlen bewacht,hat offenbar n ichts m it dem A chat oder mit indischer Tradi tion zu
_t un .
E s liegt h ier w ahrschein l ich , w ie ich nachträg l ich sehe, ägypt ische Ub erl ieferung vor : in dem S eelenhymnus der T homasakten heißt es nämlich an
eine S tel le : „wenn du nach A gypten h inabstei gt und die eine Perle bringst,die im Meere ist in der Umgebung der schnaubenden S chlange“
(v r . 12— 13,
vgl. w e iter vv . 21 . s. darüber R e i tz en s t e in , Hel len ist. Wundererzahlungeu (Leipzig p. 107 ff. Z ur Datierung dieser Texte trägt bei,daß in v . 7 das Kükanreich erwähn t w i rd offenbar das indische Reichder Kusana.
Man beachte auch , daß es in S auskfi fq uellen eine Ar t S chlangengib t
,die sahkhapäla (p. samkhapäla Jat .) heißen . Ob dieser Name irgend
w as mit . dem custos pretz'
osce vipera con chce zu t un hat ?
K le ine Bemerkungen zum Phys io logus 285
w ar d ies dem Verfasse r se l bst n icht so besonders k lar. Wenn
w ir nun w e iter bedenken, daß der Per lenfang von jeher im
Pers ischen Meerbusen und im Indis chen Ozean (r ubris (Bgu0n'
bus)
he im isch gew esen ist und som i t den antiken Völkern von der
Fangart nur ziem l i ch dunk le Nachr i ch ten zu Gebo te so
gew innt me ines Erachtens die Vermutung von L a u c h e r t größerenAn spruch auf Glaubw ü rd igke i t
,daß w ir es h ier mit e iner Ver
drehung v on der Gesch ichte des Megasthenes bei A rriau Ind. 8 ;
Plin . n . h . IX,55 zu tun haben. Bei A rr iau ?) heiß t es näm l i ch
za l Myec Meyao .9 émg 3 qgev'
eof) az r f,w xöyxr,w crözoü örzzv
'
ocw,
véy eo .9 ac d’
51! z;f; 3 a ). oéocrn zaz’
aözb n ol l äg z o'
yxag, za&ofm sg z c‘
zg
y el laoorg'
za l eiva c ; fbg zal zoioc_u agyagizycu p
’a ozitéa ij ßa oilw oav ,
(og z;r°
;oz ,u eh ooly;oe. z a l b'
ou g ,uev €zelmv zaz
’
€n: tzzrxi-
nr o*
ul l éßoz,zoüzov db eön ez éwg n egcßdl l ew z a l zb ä).l o o
_u fivog z rb v yagya
gtzu’
m, ei db ötmpüy0 t orpag ö ßa ozÄe-üg, zov
'
zrp db o-öze
'
zz &qgazoigg
43v z obg äl l ovg l . Daß der sons t so gew issenhafteMegasthenesd ies a l les auf eigene Faus t zusammengefabelt hätte, i st absol u tni ch t anzunehmen ; er muß es w oh l unbed ingt v on se inen indischenGew ährsmännern erfahren haben, und som i t können w ir w oh ld iese Ges chi ch te als in disch betrach ten , w enn sie auch b i sherin e inhe im i sc hen Que l len n icht gefunden w orden i st.
U rsprüngl ich hat a l so meines Erachtens die Ges ch i chte so
gelautet, w ie sie bei Megasthenes (Arriam) steht : unter den Perlmuscheln gäbe es ebenso w ie u nter den Bienen e inen Kön ig(oder e ine Königin) , der s ich irgendw ie etw a durch seineGröße vor den andern ausze i chnete ; w enn es den Fischernge lang
,se in er hab haft zu w erden
,so konnten sie le i cht den ganzen
S chw arm Daraus hat si ch w oh l nun w eiter die1) Die beste Nachricht findet sich w ohl in e inem F ragment des Isidorus
v on Cherex bei A then . I I I , p. 93 d. E s hande l t s ich dort um die Per lfischerei im Persischeu Meerbusen.
Vgl. S c hw an b e ck,Megasthenis Indiea p. 149 f.
E ine gew isse E rk lärung b iete t s ich für diese sonderbare Gesch ichtev iel leicht dadur ch , daß im al lgeme inen die größ ten, m it A lgen und Seet ierenbewachsenen Muscheln die schönsten Perlen enthal ten und man som i t m iteiner gew issen S icherhe i t diese sofort ausfindi g machen kann , Gute Auskunftüber Perlfang und Perlfi scher bei L e B e ck , „
Au account on the pearl fisheryin th e gulph of Manar in March and Apri l A siat ic Researches I I ,p. 1070 ff. (Suppl . v ols . to th e Works of S ir W . Jones I I
,London
286 Jarl Charpentier
phantast is che Erzählung von der vc'
pera, die die Musche ln bew ach t,b ei Lucan und von dem Achat
,der die Per len auffindig mach t,
Phys iologus entw i cke l t . Es ist aber auch zu b each ten,daß
der letztgenann te Autor sagt : decy eöovoz ocözbv (so. zbv äxdznv)on agz icy ozegeg; za l xa l ä ww aßzbv eig z 1)v &dl azzozv. Dabe is che in t mir näm lich auc h in Betrach t zu kommen
,w as über das
Verw enden v on S enksteinen von sei ten der Perlfischer beri ch tetw ird ; L e B e c k , a. a. 0 . p. 1 075 f. sagt näm l i ch : T he diving stonei s a piece of coarse grauite, a foot long
,six inches th i ck
,and
of a pyram i d i ca l shape, rounded at the top and bottom . A largehair repe ‘
) is put through a ho le in the top. S ome of the d iversuse another shape of stone shaped l i ke a ha l f moon
,to lind round
thei r bel ly, so that thei r feet m ay be free. At present these are
art i c les of trade at Condutchey . T he m ost common,or pyram i d i ca l
stone genera l ly w eighs abou t th ir ty lbs.
“ Es kann ja sehr w oh ldie Nachri ch t von dem Geb rauch derart iger S enksteine dahinm i ßverstanden w erden se in
,daß m an durch Ausw erfen des S te ins
beab si ch tigte,die Behausung der Peflmuscheln ausfindig zu ma chen .
Daß jeden fa l l s die Ges ch i ch te v om Achat im Phys iologus ebensow ie die v on der Per le letzten Endes auf indis cher Grundlage beruh t, darüber hege i ch n i ch t den geringsten Zw e i fe l .
Versch iedene se iner Wundererzäh l ungen ver legt der Phys iologue se lb st nach Ind ien
,dem Märchenlande xozz
’
égoxn’
v . S o heißtes vom Voge l Phön ix (VI I) : .
’
s'
0 z t zoir v v mszew bv tv zfi°
Ivdzxfi,
(pam ; l eyo'
y e'
vov ; inw iew ei t dies w irk l i ch auf irgendw e l che Bez iehungen der Phonixsage zu Indien h inw e is t
,w ird h ier besser
beise i te ge lassen 2) . We i ter vom Ge ier (XIX) : é’
c‘
zv edv .
’
s'
yxv og
yévnzozz, n ogev'
eza c év°
Ivdz'
g z a l Äozyßdvet zbv edzöz tov Äi3 0 v .
5 db Äi&og 39'
xec za zc‘
z zb xdgv ov zi;v n egamégeaozv . som3 élyg adzbv
zw fioa z, c’
z'
l l'
log l iäog evdo&ev aözoö oal eöezo a za l agov'
w v m i
äc‘
rv db cbdiv ovoa aözbv Äo?ßy, zd3 r,zozt ärzd aözoö za l
än o’
vwg yevvg. Diese lbe Ges ch i chte begegnet auch bei Plin . n . h .
X , 3, 1 2 ; XXXVI, 21, 1 5 1
,w o es s i ch aber um zw e i S te ine
1) Vgl. das 0 7ragz io v az egeöv des Physiologus.A us L au c h e r t a . a . 0 . p.
l ofi . ist dafür n ichts zu ho len ; doch we istdie S age w ahrsche inl ich starke Bez iehungen zu indogermanischen , bzw . in
dischen Myt hen auf, vgl. H am m ar s t edt , Meddelanden frän Nord.Museet 1 901 ,
p. 202fi . ; J oh an s s on , S olfägeln p. 72.
286 Jarl Charpentier
phan tast ische Erzäh l ung v on der vipera, die die Musche ln bew ach t,bei Lucan u nd v on dem Achat
, der die Per len anifindig mach t,
im Phys io logus entw i cke l t . Es i st ab er auch zu b each ten,daß
der letztgenannte Autor sagt : deoy ev'
ov cn aözbv (sc . z bv äxciznv}0 7t agzicp 0 zsgegö za l xa l cb ow aözbv eig z ip» 3 äl a zza v Dabe is chein t mir nämli c h auch in Betrach t zu kommen , w as uber dasVerw enden von S enksteinen v on sei ten der Perlfischer beri ch tetw ird ; L e Be c k , a. a. 0 . p. 1 075 f. sagt näm l i ch : „
T he diving stonei s a piece of coarse gran i te, a foot long, s ix inches thi ck , and
of a pyram i di ca l shape, rounded at the top and bo ttom . A largehair rope
‘) is put through a ho le in the top. S ome of the di vers
use another shape of s tone shaped l i ke a ha l f moon, to lin d roundthei r be l ly, so that the i r feet may be free. At present these ar e
art i c les of tr ade at Condutchey . T he m os t common, or pyram i di cals tone genera l ly w e ighs abou t th irty lbs.
“ Es kann j a sehr w oh ldie Nachri ch t v on dem Geb rauch derart iger S enksteine dahinm i ßverstanden w orden sein
,daß man du rch Ausw erfen des S te ins
beab s i ch tigte,die Behausung der Perlmuscheln ausfindig zu m achen.
Daß jeden fa l l s die Ges ch i chte vom Achat im Phys iologus ebensow ie die v on der Per le letzten Endes auf indischer Grund lage beruht, darüb er hege i ch n ich t den geringsten Zw e ife l .
Vers ch iedene seiner Wundererzäh l ungen verlegt der Phys iologus se lb st nach Ind ien , dem Märchenlande xaz
’
é£ o;pjv . S o he iß tes vom Voge l Phönix (VII) : 3
'
0z t z oz'
vv v 7zez €zvbv iv zfi Yvdzxfi,
cpolw ä Äeyö‚u évov inw iew e i t d ies w irk l i ch auf irgendw e l che Be
z iehungen der Phönixsage zu Indien hinw e is t,w ir d hier besser
be ise ite ge lassen 2) . We i ter vom Geier (XIX ) : id: » 0 131» .
’
s'
yxv og
yévnzc u, n ogeziezm iv°
Ivöiq z a l Äayßoivu zbv sözöxw v l i3 0 v .
6 db M&og fe'
xez xazbc z b xoégv ov z-i‘
3v n egzme'
gsaa v . äo‘
w (1 5s
zw fioo a, äl l og l iä og ä'
vdo3 ev aözoö aa l eziczaz xa i xgov'
w v m i
7°
;xäna ca r dä cbdc'
vovoa aözbv läßn, xd3*r,za z in
"d a özoü xa i
&n o'
vw g ysvvq . Diese lbe Ges ch i chte begegnet auch bei Plin . n . h .
X, 3, 1 2 ; XXXVI, 21 , 1 5 1 , w o es s i ch aber um zw e i S teine
1) Vgl. das a n agz io u azsgeöv des Physiologu s.A us L au c h e r t a . a . 0 . p. 1 0fi . ist dafiir n ichts zu holen ; doch w e ist
die S age w ahrscheinl ich starke Bez iehungen zu in dogermanischen , bzw . in
dischen Mythen auf, vgl. H a rnm ar s t edt , Meddelanden frau Nord.Museet 1 901 ,
p. 202ff. ; J oh an s so n , S olfägeln p.72.
K le ine Bemerkungen zum Physio logus 287
ve rsch iedenen Gesch lechts hande l t, die man andersw o im Physiologas (XXXVII) als
„lapi des igni fer i “ w ieder Diese Ge
s ch ichte hiingt m it dem Vo l ksglaub en v on dem Voge l m it demw underbaren S te in zusammen, vgl . Ham m a r s t e dt
,Meddelanden
irän Nord . Museet 1 90 1, p. 1 66 112 In Indien findet s i ch auch der
Wunderbaum n egzds'
5w v (XXXIV), der von den S ch langen so ge
ttirchtet w i rd,daß sie sogar se inen S chatten fl iehen . Nach L a u ch e r t
a . a. 0 . p. 29 s timm t d ies genau m it dem übere in,w as Plin. n. h . XVI ,
1 3, 64 v on der Esche (fram '
nas) zu ber i chten w eiß ; einen ähn
l i c hen Glauben hegen die Leute z. B. in S chw eden von dem
Wachol der (Jun iperus) usw . Aus Ind ien w eiß i ch ab er le ider ke inePara l le le vorzub ringen, und es i s t w oh l am ehes ten zu vermuten,daß der Phys iologus den Baum nur desw egen dahin gesetzt hat
,
w ei l man dor t a l ler le i Wunderdinge zu finden Was
s ch l ieß l i ch den ‚ indischen S tein “
(XLVI ) betri ff t, von dem der
Phys io logus sagt : Ts'ou M.? og ivöm bg xaÄov'
pevog, z oca v'
zqv die rpv’
aw
is'
e äc‘
zv äfvö gum og ddgco7t cxbg zvyxdvy di v,0 ? z sxw
'
zac iazgoi
a oöoc zbv Äi3 0 v zoözov,
za l dsoy eüovow ozözbv zgö Ödgw ru xq'
i
digag zgelg°
za l b'
l a zb oan gä zoü ödgco7u xoö xaza 7zlv& ö Äi3 og.
efza ).v'
ovoz zbv Äz’
0 0 v za ). oza&„u lé
'
ov ow orözbv pezbz zoü är&gu’
n zov
eig zb 0 za3 y iov‘
za l ö mxgbg Mö og 2'
Äxu zb o <by a zoü &vß gu'
nrov .
6%ä(p€&fi ö l iö og eig zbv filw v zgsig digag, n dvza zb: 0 0:7n'Ud
‘
az oz,ä'
7zeg figev iz zoö 0 u'
ma zog zoü ävöga’
nzov , éxxe'
u 33'
5w ,za l
ylvszou. xa 3 agbg 7zäl zv diozzeg fiv , so hab en w ir h ier s i chereine verd rehte Erzäh lung v on den se i t a l ters her in Ind ien ge
brauch ten S te inen,w om i t man S ch langenb is se zu he i len glaubt
,
v or Diese w erden näm l i ch auf die Wun de ge legt,w obe i
man glaub t, daß sie von se lbst das Gi ft au fsaugen und dannherab fa l len ; in irgende iner We i se w erden sie dann v on dem
au fgesogenen Gift befre i t. Die Gesch i chte v on dem Wägen des1) Vgl. L au c h e r t a. a. 0 . p. 82 und die genaue Übereinstimmung m it
diesen S tel len bei Lucan Phars. VI , 676 : qu cequ c sonan t feta tepefacta su b
alite causa .
2) Der Name n egaäé£ w v erw eckt aber gew isse Bedenken ; sonst ist das
Wort nur in der Bedeutung„A rmband des rechten A rms“ (Septuag.) be
kann t . Hängt das W ort i rgendw ie m it n agddew os= pairi-da ésa zusammen ?Man erinnert sich auch des indischen Paradiesbaumes, der ja päi‘ijäta heißt.
Über ihre Verw endung in neuester Zei t vgl. z. B . T h u r s t o n ,
Omens an d Superst i t ions in S outhern India (London 1 9 12) p. 92.
288 Jar] Charpen t ier
S te ins und des kranken Mens chen kann ja der Verfasser des Phys iologu s oder se ine Que l le der rhetor is chen Ausschm ückung w egenauf eigene Faust zusammengefabelt hab en.
Was der Phys iologus von der ehe l i chen Treue der Krahebzw . der Taub e (XXVII) erzäh l t, findet s i ch nach L a u c h e r t a. a. 0 .
p. 26 s chon bei Aristote les , der H . A . IX,3 d ies von der T urtel
taube und bei Athenaeu s IX, p. 393 f. v on der Krähe zu beri chtenw eiß . Von der Krähe w issen die In der, sovie l ich w eiß , Ähnli chesn i ch t zu erzählen, w ohl ab er ganz andere S achen dagegen w irddie Taube b ei indis chen Au toren als Vorb ild ehe l icher Treuedarges te l l t, w ie z . B. die in Pürnabhadras Pari catantra Il l, 8
\ge
gebene rührende Gesch i chte bew eist. Doch m ö chte i ch ja n ich tbehaupten, daß gerade bei Ari s toteles ind ischer Einfluß zu spürenw äre ; e ine derartige Vorstellun g kann seh r w oh l bei versch iedenenVöl kern se lb ständig entstanden sein .
S ch l ieß l i ch sei auch bemerkt,daß in dem , w as der Phys io
logas v on dem Wiedehopf VIII) erzäh l t, und noch mehrin der bei L a u c h e r t a. a. 0 . p. 1 3 aus A elian XVI, 5 ange führ tenS te l le s ic h ganz s icher indi s ches Materia l findet. E s w ürde aberzu w e i t fü hren, w ol l te i ch h ier d iese Dinge w eiter entw i cke ln,und so muß i ch ihre Behand lung für eine andere Ge legenhe itau fsparen
I ch habe zur ze i t n ichts mehr zuzufügen . Durch die ob igekurze Dars tellung ist aber w e i ter bes tätigt w orden , daß s i ch imPhys iologus zieml i ch viel indi sc hes Mater ial findet ; man w ußtedas j a s chon irüher ; doch hofl°e i ch h ier noch ein paar Bei tr ägezur Erk lärung der oft sehr rätse l ha ften Erzäh lungen des sonder
1) Was A ristoteles Gen . an. III , 6 w iderlegt : awar d 1 6 oz o
'
p a ,u iyw a3 au
1 0 6 ; (1 8) xögax a c ist auch indische Vorstellung, vgl. Vätsyäyana Kämas.
p. 1 73 cd. Du rgäpr a säda .
2) Nebenbe i sei h ier bemerkt, daß zu dem , w as L a u c h e r t a. a. 0 . p. 40
aus dem armenischen Phys io logus über die Tiger in angeführt hat,sich e ine
deutli che Paral lele bei C laudian carm . 36,267 : iam iamqu e hausw a p mfwndo
or e vir um vitr ea tarda tu r imagin e for mae findet ein e s ich auf diese F angar tbeziehende Abbildung bei B ar t o l i
, Sepolcro dei Nason i,tav . 28 ; vgl.
B lüm n er in I . v . Mül lers Handb . IV,2,2 p. 522 A . 1 1 .
290 Jarl Charpen t ier
daß das Buch von Anfang an von e inem Manne aus dem Vo l ke 1)fürs Vo l k ges ch r ieben w urde
,und daraus erk l ärt si ch w oh l auch
seine s chon früh groß gew ordene Popularität. Zu jener Ze i t gabes aber in Alexandr ien ein b un tes Gem is ch von Vö lkern a l lerLänder, die si ch in der großten Hande l ss tadt der We l t
,du rch w e l che
a lle S chätze des Ostens nach den Ländern des Mi tte lmeeresström ten
,zusamm engedrängt hatten. Von diesen w aren aber der
n i ch t geringste Te i l Inder ; denn Pl in ius u . a. bezeugen zur Genüge, w e l ch zen tra le S te l l ung als Export land Indien zu dieserZe i t einnahm . Diese Inder aber müssen zum a l lergrößten Te i l ausCey lon oder aus den Emporien des w est l i chen Indiens (Bharukaccha B agi yaCa usw .) gestamm t haben und w aren som i t zieml i ch si cher Buddh isten ; für Cey lon i s t das se l bs tverständl i ch , und
das w est l i che Ind ien lebte ja dama l s m i tten in der buddhistis c henRestaur at ion un ter Kan iska und seiner Dynastie . Nun bedenkeman aber auch
,daß unter den buddhisti s chen Laien zu jeder Zeit
die Ges ch i chten von dem Erden leben des Meisters in seinen un
zähligen Existenzen gang und gäbe gew esen sind , und w enn
so l che Leute irgendein he i l iges Buch ihrer Religionsurkundenm it s i c h führten , um daraus S ee lentros t und Vergnügen zu ho len
,
so w ar es w oh l das Jätakabuch oder e ine ähn l ic he Legendensamm l un g .
E s i st nun bem erkensw ert, daß ia dem ä l testen Physio logusdie Eigens chaf ten so vie ler Tiere direkt als die des He i landssym bo l is ieren d ausge legt w erden . Es kommen h ierbe i in Betracht :1 . L öw e (dre i Eigenscha ften) ; 3. Charadm
'
us ; 4 . Pelikan ; 5 . N acht
rabe 7 . Phönix ; 1 6 . Panther ; 1 9 . Geier (Äi3 0 9 edzo'
u og
= Christus) ; 22. E inhorn ; 25 . Hydr us ; 26 . Ichneumon ; 28 . T ur tel
taube ; 30 . Hirsch ; 32. Diaman t ; 34. Peri dexion ; 35 . T aube (ersteEigens chaft) ; 42. Diam an t ; 4 3. E lefant ; 44 . Per le ; 46 . l iä og
lvöm o'
g. Unter diesen fin den s ich ein ige Erkl ärungen,die sehr
g'
eküns te l t s ind,so w enn z . B. die Eigen schaft des Nachtrab en
,die
Finstern is mehr als das Li cht zu l ieben , so gedeutet w i rd, daß der
1) Wenn es n icht allzu kuhn w are oder j edenfal l s zu kuhn lauten
wu rde m öchte ich gern sagen,daß mir Cosmas Indicoplenstes ein ähn
l iches Indiv iduum wie der v ermutl iche Verfasser des Physio logus gewesenzu sein sche int.
K le ine Bemerkungen zum Physio logus 29 1
Herr die He iden mehr als die Juden l iebte Die m ei sten sindaber n i cht ü bel gew äh l t
,und h ierunter s ind ein ige
, die mir be
sonders beachtensw ert s che inen .
Die genaue Übere ins timmung lehr t unzw ei fe l haft , daß die
di rekte Vor lage der Gesch i chte v om Einhorn entw eder das Réyas' rri gajataka oder ein ihm ganz ähn l i ches S tück gew esen se in muß.
Die Deutung lautet : e i n 7’
;övmj9 qoa v a i äyyeit txa i dv vdy ezg aözbv
xgazfioa u dl l’
€o*e rjvw oev eig z i,v ya oze'
ga z f; g &Äsäd:g (drei) fra g
8 {v ov Maglag, „na i ö /Iöyog odgé
'
iye'
vezo za l £ omjvw aev s’
r i;vAlso das Einhorn beze i chnet Ch r i stus
,der im Leibe der Jungfrau
Maria erzeugt w i rd ; Béyaérirga aber i st der Bodh isatt va,der bei
der Vol lendung der Ze i t im Le ibe der reinen,j ungfräu l ichen%
Mäyä empfangen w ir d man muß zugeben. daß die Ähn l i chkei teine s ch lagende i s t. Beachten w ir aber w e iter die Gesch i chtev on dem Elefan ten : w enn d ieser herumgefallen i s t und ihn die
großen Elefan ten n i ch t au fri ch ten können,dann : i
'
ozegov‘
öé
: r olvzw v .
’
s'
gxeza c putn é'
l erpag, na i ön oz i& ryoz z ip» n goy vé'
lda
aözoö 'ö/zoxdzco zoü äl érpa vzog, na i éyelgu aözöv . U nd dieserkleine Elefan t is t der He i land : v azegov o
-Öv 7zoiv zw v 6
voegbg e’
Äétpag, ijzoz n zbg 5 9 869, na ). ijyszge zbv n en zw xo'
za
d7t b zfig yng. ö n gcb zog ybzg n oivzw v éyév ezo _u zxgo
'
zegog 7zoivzw v .
äza n eiv roos die s‘
av r o'
v, y ogrpi;v dov
'
l ov Äaßa3v , Yva n dvzag außen.
Man kann kaum verne inen, daß diese Ges ch ichte v on dem k le inenElefanten , der Christu s v orste l len sol l , w underbar mit der buddhistischen Anschauung v on Buddha oder v ielmehr Bodhisattva
,
der als w eiße r Elefant vom T usita-Himme l in den Le ib se inerMutter herabkommt, übereinstimm t ; und diese Vorste l l ung, dieuns üb era l l in späteren buddh is tis chen Werken en tgegentri tt, w aroffenbar schon zu Asokas Ze i t w oh lbekann t ?
We i ter sehen w ir,w ie der Physio logus deta i l l iert die E nt
stéhung der Perle in der Musche l m it der Erzeugung des He i landsim Le ibe der Maria vergle i ch t ; es erinnert uns unzw e i fe l haft
V ie l v erständiger scheint die E rklarung der späteren Physiologi zusein , vgl. L au ch e r t a. a. 0 . p. 9 A . 2.
Dies muß schon zu dieser Ze i t die buddh ist ische Lehre gew esense in
,vgl. W i n d i s c h , SA XXVI , 2, 153 ff.Vgl. die U nterschrif t des X II I . E d ik ts in Gir nar va sveto bas ti
savälokasukhävaho näma und W i n d i s c h , SA XXVI , 2, 5 1T. l ößfi .
1 9*
292 J arl Charpent ier
daran , w ie der b uddhis ti sche Kanon den Bodhisattva im Le ibe derMu tter mit einem kostbaren Ede l stein U nd w enn
der Phys iologus von den T aub en spr i cht, sagt er fo l gendes : 0‘
Q vow l o'
yog n egi n ohläw n en egeb v is'
l eéer elol ybzg n ol l bz ye’
rnn egzozegcb v na i n ol zixgwy oi. taz). rpagög, nel.avoszdrjg. idw 05v
lil a ; zb:g n egaozegbzg ö m yy,u azw zigg n ny,u azioy‚ oöde,u lav eindyez
oööé m si&ez zä w 55v n epzozegcöv eioayayelv eig zi;v xal cäv,ei
M) „6110 ; 5 n vgoecdbg slodyezo a. b'
zs 0511 än éaza l.sv ö Haziyg znzfig évön‚
u iozg zofi‘
I'
w -ö,dixnv n en ega7v za l éoa z n civzag zn g
Canjv , Mw üofiv qmm,
‘
l flla v,Z ay omj/I,
d a vm’
l,na i zobg Äom obg n gorprjzag, oddeig
’
loxvoev eig zi;v tw ijvcioayayelv zoög 3zs di; é£ an sazdln ö n zbg é€oögava
'
w n age‘
: zo°ü Hazgo
'
g, 7L'äVT GQ slmy
’
yayev eig ziyv Canjv , Äéyw v'
„ deüze n go'
g ‚es n oivzeg oi xom w vzeg na i n ecpogzw ,u évoz
,xäyt
‘
u
&va rzav'
ow öyäg“
. orözbg 7 ctg 50s ö n vgoezdi;g n sgzozego'
g, xa&b
iv ze ig’
Liw y ozoz yéyga 7t za z'
„o’
zdel cpo'
g ‚um; n vggo
'
g“
qmow fi vv'
y rpn,
7‘
s g éoziv n zoö’
E l noio: . Diese Ges ch ichte findet s i ch nachL a u c h e r t a . a. 0 . p. 30 in etw as anderer Art bei A elian IX
,2 ;
i ch er innere aber au ch daran,daß in Jataka I
,208fl
°. Bodh isattva
ein Wachte l kön ig ist,der dur ch seine Klughe i t die ganze S char
v on Wachte ln re ttet ; dem entspri cht nun aber, w ie bekannt , dieEinle i tung zu Pafi catantra 11 . Dort ist es jedoch nach e iner vie llei cht älteren' Vers ion der Gesch ic hte der T aubenkönig Gitr agriva ,dem a l le anderen Tauben be im Auffliegen fo lgen und som it dasgefährl i che Netz fortb ringen. Eine gew isse Übereinstimmung l iegtdoch offenbar vor .
Ich kann h ier _ n i cht w e iter gehen,das Gesagte w ird ab er
für meinen jetzigen Zw eck genügen . Daß unbes tre itbare naheÜb ere ins timmungen zw is chen dem Physio logus und indis chen Que l lenvorhanden s ind, s teh t fest ; daß an dem Ort und zu der Ze it
, w o
der Phys io logus ents tanden ist,hinrei chende Mögl ichkeit e iner Be
einflussung v on seiten buddhisti scher Inder auf den Ver fasser vorhanden w ar
, steht au ch fes t ; daß en dl i ch der Phys io logus in derk lassischen und christli chen Literatur seiner Ze it ke ine direktenVorb ilder hatte
,dagegen ab er in se in er ganzen An lage mit den
buddh ist is chen Jatakas beach tensw erte Übereinstimmun g ze igt,
1) Vgl. W i n d i s ch , SA XXVI, 2, '
1 1 6 ff.
Die Zitate aus Mäghas Sisupalavadha mitihren Varianten .
Von
0. Cappeller (Jena) .
Al . A lamkärasarvasv a (Kävyamälä) ; t . t anyäloka
Käv Kävyälamkäravrtti (Jena Kpr . Kävya
prakäéa (Ka lku tta Kuv . Kuvalayananda (BombaySp. Särfigadharapaddhati (Bombay S ar . S arasvatikanthäbharana (Ka l kutta Säh . S ähityadarpana (Ka l ku tta
S ubh . S ubhäsitäv ali (Bombay Hal. Haläyudha
(Ind. S t. Bd. VIII).
V,1 5 agre gatena S ar . 143.
II,53 avikädhiropitamg
r
ga° Kuv . 85 .
VI,67 atisarabhiz abhäj i Hal. 380 .
XV,1 a tha tatra pän c_iu
° Säh . 7 2.
IX,31 a tha lak,sma
° S ubh . 197 4 (vyatitga st. vilaizghya ; balais st.
ganais).
VII,52 adhir aj ani j agama Sp. 357 0.
XI,9 anunayam agrhitvä S ubh . 21 7 5 .
IX,1 0 anarägw an tam Sp. 3585 ; Säh . 235 ; S ubh . 1 923 .
II, 44 anyadä bhüsanam S ar . 42 (s
'
amo st. lc_sam ä).
X,28 anyayänya
" S ubh . 201 0 .
X, 14 apr asannam aparäddhari S ubh . 201 1 .
XVI,2 abhidhäya tadä S at . 35 .
X,62 ambaram vinayatah S ub h . 2094 .
IV,29 ayam a tij ara _
thäh Kuv . 8 1 .
VII,6 1 avacitalcu sumä S ubh . 1 863
IX, 1 2 avibhävyatärakam S ubhi 1 925 (avasanna ° st. viratom
Die Zi tate aus Mäghas S i9upii lavadha m it ihren Varianten 29 5
11, 4 7 asa rgzpfidayn tah Sp. 4 62.
VII I,36 äncmdum (lud/m il S ubh . 1882 (svedämbhahsnapitam ).
XIX , 2 <Tpa lrm lam am um Säh. 1 04 .
X,7 4 üha ta r
_
n l mca ta {.ßna S ubh . 21 24 .
VII, 56 iti gadita ra ti S ai l) . 50.
V III,7 1 [ tl dha utapu ram dhr i
° Hal. 421 (ättava to s t . äplava to).vn
,50 idam i<im n iti Sp. 3805 .
IV,60 illa nw bw ‘ S &P. 85 .
IX,30 udam ajj i ha itabhaj ilah S ubh . 1 97 3 .
I V, 20 udayati vitatordhva ° Kpr . 148 ; Sp. 3737 ; S ubh . 2163.
IX . 1 2 udayam u (lltadiptir S ubh . 217 7 .
XI,4 7 udayas
'
ikhü r i° S ubh . 21 87
III,8 ubhan yadi Käv . 50 (tadopanüyeta) ; S ar . 19 . 200 (tadepamiyeta).
I V. 59 etasm inn adhilca ° Knv . 82.
III,1 3 kapä{auistir na
" S at . 1 4 .
X1X,36 kar enuh prasthit0 S ar . 89 .
XV,96 l:äcit I:ir r
_
aä Kpr . 93 (anzw idadhe
VII],23 hän länärn knealayam S ubh . 1 883.
XIV,7 5 /ci 7
_n
‘lcram isyali Sp. 4020 (asahan6a m andalah kram ah).VIII , 29 kim tär at Kuv . 1 84 ; Säh 284 .
I,3 lcu lhena nägen tlram Käv . 7 6 .
XI, 64 lmnm da r
-
anam apaér i S ar . 1 63 S ubh . 21 88
-
ngianz udaya ti dinanätho yäli).
IX,38 Äf3
'tagzt r utai'a lzära 0 S ubh . 2183.
IV,23 lc
_
r tvä pzwgw at S ar. 1 01 (bhrgubhyäm— sm arär tam).
X, 54 kenaoin m adharam S ar . 3 1 6.
XIV,66 lcevalaqn dadhati S ar . 22.
X,3 krän ta lcän la “ KGV . 1 84 (bhagnabäla
°— nirvivär a) ; S at . 1 81
(bhayna°
—
pranihitälini) ; S ubh . 2008
XI,65 ksanam a tuh ina ° S ubh . 21 89
XI , 48 lc3anam ayam S u bh . 21 86 .
V,50 ksiptanz puro S ar. 1 03 .
I, 1 2 gires radialen Kav . 59 .
VII,1 8 gar ataralcala
° S ar . 308 S äh . 56.
X,63 gr an thim udgrathayitum S ar . 31 9 .
III,5 1 cikranw ayä S ar . 1 73.
XI, 1 3 c
irar a ti ° S äh . 6 7 (
°
pa7i hhedät
II,21 j agäda vada ° Säh . 337 (parya3 ta st. paryan la ).
296 C. Cappeller
XIX ,3 j aj auj oj ä
° S ar . 1 1 6 .
XI,1 4 j ar alhakam ala
° Käv . 49 .
X VI,26 j itar o,sarayä mahädhiyah Sp. 21 6 .
XI, 33 tad avitatham Säh . 43 ; S ubh . 21 82 (dugülam ).VII
,54 tava kitava
i
Säh .
IX,64 tava sä
'
ka thä8u S at . 307 .
III,82 tur agaéa täleu laeya Hal. 424 paricara to
°s'
7iyah salilanidheé).
VI,4 tu layai i sm a S at . 83.
11,49 tu lye
’
parädhe Sp. 287 ; S ubh . 2263.
VIII,24 trasyan ti cala 0 Säh . 58.
V,26 träsälculah DIN. 1 14 (ahganäbhir st. ahganänäm ).
IX,23 dad
_rs
'
e’
pi S ubh . 1 926 .
XI,1 5 dadhad
_
asakalum S ubh . 21 78.
V, 37 danani dada ty api Kuv . 142.
IX, 34 divasam bhréosna
° S ub h . 1 9 7 6 .
VIII,64 divyänäm api Ruv . 25.
XI,8 dm tatar altaradaksäh S ubh . 21 74 .
VII,53 na lthalu Säh . 49 (vatavi _tapam st. w aj a vitapam ).
IX,56 na ca me S äh . 46 (avagamya st. iipagamya).
IX,6 1 nanu samdiéeti Sp. 3440 (kréitam).
XI,22 navakumadavanaéri ° S ubh . 21 80 (päntiuglänam).
XI, 34 navanalchapadam anyam Säh . 82 ; S ubh . 21 7 1 (m ahur st. punar ).VI
,2 navapaläs
'
a° Säh. 26 1 .
XIX,34 nidhvanajjaaa
" S ar. 1 21 .
II, 68 nzsamya tah S at . 4 7 .
II,6 1 n itir apadi S ar .
_
54 .
XVI,28 pazi tosayitä Sp. 34 7 .
XI,1 1 par iéithilita
° S ubh . 21 7 6
X , 53 pallavopam iti ° S äh. 55 .
X,69 pänirodham Säh. 55 .
n,46 pädähatam yad u tthäya Sp. 265 ; Säh. 3 12 ; S ubh . 2264 .
III,70 pärej alanz nir anidher Säh. 294 .
IV,22 päéccüyabhägam Sp. 4022.
IX,6 pr atilcüla täm apaya le Sp. 450 ; Sah. 263 ; S ubh . 1 922.
XI,4 1 pratis
'
aranam aéirna° S ubh . 2184 .
IX,29 praihamam kaläbhavad S ubh . 1 9 72 (hramata sah asä
bhyudayam).
I, 22 pr aphu llatäpiccha° S ar . 1 62.
298 c . Cappeller , Die Zi tate aus Mäghas Si8upälavadha m it ihren Varianten
I I,42 vidhäya v aira7
_ri Kuv . 84 .
VI I,5 7 v inayali s udr s
'
o Säh . 8 1 (d9‘
8'
0h st . drs'ah) ; S ubh . 1 864 .
IV,1 4 vibhinnavarnä AI. 1 7 0 (m cam r ucä) ; Kpr . 1 83 ; Kav . 159 ;
S an 98 .
VI,3 vilu litälaka ° S er . 83 (tatih st. ta tim ).
I,29 v ilohanenaiva Säh . 95 .
IV,36 nihayah kadam ba
° S ar . 85 .
XIV,1 5 éasane
'
pi S ar . 1 92 (ta t
XX,7 9 s
'
riyä instam divyaih Hal. 423 (vapust0w air yasya -nin iya°rädvilcsipad) .
VI II,1 8 samksobhanz payasi Sp. 3844 ; S ubh . 1 88 1 .
XIX,1 20 sa tvam m ana
° S ar . 1 20 (m uktä st. m ulctvä).
XI,24 sapadi lcum adinibhir S ubh . 21 70.
I,70 sa bäla asid S ar . 1 49 .
I I,33 samülaghätam Sp. 267 .
II,32 campada Sp. 461 (susthitanzm anyo).
XVII,2 caragaga sm ta ° Säh. 244
II, 28 sarvalcäryaéar iresu S ar . 34 (m aktäizga
I, 52 sali layätäni Sp. 3993 (ab/zidm tah st. anudr utah) .
I,46 sa sa7
_n eari
_snar S ar . 1 38 s
'
riyäm tue-mai).
XVI,29 sahaj ändhadys
'
ah Sp. 348 .
X,1 6 sävas
'
esapadam S ur . 236 .
XIX,29 sd senä S ar . 1 23 .
I,25 sitam silimna Käv . 62.
VII I,7 0 svacchämbhah ° Säh . 54 (väsas in).
X,1 3 hävahc
'
zri Sp. 3652.
XIII, 38 himamuktacandrarucir ah S äh . 1 06.
X,52 hribharäd S ar . 307 .
Mahäbharata II, 68, 416 . und Bhasas
Dntavakya.
M. W in ter n i tz (Prag) .
Im Mahäbhärata I I,6 7 f. w i rd erzäh l t, w ie Draupadi , nach
dem Yudbisthira sie im Würfe l spie l e ingesetzt und verloren hat,auf Duryodhanas Befeh l v on dessen Bruder Duh8äsana bei den
Haaren in den S aa l ges ch leppt w i rd . Trotz ihrer Klagen n imm ts ich ke iner der Hel den ih rer an
,da sie „
rechtm äßig “ verspie l tw orden ist. Bhima
,der an Yudhisthir a se inen Zorn aus lassen
w i l l,w ird von Arj una zurechtgew iesen . Nur der junge Vikarna
tri tt für sie ein. Aber Duryodhana w ei s t den j üngeren Bruder inseine S chranken und erk l ärt, a l les sei dem Yudhisthira abgew onnenw orden, se lb s t die Kle ider se ien n icht mehr Eigen tum der Pandavasund ihrer Gemah l in ; es w äre desha lb sogar rech t und b i l l ig, i hnenund der Draupadi die Kle i der v om Leibe zu nehmen . Wahrenddie Pandavas ihre Oberkleider h inw erfen, beginn t Duhs'äsana derDraupadi , die als r aj asvalä nur e in Klei d anhat
,d ieses vom Le ibe
zu reißen . Da erheb t Draupadi i hre Gedanken zu K rsna u nd
fleht ihn um Hil fe an . Dieser komm t v oll Mitleid herbe i,w orau f
s i ch das Wunder vol l zieht, daß der unsi chtbare Gott Dh a rm a sie
m it Kleidern umhü l l t : so oft i hr das eine Kle i d v om Leibe ger issen w ir d
, ersche int ein neues ; zu hunderten ers che inen bun tfarb ige Kle ider a l ler Art . Be im Anb l i ck d ieses Wunders en ts tehtein großes Beifallsgeschrei unter den anw esenden F ürsten
,von
denen Draupadi gepr iesen und Duryodhana getadel t w i rd . Bh im a
aber spr i cht m it vor Zorn b ebenden Lippen den furchtbaren S chw ur
300 M. W in tern i tz
aus,er w ol le n i ch t zu seinen Vä tern eingehen , w enn er n i cht dem
S churken Duhéäsana die Brust aufgerissen und sein Bl ut getrunken habe.
Aus mehr als e inem Grunde sind die Verse II, 68, 4 1 — 50
verdäch tig und machen durchaus den Eindr u ck , daß sie erst s e h rspä t von e inem Krsnaverehrer in den Text des Mahäbhärataeingefügt w orden s ind . Erstens ist es sehr w enig passend, daßBhima se inen furch tbaren S chw ur erst nach dem Kleiderw under
ausspr i ch t. An Vers 40, w o Duhéäsana der Draupadi das Kle idv om Le ibe zu reißen beginn t, sch l ießen si ch naturgemäß die
Verse 5 1 ff. mit dem S chw ur des Bhima an . Zw eiten s erscheintin a l len unzw eife l haft echten S tel len des Mahabharata Krsna immernur als ein mensch l i cher, oft a l l zu mens ch l i cher Freund der
Pandavas, n i cht als der Gott Visnu . U nd gar als „Freund'
der
Hir t innen (gopijanapriya , v. 4 1) ersche int er im Mahabharata sonstnie Drittens ist es ganz se l tsam ,
daß Krsna au s Mi tleid mitDraupadi herbe ikomm t, daß aber das Wunder m it den Klei dernv on Dharma b ew irkt w ird. Der Vers
Krenam ca visnm _n ca harim naram ca
tränäya vikroéati yäj üaseni
tatas ta dharmo’
n tarito mahätmä
samävrnod vai vividhaih su vastxraih
erw ei st si ch auch durch das Metrum Upajäti m itten unter denS lokas als ein Fremdkörper.
Daß w ir es mit e inem spaten Einschub zu tun haben , w irddur ch die s ü d i n d i s c h en Man u s k r ipt e , w enn au ch n i cht bestätigt , so doch w ahrschein l i c h gemach t. Zwar feh l t die S te llein keinem der m ir bis jetzt bekannten Mss.
,aber diese w e i chen
sehr stark voneinander und von der Vulgata ab . In den süd
indi s chen Mss. w ird das Kleiderw under dur ch K rsn a herbe igeführ t, ohne daß erst D h a rm a bemüh t w i rd. S tatt der zehnVerse der Vulgata lies t das Malayälam Ms. Whish Nr. 1 8 (derRoyal Asiati c S oc iety)
Nach S . S o r e n s en s Index to the Names in the Mahäbhärata ist
dies die e inzige S te l le, w o das E pitheton v orkomm t. Auch die Epi thetar amänätha und vraj anätha kommen nur in v . 42 vor . U ngew öhn l ich sindauch die E pi theta m ahäy09in , viévätman und ziivabhävana in v . 43.
302 M. Wintern i tz
w ie sie im V . Buch des Mahabharata erzäh l t w ird. Der Einak terbeginnt dam i t
,daß s i ch a l le Fürsten der Kauravas im Beratungs
saa le versammeln und Duryodhana sie i hrem Range gem äß e inennach dem an deren begrüßt. Nach dem a l le Fürsten versamme l ts ind
,w i rd die Ankun ft des Krsna gemel det, der als Gesandter
der Pändavas ersch ienen i st. Wäh rend von e in igen der An
w esenden vorges ch lagen w ird,den Ankömm l ing als Gas t zu ehren
,
erk l ärt Duryodhana sofort se ine Abs i ch t, ihn gefangenzunehmen .
Zuglei ch verkündet er , daß jeder, der s i ch vor Keéava (so w i rdKrsna von Duryodhana stets erhebe, e ine Ge l ds trafev on zw ö l f Go l dstücken bezah len m üsse. Um aber n i cht se lbstin die Versu chung zu komm en, dem Krsna e ine Ehrenbeze igungzu erw e i sen
,l äß t er s i ch ein Gemäl de b ringen , w e l ches darste l l t,
w ie Draupadi bei den Haaren in den S aa l gesch leppt und ih rdas Klei d vom Le ibe gerissen w ird (yatr a draupadikeéämbarä
naharsanam älikhitam ). Das Gemäl de w i rd gebrach t, undDuryodhanab es chre ibt vo l l En tzücken das Kunstw erk : Hier sieht m an Duh éä
s an a,w ie er die Dr au padi bei den Haaren häl t ; diese reiß t
v or En tsetzen die Augen w e i t auf. Bh im a s chw ingt beim An
b l i ck der m iß hande l ten Draupadi in maß losem Z orne eine S äu le derHal le . Yu dh isth ir a beruh igt ihn mit einem S e itenb l i ck . A rj u n a
,
mit zorngetrüb ten Augen u nd zu ckenden Lippen , zieht langsam dieS ehnedesGändivabogens aufundw ird vonYudhisthirazurückgehalten .
N a k u l a und S a h a d e v a ergre i fen S ch i l d und S chw ert, b erei t, s ic haufDuhSäsana zu stü rzen . Aber auch sie häl t Yudhisthira zurück .
Man s ieht noch S ak u n i,w ie er die Wü rfe l w irft und die w einende
Draupadi finster anb l i ck t,und end l ich die bei den ehrw ürdigen
Kauravas,den Lehrer D r on a und den Großvater Bh i sm a . E nt
zück t steht Duryodhana vor dem Bi l d und ruft aus : „Ach , dieserFarb enre i chtum ! Ach
,dieser Gefüh l sausd ru ck ! Ach , d iese trefi liche
Zei chnung ! S ehr Iebenswahr ist d ieses B i l d gema l t.Auch Krsna, der ba ld darauf e intr itt
,br icht be im Anb l i ck
des Gemäl des in die Worte aus : „Ach
,w as fur ein s chönes B i l d ! “
Ers t als er s ieht,w as es dars te l l t
,mach t er dem Duryodhana
1) Der Kammerer me ldet, daß „
der Purusot tama Näräyana“als Gesandter
vom Hauptquart ier der Pändav as gekommen sei. Darüber ist Duryodhanasehr aufgeb racht und beruh igt s ich erst, als der Kämmerer s ich berichti gtund meldet
,daß
„K ese v e “ gekommen sei.
Mahäbhärata II, 68, -I l ff. und Bhäsas Dütaväkya 303
Vorw ü r fe,daß er s ich n i cht s chäme
,se ine eigene S chande durch
d ieses Bi l d offen kund zu tun. U nd auf Krsiias Be feh l läßt esDuryodhana durch den Kämmerer w egtragen .
Weder die von Du ryodhana a nged roh te Ge l ds trafe, noch dasBi l d erfü l len i h ren Zw eck. Die göttl i che Macht des Krsna bew irkt
,daß a l le F ü rs ten ihm auch gegen ihren Wil len die Eh ren
beze igung erw e i sen müssen . Kr_
srga ri chte t sodann seine Bots chaftaus und sucht Du ryodhana zu r Nachgiebigke i t gegen die Pandavaszu bew egen. Du ryodhana w i l l aber kein Rech t der Pändavasanerkennen und verhöhnt den Krsna. Da dieser s ieht
,daß al les
Zureden vergebens is t, w i l l er m it heftigen, gegen Duryodhanageri ch teten S ch impfw orten den S aa l ver lassen. Da gib t Duryodhana Befeh l
,ihn zu fesse ln . Aber ke iner vermag es. Duryo
dhana versucht es se lbs t. . Aber Krsna nimm t a l l e m ögl ichen Gestalten an, i s t ba l d k le in, ba l d groß , bal d unsi chtbar, ba l d fü l l ts i ch der ganze S aa l m it Krsnas. Die Kön ige, die ihn. fesse lnw o l len
,fal len se lb s t gebunden hin . Zorner fül l t ruft Vasudeva
se ine Waffen herb e i : Der Diskus S udaréana, der Bogen Särfiga,die Keu le Kaumodaki , die Musche l Päfi cajanya, das S chw ertNandaka und s ch l ießl i ch der Voge l Garuda ‚ des Gottes Re i tt ier,treten auf
,die Befeh le ihres Herrn zu vo l l z iehen . Dieser aber
en tl äßt sie w ieder, nachdem si ch sein Zorn besänftigt hat. Erbr i ch t auf, um ins Lager der Pandav as zurückzukehren . Da er
s che int der a l te Dhrtarästra, um dem erhabenen Näräyana“ seineVerehrung darzubringen .
In dem ganzen Drama w ird a l so Krsna , w ie man s ieht,durchw egs als der erhabene Gott Visr_ m dargeste l l t. Daraus fol gt,daß der Dichter Bhasa ein frommer Vaisnava w ar . Dies w ir dauch durch das Bü la c a r i t a l ) bestätigt, in w e l chem die Tatendes j ugend l i chen Krsna bis zur Tötung des Kamsa d rama tis ierts ind . Ganz so w ie im Dütaväkya ers che inen auch im Bälacar ita
die Waffen des Visnu und der Voge l Garuda un ter den personaedramati s . Wie in diesen be iden Dram en Krsna , so w i rd im
A b h iseka n ätak a*) (im IV. und im VI . Akt) Rama als der Gott
Visnu -Narayana v erher r l i cht. Es ist nun n i cht gut denkbar, daß
1) Trivandrum S anskrit S e ries Nr . XXI
,1 9 12.
2) Tri vandrum Sanskri t S eries «Nr . XXV I , 19 13 .
304 M.W intern itz, Mahäbhärata I I , 68 , 4 1 ff . und Bhäsas Dütaväkya
ein sol cher Verehrer des Visnu das Kle ide rw u nde r in der
Episode des S abhäpar van um eines d ichterischen Zw eckes w il lenn i cht berücks i ch tigt haben so l lte, w enn es zur Zei t des Di chterss chon e inen Bestandte i l des S abhäparvan geb i ldet hatte. In
unserem Mahabharata ist aber die S zene, w ie Dubéäsaua der
Draupadi das Kle id vom Le ibe re ißen w i l l,durch Einführung des
Kleiderwunders geradezu zu r V_
e r h e r r l i c h u n g des K rana ver
w endet,w ährend in Bhäsas Dütaväkya das Gemäl de, in w elchem
diese S zene dargeste l l t w ird, dazu d ienen so l l , den Duryodhanaan die S chande der Pandavas ‚ und die Ma c h t l o s i g k e i t i h r e sF r e u n d e s K rsn a zu erinnern. Wir dürfen daraus m einesErachten s mit S i cherhei t den S ch luß ziehen , daß die V e r s eMa häb h är a t a II
,68
,4 1 111, in denen das Kleiderw under erzäh l t
w ird,e r s t n a c h de r Z e i t de s B has a in das Epo s e i n g e f ü g t
w o r d en s i n d .
Voraussetzung i st a l lerd ings, _
daß das Dütaväkya w i rk l i ch einWerk des Bhasa ist. Ich gestehe, daß ein s trenger Bew e i s fürdie Autorschaft des Bhäsa b isher nur für die Dramen S v apnav äs a v ada t ta und P r a t ij fi äy a ugandh a r äy ana erbracht i st.E s spr i ch t aber, sovie l i ch sehe, n i ch ts dagegen, auch die anderenmit d iesen be i den Werken zusammen v on G anapa t i Sä st r i auf
gefun denen und mit ihnen manche E igentümliehkeiten teilendenDramen dem Bhasa zuzuschr eiben . Daß sie alle, insbesondereauch die kleinen Mahäbhärata-Einakter, sehr w ertvo l le und zum
Te i l hervorragende d ich teris che S chöpfungen s ind , berech tigt unsjedenfa l l s , sie dem
.
großen Vorläufer des Kal i dasa zuzus chre iben,solange n i cht das Gegente i l erw iesen i st.
306 W i lhelm Jahn
rücksichtigung abw ei chende Lesarten, der S chemati smus in der
indis chen Über l ieferung der Genea logien, die S chre iber und Hörerfeh ler, w e l che aus versch iedenen Namen e ines und desselbenHerr s chers versch iedene Persön l i chkei ten machen und Verw echs
l ungen zulassen, das Zusammenarbe i ten v on mehreren Listen , dieVerw endung von Nachrichtentrümmern zu h i stor iographischen Neubauten. Dennoch b le iben so l che fast nur arithmetis ch gew onnenenTab e l len
,w ie sie der Verfas ser aufzuste l len untern immt, vor l äufig
re in prob lematis ch . Positive Ergebn isse w erden erst dur chKo l lektanea geschaffen w erden können . Dam it me ine i ch die
lexika l i s che Anordnung der einze lnen Namen , ein Zusammen tragena l ler errei chbaren Beri chte über sie. Das s ind Arbei ten
,die
natürl i ch vie le Jahre erfordern . Das Matsya-P. erw eis t s i chBork zufo l ge als sehr, das Bhav isya—P. als le i d l i chdie südbuddhistische Überl ie ferung als n i cht vö l l ig feh lerfre i . Aus denHauptresu l ta ten seiner S tudie hehe i ch fol gende Punkte hervor :„Die Ein le itung und die Ab s chn i tte über die Pauravas und die
A ikSväkus b i l den die erste Que l le. S ie i s t mytho logis ch und
enthäl t nur gegen das Ende hin ges ch i cht l i che Bestandte i le .
Eine Para l le le zu d ieser Que l le ist die Liste der Bärhadrathas ,die für die Gesch ichte vö l l ig w ertlos ist. Die ges ch i chtl i che Überl ieferung beginnt mit den Ab schn itten über die Pradjotas und
Si8unägas Der h istoris ch w ertvo l l ste Bestandtei l der Puränassind die Listen der Nandas
,Maurjas, Surigas, Känväjanas und
Andhras . “ Treffend s ind die S ätze p. 1 25 :„Es hande l t s i ch bei
diesen S chriften doch keinesw egs um das Bedürfn i s, g esch ichtl iche
Dinge festzuha l ten,sondern einzig und a l lein darum
,v om re l ig iösen
S tandpunkte aus das große Weltw erden und Weltvergehen zubegrei fen. Für diesen Zw eck sind historis che Angaben anna l i stis cherArt zw ar gut zu b rau chen , aber gew i ssermaßen nur als Füll sel . “
Für die Annahme p. 128 : „Da die Puranas in der Pälisprache
abgefaß t w aren, so w erden w ir w oh l n i ch t feh lgehen,w enn
w ir in ihnen altbuddhistische Werke sehen, oder sol che, die von
bu ddh ist is ch en I deen s tark bee influßt s ind “
,verm isse i ch
Darin stimm t er mit Pargiter überein . A u f r e c h t s Verurte i lungdieses Werkes, ZDMG 57 , p. 276 11 . w ird daher nur partiel le Gel tung beansprachen dür fen .
P a r git e r , T he Paräna tex t of the dynast ies of the Kali age (London1 913) v ermutet, daß die Pnräna ursprünglich in Präkrt abgefaßt se ien .
Aufgaben der I‘uränaforschung 307
ganz zu schw*
e igen v on gew agten S ch l üssen auf das TodesjahrBuddhas
,w e l ches nach nordindis cher Überl ieferung auf 359 v. Chr .
fa l len so l l , und v on der Gle i chung Mahäpadm a = Alexandros.
Immerh in s ind die gegebenen Anregungen zu begrüßen .
Jeden fa l l s steht die F orschung noch vor ungeheuren A uf
gaben . Z u diesen gehört das w e i tere, le ider auf absehbare Zei tun terb rochene Durchdringen der großente i l s in England befind
l i chen Handschriftenschätze, w eniger du rch editiones principes odervo l l ständ ige Übersetzungen, w e l c he die aufgew andte Mühe kaumlohnen dürften
,als durch sorgfäl tige Inha l tsangaben m it einge
streu ten M itte i l ungen e inze lne r w i ch tiger Partien im Origina l,
sow ie durch lndi ces . Dasse lbe gi l t für die berei ts ers ch ienenenTexte, die erst zu einem Te i l w irkl i ch durchgearbeitet s ind und
nur ganz ged rängte Übers ich ten ih res S toffes geben . Bekann tl i chs chreiben s ic h die Puräna vie l fach gegenseit ig ab
,mei st ohne
ihre Que l le zu nennen , zuw eilen sinn los und w i l l kü rl i ch,und
zw i schendu rch se lbst größere S tü cke ganzS ol che Kopiertätigke i t erk l ärt si ch aus dem Bedürfn i s e iner jedene inze lnen S ekte, e inen besonderen Katech ismus zu bes i tzen, w e l cherzunächst einma l in popu l ärer Form a l les Wissensw erte der vedis chenOffenbarung und der nach vedischen Trad i tion darbot
,als deren
berufene Hüter in s ic h die engere Re l igionsgeme inschaft gern gebärdete. Daher au ch die Massenfabr ikation der k le ineren Kompendien w ie S aura und der Enzyklopädien w ie Agn i-P. Daneben
regte s ich natürl i ch der Ehrgei z , die gegebenen Ansätze w ei terzuführen , die e igene poeti sche E rfindungsgabe w a l ten zu lassen ,
e inen besonderen re l i giösen S tandpunkt zu vertreten. Bei der
erw ähnten Gle i ch fö rm igkei t fäl l t es n i ch t lei cht, neue S toß°e zu
R icht i g dürf te daran sein , daß un ter den Quellen der Purär_1a auch Präkr ttexte w aren , w ieW i n t e r n i t z in seiner Besprechung des Buches W ZKM 1914 ,p. 305 f. ausführt. Vgl. auch P ar gi t e r s Aufsatz ‘E arl i est Indian trad i t ionalhistory’
,JRAS 1 9 14
, p. 267 ff.
Brahma-P. (Anand. S cr . S er . ,Poona 1895) adhy. 1 — 1 7 entspricht fast
w ort lich Hariv arpéa I , adhy. 1 — 39 . Ki rma-P. (Bib l . Ind. ,Ca lc. 1890) I I ,
adhy. 12— 1 6 und adhy. 26 — 29 entspricht Padma-P. (A nand. S er. Ser . ,Poona
1 , adhy. 5 1— 55 und 57 — 60. Küm a—P. I I , adhy . 26 h at v ieles,w as m it Saure -P . (Anand. S er . S er . ,
Poona 1889) adhy. 10 übereinstimm t .Das Padma-P. V (Sratikhanda) , adhy. 6 — 10 schein t das j edenfal ls äl tereMatsya-P . (Anand. S cr . Ser . ,
Poona 1907) adhy. 5— 20 benutz t zu haben .
20*
308 W i lhe lm Jahn
fi nden , die e ine k r i tis che Bearbe i tung v erd ienen . Glaube n iemand,
daß er in dies .w ogende Meer nur das Netz zu w erfen brau che, um
e inen F ang zu tun ! Je mehr s ich aber so l che w ö rtl i chen Übere instimmungen oder auch nur inha l t l i che Para l lelen w ie die angeführten ergeben, des to eher w ird s i ch die l i terar i s che Überl ieferun gklären , die v or läufig noch ein w üstes Du rche inander zeigt. S o
w erden e inze lne S tü cke bekannter Werke,z . B. der Hariv amSa,
als besondere Purana gezäh l t, w ie ja auch in den Upanisadlisteneine Maitreyi-Up. v orkomm t, w e l che n i ch ts anderes ist als das
S tü ck Brhad-A ranyaka-Up. 5 . S ogar die Nam engeb ungist sehr un s i cher. Man che Puräna gehen unter mehreren Titeln :das S aum -P. w ird geradezu Brähmam Dann ersche inenw iederum synonyme, daher irre führende Beze i chnungen für s che inbar e ine und diese lbe S chrift, w ähren d es s i ch in Wirk l i chke i tum zw e i versch iedene handel t, w ie be im Adi tya und S au m-P
,
w e l che B a r t h ?) als i den t isch ansah,w ähren d sie
,obw oh l derse lben
S phäre angehörend de facto anseinanderzuhalten sind s), w enigstensnach dem
,w as w ir zurzei t v on ihnen w i ssen . Die Verhäl tni s se
l iegen hier ähn l i ch w ie in dem F a l le : „Die Braut v on Messina
oder die feindl i chen Brüder “,w ie fe rner b ei dem Roman Die
Ges chw is ter “ v on F reytag und,Geschw i s ter “
,zw e i Nove l len von
S udermann . Dazu komm t die S chw ier igke i t,daß der Begriff
„Puräna“
ein sehr dehnbare r i st. Im w e iteren S inne be faßt erauch das Mahäbhärata, doch steht d ies j etzt als ein festes
,se lb
ständiges Geb äude vor uns ; dann gre i ft er ab er über in die Gattungder tantra, von w e l chen der Sabdakalpadruma b esonders un ter denm it dem Siva
’
1’
smus im Zusammenhangs s tehenden Wörtern e inigeProb en l iefe rt . Eine Inv en tar i s ierung alles vorhandenen puränaartigen Mater ia l s i st daher vorläufig als undur chführbar anzusehen.
Die j etzige Gestal t der zum Tei l zu mastodontischen Maßenangeschw ol lenen We rke ste l l t das Prob lem
,w e l che Wandlungen
Im Bhan'
sya-Puräna (Bombay 1897 ) I , udby. I
,60 ,
Deux chapitres du S aurepuräna, Mé langes Harlez (Leyde3) Diese A ns icht , w e lche ich in der E in lei tung zu me iner S chri ft „
Das
S aurapuranam . E in Kompend ium spätindischer Kultur gesch ichte und des
Sivai'
smu s“
(S traßb . 1908) v ertr at , findet e in e S tütze darin , daß das A di tya-P.
im A cärendu (p. 149 der Poonaer Ausg . 1 909) z it iert w ird und die betr effendeS te lle s ich im Sau m-P . n icht nachweisen läß t .
308 W i lhe lm Jahn
fi nden, die e ine kri ti sch e Bearbe i tung v erd ienen . Glaube n iemand,
daß er in dies . w ogende Meer nur das Netz zu w erfen brau che, um
e inen F ang zu tun ! Je mehr s i ch aber so l che w ört l i chen Übereinstimmungen oder auch nu r inha l t l i che Para l lelen w ie die augeführten e rgeb en, des to eh er w ird s ic h die l iterari s che Überl ieferungklären , die v or l äufig noch ein w üstes Durche inander ze igt. S o
w erden e inze lne S tücke bekannter Werke,z. B. der Hariv améa,
als besondere Puräna gezäh l t, w ie ja auch in den U panisadlisten
eine Maitreyi-Up. v orkomm t, w e l che n i ch ts anderes i st als das
S tü ck Brhad—A ranyaka-Up. 5 . S ogar die Namengebungi st sehr un s i cher . Man che Puräna gehen unter mehreren Titeln :das S aura-P. w ird geradezu Brähmam genannt Dann ersche inenw iederum synonym e, daher i rre führende Beze i chnungen für scheinbar eine und diese lbe S chrift , w ähren d es s ich in Wi rkl i chke itum zw e i v erschiedene hande l t, w ie be im Aditya und S au m-P
w e l che B a r t h “) als i dent is ch ansah
,w äh ren d sie
,obw oh l derse lben
S phäre angehörend de facto ansein anderzuhalten siud3), w en igstensnach dem ,
w as w ir zur ze i t v on ihnen w issen . Die Verhäl tni ssel iegen h ier ähn l i ch w ie in dem F a l le : ‚ Die Braut von Messin aoder die fe ind l ichen Brüder “
,w ie ferner b ei dem Roman Die
Ges chw i ster “ v on Freytag und Ges chw i s ter“ , zw e i Nove l len von
S udermann . Dazu komm t die S chw ierigke i t,daß der Begriff
„Puräua“
ein seh r dehnbarer is t. Im w ei teren S inne be faßt erauch das Mahabharata
,doch s teht d ies j etzt als ein fes tes , sel b
s tändiges Geb äude v or uns ; dann gre i ft er aber über in die Ga ttungder tantra
,v on w e l chen der Sabdakalpadruma besonders un ter den
m it dem Siva'
1'
smu s im Z usamm enhauge stehen den Wörtern e in igeProb en l ie fert . Eine Inventar i s ie rung al les vorhandenen puranaa rtigen Mater ia l s i st daher vor läufig als uudur chführbar anzusehen.
Die j etzige Gestal t der zum Te i l zu mastodontischen Maßenanges chw ol lenen Werke ste l l t das Prob lem
,w e l che Wandlungen
Im Bhau'
wa-Puräna (Bombay 189 4 ) I , adhy . l , 60.
Deux chapitres du Saurepuraua, Mé langes Har lez (Leyde3) Diese A ns icht, w elche ich in der E in le i tung zu meiner S chri ft
„Das
S aurapuränam E in Kompendium spätindischer Kulturgesch ichte und des
Sivai'
smus“
(S traßb . 1908) v ertr at, findet eine S tütze darin , daß das Adi tya-P.
im A cärendu (p. 1 49 der Poonaer Ausg . 1 909) z i tiert w ird und die betreffendeS telle sich im Saure-P . n icht nachw eisen läß t .
Aufgaben der Puränafo rsehnng 309
sie er fahren haben mogen . Da tauchen w en ige künst l er isc h gerundete Geb i l de aus dem chaoti schen F l ießen und Wegen auf.
Nicht einma l die 18 großen,in der Benennung nahezu fest
ges tempe l ten Puräna , w e l c he W i l s o n zu analys ieren begonnenhat
,b i l den in allen Fäl len ein fer tig abges ch lossenes Ganze. Das
S kandapuräna zeigt vor l äu fig überhaupt w eder e inen festen Kernnoch deut l i che Umrisse und s che in t n i chts als ein S amme lbegri fffür sehr v erschiedenart ige Materien zu se in. S ämt l i c he E rgänzungen der b i sher he rausgegeb enen ode r sonst aus Handschriftenund Zitaten näher bekann ten Tei le dü r ften s ic h schw er l i ch beib ringen lassen. Ob es vormal s dennoch e ine Einhe i t geb i l det hat ,w e l che in Trümmer gegangen is t, w äre erst zu untersu chen . Uberdie mann igfachen S ch icksa le des Padmapuräna durch Überarbeitungen l ieße s i ch ein besonderes Kapite l s ch re iben . Es so l le ine Sakunta la-Epi sode entha l ten
,die i ch in der Poonaer Ausgabe
v ergebli c h such e.
S ind a l so die S amm l ungen der Texte vervoll s tänd igt und
gesichtet, sind die e inze lnen S tü cke d urch Auszüge le i chter zugänglich gemacht und i s t mehr Klarhe i t ges chaffen über denWerdegang der Produktion, die s chw ankende Titu latur und das
Ineinaudergre ifen der Ideenkreise, dann w ird auch e ine Konkordanzm ögl ich se in , w e l che fü r die äl teren und n i cht üb ermäßig langen(Visnu Väyu Matsya Märkandeya-P.) verhäl tni smäßig einfach
,
für den Rest der k lassis chen Liste und gar für die Upapuranaund die v ie len sporadischen, manchma l ke inem größeren Ganzene inge fügten Blähätmya w esen tl i ch schw ieriger sein w ird . BesondereBerücks i ch tigung er fordern die epi schen Erzeugnis se in den brahman ischen S iedelungen des h interindischen Archipe l s *) und die
Vgl. J uy n b o l l , Het Oudjavaansche Brahmändapuräna (Bijdragentot de Taal Land-eu Volkenkunde van Ned.
-Indiö‚ce Volgr . , Deel vu ).
Nach einer b rief l ichen M itte i lung des Verfassers v om 8 . X. 19 12 en thäl t dasWerk
,außer dem in der Abhandlung E rwähnten
,noch folgende E rzählungen
Gesch ichte v on Dak5a . S ein Zw ist m it S iva und der S elbstmord der S ati(p. Der Zw ist zw ischen Säkalya und Yajnavalkya (p. Die Namender Mann (p. Nisäda’
s Gebur t aus V ena’s l inkem A rm (p. Die Ge
sch ichte v on Pr thu (p. 58 Die H erabkunft der Gai1gä (p. Die
Gesch ichte v on Dhruva (p. 106 E in anderer Name des BrahmändaP .
scheint Amr ta-Jambudvipa zu sein .
3 1 0 Wi lhelm Jahn
in den Aborigiuerspracheu Dekhans F ur das letztgenannte Geb iet
,auf dem noch w en ig geschehen ist, die Mackenzie-Col lection
gib t e inige Fingerzeige s cheint die Bib l iothek der Bas lerMi s s ionsgese l l schaft vie l Brauchbares zu entha l ten . In die Geb i rgedes S üdens kann si ch manches a l te S ageugut gerettet haben, dessenDub letten im Norden vie l lei ch t den zah l re i chen Invasionen zum
Opfer gefa l len sind .
Die angedeuteten Vorarbe iten w erden endl i ch für Einze lforschungen rei chha lt igeren und schne l ler benutzbarenS toff an die Hand geben, als es augenb l i ck l i ch mögl ich ist
,w o
m it e inem Aufsu chen und Zusammentragen der zu verglei chendenS tü cke begonnen w erden muß
,w as um so langw ierigere Arbei t
verursacht als die Tite l der e inze lnen Werke so gut w ie n i chtsüb er ihren Inha l t verraten . S o sagt uns das S au m-P. b l u tw en igüber die Verehrung des S onnengottes , die m it dem Sivadienst
garn i ch t rech t v erschmolzen und mit ein paar farb losen Be
m erkungen abgetan w ird ; das Brahma 2) und das Bhavisya-Ff
t)
entha l ten vie l mehr darüber. Ich w e iß n i cht, ob Less ing bei
se iner Forderung :„E in Tite l so l l kein Küchenze ttel sein “ dem
indischen Brauche une inges chränkten Beifa l l gezol l t hätte. Bis
zu e iner erfol gre i chen Textkritik einze lne in dische Ausgabenmachen einen bes che idenen Anfang ist es noch ein gutes S tückWeges. Hier könnten die einheim is chen Kommen tatoren guteDiens te le isten
,namen tl ich bei den vie len Dunke l hei ten der Kapi tel
über yoga, tantra und tithi, jedoch w en iger für die phi losophis cheAuffassung
, wo sie gew öhnl i ch ihre e igene Ans i cht in den Texth in ein interpretieren, als vie lmehr für die Rea l ien des Rituale. In
Ermange l ung v on Kommentaren w ir d sich vie l lei cht die Hilfev on Pand its n i ch t entbehren lassen , denn die Mys tik und Symbolikw ird
, j e später, desto phantasti scher und unvers tänd l icher, und fürih re rest lose E rklärung w erden d iejen igen zu be fragen se in, w el chemit d iesen V orste l lungen verw achsen s ind .
Oft genug lassen s i ch schon jetzt Beziehungen der Puräuazu den benachbarten und en tfern teren Gattungen der Poesie be
Deren Originalität Wu rm , Gesch ichte der indischen Relig ion , imUm riß dargestell t (Basel al lerd ings sehr n iedrig e inschätzt .
adhy. 28 fi .
I, adhy. 49
,68
,103, 1 73, 212.
31 2 Wi lhelm Jahn
(Bha irava), w ie sie e inze lnen S ekten e igen ist. Vattula (die Var ian ten unb rauchbar) Vattula-tautra l). Bha irava ist eb en fal l sder Tite l eines tantra Daß die h ier b etrach tete Puranapartiedie tantra bekämpf t, kann n i ch t w undernehmen, denn sl. 1 34 h ,1 35 a sagt S iva :
E kalz sarvaga to hy ätm ä kevalas'
citimätr alcala
A nanda nirmalo n iiya etad vaz'
säm lchyadars'
anam
Hier w ird a l so auf das a l te,noch n i cht sys temat is ierte sankhya
in der Bedeu tung der reinen Erkenn tn i s des atman Bezug genommen . Diese konservative Ha l tung erkl ärt auch den Antagonismus gegen die angeführten Abs chni tt e des Linga-Puräna,w e l ches, w enigs tens in der Legende vom dem
Kürma-P. die‚
materie l le und auch w oh l chrono logische Prior i täteinräumen muß . Der Umstand
,daß in der soeben be trachteten
Polem ik das chrono logische Verhäl tn i s ein umgekeh r tes is t,indem
das Linga v om Kürma-P. v orausgesetzt w ird, obw oh l letzteres ,
w ie gezeigt, sehr a l ten Tradit ionen fo lgt,kann un s leh ren, mit
w e l cher Vors icht Para l le l s te l len vergl i chen w erden müssen .
S ind in d iesen und anderen Bere i chen ech te und w ertvo l leAufzei chnungen b ew ahrt
,so geht anderersei ts auch w ieder die
Erinnerung an ursprüngl i che Konzeptionen d ieses oder jenes Gegenstandes ver loren oder schrumpft ein. Die genea logis chen Listenw erden m it der Ze i t imm er summar isc her und ungenauer ; v er
s ch iedene Partien darin ers cheinen sogar bis zur Unkenntl ichke itverw i sch t. Im S aur apuräna adhy. 30
,29 s ind Yama und Yamuuä
l ichke i t ab er,w ie der Vergle i c h m it äl teren Texten zei gt, die des
S onnengot tes und der S amjüä. Dies i st in meiner Ausgabe zub eri ch tigen
Der großtc Gew inn, w e l chen eine ergieb ige Ausbeute der
Parar_i a vempricht, bes teht in den Grun dlagen für e ine Gesch i chte
der indis chen S ekten , w e l che von besonderer religionsgeschicht
l i cher Bedeutung w äre.
T ay l o r a.
.
a. 0 . p, 330 .
2) Über w el che ich ZDMG 69 und 70 handle.
?7fz‘
und ?7f’
a .
V on
He inr i ch Luder s (Berl in).
In einem demnächst ersche inenden Aufsä tze habe i ch denNachw eis zu füh ren gesu cht, daß das [ des Späteren S anskrit,das n icht auf a l tem l oder r beruht
,aus zerebra lem entstanden
i st,das se inersei ts w iederum auf ein ze reb ra les d zu rü ckgeht . Ich
sehe die Herkun ft des 1 aus_
1 unter anderm als ges ichert an, w ennin a l ten nordind is chen Ins ch r i ften oder Handschri ften die S chre ibung 1 s tatt des später üb l i chen vor l iegt, und es sei gestattet,h ier an e inem w e i teren Be i spie le zu zeigen, w ie sol che S chreibungen für die Etymo logie und se lbst für die In terpretationvedis cher Texte von Bedeutung se in können.
Für ah“
‘Biene ’
verzei c hnen die Petersburger Wörterbücherals früheste Be lege S te l len aus Kälidäsas Raghuvams
'
a . E in so
spät ers che inendes Wort unterl iegt von v orneherein dem Verdachte,
ein Lehnw ort aus den Vo l kssprachen zu se in . In einer Fe l seninschri ft zu Tusara im Panjäb , die aus dem Ende des vierten oderAn fang des fünften Jahrh underts stamm t, w i rd das Wort m it !ges chrieben : J ämbava tinadanär avc'ndoayj itälinä Visnunä (CH . 111
,
Das w e i st auf ein ursprüngl iches *ac
_
li‚das s ich am
natü r l i chsten als e ine Präkritform aus*r dz erk lä rt. Analogien
für den Übergang eines an lautenden r m a b ieten M. AMg. usw .
acchai r cclza ti, Pa l i AMg. ace/za rksa, AMg. aaa m a
C h i l d e r s gib t das Paliw or t als ali (Abh idh . Ich kann
darin der S chreibung in der Inschri ft gegenüber nu r eine falsche S chre ibungsehen . Fii r spricht außerdem das nachher besprochene P. ala . S olangeali im Pal i n icht aus der äl teren Literatur be legt ist , muß es uberhaupt
als au s dem Sanskri t zurückübernommen gelten.
31 4 Heinr ich Lüders
(P is ch e l , Gramm. (1. Prakri t Spt . Dem *
g*di entspri cht
im Griech ischen genau ägözg, das Herodot 1 , 21 5 ; 4 , 8 1 für ‘Pfe i lspi tze’
,Aes chy l us , Prem . 880 für den ‘S tachel’ der Bremse ge
b raucht : oi'
azgov d’
ä'
gdtg xgieo E s kann kaum zw e ife lha ft sein, daß die äl tere Bedeutung des Wortes im Gr iech ischenerha l ten ist. Als Name der Biene kann alz
' verkürztes Kompositum sein , w ie khadya ‘Rhinozeros ’ für älteres khadgam'
säzta s tehtoder sücz
"ka (RV . 1
,1 9 1 , 7 ) auf ein sücz
"muklza oder e ine ähnliche
Bi l dung z ur ückgeht. Ausges ch lossen ist es aber n i ch t,daß *
g‘di
nach e inem bei Tiernamen auch sonst zu beobachtenden Gebrauchedie Biene nac h ihrem charakteris tis chen Körperte i l beze i chnet ;ati w ürde s ich dann zu ägötg verha l ten w ie etw a innerha lb desLate in i s chen barbus ‘Barbe’ zu barba .
Ohne w e i teres i s t nun auch verständ l ich , w arum alz'
nach denind is chen Lex ikographen (Am . 2, 5 , 14 ; Trik . 683 ; Vaij . 1 , 4 , l , 32)auch den S korpion (vyécika , dr u73a) beze ichnen kann . Die Bieneun d der S korpion s ind sehr vers ch iedene Tiere ; der S tachel aberist be iden geme insam
N eben alz'
lehren die Lexikographen auch alin in der Be
deutung ‘Biene ’
(Am . 2, 5 , 29 ; Trik . 7 82 ; Hal. 2, 1 00 ; Vaij .
3,42; Hem . ahh . Med. n 34 ; Sabdärnava bei Ujj val. zu
Un. 4,1 38) und ‘S korpion '
(Trik . 782; Bär . Med. 11
An den me isten S tel len l äßt es s ic h n ic ht en ts che iden , ob der
oder der ira-S tamm vor l iegt. S o l äß t es s i ch z. B.,fa l ls i ch n i chts
übersehen habe, n i ch t fests te llen, ob Kal i dasa alz'
oder alin für‘Biene ’ gebrauchte (Kam . 4 , 1 5 alipaizktilz; Raghuv . 9 , 30 alinir a
patatm'
qzalz; 9 , 4 1 alibhz'
lz; 9 , 44 alikadam baka 9,4 5 alivr ajälr ;
Auf w ei tere Verwandte des Wortes naher einzugehen, muß ich mirh ier v ersagen . S ie l iegen w ahrschein l ich in ved. arddyati , rdüdära , ?
‘düpä,
rdüvidh v or .
2) Ob alt in der Bedeutung ‘berauschendes Getrank’ dasselbe Wort ist,
ist schw er zu entsche iden . U m die nach dem PW. nur im Sabdar. inSKDr . verzeichneten Bedeutungen ‘Krähe ’
und‘Kuckuk ’
b rauchen wir uns,
solange sie n icht besser bezeugt s ind, kaum zu kümmern.
3) Indindir o
’
lt rolambalz; aus alt erschließ t der Kommentar be ideF ormen.
D runa5 cäli ca vräcikalz. Auch Am . 2, 5 , 14 alidxruzt au tu v;récikc,
Vaij . 1 , 4 , l , 32 v_ra
’
cike tv älyalidxrüqtä (so zu lesen) kann natür lich alin v or
liegen . S icher erscheint der ira-S tamm Vaij . 2, 3. 6 , 14 simhakanyätuläl ina‘
m .
3 1 6 Heinrich Lüders
sind l ). Die S chreibung mit l im Pa l i ?) bew e i s t, daß a la auf ada
zurü ckgeh t. Dies ac_
la ist ab er im Mahäbhäsya zu Pan. 8,3,56
tatsäch l i ch be legt ; P atafijali gib t h ier, um zu zeigen,daß das in
der Rege l genann te 85 94 nur das S ub stitut von sah se in dürfe, dieBei spie le sädo dazulalz, sädo vgc
’
cz‘
kalz,‘der S tock
,
“
der S korpion , derm it e inem S ta'chel versehen A da i s t die mit dem Pan ineischen Lau tsystem e, das das l ignoriert , übere instimmende Formdes Wortes und geht offenbar auf *
_
rda zurück w ie all auf *
_
rdi.
Es l iegt w egen des ada nahe, zu denken , daß a li überhaupt auf
a lin beruhe , und in der T at w äre bei einem Lehnw orte aus dem
Prak r i t,w o die S tämme auf -z
'
und —z'
n vie l fach zusammen fal len,
die irrtüm l i che Verw endung als i—S tamm n i ch t unm ögl i ch . Al le ingerade die Übere inst immung mit ägöt g spr i cht doch fü r die U rsprünglichkeit v on all und das Neb eneinanderstehen v on
*7
‘di und
*r da l äß t si ch durch die Annahm e erk l ären
,daß der a-S tamm
zunächst rege l recht als Hin tergl ied des Komposi tum s e intrat “) und
dann w e iter fre i verw en det w erde.
Anstatt all,alin lehren Haläyudha, 3, 23, Mankha, in
der Bedeu tun g ‘S korpion ’
all,Hemacandra
,abh . 1 21 1
,älz
'
n und
ali (äly alib). Diese lben F ormen w erden im Kommentar der Bom
b ayer Ausgabe des Amarakoéa,2,5,1 4
,aus dem Lexikon des
B0pälita und e ines Anonymus Vaij . 1 , 4 , l , 32 nenntali(n) neben Es ist kaum anzunehmen
,daß d ieses all,
älin n i ch t auf dem a l teren a ll,
alin in der glei chen Bedeutungb eruhen so l l te . Re in mechan is che Dehnung des Anlau ts i st m irunw ahrsche in l i ch ; i ch mö chte eher annehm en
,daß sie in An lehnung
In a l terer Ze i t hat man aber die S cheren als Horner des Tieresaufgefaß t. E s ist charakterist isch
,daß in den Gäthäs der Jat . (267 , 1 ;
389,1) der Krebs smgi genannt w i rd , während der Kommentar v on alas spricht.2
) B iswe i len schre ib en die Handschri f t en“
auch ala .
3) A la und ada hat schon Wa ck e r n ag e l
,Altind. Gr. I , p.
zusammengeste l l t .W a ck e rn a g e l , a. a. 0 . I I ‘
, p. 1 18f.
Z i tiert, mit einem Belege, v on Mahendra zu Bern . an. 2, 464.
A lih älilt‚ v:r éciko drum älih syäd iti B0pälltah äli | athäli syäd
vr écz'
ke bhr amar e pumän iti koéäntar am .
7) S iehe oben p. 314 Anm . 4 . E benso kann Bär . 220 ; Var]. 2, 3,älin v orl iegen . Auch sonst ist eine E ntsche idung über die genaue F orm des
Wortes oft n icht m ög l ich “
; Süryasiddh . 12,66 dhamwmwälz
'
kumbhegu kann
all,alln
,alt oder älin enthalten .
A li und A lu 3 1 7
an dla erfo l gt das nach dem PW. be i S uéru ta 2,25 7 ; 29 6 ;
29 7 b e legt is t. An den beid en letzten S te l len spr i ch t S uéru tavon e iner gew is sen Spinnenart, die er alu.vi„<a nennt : älam ülra viea ;j äyan te lü/néogaé ca (lä/raé A n der ers ten S te l le leh rter , daß der S korpion , der Vis' vambhara (S korpionenart), de r lläjivafi s ch , der U ccitihga (Kreb sa rt) und die S eeskorpione ih r G i ft imäla haben : vräcil‘
a r iévamb/zar aräj lvama lsyocci_tl7lgälr
c«Tla r isä'
h . Li egt auch h ier w i rkl i ch älac i,säb vor und i s t cälav zkälan i cht etw a e infach in ca a la t=isälz zu so dürfte es das
Wah rs chein l ich ste sein, daß ala e ine Ab le i tung v on a la , a (_
la i s tals ‘die aus dem ala s tammende auch der Räjivamag i rgende in als ala beze i chne tes O rgan haben , das e ine Fl üssigkei t absondert , und mit den älaz*igä - Spinnen i st vie l lei cht e inek le inere S korpionenart gemeint, die den Spinnen ähne l t . Andererse i ts i st abe r auch die Annahme e ines u rsprüngl ichen ala ‘Ausfluß
,S ch le im“
) du rchaus n i cht unmögl i ch ; das Wort könn te dann,
w ie L i d en,S tud . 3 1 geze igt hat
,mit v ed. r/isa
' verbunden w e rden .
Nun gib t es aber auch ein äla,das nach den Lexikographen
(Am . 2, 9 , 103 ; Vaij . 1 , 3, 2, 1 4 ; Bern . abh . 1 059 ; an . 2,4 63 ;
vgl. au ch Bhävaprak. 1,
den ge lben Arsenik, Auripigment,b ezei chnet . Be l egt ist es in Verb indung m it m a
-
nahs'
z'
lä bei S uéruta
(siehe PW .) und oft,m it verdeutlicheudem Zusä tze , als haritäla
im Mbb . und in der k lass is chen Literatur *)l Mit diesem ala l äßtIch hal te es für sehr w ahrschein l ich
,daß äli, älln
‘Skorpion ’e ine
künstl iche Neub i ldung ist . die der Abs icht entsprungen ist , das Wort v ona ll
,all-n ‘Biene ’
zu differenz ieren . Man beachte , daß Haläyudha , Mairkha und
Hemacandra, die alt,älln
‘Skorpion ’ lehren
,all
,alla in dieser Bedeutung
n icht v erze ichnen W as das PW . für äll in der Bedeutung ‘B iene ’
anführt,ist so unsicher , daß es s ich n icht v erloh u t
,darauf e inzugehen .
Der Zusamm enhang läß t n icht erkennen , ob ala oder äla v orl iegt,
da unter den der t i erischen Gifte sow ohl Korperteile w ie darn,s
_
trä,
-nakha
,als auch Aussche idungen w ie mütr c
'
z, purt ,9a v orkomm en . Die F rage
w ird dadurch noch kompl iz ierter, daß S uSruta in der Aufzählung der 16 adhl
athänas w eder ala noch äla erwähnt . Ka v i r a j K u n j a L a l gibt ala in seinerÜbersetzung durch ‘sal iv a’
w ieder, als ob lälä dastände , v iel le icht m it Rücks icht auf Bhävaprak. 2, 4 , 1 55 , w o aber lälä als adhi
_
s_
thän a des Giftes nur
für den U cc it ika U cc it iüga) usw . gelehrt w ird.
3
) Die Bedeutung ‘Laich ’
,die im
“
PW . offenbar w egen des Räjiva angesetzt is t , ers chein t m ir n icht gerechtfert igt .
Der Kommentar zu Am .2,9,103 in der Bombayer Ausgabe fuhrt
das Zeugn is e ines Mädhava für die F orm ala an,die s ich auch Bäjanigh . 1 3
,65
3 1 8 Hein r ich Lüders
si ch äla ‘Ausfiuß’ s chon der Bedeutung nach n i ch t vereinigen ;
sol l te s ich die Ab le i tung des äla ‘Ausfluß’
von a c_
ia b estätigen , sos ind die Worte auch lau tl i ch erst im Laufe der Ze i t zusammengefa l len, denn ala ‘Arsen ik ’
hat a l tes l. E s ist kaum zu bezw e i fe ln
,daß das Wort für ‘Ar sen ik ’
in RV . 6 , 7 5 , 1 5 vor l iegt,w o der Pfe il das Beiw ort a
'
läktä e rhäl t. Sayana erk l ärt dasWort älena vl,seqzäktä, und m an hat danach ala h ier mei st als Giftgedeutet. E s l iegt aber kein Grund vor, w arum äla
,w enn es im
späteren S anskri t e ine bestimm te gi ft ige S u bstanz bezei chnet, diese lbe Bedeu tung n i ch t auch schon im Veda haben sol l te, und i chha l te daher die Übersetzung ‘mit Arsen ik b es tri chen’
,die G e ldn e r
in seinem Glossar gibt,für
A la ‘Arsen ik’ l iegt meines Erachtens aber noch in e inerandern S te l le des Veda v or
, ohne b i sher ri chtig erkann t zu sein,näm l i ch in AV. 5 , 22, 6
ta’
kman vycila v l gada vydizga bhüm'
yävaya
daszm nista'
kvarim iccha täm vdj rena sam arpaya
Bloomfield2) hat die Worte vyala vl gada vyc‘
mga unübersetztge lassen ; Whitney sagt von se iner Übersetzung der ers ten Ze ile,sie sei nur mechan is ch , da Emendationen unbefr iedigend se ien.
Mir s cheinen die S chw ier igke i ten doch n i cht so unüberwind l i chzu se in . Vyäla hat man b isher fas t a l l geme in mit dem vyäla des
epis chen und klass is chen S anskri t “) i den tifiziert, und danach ent
w eder durch ‘tück isch ’
(PW . ,Gri l l
,Hi l lebrandt
,Whitney) oder
findet. S ie beruht w ohl ebenso auf fa lscher Zerlegung v on hurttala w ie das
v on den Lexikographen (Sä8v . 7 76 ; Am . 2, 9 , 1 03 ; Trik. 948 ; Vaij . 1 , 3, 2, 14 ;Hem . abh . 1059 ; an . 2
, 480 ; Med. 1 2ai. ; auch Bhävaprak.1,1,263 ;
Räjanigh . ge lehrte täla , neben dem in Bhäv aprak . Räjanigh . auchtalaka erscheint ; vgl. G a rb e , Ind. Min. p. 48 .
Man w ird n icht dagegen einw enden dür fen , daß nach AV. 4 , 6 das
Gift , mit dem der Pfei l bestrichen w ir d, ofi enbar ein Pfianzengift ist , da es
in V. 8 og;adhe angeredet w ird . Warum soll te man n icht m ineralische und
v egetab i lische Gi ft e nebeneinander v erw endet haben ? Von mineralischenGiften (dhatu visa) kenn t aber Suéruta 2
, 252 nur phenäémabhasman und
har itäla .
Fu r die genaueren Li teratur angaben v erw eise ich auf Wh i tn ey ,
A tharva-Veda Samhitä p. 259 .
In der vedischen Li teratur komm t das Wort nach dem PW. sonstn icht v or .
3 20 Heinrich Lüders
Kle ines in se inem S chw anze (pücche bibhar ,sy arbhakcim ver
w undet m it Mund und S chw anz , hat aber das Gift nur in se inemS chw anzb ehälter (yet ubha
"
bhyäm pr ahcim sz'
pu'
cchena cäsyena ca läsyé nd te vi,3dmkim u te pu cc/eadhci u asa t Deutl i cher
,s che int m ir ,
kann doch der S korpion n i cht besch r ieb en w erden Dazu komm t,daß sow oh l die Anukramani als auchKeéava (w
°écékabkaisajyam u cya te) das Lied auf den S korpion be
ziehen . An dere S tel len , w o vyar'
zga oder anaizga Be iw ort oderName der S ch lange w äre, gib t es n icht ; vyahga bedeutet v ie lmehr im S k. für gew öhn l i ch ‘
e ines Gl iedes en tbehrend , verkrüppe l t ’ ,w as als Be iw ort fü r den T akman n i cht paßt.
Daneben g ibt es ab er ein ganz anderes vy aizga , das das PW.
aus S uéruta und Särhgadharas. in der Bedeutung ‘F lecken im
aus dem Hariv . in der Bedeutung ‘Fleck, S chandfleck’
be legt. Das Wort muß aber auch e inma l die Bedeutung ‘fleckig’
gehab t haben . Wenn nach den Lexikographen (Trik . 1 68 ; Vaij. 1 ,4,1,4 7 ; Hem . abh . 1 354 ; an . 2 4 7 ; Med. g 24) vyariga der
‚F ros ch ’ is t
, so hat er si cherl i ch d iesen Namen als der ‘fleckige’
;
s chon in dem F roschliede RV . 7,1 03 w i rd der pfénz
'
neben dem
ha’
rita erw ähn t. Das PW. hat daher meines Erach tens mit vol lemRechte au ch in dem Verse des AV. für vyä7
'
zga die Bedeu tung‘fleckig
’
angesetzt. Natü r l i ch erk l ärt s ich das Be iw ort aus den
Krankhei tssymptom en . Wenn Bloomfield das mit einem non
l iquet ab lehnt, so mochte i ch demgegenu her darauf h inw eisen,daß der T akman in V . 3 pam ,sa
’
la päm ,seya'
lz heißt und daß Bloomfield
s e lbs t das m it ‘fleckig, m it° F lecken b ede ck t’ w iedergib t. E ty
m ologisch ist vyähga natürl i ch ein Bahuvrih i aus*a7
'
zga‘Fl eck ’
(zu afzj ) und dem Präverb vz’
in der Bedeutung ‘nach vers ch iedenen
S eiten gehend, s i ch ausbre i tend ’
,die in der a l teren Sprache die
gew öhn l i che i st 3) . Ebenso ist vipar ulz in AV . 7,56
,4 als Beiw ort
A uch die W orte in V .7 vi v
_récan ti m ayüryälz sche inen m ir e ine
Anspie lung auf den gew öhn l ichen Namen des Skorpions , v _récika
,zu en thal ten .
Pfauenfedern w erden auch später als M ittel gegen S korpionenbisse v erw endet ;s iehe S n9r uta 2, 294 . Für die Deutung auf den Skorpion hat s ich übrigensschon Grill 1 1
, p. 185,ausgesprochen, der trotzdem p. 1 56 vyähga fiir das
Beiw ort e iner S chlange erk lärt .2) Auch Vaij . 1 , 4 , 4 , 125.
Vgl. W a ck e r n ag e l , A ltind. Gr . IP , p. 285 . E rst allmahlich hat
s ich daraus die Bedeutung ‘fehlend’entw ickel t, die spater fast ausschließ
A li und A lu 321
des S korpions ‘m it Ge lenken auf a l len S e i ten ’
,und das legt es
nahe , das danebenstehende vyäizgab in diesem F a l l e als ‘m it
Gl iede rn auf a l len S e i ten ’
au fzufassen,w enn au ch die Bedeutung
‘m it F lecken bedeckt ’ auch h ier n i ch t ausges ch lossen i st .Die Bedeutung, die vi in vyäfiga hat
,muß es auch in dem
o ffenbar paral le len vyäla haben ; d ie s muß a l so ‘auf a l len S eiten
mit Arsen ik bes treut ’ bedeu ten . Das Beiw ort m ag zunächst se l tsam ersche inen. Aber ganz ähn l i ch w ird der T akman in V. 3
a vadlzva -m sa’
iuär zq zdlz genann t, ‘rot w ie S treupu lver ’ oder ‘
w ie
rotes S treupu l ver ’ , w as dem S inne nach jeden fa l l s so vie l i st w ie‘gle i chsam mit rotem Pul ver bestreut ’ . Zw e i tens aber ist es für
den T akman cha rakteris tis ch,daß er den K ranken gelb macht
(aydrgz yö viévän hdr itä'
n kgvzösi 2; aya'
m yo'
abhiéocayi,szzzir vis'
vä rüpäv i
hér ita /sm o,si AV . 6 , 20, AV. 1 , 25 , 2 ; 3 w i rd er als ‘Gott desGelben’
angeredet . Daß der ham'
tasya deva mit har itäla bedeck tist
,ist a l so n i cht
l ich herrscht, im RV . aber noch sehr se l ten ist . E s gib t im RV . e igentl ichnur ein Wort
,in dem vi vol lkommen einem a entspricht, vyéna s in 8, 33, 13 .
Dieser Geb rauch von vi v ers tärkt den schon durch das Metrum und die
Dualformen auf -c u v or Konsonant erweckten E indruck. daß die S trophespäter hinzugefügt ist (vgl. O l d e n b e r g , Ri gv eda I, Den Bedeutungs
übergang lassen W endungen erkennen w ie 10 , 78 , 7 däsam kn wändbvimäyam ,
‘den Däsa zu e inem m achend, dessen Zaubermacht nach v ersch iedenenS e iten auseinandergeht, zers tieb t ’ . Im Banne der späteren Bedeutung v on
v i hat man derart ige Kompos i ta im Veda v ie lfach falsch aufgefaß t ; so ist
z . B. in l . 1 87 , 1 vg öj asa-v
_
r trcir_n viparv am ardäyat, vipar vam s icherl ich
ke in leeres Beiw ort ‘
gelenklos‘. E s ist v ie lmeh r zu übersetzen : ‘
er durchstießden V r tra
,so daß die G elenke (oder S tücke) auseinandergingen ’
; vgl. 8 , 6 ,
13 vi vrträa_n parvaéö m jdn 8,7,23 vi vfl r cim parvasö yayu la.
1) Der A usdruck vyäla w ürde v iel le icht noch v erständl icher w erden ,
w enn w ir annehmen durften, daß schon in v edischer Zei t der gelbe A rsenikals Schm inke oder Puder v erw ende t wurde. Später gesch ieht das jedenfal ls .
Besonders S chauspie ler geb rauchen ihn , so daß natasa1_nj ii aka (T rik.
n a tumapdana (Hem . abh . Räjanigh . 13,
na tabhüsazza (Vaij . l , 3,2,13 ; Mädhava im Komm . zu Am .
2,9,1 03) geradezu Synonym s. v on
har itäla sind. Aber auch der Ti laka des Bräut i gams bestand für gew öhn l ichaus gelbem A rsenik, w ie R um . 7 , 33 zeigt
,w ährend der Hochzeitst ilaka
(vivähadikgätilaka) für die Braut v on der Mutter aus feuchtem glückb ringendengelben und aus rotem A rsen ik hergeste l l t w i rd (har itälam ärdr am mähgalyam
ädäya m ana laéilär‚n ca , ebd. E inen T i laka aus ro tem A rsen ik machte
e inst Räma der S i ta (Räm . 2, 95 prak . ,5,40
,5 ; 65 , Ich möchte
Fes tsch r ift Kuh n . 21
322 Heinrich Lüders
Die Auffassung v on vyä'
la und vyanya is t auch für die E rklarung von vi gada bestimmend . Der Imperat iv ‘spri ch
'heraus ’(Ludw i g, Gri ffi th , Whitney in der Übersetzung) ist vo l l kommen
Whitney hat daher schon in seinem Index verborum
vorges ch lagen, v igada zu l esen. Das i st im Grunde gar keineTextänderung, sondern nur e ine Ber i chtigung des Padapätha, und
i ch hege ke inen Zw ei fe l , daß Whitney sow e i t das Richtige getrofien hat. Whitney hat aber w e i ter das Wort zu gad ‘sprechen ’
ges te l l t, und Gri l l und Hilleb rand t s ind ihm ge fol gt und habenvigada durch ‘stumm ’
bzw .
‘w ort sprach los ’ übersetzt. Warum
der T akman so genann t se in so l l te, b leib t vö l l igEbensow en ig kann i ch Bloomfields Ve rm utung glück l ic h finden,daß v igada
‘chatterer ’ sei m it Bezug auf das De l i r i um des
Kranken . Ich ha l te das s chon desw egen fur unmögl i ch,w e il
w eder gad noch vigad j ema l s ‘
plappern ’
bedeuten Weber übe rsetzt vigada
‘beulen loser’
,w as w oh l ein D ruckfeh le r fü r ‘keu len
lose r’ (v on gadä) is t. Warum der T akman so genann t se in so l l te,dürfte schw er zu sagen se in. Vigada kann meines Erachtens nurgada
‘Krankh e i t ’ en thal ten . F ür ausges ch lossen ha l te i ch aber,
daß es‘fre i von Kr ankhe i t’ bedeuten und euphem is tis che Anrede
an den Krankheitsdämon se in könn te,
w ie Bloomfield w e iterverm utet. Vi muß h ier natürl i ch w ieder d iese lbe Bedeutunghaben w ie in vyäla und vyähga ; v igada ist a l so gerade umgekeh rt‘m it Krankhei ten auf a l len S eiten’
. Wiederum b iete t V. 3 einePara l le le ; w ie dem vyc
‘
w'
zga pam ,sa’
lzpäm ,seydlv, dem vyäla avadhvamsci
ivä'
ruzzdlv, so entspri cht dem v igoda dort viévadlzäv izya . Daß man
es n icht für unw ah rschein l ich hal ten , daß w ir un s un ter dem roten avadhvamsa
roten Arsen ik,m analvéilä, zu denken haben ; vgl. auch RV . 2
,34
,13 arw
,zébhir
näfijibhilz; 10 , 95 , 6 afijäyo’ruquiyo mi .
1) Gri l l hat seine Konj ektur v i gadha in der zwe iten Auflage selbst
zurückgenommen ,so daß es sich erüb rigt, darauf einzugehen .
2) Dazu komm t. daß es sehr zweife lhaft ist,ob es überhaupt je ein
gada‘Sprache’ gegeben hat . Ävijfiätagadä in AV .
12, 4 , 1 6 hat schon
Leumann, E t . W örterb . p,81
,richt ig als ‘fre i v on Krankhei t’ erklär t. Gadaih
in Mbh . l,43, 22 erklärt Ni lakantha durch daméasthäne kawrezw tkim e ma rdyw
mänair ausadhaviée_sailv; höchstens könnte es
‘S pruch ’
bedeuten . In der
Rämat äp. U p. (W eber, p. 350) erscheint ein gadä, das ‘Spruch ’
zu bedeutenscheint.
3) Gadgada bew e ist selbstverstandlich n ichts fur das n icht redupli
z ierte gad.
324 Heinrich Lüders
s chon durch äpr aj ästvdm ausgedrückt ist. Im kle ineren PW. w i rddenn au ch gerade umgekehrt ‘Empfängn is ’ als Bedeutung angesetzt,augens chein l ich unter der Annahm e,
‘
daß nyheim als Adjektiv m itävaycim zu verb inden Dem w i derspr i cht die Lesung der Ze i lein Hir. Grhyas. l
,1 9
,7 ; Ap. Man trap. 4
,1 1 : apm j astäm
pau tfamg*tyuz_n päpmänam u ta vägham ; Sämamantrab r . l
,1,14
apr aj asyam pau tram ar tyam päpmänam u la vd“
agham . Die Fassungbew e i s t, daß aghdm n i cht zu ävaydm gehört ; ävayoi-m muß vie lmehrein besonderes Übe l se in. Nun wird in der medizini s chen Literaturävi von den Geburtsw ehen geb rau cht (Caraka, Särirasth . 8
,82 avi
prädurbhäve ; 83 äv ibhih samklis'
yamänä ; 88 anäga tävi S uéruta
l , 27 9 ävinäm pr anäs'
alt ; 368 apräptävi Geburtsw ehen'
w ürde als
Bedeu tung für c7vayci in AV. 8, 6 , 26 vorzügl i ch passen ; forme l lw ürde s i ch ävi zu ävayci verha l ten w ie e tw a v ed. pr am
" zu k lass .pr aqzaya . In unsere r S te l le kann es s ich natü r l i ch n i cht Spezie l lum Geburtsw ehen hande ln ; ävayci muß te h ier e ine a l l gemeinereBedeu tung haben , “
und d iese l iegt für das en tsprechen de ävi in
der ved is chen Literatur tatsäch l i ch vor : Kath . 30, 9 ävya1_n vä etais
te’
pa7°
aya1izs tad apävyänäm apävya tv am ci vyam ev az'
taz'
r apaj aya ti ,‘
Ta i tt. S . 2, 2, 6 , 3 ävyä7_n vä'
e,sfi prdtigghzzc'
i li yo' ’
vim pr a tigy*hnä
’
li
nävyäm preitigy/cqväti ya’
u blzayädat pratig_
r lm ätz Tai tt . S . 3 ,
2, 9 , 4 ya
'
d vai lvo'
tädhvaryzim abhyä/wciya ta ävyäm asm in dadhätz'
idd ycin m i apahdnita purä'
sya sctmva tsarä'
d g;rhci ä'
veviran . Sayana
erkl ärt an der letzten S te l le d“
oyo li (s ic) für e ine bestimm te Krankhe i t ävevir an durch sam arogädibhz
'
lz pidyer an . S e ineErklä rung erw eckt n i cht gerade den Eindruck , daß sie aufw irk l i ch erKenntn is beruhe ; w ir w erden kaum feh lgehen , w enn w ir für ävz“ ' indiesen S te l len die a l l gem e ine Bedeutung ‘Weh , S chmerz’ ansetzen
,
w ie es im PW . Nehmen w ir d iese lbe Bedeu tung für
1) Außerdem hat dazu w ohl die angeb l iche Bedeutung v on ävayns
beigetragen, das in AV .
7,90 , 3 erscheint : ycithä éépo apäyätai stri ‚
s ie cäsad
dnävayälz. A nävayälz übersetzt das größere PW . mit‘n icht w eichend‚ n icht
a blassend’
,das kle inere m it ‘ke ine E mpfängn is zustande bringend’
,Henry
m it ‘inoffens ive’
,Wh i tney mit ‘impotent’ . Säyana etym ologisiert . Mir sche int
,
daß ävayas garn ichts m it ävagd zu tun hat , sondern Synonym v on r etas ist .
Naigh . l , 12 w ird civayälz unter den udakanämän i aufgeführt ; in derse lbenL iste steh t auch r étalz.
Vgl . auch G e ldn e r , Ved. S tud. 246, Anm . 1 .
A li und A lu 325
a vay< i in u nserer S te l le an,so ergib t s i ch , daß begriffl i ch bh iir i«
y(i r aya dem va'
gada en tspri cht w ie vydriga dem vy(ila , e ine gew ißn i cht unbeabs ichtigte Pa ra l le l i tät des Ausd rucks . I ch übe rsetzedemnach die Ze i le : ‘
0 T akman , der du m it Ar sen ik bes treu t b is t,von Krankhe i ten umgeben , m it Flecken bedeckt, vie l S chmerzenberei test ’
1) A la schein t auch ein Pfisnzenname zu se in . Kaué . 25
,1 8 w i rd gegen
Harn v erha ltung und Verstopfung ein Infusum vorgeschr ieben ,das un ter
anderm äla entha l t . Därila bemerkt dazu : äla yn godhümavyädhilz Keseveerklärt die durch yavagodhümavalli . AV . 6 , 16 4 besteht aus den z iem l ichrätse lhaften Worten alasäläs i prir vä silä-fijöläsy u ttarä nüägalasälä. Säyar_ra
erk lärt ala sälä,éaläfijälä (sie) und n ilägalasälä als die Namen von dre i
sasyw*alli (sasyamafaj ari). Kant , 51 , 15 schre ib t die Verw endung der S trophe
be im älabhc,saj a (aber Say, annabhesaja-m) v or
,w obe i man dre i Spi tzen v on
siü fijäla (sie) in der M itte des F e ldes eingräb t ; Keé . nennt die dre i sasyavalli .Die v orausgehende S trophe schl ießt äpehi n ir äla . Say. l i est n iräla und
sagt, es sei die Krankhei t d ieses Namens . Das Wort ist aber kaum von dem
am der S trophe 4 zu t rennen ; vgl. B l oom f i e l d , SBE 42,465 f. R ené . 35
,
28 endl ich w i rd für e inen Liebeszauber ein Pfe i l v orgeschrieben , dessen
Spi tze ein Dorn ist , der mit E ulenfedem versehen ist und dessen S chaftasitäla ist (asitälakändayä) . B l o om f i e l d ,
Kaué. p. XLVI und C a lan d ,
A ltind. Z aub . p. 1 19 sehen in asitäla w iederum e inen Pflanzennamen,aber
Därila erklärt : asitm‚n Ice alam kändam (MS . känu 7_ n) yasyäb. sä.
Würde es n icht ganz g ut zu dem übrigen passen, w enn an den S chaft desPfei les der S tache l e ines schw arzen Skorpions gesteckt ware ? W ie s ich derPflan zenname zu den oben besprochenen Worten v erhäl t , v ermag ich
nicht zu sagen. Giftig kann die Pflanze kaum gewesen sein,wie ich in
Hinb l ick auf RV . 6 , 7 5 , 1 5 bem erken m öchte,da nach Kane. 25
,18 der
Kranke die Ä labruhe t rinken muß.
Lehrsatze des dualistischen Vedanta
(Madhvas Tattvasamkhyana) .Übersetzt und erklärt v on
Helm uth v. Glasenapp (Berl in) .
Der Visnuismus hat vier Sys teme hervorgebracht, w el che einevon Samkaras Adva ita-mata durchaus abw e i chende Form des
Vedanta lehr en ; näm l i ch 1 . den Sri-sampradäya des Rämänuja
(Viéistädvaita-mata) , 2. den Brahma-sampradäya des Madhva(Dva ita-mata), 3. den Rudra-sampradäya des Visnusvämin und
Vallabha (Suddhädvaita-mata) und 4 . den S anakädi-sampradäya
des Nimbärka (Dvaitädvaita-mata). Von d iesen hat bi sher nur
das System Rämänujas in Europa Beachtung gefun den, w ährenddie an deren trotz ihrer Bedeutung für die Gesch ichte der indis chenRe l ig ionen und der n i cht zu unterschätzenden Zah l ihrer Bekenner nur w en ig bekann t gew orden sind . Es dü rfte daher n i chtüb erflüssig se in, w enn im fo l genden an der Hand e iner kurzenS chr ift Madhvas e ine gedrängte Übers i cht uber e in ige Hauptpunkteder Dvaitaleh re gegeben w ird .
Madhva (mit se inen anderen Namen A nandatir tha oder F irma
pra1na) w urde nach der w ahrschein l i chsten Ans ich t im Sakajahr 1 1 21(A . D . 1 1 99) geboren . Er w urde frühzei t ig Asket, zog predigendim Lande umher und starb im Sakaj ahre 1 1 98 , nachdem er nochvor seinem Tode se inen S chü ler Padmanäbhatirtba zu se inemNachfolger ernann t hatte S e ine Z w eiheitslehre“ s te l l t e ineVerqu ickun g der in den Upanisads und den Brahmasütr en ent
haltenen Vedäutagedanken (die er a l lerd ings für seine Zw ecke1) R . G . B h an dar k ar , „
Vai s_
mav ism ,Saiv ism and m inor religious
systems“
(Grundriß d. indo-ar . Ph i lo l . u . A l te rtumskunde, Bd. III, Heft 6)p. 58 5 .
328 Helmuth v . G lasenapp
Up. 6 , 8, 7 sa ätm ä, ta t tvam asi “ (das b i st du) ist ri ch tiger„sa ätmä a ia t ivum asi “ (das b ist du n i ch t) zu lesen .
bhäväbhävau dvidhe ‘tar a t. | 1 .
Da s a n d e r e [d. h . da s H e te r o n om e] i s t z w e i f a c h : S e i nu n d N i c h t s e i n .
präkpradhvar_nsusadätvena tr ivz'
dho’
bhäva isya te.
Da s N i c h t s e i n is t d r e i f a c h : pr i o r e s , po s t e r i o r e s u nd
ew i g e s N i c h t s e i n.
Madhvasiddh . 4 7 kennt vier Arten des abhäva , nam l i ch „präg
abhäv ah pradhvarm äbhävo’
nyonyäb/zävo’
tyantäbhävaé ca“
. Die’
l_
‘
ikä
unseres Textes läßt jedoch nur die dre i genannten als abhäva
gelten und sagt : „anyonyäbhävo hi blwda eva
,sa ca svarüpam eva
“.
(Geme int i st'
vastusm rüpa, vgl . Nyäyakoéa s. v . Anyonyäbhäva
„anyonyäbhävo vaetusm rüp«z eva , na tu p_
r thag iti madhväcäryänu
yäyina
ceta näcetanat vena bhava’
pi dvividho m a tc h “2
Da s S e in is t zw e i fa c h : g e i s t i g u n d u n g e i s t i g.
dulvkhaspr,s_
targz tadasp_r ,stam iti dvedhaz
' ’
va cetanazgz.
Da s G e i s t i g e i s t zw e i f a c h : zum L e i d in Be z i e h u n g s t e h en du n d v o n d i e s em u n b e r ü h r t.
Gott i st natürl i ch vom Le i d unberührt, w e i l er autonom ist.
Hier w ir d nur von heteronomen Wesen gesprochen .
nityädulvkhä R amä'
,
’
nye tu sprstadul_zkhäb samastas'
ah. | 3
Ew i g e
o h n e L e i d i s t L a k sm i . A l le a n de r en (W e s e n) s i ndi n s g e s am t v om L e i d b e r ü h r t.
Laksmi ist die Gattin Vienna, sie i st ihm in Raum und Ze itkonkom itant (Br . Sutra IV
,2,
hat keinen mater ie llen Körperund n immt (als S i ta, Rukmini usw .) mannigfache Gestalten an.
S ie ist von Gott vers ch ieden und ihm untertan, w enn sie auchdadurch über a l len andern Wesen steh t, daß sie ew ig er l öst ist.
Alle anderen Wesen s ind vom Le id berührt und haben e inenvergänglichen Le ib . Das gilt sow ohl für Brahman und S i va, als
au ch für Garuda, Ananta und Viévaksena, w el ch letzteren ein igeVaisnavas e in e Ausnahmeste l lung einräumen .
spra_tadu äkhä vimulctäé ca du]zkhasamsthä iti dvidhä
De r zu m L e i d in B e z i e h u n g s t e h e n d en W e s e n s i n d zw e i
A r t en : im L e i d b e f i n d l i c h e u n d e r lö s t e.
L eh rsatze des dual istischen Vedänta (Madhv as T at tv asam khyäna) 329
Kommentar : „caéabdo dulck/mt amst/cä ity a ta l:par amyojyah
“.
dit/ak/i asums ilzä m uktiyogyä'
ayogyä iti ca dvidhä | 4 .
De r im L e i d Be f i n d l i c h e n s i n d z w e i A r t e n : e r lös u ngs
f ä h i g e u nd n i c h t e r lös u ngs fäh ige .
devar sz'
pitg-
ptm arä iti m ulrtäs tu podcatevam v im uktiyogyäé ca .
De r E r lo s t en s i n d f ü n f A r t e n : G ö t t e r , Rei s , Man e n ,W e l t
b e h e r r s c h e r u nd h ö c h s t e M e n s c h e n. E b e n d i e s e s i n da u c h e r lösu ngsfäh ig.
Madhvasiddh . 80 gibt als Be i spiel e : Brahman und Väyu
(Gotter), Narada (Rai) , Raghu und Ambaries (Weltbeherrscher) . Die
hö chsten Menschen (u ttamam anu_
sya) s in d entw eder ekaguzzo;fi salras,
d . h . sie m ed i t ie ren über Visnu als Gott an s i ch , oder caturgu
uopäsakas , d . h . sie betrachten ihn unter den v ier Aspekten S at,Cit
,Ananda und Atman. Angehörige der dre i obersten Kas ten
können erl ös t w erden , auch F rauen (Br . S . 1,1,1 Komm ) , jedoch
n ich t Südras. Auch Gandharv en und Apsarasen konnen erlösungs
fähig se in .
‘ Die Erlö sten erfreuen s ic h in Vienna Nähe ew igerS e l igke i t und kehren n iemal s w ieder in den S arasära zurück(Br . S . IV
,4,1
tamogälc ar tisams thitäh 5
iti dvidhä muktyayogyäh .
Die Ni ch t e r lös u ngsfäh ige n s i n d v on zw e i e r l e i A r t : f ü rdie F i n s t e r n i s g e e i g n e t u n d ew i g im S amsar a b e f i n d l i c h .
daityar aksalvpiéäcakäh
m ar tyädhamäé ca tard/zaz v a tamoyogyälz pr akir titälz 6
F ü r die F i n s t e r n i s g e e i gn e t s i n d v i e r (A r t e n v o n W e s en)Da ity a s , R äkea sa 3 , P i sac a s u n d n i e d r i g s t e Men s c h e n .
te ca präptänd/za tamaß ah sräsazrwtlzä iti d0’idhä'
D i e s e s i n d zw e i f a c h : s o l c h e , di e b e r e i t s in die du n k l eF i n s t e r n i s e i n g e g an g en s i n d , u nd s o lc h e
,die n o c h im
S ams a r a w a n d e l n.
Aus den Kommentar zu Br . S . III,1,14 — 23 ergib t s ich
,
daß unter „Finstern i s “ (tam as) und „dunkler Finstern is “ (andha
tam as) die untersten Höllenregionen zu vers tehen sind , aus denender Verdammte n i ch t w ieder empors teigen kann.
330 Helmuth v . G lasenapp
nityäm'
tyav ibhägena tn'
dhaivä’
cetan am m azar_n . 7 .
D a s U n ge is t ige i s t d r e i f a c h : ew i g , z e i t l i c h - ew i g u n d
v e r gän fl i ch .
m'
tyc7. v edälz,E w i g s i n d die V e d e n.
Die Vedeu s in d ew ig, w e i l sie unveranderlich s ind, sei t undin Ew igkei t bes tehen .
puränädyäh kälalz pralc_rtir eva ca
nityänityam tr id/zä pr 0ktam .
Z e i t l i c h - ew i g s i n d die P u r än a s u nd die an d e r e n [v onMe n s c h en v e r f a ß t en W e r k e], die Z e i t u n d pr akrt i.
„a na sar vathä kütast/zam nä’
py anityam eva,tad u cya te nityä
n ityar_n“
(Komm Die Purai_n a
‚die Zei t und die Materie sind
a l so „ eterna l prin c iples w i th modified or changing aspects “ (S .
S ubba Rau) .am
'
tyam dvividham m atar_n 8
asamsrstam ca
Da s V e r g ä n g l i c h e i s t zw e i f a c h : n i c h t k om b i n i e r t u n d
k om b i n i e r t .sa7psygs_
ti ist Verb indung , Mi schung (vgl . A lamkärasarv asvaed. Kävyamälä, p. 1 92 : „
esä'
7,n tila tazzdulargäyena m is
'
r a tvam
asa 7_nsr ,stam m ahän
,aham
,
buddhir,m anah
,Ä'hä71i dasa
,m äträbhüläni pafzca ca
N i c h t k om b i n i e r t s i n d : Mah än,A h amkar a , B u d d h i
Man a s,die z e h n Ö f fn u n g e n ,
die fn nf R e in s toffe u nd die
f ü n f g r ob e n E l em en t e .
Die 24 T attvas, die h ier au fgezäh l t w erden, s ind der Samkhyaphilosoph ie en tnommen, w enn auch gew isse Abw ei chun gen be
stehen . Un ter Mahattattva kann hier n i ch t,w ie im k la ssi s chen
Samkhya, Buddh i verstanden w erden , da d iese j a nachher nochgenann t w ir d
,sondern vie lmehr ähn l i ch wie in Kath .
-Up.
und Mbh . XII, 204 , 10 und XIV 50 , 55 das oberste Denkprinzip,das direkt aus der Prakrti hervorgeht (säk,säd guzwztr ay0padänakammaha ttaüv az
_n Madhvasiddh . Aus dem Mahat geht der Ahamkara
hervor (m ahatta ttvopadänakam ahaz_nkära tattvam Madhvasiddh .
dann fol gen Buddh i und Mauss. Die zehn Ofinungen“ sind die
fün f Erkenntn i sorgane (Auge , Oh r, Zunge, . Geruch sorgan , Hau t)
Devarakumda, der Gottertopf.
E in Beitrag zur Gesch ich te der Hau sgötter Südindi en s.
Von
E . H. Mueller (A . E . L. Mission,Guntur
,Indien).
Im Münchner Ethnographis chen Museum befindet s i ch ein mit
den Symbo len S ivas ges chmü ckter Rei f , der ursprüngl i ch den
Hauptbes tandtei l eines devar alcum q'a bildete, der mir v on seinenletzten Verehr ern übergeben w erden w ar .
Auf e iner me iner Berufsre isen als Mi ss ionar kam i ch im
Jahre 1 90 1 nach Kammaväripalem ,e inem Dorfe im Guntur—Di strik t
der Madras—Präsi dents chaft, S üdind ien. Die Bew ohner des dort igenMalapalems, d . b . des v on dem Hauptdorfe abse its ge legenenVierte l s , in dem die außerha lb des Kastensystems stehendenMala w ohnen , hatten s ic h en ts ch lossen, zum Christentum überzutreten . Den aus Lehm gebauten k leinen Tempe l der Polerama
sie gi l t als eine Form Kalis,w ar aber ursprunglich w ahr
scheinlich e ine dravidische Loka l gott hei t, grämadevatä hattendie Tau fbew erber berei ts zerstö rt
,nur ein devarakumda befände
s i ch noch im Gew ahrsam des Dorfä l testen,so w urde mir auf
meine Frage nach dem Verble ib i hrer Götzenb i l der geantwortet.Niemand hatte gew agt , Hand an ihn zu l egen , und so übernahmes e iner der m i ch b egle i tenden chris tl i chen Lehrer, den Göttertopfzu ho len. Der Name devar akumda bes te ht aus den be i den
,auch
sonst in der T elugusprache üb l i chen Wörtern devam Gotthei t(Plura l i s maj estaticus, skr . de m) und lcw _
n t_
i a (akr. kuncia) ir denerT opf. Der von e ingeborenen T öpfern
'
gefertigte T opf i st etw a30 cm hoch und hat an se iner w ei testen S te l le einen etw a eben
sogroßen Durchmesser . Er ist aus T on gebrann t, von s chw arzerFarbe und unters che i det si ch in n i chts von den heute noch
Devarakumda, der Göt tertopf 333
ü b l i c hen nz'
la lcmgu_
iu fu (Wassertöpfen) . Al s Vers ch luß d ien t ein
flache r, te l lerartiger töne rner Te l ler m üta , der me is t m i tte l s e inesS tückes Zeug und Um s chnü rung auf dem Topf b e fest igt ist.
Den Hauptbes tandte i l des Inha l tes e ines devarakumda b i l detdas Lemm a
,d . i . die Darste l l ung e iner Gotthe i t
,sodann e in t«.7li
,
d . i . e in k re isrundes,seh r d ünnes gol denes Plättchen von e tw a
2— 3 cm Durchm esser,w ie es an e iner m it S afran gefärb ten
Baumw o l l schnur von jeder _ _Hinduehefrau
,als Zei chen ih rer Ver
heiratung um den Ha l s gebunden,get ragen w i rd . Endl i ch v er
s ch iedene gu das sind k leine irdene S chal en und Töpfchen ,te l lerart ig flach , w ie der m üta des Götter t0pfes, oder in der Formdes dmar akumda sel bst
,ode r aber zy l inderförm ig, etw a 5 — 6 cm
hoch , m it e inem Du rchmesse r von 3 — 4 cm . Oft s ind letztere
S udindischer Bronzereif. K . E thnograph . Museum , Muncheu .
E twa Gr.
paarw ei se, oder auch zu d ri t t auf e inem eben fa l l s irdenen Piedesta lge form t
,w obe i dann das täli m e is t um e inen der zy l inder fö rm igen
gun'
gi gebunden i st. Diese Dinge w urden in jedem der von mir
geoflneten (3— 4 ) dev ar ai wgzda ge funden , in et l i chen fanden s i chnoch kupferne , 2 qcm große , viereckige , fläche Amu le tte m it ein
gegrabenen Bu chstaben oder Götzenb i l dern , sow ie lanzettfö rm igen ,e tw a 1 5 cm langen e i sernen Messerkl ingen, vim lu genannt, d . h .
Heroen, w oh l Versinnb i l d l ic hung gött l i ch verehrter Ahnen . Der
e ingangs erw ähnte Re if vertrat das Lamm in diesem devarakumda .
Es ist ein Bronzcgnß; im Kre i se s teht auf s chma lem Reife d reim al w iederhol t fo l gende G ruppe srvaitischer Attr ibu te : Linga und
Yon i m it darüber s ich w olbender geb l ähter Kob ra , zu ihm gew andtder Nand i
,dann (in w echse lnder Fo lge) Dreizack , Doppelaxt .
334 E . H . Muel ler
Das täli als E heabzeichen legt den Gedanken an e ine w e ibl i che Gotthe i t nahe, das yurigi, das m it dem täli ges chmückt ist,könnte als Repräsen tan tin des w e ib l i chen Prinzips ge l ten . Die
Amulette sind nach Hinduanffassung zur Abw ehr des üb l i chenEinflusses böser Ge ister auch in e inem devar akm
_nda nü tzl i ch .
Gew ohnlich w ird der devar akumda im Dachgebälke des
Hauses des Pedda (S ippenältesten) aufbew ahrt, und zw ar,w enn
se in Gehöft aus m ehreren Räum l i chkei ten b esteht,in dem nach
Wes ten ge legenen Raume , andern fa l l s nahe der Wes tsei te des
e inen Raumes ; se l tener findet man im Hause e ine Art Tempe l ,etw a 7 5 — 1 00 cm hoch
,aus Lehm gebaut und w eiß ge tün cht
,an
der Westw and des Hauses errich te t .Der devarakum gla ist E igentum der ganzen S ippe, der Pedda
i s t nur der Hüte r des He i l igtum s . Es s cheint, daß e ine S ippenur e inen devaralcumc
_
la b esi tzt. S e lb st w enn die ganze Fam i l ieeines so l chen Pedda die Hindureligion aufgib t
,s cheut sie s i ch doch
,
den i hrer O bhut anvertrauten deva rakumda auszu l ie fern,w oh l
info l ge des Anrechtes, den die üb r igen S ippenglieder an ihn
haben ; nur w enn m it dem Pedda auch der einflußreichste und
größere Te i l der S ippe zum Ch r is ten tum übertritt, i st es m ögl i ch ,die Ausl ieferung“
des deva r alcum da zu erlangen .
Jährl i ch m indes tens einma l findet e ine besondere, feier l i cheVerehrung des devarakm
_n da s tatt
,doch w i rd auc h sonst w oh l b ei
besonderen An l ässen du rch Opfer und A nbetung die Guns t derGotthei t erstreb t. Der Topf w i rd bei so l chen Ge l egenhe i ten m it
kawkama bema l t,d . i . einem roten Pulver, das aus Ge lbw urze l ,
Alaun und Ka lk m it Limouensänre bere i tet w ird ; das bomma w irdau fgeste l l t ; et l i che der flachen yurigi w erden m it Ö l und Weib
rau ch gefü l l t,die zu Ehren des bomma angezündet w erden . E in
b l utiges Opfer, je nach der Woh l habenhei t der S ippe aus einemHahn
,Ziegen bock
,Widder oder Büflelochsen bestehend
,b ildet
das Ende der Verehrung, ein gemeinsames Mah l aber, bei w e l chem
Ar rak und Pa lmw e in e ine w i ch tige Rolle spielen , i s t der Höhepunkt und S ch l uß der F e ier .
Als Opferpries ter fungiert der P edda der S ippe .
Nach m e iner Er fahrung ist die Ve rehr ung eines dev ar akw_nda
nur unter den Panchama geb räuch l i ch,doch w ürde m i ch die Ver
Der „Negativ ismus in der alten
Buddhalehre.
R . O t to F ranke (Konigsberg).
In se inem Buche Prajfia Param i ta (Gottingen und Leipzig 1 9 14 ;Que l len der Re l igionsgesch i chte, Bd. 6) s te l l t Pro f. W a l le s e r
p. 5 die Behauptung auf, „daß die Grundanschaunng des Buddhismus
in der Ze i t seiner Entstehung posi ti vi st isch gew esen ist, und daß
die e rsten ausgesprochenen Mahäyänatexte an erster S te l lei s t die Astasähasrikäprajnaparam tta zu nennen den Um s ch lagdes Pos itivismus in den ansgesprochensten Negativismus beze i chnen “
.
Vgl . auch p. 1 . An d ieser Ans i cht ist nur das e ine r i ch tig, daßd iese Mahäyänatexte den Negativi smus vie l nachha l t iger und aus
drücklicher e rörtern als die a l ten Pälitexte. Es ist aber ein Ir r
tum,anzunehmen
,im a l ten Buddh ismus sei etw as anderes als
Negati vismus ge lehrt w erden . Das w i l l i ch h ier kurz an den
zw e i äl tes ten Texten,Dighanikäya (D .) und Majjhimauik
‘
äya (M.)nachw e isen .
Al les E rscheinungsw eltliche faßt Buddha m it der Beze ichnungpai m
’
upädäna-kkhandhä
„die fünf G ruppen des Annehm ens “ (d . h .
unseres Inbeziehungtretens zu den angeb l i chen Dingen der We l t)zusammen (D. XXII , Etw as anderes gib t es für uns n i cht .Für die F rage , ob ob „
Negativismus “ , komm t esa l so zunäch st e inma l darau f an
,zu w is sen
,ob Buddha un ter den
upädäna-kkhandhä si ch e tw as S e iendes vorges te l l t hat oder n i cht.
Vie l lei cht ist d iese F rage s chon übe rflüssig,denn hätte er die
E rsche inungsw e l t s i ch als etw as Rea les gedacht, so hätte er sie
w oh l n i ch t m it dem um ständ l i chen Namen Gruppen des An
n ehmens “ zu benennen brauchen,der deu tl i ch genug besagt
,daß
Der „Negativ ismus“ in der a l ten Buddhalehre 337
Buddha a l lem Ersche inenden und von etw as anderem hat er
n ie gesprochen nur psych ische Ge l tung zuges tand, er hätte auch
die Dinge n icht kurzerhand als S a rgzl:häras „Vors te l l ungen “ be
ze ichnet (die D.-S te l len s . ZDMG 69
, p. U nd hätte er ein
h inter den Ers che inungen vie l le i ch t Vorhandenes v on der auf
jeden Fa l l unfru chtba ren E rörterung nur aussch l ießen, aber als
m ögl i chen Gegenstand v on Vermutungen ge l ten lassen w o l len,so
hätte er sich w oh l kaum so ausgedrück t w ie in D. XI‚85 : Die
Wahrnehmung sch l össe a l les , w as es überhaupt gebe, a l le Gegensätze , in sich ein, und ohne sie gehe es w eder Gesta l t nochNamen , w as j a auch in der Pagz'aaa -samuppäda
-Form e l zum Ausd ruck komm t (XV , 22 viüf:äp apaccayä näm arüpam ). Er kann au chdeshalb n i chts außerha lb der upädänalclclzandhas Vorhandenes auchnur als mögl i ch haben andeuten w o l len
,w e i l er a l le „
Existenz“(bhava) ausdrück l i ch auf das „Annehmen “
als Grund zurückfüh rt,
denn in der oben genannten Forme l heiß t es : upä'
däna—
paccayä
bluw o ,.nur auf der AnnaM e beruh t das Existieren “
,und nach
M. 44 (I , 299 , ‚Z . 7 ff.) hat der Erhabene den „Körper “ (sakkäya)für b loße upädänakkhandlzas erk l ärt. Aber Buddha spri ch t nochdeutl i cher . Wo S e in w äre
,da müßte ein S eiendes
,ein S ubjek t
,
ein S e lbst d ieses S e ins sein, und w enn Buddha jedes„S e lbst“
in Ab rede ste l l t, so besagt das, daß er jedes S e in des Erscheinendengeleugnet hat . Er tut das aber ausdrückl i ch in D. IX
,40— 42 :
Euch fre i zu machen von der I dee des S elbstes, predige i ch die
Lehre“und erk l ärt in IX ,
53 in bezug auf a l le dre i vorhererörterten We isen ,
w ie man s i ch ein so l ches S e lbs t v orste l l t :„Das s ind überhaupt nur landläufige Namen, Ausd ru cksw eisen,Benennungen, Beze i chnungen, die der Tathagata zw ar geb rauch t(w ei l sie vorhanden s ind), ab er n i cht erns t nimm t. “ Zu den zub etät igenden Bew ußtseinsäußerungen gehört nach D. XXXIII
,2,3
(VII I) und XXXIV, 1 , 8 (VIII ) das Bew ußtse in , daß ke in S elbst
vorhanden i st (an -a tta Und w oh l w e i l der Einw and zuerw arten w ar
,daß
,w o Le i den sei (um das s i ch ja die ganze
Buddhalehre dreht), auch ein S e lb st vorhanden sein müßte, i st inXXXlII
,2, 1 (XXVI) unter den zur Erlösung füh renden Be
w ußtseinsarten “
„das Bew ußtsein vom Nichtvorhandense in e ines
S elbstes im Lei den “
(dukklze anatta-safzüä) mit genannt. Im M .
i st die Nichtselbsthaftigkeit a l ler Objekte der S inneserfahrungFestsc hr if t Kuh n . 22
338 R . O tto F ranke
ausgesprochen : sa6be dhamma anatta 35 (I , 228, Z . 64
(I, 435 , Z . 31 Walleser erw ähnt d iese Forme l zw ar (p.
ist aber der Ans i ch t (p. daß der Zusammenhang, in dem sie
steh t, ih re Bedeutung erheb l i ch verändere_
und den Gedanken der
a l lgemeinen S ubstanzlosigkeit modifiziere. Diese An si cht ist verfeh l t,und daß man dem Buddhisten n i cht darin fo l gen “ könne, „
daß
etwas ohne S e l bst sei,w ei l es vergängl i ch und le i dvol l i st“ , ist
ein I rrtum . Auch Le i d ist e ine Affizierung, a l so Veränderun g,Ze i chen der Vergängl i chke i t . Vergängl i chke it aber ist ein Widerspruch zum philosoph is chen Begriffe des S elbstes
,des w irk l i ch
S e ienden . Ich bin “ i st ein Wahn,der aufzugeben ist (D. XXXIII,
2,2 [XVII] und XXXIV
,1,2 U nd w ie hätt e der er
kennende Buddha von s ich sagen können : n ’
a ttlzz'
dam'
punabbhavo
nun gib t es ke in Existieren w ieder “,w enn er im t iefsten Inneren
doch ein exis tierendes S elbs t ha lb zugegeben hätte? Dasse l bew ie für das e igene S e lbst gi l t aber auch fü r a lle Dinge und
Wesen außerha l b des e igenen see l i s chen S elbstes. Die Ans i cht,daß es w irk l i ch se iende Körper gebe“
(sakkäya-dipghz'
) i st eine derdrei „
Fesse ln“
(D . XXXIII, 1 , 1 0 von denen s chon der in
den Heilsstrom Ge langte s ich fr ei gemacht hat (D. VI, U nd
daß es überhaupt „n i chts gebe“
(äkifzcaflfla i s t ein Denkresultatder b is zu den höheren S tufen des E rlösungsw eges Vorgedr un genen ,IX
,1 6 lehrt Buddha den Potthapäda : „
dann “
(nach dem
Zus tande des Bew uß tse ins v on der Unbegrenzthe i t der Wahrnehmung) „
errei cht der Mön ch den Zustand des (Bewußtseins v om)Nichtvorhandensein von irgen d etwas, indem er erkenn t, ‚
daß es
gar n i chts g ibt‘ (n ’
a tthi nachdem Buddha den Mön ch schonauf e iner fr üheren S tufe
,derjenigen des Bew ußtse in s
, „daß der
Raum ohne (innere, Gegenstands-)Grenzen sei“ (äkäsänafwa), die
Ideen,daß es e inze lne Gesta l ten und eine Vie l hei t von Dingen
gebe, hat überw inden lassen (X, 14 rüpasafiz‘
zänazn samatikkamä
näna ttasaüfzänam am anasz'
lcärä) ; auch im Sys tem der acht S tufender Befr e iung“
(D . XV,35 ; XVI , 3, 33 ; XXXIII, 3, 1 [XI] und
XXXIV, 2, 1 [X]) ist diese lbe Methode des Überwin dens der Ideev on vorhanden se ienden Gesta l ten und von exis tierenden Dingenge lehrt (und es hängt dam i t das S chema der „
s ieben S tufen derWahrnehmung“
, XV, 33, eng zusammen) . Eine andere Methodezur Überw indung der „Gesta l ten “ s ind die „
ach t S tufen des Über
340 R . O tto F ranke
tivistischen S ätze des D. w iederho len s i ch , w erden varnert und
noch schärfer zugespi tzt im M. ,e in ige so l che M.
-S te l len habe i chj a oben m it angeführt. Im a l l gem einen aber gehe i ch der Raumbes chränkung w egen h ier n i cht auf so l c he ein und komme gle i chauf die bezeichnendsten zu sprechen .
Im M. 43 Z . 35 f .) i s t der Gedanke, daß in den
Dingen der Ersche inungsw e l t kein S e lbs t zu finden sei, durch dieWorte ausged rück t sw
'
züam idam attena„dies a l les i s t leer von
e inem S e lbs t“ , und w em das klar gew orden ist,der hat d ieser
S tel le zu fo lge die Erl ösung der„Leerhe it “ (sufiüa tä
We il „Leerhei t“ von e inem
„S e lb st “
,e inem S einskern, geme in t
i st,darum steht au ch in M. 64 (l , 435 , Z . 26 ff.) suflüato anattato
sam anupassatt'
nebene inander, und zw ar sieht der Betr efiende „die
S inneserfahrung “
(te dhamm e), näm l i ch a l les Gesta l tete “
(rapa
ga ta7_n) usw . so an . Dieses Wort s ufzfza,resp. s uizfi a tä ersche int
h ier zw ar n i ch t zum ers ten Ma le in dieser Anw endung,denn
s chon D. XXXII I , 10 (LI) kennt den swi fzato samädhz'
„die ge
samm e l te Versenkung in die Betrach tung der Ers che inungsw e l tals lee r “ , aber es beginn t im M . se ine große Ro l le zu spie len ,die es im Mahäyäna dann nur fortgesetzt hat . In M . 44 (I , 302,Z . 22) he iß t der „Eindruck “
von diese r „Leere “
s uizfzato phasso.
In M. 1 22 (III, 1 1 1 , Z . 21 ff.) w erden die v ier Versenkungsstufenge lehrt als den Gedanken der Leerhe i t“ herbe i führend (sufzfzataznm anasz
'
karotz'
) und als „den Ge is t (von der Erscheinungsw e l t ab und
in s i ch zusammenziehen d “
(cittam sam ädahitum ), die S te l les te l l t s i ch a l so inha l tl i ch eng zu der eben erw ähn ten D.
—S te l le .
U nd jeder Zw eife l , daß d iese M.-S te l le so aufzu fassen ist
,w ird
w oh l e inma l dadurch ausges ch lossen,daß unm itte lbar vorher ,
ebd. p. 1 1 1 , Z . 6 ff. als die Erkenntn i s e ines den E rlösungsw eg
Gegangenen (T a thägata) h ingeste l l t ist, sabbanim ittänaz_n am anasikärä
aj7'
hattav_n suüüa taz
_n upasampajj a viharitum „
durch Nichtbeachtunga l ler S innesobjekte bei s i ch (das Bew ußtsein) der Leerhe i t für dieDauer zu gew innen “
,und sodann durch M. 64 (I, 435 , Z .
w onach auf jeder der sieben ers ten S tu fen der Aufhebung desBew uß tse ins , deren erste vier die vier Versenkungsstufen s ind,der darauf Befindliche die Upädänakkhandhas als leer und ohneS e lbst“ (suüfla to anattato) auffaßt. In M. 1 21 (III, 1 05 — 1 08) s inddie vier höheren von den S tufen der Aufhebung des Bew ußtse ins
Der„Negat iv ismus“
in der a l ten Buddhaleh re 34 1
resp. die S tu fen 5 — 8 der neun Zustände der S tu fenfol ge, von der
Unbegrenzthe i t des Raumes (in si ch)“ an,als Ergebn isse des
m üüa tJ -v i/zära,des „
Hingegehenseins an die I dee der Leerhe i t “darges te l l t
,und nach M . 44 (I , 302, Z . gew innt auch der
zur neunten dieser S tu fen Aufste igende den Eindruck Leerhe i t “ .
Daß aber d iese höheren S tu fen die s ch r i ttw e ise Übe rw indung derRealitz
'
itsidee s ind , habe i ch schon oben ausgesprochen.
Es sei hier gle i ch bemerkt, daß suüfza to in D. XXXI II, I , 1 0(LI) und M. 44 (I , 302, Z . m it zw e i anderen Term in i
,
anz'
m itfo und appa r_zihito zu e iner Trias zusammengruppiert i s tgeradeso w ie dann auch in der Praj fiäpäramitä des Mahayana ,für deren e igentl i chstes Eigentum Walleser p. 12 a l so m it Unrechtd iese Trias erklärt
,w ie i ch schon D. n . 1 9 1 5 N r. 38
,Sp. 1 937
ausgesprochen habe. In der D.
-S te l le s ind d iese dre i Adjektivam it samäd/zi verbunden, in der M.
-S te l le m it phasso , in jener Verb indung bedeuten sie w oh l Geistessammlung, die die Dinge als
leer auffaßt, die ke ine Wah rnehmungsobjekte kennt und ohneBegeh ren nach so l chen ist “
,in d ieser : „
der Eindruck,daß die Dinge
leer s ind,daß es keine Wahrnehmungsobj ekte gib t, und der Gei stes
zustand (die Geistesafiektion) ohne Verlangen “. Mit Walleser
anzunehmen,daß diese Te rm in i in diese äl teste Buddhalehre aus
dem Mahayana e inged rungen se ien,w äre
.
n i ch t nur eine e tw asgew a l ttätige A nnahme , sondern s chon vom h istorischen S tandpunkteaus ein unri chtiges Verfahren .
Auch tuccho he i ßt„leer “ , und auch d ieses ersche in t im M . ,
1 06
(II, 26 1 , Z . 3 v. a l lerd ings nur auf die Begierden (kämä,w as indessen auch die Objekte der Begierde angew andt : „
sie s ind leer “ . S ie he ißen an dieser S te l le auch,und
das ist im S inne unserer Auffassung ebenfa l l s w i chtig, m äyälcatar_n„nur als Trug vorhanden “
Wenn noch ein Zw e i fe l an der ncgativ istischen Na tur dera l ten Buddhalehre se in könnte
,so müßte ihn der Inha l t des
S utta M. 1 zers treuen , das seh r beze i chnend gle i ch am Anfangsdes M. steht : ‚
Der Erhabene sprach : ‚Mönche , der A ltagsmensch,der n i c hts von der Lehre w e iß faß t die Erde als Erde auf
p. 262 Z . 9 he ißt es denn auch mit Bez iehung auf sie : abhibhuyya
loham „die “'
elt überw unden habend" .
342°
R . O tto F ranke
(saüj änäti), glaub t (maflüa tz') an sie als Erde Warum ? I chsage euch : Er hat noch n i cht die rechte E rkenntnis . Er faßtWasse r als Wasser F euer als Feuer Luft als Luftdie Wesen (Elem en te ? bhüte) als Wesen die Götter als
Gott Pajäpati als Pajäpati die S tu fe der I dee von der
U nbegrenzthe i t des Raumes als so l che die S tu fe der I deev on der Unb egrenzthe i t der Wahrnehm ung als sol che die
der I dee v om Nichtvorhandense in v on irgend etw as als so l chedie des Nichtvorhandense ins v on Bew ußtse in sow oh l als v on Nichtb ew ußtsein als so l che Gesehenes als Gesehenes Ge
hörtes als Gehö rtes Gemein tes als Gem e intes Wahrgenommenes als Wahrgenommenes Einhei t als Einhe i tV ie l hei t als Vie l he i t oder Versch iedenhei t als Versch iedenhe i t(näna ttam ) a l l es als a l les das Nibbana als Nibbanaauf (p. 4 , Z. Der Vo l lendete und der Tathagataaber n imm t Erde (usw .) zw ar auch als Erde (usw .)Nibbana als Nibbana (p. 4 , Z . w ahr aberer glaub t n i cht an ein Nibbana “
(nibbänazgz na Hierw i rd n i ch t e inm a l den hö chsten S tufen der Heilserrungenschaften ,ja n i cht e inma l dem a l lerhö chsten buddhist is chen I deale Realitätsw ert zuerkann t. E in radika lerer Negativ ismus ist gar n i ch t denkbar,und in der Prajfiäpäram itä ist kein s tärker potenzierter aufzu
finden . Es herrscht kein Gegensatz,sondern umgekehrt eine
enge Verw andts chaft oder besser Identi tät, denn genau dense lbenGedanken, w ie den eben angefüh rten S chlußgedanken sprich t dieAstasähasrikä (Räj . Mi t r a s Ausg . p. 9 Z. 1 3) mit dense lben ,offenbar v on dort stammenden, Worten aus : sa nirvänam apz
'
na
m anyate „ ein so l cher glaub t n i ch t e inma l an das Nirvana “
(von
Walleser p. 38 unzu längl ic h ubersetzt : „ auch denkt er n i cht andas U nd w ie nach M. 1 der Vo l lendete und der
Tathagata die höchsten Errungen schaften des samädl n'
,die Idee
von der Unb egrenzthe i t des Raumes usw .
, n i cht als Rea l i tät auffaß t (saüj änäti) u nd n i cht an sie glaub t
,ganz entsprechend heißt
es in der Astasähasr . p. 1 4 , Z . 4 sam ädhiz_n na samjänite.
Mit M. 1 i s t M. 4 9 inha l t l i ch verw andt. Dort sagt (I, 329 ,Z . 1 2ff.) Buddha zu Brahma : „
Brahma, nachdem i ch (ers t) dieErde als Erde au fgefaßt hatte, so w ar dann , als i ch erkann te,w ie doch die Erde des E rdeseins bar ist, e ine Erde n i cht m ehr
342 R . O tto F ranke
(sahj änäti), glaub t (mafzüa tz'
) an sie als Erde Warum ? I chsage euch : Er hat noch n i cht die rechte Erkenntn i s . Er faßtWasser als Wasser Feuer als Feuer Luft als Lu ftdie Wesen (Elem ente ? bhüte) als Wesen die Götter als
Gott Pajäpati als Pajäpatr die S tufe der I dee von der
U nbegrenzthe i t des Raumes als so l che die S tufe der Ideev on der Unb egrenzthe i t der Wah rnehm ung als so l che die
der I dee v om Nichtvorhandense in von irgen d e tw as als so l chedie des Nichtvorhandenseins v on Bew ußtse in sow oh l als v on Nichtbew ußtse in als so l che Gesehenes als Gesehenes Ge
hörtes als Gehö rt es Geme in tes als Gem e in tes Wahrgenommenes als Wah rgenomm enes Einhei t als Einhe i tV ie l hei t als Vie l he it oder Versch iedenhe i t als Vers ch iedenhe i t(näna ttam ) a l l es als a l les das Nibbana als Nibbanaauf (p. 4 , Z . Der Vo llendete und der Tathagataaber n imm t Erde (usw .) zw ar auch als Erde (usw .)Nibbana als Nibbana (p. 4 , Z . 3off.) w ah r aberer glaubt n i cht an ein Nibbana“
(nibbänam na Hierw ird n ich t e inmal den hochsten S tu fen der Heilserrungenschaften,j a n i cht e inma l dem a l lerhö chsten buddhi sti s chen I deale Realitätsw ert zuerkann t. E in radika lerer Negativismus i st gar n i ch t denkbar,und in der Prajfiäpäram itä i s t kein s tärker potenzierter aufzu
finden . Es herrscht ke in Gegensatz,sondern umgekehrt e ine
enge Verw andts chaft oder besser Identität, denn genau dense lbenGedanken, w ie den eben angeführten S chlußgedanken spr icht dieAstasähasrikä (Raj . Mi t r a s Ausg. p. 9 Z . 1 3) mit dense lben ,offenbar von dort stammenden
,Worten aus : sa nirvänam apt
'
na
m anyate „ein so l cher glaub t n i ch t e inma l an das Nirvana“
(von
Walleser p. 38 unzu längl ic h übersetzt : „ au ch denkt er n i cht andas U nd w ie nach M . 1 der Vol lendete und der
Tathagata die hö chsten Errungens chaften des sam ädl n'
,die Idee
von der Unb egrenzthei t des Raumes usw .
,n i ch t als Rea l i tät auf
faßt (saüj änätz') und n i cht an sie glaub t, ganz entsprechend heißtes in der Astasähasr. p. 1 4 , Z . 4 sam ädhim na
-
samjänite.
Mit M. 1 ist M. 4 9 inha l t l i ch verw andt. Dort sagt (1, 329 ,Z . Buddha zu Brahma : „
Brahma, nachdem i ch (ers t) dieErde als Erde au fgefaßt hatte, so w ar dann
,als i ch erkannte
,
w ie doch die Erde des E rdeseins bar ist, eine Erde n i cht mehr
Der „Negat iv ismus“ in der al ten Buddhaleh re 343
vorhanden nachdem i c h (erst) das Wasser als Wasser aufgefaß t hatte (usw .) die Wesen (oder Elemente)die Götter Pajäpati w aren a l le diese
,als i ch er
kannte,
n i cht mehr vorhanden (Pa tha vz'
m Icho aham
B rahms patha vz'
to abhiüüäjya yäva tä patha vz'
yd pa thavc1ttena anan u
bhüta r_n tad abhiüü@ a pa _
thavi nähosi
Wegen des Wortes m a f u‘
n'
ta lp gehört M . 1 40 (I I I , 246, Z . IMT.)m it in e ine Be trachtung über M. 1 . An j ener S te l le von M. 140
Spr i ch t Buddha : „
“I ch bin’
,das ist ein (fa l s cher) Glaube
‘i ch w erde se in’
,das i st ein fa l scher G laube, ‘i ch w erde ni cht
m ehr sein ’
,das ist ein fa l s cher Glaube “
(w e i l , w o überhaupt ke ineExistenz ist
,auch ni cht v on Nichtmehrexistieren geredet w e rden
kann) (S o l ches) Glauben i st e ine Krankhe i t w enn er
a l les Glauben überw indet, dann , Mönch , heiß t der Weltentsagende
zur Ruhe gekommen .
“
Ju 72 Z . 1 8 — 20) erklart Buddha mit Bezug auf
die b ekannten Dogmen von der Ew igke i t der We l t (d . h . vom
S ein der We l t, v on der Fortexistenz des Tathagata,d . h . der
S ee le „Darum sage i ch d ir : Der Tathagata i s t,w e i l a l les
so l ches Glauben a l ler Ichglaube in ihm geschw undenund abgetan is t , endgü ltig erl öst. “
Nu r auf eine S te l le von Wallesers Buche (p. 143) sei m ir
noch gestatte t e inzugehen, w e i l d iese S te l le Licht empfängt vonM. 22 und 38 . Der letzte S atz von Vajracchedikä 6 (Kolopamaz
_n
dhan napazyäyaz_n äj änadbhir dharmä eva pr a/züta vyälrpr äg evädharmälz)lau te t in W.s Übersetzung : „Desha lb i s t durch den Tathagatader Gemeinde d ieses Wort verkünde t w orden : ‘
Die,w el che das
Lehren des dharma als e inem Flosse gle i ch erkennen, so l len diedharmas (Objekte) s chon au fgeben, um so mehr die Nicht-dharmas
Der Vaj racchedikä—Verfasser bezieh t s i ch h ierauf M. 22 (I, 1 34 , Z . 30 — 1 35, Z . „Mönche, i c h w il l euchden dharma unter dem Bi l de e ines F losses ze igen (dam i t i hr seht),daß er nur zum Hinüberkommen dienen, daß man aber n i ch t m itihm s ic h herum sch leppen so ll (w enn er seinen Zw eck erfü l l t hat)Wie w enn ein Re i sender
,w enn er ein großes Meer s ieht und
ke in S ch iff vorhanden s i ch ein Floß zusammenb inde t undauf d iesem glück l i ch h inüber ge langt
,dann aber denkt :
‘Woh lan, i ch w i l l dieses Floß auf dem K0pfe oder auf der S chu l ter
344 R . O tto F ranke, Der „Negativ ismus“ in der alten Buddhalehre
tragend gehen , w ohin es m ir be l ieb t ! ’ w as meint ihr, Mönche ,w ü rde so eine r, w enn er w irk l i c h den Gedanken ausführt
,von
dem F losse den rechten Gebrauch machen ?“ Ne in,Herr . “
„Mönche
,w ie w ürde er es anste l len, den rechten Gebrau ch davon
zu machen ? Wenn er,drü ben angekommen , denken w ürde : ‚
DiesesFloß hat seinen Zw eck aufs beste er fü l lt
,jetzt w i l l i c h es ent
w eder auf den S trand ziehen oder forts chw imm en' lassen und von
dannen gehen, w oh in es mir b e l iebt ! ’ Wenn er das tut, dann tuter das Rich tige. Geradeso steht es mit dem dhamma . I ch hab eihn euch unter dem B i l de e ines Flosses betrachten lassenMönche
,w enn ihr w ie ein Floß sie auffaßt
,dann müßt ihr die
dhamm as aufgeben,w ie vie l mehr die Dinge
,die ni ch t dhamma
s ind“ (Ku llüpamaqn. vo bhikkha ve äj änantehi dhamma pi vo pahätabbä,
pay ev a adhamm ä) . In M. 38 (I , 260, Z . 32 If.) fragt Buddhadie Mön che, nach dem er sie über die w ahre Natur der Wahrnehmung, daß sie n i cht se l bständig, sondern nur bedingt vorhandenist
,be lehr t hat : „Wenn ihr
,Mön che
,nun an diese doch so re ine
Ans i cht eu ch fes thängt,w ürdet i hr dann den dhamma (ri chtig)
auffassen als un ter dem Bi l de vom Flosse ge lehrt,daß er näm l i c h
nur zum Hinüberb ringen , aber n i ch t dazu dienen soll , daß man
si ch dann noch mit ihm herum s ch leppt
346 Julius Dutoi t
542 angeführ t,ebenso im AV. zu J . 506 zu r Bes chreibung der
Größe des Bodh isattva in seiner Exis tenz als Naga die J . 524
und 545,und im AV. zu J . 4 69 als Be ispie le für einen lauten
S chre i die J . 543 und 545 . Ungenau ist im PV. des J . 358 b ei
der Aufzäh lung der Greue l taten Devadattas in früheren Existenzendie Beziehun g auf das Daddara-J .
, da in den beiden J. d iesesNamens (1 72 und 304) der Inha l t ein anderer ist ; bei derse lbenGe legenhei t s ind noch erw ähnt J . 222, 31 3 und 51 6
,das aber
h ier n i cht Mahäkapi—J .
,sondern Vevatiya-J . heiß t. Eigentüm l i ch
i st die Anführ ung der J . 7 0,509 und 5 1 0 in der S ch lußbemerkung
zu J. 538 . End l i ch w ird noch im AV. zu J . 543 bei der S ch i l derungdes Kampfes zw ischen S upannas und Nagas auf das als ze itl i chspäter gedachte J . 5 18 verw iesen ; ebenso im AV. zu J. 54 7 auf
J . 546 . Zu die ser Ar t von Zitaten gehört auch die Erw ähnungder Ge legenhe it
,bei der Bu ddha ein anderes J . vortr ug. S o er
zäh lt im PV. zu J . 485 der Me ister das J . 447 , im PV . zu J . 465
das J . 7 und üa v . zu J . 536 dasflL 4 7 5 .
Hieran s ch l ießt s i ch e ine w e itere Reihe von Zita ten,in denen
in dem AV. zur Vervo l l s tändigung der Erzäh lung auf andere J .
verw iesen w i rd,und zw ar sow oh l zurückgreifend auf frü here w ie
auch vorgrei fend auf spätere. Die F ormel ist gew öhnli ch fü r denersten Fa l l : °
j ätake vu ttanayen’
eva, oder va tthm_n ke
_ttha
‘fj atake
vu ttanayen'
eva vitthäretabbam; fiir den zw e i ten Fall : sabbam‘f7
‘
ätake
ävz'
bhavz'
ssati, oder w enn die erste Bearbe i tung kürzer i st, agar_n
pan’
ettha samkhepo. Die Liste d ieser oft ungenau angeführtenZitate ist fol gende :
J . 1 2 ist zit iert in J . 385
4 2 274,395
5 1 282,303
96 1 32
264 489
3 1 8 4 1 9
424
439 369
443 328 (Auszug)489 264
4 91 501
523 526
Jatakazitate in den Jätakatexten 34 7
J . 5 34 i st zit iert in J . 502
536 : 7 n 32‘
538 540
529 378 , 445 .
Eine Anzah l von J . erk lärt s i ch als i dentis ch m it anderenund gib t nur e inen oder m eh rere andere Verse . S o i s t
J . 28 J . 462 (1 andere S trophe)28 88 (1
82 439 (1
90 363 (5
1 01 99 (mit Anderung e i n e s Wortes , ohne PV .)1 04 4 1 (1 andere S trophe)1 25 1 27 (mit kle in er Veränderung)14 7 297 (Verw echs lung von AV. mit PV.)224 5 7 (1 andere S trophe)237 68 (2
369 439 (andere S trophen).J . 52, das s i ch auf J. 539 beru ft, entlehnt von d iesem sogar seinee inzige S troph e, die dort als S tr . 1 7 w ört l i c h w iederkehrt .
Außerorden t l ic h häufig findet s ic h e ine Bezugnahme in einerRahmencrzählung auf ein anderes PV. Es bes tehen h ier E rzählungstypen, die bei jeder pas senden Ge legenhe i t benützt w erden . Mei stw erden sie m it dem Namen i hres J . beze i chne t, manchma l aberauch nur mit der Nummer des Buches, in dem sie vorkommen
,oder
es w ird bemerkt : S abbar_n het_thä vu ttanayen
’
eva vitthäretabbaz_n Od. dgl .
Manchmal gehört auch die Rahmenefzählung zu zw ei oder selb s tdre i unm i tte lbar auf e inander fol genden J . , w obei led igl ich gesagtw ird : tassa va tthum het;lzaka thita3adisam eva od. 53. S O ist es
bei J . 23 und 24 , 5 1 und 55 , 59 und 60,6 1 . 62 und 63, 64
und 6 5 , 125 und 1 27,1 28 und 1 38, 154 und 1 65
,1 98 und 1 99
,
394 und 395 .
Die typischen Rahmenerzäh lungen s ind fol gende (nach derHaufigkeit des Vorkommens geordnet)PV . zu J . 423 (Ver lockung e ines Mönche dur ch seine frühere Fran)
zitiert in PV. 1 3, 1 45 , 1 9 1,297 , 3 18, 380, 523 .
540 (Lob eines Mönche, der se ine El tern ernährt) zitiertin PV . 1 64
,398
,4 55, 484 , 5 1 3, 532.
348 Jul ius Dutoi t
4 7 7'
(Verführung dur ch ein Mad chen ) zi tiert in PV. 30,
1 06,286
,348 , 435 .
53 1 (Bekehrung e ines unzu friedenen Monchs) zi tiert inPV. 444
,458
,488
, 538 .
465 (Wi rken zum Woh le der Verw andten) zitiert inPV. 7 , 22, 1 40, 4 07 .
481 (Kokälikas verderb l i ches Wirken) zitiert in PV. 1 1 7,
21 5 , 272, 331 .
54 6 (Buddhas übernatürl i che We i sheit) zitiert in PV. 387 ,
402, 5 1 5 ,
26 (verr äteris cher Mönch) zitiert in 1 4 1,1 84
,39 7 .
1 72 (Kokalika ze igt seine Un fäh igke i t) zi t iert in PV. 1 88,
1 89,21 5 .
427 (ungehorsamer Mon ch) zi tiert in PV. 1 1 6,1 6 1
,439 .
4 59 (Bezw ingung der S inn l i chke i t) zi tiert in PV. 305,
37 0,408 .
469 (Buddhas Wirken zum Hei le der We l t) zi tiert inPV. 50, 347 , 39 1 .
521 (Konigsermahnung) zitiert in PV. 1 5 1, 334 , 396 .
522 (Lösung e iner F rage dur ch Säriputta) z itiert inPV. 99 , 1 34 , 1 35 .
533 (Devadattas Wirk‘
en gegen Buddha ; au ch oft ohneausdrü ck l i ches Z itat vorausgesetzt) zitiert in PV . 1 1
,
389,5 01 .
542 (Devadatta entsende t Mörder gegen Buddha) zi tiertin 1 0
,1 1
,389 .
40 (Woh l taten des Anäthapindrka) zitiert in PV. 282,
340.
1 54 (S tre it zw e ier Min is ter) zitiert in PV. 1 65,273 .
253 (übertriebene Be tte le i) zitiert in PV. 323, 403.
434 (gieri ger Mönch ; fa l s ches Zi tat) zitiert in PV . 42,
260 .
487 (betrügeris cher Mou ch) z itiert in PV. 89,37 7 .
527 (Ver lockung e ines Mön chs durch ein ges chmü cktesWeib) z itiert in PV. 6 1
,1 93.
536 (Buddha veran laßt seine Lands leute zur Aufgabeihr es S trei ts und bekehrt 500 Jüngl inge von ihnen)zitiert in PV. 33
,7 4 .
350 Julius Dutoi t
alles,w as sie en tha l ten sollen ; besonders tritt dies bei der Be
t ufang auf Devadattas Mordpl äne zutage .
Wie die b isher angeführten Zi tate zu deuten s ind,ist k lar.
In der die S trophen , den a l ten Kern der J.,umgeb enden Ges ch ic hte
aus der Vergangenhei t,noch meh r in der Rahmenerzäh l ung finden
s i ch ähn l i che S i tuationen w ieder ; m an verzichte t darauf diesenochmal s auszuma len und beruft s i ch auf frühere oder spätereErzähl ungen desse lben Inha l ts . Auch die Anführungen v on S trophen,die auch sonst vorkommen, s ind so zu erk lär en .
Wesen t l i c h anders s in d die als se lbs tänd ige J . gezäh l tenBem erkungen , in denen nur gesagt w ird
,die m it dem zitierten
Jätakav erse beginnende Erzäh l ung oder Frage w er de in einemspäteren J . geb ra ch t w erden. Die Forme l i st rege lmäßig : ayam
°paiJzo oder idam °
jätakam (sabbäkärena)°j ätake ävibhav issa tz
'
. Essind im ganzen 1 6 sol che Not izen , die h ier in Be trach t kommen ;eine bezieht s i ch auf J . 535 , e ine auf 545
,zw e i auf 536 und
die üb rigen zw ö l f auf das große Ummagga-J . 54 6.
J. 1 1 0 (S abbasarphäraka-J .) J . 546,Band VI
, p. 336 der Fausböllschen Ausgabe, 1 S trophe.
1 1 1 (Gadrabha-J .) J . 546, p. 343,1 S trophe.
1 1 2 (Amaräpafiha-J .) J . 546, p. 365 , 1 S trophe .
1 7 0 (Kakantaka—J .) J . 54 6, p. 345 — 34 7,2 S trophen .
1 92 (S irikälakanni-J .) J . 546, p. 34 7 — 34 9
,2 S trophen.
34 1 (Kandari-J .) J. 536 , Band V, p. 435 — 444 , 4 S trophen.
350 (Devat-äpaiiha-J .) J . 546, p. 37 6 — 378
,4 S trophen .
364 (Khajj0panaka-J .) J . 546 , p. 37 1 f., 5 S trophen .
44 1 (Catuposatha-J .) J. 545, p. 25 7 — 262, 1 1 S trophen .
4 52 (Bhüripafiha-J .) J . 546 , p. 372— 37 6,1 0 S trophen .
464 (Cullakunäla-J .) J . 536 , Band V, p. 445 f. , 1 2 S trophen .
4 70 (Kos iya-J .) J . 535 , Band V, p. 387 — 390, 12 S tr ophen.
4 7 1 (Mendaka-J .) J . 546, p. 349 — 355,1 2 S trophen .
500 (S irimanda-J .) J . 54 6, p. 356 — 363
,21 S trophen .
508 (Pafi capandita-J .) J . 546 , p. 37 9 — 389,22 S trophen .
5 1 7 (Dakarakkhasa-J .) J . 546, p. 466 — 4 7 8, 34 S trophen .
Das deutl i chste Bild b ieten die zum J. 546 gehörenden J.
S ie s in d nach der Zah l der S tr ophen den versch iedenen Büchernzugete ilt und um fassen zusammen genau die 83 Verse, die vor
u
u
mu
u
u
u
u
u
y
u
u
_u
s«u
Jätakazitate in den Jätakatexten 35 1
der e igentl i ch als Anfang gerechneten S trophe stehen sow ie die34 , die nach Beendigung der e igentl i chen Ges chi chte kommen .
Es sind auch tatsächl i c h Erzäh l ungen von e iner gew i s sen S e lbständigkeit des In ha l ts . Ebenso gehören zum Catuposatha
—J . 44 1
die noch n i ch t zum eigentl i chen .l. 545 gezäh l ten S trophen 1 — 1 1,
die eine vom übrigen J . so ziem l i ch getrennte Ges ch i chte um
fassen. Das Kosiya-J . 4 7 0 so l l w oh l die zw ö l f e rsten S trophendes J . 535 en tha l ten , die die Bekehrung des ge i z igen Kos iyasch i l dern. Im Kandar i-J . 34 1 müssen vier inha l t l i ch eigent l i chn i cht zusammengehörende S trophen (20 — 23) des J . 536 zusammenge faßt sein, und das Cullakunäla-J . 4 64 end l i ch ist gedacht als
gesonderte Dars te l l ung der S t rophen 24 — 35 desse lben J .
,die
die S ch lechtigke i t der We iber behande ln.
Die E rklärung dieser Z itate ist n i ch t ganz lei c ht. Bei ob er .flächlicher Betrach tung könnte m an meinen, sie seien angeführt
,
um eine runde Zah l der J . in j edem Buche zu erre i chen ; tatsächl i ch steht auch J . 350 am Ende des betr. Buches . Daß d ies abern i c ht so is t, geht aus der A rt, w ie in den großen J . ,
w en igsten sim J . 546
,zi t iert w i rd , hervor . Hier w ird jedesma l am Ende des
betr. Abs chni tt s h inzugefügt z. B. Menda lca-j ätakam dvadasam'
pate
ni_
tth-itam. A l so muß doch das betr . J. an dieser S te l le gestanden
hab en . Auch die in den ersten Bü chern zugrunde ge legte E inte i l ung in Vagga zu j e 1 0 J . berücks ichtigt s chon d iese v er
m eintlichen fül lenden Eins ch iebungen . S o he iß t der 12. Vaggades E kanipäta, der mit dem Gadrahha—J . 1 1 1 beginnt
,nach dem
ersten Wort von dessen einziger S trophe Ha ns i-Vagga ; der m it
dem Kandari-J . 34 1 b eginnende 5 . Vagga des Catukkanipäta heiß teigentüm l icherw eise Cullakunäla-Vagga
,als ob d ieser Vagga m it
dem ebenso w ie das Kandar i—J . zum Kunäla-J . 536 gehö ren denCullakunäla-J . begänne . Wenn w ir uns ferner vorhal ten, daß die Verseder al te Kern der J . sind und daß die ersten Verse der betr. Erzäh lungen
mit einer Ausnahme (4 70) w en igstens m it i hrem Anfangin d iesen Minia tur-J . angeführt s ind , genau so, w ie es in jedemanderen J . der F a l l i s t
,m üssen w ir zu dem S ch l uß kommen
,daß
d iese Verse m it der bald h inzugekommenen Prosaerzäh l ung zuers tse lb s tändige J . b il deten und daß sie w en igstens w as das J . 545
Die al lererste S trophe um faßt nu r eine Zusammenste l lung der v er
schiedenen W eisheitsbetätigungen des Bodh isattva .
352 Jul ius Duto i t , Jätakazitate in den Jätakatexten
und 54 6 betr ifft ers t später in den Text der großen J . Aufnahme fanden . Desha l b beginn t h ier die Zäh l ung der Verse auchers t nach dem Absch l uß der verschiedenen k leineren Vorerzählungen .
Nachdem dann d iese Aufsaugung der k leinen J . in den S amme l-J .
(b esonders in 546) e rfo l gt w ar , str ich man in den vorausgehendenBüchern diese Erzäh lungen m it ihren Versen ; man begnügte s ichdam i t
,nur den Tite l und den Versan fang stehen zu lassen und
für das üb r ige auf das spätere große J . zu verw e isen . Ähn l i chverhäl t es s ich mit den in den J .
'
535 und 536 entha l tenen T eilges ch ichten, w enn auch die Voraussetzungen n i cht ganz die glei chens ind. Hier b i l den diese Erzäh lungen w en igs tens se lbs tändige Te i leinnerha lb der großen J. Anstatt
,w ie es sonst oft geschah , für
den b etr. Te i l auf das frü here J . zurückzuverw ei sen, brachte m an
den Ber i cht samt den S trophen in dem großen J . ganz und ti l gtedann unter Zi tierung desse lben die k le ineren Erzäh l ungen in denfrüheren Bü chern . Bei dem KandariJ . 341 w äre dabei e inei rrtüm l i che S tr0phenzitierung anzunehmen
,da die h ier erw ähnte
S trophe n i ch t m it der e igent l i chen Gesch i ch te zusammenhängt ,sondern den Ab sch l uß der im J . 536 vorausgehenden Erzäh l ung bi l det.
Zu untersu chen, w ann diese Versch ieb ungen statt fanden, i stein m üßiges Beginnen ; m ach t ja doch das ganze Jätakabuch inseiner jetzigen Gesta l t den Eindru ck einer erst rech t spät zumAbsch l uß gekommenen Kompi lation.
354 A . A ttenhofer
Benares . In dessen Park s itzt „Ksäntivädin , der S eher aus dem
nördl i chen Kurulande“. Der Kön ig schl äft ein. Der Rsi predigt
den Frauen und w ird von dem König durch Ahhacken der Gl iedervers tümme l t. Aus den S tumpfen fl ießt Mi l c h . Der Rei läß t n i ch tvon seiner Gedu ld und denkt n i cht an Rache. Der König komm tin die Höl le Aviei.
5 . Vinayapitaka der Mülasarvästivädin, S chach te l XVII , V01. '
IV‚
p. 63. Ed. Tokio. Kurze Erw ähnung des Vorgangs,doch m it
Beziehung auf das Kinnarajätaka. (Nach Mi tte i lung von Sylv . Levi .)6 . Rästrapälapariprcchä. E d. Finot p. 21 . Der Rei heißt
Ksäntirata.
7 . Kathäsaritsägara. N . S . P. Bombay 1 903. p. H.
Ort unbes timm t „ irgendw o am U fer des Ganges“. Der As ketohne Namen , eb enso der Kön ig. Vom Kön ig verstümme l t. Emp
findet ke inen Zorn . Eine Gottheit erb ietet s i ch,den Tater zu
töten. Der Brahmane kennt keine Rache. S e ine Gl ieder hei lenw ieder an.
8. Chines i sches Tripitaka. Chavannes,Cinq cen ts con tes et
apo logues I , p. 1 6 1 ff. Nr . 4 .
Der Bodhisattva war ein Brahmane namens Tch ’
an—t 1-ho
(Ksäntivädin). „Au m i l ieu des sol itude8 de la mon tague“
,keine
b est imm te Loka l i s ierung. Der Kön ig he ißt Kia- l i . Ver fol gt auf
der Jagd e inen Hir s ch,der am Bodh isatt va vorüberflieh t. .Da er
erst die Auskun ft verw eigert, ob er den Hirsch gesehen,dann
sagt,er hätte ihn n icht gesehen
,w ird er v om Kön ig dur ch Ab
s chne iden der Gl ieder verstümme l t. Die ganze We l t w ird er
schüttert dur ch die Le i den des Bodhisattva . Die vier großenGötterkön ige erb ieten s i ch , ihn zu rächen. Der Bodhi sattv a w eis tdie Zum utung zurück. Z um Bew e ise, daß er ke inen Zorn kennt,fl ießt aus den abgehauenen Gl iedern Mi l ch .
E in j üngerer Bruder des Bodhisattva,der eb en fa l l s als Asket
leb t, komm t dur ch Zauberkraft herbei . Als Bew e i s für die Gedu l ddes Bodhi satt va w achsen a l le Glieder w ieder an . Tch ’
an-t ’ i-how ar der Bodh isattv a, der jüngere Bruder Ma itreya, der Kön ig derArhat K iu-lin.
9 . Jätakamälä. Ed. Kern p. 1 01 111 Übersetzung von Speyerp. 253 ff.
Der Bodhisattva ist ein Asket, der von den Leuten Ksänti
Paral lelen zum Ksäntivädijätaka 355
vädin genannt w i rd . Leb t in eine r l ieb l i c hen Wa l dgegend . Der
Kön ig komm t mit dem Harem in den Wa l d,s ch l äft ein , die Frauen
finden den Asketen . Er be lehrt sie über den Dharma im a l lgeme inen, die Vortrefllichkeit der Kaänti im besonderen . Ver
stümmelung du rch den zornig-ei fersüchtigen Kön ig. Der Königversinkt in die s ich spa l tende Erde. Der Bodh isattva verkündetb is zum Tode die Gedu l d .
1 0 . Milindapafi ha. Ed . T renckner p. 201 . Übersetzung RhysDavids SBE XXXV, p. 286 .
Devadatta w ar Käsikönig namens Kaläbu,der Bodh i sat tva
ein Büßer namens Khantivädin.
1 1 . Hiuen Tsiang . Real, Buddh . Records I, p. 1 20 ff. S tan is las
Ju l ien,Memoi re I, p. 1 33. Wa tters
,On Yuan Chw ang II
, p. 227 f.
Vier oder fün f L i östl i ch von Munga l i ein S tüpa am Ort,w o
Buddha als Keäntirgi zuguns ten des Kön igs Kaliräja die Z er
s tü ckel ung se ines Körpers erdu ldete .
12. Ajanta . Bur gess and Bhagaw anlal Indrap ,Ins criptions
of the cave-temples of w estern Ind ia p. 8 1/82. Vgl . Luders,Arya
Süras Jätakamälä u nd die Fresken von Ajanta, Nachr . K . G. d . W .
Göttg. 1 902, p. 7 53 ff.
1 3 . Wong Pub . Übers . von Real, JRAS XX. Zitiert das YanKw o Sum . Buddha w ar der Bei Jin Juh (Jin '
Jo Rei. i . e.
Ksäntirsi. Anm . Bea l s). Kön ig w ar Kiao-ch in -ju (Kaundinya),genannt Ko-l i (w ho w as possessed of a c rue l and w i cked dispos i tion). Der König geh t mit seinen Frauen in die Gegend
,um
zu jagen. Der Rsi w ird v on dem e i fersü chtigen Kön ig ver
stümmelt,verl iert aber die Gedul d n i cht. Verspri ch t dem Kön ige,
daß er,nach dem er (der Rai) die Buddhaschaft er langt habe
,
der erste Bekehrte sein sol le.
1 4 . Pradeepikäw a (Jam es d’
A lw is,T he S idath S angaraw a,
p. CLX und CLXI).Zitiert aus dem S inghales is chen das Ksäntiväda-Jataka , in
dem das Zitat in Pal i s i ch findet : „may the king w ho cau se myhan ds
,feet
, cars, and nose to be cu t, l ive long ; a person of my
hab i t i s not off‘ended.
“
1 5 . Boro-Boedoer. (S . F . O l denburg, Notes on Buddhi st Art,
JRAS 1 897 . Leemans,Boro-Boudour dan s l ’ i le de Java . Leide 1 874 .
Atlas Pl . CLXI. )
356 A . A tt enhofer, Paralle len zum Kaäntivädijätaka
Nach O ldenburg w ur de es s ich h ier in Nr . 1 03— 105 um
e ine Darstel l ung des Ksäntivädijätaka hande ln . Tatsäch l i ch sindab er die B i l der so vag, daß von e iner s ichern Beziehung auf
un sre Erzäh lung kaum die Rede sein kann .
1 6 . Bodbisattvävadänakalpalatä. Nr. 36 (Raj endralala Mitra,T he S anskri t Buddh is t l iterature of Nepa l p.
„A herm i t practised austerities in a w i l derness. A king
cam e in to that fores t w i th the ladys of his house. One day,
w hile he slept, the ladys, in the course of thei r w a l k,came to
the herm its grove . T he herm it w e l comed them , and extol led thepow ers of righteousness before them . T he king, see ing a herm i tam idst the roya l dames , flew at h im in a rage
,and cu t tw o of
h is fingers. Instan t ly he fe l t a burn ing fever. T he herm i t w asthe Lord Buddha.
1 7 . Kärandavyüha. Bea l verw e is t in e iner Anmerkung auf
Bur nouf, In tr . p. 1 98 . Un ter dem Buddha Viéväbhü w ar Buddhaein Rsi nam ens Ksäntivädin. „
Dan s ce ré c i t se trouve inserré
l’
histoire de Ba l i , ce roi pu issant qui a été r élégu é aux en ferspar Visnu et qui se repea t d’
avoir sui vi la loi des Brahm anes. “
1 8. Dsanglun (I . J . S chm i d t , Der We i se und der T or .
Text p. 4 6 ; Übers . p.
Kaundinya und vier ande re w erden zuerst Anhänger Buddhas .
Buddha erzäh l t, daß das die Fol ge e ines Gel übdes sei,das er
f rüher um i h retw i l len getan. Vergangenheitserzählung: In Benares .Der König heiß t T sod-dschung (der S tre itsüchtige) , der Rsi S odpatschan (der Duldende), Gesch i chte von den Frauen. Der Kön igs ucht sie m it vier seiner Beamten. Verstümm e l ung. Wiederanw ach sen der Gl ieder . Bl ut-Mi l ch-Wunder. Der Kön ig bereut,läßt den Rsi unausgesetzt in seinen Pa las t ein und b ringt ihmOpfer. Der Rsi w ar Buddha, Kaundinya und seine vier Gefährtenw aren der Kön ig und se ine vier Beam ten .
1 9 . Mongol i sches (Mitteil. v on Prof. Grünw edel). „Da im
Dsanglun das Ksäntivädijätaka vorkommt , w ir d es auch im
mongo l is chen Migarun Da la i vorhanden sein . Der mongol is cheT ext b eruh t auf anderer Que l le als der t ibe tische Text, der aus
dem Ch inesis chen übersetzt ist. “
358 F riedrich Hei ler
als v on den außeren Dingen s i ch loszumachen, das gesunde Afl"ektund Trieb leben zu hemmen und unterdrücken
,kurz den natur
l i chen Mens chen zu„morti fiz ieren “
. Der berühm teste mystis cheHe i l sw eg w urde v on den Neuplatonikern form u l iert : v ia pur gativail l um inativa un it iva : Askese Beschaul ichke i t Ekstase. Aberdas mystis c he Beten und Be trach ten
,das die zw ei te Etappe d ieses
He ilsw egs ausmacht,s te l l t ke ine e inhe i tl iche Größe dar
,sondern
ze igt se lbs t w ieder v erschiedene .Grade und S tufen . Überal l dort,
w o das mystis che E r leb en s i ch zur Höhe psy cho logischer S e lb stana lyse erheb t und zu klassifizieren und sys tematis ieren beginn t
,
treffen w ir in der mystis chen Literatur kunstvo l le Kons truktionenv on Gebetsskalen
,in denen s i ch b isw ei len eine ers taun l i che psycho
logische F ähigke i t verrät. Proc l us und Algazzali, Johann v om
Kr euz, Teresa d i Jesu, Madame Guyon u . a. haben den S tufengang des mys tis chen Betens gesch ildert. Aber noch v iel äl terals alle d iese Gehetsskalen ist die vierfache S tufen le i ter der Versenkung (dhy5 nam ,
Pa l i j/zänam), von der die kanon is chen bud
dh istischen Texte an unzähligen S te l len mit stets den gle i chenform elhaften Worten reden .
Der achtgl iedrige he i l ige Pfad nennt das rechte S ichversenken“
(sammäsamädhi) an le tzter S te l l e. Die S e lb stversenkung ist in derT at fur den buddh isti s chen Bhikkhu „der Gipfel des ge is t l i chenLebens , der S chlußstein der Diszipl in ; sie a l lein führt in letzterInstanz zum Zie le “
zum Erlös chen des Lebensdurstes (tamhä) undzur Be fes tigung der Erkenntn is (fi änadassanam ) Die Versenkunghat zur Voraussetzung die S ittl i chke i t und Askese, genau so w ie
in der aben d ländis chen Mystik der v ia i l l um inat iva die via pur
gativa vorausgehen muß. Der Bhikkhu , der ein Ar hat zu w erdenver langt
,muß die Gebote (si la) ha l ten, die Buddha ge lehrt hat
und Vinaya eins chärft ; er muß si ch in der S elbstheherrschung
üben, muß se ine S inne gegen die Außenw e l t vers ch l ießen , muß dieim Herzen lebendigen Aflekte und tr iebhaften RegungenErst w enn er die gefährli chen fün f Hindern isse (pai wa nivaraqze)We l t l iche, Bösw i l l igke i t, Träghe i t, Angst und Zw ei fe l durch die
asketis ch-eth is che Arbeit an s i ch selbs t b esei tigt hat,i st die Grund
K o eppen I , 585.
A n esak i 703 f .D I I 1 — 74 ; A n e s ak i 703 .
Die buddh istischen Versenkungsstufen 359
lage für die Versenkungstätigkeit gegeben (D. II Die Ver
senkung vol lendet, w as die asketisch-s i ttl i c he Ans trengung be
gonnen : die Losreißung von a l lem Ird ischen, die Aufhebung desna iven S ee len lebens . In der v ierfältigen Versenkung (dhyana-m ')
catu rvidham) vol l zieh t s i ch der mystis che Prozeß des anupubba
m‘
rodha (d. h . der Zerstörung des jew ei l s vorhergehenden S ee lenzustandes [D. XXXIII 3, 2 VI ; vgl . C h i l d . der sukzessivenVerein fachung, Reduktion , Ent leerung des gesam ten in te l lektue l lenund emotione l len S ee lenlebens derse lb e Prozeß , den die Neuplaton iker mit e inem treffenden Term inus än lw cn g nennen, die
deu tschen Myst iker mit einer w undervo l len Prägnanz als „E nt
w erden“ bezeichnen. Das Erleben des be trachtenden Bettelm önchsverl iert imm er mehr den Zusammenhang mit der gegenständl i chenWelt, wird imm er e inhei tl i cher, unbes timm ter, ärmer, inha l tsleerer,b is s ch l ieß l i ch ein gei stiger Nu l lpunkt erre i ch t ist, ein der Ekstaseverw andter Zustand der vö l l igen inneren Unberührthe it und Einhei t.
Der mora l is ch gefestigte Mönch zieht s ich an einen abgelegenen, zu st i l ler S amm l ung gee igneten Ort zur ück , am häufigstenin die Waldeinsamkei t (D. XXII 2
,Th . G . 537 n imm t die
kontemplat ive Hockerstellung mit gekreuzten Be inen ein, r ich tetden Oberk örper auf
,atmet in rege lmäßigen Interva l len aus und
Die buddh ist ische Literatur verw endet für Versenkung zwei Term in i,die in ihrer Bedeutung s ich berühren , b isw ei len sogar e inander substituiertwerden (D. XXX I I I l , 10 ; XXXIV 1
,4 ; H a rdy gleichw ohl aber
n icht zusammenfa l len : samadhi und jhänam . S amadh i ist ein v iel w ei tererBegriff ; er beze ichnet n icht eine best imm te seel ische Tät igke i t, sondern e inendauernden see l ischen Zustand, einen b le ibenden ge ist i gen Hab itus , e ine ständigeseel ische Qual ität (C h i l d. 423 ; Ko epp enll 585 ; R . Dav i ds , Y. M. XXV fi . ,
A n e s ak i S amähito ist e ines der charakteristischen A t tribute e inesA rhat. Man w i rd Samadh i am besten m it Gesammeltheit , Konzentrierthe i t ,Andacht, Versunkenhe i t, Geistesstille w iedergeben ; Samadh i is t das Gegentei l von Zerstreuthei t, ge isti ger Z erfahreuheit (K o eppe n I 585 R . Dav i ds ,Y . M. Samadh i ist bere its eine Voraussetzung für die Übung desv ierfacben Jhäna ; sie v ertie ft s ich, wächst und ste igert s ich im Verlauf derv ier Versenkungsstufen und erlangt so ihre Vol lendung (vgl. D. XXII 21 ,C h i l d. Nach H a rdy (270) ist S amadh i U rsache und Wirkung des
Dhyana zugleich. A n esak i (702) bezeichnet Dhyäna als M itte l zur E r
reichung von Samadh i (vgl. Ke r n I 483 In den Pitaka bedeutet S amadhike in myst isch-ekstatisches E rlebnis oder ein M i tte l zur E rlangung e inesso lchen ; erst im späteren Yoga hat sich ein so lcher Bedeutungswechselvo l lzogen (vgl. R . Dav i ds , Y . M. XXVII) .
360 F r iedr ich He i ler
ein (anapana) und achtet auf seine Atem züge,seien es nun kur ze
oder lange Atem züge (D. XXII Nachdem so durch die unb ew egliche Körperha ltung w ie durch die strenge Regu l ierung derAtm ung die phy s i s c h e Tä tigkei t vereinhe it l i ch t und auf ein Mindes tmaß reduziert ist, beginn t m it der Fixation der Aufmerksamke i tdie Vereinhe itl i chung und Reduktion des psy c h i s c h e n Lebens .
viac'
ce’
eva kamet Entronnen den Lüsten,vz
'
zn'
cca akusalehz'
dhamm ehz'
entr onnen den s innli chen Dingen,erlangt er
savitakkaa_n savicä
'
ram2) die mit Erw ägung und Über
legung “) verbundene,
vivekaj argz“) piti suklzm
_n aus der Ab sonderung 3) geborene,
glück und freudenrei chepathamaj ihänam upasampaj j a e r s t e S tufe der Versenkung undviharati. verw ei l t auf i hr.
Hauptstel le für die Beschre ibung des v ierfachen Jh‘
a'
na D. I I 7 5 11 .
(Sämannaphala-Sutta) ; die Beschre ibung kehrt in derselben F assung w iederD. I 3, 2I fi . ; IX 10fi . ; XVII 2, 3 ; XXVI 28 ; XXIX 24 ; M. I l
,4 ; III 1 ,
8 ; A . II 2, 3 (Ausgabe der Pali -Text-S oc . I III 58,2 (I 63
,5
(I 182) usw . Vgl. Dh . S . 160 11 ; Lal. V ist. p. 1 47 , 439 . Übersetzungen und
E rläuterungen der Beschreibung bei E . B u r n o u f, Le Lotus de la bonus loi1 852
,H a rdy 270 ff. , derselbe, T he Legends andTheories of the Buddha
1 7 9 f. ; K o eppen I ö87 fi . ; H . A l a b a s t e r , T he Wheel of the Law 1 87 1,
1 92fi . ; C h i l d. 1 69 f. ; P. B ig an de t ‚ T he life or legend of Gaudama, the
Buddha of the Bum ese 1880 II 204 fi . ; K e rn 1 479 ff. ; W a r r e n 374 ; T. W .
Rhys Dav i d s , Buddh ist Suttas , SBE XI 1880 , 272; DerBuddhismus, deutschv . R . P fu ng e t 1899 , 1 82ff. ; R . Da v i d s , B. M. 43ff. ; K . E . Neum an n ,
Die
Reden Gotamo Buddhas aus der m it tleren S amm lung 1 1896 , 33fi . ; H .
H a c km an n , U rsprun g des Buddh ismus 1905, 22f. ; R . P i s c h e l , Leben und
Lehre des Buddha 1906 , 9 1 fi . ; L e hm an n 202; A n e s ak i 703 ; O . F ran cke ,
Digha-Nikäya in Auswah l überse tz t 19 13, 7 5 f.2) Die spätere buddh istische Psychologie (A t thasälini 1 14 f. ‚ Dh . S . 7)
sucht die be iden v erw andten Term in i voneinander abzugrenzen und j edemeine gesonderte Bedeutungsnuance zu geben : vitahka ist der erstmaligeAkt der Aufmerksamkeitsspannung, das wil lkür liche S ichhinwenden zu einem
bestimmten Bewußtseinsgegenstand, das w i l lentl iche E rgreifen einer Vorstel lung ; vicara h ingegen das bewußte F esthal ten der e inmal gefaßten Vorstel lung, die logische Fortfuhrung eines Gedankens in syn thetischer wie ana
lytischer Weise, die phantasiemäßige Vertiefung und Ausgestal tung e inerVorstel lung. R . Dav i d s
,B . M. 1 0 f‚ ; vgl. B iga n de t a. a. 0 . II 204.
Viveka w i rd von der großen A nzahl der Übersetzer als Loslosung,Iso l ierung, Trennung, Absonderung, E insamkei t v erstanden . K o eppen (I
362 F riedrich Hei ler
Gegenstand der buddh isti schen Medi tation b i l den die großen Wahrhei ten von der Kürze und Vergängl i chke it von der
Nichtigkei t und Wesen losigke i t des Daseins (anatta) und vom
un i verse l len Le id (dukkham ). In B i l dern und Verglei chen suchts ich der Med itierende d iese Wah rhe i ten zu phantasiemäßiger Anschaulichkeit zu b ringen . „Die Ges ta l t des Körpers glei cht denWegen des Meeres
,die s i ch für einen Augenb l i ck erheben und
ebenso ras ch vers chw inden ; die Empfindung entsteh t w ie der
S chaum,w e l cher von den aufeinanderstoßenden Wogen spritzt ; der
Gedanke geht ebenso s chne l l vorüber w ie der „Der
Le ib ist unw irk l i ch,genau so w ie die Luftspiege l ung, die im
S onnens chein s i ch zeigt, w ie ein gema l tes Bi l d , w ie eine Spei se ,die man im Traum e s ieh t. “ Durch den s teten Kre is lauf von
Gebu rt und T od ist j edes füh lende Wesen Gegenstan d s tetenLei dens ; es i st w ie eine Eidechse in einer Bambushöhle, die an
bei den Enden b rennt ; w ie ein lebendes Gerippe, beraubt von
Händen und Füßen und in den S and gew orfen ; w ie ein Kind,
das,w e i l es n i ch t geboren w erden kann
,stückw e i se aus dem
Mutter le ib herausgeschni tten w ir d “
(H a r dy Um des LebensEitel ke i t und Elend t ief zu erfassen, erw ägt der Mönch nach dermethodi schen Anw e isung des S atipatthäna-S utta (D. XXII) derRe ihe nach die versch iedenen S tell ungen und Bew egungen des
Körpers, die tägl i chen Hand lungen des A nk le i dens , Essens , Trinkens,Redens und S chw e igens, die 32 Bes tandte ile des mensch l i chenLe ibes
,das S ch i cksa l des toten Körpers ; w enn ihm so der Unw ert
des phys is chen Lebens k lar gew orden ist, w endet er s ich dempsych is chen Leben zu ; er durchläuft die versch iedenen Wahrnehm ungen, Gefüh le und Afi
‘
ekte,die Skandha, die S innesorgane
und i hr e Objekte . Nun ist ihm die erste der vier he i l igen Wahrhe iten ganz au fgegangen : das Lei den, dem a l le Wesen unterw orfens ind ; nun s chrei tet er fort zur Betrachtung der Ursache des Le i dens,ih rer Zerstörung und des Weges , der zu ihrer Zers törung führt.Die buddh istis che Term inologie bezei chnet diese Art der Betrachtung,die übera l l die d unk len S e iten hervorhebt
,die übera l l nur das s ieht,
w as Eke l am Leb en erzeugt, asubha bhävanä,die Med itat ion des Un
reinen, Häßlichen (Hardy Im engeren S inne ist am bha-b/zä'
vanä
B igan de t I I 234 bei K e rn I 474 .
Die buddhist ischen Versenkungsstufen 363
oder -j izänam die Betrachtung der zehn v ersch iedenen Zuständedes Le i chnam s : „
der au fgedunsenen,ents te l l tem, mit Geschw üren
bedeckten Le i c he der Lei che m it au fgeb rochener Haut,der zer
bissenen und zermasenen, in S tü cke zerschn ittenen, ve rs tümme l ten,
b l u t igen ,v on Würmern he imgesuchten Le i che ,
des S ke letts “(Dh. S . 264 , R. Da v i d s
,B. M. Das is t auch me ines Le ibes
Natur und S ch icksa l,es gib t ke ine Ausnahme
,
“ i st der düstereRefra in, in dem nach dem S atipatthäna
-S utta j ede der neun Betrach tungen über das S ch i cksa l des toten Körpers ausk l ingen so l l(D. XXI I In e inem j üngeren Meditationsrezept w i rd sogarempfoh len , e inen w i rkl ichen Leic hnam aufzusuchen und vor ihm
die Betrachtung über die Nich tigkei t des Dase ins anzuste l len(H a r dy
Die Be trachtung des Häßlichen, die E rw agung der U nbes tändigkei t, Unw irk l i chke i t und des Le idens , die Erkenntni s der Ursachealles Elends l öst in dem medi tierenden Bhikkhu e inen Abschei1an We l t und Leben aus, tö tet das naive Lebensge füh l
,zerstö rt
das Begehren und Wüns chen . Das frühere Bew ußtsein des Verlangens w ird v ern i ch tet “ (tassa yä pum
'
ma käma-safzfzä 3ä niruj jhatz'
;
D . IX S o löst er s ic h von der Welt des Unw ertes und
des Leidens los (viveka) und ge langt zum Zus tan d der Abges ch iedenhei t und inneren F re i hei t, des t iefen seel is chen Glückes . Einenachha l t ige, bre i te , von san fter Lust gesättigte S timmung überkommt den Med it ierenden, meis t w oh l mit e inem l e i sen Einsch lagvon U n lu st. Wir können w en igs tens vermuten, daß der „
süßeS chmerz“ , den chris t l i che Mys tiker füh l ten , dem das Asubha—jhäna
übenden Bh ikkhu w oh l v ertraut w ar, w enn auc h die knappe
Charakteris tik des ersten Versenkungsgrades davon n i chts erw ähn t .Die Tiefe und Nachhal t igke i t der Luststimmung, die aus der
Meditation herausw ächs t und den ganzen Körper durchstromt, w ir dim S ämafifiaphala
-S utta in e inem ans chau l i chen Bi l de verdeutl i cht :„Er tränkt d iesen seinen Le ib, überschü ttet, erfü l lt und durchdr ingt ihn mit dem aus der Los l ösung geborenen tiefen Glü cksgefüh l
,so daß ke in einziges Winke l chen von der Freude und dem
Glück unberührt b le ibt.“Auf der zw e i t en S tu fe der Versenkung schrei tet die Ver
engerung des Bew ußtseinsumfangs w e i ter fort .
364 F r iedrich Hei ler
f u na ca par am bhikkhu
vitakka -vz'
cäranam vüpasam ä'
aj j hattam sampasädanam
cetaso ek0diblzäzzam
avitaklcam avicäram
sam ädhgazn piti-sakham
du tz'
yajjhänam upasampcyya
v ihara ti.
Die krampfhafte A ufmerksamkeitsspannung los t s ich , die
angespannte inte l lektue l le Tätigke it des Reflektierens und Rasonn ie t ens , Vergle i chens und S ch l ießens komm t zur Ruhe
,das rege
Spie l der Phan tas ievorste l l ungen endet,es tritt „ innere Meeres
st i l le“ein. An die S tel le des he l lw achen Zustandes, in dem s i ch
der Med it ierende b efan d, tritt ein anderer, überw acher Zustand,der Zustand des se l igen Friedens , der w onnevollen Ruhe, deren tzückenden Klarhe i t und Gew ißhei t
,der vol len Zufr iedenhe i t
,
des frohen Getrostseins. Die sanfte Luststimmung, die aus der
Erhebung uber die We l t der Vergängl ichke it und des Le i denshervorgegangen w ar
,er langt die A l leinherrscha ft ; die w i l l kürl i che
Hinw endung auf bes timm te Bew ußtseinsgegenstände, die das w esentl i che Merkma l der ersten Versenkungsstufe ausmacht
,feh l t ; die
konkreten Objekte der Meditat ion, m it denen s i ch der Bhikkhuzuvor angestrengt b es chäftigt hat
,sind gänz l i ch aus dem Bew ußt
se in vers chw unden oder s tehen als dunkle Erinnerungsb i l der imHin tergrund des geis tigen B l i ckfe l ds : die lustgesättigte S t immunga l lein ist geb l ieben . Der Betra chtende ist ganz in s i ch gew endet,in s i ch versunken , ruht in s i ch se l bst, i s t innerl i ch gänz l i ch eine
gew orden,er l eb t se in e igenes Ich .
Die En tleerung und Vere infachung des Bew ußtseinszustandesfüh r t noch w e i ter.f una ca param bhikkhu Wenn dann der Bhikkhupitiya ca virägä nach dem Verb lassen der Freudeupelchalco ca. viharati im Glei chm ut verharrt
,
sata ca sampaj äno e insi ch tig und vo l l bew ußt,
Indem nunmehr der Bhikkhudem Erw ägen und Über legen ein
Ende mach t,erlangt er t iefe innere Ruhe
,
das Einsw erden des Ge istes,
die v on E rw ägung und Überlegung freie
,
ausder S e]bstvertiefunggeborene,glück und f reudenre i che
zw e i t e S tu fe der Versenkung undverw ei l t auf ih r.
366 F riedrich He iler
Das vierte Jhana ist ein Zus tan d emotione l ler E rstorhenheit‚
es herrs cht vö l l ige Gefüh l Affekt u nd Wuns ch losigkeit,gänz l i che
Apath ie ; der Kontemplierende i st bei dem Zustand vö l l iger ge istigerLeere und Einförm igke i t ange langt ; a l le konkreten seel i schen Inhal te sind bese i tigt ; das bun te Spie l des natürl i chen see l i schenLebens hat Über Lust und Un lust erhaben
,frei v on
Liebe und Haß, gleichgultig gegen die We l t
,gegen Götter und
Menschen , gegen si ch se lbst, w e i l t der M önch auf der Höhe dersan cta indifferentia
,des vol lendeten Gle i chmuts (up8khä). Nun
ist er aus einem S ekha (S chü ler) ein Arhat, ein Heil iger gew orden ,der dem Nirvana n i ch t m ehr ferne steht. Die vierte Versenkungss tufe ist zw ar noch n i ch t das w ahre Nirvana, das Endz ie l a l ler
ab er aus i hr ist der Tathagata unm i tte lbarins vol l kommene Nirvana e ingegangen (D . XVI 6
,Wei l die
letzte Versenkungsstufe n i cht mit dem Nirvana iden tis ch ist , darum bedes Patafi jali interpretiert , beruft s ich auf den Yogascholiasten Bhoja
,
w elcher an e iner S tell e par isuddhi m it p ravilaya (U n terdrückung) komment iert und übersetzt
„disparaitre
“oder
„perte“. Dabe i w ird in unzutr efi ender
Weise upekhä als„Sorge um j eden Gegenstand“
und sati als„Gedächtn is“
gefaß t . Die Richt i gke i t der äl teren Übersetzung ist durch diese Deutungn icht ernstl ich in Fr age geste l l t . Die Palikommentare b eze ichnen upekhä
neben cittekaggatä (E inhei tl ichkei t, Konzentrierthe i t des Ge istes, ein Aquiv alen t v on samädhi) als das Charakteristikum der letzten Versenkungsstufe(A n e s ak i Die Parallelskala der v ier Bhävanä erre icht g leichfal ls in derupekhä ihr en Höhepunkt . Die poesievolle S childerung des Zustandes der
heil igen G leichgül tigkei t im Car iyä-Pi taka II I 1 5, 4 (s. u.) redet in e in emsynoymen Ausdruck eben falls v on der
„Vo l lendung des G le ichmuts“ (upekkhä
pär ami) . Vgl. auch die ausführ l iche Beschreibung der Upekhä-S t imm ung inder s iames ischen S chrift über die sieben W ege zum Nir vär
_
ra (B igan de ta. a. 0 . II Die Übersetzung „
Läuterung“
(R . Da v i d s , F r an ck e)ist m öglich und durch die Grundbedeutung wie durch das B ild von der
w eißen Kleidung gerechtfertigt . Der San skrit tex t Lal. V ist. p. 439 hat
viéuddham, w as ausschließlich mit „ge läutert“ w iedergegeben w erden kann .
Der die gedrungene psycho logische Beschreibung erläuternde Vergleich versinnbildet sehr schön diesen Zustand der Leere :
„W ie w enn jemand
v om Kopf b is zu den Füßen w eiß gekle idet das i tzt , so daß kein e einz igeS te l le seines Körpers nicht w eiß umhül l t w äre, geradeso s i tzt ein so lcherBh ikkhu da
,diesen seinen leib l ichen Korper mit Geistesläuterung und
-reinigung durchdringend, so daß n icht das k leinste W inkelchen desselb enundurchdrungen b le ib t“ (D. I I 81 , F r an ck e a. a. O .
Die Iden tifizierung ir gendeiner S tufe des Jhäna m it dem Nirväna
w ird im Brahm ajälasnt ta D. I 8, 21 5 . als häret isch gebrandmarkt.
Die buddh i stischen Versenkungsstufen 36 7
deutet sie auch n i cht ein tota les Er l ös chen des Bew ußtse ins ; w irhaben es h ier auch n i cht m it e inem pathologischen Zustandekstati scher oder hypnotischer Bew ußtlos igke i t zu tun, sondernmit e inem Zustand höchster Bew ußtseinssteigerung. Jene g rand ioselnditferenzstimmung i st nur bei hö chster Spannung seel is cherAktivi tät mögl i ch und verträgt s ich n i ch t mit e iner Bew ußtse instrübung. Die Upekhä, in der die Versenkung des buddh is tis chenBette lmönchs gipfe l t, gehört darum zu den w unde rbarsten Außerungen der mystisc hen F römm igkei t . S ie hat ihre Para l le len inder S e l igke i t der Männer der Upanischadeu , die in der S ti l l eden A tman verehren , in der äm i&eza des S toikers , in der novxogza r ciaw mg, in der Plotin das Eine er leb te
,in dem Zustand der
„Ge lassenhe i t“ , der „Ein fä l tigkei t, Lauterkei t und Bloßheit“ , von
der Meister Eckart begei stert im amor dei intellectualisdes Spinoza, im „
mys tis chen T od“ der Madame Guyon .
Neben der S tufenreihe des vierfachen Jhäna kennt die buddhistische Literatur eine zw ei te paral le le Versenkungsleiter , die von
einem anderen Ausgangspunkt ebenfa l l s in vier Etappen zur Höheder upeklzä emporführt. Es s ind das die vier bhävanä oder appa
m afzfiä (auch brahmav«ihära genannt) Bhävanä' ist das Entstehen
lassen, d . h . die w i l l kü r l i che und ab si cht l i che Erzeugung,in der
Sprache der ch r istl i chenMystik die „E rw eckung “
eines bestimm tenGefühls
,h ier e ines bes timm ten sozia len Gefühle. In den vier
Bhävanä darin l iegt der Hauptuntersch ied von den vier Jhänahande l t es s ich stets um e ine sozia le S te l l ungnahme zu den anderenfüh lenden Wesen . We i l d iese Gefüh le s ich ohne Einschränkungauf a l le Wesen beziehen, heißen sie appamafzizä, „
unbegrenzte “
Gefüh le . Im Anguttara Nikäya“) sagt Buddha von der Übung der
Bhävanä :„Nach der Mah l ze i t, w enn i ch von dem Almosengang
zurückgekeh rt bin,gehe ich in den Wa l d . Da hänfe i c h Gräser
oder Blätter, die s ich dort finden,zusammen
,setze m i ch n ieder ,
mit gekreuzten Be inen,den Kö rper gerade aufrich tend , das Antl itz
m it w achsamem Denken umgehend. S o verw e i le i ch,indem i ch
die Kra ft des Woh lw ol lens, die me inen S inn erfü l l t, über e ineA . S pam e r . Texte aus der deutschen Myst ik 19 12, 49 .
2) Vgl. C h i l d. 85, 51 , 95 ; K e r n I 47 1 f.II1 63 , 6 (I p. vgl. D. XIII 76 fi . ; XVH 2
,4 ; XXV I 28 ; Dh. S .
254 fl . ; 0 1denh e r g ‚ B. 350 f. ; K e rn I 47 1 ; P isc h e l a. a. O . 82.
368 F r iedrich Hei ler
Himme l sgegend hin si ch erstrecken lasse ; ebenso üb er die zw e ite,die dritte, die vierte, aufw ä rts , abw ärts
,in die Quere, nach a l len
S e i ten hin , in a l ler Vo l l s tändigkei t, über die ganze We l t hin lassei ch die K raft des Woh lw o l lens
,die me inen S inn e rfü l l t
,des
w e iten, des großen, des unbegrenzten , des von Haß und Übe lw o l len freien, si ch erstrecken.
“ Mit dense lben Worten sagt erdas v on
„der Kra ft des Mitlei ds , der Kra ft der F reude, der Kraft
des Glei chm uts “ . Der cey lonesi s che Kommen tar des Visuddhi
Magga (H a r d y gib t e ine nähere methodis che Anw eisun gfür die Übung des Woh lw o l lens (metta-bhävanä). Der Betrachtendegeht von der S e lbs t l iebe aus und übe rträgt das Glücksverlangenvon der e igenen Person auf a l le anderen Wesen :
„Mögen a l le
h öheren Wesen gl ück l ich se in,frei v on S orge
,Krankhe i t und
F ein .
“ Diesen freun dschaf tl i chen Wunsch such t er nun au ch auf
seine Fe inde anszudehnen,indem er s ic h k lar macht
,daß au ch
der F e ind w ertvo l le Eigenschaften b es itzt,daß a l le Menschen in
früheren Gebu rten Verw andte w aren ; er erinnert s ich , w as fürQua len der Höl le der Haß nach s i c h zieht
,w ie umgekehrt Metta
die Arhatschaft b egründet oder doch w en igsten s die Wiedergebur tim Himm e l e in trägt. Wenn er durch so l che E rw ägungen ein
a l l gemeines.
Gefüh l des Woh lwo l lens gegen a l le Wesen erw eck that
,differenziert er d ieses S ozialgefühl; er füh l t s ic h in i hr Le iden
ein und hegt den Wuns ch,daß es besei tigt w erden möge (karunä
bhävanä, die Übung des Mit lei ds , vgl . C h i l d . dann füh l t ers ich in i h r Glück ein und hegt den Wunsch , daß es nie ent
w e i chen möge (m uditä- bhävanä die Übung der Mi t freude , vgl .C h i l d S o w achsen die stimmungsgesätt igten Gefühle desMi t le i ds und der Mi tfreude unm i ttelbar aus dem unbestimmteren
Gefüh l des Woh lw o l lens heraus . Die Gefüh l sintens ität der kar unäund m uditä-bhävanä i st gegenüber der der m etta-bhävanä w esentl i ch erhöht ; die in te l lek tue l len Prozesse des E rw ägens und Überl egens , die nö tig s ind , um das un i verse l le Gefüh l des Woh lw o l lenszu erzeugen , treten ,
nachdem eine Gefühlsbasis geschaffen ist,
zurück ; das sozia le Verhäl tnis zu den anderen füh lenden Wesenist enger ; die anderen stehen dem Mitle i denden und S ichm itfreuenden
unglei ch näher als dem Woh lw ol lenden : die Distanz zu den anderen,
die im Woh lw o l len steckt,i st aufgehoben . Aber es ist charak
teristisch für den Buddhismus w ie fü r die mys tis che Frömm igkei t
37 0 F riedr ich He i ler
stellung „Wa l d “
; d iese sub sum iert er un ter die genere l lere Vorste l l ung „
Erde“. „Indem er dann üb er a l le konkreten Vorste l lungen
(über a l les Bew ußtsein von den Gesta l ten) h inauss chrei tet (sc bbasar üpasafzüäzzam sam a tz
'
lcamm a)1) faß t er den Gedanken : „
Der Raumist unend l ich “
und erlangt so den Begr iff der Raumunendlichkeit(äkäsanafi cäyatana) und verw e i l t bei ihm . Indem er dann den
Begriff der Raumunendlichkeit h inter s i ch l äßt, faßt er den Ge
danken : „Das Bew ußtsein ist unendl i ch “
und er langt so den Begriffder Bew ußtseinsunendlichkeit und verw eilt beiihm . Indem er dann den Begriff der Bew ußtseinsunendlichkeithinter s i ch läß t , faßt er den Gedanken : E s ist n i chts “ und er langtso den Begriff der Nichtsheit (äkifi cafi fi äyatäna) und häl t ihn fe st.Indemer dann den Begriff der Nichtsheit h in ter si ch l äß t, errei chter den Zustand , in w el chem w eder Bew ußtsein noch Unbew ußtseinvorhanden ist (nevasaäM Oft w ird noch ein
fünfter Grad der abs trakten Versenkung erw ähnt : „ Indem er den
Zustand,in dem w eder Bew ußtsein noch U nbew ußtsein vorhanden
ist,verl äß t
,erre i ch t er die Zers törung v on Bew uß tsein un d Emp
findung (saizzi ä-vedayita-nirodba).
Diese vier A ruppa w erden haufig in den budd h is tis chen Textenunm itte lbar an die vier Jhäna angehängt und so e ine S ka la von
acht Versenkungsstufen konstru ie rt, die als die acht samäpa tti b ezei chnet Aber diese Verb indung is t eine rein äußerl i che klassifikatorische Komb inierung zw e ier versch iedener Versenkungsmethoden . Daß die vier Grade der abstrakten Versenkun gn i ch t die gerad l in ige natürl i che Fortsetzung der vier Jhäna s ind
,
lehrt s chon der Um stand,daß erstere an versch iedenen kanon is chen
S te l len (D . XVI 3,33 ff. ; M. III 3
,I ) als vö l l ig se lb ständige, in
si ch gesch lossene Re ihe erscheinen, die zum vierfachen Jhäna inkein er inneren Beziehung s teh t. Aber noch s ch lagender s in d diepsychologischen Versch iedenhei ten der be i den Versenkungsarten .
Den Ausgangspunkt der vier Jhäna und Bhävanä b i l det die ernsteBetrachtung der großen re l igiösen Wahrhe i ten , den Endpunkt ein
1) Derselbe Ausdruck findet sich bei Meister E ckehart (a. a. O . I 202)
Der Ge ist m uß h i n au s s c h re i t en über die Dinge und al le Dinglichke it,über die G e s t a l t un g en und alle Gestaltigkeit .
2) C h i l d . 428. D. IX 10 ff. ; XVI 6 , 8 ; XXX I II 3, 2, V ; M. I 1 , 18 ;I 3
,5 ; II I 2, 3 usw .
Die buddh ist ischen Versenkungsstufen 37 1
ü berw acher , v o llhew ußter Zustand,der durch hö chste ge istige
lntensitiit ausgeze i chne t i s t . Den Ausgangspunkt der vier Aruppab i l de t ke ine auf re l igi öse O bjekte zie l ende Med itation, sondern diere in inte l lektue l le Tätigke i t des A bstrahierens
,deren S toff außer
re l igiöse,neutra le Vo rste l l ungen abgeben ; den Endpunkt b i ldet
ein unterw acher , unbew ußter Zustand , e ine Art der Hypnose, derm agische Tiefs ch la f. Wie der Körper in kataleptischer S tarreunbew egl i ch b le ib t
,so i st au ch das bew ußte S eelen leben zum
gänz l i chen S ti l l s tand gekommen ; das Bew ußtsein ist untergegangen .
Dieser hypnotisc he Zustand des safiää-vedayita-n irodha unter
scheidet s i ch nach e iner S te l le des m i tt leren Kanons (M. I 5,3)
v om w irk l ichen Tode ledigl ich dadurch,daß nur Bew egung
,
S prac he und Denken (Ä‘
cTytl , vacZ cz'
ttasaizkhära ), n i ch t auch Leben(äyu) und Wärme (usmä ) aufgehoben s ind (C h i l d . Die
upelchä , die grandiose Indifi‘
erenzstimmung, in der die Jhäna und
Bhävanä gipfe ln, und der süfi fiä-vedayz'
ta-nirodha , die tota le Be
w ußtlosigkeit, in der dieÄruppa ausmünden , sind kon träre psych ischeZustände
,aus
,ganz vers ch iedenen psych is chen Vorgängen heraus
gew achsen. Hier ein Höhepunk t mys tis chen Er lebens, geborenaus der rel igiösen Betrach tung dort ein pathologischer Zustandder Bew ußtseinsunterb rechung, erzeugt durch die Kunst der S e lb sthypnose ; h ier echtes re l igi öses Er leben dort e ine erlernbarePsychotechn ik , deren re l i gi öser Charakter zu bestre iten i s t.
Es kann kein Zw e i fel darü ber he rrschen,daß diese Methode
der abstrakten Ve rsenkung und i hre sys temati s ch-psychologischeAusges ta l tung n i ch t eine S chöpfung des u rsprüngl i chen Buddh ismusi st. Dagegen spr i cht schon die ganze re l igiöse Hohe i t und dersittl i che Erns t
,der Buddha s Persön l i chke i t und se ine Heilsanw eisung
besee l t. Jene Art des S ichv ersenkens muß als fester Modus destra in ing of sou l s chon vorher bes tanden haben und von außenher in den Buddhismus eingedrungen sein . Daß man s chon vor
Buddh a die A ruppa kannte und üb te,lehrt die a l te
nach der Buddhas Lehrme is ter Alära Käläma und Uddaka zuso l chen Zus tänden ge langten ; ersterer brachte es bis zum Zustandder „Nichtsheit
“
,letzterer zu dem des „Weder-Bew ußtseins noch
Nich tbew ußtseins“. Aber d iese l be Erzäh l ung ber i chtet auch
,daß
A riyapariyesana—Sutta M. I 3
,6 ; vgl. Lal . V ist. p. 295 f.
24*
372 F riedrich He i ler
Buddha s ich von be iden lossagte, w e i l er i hren ge i stl ichen Übungenden re l igiösen Charakter ab sprach . Nich t Alära Kalama hat
Glauben , i ch hab e Glaub en ; n icht A. K. hat Kraft,Bew ußthei t
(sa ti) Konzen tration We i sheit (pafifiä), i ch habeKraft usw .
“ In diesen Worten l iegt eine unverkennbare AbsageBuddhas an die Methode des ab s trakten S ichv ersenkens. DieseMethode entstamm t jener Rich tung des myst is chen Lebens, dieYoga, d . h . Anspannung ‘
, genann t w i rd , ein Term inus , der denm ethodis ch-techn i s chen Charakter d ieser Art v on Mystik gu t veranschau lich t. Yoga gestal tete unter Zuhi l fenahme u ra lter magischerPrak tiken 1) die sub l ime Atman -Mystik der äl teren Upanischadeuzu e iner mystis chen Psychotechnik um ; die Samkhya-Ph ilosoph iel ieferte ihr ein theoret isches Fundament : so entstand der psychologis ch durchgebildete Yoga , der noch unsystemat is ch in den
j üngeren Upanischadeu vorl iegt und vie l später in den Yogasütrades Pätafijali und deren Komm en taren eine s treng systemati s cheZusammenfassung Der von der Samkhya-Phi10w phietheoretis ch un te rbaute Yoga hat zw ei fe l los auf die Entstehung desBuddhi smus bedeutsam e Einflüsse Aber auch in der
der Ursprungszei t fo l genden Epoche s che int ein S trom v on YogaVors tel l ungen und Yoga-Praktiken in die rel igiöse We l t des Buddhismus si ch ergossen zu haben . Zu diesem gehö rt auch die
Methode der ab s trakten Versenkung und i hre K lass ifikation in
v ier bzw . fünf Grade.
Abe r n i ch t nur die den I dea len Bu ddhas w i dersprechendenA ruppa, sondern auch die vier Jhama t ) und die vier Bhävanä, dieecht buddh ist isch s cheinen, sind keine originalen Produktionen desBuddh ismus . Die Bezei chnung der v ier S ozialgefühle als Brahmazustände (brahmavihära) deutet auf ihre brahmani s chedie v ier Bhäv anä keh ren in den Yogasütra des Patafijali m it
1) Vgl. O l de n b e r g , U . 258 ff.2) E ingehende Darstel lung des systematischen Yoga bei P. T üx e n ,
Yoga, E n Oversikt over den Systematiske Yogafilosofi 1 9 11 .
8) Vgl. J a c o b i , Der U rsprung des Buddh ismus aus dem Sämkhya
Yoga , Nach richten der K . Gesellschaft der W issenschaften zu Gö ttingen 1896 ;S e n a r t , Bouddh isme et Yoga ; O l d en b e r g , U .
Der Term inus Dhyana findet sich Chänd. Up. VII 6 .
5) K e rn I 472, O l den b e r g , U . 826 . Vgl. den Term inus arüpa
brahmalolca .
3“ ma n; Heiler
w hrrindet M auf der dritten r im.
h onda, so daß,
nur mehr m äa M ü hle t. Wie in jungembuddhistischen h in sißh fionea ist hier der ste \ erseukungsgradIn msi Grade Du M ein ar dritten Stufe der
M M in \ on ea°priebt dem,f-«Han.deszweiten
beddhb tisc ln o JN BI . Da an ! “ der dem Yogastnle hat inde r buddhistischen S kala kein Aqnin lent.
Alle diese Momenle M m es gewißdaß die Stufenleiterder vier Ihm pri buddhid nehen Urse ist iii Davids
, Y,noch die psychologischen Kategoen , welche die bad.
dhist ische Beschreibung der vier m l rsstuien verwendet,n bd oeo mm mm T eil tehoo vor der M bung des Buddhhn cs geprägt w erden zu sein. Es wi r icdorh verfehlt
, die
III der Vi€l'ten
T ag. nd n la nm . du auf den -&mhhyah r t sich aufbaut undin den Yacnfl tn [ “N icht in Ieluh fler lin e dargestellt ist
(T . fl . Es «w i ch t Vielmehr wahehelnlich, daß die
der PM . Wie die der Yumütra auf einegem [ Ih re Quelle zurückgeht, die uns lobt silber bekanntH. F@ m i t jedenfalls dal das M ixe Diryi na keineW and mlh th dip Sehdpfuu du ßn £hismna ist
M u ri ! hat die religih e Schöpferkra des ursprünglichen
m im w erden “ sole, M die ganze Tenfnolagie als festes
es wurde ein neuer Inhalt In die alte Form grossen. DieEigen
m dm h dt he0 M in Üntcxw hied in der Versenkung
den Vega liegt in seine. rein geistigen „Währendder Vq s vorwiegend pin“ u d hypnotisr ist, u
die bad.
dhtsfi sche Methode (der Vermut ung) vm ricgc : intsüet tmll und
M “ hat mit Rech t Rhys D a v ids bemerkt(Y.M. XIII)im
en
Ra m ben beode mam ma , durch die reinan man.
m s. im ; um. v n ; cm s. no; a. me.. r . N XXX
Die buddh ist ischen Versenkungsstufen 37 5
ung er lau f w erden könnte ; sie i st n i cht mogl ic h ohne intellek: lle und ohische Aktivität .
„S ittl i chkei t (sila) , Konzentrat ion
rmäd/zi) u n Veisheit paflüä) gehören unzertrenn l i ch zu sammenie die “n issenheit (an
'
dya) die Wurze l a l les Übe l s i st,so ist
Weishe it d . h . die re l igiose Eins i cht,die Erkenntn i s des U n
rtes des die Grund lage a l les He i l s . Darum„gib t es
due Verse .ung (j hänam), w o n i ch t Wei she i t (paäfiä) i s t“ , w ie
ngekehrt :e ine We ishe i t, w o n i ch t Versenkung ist“ Der
:istig-sittlice Charak ter des buddhi stis chen Jhäna tritt am deu t
hsten auf er ersten und auf der letzten S tu fe hervor . In den
teren und esonders den jüngeren Upanischadeu , in denen s i ch.e Versenkngspraxis des vorbuddh is ti s chen Yoga abspiege l t, i ster Gegenstnd der Betrachtung m e i s t ein neutra ler . Der
„S tütz
unk t“,
an len der Med itierende si ch k lammert,i st ein w ahr
ehmbarer egenstand der. Natu r oder eine S te l le des e igenen.örperß ; n starrem Bl i ck fixiert der Sramana seine Nasenpi tze oder beach tet au fmerksam die e igene Kö rperw ärme oderas S umme des Ohre. Besonders b e l ieb t i st das andäch tige‚innen übe die m it magischen Kräften begab te S i lbe Om . „
DiesVort
,es i
'
der beste Im Gegensa tz zu d iesem Med iationsmodu r ich tet s i ch die Betrach tung im ursprüngl i chen Budlhismus auschließlich auf die re l ig iösen He i l sw ahrhe iten ; auchvenn sie af s cheinbar profane Objekte s ich r i chtet, so i s t der%sichtspunt doch ein aussch l ieß l i ch re l i gi öser (s . Die aus
’ührlichen Ieditationen , die j üngere bu ddh is tische Texte entha l ten,stehen als einzigartig in der mysti s chen Literatur IndiensDer zw eitr Punk t, an dem die Original ität der buddh ist is chenVersenkungin die Augen spr ingt, ist die Upekhästimmung, zu derdie Jhäna *ie Bhänavä h inführen . Die Mystik der äl teren Upanischaden w i der Yoga der j üngeren suchen das Hei l in einem S ee lenzustand , dr jense i ts des w achen Bew ußtseins steh t
,jene im
T raumschlz, dieser in dem ekstati s chen Untergang des Bew ußtse ins ; die uddh istische Versenkung zie l t n i ch t auf so l che über
U lun b e r g ,B. 339 .
l '°
np372. Vgl. W a r r en 282 f.
Kät . Up. I I 1 7 ; vgl. 11 1 5 . O l d en b e r g,Ü . 14 1 f.
,262f.
Vgl L eh m a n n der in der asubha-bhavans' . das Originel leder buddhisschen Versenkung erb lickt .
374 F riedrich He i ler
S tufe s chw indet vitarka,auf der dri tten vicär a
,auf der vierten
ananda,so daß nur mehr asm z
'
tä zu rückb le ib t. Wie in j üngerenbu ddhistis chen Klass ifikationen i s t h ier der erste Versenkungsgradin zw e i Grade zerspa l ten Das änanda der dr itten S tu fe dersampraj fzäta -sam ädhi im Yoga entspri ch t dempiti—suk/zam des zw e i tenb uddhisti s chen Jhäna. Das asmz
'
tä der vierten Yogastufe hat in
der b uddh ist is chen S ka la ke in Äqu iva len t.Al le diese Momente ma chen es gew iß
,daß die S tu fen le i ter
der vier Jhäna präbuddhistischen Ursprungs ist (R. Da v i d s,Y .
M. XIV) ; auch die psycholog is chen Kategor ien , w e l che die buddhistische Bes ch reibung der vier Versenkungsstufen verw endet,s cheinen zum größ ten Te i l s chon v or der Entstehung des Buddh ismus geprägt w erden zu se in . Es w äre j edoch verfeh l t
,die
Deskr ipt ion der Jhäna als eine Ent lehnung aus jenem Sys tem desYoga aufzufassen
,das auf den S ämkhyakärikä s i ch aufbaut und
in den Yogasütra Patafijalis in leh rhafter Kü rze dargeste l l t ist(Y . M . XVH) . Es erschein t vie lm eh r w ahrs che in l i ch
,daß die
Versenkungsskala der Pitaka w ie die der Yogasütra auf eine gemeinsam e äl tere Que l le zu rü ckgeht, die uns n i cht näher b ekanntist. F es t s teht j edenfa l l s, daß das v ierfältige Dhyana ke ineoriginale und se lb ständige S chöpfung des Buddhismus ist.
Gle i chw oh l hat die re l igiöse S chöpferkr aft des u rsprüngl ichenBuddh ismus e ine unverkennbare Läuterung, Verinner l i chung und
Versittlichung des stufenw e isen Versenkungsganges bew ir k t. Die
b uddhis t ische S tufen le i ter der vier Jhäna und Bhävanä bes i tzte ine in dividue l le Eigenart und Origina l i tät se lbs t dann
,w enn
erw iesen w erden könnte,daß die ganze Term inologie als fes tes
Trad it ionsgut aus dem präbuddhistischen Yoga übernommen w ur de ;es w urde ein neuer Inha l t in die a l te Form gegossen . Die Eigenart des buddhistischen Jhäna im U n ters ch ied von der Versenkung .
des Yoga l iegt in seinem re in ge istigen Char ak ter. Währendder Yoga vorw iegend phys is ch und hypnot isc h ist, ist die buddhistische Methode (der Versenkung) vorw iegen d inte l lektue l l undethis ch , “ hat m it Recht Rhys D a v i d s bemerkt (Y. M. XIX ) . Die
Versenkung is t keine auf e inem deta i l l ierten psycho logischenRezept beruhen de Psychotechn ik, durc h die a l le in He il und Er
1) Dh . S .
1ß7 t . ; Mil. V 1 5 ; C h i l d. 1 70 ; R . Da v i ds , Y. M . XXX .
7 6 F riedrich He i ler
naturl ieb e ekstati s che, hypnotis che oder magische Zustande ab,
sondern auf einen Zustan d höchster Bew uß thei t und Wachhe i t .Buddhas Jünger s ind a l l ze i t vö l l ig w achsam “
(suppabuddham
pabuj ihan tz'
) b etont w iederhol t das Dhammapada (296 E . ; vgl .L e hm an n Upekhä, die Vol lendung des Jhana , ist ke inpassiver Zustand stumpfer G le i chgü l tigkei t, die Indifferenzstimmungist vie lmehr getragen v on e inem Akt der Erkenntni s und der
Wertung : der Bhikkhu „b etrachtet alle Dinge dur ch das Mediumder drei großen Grundgedanken : aniccam ,
ana tta,
er durchschaut den Zusammenhang des Lebens und seinen U nw ert , er verw irft a l le F reude und a l les Leid
,er verachtet die
We l t und das Leben , er w eiß s i ch unabhängig und fre i . Diesesancta indifi
‘
erentia des b uddh is tischen Mön chs ist eine spezifis chb uddh isti s che S ee lenst immun g ; trotz mancher Berühr ungspunkteun tersche i det sie si ch unverkennbar von der S el igke it, in der
Yajnava l kya u nd S andilya den Atman s chauten,noch tiefer v on
dem Bew ußtsein sstiilstand, den der Yogin e rstreb t, und von der
ekstati schen T runkeriheit , in der die spatereu Bhakti-Myst ikerInd iens schw eigen
We i l im ursprunglichen Buddh ismus das S ichv ersenken einepersön l i che re l igiö s-s ittl i che A rbe it ist und ke ine s treng genaueAusfüh rung eines psycho logischen Rezepts , darum ist das m ethodische Dur ch laufen der vie r S tufen des Jhäna auch n i cht e ineunerläß l i che Voraussetzung zur Erre i chung des Nirvana. Gew ißgib t es kein Hei l ohne rechte Konzen tration (sammaaber d iese Versenkung ist auch ohne die strenge Bindung an die
Methode der vierfachen Versenkungsskala m ögl i ch . Darum feh l tin der Heilsanw eisung mancher kanoni s cher Texte jeder Hinw eisauf das vierfältige S o ist im Gegensatz zum Yoga diein vier S tufen verlaufende Versenkung nur eines von den He i l sm i tte ln
,aber n i ch t das e inzige und unentbehr l i che Mitte l zum
Heiß ). Es erheb t s i ch nun die Frage, ob Buddha selb st das
vierfache Jhäna üb te und se inen Jüngern empfah l und ob die
ged rungene, aber prägnante Beschre ibung, die als fes te Forme l
1) S ieben Wege zum Nir vana, B igan de t a. a. 0 . I I 206 .
R . D av i d s , Y . M. O l d e n b e r g , U . 822f.3) R . D av i ds
,Y . M. XXVI I I , O l d en b e r g , B . 82.
Die buddh ist ischen Versenkungsstufen 37 7
in den Pitaka immer w iederkeh rt, aus dem Munde des Me is terss tamm t. Edvard L e hm a n n (1 58) ve rnein t d iese F rage : in den
a l ten Texten w ie dem S uttanipäta w ü rden die Versenkungsstufen
n i ch t erw ähn t ; das Digha Nikaya h ingegen sei„e ine a l l zu späte
S chri ft, um m i tte i len zu können, w as dem ursprüngl i chen Buddhismus e igen w ar : es führ t in die Klosterzei t h inein , da derBuddh ismus s ich b erei ts m it den re l igiö sen Bräuchen der Inder
besonders m it dem Yoga ve rm isch t hatte “. In der T at
w äre es w oh l denkba r, daß Buddha die Versenkung noch fre iüb te und daß erst se ine Späteren Jünger im Ans ch luß an das
K lass ifikat ionss chema des Yoga die lehrhafte Bes chre ibung der
v ie r Versenkungsstadien fo rmul ierten . Aber w ir haben ke inenGrund , die a l te Tradition anzuzw ei fe ln
,nach der Buddha gerade
in den en ts che i denden A ugenb l i cken se ines Lebens , vor der Erleuchtung und v or dem Eingehen ins vo l l kommene Nirvana diev ie r Versenkungsstufen durchlaufen Die e th is ch -re l igiöseLäuterung und Vertiefung
,w e l che die s tu fenw ei se Versenkung im
Buddhismus erfahren hat,i s t am besten v erständ l ich
,w enn w ir
sie auf die produktive Kraft des Me i sters se lbs t zu rückführen .
Auf der ge istig-s itt l i chen Höhe des Mei sters b l ieben n i ch ta l le seine Jünger in i hrem Betrachten stehen. Aus dem Du rchdenken dessen , w as zur E r l ö sung führt , w ar man gew ohntw aren vie le gew ohnt immer w ieder in die mystis chen U n
ergrüudlichkeiten des vom Yoga dargebotenen Er lebens h inabzutauchen “
(O l d e n b e r g , U . Aus dem Yoga geboren , fiel
das in S tufen au fsteigende Jhäna immer w ieder in den Yogazur ück . Man übernahm die äußer l i chen Yogapraktiken ; man
su ch te n i ch t a l le in den he i l igen Gle i chmut,sondern berauschende
Verzückungen und magischen Tie fs ch la f. Eine dieser autohypnotis chen Methoden s ind die kasina 2) Man fixie r t e inenselbs tkons tru ierten Krei s , eine Wasserflache
, e ine enge Li ch töfi
‘
nung, e inen farb igen Gegens tand, man starrt ihn so lange krampfhaft an
,bis das Nachb i l d
,das bei S ch l ießung der Augen b le ibt
,
so deutl ich ist w ie das Wahrnehmungsbild. Hier tri tt die b loßeSpannung der Aufmerksamkei t an die S te l le der ge füh l sbetonten
L a]. V ist. p. 1 47,439 ; D. XVI 6 , 87 f. ; vgl . O l d e nb e r g , U . 320 .
A . vol. V p. 46 f. ‚ H a r dy 252fi „C h i l de r s 19 1
,O l de n b e r g ,
B.
372, W a r r en a. O . 293f.
378 F riedrich Hei ler
rel igiö s-s i tt l i chen Betrachtung, die im u rsprüngl ichen Buddh ismusdie Grundlage des Jhäna b i l det. Aber all diese künstl i chenMethoden der S elbsthypnose 1) s ind, obglei ch sie zum Te i l s chonin den kanon i schen Texten erw ähnt w erden , der Versenkung desäl tes ten Buddh ism us frem d ?)
Wo die b uddhisti sche Heils lehre v on der Versenkung redet,da redet die neuplaton is che und christl i che Mystik v om Gebet.Denn das Gebet der Mystiker ist n i cht w ie das na iv e Beten despr im i tiven Mens chen und der großen prophetis chen Persön l i chkei tendie s ch l i chte Aussprache der Not und der Zuversi ch t, ein „Aus
s chütten des Herzens “,sondern ein erhabener S ee len z u s t an d der
Abges ch iedenhe i t, in dem der F romm e w ei lt“ dense lbenTerm inus (viharatz) geb raucht die buddh istische Bes chre ibung derVersenkungsstufen ein w ort loses , schw eigendes Betrachten
,
S chauen und Versunkensein . Im Gegensatz zu dem gew öhn l i chenm ünd l ichen “ Gebet bezei chnen die Mystiker ihr Gebetsideal als
die orat io men ta l is , als n gooevp‘
; vosgd, als „inneres “ oder „be
trach tendes “ Gebet, als das Geb et des Herzens “ . Wie der bud
dhistische Mou ch auf e iner S tu fen lei ter v on Versenkungszuständen
zum Nirvana aufsteigt, so kl imm t der neuplatonische h nd chr istl i che Mystiker auf e iner Le iter v on Gebetsstufen zur vo l l komm enenVere inigung m it Gott empor . Die Beze i chnungen der vers ch iedenenS tufen des Gebets , ihre_
Z ahl und i hre Merkma le w echseln ; gle i chw oh l besteht zw i s chen den Gebetsskalen neuplaton i scher, sufistischerund christl i cher Mystiker kein w esent l i cher Un tersch ied ; in i hrenpsycho logischen Grundzügen , oft sogar in ihrer Term ino logie
,
decken sie s i ch m it den vier S tufen des b uddh is tis chen Jhäna.
Al le Gebetsskalen b eginnen w ie die b uddh is tische Versenkungslei ter m it e iner w i l l kürl i chen Konzen tr at ion der Aufm erksamkei tauf ein ge is tiges Objekt. Der Beter su cht die Einsamke it auf,„macht s ich los von den vie len Zers treuungen
,zieht s i ch zurück
v on den äußeren Objekten , samme l t di e S inne nach innen, fixiertden Geist“ (Guyon 7
,vgl . Teresa 1 54) und r ichtet seine Auf
m erksamkeit auf e ine re l igiöse Vorste l l ung, von der starke Gefühlsreize ausgehen ; er betrachtet die letzten Dinge , T od, Ger icht,Himme l
,Höl le
,die Vergängl ichkei t
,Nichtigke it und Armse l igkeit
1) Vgl. O lde n b e r g , B. 369 ,
R . Dav i ds , Y . M. XXIX .
380 Fr iedrich He i ler
des Daseins all die Them en der Asubha-bhävanä, die den
Betrach tenden in e ine he i l ige Melan cho l ie versetzen, finden sic hin den mys tis chen Erb auungsbüchern des chris tl i chen Abend landesw ieder. Andere Meditationsstofi°e s ind ein spezifisches S ondergu tder christl i chen Mys tik : Gottes Größe und Hei l igkei t, Güte und
Gerech tigkei t, die S e l igke i t des Himm el s , das Leiden und S terbendes He ilands (vgl . Teresa Wie die buddhi s tis che Be
trachtung s i ch gerne an die den re l igiösen Wahrhei tsbes itz l eh rhaft zu samm en fassenden Forme ln (die v ier hei l igen Wah rhei ten
,
die zw ö l ffache U rsachenkette) ans chließt (A n e s a k i so w äh ltdie ch r i stl i che Med itation häufig die Vaterunserbitten oder die S ätzedes Credo zum Thema (vgl . Guyon Die Betr achtung der abendländischen Myst ik hat w ie die buddhisti s che ba l d eine mehrverstandesmäßige, ba l d eine m ehr gefüh l sm äß ige Farbe. Proc l uscharakter is ier t die erste S tu fe des Gebets als w u ng, Johannv om Kreuz als „Betrach ten und Nachdenken m it dem Verstand “
,
der F romme mach t s i ch ü ber die Meditationsgegenstände „ seineGedanken , zieh t S ch l üsse, verglei ch t sie m i te inander und bezieh tsie auf s i ch se lbs t “ (a . a . O . 405
,Teresa h in gegen empfieh l t
„ si ch n i cht dam i t zu ermü den, imm er neue Erw ägungen anzuste l len “
,
sondern „die Verstandes tätigke i t ruhen zu lassen “
un d s ich phantasiemäß ig den Kontemplationsgegenstand zu vergegenw ärtigen und
zu leb endiger Ans chau l i chkei t zu b ringen Die in tens ive Bes ch äftigung m it gefühlsbeton ten Vors tell ungen erzeugt im Be
trach tenden zarte Lustge füh le, eine sanfte, süße S timm ung, in der
An m erkun gen v on Seite 87 9 .
1) T im . 64 f. p. 149 ff. ; vgl. H.K o ch, PseudodionysiusAre0pagica 1908, 1 78 ff.
A . T h o l a ck, Sufi smus s ive T he0 30phia Persarum pantheistica 1821 , 105 f.8) N m ödr; ‚u os J [ öv axog‚ E v ,ußo v l ev u xör
’
n ecgi8w v 1895 ,
M. Mo l i n o s , Guide Spiri tua le 1675 .
5) H . H eppe , Gesch ichte der qu iet istischen Mystik 1875, 53f.A bhandlung v on den Dörnern (Mystische S chriften al ler katholischen
Vo lker XVIII ) 405 ff.
7) A . a. O . passim . Vgl. Realenz . f . prot. Theo l . u . K . XIX 523 f .8) H eppe a. a. O . 104 in der Regle des associées v on Guyon uber
nomm en (HeppeMoyen court et tr és faci le de fai re oraison (Opuscules Vgl. die
„sieben S taffe ln des Gebets“
eines m i ttelal terlichen deutschen Myst ikersF . P f e i f f e r , Deutsche Myst iker des 14 . Jh . I 1 907
,387 5 .
l) 1 86 ; vgl . 81 , 134, 1 79 .
Die buddhis t ischen Versenkungsstufen 38 1
er e inen ,.goüt expé r imen ta l de la pré sence de b leu “zu bes i tzen
glaubt (Guyon nach Teresa besteht die S timmung auf der
e rsten Gebetsstufe in e iner „F reude, die n i ch t ganz gei stig,aber
auch n ic ht ganz s inn l i ch füh l bar ist “, oft auch in füh l ba ren süßen
S chmerzen “ S o lassen s i ch die Charakter ist ika des erstenbuddhisti schen Versenkungsgrades, vitaklra , v icär a
, pitisu/clzam in
den c hris t l i chen Beschre ibungen der ersten Gebetsstufe w iedererkennen .
Auf der fol genden Gebetsstufe verschw indet a l le w i l lentl i cheA ufmerksamkeitsspannuug; a l le di skurs ive Vers tandestätigkei t, a l l eskonkrete , phantasiemäßige Vors te l len hö rt auf; nur die Luststimmung
,die du rch die Med itation erregt w orden w ar, b le ibt.
„Die S ee le ruh t, tie f be fr ied igt in Gott, er gew äh rt ih r e inenunaussprech l i ch süßen , fr ied l ichen Genuß , der a l le i hre Kräftem it t iefs te r Befr iedigung , m it reins ten) Wonnege füh l üb erfü l l t“ ,„ sie gen ießt in der A bgezogenhe i t von den anßeren Dingen ihreinnere Befr ied igung“
. ‚Der Verstand hat dabe i gar n i chts zu
tun “
(Teresa 1 87 „Die S ee le hört auf,an etwas zu denken
und ste l l t die Ruhe in Gott her “
(Johann von Kreuz) Die S ee let ri tt in die he i l ige Ruhe“
(F ranz v . Al le Term in i inder Besch re ibung der zw e i ten buddhis tischen Versenkung : avitakka
,
a vicära,ajjha tta sampa3ädana , pitisulcham ,
kehren in der Desk r iptiondes , Ruhegebets
“ b ei Teresa und Johann vom Kreuz w ieder .Die Bes ch reibung der d r itten Gebetsstufe ze igt bei Teresa
und anderen christl i chen Mystikern e ine Abw e i chung v on der bud
dhistischen . Die Reduktion des see l is chen Erlebens s ch reitet auchh ier fort ; von e inem „ S ch l ummer der S eelenkräfte “ redet Teresa (210)‚die Wonnestimmung n imm t j edoch im Untersch iede zum drittenJhäna in i hrer Intens ität zu . „
Die S ee le gen ieß t unvergle i ch l i chm ehr Freude Wonne u nd Entzücken w ie vorher ; sie gen ießt einnamen loses Entzücken
,sie s chw imm t in den re insten und höchsten
Wonnen,sie
_
ist in e inen h imm l is chen Rausch , in eine he i l ige Torhe i t
A . a. O . 409 . Vgl. ebenda : „Das Ruhcgebet besteht n icht in S chluß
fo lgerungen und Ven taadestät igkeit .“
Der Gegenstand, m it dem der Med i t ierende s ich beschäft igt hat ,
entschw inde t dem Bewuß tse in . Mdm . Guyon v eranschaul icht diesen Vorgangin e inem dr ast ischen B i lde : „
il faut que l ’ame avale par un pet it reposamoureux ce qu ’
e l le a mäché et gonte“
38 2 F riedr ich Heiler
versunken “
(Teresa Dieser Wonnerausch steigert si ch nochauf der vierten Geb etsstufe
,im ekstatis chen Gebet oder im Gebet
der Verzückung . . Die enthus ias tis che Hingabe an Gott , den e inzigenund hö chsten Wert , die Liebe zu Gott w ird so stark
,daß der
Betende vö l l ig eine mit Gott w ird, ganz in ihm auf und untergeht
,daß j eder Untersch ied zw i schen Ich und Du aufgehoben
i st. Dieses „ekstat is che Gebet “ hat m it der Upekhästimmung desv ierten Jhäna das Momen t geme insam
,daß es ein Zus tand der
rest losen Einhe it des Ich i s t ; es untersche i det s ich von ihr dur chse inen passiven und effektiv en Charakter ; der Beten de w ird v on
der Ekstase pl ötz l i c h und unerw arte t übermannt,überfintet
,fort
gerissen ; das S e lb stbew ußtse in m acht der S e lb stvergessenheit Platz.Die qu ieti stis che Mysti k des 1 7 . Jh . ,
am fe insten ausgeprägt inMadame Guyon, sieht im Gegensatz zu Teresa und anderen christl i chen Mystikern n i ch t im Enthusiasmus und in der ekstati sc henTrunkenhe it, sondern in der san cta indifi'
erentia die Vol len dungdes mysti s chen Geb ete. Hier is t der Para l le l ismu s zw is chen dermys tis chen Gebetsskala und der buddh istis chen Versenkungsleiterein vo l l s tänd iger . Was Guyon als „o ra i son de s impl i c i té “
s ch i l dert,s timm t mit dem übere in
,w as der Bhikkhu im dri tten
Jhäna er leb t. In dem Gebet der Einfachhei t vo l l z ieh t si ch dievö l l ige S e lbsthingabe (abandon), die Pre isgabe jeder S orge um
das e igene Ich (dépou i l lemen t de tout soin de nous-memes), dasgänzl i che S ichüb erlassen in die Bande Gottes (déla i ssemen t tota len tre les ma ins de Dieu). Aus dieser rücks i chts losen S e lbs ten täußerung en tsteht e ine Indifierenzstimmung, w el che der Upekhäder dr i tten Versenkungsstufe gle i cht. „
Die S ee le verliert a l lenEigenw i l len im Wil len Gottes ; sie en tsagt a l len besonderenNeigungen , w ie gut sie auch sche inen m ögen , soba l d sie d iese lbenentstehen füh l t
,um s i ch in die Gle i chgü l tigke it (indifiérence) zu
versetzen und nur das zu w ol len,w as Gott gew o l lt hat von Ew ig
ke i t her ; sie i st gle i chgü l tig gegen a l le Dinge, hand le es s ichnun um den Le ib oder um die S ee le, um die zeitli chen oder dieew igen Güter . “ Der hei l ige Gle i chm u t
,den die fromme S ee le
im Gebet der Ein fachhe i t und des S chw e igens e r langt,w ir d noch
reiner und vo l l ständiger auf der höchs ten S tu fe der mysti schenErfahrung .
„Der Verstand v erfinstert s i ch
,die Erinnerung v er
b laßt,der Wil le ver l iert a l le Spannkraft ; die lei sesteLebensregungder
38 2 F riedrich He iler
versunken “
(Teresa Dieser Wonnerausch steigert si c h nochauf der vierten Gebetsstufe, im ekstat ischen Gebet oder im Gebetder Verzü ckung . ‚ Die enthusias tische Hingabe an Gott
,den e inzigen
und höchsten Wert, die Liebe zu Gott w ird so stark,daß der
Betende völ l ig eine mit Gott w ird , ganz in ihm auf und untergeht, daß j eder Unters ch ied zw i schen Ich und Du aufgehobeni st. Dieses „ekstatis che Gebet“ hat m it der Upekhästimmung desv ierten Jhäna das Momen t geme insam ,
daß es ein Zus tand derrestlosen Einhei t des Ich ist ; es unterschei det s i ch von ihr durchse inen pass iven und affektiven Charakter ; der Beten de w ird v on
der Ekstase pl ötz l i c h und unerw artet übermannt,überfiutet
,fort
gerissen ; das S eibetbew ußtsein macht der S e lbstvergessenhe i t Platz.
Die quieti stis che Mystik des 1 7 . Jh . ,am fe insten ausgeprägt in
Madame Guyon, sieht im Gegensatz zu Teresa und anderen chris tl i chen Mys tikern n i ch t im Enthusiasmus und in der ekstati sc henTrunkenhe i t
,son dern in der sancta indifi°erentia die Vol lendung
des mysti s chen Gebets . Hier ist der Para l le l i smus zw is chen dermysti schen Gebetsskala und der buddh isti s chen Versenkungsleiterein vo l l ständ iger . Was Guyon als „orai son de simpiicité
“
sch ildert,stimm t mit dem übere in
,w as der Bhikkhu im dritten
Jhäna erleb t. In dem Gebet der Einfa chhe i t vo l l zieht s i ch dievö l l ige S e lbsth ingabe (abandon), die Pre isgabe j eder S orge um
das eigene Ich (dép0 niliem ent de tout soin de nous—memes), dasgänzl i che S ichüb erlassen in die Hande Gottes (dé la i ssem en t totalentre les mains de Dieu). A us d ieser rü cks ichts losen S e lbs ten täußerung en tsteht e ine Indifferenzstimmung, w elche der Upekhäder dr i tten Versenkungsstufe gle i cht . „
Die S ee le ver l ier t a l ienEigenw i l len im Wil len Gottes ; sie en tsagt a l ien besonderenNeigungen, w ie gut sie auch s cheinen m ögen , sobal d sie d iese lbenentstehen füh l t, um s i ch in die Gle i chgü l tigke i t (indifiérence) zuversetzen und nur das zu w ol len
,w as Gott gew ol l t hat von Ew ig
kei t her ; sie i st glei chgü l tig gegen a l le Dinge, hand le es s ichnun um den Leib oder um die S ee le, um die zei t l i chen oder dieew igen Güter . “ Der he i l ige Gle i chm u t
,den die fromme S ee le
im Gebet der Ein fachhe i t und des S chw eigens erlangt, w ird nochreiner und vo l l s tänd iger auf der höchsten S tufe der mystis chenErfah rung.
„Der Verstand v erfinstert s i ch,die Erinnerung v er
biaßt,der Wil le ve r l iert a l le Spannkra ft ; die ieisesteLebensregungder
Die buddh ist ischen Versenkungsst ufen 383
S elbstheit erl isch t . Wuns ch,Neigung, Begierde , Widerw i l le , A b
ne igung , a l les i st dahin . Die S ee le tritt in den dunklen , s chauervo l len Zustand des my sti schen Todes , indem sie in den Zustandgänzl i cher Gefühiiosigkeit übergegangen ist ; denn sie ist gle i c hgü l ti g gew orden gegen die We l t
,gegen si ch , gegen Gott . S ie
l iebt ni ch t m eh r und haßt n i ch t meh r ; sie le i de t n i ch t und freuts ich n i ch t ; sie tut n i c ht s Gutes und tut n i chts Böses
,sie tu t gar
n i chts . Die S ee le hat n i c hts,w i l l n i chts
,ist n i chts : sie s teh t im
S tande der Ähn l i che Beschreibungen der mys
t i schen Resignation und Indifi"
erenz keh ren in der gesam ten Literatu rdes Quietismus im 1 7 . J h . immer Wie der buddhistische Mönch in der „
freud und ieidlosen “ Upekhä die Kronedes Jhäna erb l i ckt, so betrachtet der ch r istl i che Qu ietis t die lndifi
'
erenzstimmung, in der das ganze Gefüh le Afi‘
ekt und Wil lensleben ers torben ist
,als das Ideal des Gebets .
Die see l i s chen Vorgänge, die s ich beim S tufengang des
mysti s chen Gebets abspie len, sind diese lben, w ie im v ierfachenJhäna des Buddh ismus . Die psycho logischen Kategorien ,
m it
denen die psych ischen Zustande und Erlebn is se bes chrieben w erden ,st immen sach l ich , häufig au ch term ino logisch übere in . Trotzdemlassen s i ch Unters ch iede in phänom eno logische r undpsychologischerH in s icht festste l len . Der fundamen ta le U ntersch ied der buddhistischen Versenkung von dem mysti sc h-kontempiativen Gebet l iegtim Feh len j eder Art des Gottesgedankens . Al les mys tis che Betenund S ichversenken i s t getragen von e iner inneren Bl i ckric htung
,
e in er gei s tigen Z ielung auf e ine ubereinniiche, m etaphys i scheReali tät
,sei es nun ein persön l i cher Gott, der Hei land und himm
l is che Bräutigam, oder der souveräne höchste Wil le, oder die
unpers ön l i che Einhe i t im Al l oder das I ch,das zum universe l len
Weltich w ird . Diese Rea l i tä t w i rd im Gebet als unm i tte lbargegenw ä rtig
,als im e igenen Inneren „präsent“ erleb t . Das
Medi tieren auf der ersten Gebetsstufe hat den Zw eck , sich lebendig
1) Hoppe a.. a. O . 465 f.
Vgl. H oppe a. a. 0 . An die buddhistische Beschre ibung der U pekhäerinnert auch die Anw eisung eines deutschen Mystikers : „
Du seit w issen ,daz die abgesch aidenheit nit anders ist
,dann daz der geist unbew egl ich ste
gegen allen zuveiien l i b s und le ide , cm und scbanden und iasters, als v il
als ein stehlein pergk“
(S pew e r a. a. O .
384 F riedrich He i ler
in Gottes Nahe und Gegenw ar t zu versetzen und dort zu ver
Die w onnevoiie Ruhe der fol genden S tufe ist ke inRuben in si ch se lb st
,sondern se l ige Ruhe in Gott.
„Die S ee le
ruht,v on Lieb e ganz er fü l l t, in Gott und verein igt s i ch auf die
l ieb l i chste We ise in Wonno und Bew underung und in der Al lgew al t der Lieb e mit ihm ; sie v ergißt a l le Ges chöpfe und richtetih ren B l i ck al le in auf se in unendlichee S ein
,seine Güte und
S chönhe i t und v erw e i l t dabe i l iebend in unaussprech l i cher S üßigkoi t
,F reude Ruhe und Frieden “
(Johann vom„Die
S eele gen ießt ihr hö chstes Gut “ (Teresa) Auch die Indifi‘
erenz
s timmung des christl i chen Quietisten w ird getragen und durchdrungon v on der H i n g a b e an Gott . Die Glei chgül tigkei t gegenLust und Le i d , der Verzi cht auf alles eigene Wüns chen und
Wol len w ird so zur res t losen Ergebung in Gottes souveränenWil len
,zur
„donat ion de tou t soi-m émo a Dion “
zum „perdret oute volon té propre dans la vo lon té de Dion “
, zum „ne vou loir
que ce que Dion a v ou iu “. Nur im Zustand des mystis chen
T odes, w o die S eele sogar „gegen Go tt gle i chgül tig “ gew orden
ist,feh l t der Glaube an die Präsenz der höchsten metaphysischon
Rea l i tät, die Hingabe an sie,das Bew ußtse in der Einhe i t mit ih r.
In diesem Zustand der völl igen „Entb l öß ung “ der S ee le i s t au ch
der Go ttesgedanke untergegangen . In der buddhis tis chen Vor
senkung h ingegen feh l t die Hinw endung an ein hö chstes Me taphysi s ches s chon von der untersten S tufe an. Gew iß ze igt auchdas Jhäna eine Bl i ckr i ch tung auf ein
‘
Metaphysisches : aber d iesesMetaphys is che, das der betrachtonde S amana im Auge hat
,i st
keine hö chste u bereinniiche Real ität,kein h ö chster ge istiger Wort
,
dem man si ch unbedingt h ingib t,sondern ein unpersön l icher Kansal
zusamm enhang,der
*
leidvolio Kre is lauf der Gebur ten,dem man
entfi iehen muß. Was a l lem mysti s chen Beten und Be trachtene igen ist das E rgrifi°onsein un d Vorzehrtw orden von einem letztenund höchsten Wert die Mysti k aller Zei ten nennt es Liebe(bhakti, amor) das i st dem buddh ist ischen Jhäna vö l l ig
1
) Teresa 1 34,1 65
,186 ; Guyon : L ’
exercice princ ipal (de la méditation) do i t é tre la présence de Dion
2) A . a. O . 409 . Vgl. Teresa 1 96, 202.
3) 188. F ranz von S ales redet vom
„süßen Genuß der Gegenw art Gottes“
—(Traité de l‘arnour VI
386 F riedrich Heiler
n i ch t imm er , so doch zum ei st jene mysti schen Zustände ein .
Gefühle und S timm ungen können dur ch w illkür liche Geistostätigkeitbegünstigt und vorbere itet w erden. Dur ch die Ausscha ltung derfr eien Spontane ität im Erleben re l ig iö s ausgedrü ck t durchdas F eh len des Gnadonmotivs besteh t jedoch die Gefahr , daßdie stufen fö rm ige Versenkung zu e iner lohr und lernbaren S ee lenkun st herab s inkt, zur b loß mechan is chen Anw endung eines genaudetaill ierten psycho logis chen Rezepte.
Die dritte Vers ch iedenhe it zw ischen buddh isti scher Versenkun gund mys ti schem Gebot l iegt in der Art des Erlebens, die si c hdeutl i ch in der Art der psy chologischen Bes chre ibung w iderspiege l t .Die Gebetszuständo der christ l i chen Mystik bes i tzen e ine persönli c he Farbe, e ine ind ivi due l le Eigenart. In all den Beschre ibun gench rist l i cher Mystiker verrät s ich ein persön l i ches Leben . Trotzder auffallendon Übere instimm ung und trotz der gegense itigenl iterarischen Abhängigkeit ist jede d ieser Bes chre ibungen ein
se lbständiges Dokum en t des persön l i ch Erleb ten ; in den mannig
fa l tigsten Au sdrücken und in w undervol len Bildern w erden die
individue l len Erfahrungen veranschaul i cht. Die b uddhistischenDeskr iptionen der Versenkungsstufen sind im Verglei ch hierzuungeme in monoton und s chematis ch ; es kehr en immer die selbenstereotypen Wendungen w ieder ; von der Aus führ l i chke it der chr istl i chen Darstel l ungen s ti cht ihre doktrinäre Knappheit und Kärg
li chke it ab ; neben den poesievollen S elbstzougnissen e iner Teresaoder Guyon kl ingen sie so nü chtern und prosa is ch . Es w eht inder b uddh ist ischen F ormel des v ierfachen Jhäna sow en ig w ie in
der Gebetsskala der Neuplaton iker ein Hauch kraft vollen persönli chen Lebens . Der V ergle i ch der buddh i sti schen Versenkungs
grade mit den Gebetsstufen der chr i stl i chen Mystik bestätigt diefeinsinnige Beobach tung N . „daß die indis chenRelig ionen und Buddhas Ordensliteratur , die s ic h mit großartigerKonzentration auf das innere Leben r i ch ten und in unzähligenBes chreibungen den s ic h beständig glei chen S eelenzustand schil dern,doch ärmer s ind an roligionspsychologischom Materia l als das
Chr istentum, und trotz all der Feinhe i ten und S chönhe iten ein
1) Natür liche Theo logie und allgemeine Reiigionsgeschich te (Beiträgezur Rel igionsw issenschaft hr sg. v . d. religionswissenschaftlichen Gesellschaftin S tockho lm I l ) 84 .
Die buddh istischen Versenkungsstufen 387
fö rm ig das tehen neben den nach dem Re i ch tum des Lebens se lb s tmannigfa l tig ausgeprägten Bi l dern des inneren Lebens , w ie die
Ofi‘
enbarungsreligionen sie bes itzen.
“ Wenn die chri st l i che Myst ikdasse lbe gilt ana log von der sufistischen gegenüber der
indis chen als das re ichere und lebendigero Geb i l de ersche int,so
beruh t d ies darauf,daß in ers terer der mys t is che Gedanke si ch
n i cht rein und konsequent ausgesta l tete, sondern ni it einem anderenF römmigkeitetyp, dem propheti schen , s i ch verm i sch te. Währenddas Zie l der mys ti s chen E rlösungsroiigionen in der Aufhebungdes natürl i chen S ee len lebens, im Erl öschen des naiven Leb ensgefühis l iegt, ge langt in der prophe ti schen Frömm igkeit das gesam to Gefüh l s und Willensleben zur freien Entfa l tung ; w ährenddort die ind ividue l le Persön l i chkei t negiert w ird, erfähr t sie hierihr e h ö chste S teigerung. Die Wurze l der chri s tl i chen w ie der
sufistischen Mys tik ist die neuplat0nische E r lösungsleh m, die den
se lben negati ven, persönlichkeitsvem einendon Charakter trägt
w ie die indis chen Hoilssysteme ; aber im Christentum w ie im Is lamdurch drang der Ge ist der propheti s chen Frömm igke it diese un
persön l i che U nendlichkeitsmystik und hauchte i hr persön l i chesLeben ein . Die Verschmel zung prophetischer und mys ti scherRel igion s chuf einen eigenen T yp mys ti scher Erfahrung , der imGegensatz zur rein en Mystik eine Mannigfa l t igkeit indiv idue l lnuancierten Erlebens
Vorstehende Skizze w i ll e inen Überb lick uber die Prob leme geb en,w elche die buddh ist ische Versenkung der Religionsw iesenschaft b ietet. Die
im ersten Tei l ausgesprochenen Gedanken hoffe ich in einer h istorischgenetischen Monograph ie näher ausführen zu können
,in der ich die E nt
w icklung der Versenkung in den indischen Religionen zu verfolgen beabsich tige . Die S tufenle i ter des mys tischen Gebets w ie die Un tersch iedezw ischen prophetischem und mystischem F römm igkeits w erde ich aus
führ licher in einer verg le ichenden S tudie über das Gebet behandeln .
Ein vorschoilener Mythus.
O. Cr usius (Muncheu).
Ver ehr ter Her r Kollege ! Vor w en igen Wochen dmfi e ich Ihn en die
Glnckw iin sche unsr er Akademie da r bri ngen . Die F estschr ift , der en Inhalt
S ie dam als schon zwr Hälfte kennen gelern t hatt en , zeigt, w ie w eit die Kr eise
sind,in die S ie. sachlich n nd per sön lich , hin eingew irkt haben , als F or scher ,
Dozen t und Herau sgeber der Z eitschr ift fu r vergleichende Sprachwissenschaft .
Dabei bewundr e und ver ehr e ich in Ihnen vor allem den Philologen im
eigen tlichsten S inn e : S ie fassen jede E rscheinung eacegetisch und histor isch an
ihrer besonder n S telle,in ihr em besonder n L eben und Z usamm enhan gs er st
w enn das geschehn ist, v erfolgen S ie sie in ihr em F or tw irken ins Weite u nd
ziehn Parallelen u nd A nal0gien als Hilfsmater ial her an . S o wage ich es,
Ih n en ein e kleine Un ter su chung vorzu legen , die von der E rkläru ng ein er
D ichterstelle ausgeht, von da au s ein en seltsam e n alten Mythu s zu er schließen
sucht u nd w enigstens bis an die S chw elle vergleichender B etrachtung hin-an
geführ t w erden konn te.
In den Aristophanischen Wespen findet eine über den Kreisder Buchstab en und Wortkritik h inausgehende Behandlung . tr otz
der neuen S onderausgaben ganze S trecken nnangebant und pfadlos .Dazu gehö rt vor a l lem j ene S cene, in der der junge Bdelykleon
se inem Vater eine Art Anstandsunterri cht erteilt (V. 1 1 22 JederLoser merkt es
,daß h in ter den ein fachen , oft e infäl tigen Wechsel
reden An spie l ungen, E in und Ausfäl le aller Ar t stecken suchenw ir uns aber über die Adressen, an die der Kom iker s i ch w endet,klar zu w erden , so lassen uns in den me is ten Fällon die antikenw ie die modernen Führor im
1) E s ist beze ichnend fur den Gesam te indruck der S cene, daß R i ch t e r
p,337 sogar in dem s implen, durch 1 130 und die ganze S ituation ohne Rest
erklärten V. 1 125 äya3 6v ie'
ow a s 0 155351! 3:7u 3 v,uslv n
'
a 3'
elv eine T ragikerparodiew i t terte.
2) Gesch rieben wurde das F olgende schon in Tub ingen , bei Gelegenhei t
e ines Ko llege über A ristophanes’ Wespen . Damals wurde auch die F orderu ng ,daß der ganze Pro log 541 — 135 v on Xanthias gesprochen werde , kurz be
gründet und durch Analogien gestützt : Ph ilol . LI p. 663.
390 C . Cru siuß
Didym os (p. 259 S chm .) sah in dem Kardopion e ine w irk l i chePersön l i chke it, von der er sonst frei l i ch bei den Kom ikern ke ineSpuren ge funden ha tte ; bei se iner ausgedehnten Be lesenhe it erinnerte er s i ch aber eine r sche inbar verwandten Ro l le im A yxv l iw r
des E ubulos (AF . 11 p. 1 65 K .,vgl . FCG . I p. 359 w o der
S ohn die Mu tter m ißhande l t, w ie S trepsiades den Va ter , und
ergänzt nun fri s chw eg é'
rmpev . Das w ar übe l angebrachte Gelehrsamkeit. Denn die Zw i schenrede des S ohnes pi) yotye p i53 ozeigt
,daß s i ch diese zw e ite Gesch ichte, gerade w ie die erste,
n i cht auf dem Boden der Wirk l i chke i t abspie l t, sondern im Re i cheder S age und des Glauben s o der Aberglaub en s . m i r oflr o äggp
‘
;
y v'
&ov sagt ein S cho l iast ganz ri ch ti g. Aber dam i t w ar auchseine We i sheit zu Ende und zuglei ch die der neueren Aus leger .
Der Mythenkr eis, in dem w ir uns umzusehn haben,i st durch
die S innesart und den Zw eck des Al ten eng um grenzt. GroteskeSpukges ch ichten , vo l kstüm l i che derbe Götterschw änke , in denenes men sch l i ch
,a l l zum ens ch l ich hergeht, stehen da im Vorder trefl‘
en.
Nun hat uns Didymos se lb st (bei Z enob ios III 1 3 in Mi l lersMél. p. 370 Par . 380 vol. I p. 1 06 Gott .) fol gendes A rgumentdes S ophokleischen
‘
S atyrdram as n oc t bew ahrt : Käly tg év möfigcpa iim r ein er e n irrt T ÜW o<po
'
öga éorv zolg n eor svooivr w r,b'
u ioxvgoi
na i övoxeiw rm. n emv’
xaoe. Ke’
ly tg yc‘
zg s ig r div’
Iöa tw v A a x r ühw r
r i; v y nr éga Péozr irßgt o a g na i‚a i; örvode
’éoiy evog söy eva
'
igl
) Örvbwww &dehpa5v iv r ;:7
"Idy
‘ ärp’
05 ö or egea’
rr azog éyér sr o otdqgog'
u e'
uvnr a a die r aüzng r fig io r ogt a g q oox l fig i r Kw <p o i go a r v
’
go rg. Hin ter eöy evcög i st e ine Lücke anzu setzen,schon
w egen der fehl erhaften F ligung bn oöeé' oiy svog ön ö. Kelmis„n imm t
die Mutter Rhea “n i cht pietätvoll auf, j a no ch m ehr : i i; i
f‚uméga
i’
ßgw er . W en n w ir u n s den A r is t oph an is c h e n Kar dopion
als P a r tn e r de s Ke lm is d en k e n , is t die S t e l l e v o r z ü g l i c he r k l ä r t u n d e r g än z t S e ine Brüder
,gehorsame Kinder der
‘großen Mutter ’,s in d emport über den ynzgozhoiag doch darüber
später.Aber hab en w ir denn üb erhaupt An laß , h ier e ine Dak ty len
legende zu vermuten ? Gew iß . Der Nam e Kagöomfw v (von zeig
1
) Dies ist die richt ige, d. h. ur sprunglichs Wortstellung, von der aus
zugeb en ist ; P. stel lt falsch um : Ön ode£ ziy er og 157t 6 T ä'
n » äö‘
ehqräiv eö,u ev a7 g
E in v erscho l lener Mythus 39 1
öon og „Back trog “
) feh l t im griech ischen Namensystem (Fick ,Personennamen p. und auch als Spitzname ist er n ic ht nachw eisbar . Nur im Myt hus tri tt ein Verw andter auf in den E liaka
des Pausanias (V, 8 , Ké gövg in Kreta, dessen S ohn Klymenosnach O lympia komm t, ein Abkomme ‘
Hga xl éovg r oü’
Ido u’
ov,a l so
se l bst ein 7da d oixr vl og'
, w ie jener Herak les (Lobeck ,
Aglaoph . Kdgöug i st nur als Hypokoristikon von Kagöo
m'
mv vers tänd l i ch , und der ‘redende Nam e ’
Ba c k t r og ist w ie
gemacht für e inen j ener kunstrei chen Zw erge v om kretischen Ida,die nach dem von Apollodor be igeb rachten und von Diodor V 64 ,3 , S tr abo 1) p. 423 u . a . benutzten Materia l man cher le i nü tz l i cheDinge erfunden hatten und nach dem Vol ksglauben ein w undersames Leben im Bergessohoß füh rten, w ie unsre Zw erge. Vgl .S trabo X 22 p. 4 7 (665 Z ombxl fig dis oi
'
sr a z n é v r e r ot ;
n ga'
no vg agoevag ysvéoäw ,oz o idqgo
'
v r s é £ sü go v z a l e igyoi
o a r r o n grär oe na i bil l a n o hl. öz r cö v n gog i b r_ö’ t o r xgqo ty w v
,
7r évr e dä na i ädsl qml r ov'
r w v , di t ?) di“r ofl >3 ,
u oö öaur zll ov g
xl q9 fir c u. 6%ä).l ;cvß ev'
ov 0 1v Ammo'
gorg dl na i
r oig övo'
,u abz xgw
'
vr o n,drv K é l y w övo
‚u oié
'
ovo i u va za l
A a y v a ,u e r é a na i
‘
Hga x l é a na i’
L4x rc o v a ru in s; dt oidr;gov
sigyé o&aa int ?) r ov’
r w v év"Idy n gui r öv wenn . Ahnlich Diodor a. 0 .
i hr r s r oü n v gbg xgfiow zal z ip 1 0 13 xa l x o-ü x a i o cdrjgo v
qn$0'
zv
Doch der klass ische Zeuge für die Berechtigung dieser Interpretation ist Aristophanes se lbst (V. Der Al te soll , um
m it seinem Herrn S ohn in e leganter Gese l l s chaft ers cheinen zukönnen, ‘Lakonerschuhe
’
anziehen . Ohne Ausflüchte und Possengeht es dabe i n i cht ab . Den e inen Fuß hat er glückl i ch in derneuen Hül le : w ie der zw e i te drankomm t
,ruft er
ur;dan r oür o'
r 7°
ézvei
1 1 65 n aive pw oÄa’
mw v aör oö’
ou v sl; w i r öa x n ihw v
Auf e inen s c h l e c h t e n Witz kommt es Ar istophanes ni ch tan : aber w ie m an die S telle b isher erk l ärt
,ist überhaupt k e i n
1) Vgl. E . B e t h e , Hermes XXIV 412.
Manchem Leser w ird h ier die Besserung xöaw in den S inn gekomm ensein ; von draxéa ; aidqgou w e iß auch Pausanias III 1 2, 10. Über die F rage ,w ie w ei t den A l ten der E isenguß bekannt war , s. B lüm n e r , Technol . IV ,
'
355 ff .
392 O . Orasine
Witz darin . Verm u tl i ch spiel t der Di chter 1 1 65 mit öaxzülw v
und d am v’
l w v,
‘Daumen ’
und ‘Däumlinge’
. Dasse lbe Wortspie ll e i stet s i ch spater Kroby los (fr. 8 vol. III p. 381 K. Inc. 1
vol. IV p. 568
439180 6%a gb; i ä ö egy c‘
x r a ö&’
örrcgßolfir obg öa x z v
’
l o v g, öfin ovä ev’
I da i o v g fixen
na i i br Ädgvyy’
ijdw r a 75l 07 r e‚u aximg.
B . x ol,u w og‚
oöx
Die Alten nehmen die Spe i sen m it der Hand : so w ußte dieserS ch lemmer r i;v xelga za l r bv Äoigvyya ovve&t{ew n gog r d: 3 89gd
daß sie hart und feuerfest w erden, w ie die Däum linge vom
Ida,die ioxvgol. na i dvoxetgw r oe 7t eq>v
'
xa 0 t,vor al lem ieuerfest
,
w ie der sagenhafte S alamander (vgl. L o b e ck , Aglaoph . p.
Von h ier aus konnen w ir noch e inen Sprung w ei ter tun . In
den T hesm0phoriazusen staffiert Euripides den Mnesilochos als
We ib aus ; er w i l l,bekenn t er V . 21 5
ä7ro€vgelv wordt,
r c‘
r xdr w ö’
ärpsüew
Dazu bem erken die S cholien : r d: ys'
vsw : za-ör a dis ä
'
haßev isn
w i r°
Ida t w r Kgar tvov . D in d o r i hat dam i t r ichtig e ine S te l ledes Autors n egi xl orrfig b ei Klemens (Ar istobul) komb in iert, w onach Aris tophanes in den T hesmophoriazusen r d: ér r cöv Kgau
'
vov
’
E y n cyr ga ué r w v psmjveyxsv und daraus überzeugend denDoppe l tite l ’
E ym y yrgoiy evoc ii’
löa lor ersch lossen . Auch im fol genden , bei der Ausführung des s chw ierigen Ges ch äftes
,scheinen
Rem in iszenzen an das m it Unrecht bezw ei fe l te Drama des Kratinm it unterzuläufen : Vgl . besonders V. 240 ff. :
MN . é,u ol
,u eln
'
oec v r) J ia , n l iyv 7'
du xdoy ae
oc‚u oe r dl ag. iidwg, ifdwg, ä) ysir oveg.
E T F . 3 dggso. MN . r t S agen? r aw n erw grrolny e'
v og.
(pü, iov r fig äoßo'
l ov
ai3 bg yeyérn‚u a e n atur a z a m ent r i;v r géy zv.
Wenn die E ym y rrgd‚u svoo We i ch l inge
,w ie Agathon, w aren,
m ußte Aristophanes in der T at ein Plagiator gew esen sein. Das
anzunehmen l iegt aber ke in Grund v or : w ir haben ja gesehn, w ieeng die
’
Ida lor m it dem Element des Hephaest verbun den w aren.
Aristophanes versetzt den Mnesilochos in e ine entfern t verw andte
394 O . Crusius
Mutter“ ers che in t bei ih rem Zw ergenvol k ; Kelmis und Kardys
freve ln gegen sie und erle i den ihre S trafe. Aber w e l che?Die mytho logische Kom öd ie in Attika empfangt ihr e S toffe
m e ist dur ch Verm itt l ung der Tragö die und des S atyrdramas und
pflegt dab e i zum Dank die parodische Spi tze gegen i hre Woh ltäter zu r i ch ten S o können wir die Reste be i der Literaturgattungen zur w echse l se itigen Ergänzung und Erk lärung benutzen.
Auch in un serm Falle w ird die Tragödie vorgearbe i tet haben.
S chon oben (p. 390) gew ährten uns die c poi des S ophokles einenAnha l t. Wir w o llen den Spuren d ieses merkw ürdigen S tückesw eiter nachgehn, w obei w ir fr eil i ch der bew ährten Führun g Nanokeen tbehren m üssen.
Aus den c poi fuhr t Nauck an erster S telle (Fr. 335 p. 209)ein w underl i ches Märchen an. Zeus gab den Mens chen zum Lohnefür den Verrat des Prometheus das <poig,u omov dn a05ag, das
Kr äutlein „Nimm er-alt“ . E in Esel muß den Menschen das Krautb ünde l von dannen tragen ; von Durst gequäl t, komm t er zu einerQuel le, die eine S ch lange (örpcg) bew ach t. Die S ch lange gew ährtihm Z utri tt
,und er überl äß t ihr dafür seinen S chatz (zal r ofl
n or oü ögeyo'
y évog än e’
öor o r ofl yrjgwg’L
'Ö q>oigyaxor ) . Daherstammen dann die b ekann ten Eigenscha ften der S chlange
,die
a l lj ährl i ch„das Al ter abwi rft “
,stets durstig ist und den Geb issenen
brennenden Durst m i ttei l t. Neben S ophokles w urden in der gelehrten Que l le
,w e l c he die Nikanderscholien un d Aelian (nat.
an. VI 5 1 ) excerpieren, Deinolochos (Lorenz , E picharm p.
Ibykos (Lyr . III p. %gw r(s)iozg (der S atyrdramendi chter oder derWundermaun) na i
'
A rvol l o <pdmyg(OAF . I p. 7 99) n omym i xwycpdtag”)
erw ähn t. Dar auf, daß die Gesch i ch te in ir gende inem Drama alsHauptstoff dargeste l lt sei
,führt keine Spur, und ganz au sges chlossen ist d iese
1) Das Satyrdrsma hat 99 150 5 : k e i n e r l e i par o di sc h e T e n den z. Ich
habe das w iederhol t hervorgehoben (z. B . bei Pauly-Wissowa 5 . v . Dithy
rambus). Die myt hologische Kom ödie dagegen leb t von Parodien. Das ist
der Hauptuntersch ied der beiden Gattungen , den W i lam ow it z (Hat ip.
Kyklops, Übers .) zu v erkennen scheint.2) S o Älian , v ermutlich v erw irrt
,da ein Komöüendich ter Ar iste(i)ao
unb ekann t ist . Man w ird zunächst an den S atyrdramendichter denken . In
den Nikanderscholien (T hor . 343) meine ich ein Hexameterfragment herauszuhoren : 0 15 xa l r
‘
p: (r a ü)n yv xaipn oc T l’
WO VT £ S &‚a ozßrjv . Den A rimaspeia des
Ps.-A risteas ware die sel tsame Legende schon zuzutrauen .
E in verscho l lener Mythos 395
Annahme für das S atyrdrama, in w e l chem die Protagoni sten desMärchens , die Tiere anders als in der Wunderw e l t derKomö d ie ü berhaupt kaum se lbständ ig auftreten konn ten . Mitl‘h '
. 336 xv lw ö eig dig n g b'
vog ioöorrgrog „w ie ein Ke l lerasse l
hingewälzt“ i s t n i ch t vie l anzufangen. S o b le ib t nur das oben
angezogene Hauptexzerpt Fr . 337 , w onach c’
v Kw rpo i g E ar v'
gmg
Kel_u t g
,eig n u r
’
Ido u'
w v d ax r v'
l w v,r i;v pnr s
'
ga‘
Ps'
a v ößgi o a g za l
p i; Ört odeé'
dy erog sö„u evoig
Aber i rre i ch n i cht sehr,so laßt s i ch von andrer S e ite Z u
fluß heranleiten . Aus der oar vgm j zitiert S tobaeus Fr . 609h i3 1{v r e r i;v (r d) n dv r
'
&n eor egryyérnv
r. w cpiyv äv a v do v
Kl ingt das n i cht w ie eine Erk lärung des w underl i chen Tite l sc poi ? U nd ist n i cht umgekehrt der ebenso w underl iche Ti tel"I
'
ßgcgd as r i chtige S t ichw ort für ein Drama, in dem jener Dämon,r i;v ynr e
'
ga‘
Péa v dßgi o a g e ine Hauptrolle spie l te ? Ebenso sch l ießts ich 6 10 s
’
o&tew &élw v r öv öél <paxa und 335 f. zusammen . Es mußein G a s tma h l vorgekommen oder gesch i ldert w orden sein . Die
Ges ch i chte von dem dummen Ese l , der das kostbare Kraut Nimmeralt fü r e inen Trunk Wasser hergib t
,i st w ie gemacht für die stets
durs tige S atyrschar , die w ir in gle i cher Eigens cha ft aus dem
Kyklops kennen ; i rre i c h n i ch t sehr , so w ar Fr. 696 das man
s chon se ines fes ten Versbaus w egen dem S ophok les n i ch t entz iehenund für die Komöd ie in Anspruch nehmen soll te 1) die Mora lder Fabe l :
dupo7ru yoig r oe m in or n goo <pén ooq>oi
odx äv n l e'
ov rägn,üscag ij m eiv didov’
g.
Das i st w oh l der Lethetrank für die S atyrn gew esen . Kulm
3 eig dig n g b'
r og ioo'
orrgw g lag der Chor da, x w rp bg ä'
v a v do g,
und spie l te so se ine ebenso e infache w ie w i rksame ‘stumme Ro l le’
.
Ist d iese Komb ination berech tigt , h ieß das S ophokleische
Drama ‘
Tßgi g i} Kw rpoi. Der ers te Tite l geht w ie gewöhn lichauf den Agon isten, der zw e i te auf den Chor . Der zw eite (c por)w ir d von Didymos, der Que l le des Z enobios und der Apo l loniosscholien , bevorzugt, der erste bei S tobae
'
ns und Athenaeus .1) Das ist die Ans icht v on v . d. S an de - B a c kh uy z e n ,
De parodiap. 135 ; A . N au c k p. 296 Spricht ke in entscheidendes Wort .
3 96 O . Crusius
Die a l l gemeinen Umrisse des Dramas lassen s i ch danachw oh l erkennen. W ie der S atyrchor bei Euripi des in der Gew a ltdes Kyklopen ist
,so hat er si ch bei S ophokles in den Bere i ch
der Daktyloi v om Ida verirrt ; da mußte er Hüter und Knechtsd ien ste tun , und am S chmiedeherd oder Brat und Backofen mag
er s i ch ähn l i ch aufgeführt haben w ie dem ersten Feuer desProm etheus gegenüber : da für sprechen neben der Ana logie desÄschyleischen v xa ev
’
g die oben behande l ten Spuren in den
Wespen, den T hesm 0phoriazusen und bei E ubu l. Die Dakty lenhat S ophok les (na ch S trabo) als Autoch thonen am Ida ‘
) n i chtals eigentl i che Zw erge dargeste l l t ; nur so w urden sie m ögl i ch fürdie Bühne. Wie im E uripideischen Kyklops w erden die S atyrnetw as Kostbares um e inen Weintr unk w eggegeben haben, den mani hnen bot ; das ist der S inn des Märchens .
Wer mag der Versu cher gew esen se in ? S tumm und taubl iegt der Chor da ; die Vorw ürfe und Wutausbrü che des be imkehrenden Neidings (man denkt an Gesta lten der deutschen S age)gehen spur los an ihm vorüber.
Die Bergmu tter se lbst ers chein t nun kehrt s ich die Wu tdes Kelm is (oder des Kelm is und Kardys?) w i der die Göttin .
Worin b es tand das ößgiäsw ? Es kann so jeder w iderrechtl i che Angriff beze i chne t w erden. Man w üßte gern Näheres . Didymosergänzte bei Aristophanes ie'r vürev Kard0pion w äre dann ein
nmea l or’
ag. Dü rfen w ir das auf Kelmis übertragen ?S ei t Jahren komm t mir h ier j enes schw arzfigurige Vasenb ild
in die Er innerung, das i ch zuers t bei W e l c k e r (Antike Denkm . III,
T af. XV) gesehen habe : ein Riesenhaupt, das aus der Erde auf
s teigt ; rechts und l inks zw e i se l tsame Gese l len, ke ine S atyrn ;der e ine l äßt zaudernd einen mäch tigen Hammer auf der S chu l terruhn, der andre hat ihn auf das Haupt n iedersausen lassen .
Dazu s te l l t s i ch e ine rotfigurige Hydria bei F röhner , Musée deFrance VI
,21 ; h ie r s ind zw e i S atyrn m it der Spi tzhacke tätig
gew esen ; zw is chen i hnen tau cht ein m ächtiges Haupt auf, b eglei tetv on zw ei geflügelten Gen ien . We l cker erkann te hier die Pal iken ;se ine Deutung hat w enig Glauben ge funden und i st l ängst aufgegeben. C . R ob e r t (Archäol. Märchen p. 201 f.) me in t, daß die
1) I hren Namen scheint er v on der Zah l hergeleite t zu haben .
398 O . Crusius
als Kardys , der andre als Kelm is anzusprechen . E s vers teh ts i ch
,daß das n i chts ist als e ine ganz b lasse Mögli chke it. Wie
es sche in t,w ird die S trafe auf Geheiß der Gö ttin von den Brüdern
(dm) r a'
w äösl <pa7v) vol l streckt ; sie lehrt ihnen etw a dem Damnameneu s oder Akmon die Kun s t
,das Eisen zu stäh len und
äggfixzovg n éclag zu s chm ieden. S o muß Kelm is,ein andrer
Prometheus und Ixion,am Ida in Eisen fesse ln seine Ruch los igke it
b üßen. Denn das ist der offens i chtli che S inn des Spr ichw ortesKélni g év ocdrjqrp: Kelmis in Eisen , in Eisen fesse ln Die Lückein dem Z enobiusexzerpt (oben p. 390) setzt e in en derar tigen Inhal tvoraus ; denn es he ißt dann w eiter : ärp’
ob 5 or egeaßr azog éyéver o
oldr;gog das fü hrt übr igens auf ein A i t ion,und die griech ische
Phantas ie mag da noch mancher le i Gew ebe angesponnen haben ,im S ti l der Verw andlungssagen .
Mytho logisch bedeutsam i st das Verha l tnis der Rhea zu denZw ergen. Die Gottin bestätigt und betätigt s ich als echte Wahl
verw andte der Kyb e le, Dindymene, S ipylene : als ,.njmg ögsia oderMutter vom Berge
,w ie Demeter die A r;,u oy rjr qg, die Mutter des
Gans,der Dorfflur
,zu sein s cheint. Auch ihr Name ist so zu
deuten : Petry ist (ö)geln das w ur de vor drei Jah rzehn ten in
e iner Jugendar be it von m ir darge legt”) und i st in zw is chen auchv on anderer S e i te als sprach l i ch zu l ässig , ja w ahrsche in l i ch an
erkann t und erwiesen w orden.
Was oben ausgeführt w urde,mag man zum Te il als ph ilo
logische Komb inationen von versch iedenem S i cherhe itsgrade be
ze i chnen. Urkundl i ch ersch lossen ist aber e ine verscholleneZw ergensage und eine so gu t w ie vers chol lene S agengestal t
,der
Zw erg K a gdo zu'
w v der die Rolle des Bäckers im‘Zw ergenhaushalt
’ gespie l t haben muß.
Er» wol l e} aul 1q r läß t die Protagon istin des Mimus aus Oxyrhynchoseinen in U ngnade gefal lenen Sklaven festlegen .
Bei träge zur griechischen Rel igionsgeschichte (Programm der Thomasschule 1886) p. 1 6 .
8) Kurzform und Vol l form nebeneinander, wie ich es in vielen ähnlichen , auch myth ischen Be ispielen nachgew iesen habe, 9 . Fleckeisens Jah rbücher XLIII p. 385 .
Ein v erscho llener Mythos 399
Die antiken Z w ergsagen s ind b i s lang, sovie l i ch w e iß, nochn i cht in de r Wei se behande l t w orden, daß man die rei che moderne(besonders nordeuropäische) Überl ieferung zur Ergänzung und Verlebendigung des bedeutsam en
,ab er recht fragmentarischen antiken
S agenmaterials‘) ern sthaft zu verw erten versu ch t hätte. Perchta
und die Heimchen, Huldra als Herrin der Zw erge s ind Gesta l ten,die den oben behande l ten griech i schen Typen ganz nahestehn .
Die einzi g b rauchbare S tofi sammlung bei L ob e ck , Aglaophamus I I,1 1 56 — 1202.
[Nachtrag Zu p. 394 vgl. die vor t reffl iche Darlegung v on M e i neke ,
0 . Gr. I 504 ; danach ist an A ristias und ein v on Sophokles benütz tes äl teresSatyrdrama zu denken .]
Aufgaben undWege der Marchenforschung.
F r iedr ich v . der Leyen (Mün chen) .
In den letzten Jah ren hat s ich die Forschung in v ie l en Ländernm it erneu teni Eifer dem Märchen zugew an dt. Die v on JohannesBo l t e und Georg P o l i v k a besorgten neuen Anmerkungen zu denKin der und Hausmärchen der Brüder Grimm s ind im Ers cheinenund übertreffen an Rei chtum und an We i te des Blicke a l le früherenNachw e i se zur Verb re i tung v on Märchen und Märchenmoti ven,o bw oh l w ir gew iß an sorgfäl tigen und um fangrei chen Ar be iten auf
diesem Geb iete ke inen Mange l Einze lne w i chtige Märchenhat in ihr er Ges ch i chte und Verbre i tung F riedri ch P a n z e r “) behandel t
,F r iedr ich Z a c h a r i a e und Johannes H e r t e l pflegen unver
drossen und erfol grei ch ihre namen tl i ch dem indis chen Märchengel tenden e indringenden Bemühungen Emmanue l C o s q u i n setztseine k laren, feinen und überzeugenden Un tersuchungen auf
1) A nmerkungen zu den Kinder und Hausmarchen der Bruder Grimm .
N eu bearbe i tet v on Johannes B o l t e und Georg P o l i v k a. 1 . Band Le ipz ig1 913. 2
. Band L eipzi g 1 9 15 . Vgl. auch die Berichte v on Johannes B o l t ein der Z . des Vereins fur Volkskunde , Berlin, se i t 1 905 .
F riedr ich P an z e r,Hi lde Gudrun. Halle 1 900. Ders. , Beowulf.
Munch eu 1 910. S igfrid . München 1 9 12.
3) Z a ch ar ia e s A rb eiten nam en tl ich in der W iener Zei tschrift fur die
Kunde des Morgen landes und in der Berl iner Ze itschrift des Vereins fürV olkskunde, ebendort H e r t e l s S tud ien und Nachw e ise . Vgl. ferner dessenT an träkyäyika , Le ipzig und Berlin 1909 und dessen Pancatantra, ebd. 1 914.
A us den l etzten Jahren se ien erwähnt : F antaisies bibliomythologiques,R evue b ib lique in tem ationsle , Janv ier 1 905.
i Le la it de la mere etc . , Revuedes questions h istori ques
,A v ril 1 908 . Le prologue-cadre des m il le et une
u nits etc ., Revue b ib l ique internat ionale , Janv ier et A v ril 1 909 . Le conte
-de„la chaudiere bouil lante et la feinte maladr esse“
etc . ,Revue des tradi tions
popu lai res, Janv ier, A v ril 1 9 10. La legende du page de sain te E lisabeth
402 F riedrich v . der Leye
S o unübersehbar re i ch in den letzten Jahrzehn ten das Mater ia lan Märchen gew orden ist
,so w äre doch die Behauptung feh l am
Ort,die ganze Arbe i t des S amme lns sei nunmehr abges ch lossen .
We l che unerschöpf l i chen S chätze China für den Märchenforschernoch b irgt und w e l che tiefen Bl i cke in Ch inas Re l igion
,Kunst
,
Ge is tesges ch ich te uns die ch ines is chen Märchen gew ähren ,das
hat im vorigen Jahr die s chöne Auswah l v on Ri chard W i lh e lmgezeigt
l). Wie vie l Märchen noch heute aus Norddeutsch land zu
gew innen s ind,m achen die überras chend ech ten und lebendigen
Ausbeuten k lar,dieW i s s e r aus Ostho l s tein und W os s idlo aus
Me cklenb urg e inb rachten In e inigen von der Forschung begünstigten Ländern , in Hol ste in, Dänemark, Finn land usw .
,s ind
jetzt die Märchen undMärchenvar ianten a l lerd ings in erstaun l i cherFü l le zusammengeb rach t
,so daß man h ier den vorhandenen Be
stand in seiner Verbre itung und al len se inen Wand l ungen und
Abw andlungen genau überb l i cken kann. Hands chri ft l i che Ver
zeichnisse darüber s ind tei l s der Forschung zugängli ch gemach t,
te i l s w erden ausfüh r l i che Verofi‘entlichungenN e u e Märchen w erden im Westen fre i l i c h kaum auftauchen
,
sondern nur neue Zusammensetzungen der bekannten Mot ive.
Die w i chtigen Mo tive und Motivverbindungen aber sind j etzt w ohla l le nebeneinandergeste l l t und vergl i chen w orden
,das uns be
kannte Materia l ist in d ieser Hinsi cht im w esent l i chen dur chgearbeitet. Als Ab sch l uß d ieser Arbe iten
,die mit den a l ten An
m erkungen von Jakob und Wil helm Gr imm begannen und den
w i ch tigsten Anstoß durch Theodor Benfey erh iel ten, dürfen nun
die neuen Anm erkungen zu den Kinder und Hausmärchen v on
B o l t e und P o l i v k a ge l ten. E in Verze ichn is der bekanntenMärchentypen gab Antti A a rn e .
Mit der S amml ung und Verglei chung der Motive und Motivverb indungen ergib t si ch e ine andere Aufgabe fast von se lb st : dieForderung näm l i ch der kriti s chen Beurte i l ung der Varianten b eijedem Märchen, der Versu ch , späte und unechte Zusätze als sol chezu erkennen und abzu l ösen
,zu den echten Bestandte i len durch
1) Richard W i l h e l m , Ch ines ische Volksm archen . Jena 19 14 .
2) W i lhelm W i ese r , Plattdeutsche Volksmärchen . Jena 1 913.
Richard W o s s idl o . Mecklenburgs Volksüberl ieferungen. Wismar, sei t 1 901 .
Genaueres bei A a rn e,F . F . C . 13
,14 .
Aufgaben und W ege der Märchen forschung 403
zndr ingeu, die ältesten , gesch lossens ten und besten Aufzei chnungenzu erspllren , ku rz die U r form jedes Märchens zurückzugew innenund a l sdann se ine Verb rei tung und Ges ch i ch te darzus te l len und
den G rund der Versch iebungen, E ntstellungeu und Zusätze auf
zudecken . Diese Au fgabe gi l t der gegenw är tigen Forschung als
die w esentl ichste und d r ingendste,und w oh l m it Recht . Denn nur
nach i hrer Bew äl tigung ge langt die F ors chung auf s icheren Bodenund zu fes ten Erkenn tn is sen. Al lerdings ist beim Märchen die
Methode dieser Einze l untersuchungen noch n i ch t zu jener k larenZuverlässigkei t und s i cheren Überzeugungskraft durchged rungen,die das Idea l der ph i lo logischen F orschung b le ib t. In den Wer
tungen der Var ianten spie l t noch vie l fach subjektives Ermessenm it
,und es w erden die Entscheidungen über A l ter und Echthei t
e ines Zuges noch oft zu rasch ge troffen und n i cht a l le Mögl ichke i ten sorgfaltig genug durchdach t und erw ogen Aber geradedie besonnenen und hervorragenden Märchenforscher haben in
diesen Einze l untersu chungen sehr w ertvol le und zum großen Tei lb le ibende Ergebn i sse errei ch t. Wir nennen h ier vw DeutschenErns t K üh n
,Johannes Bo l t e , Wilhelm H e r t z , Theodor Z a c h a
r i a c , von Dänen Axe l O lr ik , von S chw eden C . W . v. S y d ow ,
v on Firm en Ju l ius K r o h n,Oskar H ac km a n n und Antt i A a r n e
,
von F ranzosen Gaston P a r i s und Emmanue l C o s q u i n ?)Jede d ieser Untersu chungen b rachte das Ergebn is , daß jedes
gegenw ärt ige Vo lksmärchen auf ein kunstrei c h erdachtes un d
zu sammengesetztes Märchen als Urform zurückfü hrt,daß d ies U r
m ärchen im Ver lauf seiner Ges ch ich te den mannigfal tigsten Vers ch iebungen, neuen Zusammensetzungen ,
Berei cherungen ,Ver
stümmelungen unterw orfen w ar .
° Möchte man d iese Ergebn i sse nun
auch darin berücks i chtigen,daß die Forscher n i cht immer w ieder
b e l ieb ige Varian ten undMot ive e ines Märchens herausgrei fen, und
aus ihnen S ch lüsse über Alter und Herkunf t des g a n z en Märchensziehen . Jedes Märchen muß z u n ä c h s t als Ganzes und als Organismus untersu ch t w erden, für die Ges ch i chte des Märchens habendie e inze lnen Motive z u n ä c h s t nur in ihrem Zusammenhang,ni ch t in i hrer Vereinze l ung Bedeu tung .
Vgl. z. B. August v o n L öw i s gegen Antt i A a rn e , Z . des Vere in sfür Volkskunde 25, MM.
Genauere Nachwe ise bei Vf. „Das Marchen “
, p. 147 fi
404 F riedrich v . der Leyen
In w e l chen Landern diese Urformen ges chaffen sind , darüberkonnen w ir vie l le i ch t ein lei d l i ch s i cheres U r te i l fäl len, w enn
w irkl ic h Einze l untersuchungen über a l le w i ch tigen und verb re itetenMärchen vor l iegen . E in so l cher Ab s ch luß l iegt heute im Berei chder Mögl i chkei t. Al lerdings w ir d in vie len F äl len die geforderteUrform verloren se in und si ch nur verm utungsw e ise ansetzen lassen.
Viele Märchen sche inen in der äl testen Form ,in der sie vor uns
treten , b erei ts entste l l t und durcheinandergleitend. Z . B s in d dasMärchen vom Me isterdieb be im Herodot und das al te ägypti s cheBrudermarchen in e iner w ohl a l ten , aber ke inesw egs in der U rformuns e rha l ten, und es ist der F ors chung noch n i ch t ge l un gen, m itHil fe anderer recht b em erkensw erter Var ian ten die geforderteU rform dieser Märchen zw e i fe l s fre i herzus te l len . Das gle i che gil tb isher v on e iner Re i he von Märchen
,deren Urform w ir m it e iner
gew is sen Wahrschein l i chkei t : sei es in der alt und m itteljüdischen ,sei es in der a l tgr iech is chen , sei es in der m i tte la l ter l i ch-ke l t ischen ,sei es in der roman i s chen oder der german i schen Di ch tung v er
m utenDagegen festet s i ch die Erkenntn is immer unw i der legl icher
,
daß uns von e ine r Rei he v on Märchen , die noch heute gern erzäh l tw erden und die zu den verb re i tets ten gehören , die U rform in
Indien erha lten ist. Die Fors chungen von Gas ton P a r i s und
namen tl i c h die v on Antt i A a r n e und Emmanue l C o s q u i n habenimmer von neuem gezeigt, daß von d iesen Märchen die äl tes ten,b esten , in s ic h ges ch lossens ten Fassungen in Indien erzäh l t w erdenund daß dort au ch ihre Über l ieferung die re i chste i s t . Dam i tv erw irk l i ch t s ich denn e ine Propheze iung des Verfassers : dieBenfeysche , so heftig und oft so unverständ ig angegriflene Theorieer leb t ihre Auferstehung und w ande l t nunmehr ge l äuter t unter uns.
Von andrer S ei te hat der Verfasser die indis che Herkun ftverschiedener Marchen erw iesen e in igen von i hnen w endenj etzt auch C o s q u i n und A a r n e ihre Aufmerksamke i t zu indemer näm l i ch die indischen und aussch l ießl i ch ind is chen E igentümlichkeiten in ihrem Aufbau , i hr er Phan tas ie, i hrer E rzählungsartaufdeckte . Auch muß es auffa l len
,daß w ir bei den indischen
Beispiele in Däh n h ar dt s Natursagen , A a rn e s F orschungen und
Vf. . Das Märchen .
4 06 F riedrich v . der Leyen
ras ch fu r ort und ze i t los erklä rt , oder sie in irgendeine myth ischeU rze i t versetzt. Die gegenw ärtige Wissens chaft such t umgekehr tzu m ögl i chst genaue r Orts und Ze i tbegrenzung der Märchen zuge langen und erkenn t dadur ch unzw e i fe l ha ft besser und tiefer dieVerb indungen der Märchen m it der Di chtung und dem ge is tigenLeben der Vo lker. Gerade der Versuch , das ers te Auftau chene ines Märchens zu b est imm en , führ te z . B. die Wissenschaft v omgerm an is chen Märchen zu ungem e in w i chtigen Ausbl i cken und Erkenntn issen betrefi
‘
s der Vorge s ch i chte der german is chen und
nord is chen Götter und He l densagen im Ze i ta l ter der goti schenWanderun gen. F unde in der gegenw ärtigen Volks l iteratur desKaukasus und im esthnischen und finnis chen Märchenschatz w arenh ier '
von großer Bedeu tung l ) .Von diesen Ausb l i cken sind nur noch w en ige S ch ri tte zu
an dern Fragen. Läßt s i c h viel lei c ht auf Grun d der gew onnenenDaten e ine Ges ch ichte des Märchens in e inze lnen Ländern v er
suchen ? Vor w en igen Jahr en noch hätte m an eine so l che Fragef ür tö r i c ht und un l ösbar gehal ten
,heute darf m an versuchen
,sie
w issens chaftl i ch und erns thaft zu ergründenö. Die en ts che i dendenDaten in der Ges ch i chte des Märchen s bei versch iedenen Kulturvö lkern l iegen vor . Dann aber, nach Bean tw ortun g dieser Frage
,
w ird erst offenbar w erden , w ie vie l fäl tig und l ebendig die Ges ch ichte der Märchen e ines Lan des m it der Ges chi chte seinerDi ch tung und Bi l dung s ich berührt.
Wenn w ir es nun auch als Erl ösung empfinden , daß die
Märchen,und gerade dank der Benfeyschen Entdeckung , v on
dem tr üben Durche inander und dem phan tas tis chen Raten , auchvon den unbeho l fenen Verm utungen früherer Ze i t befre i t s indoder w en igs tens befre i t se in könn ten und daß sie den erns tenund w issens chaft l i ch en Me thoden der Litera turges ch i chte und
1) Vgl. die oben genannten Bucher v on P an z e r und A xel O l r ik ,
Om Ragnarok,Kopenhagen 1902 und 19 14 ; ders ,
Danske S tudier 1 906 ,1 907 . Über das A lter des deutschen Märchens denkt der Vf. demnächstausführl icher zu handeln , dabei w ird er s ich m it F riedr ich Panzers ah
w eichenden Meinungen befassen .
Man v ergle iche in den Märchen der Wel tli te ratur die E inlei tungenzu den Märchen der B rüder Grimm
,zu den russischen und nordischen
Märchen, und v erg leiche Karl Dy r offs Ausführungen , T ausendundeiueNacht.Leipz i g ,
1 908. Bd. XII, 231 f.
Aufgaben und Wege der Märchenforschung 4 07
Phi lo logie zugä ngl ic h gemach t w urden,so kann doch die Fors chung
n i ch t au fhören, w enn sie die den heu tigen Märchen zugrunde l iegendenU rmärchen mit größerer oder geringerer S i cherhei t ersch lossenhat . Eben w e i l j ene Märchen zusammengesetzte Geb i l de s ind ,gi l t es
,den einze lnen Bes tandtei len , aus denen der Di chter sie
zusammensetzte, den Märchenmot iven und i hrer Herkun ft, nachzufragen .
Wi r verstehen unter Marchen h ier e ine zusammengesetzteWunder und Zaubergesch i ch te. Die Ans i ch t ist nun w ei t verb re i tet
,
daß diese Ges ch i chten gar n i cht alt s ind,d . h . daß sie in Kultu r
zeiteu,n i ch t in den Zei ten des prim i tiven Menschen entstanden ,
und daß sie v on An fang an F abeleien w aren ; zum Spiel , n i chtzum Erns t erdacht.
Diese Ansi ch t kann der Verfasser n i ch t tei len. Fre i l i ch s indunsere Vol ksmärchen
,in der Form ,
in der w ir sie heute bes itzen ,se l ten a l ter als etw a drei bis fün f Jahrhun derte ; die deu tschen Vo l ksmärchen, die man in Deutsch land im zehnten und e l ften Jahrhundert nachw eisen kann
,s ind schon recht se l ten . Wenn w ir a l s dann
indis chen Märchen s chon im vierten Jahrhun dert vor Christus und
den a l ten griech ischen und ägypti schen Märchen noch früher begegnen, so vergessen w ir n i cht
,daß die Ze i ten, aus denen sie uns
überl iefert w urden,Ze i ten e iner re i fen oder überrei fen Kul tur
w aren. Aber w eder die staunensw erte Zähigke i t, die das Märchenze igt
,noch die Gle i chhei t
,die es si ch im Lauf der Jahrtausende
bew ahr t könnte doch das Märchen vom Me i sterdieb in der
F assung bei Herodot oder das von Amor und Psyche, die Que l ledes Apu leius , ebensogut aus der Gegenw art s tammen w ie aus
der Zei t vor zw ei Jah rtausenden noch die unvergle i chl i cheVerbrei tun g dieser Ges ch ichten auf der ganzen We l t und i hreBe l iebthei t, n i ch ts von a l ledem w äre mögl i ch
,w urze l ten i hre
Mot ive n i ch t tie f im Vol ksglauben .
Man bedenke auch d ies : die Verw irrung im gegenw ärtigenVol ksmärchen kann ‘
w oh l die Zurückführung auf das zugrundel iegende U rmarchen lösen
,umgekehrt aber : w ie gewa l tsam ist
die Dichtung,se i t den Tagen des Gilgam eschepos, se i t Homer
und der Edda , mit den a l ten Märchenmot iven und Märchen um
gegangen,die sie im Vol k aufgriffl Während das gegenw ärtige
Vol ksmärchen gerade die a l ten Motive oft üb erras chend gut und
4 06 F riedrich v . der Leyen
ras ch für ort und ze i t los erkl ärt, oder sie in irgendeine myth ischeU rze i t versetzt. Die gegenw ärtige Wissenschaft sucht umgekeh rtzu m ögl i chst genauer Orts und Ze i tbegrenzung der Märchen zuge langen und erkennt dadurch unzw e i fe l ha ft besser und t iefer dieVerb indungen der Märchen m it der Di chtung und dem ge istigenLeben der Vo l ke r. Gerade der Versu ch , das ers te Auf tauchene ines Märchens zu b est imm en
,führte z . B. die Wissens chaft v om
german is chen Märchen zu ungem e in w i chtigen Ausb l i cken und E r
kenntn issen betrefi‘
s der Vorge s ch i chte der german is chen und
nord is chen Götter und He l densagen im Ze i ta l ter der gotis chenWanderungen. Funde in der gegenw ärtigen Vol ks l i teratur desKaukasu s und im esthnischen un d finn ischen Märchenschatz w arenhier von großer Bedeu tung l ) .
Von d iesen Ausb l i cken s ind nur noch w en ige S chr itte zuandern Fragen. Läßt si ch viel le i c ht auf Grund der gew onnenenDaten eine Gesch ichte des Märchens in e inze lnen Ländern v er
suchen ? Vor w en igen Jahren noch hatte man e ine so l che F ragefür töric ht und un l ö sbar gehal ten , heute dar f man versuchen, sie
w issens chaftl ich und erns thaft zu Die ents che i dendenDaten in der Ges ch i ch te des Märchens bei vers ch iedenen Kulturvö lkern l iegen vor . Dann aber
,nach Beantw ort ung d ieser F rage,
w ird erst offenbar w erden , w ie v ie l fäl tig und leb endig die Ges ch ich te der Märchen e ines Lan des m it der Ges ch ichte se inerD ichtung und Bi l dung s ich be rühr t.
Wenn w ir es nun auch als E rlosung empfinden , daß die
Märchen,und gerade dank der Benfeyschen Entdeckung , von
dem tr üben Durche inander und dem phantas t is chen Raten, auchvon den unbeho l fenen Verm utungen früherer Ze i t befr e i t sindoder w en igs tens befre i t sein könn ten und daß sie den erns tenund w issens chaft l i chen Me thoden der Literaturges ch i chte und
1) Vgl. die oben genannten Bucher v on P an z e r und Axe l O l r ik ,
Om Ragnarok ,Kopenhagen 1 902 und 1 914 ; ders. ,
Danske S t udier 1906,1 907 . Über das A l ter des deutschen Märchens denkt der Vf. demnächstausführl icher zu hande ln
,dabei w ird er s ich m it F r iedr ich Panzers ah
w eiéhenden Me inungen b efassen .
Man v ergle iche in den Marchen der Wel tli teratur die E in leitungenzu den Märchen der Brüder Grimm
,zu den russischen und nordischen
Mär chen , und v ergle iche Karl Dy r o ffs Ausführungen, Tausendundeine Nacht.Leipz ig 1908. Bd. XII , 231 f.
408 F riedrich v . der Leyen
treu fes th ie l t, so daß es heute der.
F orschung m ögl ich w urde, dieNeubiegungen etw a bei Homer und der Edda durch den Verw ei sauf gegenw ärtige Vo l ksm ärchen zurü ckzub iegen , die das a l te Gutunangestastet l ießen ! Die Kunstdichter haben auch aus knus tlerischen Gründen
,i hren künstlerischen Ab si chten zu l iebe
, ge
ändert, dem Vol k ist das Marchen n i cht w egen se iner künst leris chenForm ,
die es immer w ieder zerreiß t, sondern w egen seines S toffes,w egen der a l ten Motive w i l l komm en, die es s i ch immer w iedervermehrt und neu zusammensetzt . Al le diese a l ten Motive, ausdenen die Märchen erw uchsen
,führen uns zu ura l tem , zu den
Anfängen der Menschhe i t zurü ckre i chendem und noch heute vie lfa ch mäch tigem Glauben : zum Glauben an die Mach t der Zaubere i ,die Be leb theit der Natur, die Verw andl ungsfähigke i t der Mens chen,die versch iedenen Erscheinungsformen der S ee le
,die Wirk l i chkei t
der Träume usw . Auch a l te S i tten der Urzei t, aus dumpferFurch t des prim i tiven Mens chen geboren , leben im Märchen w e i ter.Aus d iesen Motiven kann ein Di chter das Märchen nur zu e inerZeit geb ildet hab en , in der sie noch mächtig und leben dig w arenund n i ch t b loß ein Spie l der Einbil dungskra f t, und er muß sie
Menschen erzäh l t haben,die in jenen Vorstellungen w irk l i ch lebten.
Natür l ich b rauchen das n i cht die Menschen der U rze i t gew esenzu se in , aber Mens chen
,deren Fühlen und Glauben s ic h in
prim i t iven Formen bew egte : die Frage, ob sie heute leb en oderv or Jah rtausenden ,
i st w en iger w i chtig. Immerhin b leib t beach tensw ert , daß b isher ke in Kuns tmärchen des 1 9 . Jahrhundertsv om Vol k als Märchen anerkann t oder von ihm aufgenommenw urde , w ährend doch e ine Fü l le von Liedern unsrer
„Kun s t
d i chter “ aus der glei chen Ze i t im Vol ke als Vol ks l ieder leben,w enn auch in veränderter
,dem Empfinden des Vol kes angegl ichener
Gesta l t. Denn d iesen Kunstmärchen w aren die a l ten Motivew irk l i ch ein Spie l , und i hnen gal t die Form und die Kunst derErzäh l ung mehr als der a l te Inha l t. Wer aber b ehauptet, dasVo l k hätte die Märchen nie geglaub t
,der er innere s i ch doch an
die m itte la l ter l i che Legende und bedenke ihre Wunder, an die
der Glaube doch ver langt w urde, oder er denke an den heute noch
seh r m ächtigen Glauben an die Wunderkraft den He i l igen . Oderer w erfe e inen Bl i ck in die gerade v om Volk immer von neuemb egehrten Hin tertreppengesch ich ten oder in die ebenso b egehrten
Aufgaben und Wege de r Märchenforschung 409
Zauber und Traumbücher ! Ganz abgesehen davon : w ie anderss ind die Grenzen des Wirkl i chen und U nw i rkl i chen im Orien t undim Okzident, und w ie v iele unserer Märchen danken or iental is cherEinb i l dungskra ft i hr Dasein ! Man su che doch n i ch t imm er w iederin der Märchen forschung den l ängs t überw undeneu Rat iona l ismusdes 1 8 . Jahrhunderts als Maß a l ler Dinge uns aufzureden !
Die Märchen in i h ren Anfängen beha l ten som i t i h ren be
sonderen und vie l fä l tigen Wert fü r die Erkenn tn is der An fangeund der prim i ti ven F ormen von Glaube
,Aberglaube , S i tte, Recht
und Di chtung und dadurch ih ren Wert fü r die Bi l dungsgesch ichteder ganzen Mens chhe i t.
Die Beobach tung und E rforschung der Art, w ie die Küns tleraus den e inzelnen Mo t iven das Märchen zusammense tzen, muß fürdie Poet ik , für die Wissenscha ft vom Werden , Wesen und Wirkender Di chtung und namentl i ch für die Erkenntni s der epischenGesetze fruc htbar se in . Aber auch die Erforschung des Abbausund Umbaus der Märchen , i hrer for tw ahrenden Versch iebungenund neuen Zusammensetzungen ist ebenso w i chtig
,frei l i ch noch
kaum begonnen . Jedes Land hat seine Besonderhe iten und seineseh r beze i chnenden Abw e i chungen aufzuw e isen, und doch w iederdeuten s i ch a l l gemeine Gesetze der Wi rkung der Poes ie an
,der
Au fnahm efähigke it und der Bedürfn isse der Lesenden u nd Hörendenund des Einflusses best imm ter sozia ler S ch ichten auf die Ver
änderung und Umb i l dung des E rzählten l
).
Dab e i ist v on großer Bedeutung w ir bes itzen darüberw oh l e ine große F ül le einze lner sehr interessanter Vermerke und
Aus füh rungen aber noch keine zusammen fassende Darste l l ungw e l chem Alter, w e l chem Ges ch lech t, w e l c hem S tand und w e l c herGese l l s chaftss ch i cht Erzäh ler und Hörer des Märchens angehö ren,w ie die Märchen von ihnen gew onnen w urden und w e l cher Art
Vgl. August v o n L ow i s o f M e n a r, Der He ld im deutschen und
russischen Marchen,Jena 1 912. Vf. , Das Marchen und : Volksl i teratur und
Volksb i ldung , Deutsche Rundschau , Oktober 19 13.
Verw iesen sei auf Paul Z au n e r t s E inle i tung zu den March eu des
Musaeus (in den Märchen der Wel tl iteratur) , auf W i lhe lm W i s s e r s E in
le i tung zu seinen plattdeutschen Märchen , auf A sb j ö r n s en s Huldre E ventyr .
Krist iania 1845— 48, auf J. v . H ah n s E in le i tung zu seinen griech ischen und
albanesischen Märchen (Leipz i g 1864) und auch auf J . u . W. G r im m e A u
merkungen.
4 1 0 F riedr ich v . der Leyen
ih re Erzäh lung w ar . Vergessen w ir doch a l l zu le i ch t die F ragenach den sozia len U rsprüngen und den sozia len Lebensbedingungender Di chtung, e ine Frage, die für die reine und angew andte Vo l ksb i l dung von e iner noch lange n i ch t gebü hren d gew ürd igten Be
deutung bleibt.Die finni s chen Ge leh rten z eigen die Neigung, die Mä rchen
forschung in die Grenzen der vergle ichenden Literaturges ch i ch teeinzus ch l ießen , die dän is chen und s chw ed ischen ze igen außerdemdie Bedeutung des Märchens für die Poet ik doch das Geb ietder Märchen forschung ist vie l w e i ter und um fassender. Nichtnur in ihren An fängen hängen die Märchen m it dem ganzen Werdender Mens chhe i t und m it ihren b le ibenden pr im itiven Lebensformenzusammen , auch w ähr end ihrer Ges chi chte finden sie immer vonn euem ihren Eingang n i cht nur in die höhere Dichtun g, ne inau ch in Re l igion und S i tte. Man bedenke, w e l chen Ante i l diebuddh isti schen Märchen und Legenden am S iege des Buddh ismusüber die östl i che We l t bes itzen ; man erinnere s ich , w e l che Ro l lein der re l igiösen Literatur des Mittela l ters Predigtexempel und
Predigtmärlein haben ! U nd w iederum ,w ie gern beladen si ch ,
namen tl i ch im Orient, die Märchen mit den S chätzen t iefer Spru chWir erkennen noch e inma l
,w ie t ief die in unrechter
Auffassun g stehen, die im Märchen im Grunde doch n i chts sehenw ol l en als e ine re in l iterarische und im Wesen späte Ga ttung !
Die Märchen forschung i st nun,w enn w ir die erste Auflage
der Anmerkungen der Brüder Grimm zu ihr en Märchen als i hrGeburtsjahr b etrachten
,rund ein Jahrhun dert alt . Z u unbedingter
w i ssens chaft l i cher Anerkennung hat sie es in d iesem langen Ze i traum n i ch t gebracht. Einen e ins i ch tigen Beurte i ler kann das
n i ch t w undern . Ih r Materia l,d ie Fü l le der Märchen , ist zu
unübersehbar, zu l ü ckenhaft, zu unzuver läss ig, in se iner Erha l tun gDer Zusammenhang des Marchens mit der b ildenden Kunst ist noch
n icht untersucht. Wicht ig sind h ier die Bem erkungen Reitzeneteins in dengenann ten Abhandlungen ; e in ige Verweise gib t der Vf. in seiner S tudie„Deutsche Dichtung und b i ldende Kunst im Mi tte lal ter“ , die nach dem
Kriege in der F estschr ift der Gesellschaft Münchener Germanisten für
Fr anz Muncker erschein en so l l. Recht merkwürdi g, a l ten Il lustrat ionendes 1 6 . Jahrhunderts und k indl ichen Holzschni tzereien nachgeb ildet
,s ind die
B ilder zu S ophus B u g g e und Rikard B er g e , Norske E ventyr og Saga ,Kjebenhavn Kristian ia 1 909, 1 9 18.
4 1 2 Fr iedrich v . der Leyen, Aufgaben und W ege der Märchenforschung
s che i denden Vertretern w ird sie auch immer besonnener,in ih ren
Methoden b edächtiger, um fassender und zuverl ässiger . Den Einze lph i lologien , denen sie so viel dankt
,w ird sie noch manches
w iedergeb en,denn sie verw a l tet ein Mater ia l w ei t w ie die We lt,
aus Jahr tausenden immer von neuem überl iefert, re i chhal tiger undim
'
Wesen doch einhe it l i cher als andere der l i terar is chen Forschung,und darum auch ergieb iger und s i cherer für die Erkenntni s vo lk skuudlicher und di chteri s cher Gesetze. Immer von neuem führtsie uns auf den Boden zu rü ck , auf dem jede Di chtung aufgew achsenist und den die vo l lendete Dichtung ebenso gern verkenntw ie jene Phi lo logie, die nur der vo l len deten Di chtung gehörenw i l l auf jenen Boden , der uns die Di chtung noch zeigt imlebendigsten '
und s ichtbars ten Zusammenhang m it dem gesam tenge istigen Dase in der Mens chhe i t.
Die Stellung des Ubychischen in dennordwestkaukasischcn Sprachen.
Von
A . Di r r (München).
Als die Russen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach langen , b l u tigen Kämpfen die Vö lker des nordw es tl i chen Kaukasus unterj och t hatten
,entzog s i ch ein Tei l der
le tzteren durch Ausw anderung nach der eu ropäis chen und as iatischen Tü rke i der moskow itischen Herrschaft . Es w aren hauptsäch l i c h tscherkessische S tämme , die den Exodus der russ is chenU ntertanenschaft vorzogen ; auch Abchasen s ch lossen s ich ihnenan . Vom Kosovo Po l 'e bis in die Gegend des persi schen Gol fsl iegen jetzt zers treut auf türkis chem (heute z . T. in anderen Be
si tz ü bergegangenen) Boden Kolon ien der nordw estkaukasischcn
Vö lker. Ganz ausgew andert ist m it ihnen (bis auf ein e inziges Dor fvie l le i ch t) das Vö lkchen der U by c h e n . S ie saßen früher am
Ostu fer des S chw arzen Meeres , in unm it te lbarer Nachbarschafttscherkessischer und ab chas ischer S tämm e. Ihr Geb iet w ar im
Norden ungefähr vom S chache-F l üß chen , im S üden vom S chatsche
begrenzt . Im Norden w aren ihre Nachbarn die (tscherkessischen)S chapsugen, im S üden die Ab chasen . Das ganze U bychenland
hatte a l so eigen t l i ch e ine unbedeu tende Ausdehnung ; w ie die
U bychen s ich se lbs t ausdrücken kaum 30 Pferdestunden der Küsteentlang und etw a 24 Pferdestunden v on der Küste bis zu denBergen der Abadzech und der A bchasen “
. Man s ieht,es hande l t
s i ch h ier w ieder um e ine der k le inen und k le insten ethn is chenEinhe iten
,an denen der Kaukasus so rei ch ist. Die U bychen
s ind , w ie gesagt, vo l l zäh l ig ausgew andert ; im Kaukasus se lbs tsol len nur in einem e inzigen Dor f noch e in ige F am i l ien, zw isch en
4 14 A . Dirr
Tscherkessen v ers treu t,hausen Ihre Hauptmas se ist heute nach
A . B en edic t s en (s . w ei ter unten) im vorderen Kle inas ien anges iede l t : b ei Banderma in der Nähe von Brussa , bei Ism i d, im DorfeKovak b ei S am sun , und in j e e inem Dorf b ei Uzun Ja i la und b ei
Adana . Zers treut leben Ubychen in tscherkessischen Dörfern ; auchin Kon stantinope l sol len e in ige
,nebenbe i bemerkt
,in angesehenen
S te l l ungen leben.
Über das U bychische b esaßen w ir bis j etzt nur sehr dü rft igeNachr ich ten ; e ine ganz kur ze S k izze des b ekannteu Erforschers kaukasischer Sprachen Baron v. U s l a r (veröffen tl i ch t im russi s chen Nachdruck der Arbe i t über das Abchasieche “
) p. 75 ff. und ein paa r handschr ift l iche He fte des Dänen Age Ben edic t s en . Letzterer w ar
im Jah re 1 898 in Kyrk Bunar, in der Nähe v on Ism i d,w o er
s i ch , w ie er sagt,dre i Wochen lang mit dem S tudi um des U hy
chischen abgegeben hat . E s Mater ia l ien ein Heft mit Wörtern,eines m it kurzen Texten und e ines m it einem Glossar zu diesem 3
)w urden von ihm se lb s t dem Herausgeber des S amme lw erks„S bornik Materialov Kavkaza “
,L. L opa t in sk ij in Tif l is
übergeb en , der sie seinersei ts mir überlas sen hat. Lopatinskij,der Verfasser e iner kabardinischen Gramm at ik
,hatte zuerst die
Ab s icht,das U bychische se lb s t zu bearbe iten , wur de aber durch v er
sch iedene w idrige Um stände daran geh indert. Die v on B. gew ährtenMateria l ien w aren für ein grammatis ches S tud ium dur chaus unzu
rei chend, w ei l sie nur re ines Rohmateria l umfaßten . Nachdemnun aber das S tu dium der
„kaukas is chen “ S prachen in den letzten
zehn,zw öl f Jahren e inen m ächtigen S chritt vorw ärt s getan hatte,
w ar es äußerst w ün schensw ert,au ch das U bychische e inzubeziehen ,
besser gesagt, davon zu retten , w as noch zu retten w ar . Die K . R .
Akadem ie der Wissens chaften in Petersb ur g ermäch tigte daherLopatin skij , den ihm erte i l ten Auf trag , das U bychische an Ort und
189 1 schrieb L opa t i n sk iy (im S bornik Kavkaza XII , 1 p. 1
Note daß ein Rest v on U bychen (80 S eelen) v or nicht langer Zei t inv erschiedenen t scherkessischen Aulen des Kubangebietes gelebt habe ; außerdem gäbe es noch etw a 40 Rauchste llen am Ostufer des S chw arzen Meeres,n icht w e it vom Dorfe Golov inskij .
P. K . U sl afr , Abchazskij j azyk. T ifl is 1887 .
In dem G lossar ist auf e ine„Grammatik “
v erwiesen , die B. ab er niegeschrieb en zu haben scheint
,auf jeden F all befand s ich keine unter den
L opa t i n sk i j übergebenen Aufze ichnungen.
4 1 6 A . Dirr
das dorsa le c'
,die dem Kabardinischen feh len , obw oh l sie im
Gemeintscherkessischen w en igstens te i lw eise vertreten zu seins cheinen Dagegen hat das U bychische w ieder das lateralisiertet° des Kabardinischen
,daneben noch das lateralisierte Z"
, die
be i de dem Ab chas ischen feh len .
Im Worts chä tze fäl l t sofort die starke Entw i ck lung der
Kompos ition auf. S ie geht so w e i t, daß es w ahrschein l i ch ist,daß
jedes zw ei und m ehrs i lb ige Wort zusammengesetzt ist. Ein igeBei spie le w erden die Ers che inung k larmachen :
gap’
a Hand ?) + gi Herz= gap’
agi Handfläche
dz‘
i gem e insam + _
l°a B l ut Bruderdéi gem e insam p
‘
wä w eib l . Wesen : déep‘
xa S chw esterö
’
d Mund + bzi Wasser : ö’
äbzz'
Spei che lga V
" für obere Extrem ität + w fi Hal s : qaml/z' Handge lenk ;
vgl . l°azufi Fußknö che l5a Kopf + zu £ : 5azu £ Nacken .
Ahnlich verfährt au ch das Ab chas ische und die tscherkessischenDia lekte. Mit dem Ab chasi s chen
,ab er n i ch t m it dem Kabardinischen
hat das U bychische gemeinsam das h inw ei sende Präfix a.,das aber
n i cht nur zu i so l ierten Wörtern, sondern au ch zu zusamm engehörigen treten kann : t
‘
at‘ Mens ch
,a t
‘
at‘
der Mens ch , sayoc‘
z
asiä°öm r das ist n i cht meine S ache,näm l i ch sayad i ch + a
pron . Element der ers ten Person , ersetzt unser Pron . poss. ,+ ä”o ä”ua) S ache, + «na Negat ivpartike l ; azap
‘
ara die eine(za) Para (p‘
ara) (soil. gab er
Gem einsam ist dem U bychischen, Ab chasi s chen und T scherkes
eis chen die Präfigierungder Pronominalelemente zum Ersatz der Pron.
poss . : ab ch . sab (s-ab) m ein Vater, uh . ser dass ,kab . si-hade dass .
Die andern kaukas is chen Sprachen verfahren h ier ganz anders . Gem einsam i st den d reien ferne rdie Verw endungderPronom inalelementeam Verb zur Bezei chnung der Person
,ein Vorgang, der z. B. in
der daghestanisch- tschets chen is chen Gruppe mehr Ausnahme ist :
1) Die e inzige A rbe i t darüber, das im Jahre 1846 ersch ienene „
S lover’russko-éerkesskij s kr atkoju grammatikoju
“
(von L . L j u l'
e), gib t darübernur ganz ungenügende Auskunft . Ob Fürst T r u b e t sk o j seine Arbei t überdas T scherkessische v eröffentl icht hat , ist jetzt, in Kriegsze iten, n icht festzustel len .
2) Daß auch qap’
a b erei ts zusammengesetzt ist , geht aus dem Verg leichmit l°aß a F uß, Bein hervor.
Die S tel lung des U bych ischen in den nordwestkaukasischcn Sprachen 4 1 7
abch . sabluez'
t‘ i ch brenne
,uh . 39m zsan i c h lese, kab . n
°
as' i ch tue. Das
Ab chas ische und das U bychische prafigieren auch das „Pm nom inale
O bjekt “ in Gesta l t der Pronom inalelemente : ab ch . i-s-yuapx uez'
t‘ i ch
l iebe,u-s-g uapx uez
'
t‘ i ch l iebe d ich —u Pronominalelemeut der zw e iten
Person ub . u -z-ln'
en i ch sehe Die tschetscheno-daghestanischen
S prachen verfahren h ier (mit Ausnahme des T ahassaranischen)ganz anders ; dieKharthvelsprachen präfigieren zw ar das Pronom inahpräfix des „O bjekts “ , doch fä l l t dabei das des „
S ubjekts “ aus.
Gemeinsam is t a l len dre i Sprachen auch die S te l l ung desAdjektiv s nach dem S ubstantiv ; es verschm i l zt dann m it diesemzu e inem Ganzen
,an das die Plura l und Kasusendungen
,sow ie
andere Elemente treten können z . B. ab ch . ap‘
s'
adz-bza'
a gu ter F is ch ,Pl . ap
‘
s'
adz-bziak‘
m ; uh . t‘
at‘
—aga s ch lech ter Mens ch , Pl . t‘at‘-agän ;kab. c
’
ar zZ-peé-x c-m ehrl i chen Leuten -
.c c Plura lendung, -m Dativendung)
S tark heb t s ich die Deklina tion der Nordw estgruppe von der
der Nordostgruppe , a l so der tschetscheno-daghestanischen, ab .
Wäh rend hier e ine große F ü l le von Or tsbeziehungen , Ver
gle i chungen , Bew egungen un d anderm durch Kasussuffixe aus
gedrückt w ird , i st d ies dort n i ch t der Fa l l . Derglei chen Dinge gleitenim Abchasi sch-U bychisch-T scherkessischen insVerbum ,
das h ier überhaupt eine große Attraktion ausüb t und S achen ausdr ück t, dieunsere Sprachen dur ch Präpos itionen, Konj unktionen, Nebensätze,j a sogar durch tragende F ürwörter erledigen . S o ersetzt dasAb chas is che die Pron . interr . dur ch die Endungen -da
,resp. zi
'
j : izblua—da w en brenne i ch ? izblua -zzj w as b renne i ch ? das F ragew ortw ie? durch —é iäazblu a w ie i c h b renne ; unser „w ann
“ dur ch—n(a) sa—na-qou w ann i ch bin . Lokative w erden meist durchentsprechende Verben ausgedrückt : ap
‘
s'
adz adza it‘
oup F isc hWas ser in-ist (V -t
‘
a s i ch befinden in) ; s-r o—up i ch s itze ; s—t‘
a
zo-up i ch s i tze in, daher adza st‘
azoup i c h s itze (im) Wasser. Ähn l i ch89 -k
‘
4 tp befinde m i ch auf,sa-m c
’
a-t o-up si tze vor,se-la -zo-up s itze
in,zw is chen usw .
Das U bychische sch lagt ähn l i che Wege ein . Das Prafix
w a vor dem Verbum bedeutet, daß die Hand lung in etw as v or
geht, byä auf etw as,bld h inter etw as , bac ' unter e tw as , gi in
m i tten von etw .,z. B. m it V} = sein , exis tieren : w ä—s in et w. se in,
1) Die persönlichen Pronom ina s ind in beiden F a l len w eggelassen .
Festsc h r i ft Ku hn . 27
4 1 8 A . Dirr
blä-s machen,daß etw as in etw as ist, bya-s machen, daß e tw as auf
etw as ist, gi
-s exis tieren , le—s w ohnen , b leiben ; V? aus etw as herausgeb en
,kommen ; w a-z(ä) aus herauskomm en
,byä
-r (ä) v onherunternehmen , böe’
—u —z(a) von unter herausnehmen,blä-t (a)
hin ter e tw as hervorgehen, hervornehmen, ma w o? ma-lc’
äm'
w o
hin geh t er ? sä w as? söbieni sa —u-bien -i) w as siehst du ?Auch das Kabardinische w ei st ahnliche Erscheinungen auf.
s'
o od. s'
a z. B. tri tt v or jedes Verb , das ir gend e ine Beziehungzu einem Orte hat : ps'at°e-r gubyo-m s
'
o-llaz'
e der Bauer im -Fe l dein—arbe itet.
Wie sehr die Pronom ina pers . übere inst immen , ergibt fol gendeTabe l le 1
)Ab ch .
'
s-ara ich Kab . sse
u-ara duh-ara w ir
ä”-ar a 2) i hrDie Zah lw örter 1 — 1 0
A bch. 1 akr
6
7
8 a
9 é" byte
1 0 é ”a ps
’
9
Das U bychische s teht a l so dem Kabardinischen h ier naher als
dem Ab chas is chen .
E s darf nun n icht vers chw iegen w erden , daß manche dergesch i l derten Ers cheinungen auch in andern „
kaukas ischen “
Sprachen vorkommen . S o h aben gew isse kürinische Sprachen,v or a llem das T abassaranische
,sehr in teressan te Ortspräfixe im
Die Pronomina der dri tten Person mussen h ier w eg fal len.
50 ist ursprüngli ch labialisiertes jetz t Pfeiflaut .Hier : ü mit Keh lkopfpressung. Bei al len ist das Suffix -ba durch
den S trich ersetzt.Dies i v ist verschieden von dem in 59 a
Alte Parallelen zu den beiden Hundender Sarama.
Von
F rit z R omm el (Muncheu) .
Das Vorkommen der be i den (als Paradiesesw achter und als
Boten des Totengottes Yama gedach ten) Hunde der S arama, w om i tv ie l le ich t die zw e i h imm l i schen Hunde des Nakeatra—Gestirnes
citrä (a Virgin is Spice) zusammenhängen, setze i ch als bekann tvoraus ; die w i ch tigsten a l ten Be lege s in d RV . X ,
1 4 , 1 0 und 1 1
und VII, 55, 2. Dazu gehören die zw e i Hun de der E ranier
(Vend idad 1 3, w e l che die Cinvatbrücke b ew achen.
Z u d ieser den I n d o -E r a n i e r n geme insamen Ans chauungm öchte i ch nun heute me inem verehrten Kollegen
,zu dessen
äl testen S chü lern (Leipzig 1 873— 1 87 5) i ch m i c h zäh len darf, ina l ter Erinnerung an m eine heut noch n i ch t vergessene Jugendliche,m eine meh rj ährigen indologischen S tud ien (S anskri t und Pa l i),e inige a l te Para l le len als besche i denes Angeb in de zu seinem s iebzigsten Geburtstag darb ringen , w obei i ch ganz die Frage offen
lasse, ob es w irk l i ch nur nach Bastians Völkergedanken zu be
u rtei lende Ana logien sind (auch so l che mögl i chs t vo l l ständig, zuma laus äl tester Ze i t, zu samme ln, ist a l le in s chon ein verdienstli chesUnternehmen), oder ob h ier m ehr als bloße Para l le len vorliegen .
Was zunachst den a l t b a b y l o n i s c h e n Kul turkre is an lan gt,
so sehen w ir auf einem unserer äl tes ten S iegelzy l inder (abgeb i l de tund kurz besprochen in meinem Anhang „
Die S chw urgöttin E s
ghanna“ zu S . A. Mercer, T he Oath p. 102 und bei A. J e r em i a s,
E dh. der a l tor. Gei stesku ltur p. 259 , Abb. 1 64) neben Mon d und
Venusstern e ine auf zw e i H u n d e n stehende hochges chürzte Gott in ‚
w ie sie mit dem Bogen auf ein Wil d sch ießt,w as von baby
A lte Paral lelen zu den beiden Hunden der S ar ama 421
lonis chem S tandpunkt aus nur die m it dem S iri us (und Prokyon?dann den bei den Hunden) ve rbundene bogenschießende I star,die j a zugle i c h au ch die Göttin der Spi ca (s . oben das citrä
Gestirn) i st, sein kann .
Dam i t steht in engstem Zusammenhang der Um stand,daß in
dem großen Sy l laba r S b (ri ch t iger S" I I) auf Z . 1 — 9 die Ideogramme für Himme l und Go tt (an und dingir ), Zw i l l ingsstern(nab, spezie l l die Gem in i des Tierkre ises), Ges ti rn (m a l
,dann auch
spezie l l die Plejaden), Hund (ur), Doppe l b u n d (ur -day-gab, sem itisch durch äitnum t
„riva l i s ieren “ übersetzt) und Anführer (nagt'r u ,
das Ideogramm ein sog. gzm ü oder e ine Erw e i terung von ur Hund)eine in si ch ges ch lossene Gruppe b i l den, auf w el che erst m it Z . 1 0 ff.
e ine w ei tere Gruppe (Feuera l ta r, F uß= gehen, ‚ fün f soil. Finger,Hand , Arm) fol gt, w ährend die vorhergehende Ta fe l (S "I) m itdem Zei chen für Bl itzstrah l (ya ! ) sch loß . Ebenso stehen in demdie b loßen S ilbenzeichen (ohne somit. Übers .) gehenden Sy l labarS ° die Ze i chen an
, 7 0 1 und u r b e isamm en und vor der Gruppe ne
(Feueraltar), ka (Mund, Bi l d : Kopf mit Bart) , sag (Kopf, Bi l dbart loser Kopf), du (F uß), i (fün f), su (Hand). Es l iegt deutl i chdie Anschauung zugrunde, daß zum Himme l n i cht b loß die Götterund S ternenw elt im al l gemeinen
,sondern ein ganz hervorragendes
Wesen,ein Hund
,bzw . der als
„F üh rer “ bezei chnet
w i rd,gehört hat . E in Vergle i c h m it der Ro l le, w e l che gerade
der S ir ius bei den a l ten Ägyptern von der ältesten Ze i t an
gespie l t hat, liegt auf der Hand .
Wenn w ir uns nun w e i ter eben zu den Agyptern w enden ,so w ird zw ar der S i ri us dort anders
,m it einem Dreieck , ge
schr ieben (das bekannte Ze i chen spd) , aber au ch im ägypti schenAl tertum begegne t uns s chon an der Wende der dri tten und viertenDynas tie, im Grab des M37 t (Berl . Museum), ein zum m endesischen
Gau gehorender Ortsname S&w (scriptio defectiva stat t des Dua l sder mit z w e i h intere inander s chre i tenden H u n d en deter
1) Die sem itische Ub ersetzgung äitnunu „riv al isieren“ konnte vermuten
lassen, daß die beiden Hunde sich gegenüberstehen . Das Ideogramm w eistindes auf zw e i hin tere inander stehende (beide nach rechts schauende) Hundemit gekr euzten Le ibern hin ,
w ie ja au ch auf dem S iegelzyl inder die be iden(ebenfal ls nach rechts schrei tenden) Hunde dicht h intereinander stehen , indemnur die beiden Leiber s ich teilw eis decken .
4 22 F ri tz Homm el,A l te Paral lelen zu den b eiden Hunden der Sarama
m iniert i st ) Vie l lei ch t darf man dabe i an den fur den gle i chenGau aus spä teren Ins chri ften bezeugten Ortsnamen Wp nß rwj„ S che idung der be i den Götter “ (Horus und S eth) denken ; vgl .dazu Hir ngcg= p
’
jw -j w 71 E r der Hund des Herne“
(S ethe ,AZ 50
, pf S 2). Ob die Ägypter bei dem Ortsnamen S&w (vgl .zu dem ganz dunke ln Wort '
Pyr . 1 507“ 53 m
_Hr
, para l le l m it öb‘
m dlatj ?) w irk l i ch an zw e i h imm l is che Hun de ?) gedacht, i st “
zu
na chst nur m ögl i ch , aber nach aller sonstigen Ana logie dochsehr w ahrsche in l i ch .
Bei den G r i e c h en w urden der U nterw eltshund Argos und
auch Kerb eros ge l egent l i ch zw e i k öpf ig abgeb ildet (Gruppe, Gr.Myth . p. 1 325
,Anm . der v ieräugige
“ Argos erinnert zudeman die vieraugigen
“ b e i den Hunde des RV. X,
so daß
die a l te Zusammenste l l ung des E pith . s’
aba la (a ltere Neben forms'
arvara) „gefleckt“
(RV . a . a . O .) mit Kégßepog doch w ieder neuesZu trauen verd ient.
Die A r a b e r end l i ch kannten zw e i H u n d e“ im S ternb ilddes S tiere, a l-ka lba
‘
ni v,Tauri (die Hunde des a l-dabaran), s iehe
Abd-al-Rahman al—S ufi , Descr . des é toiles fixes, trad. par H. C .
F . C. S c hj e lle r u p (S t . Pét. p. 1 35 . Aber auch den
S ir iu s und den Proky _on, den großen und k le inen Hund des
Pto lemäus , s che inen sie als zw ei eng zusamm engehorige w e ibl i che T i e r e , al-5i
‘
rajäm'
(Dua l von al-Si‘
raj S ir ius,w ört l i ch
„die
Behaarte“
,daher w oh l Z eigw g, kaum umgekehrt), die S chw es tern
des S ultat'
l Canopus (Dim inutiv e ines Wortes sahl,vgl. sah! Rabe?)
aufgefaßt zu haben , so daß auch h ier die Mögl i chkei t besteht,
daß sie s chon v or der Bekann ts chaft m it der Nomenk latur desPto lemäus in ihnen nach u ra l ter Überl ieferung zw e i Hunde er
b l i ck t haben1) Vgl. die Ausgabe in Kurt S e t h e s U rkunden des Alten Re ichs I ,
p. 1 — 7,dort A
,Ze i le 7 '
in S chaefers Ausgabe E ,7 nebst den Varianten
G V I I I , 3 und G IX,1
.
2) F al ls man auch die beiden S chakals der ägypt ischenMythologie (Anub is
u nd Wp deren e inen die Griechen ja als Hund (den andern als Wol f)auffaßten , heranziehen darf, so mehren s ich die Ana logien .
Vgl. zu ai auch schon meine Bemerkun gen ZDMG 45p. 597 f. in me iner Abhandlung „Über den U rsprung und das A l ter derarab ischen S ternnamen “
.
424 W. F oy
hande ln muß als um eine Darste l l ung der Vulva,und in der T at
dienen d iese lben Gegenstände ohne Linga auch als Postamente
fü r Götterfigur en und Re l iqu iens chre ine. In letzterer Verw endungb egegnet uns die runde Form in Nepa l w ährend die viereckigeForm als Trager von aufsteckbaren Kul tb i l dern im a l ten Kamhodscha häufig zu se in ab er ebenso an althinduischen
S tätten des m alayischen Arch ipe l s gefunden w orden ist ') und auchin Vorderindien n i ch t gefeh lt haben w ird. Zuw e ilen erscheintselbst dort
,w o das runde Fußs tück v on Götterfigur en in F orm
eines Lotusthrones gestaltet ist, e ine Umb i l dung nach Art desYon i Augens chein l ich ist a l so der Yon i des LingaSymbole n i chts andres als ein zuglei ch als Pos tament d ienenderOpferaltar. Das w ird um so deut l i cher
,als der rinnenförmige
Ansatz noch heute den sehr praktis chen Zw eck verfol gt, die überdas Linga ausgegossenen Flüss igke i ten (Mi l ch, Wasser) ab zu lei tenS chon im RV. ist übrigens yom’
die ganz gebräuch l iche Bezeichnung für die mit S treu (bar-hie) versehene Opferstätte, ein Synonymvon dem später fast a l le in üb l i chen und vor a llem für die
Feuerherde 7) . Wenn dabe i auch kaum an eine Al tarform,w ie
India, London Pl. X , XII, XVI (rund) ; XVII I , XXII, XXV, XXXIX,XLVII, XLVI _
I I (v ierecki g) . S iehe auch L . F o u rner eau ,Le S iam ancien I
Ann. Mus . Guimet XXV I I), p. 123 (quadratisch) .D. W r i g h t , History of Nepa l (Camb ridge Pl. XI rechts.L . de L a j oa q u i (are , Inven tai re descr . des Monuments du Cambodge 1
(Paris p. XCVI f.3) H . H. J u y n b o l l , Jav an ische Altertumer (Kat. des E thnogr . Re ichs
museums V, Le iden p. 9 f.,Nr. 1583 und 1606 . H. L ow ,
S araw ak(London p. 268 f.
J u y n b o l l a . a. 0 . p. 5 , Nr. 2235.
Vgl. zur lmya-
püjä : B . Z i e g e n b a l g , Genealogie der malabarischen
Gotter, erster erw e iterter A bdruck, besorgt durch W. Germann (Madrasp. 3 1 ; S on n e r at , Voyage aux Indes or ientales et a la Chine, nouv . cd.
(Paris 1806) II , p. 44,46 f.
,53 , E . Mo o r
,T he H indn Pantheon
,new ed. by
W. O . S impson (Madras p. 47 ff. , 806 ; E . W. H opk in s , T he Relig ionsof India (London 1896 ) p. 453 ; B o e c k h a . a. 0 . p. 100 f., 1 7 7 ; E . 0 . Ma r t i n ,
T he Gods of India (London Pl. zu p. 1 72.
Vgl. über die vedi des RV . : H i l l e b r an dt , Rituab Litt eratur , Grundr .d . Indo-ar . Ph il . u . A l tert. I I I 2, p. 14 ; O lden b e rg , Religion des Veda, p. 344.
7) H i l l e b r an dt , a. a. 0 . sow ie Vedische Mytho logie II , p. 86 , So
w ei t yom'
n icht die Opferstätte und die Feuerherde bezeichnet , hat es im RV .,
sov iel ich sehe , nur die ursprüng l iche Bedeutung ‘Vulv a , S choß ’.
Über das indische Yon i-Symbol 425
die uns h ier beschäftigende, zu denken ist, so w i rd doch eben
d iejenige Eigensc haft vorauszusetzen sein, die der Opfers tätte und
dem F euerherd a l lein den Namen yom' gegeben haben kann ‘
) und
die die Anw endung d ieses Namens auch auf das Postament desLinga-Symbo l s veran laß t hat, d . h . die Opferstätte w ird vert ief tange legt, der F euerherd m it e iner Vertiefung versehen gew esen
w ie es vedi und u ttar aved-i nach den Ritualbüchern tat
säch l ich s ind s) .Die Richtigke i t unserer E rklarung des Yon i-Symbo l s w i rd
dadurc h noch besonders erhärtet, daß in den altiigyptischm Grabstätten sei t frühen Zei ten ganz glei chartige quadratis che oderrechteck ige, seltner runde S teinplatten m it vertieftem Fond und
rinnenförmigem Ansatz,auf denen vie l fach in Re l ie f Bi l der von
Spe i sen und Gefäßen für Getränke angebracht s ind,in altarhafter
Verw endung Um E ßtischplatten, w ie Me r inge r
im oü“
enbar en Ans ch luß an W i l k i n s o n ") annimmt, hande l t es s i chdabei n i c ht, vie lmehr s ind die vor dem Toten so oft in den Re l iefsdargeste l l ten Eßtische und d iese Pla tten zw ei ganz verschiedene
Daß d iese Bezeichnung als Vulva empfunden wurde, ist w ohl auchaus dem Verg le ich beim F euerherde m it einer F rau , die nach dem Gattenv erlangt (RV . IV 3
, zu schließen. E benso gi l t die vedi als F rau(H i l le b r an dt , R i tual-Litt eratur p.
Daher w ird er im RV . auch als näbhi bezeichnet (vgl. M a c d o n e l l ,Vedic Mytho logy, Gr undr . d. Indo-ar. Ph i l . III 1 A , p. W as B o l l e n s e n ,
ZDMG XX I I, p. 588 f. über Postamente fiir Gö tterb i lder im RV . anführt, istn icht st ichhal ti g .
3) Vgl. zu ru ttaravedi besonders H i l l eb r an d t R i tual-Lit teratur , p. “ S t .
,
122. Wie die auf diesem Hochal tar befindl iche Vertiefung (u ttaranäbhi) mitW idderhaaren belegt w ird, so hei ßt der Yon i RV . VI 1 5 , 1 6 ümäva t
‘mit
Wol le versehen‘.
Fürs A l te Re ich vgl. M a r i e t t e , Mastaba, Paris 1899 ; furs Mittlereund Neue A hm e d -B ey Kam a l , Tab les d’
offrandes (Cat . Kai ro), Kairo 1 909 .
S iehe auch F . Ll. G r i f f i t h , Karanbg (Un iv . of Pennsylv . ‚E gypt, Dep. of the
U n iv . Mus .,E . B . Coxe jun. E xp. to Nub ia VI) , Ph i ladelph ia 1 9 1 1 , Pl. I ff. ;
R . Me r i nge r , Wörter und S achen I , p. 183ff.
Manners and customs of the anc ient E gypt ians, new ed. (London1878) III , p. 430 f.
Vgl. dazu A . W i e d em an n , Das al te A gypten , 136 (druckferti gfu r die Kulturgesch . B ib l iothek, hrsg. von W. Foy). Daß es sich bei den S te inplatten um e inen Opferal tar handel t , scheint m ir durch die indische Paral lele
426 W. F oy
Da erheb t s ic h nun die kul tur ges ch ich tl i ch sehr interessan teF rage ,
w ie die m erkw ürdige,gew iß n i ch t zufäl l ige Überein
stimmung zw i s chen Ägypten und Indien zu erklären ist . Dre iMögl i chkei ten kommen in Betracht : en tw eder hat Ägypten von
Indien oder umgekeh rt Ind ien v on Ägypten d iese Al tarform be
zogen,oder sie i st in dem Z w isch engebiet, a l so in Vorderasien ,
en tw i ckel t und v on dort aus sow oh l nach Wes ten w ie nach Ostenverbre itet w orden . Über dir ekten Verkehr (zur S ee) zw is chenÄgypten und Indien hö ren w ir nun ers t se i t der Zei t des Ptolemäus II. Phi ladelphus (285— 24 7 v . zun ächst w aren es
aber röm i s ch—
griech ische Kaufleute, die von Agypten nach Indienfuhren . Eine ak tive Bete il igung der Inder am S eeverkehr zw is chenNordostafrika und Indien l äß t s i ch m it S i cherhe i t erst sei t dem1 . Jh . n. Chr . durch den Peripl us Mar . Erythr . b e legen 2) , w enn
sie auch nach dessen Worten über den Hafen E udämon—Arab ia,
das jetzige Aden, als al ten Umschlageplatz des S eeverkehrs zw is chenIndien und Ägypten s chon für die nächst vorangehende Ze it vorauszusetzen i st. Dar über hinaus ist a l les uns i cher, w ie üb erhauptder vorptolemäische S eeverkehr im Arab i s chen Meer Daß j edochges ichert . Die Auffassung des indischen und die des ägyptischen Geratesstützen sich gegense i tig .
1) E . S pe c k ,
Handel sgesch ichte des A ltertums I (Le ipz ig p. 197 ;
R . Mo ok e r j i , Indian Sh ipping (London p,l 2of.
S pe ck a. a. 0 . p. 1 63 ff.,197 f.
3) S pe ck a. a . 0 . p. 1 54 f. , 1 60f1 . , 553 11 . Mi t guten Grunden läß t
sich ein indischer S eeverkehr nur noch nach Babylon ien etwa für das
6 . Jh . v . Chr. feststel len (vgl. Mo o k er j i a. a. 0 . p. 86 Im üb rigen istvon e iner noch gar n icht in Angriff genommenen Gesch ichte der arab ischindisch-ostas iat ischen S chiffstypen, w ie überhaupt v on kulturgeschich th
'
chen
U ntersuchungen , indirekt w e itere Aufklarung zu erhoffen ; gutes Material füraltindische S ch ifis typen bei Mo o k er j i p. 19 fi . Über äl teren arab ischenHandel nach der ostafrikanischen Küs te s iehe S pe ck a. a. 0 . p. 557 ff. A uf
eine,w ohl in äl tere Ze i t zurückgehende v orderasiat ische S chiffahr t w e isen
auch die al ten Go ldbergw erke, S te in ru inen und andere Kultu rerscheinungenim Maschonaland hin (v gl. B . A n k e rm a n n
,Z . f. E thno l . 37 , 1 905 , p. 81 ;
S . P a s s arg e , Oph ir und die S imbabyekultur , G lobus XCI , 1 907 , p. 229
w enngleich das b iblische Go ldland Ophi r n icht h ier,sondern in A s ien zu
suchen ist , und zw ar trotzW . B e l ek , Z . f. E thnol . 42, 1910 , p. 23 (der s ichaufJoseph us beruft), w ahrscheinlich in Süd oder Ostarabien undNachbarschaft,n icht aber in Indien (vgl. zur Lokalisation Ophirs in Indien S pe c k a. a . 0 .
p. 1 69 , 1 94 f. , Die im 1 . Buch der Kön i ge X,22 genannten, w ahr
428 W. F oy , Üb er das indische Yoni-Symbo l
bestanden hat, w ie w ir oben gesehen haben (vgl . Geb lase). Andrerse i ts l äßt e ine Re ihe von Übereinstimmungen zw is chen Indien und
Mesopotam ien gerade auf dem Geb iete von Götterb i l dern und
in Ku l tobjekten a l so, die ebenso, w ie un sreAl tarform ,
dem s treng brahman is chen Ku l te von Haus aus fremdw aren, für Indien e inen Bezug des frag l i chen Al tars von Vorderas ien am plansibelsten erscheinen , w enn er dor t au ch noch n i chtnachzuwe isen Ob er glei chw oh l ers tma l ig in Ägypten ges chaffen w erden se in m üßte oder ob er jener um fangrei chen Gruppehöherer Ku l tur erscheinungen angehören könnte
,die s ich von Vorder
as ien aus tei lw ei se zu ganz versch iedenen Ze i ten einersei ts nachÄgypten ,
anderse i ts nach Indien verb re itet haben , w ürde nur
durch e ine nähere Un tersu chung des a l tägyptischen Kulturaufbauszu entsche iden se in.
1
) Vgl . auch m e ine A usfuhrnngen uber die S tufenpyram ide in dem
Artikel : Indische Kultbauten als Symbo le des Gö tterbergs, F estschri ft fürE . W indisch (Leipz ig p. 218 fi .
Nach R h o dok an ak i s bei Me r in ge r a. a. 0 . p. 183 sol l es s ichim 1 . Buch der Kön i ge XVI II , 32fi. um unsere A l tarform handeln ; dochsche int mir die Deutung der S tel le sehr zw e ifelhaft .
Ach und Web .
Z u Kon rads v on W ür zb u rg E ngelh ard V e rs 5 55 6 — 5 5 6 5 .
Geor g Wol ff (München).
Im Enge l hard,dem w aere von 116/zen tr iuw en
,behande l t Konrad
v on Würzbur g nac h lateini s cher Vor lage in fre ier Ges ta l tung dieS age von den F reunden Am i cus und Amelius, die er se lbstEnge l hard und Dietri ch nennt. Nach mancherle i un ter gegense i tiger Hi lfe überstandenen F ahr lichkeiten s ind die Freunde zugl ück l ichem Dase in gelangt. Engel hard l eb t als Kön ig in Dänemark
,vermäh l t mit E ngeltraut, die ihm zw e i l ieb l i che Kinder
geschenkt hat. Dietr i ch herrscht in Braban t, ge l ieb t und geehrtv on seinem Vo lke. Da w ird Die tr i ch v om Unglück heimgesuch t.Ihn befä l l t der Aussatz , er mußHof un d Burg ver lassen und bau ts i ch auf e iner Inse l ein Häus lein, in dem er einsam und a l leinleb t . Eins t geht er zum Brunnen und
,v om Weg erschöpft, s inkt
er un ter einem Baum in S ch la f. Da l äß t ihm Gott im Traumdurch e inen Enge l verkünden
,Gott w ol le ihn als Lohn für die
große Treue , die er a l lezei t bew iesen habe, von seinem Lei denbefreien ; Dietri ch m öge zu Enge l har d fahren
,ein Bad im Bl u te
von dessen Kindern, die der Freund dem Freunde bereitw i l l ig opfere.
w erde ihm Genesung bringen . A ls Dietr i ch erw ach t, is t er
durch den Traum nur in größeren Kummer versetzt. Denn nie
ma l s w ir d er es über s ich gew innen können, dem F reunde m it
so l cher Bi tte zu nahen . Der Dichter fährt dann Vers 5549 ff. fort5549 Hie m ite gienc der süeze m an
w ider heim ze käse dan
in einer Hageno'
t als
ze keiner ar zen-ie m é
430 Georg W olff
h and er gehaben zuoversiht,
u nd find e gar den traum für ni/zt
der im e w as getroumet dor t.
o w e, d a z siu fz eb er n de w o r t,
u n d au ch der r iu w ec l -ich e sp r u ch
(‚
n
ou
ou
diu n ci m en dö v i l m a n egen b r a ch
du r ch e in er fr eu de m i t t e.
5560 daz isen in der sm itte
sö sér e niki englüej et
als vaste er war t gemüej et
in der v il heizen senden gluo t
dar inn e bran sin lciuscher 1n uot
5565 alle .e it und allen tac.
5553 ha ben Druck. 5556 seufi‘tzende Druck ; siufzende Haupt ; sinflzebaer e
Bartsch ; siufzebem de Joseph . 5557 Vnd au ch der innigliche Spru ch Druck ;un d ach, der r inweoliche spr uch Haupt ; und auch der r inwecliche Spruch
Bartsch, Joseph . 5559 einer ] sein e Druck ; siner Haupt, Joseph . 5561 en t
glüet Druck. 5562 er fehlt Druck. 5568 senden gla et] S onnenglu t Druck ;sannen glu ot, (später sühte gluot, in der sunnenheizen gluot) Haupt ; sürengluot Joseph. 5565 allen] alle Druck .
Ob ige Verse s ind nach dem Texte der neuesten von Pau lG e r e k e besorgten Ausgabe des Enge l hard (Al tdeutsche Textb ib l iothek
,hrsg. von H . P a u l . Nr. 1 7 . Ha l le a. S . 1 9 1 2) w ieder
gegeben. Das Gedi cht ist bekannt l i c h n i cht in einer Hands chr ift,sondern nur in einem Drucke aus dem Jahre 1 5 73 über l ie fert,den der erste Herausgeb er und glorrei che Wiederherste l ler desverderb ten Textes
,Mori z H a upt , in se iner Ausgab e (Leipzig 1 844)
p. VI mit den Worten kennze i chnet : „w enn aber auch n i cht lü ckenhaft , v on rohen händen veransta l tet ist dieser a lte druck, n i cht v one inem dichter w ie Burkard Waldis , an den Eschenb urg dach te .
ein sol cher w ürde Konrads erzäh lung se inen ze itgenossen gen ießbargema cht hab en und uns unm ögli ch ihre ges ta l t mit ein iger w ah rscheinlichkeit herauszufinden : der unb ekannte besorger d ieser ausgabe hat sich '
begnügt die Sprache des dre izehn ten jahrbuudertsin die des sechzehnten um zuschr eiben, unges ch i ckt und oft miß
verstehend und m it unsinn gedanken los zufr ieden .
“ Die Lesartendieses al ten Dru ckes und die vorgeschlagenen Verbesserungen
4 32 Georg Wo lff
Klarhei t und d i chteris che Kraft . Dietri ch k lagt in siner klagenöt
a ls (2; Weheschrei und Achruf b rechen m i tten durch se ine F réude,
w ie der S turmw ind im Wa l de die Bäume in Bru ch “ legt. Vgl .T rojanerkr ieg 1 0 536 62: si [Hekate] wrach sö vrevelichiu w or t von
zouber lichen sachen , daz der w el t erkr achen begunde von ir sprüchen
und sich ze witen britchen vil her ter elim e dö zer cloup.
Wie „a ch u n d w eh “
,forme l ha ft verbun den als Ausdruck
des Jammers und des Jammerns, s e i t dem elften Jahrhundert durchdie deuts che Sprache z iehen, dafür hat nach Jakob G r imm im
Deutschen Wörterbuch Bd. 1 Sp. 1 6 1 , 1 62 jetzt Al fred G ö t z e eben daBd. XIV Lief. 1 Sp.
_
1 .
— 64 (besonders Sp. 8 , 1 5— 1 7
,21
,22
,26 ff.)
eine rei che Lese gegeben, und es erübrigt s ich , noch aus e igenerS cheuer Doch sei Konrads Sprachgeb rauch be
1) Nur e in ige besondere F alle seien zur E rgänzun g des Artikels an
geführt. Auch eine M e h r z a h l der F ormel begegnet : Detlev v . Liliencron
im Poggfred am S chlusse des zw ölften Kan tus (Säm tl iche Werke. Bd. 1 1 .
Berl in und Leipzig . 6 . Aufl. p. U nd m eine S eele wird so kla r und
gu t, Unschu ldig w ie das Gras,w orauf ich stehe ; R uhig bew egt s ich m eine
Herzensflu t, Ver sunken sind die vielen A ch und Wehe.
‘
Mir w ird so froh, so
seltsam w ohlgemu t,A ls ob m ir Überirdisches geschehe. G o t z e findet p. 27
die U m k eh run g weh und ach nur im Vers„R eim u ndMelodik zu L iebe
“
;
doch vgl. Spielhagen , Prob lemat ische Naturen A bt . I Kap. 27 Anfang (10. Aufl .Werke. 3. Aufl . Bd. 1 , N icht alle Kr eatu r ist fein genug organ isiert ,
diesen Duft [der blauen B lume] zu empfinden ; aber die N acht igall ist von ihm
berau scht,w enn sie beim Mondenschein oder in der Dämmeru ng singt und
klagt u nd S chlu chzt , u nd all die när rischen Menschen war en es und sind es ,
die früher und j etzt in P rosa u nd Ver sen dem Himmel ihr Weh und A ch
klagten u nd klagen . F iir ad v e r b i a l en G e b r au c h der F ormel führtG ö t z e Sp. 46 nur ein Beispie l an und zw ar aus Peter Roseggers S chelm aus
den A lpen ; der kühne Gebrauch findet sich bei ihm n icht vereinzel t, vgl. imA lpensommer zu Anfang der E rzählung Der Mann in Gefahr (Gesammel teW erke . Bd. 5 . Leipz ig 1 9 13. p. Und dennoch ist ihr ach und weh .
Wird doch nicht ihr Mann in Gefahr sein ? In v o l k s t üm l i c h e r S p rac h eüberhaupt ist das drastische W örterpaar bel iebt. Im S truww elpeter (Frankfurt a. M.
, Ra tt en Leeming) hei ßt es in der Gesch ichte v om Suppen—KasparS tr ophe 3 : Am dritten T ag, 0 w eh und ach ! Wie ist der Kaspar dünn und
schwach ! Die erste S trophe einer A ns ichtspostkarte aus Hummelsbach
(S tutt gart, Jungingers V erlag , etw a Vor hunder t J ahr en zu Hummels
bach B egr ub m an lebendig den Bu llen , Z u bann en der Viehseuche Weh und
A ch,0 abergltiubische S chr u llen
! In ein er Festzeitnng zum 3. Akadem ischen
T urnbuhdfest in Hameln am 3 .— 6 . August 1 901 (Hame ln 1 90 1) singt p. 18
A ch und Web . Z u Konrad von Würzburg 4 33
l egt : a ch und m ir a rm ez w ip . Alexius 1 148 ; 6 106 w ir hiute
und iem er ach ! Alexius 1 042. Partonopier 9256 . T rojanerkrieg1 2 1 1 4
,22586 ; om a
", geselle , u nd iem er ach ! T roi. 29 040 ;
ouwé,Pär is
,u nd iem er ach ! T re]. 34 9 78 ; m an hoer ei schr ien me
und a ch Parton . 7 6 1 0 ; a ch m ir a rm en und 6 106 T roj. 23 24 7 .
In derse lben Rede w echse ln «
zu? und ach : E ngelh . 5 7 1 4 fi . 6 w é daz
höhen triuwen ie w iderw ac 36 gr6zer schade a ch fr ian t, w ie In'
std
kam en abe der vil lichten var we din 6w é daz dinin starken lider
ie solten 36 gedihen ! T roj . 29 345 on w é , Dezdam ie,w ie gar ich
r röuden v r ie din herze und dinen reinen m uot .
’ a ch,
vrouw e, liebez
her : ebluot,w ie din gem /tete mich m ir sen t !
w o r t und sp r u ch,die zu ow é und a ch appositiona l h inzu
gefügten S ub stantiva,s ind h ier synonym ; spr uch bedeute t dasse lbe
w ie w ort. Gute Be lege b ieten Konrads Ged ichte auf Maria an
den S tel len, an w e l chen der Enge l sgruß A ve,der die Empfängn i s
v erm i ttel t, ge feiert w ird . Gol dene S chm iede 1 287 ff. : 6 0 6,der v e t er
l i ch e sp r u ch,der durch din 6re
,ein allen br ach , dir gie ze herzen
m ade sleteh„ er was 36 senfte und a lsö w eich,daz er in m enschen
verch gedéch , als im der v-r6ne geist ver-léch kr aft und m aht m it höher
sta te ; und im Marienleich in den Liedern 1 , 31 ff. (hrsg . v on Ba r t s c hin seiner Ausgabe v on Konrads Partonopier und Meliur . Wien1 87 1 . p. a v é da z w o r t alsam ein gluot begonde ir herze
enpf/amm en . daz: gab ir 36 heizen r uch daz si dich durh den selben
sp r u ch ze kinde enphienc (in a llen br ach in ir vil hinsehen w annn en .
Zu vergle i chen i s t auch der Wechse l der glei chbedeutendenF orme ln m it w erken u nd m it warten (seh r häufig, z . B. T roj . 31 55 ,7 335 , 25 063 , 26 9 1 3, 29 68 1 , 29 833) und m it w erken und m it spr üchen(T roj . 3266 3) je nach dem benötigten Re imw ort (or ten oder brüchen)und end l i ch ist noch zu beach ten T roj . 1 903 mit spr uchen undm it w er ten .
E . H e s s e in e inem Gedicht auf die„Nichtgekomm enen
“: Muncker ha t auch
schw ere S orgen , Denn der J ude w ill n icht bergen ; Man cher gar in A ch u nd
Weh, L eidet an E xamensnc
'
ih’. Meister Wu r z , Badekur in Re ichenhal l
(Reichenhal l 1 900) rühm t p. 54 f. : S ieben Mark erhielt er —‘
w elch ein Glück
A ls E rsparnis bar zu rück ! Z war n icht viel ist solches fr eilich, Doch ihm
imm erhin erfr e ulich , Hör t er er st das A ch u nd Weh D er Gefähr ten im Coup é
Die w ie er nach Hau se fahr en , Doch in andern Orten waren U nd auchein K om po s i t um w as G ö t z e n icht b e legt b i ldet die Mundart. indemsie die w ackel ige Achenseebahn v on Jenbach nach dem A chensee parodist ischin A ch u nd Weh-Bahn um tauft .Fes ts c h ri ft Kuhn .
4 34 Georg Wo lff
E s laßt s i ch m i th in a l len Einw änden gegen H a u pt s Besserungder Verse 5 556 f. begegnen , und es w ar ein Rück fa l l ins Üb e l ,als K . Ba r t s c h in seinen Beitragen zur Que l lenkunde der alt
deu tschen Literatur (S traßburg 1 886) p. 1 66 fü r ach w ieder dasau ch des a l ten Dru ckes einsetzte und ihm die neuen Herausgeberdes Enge l hard darin fo l gten. Dagegen ist in den sich ans chl ießendenVersen 5558 fi
‘
. dia näm tm dö vil nzan egen brach du rch einer freude
m itte. daz isen in der m itte 86 sére niht englüej et e ine Änderunggeb oten , die Wil he lm G r imm vorschl ägt und die si ch enger an
den Druck häl t,der hier seine
,n i cht seiner überl ie fert . In
seinem Handexemplare des Hauptschen Enge l hard , das i ch vor
Jahren als kös tl i chen Eigenbes i tz erw arb , hat Wi lhe lm G r immfo l gende Emendation an den Rand des Textes geschrieben
-
und
m it der Un ters chr i ft WG äls sein Eigen tum sign iert : eine fre ude
enmitten smitten . E s ist die e inzige T extbesserung, die si ch in
W . G r imm e Buche vorfindet, in dem er sons t die Be itrageanderer F orscher zum Enge l hard in rei cher F ü l le sorgfäl tig v er
zei chnet und man che eigene fe ine sprach l i che und me tri s che Bemerkungen h inzufügt. Aber zw ei fe l los tr ifft d iese Lesar t dasRich tige ; sie ist s innvo l ler und b il dhafter und entspr i cht a l le indem Sprachgebrauch des Di chters , der smitte nur als schw achesFem ininum kenn t. W. G r im m mochten die ersten Verse der
von ihm herausgegeb enen Gol denen S chm iede im Ohr e l iegen :E i künd ich w o ! enm itten in m ines herzen sm itten getihte de golde
sm elzen . Der Re im fin det s i ch noch an folgenden S te l len . Parton.
1 4 327 m it w er ten u nd m it bengeln huoh sich ein solich tengeln und
elah en af in alsö gröz sam sich af eine n aneb6z erhebet in der sm itten .
ser under in enm itten Par tonopier sich w erte ; Parton . 21 060
36 daz er hät den ritter gevellet n ider üf den m elm und er im houbei
unde helm durchslagen hät enm itten . sin her-ze ist in der sm itten der
er en luter w erden ; T roj . 30 988 da s sw er t w as w ol geher tet in
einer gnoien sm itten : Pa troclus w art enm itten enzw ei dä m ite gespalten ;
T roj . 32568 sin swer i daz het ein w iser m an gew orht in einer
sm itten . r ehi in dem strit enm itten begegent im A chilles ; T roj .32 938 er hielt des mäles unde streit in der mälie enm itten . daz
stahel in der m itten getengelt n ie 36 sér e w ar t alsam der heit von
höher ar t m it sw er ten w as gebliuw en ; vgl . au ch Parton. 21 67 6
dar mich vier hunder t käm en sit,die fuoren dr inne enmitte n. fünf
hunder t in der dritten r otte käm en schiere dor t.
436 Georg Wo lff , A ch und W eh . Z u Konrad v on Würzburg
in der vil heizen senegluot,
dar inne br an sin hi nscher m uot
5565 a lle zit und a llen ta c.
Wo l len S ie,hochverehrter Herr Gehe imer Rat, vorstehende
adversar iola freund l ich en tgegennehm en. S o unbedeutend die be
scheidene F estgab e i st,so mö chte sie doch n i ch t e ines t ieferen
S innes entbehren . Daß es e ine german is tische S tudie is t,die
Ihnen dargeb rach t w i rd, m öge b ezeugen,w ie S ie bei der w e l t
w e iten Ausdehnung Ihrer w i ssens cha ftl i chen Interessen auch dasDeutsche mit besonderer Liebe u nd Kenntn i s um fassen . Daß
ferner die Verte i digung eines der Häupter jener großen, e inst imNorden b l ühenden Philologenschule versucht w i rd
,w i l l e ine
Huldigung gegenüber dem Manne se in, der diesem Kre ise nachLe ib u nd Ge ist en tstamm t und se ine bes ten Über l ieferungen v er
tritt . Daß endl i ch von Ach und Web gesprochen w ird : das s indw ieder die unaufhörl i chen Klagetöne, die m ir Hüter der Bib l iothekse lbs t am F es ttage n i cht verstummen w o l len vor dem hochherzigenSpender ü nd S t i fter, dem treuen Berater und gütigen S chutzherrnunserer rei chen und schönen und doch ach w ieder so arm enB ibliotheca U niversitatis Monaeensis.
438 Georg Reismüller
m it se inem häufigen Verkehr auf der-
Bib l iothek, b rach te ihn im
F rühj ahr 1 826 auf den Gedanken , um eine Ans te l l ung in d iesemIns ti tut nachzusuchen . S einen re i chen sprach l i chen und his tor is chen Kenn tn i ssen , die auch Bib l iotheksdi rek tor Ph i l ipp L i c h t ent h a l e r w oh l w ürdigte
,w inkte dort bei der Kata logis ierung der
aus den Klöstern hereingeströmten Bücherm assen ein rei ches F e l dder Betätigung ; der Plan s che i terte jedoch an te i l s finanzie l len
,
te i l s persön l i chen Hindern i ssen .
Dem in ge istiger und le ib l i cher Not s chw er Ringenden fie lennun e ines Tages S ch löz e r s „
Krit is ch-his tori s che Neben-S tunden “
in die Hände . Die Ein le i tung des m erkw ürdigen Buches , ein an
Johann Georg Me u s e l geri ch teter offener Br ief, w or in S chlözerdie Rückständigke it der Deutschen in der Pflege der asiati s chenGesch i chte lebhaf t bek lagt
,ma chte auf Neumann e inen tiefen
, jaents che i denden Eind ruck . Jahre zuvor s chon w aren dem Göttin gerS tudenten aus He e r e n s Vorlesungen e inze lne ferne Klänge au s
dem Osten ans Ohr ged rungen, je tzt ab er tönte ihm aus S chlözers
Worten klar und vernehm l i ch das Le i tmotiv fü r se ine Forschera
_
rbe it en tgegen : „Eine Ges ch i chte des Morgen lan des im ausge
dehnten S inne des Wortes w ar mir zur Leb en saufgabe gew orden .
“
Der angehen de„Geschichtschreiber des Morgen landes “ m uß te
jedoch gar ba l d e rkennen,daß die Lösung dieser Au fgabe ohne
die Kenn tn i s e iniger Hauptsprachen des Orien ts n i ch t mögl i chsei. Mit der ihm e igenen Energie ging er unverzügl i ch an die
Erlernung derse lben,und zw ar fiel se ine Wahl auf so l che Sprachen ,
die eine rei che, aber noch fast gar n i cht ersch lossene h istorischeLiteratur b esaßen, nam l i ch das Armen is che und das Chines ische .
Überd ies w u rden d iese Spra chen an deu tschen Hochs chu len dama l sw enig oder üb erhaupt n i ch t gepflegt : das Armen is che w ar se itJohann Joach im S c h r ö d e r (1 680 — 1 75 6) ganz in Vergessenhe i tgeraten , das Chinesi sche hatte überhaupt erst mit Wilhe lm Chr i st ianS c h o t t Eingang gefunden , der es se i t 1 826 als Privatdozen t inHal le neben Heb räis ch und Arab isch lehrte
,a l lerdings nur ge
legen tlich , w enn s i ch ein S chü ler dazu fand Neumann zw eife l tenun n i ch t , daß ein tü chtiger Kenner der be i den Sprachen b ei dem
1) Hess ische B iograph ien , herausgegeben v on Herman H aup t , Bd. 1
p. 255 .
Karl F riedrich Neumann 439
durch die ind is chen S tu dien gew eckten a l lgeme inen Interesse fürdie orien ta l ische We l t n i ch t ver feh len w erde
,die Aufmerksamke i t
der ge leh rten K re i se auf s ic h zu ziehen und sch l ieß l i c h ein
Wi rkungs fe l d an e iner deutschen Hochschu le zu finden . J eneS prachen verbießen a l so, jede für si ch e inze ln genommen, innereund äußere Vorte i le ; aber auch ihre den modernen Oriental istenzunächst sonderbar anmutende Verb indung en tbeh rte n i ch t derBere chtigung
,insofern als sie
,vom äußers ten Westen und äußersten
Osten der asia tischen Kul tu rw e l t gesmochen und zur Aufze i c hnungder ges ch i cht l i chen E r innerungen benützt, die Mögl ichkei t boten ,das Prob lem der asiati s chen Ges ch ichte von den be iden Gegenpunkten hier in Angri ff zu nehmen .
S o ging denn Neumann zunäch st an das S tudium des Armen is chen . V on dem ihm befreundeten Pa l äographen Ul ri ch Koppauf die Mechitaristen von S an Lazzaro in den v enetianiscben
Lagunen aufmerksam gema cht, begab er s ich im Augus t 1 827 v on
München aus nach Venedig,der ers te deutsche Ge lehrte, der um
des A rmen i s chen w i l len das w e l tferne Inse l k loster aufsu chte . Im
Verlauf wen iger Monate erw arb er si ch bei den Mönchen,die
ein ige Jahre vorher auch Byrons ‘
) Lehr er gew esen w aren,so
gute Kenn tn i sse, daß er ba l d an die Erforschung der armen i s chenGesch i chtsque l len gehen konn te . S e ine Mußes tunden benutzte er
neben Besu chen auf der Bib l iothek von S an Marco dazu,fü r die
Münchener Bib l iothek gute und b i l l ige Bücher e inzukau fen,w or
über er am 4 . Dezemb er 1 827 nach der He imat beri chte t e).Daneben fesse l t ihn das b unte Getriebe der fremden S tadt, re iztihn der Anb l i ck des vielgeschaftigen Ha fens m it den ein und
ausgehenden Levantefahrern, die ihn imm er w ieder auf Asien,den Gegen stand seiner kün ftigen F ors chungen
,hinw eisen . S chon
w erden neue Pl äne erw ogen , w ie aus einem andern undat iertenBrief ”) hervorgeh t, den er (w ahrschein l i ch im Dezem ber 1827 ) ane inen befreundeteten Bib l iotheksbeam ten in München ri ch tet :
Im A rmen i s chen könnte i ch m ir fü r die Noth s chon se lbs t
By r o n , Letters and Journals , ed. by R . E . Prothero 4 p. M .
et pass im .
Regi stratur -Akt der Kgl. Hof 11 . S taatsbib l. Muncheu , B . VI Neu
mann , Nr . 3 .
Reg -Akt HS tB .,B . VI Neumann, Nr. 4 .
440 Georg Reismüller
he l fen,doch b le ibe i ch noch ein ige Monat, b is Media F eb r. hier,
und gedenke dann na ch Ragusa zu gehen , um I l lyris ch zu lernenkomme i ch dann gen May nach Mün chen so gehe i ch , man
w i rd m i ch w oh l gehen lassen , nach Paris um Chines is ch u . Arab ischzu lernen , das Pers is che i st e ine Klein igke i t. Dann geht es
,
w enn i ch 33 Jah r alt b in, an m e ine Ges ch ichteder Po l i tik , neb enbeysehe i ch auc h vieler Mens chen S tädte und S i tten . Morgen mehr
,
es ist 1 2. Me in K0pf ist man chm a l sehr angegriflen . I ch leseh ier die Al lgem. Ze i tung in e inem Cas ino und die Journa le imAtheneum ,
w ovon i ch Mitgl ied gew orden b in . I ch könnte vie l überi ta l . Literatur s chre iben, habe aber ke ine Ze i t und spare Al lesauf die Zu rückkun ft. Ich b in mit m e inem h ies igen Aufentha l tzu fr ieden ; B ib l iothekar Bettio 1) (der Marciana) ist me in Hauptgönner11 . w enn die h iesige Biblioth . die Denks chrif ten der A cademic se i t1 807 zum Ges chenk bekommen könn te, w äre m ir sehr l ieb ; i chb itte m it Lichtenth . und Thiersch ge legent l i ch darüber zusprechen
Der in dem Briefe erw ähnte „i l lyr is che“ Re i seplan , der den
jungen Forsche r auf ein ganz anderes Geb iet geführt hätte. kamglück l icherw eise nie zur Ausführung
,v ie lmehr finden W ir ihn
,
den die Mechitaristen zum Ehrenm i tgl ied ihrer Akadem ie ernannthatten
,s chon im März 1 828 w ieder in München
,w o er seine
Vorbere i tungen für die Reise nach Paris trifl°t. Die w en igenWochen in der He imat b l ieben auch sonst n i ch t ungenutzt. Erarbe i tete w ieder fle iß ig an der Bib l iothek und fand dort au chgle i c h Ge legenheit, se ine neugew onnenen Kenn tn isse im Arm en i schen zu verw erten , indem er im Apri l eine Beschreibung ?) derarmen i schen Handschriften der Bib l iothek ausarbe i tete. Er erh ie l tdafür ein Honorar von 25 Gu lden . Der Akadem ie der Wissens cha ften machte er im Marz das Anerb ieten , w ährend seinesAufen thal tes in Paris und London 3) für die Bib l iothek aus länd is cheWerke b i l l ig anzukau fen und Defekte zu ergänzen . DirektorL ichteuthaler nahm nach Rücksprache m it dem U niv ersitäts
b ib l iothekar H a r t e r das Anerb ieten um so l iebe r an,als gew i sse
1) Pietro B e t t i o (1 769 i talien ischer Theo loge , dama ls Vorstand
der Marc iana.
C . bav . Cat . 48 der Hof u . S taatsbibl.3) Reg.
-Akt HS tB. ,B . VI Neumann , Nr . 7 .
442 Georg R eismüller
ill . le pr ofesseur N eumann, apres avoir puisé, pendant son sej o w
Venise,
aux sour ces les plus pur es de la littér at ure arménienne,est
venu P ar is expres pour s’
y livrer c‘
t des tr avauee sur le chinois et
il a poussé cette étude avec tan t d’
ardeu r, gu
’
en tree-peu de temps
il n’
a pas cr aint d’
en trepr endr e la tradu ction d’
un ouvrage non mains
difficile par le suj et qu e par le style, fun des traités de m étaphysique
du eélébre T chu -hi Liegt auch in den Worten des verb indl i chenF ranzosen vi e l le i c ht e ine höfl i ch um schriebene Warnung
,die Kräfte
n i cht zu üb ers chätzen,so lassen sie doch erkennen , w ie hoch er
den in se inem Lerne i fer ungestüm vorw ä rts drängenden Bayerns chätzte
,w as üb rigens auch daraus hervorgeht
,daß er ihn später
h in mit guten Empfeh l ungsb riefen nah London versah .
Neb en Rémusat hörte er Antoine-Jean S a i n t -M a r t i n,bei
dem er se ine armeni schen S tud ien for tsetzte ; als e in e Frucht derse lben l ieß er anfangs 1 829 über den armen is chen Aristote lesübersetzer Davi d e ine Arbei t ersche inen, fü r w el che das Jour na lAs iatique dem jungen F orscher se ine Spa l ten Von Alt
m e i ster S i lvestre de S a cy l ieß er s i ch ins Pers ische e inführen ;die in dem ob en angeführten Briefe aus Venedig ausgesprocheneAb s i cht Arab isc h zu lernen , hat er ans che inend n i ch t ausgeführt .Auch die Frage
,ob er s chon in Paris s ich erns tl i ch mit S anskri t
bes chäftigte , muß offen b leiben ; ein b estimm ter Hinw e is auf die
Erlernung dieser Sprache findet si ch erst aus dem Jahre 1 830 :als er von Berl in nach London rei ste, las er , w ie er in seinemTagebuch v ermerk t
,im Pos tw agen in B opps Grammat ik . Der
Vo l l s tändigke it ha lber sei - h ier n och erw ähn t,daß er si ch die
Kenntni s des Heb räis chen s chon als Jüngling un ter der An le itun geines Rabb iners angeeignet hatt e. S eine S tudien b rachten ihn
au ch mit seinem berühm ten Lan dsmann Ju l ius v on K l apr o t h inv ie l fache Berührung, doch scheint ihm der Umgang mit dem b e
rüchtigten Kriti ke r und Pamph letisten w en ig Vergnügen bere ite tzu haben .
Neben den sprachli chen Übungen vergaß er , dessen ers teLiebe doch der Histor ie ga l t, die Pflege der Ges ch i chte n icht,
1) Nouv . Journ . A s. III Rapport p. 29 . E ine Arbei t uber
T schuhi v eröffentlichte Neum ann üb rigens erst im Jahre 1837 in der Z . f.d. b ist . Theologie VII , 1 — 88 .
Nouv . Journ. A s. II I , 49 — 86 ; 97 . - 1 53 (auch sep. arsch . Paris
Karl F riedrich Neumann 4 43
w e l che ge rade dam a l s am Co l lege de France durch G u i z o tg länzend v ertreten w a r . Auch die Vor lesungen Vi ctor C o u s in ebesu ch te er als e i fr ige r Zuhö re r . Der Verkeh r m it dem fre is inn igen Phi losophen , dem er auch persön l i ch naher trat, mag
n i ch t ohne Einfluß auf seinen Späteren po l i tischen Entw i cklungsgang geb l ieben se in. S o ha tte s ich der strebsam e Bayerin ku rzer Ze i t in der Pa ri ser Geleh rtenw e l t festen Boden un terden F üßen geschaffen . S chon am 7 . Ju l i 1 828 w ar er zum
ordentl i chen Mitgl ied der S ociété Asiatique ernann t w orden , derenListen ihn a ls
„professeu r d'histoire a Muni ch “au fführen . Daß
er ta tsäch l i ch den Ruf e ines tü chtigen Ge lehrten besaß,is t uns
ausdrückl i ch in den in teressan ten Briefen über den F o rtgang deras iati schen S tudien in Pa r i s bezeugt
,die s ich w ie fo l gt über ihn
äußern : „Auch besu ch t Remüsat ’s Vorl esungen der ge leh rte ProfessorNeumann aus München , der bei großer V iel se i tigke i t und k laremS inne
,sehr gründ l i che Kenn tni sse im Armen is chen und anderen
Sprachen A s iens besitzt, die er zu einer w ünschensw erthen Arbe i tü ber die Verfassungen der Völker dieses E rdtheils an zuw endengedenkt
Eben d iese vie l sei tigen Kenntni sse hal fen dem nur auf se inekärgl iche Pens ion angew iesenen Ge leh rten auch die materie l lenS chw ierigke i ten se iner Lage im teuren Par is bes iegen. Der
Ertrag kle inere r l iteraris cher Arbe iten setzte ihn in den S tand,auskömm l i ch zu l eben und s ich sogar den Luxus des gese l l igenVerkehrs zu gestatten. Denn Neumann w ar n i c hts w en iger als
ein S tubenge lehrter , er bemühte s ic h im Gegentei l , seinen Bl i ck fürdie Vergangenhe i t durch die Bes chäftigung mit der lebendigenGegenw art zu schärfen . Das Par is v or der Ju l irevo lu tion bot
ihm dazu Ge legenhei t genug, denn dem Kgl. Bayeris chen Professorund Mitgl ied der S oc ié té Asia tique st anden auch die S a lons derGese l l schaft offen . Dort lern te er versch iedene hervorragendeMänner des dama l i gen Frankre i ch kennen, w ie die Naturforsch erAm per e und C u v i e r , und den Archäologen L e t r on n e. In ein
näheres Verhäl tni s trat er zu dem fast glei cha l terigen Vic tor Cous in(s . m it dem er manches vertrau l ich-freundschaftl i che Gespräch
1) Briefe uber den Fortgang der Asiatischen S tudien in Paris , v on
e inem der oriental ischen Sprachen beflissenen jungen Deutschen . 2 . vorm .
Ausg . (U lm p. 12,
444 Georg Reismüller
pflegte. U ber all dem bun ten Leben vergaß Neumann n i ch t der Aufgabe
,m it der ihn Bib l iothek und Akadem ie in der He imat betraut
ha tten ; getreu l i ch b esorgte er b ei den Pariser Buchhändlern dieBeste l l ungen , w el che ihm die Mün chener Bib l iothekare v on Zei tzu Zei t, so z. B. am 22. Jun i 1 828 und am 7 . März 1 829
,zu
geben l ießenDie Beziehungen
,die der Ge leh rte in Par i s angeknüpft hatte,
er w iesen s i ch als sehr nütz l i ch,als er in Verw irk l i chung des
zw e i ten Tei les se ines Re iseprogramm s im Apri l 1 829 nach Londonübersiede l te
,w oh in ihn neben se ine r Bew underung für das fre ie
England vor a l lem die Auss ich t lockte,die re i chen und im Gegen
sa tz zu Paris le i cht zugängl i chen S amm l ungen ch ines ischer Bücherder Asiati s chen Gese l l s chaft und der Londoner Miss ionsgesel l scha ftb enützen zu können . Mit Einführungssch re iben se iner Par iserF reunde und Gönner versehen so empfah l ihn Remusat an den
S ino logen S ir George S t a u n t on , den Mitbegründer und Vizepräs identen der Roya l A s iat i c S ociety hatte er bei seineranpassungsfahigen Natur ke ine S chw ierigke i t, in dem spröderenengl is chen Boden rasch Wu rze l zu fassen. S taunton führte ihna l sba l d in die hochangesehene Asiati s che Gese l l s chaft ein
,an
deren S i tzungen er eifr ig te i lnahm ; das S i tzungsprotoko l l v om
1 6 . Mai 1 829 e rw ähnt se inen Nam en ausdrückl i c h in der Spenderl iste 2) . Der n eugegrundete Orien ta l Trans lation F und bew i rb ts i ch um seine w issens chaftl i che Mitarbe i t und nenn t ihn auch imRechens chaftsb er i cht v om 30 . Mai 1 829 neben Klaproth , Kosegarten , F le is cher un ter den ausgeze i chneten Ge lehrten („ very em inent
orien ta l scholars“
) desKon tinents, deren Mi tw irkung ges i chert seiEr ü bernahm h iefü r die Übersetzung der Ges ch i chte Vartans
v on dem armen is chen Bi schof E lisaeus. Daneb en verschmähte er
es n i ch t,die Ergebn i sse seiner Beobachtungen und S tud ien in
kü rzeren Abhand lungen n iederzu legen ,die er me is t in den
Cottaschen Jou rna len ve röffentl i chte. Der Er l ö s aus d iesen Arbeitem setzte ihn in den S tand , die Ausgaben für seine Re i se v on
Par is nach London und fü r den Aufentha l t dase lbst zu bestre i ten ;n i ch t se l ten gew ährte ihm Baron C o t ta Vors chüsse auf noch n i cht
1) Reg.
-Akt HS tB .
,B . VI Neumann , Nr . 9
,l l - lß.
A siatic Journal 27 p. 726 .
3; A s . Journal 28 p. 6 6.
4 46 Georg Reismüller
armen Lebens, und doch w ar er um der Wissens chaft w i l len zu
jedem Opfer bere i t. Na ch Abs ch l uß des Vertrages l i tt es ihn
n i ch t länger m ehr in London . Ende Mai 1829 e i l te er nachDeuts ch land zurück , um dort in der bayer is chen He imat Unterstützung für den Plan zu gew innen , den er in Verb indung m itse iner großen Re ise anszufuhren gedachte. Er beab si chtigte nam
l i c h n i ch ts Geringeres , als in China e ine S amm l u n g v on c h i n ee i s c h e n Bü c h e r n und Kunstgegenständen anzu legen und sie
nach seiner Rückkun ft in irgend einer F orm dem bayer is chenS taate zur Verfügung zu s te l len . War er b isher schon in Venedig,Paris und London fü r die In teressen der Landesb ib l iothek tätiggew esen, so gedachte er dasselbe jetzt auch in Chin a zu tun .
Chines is che Bücher w aren dama l s in Europa se l ten und teuer,
und Neumann hatte n i ch t Unrecht, w enn er s chreibt
,daß die
ers ten Bib l iotheken Deutschlands kaum e inze lne Bände v on den
gew öhn l i chen Werken besäßen .„Nur Berl in machte eine rühm
l i che Ausnahme.
“ Aber auch die Kön ig l i che Bib l iothek ha tte, w ieKlaproths Ka ta log aus dem Jahre 1 822 erkennen l äß t, nur e ineverhäl tn i smäßig besche idene S amm l ung.
In Ver fo lgung seiner Plane begab s i ch Neumann im Jun i 1829nach München
,um auf der S taa tsb ib l iothek Um s chau nach e tw a
dort vorhandenen chines i schen Büchern zu hal ten und durch ihreKata logis ierun g die Aufm erksamke i t der bayris chen Regierungauf sein Vorhaben zu lenken . Der v om Jul i 1 829 datierte, v onseiner Hand stammende Kata log 1) en thäl t im ganzen nur 20 Numm ern(w orun ter al lerdings e in ige w ertvo l le S tü cke aus den Jesu i tenpressen in China). Er erhie l t da für von der Bib l iothek aufBe feh ldes K. Min i sterium s 50 Gulden ausbezah l t.
Da Neumann mit se inen Bemühungen in München n i ch tdurchd rang
,re iste er Anfang August 1829 nach Berl in
,w o die
w i ssens chaft l i chen Kreise berei ts auf ihn aufmerksam gew ordenw aren und die Akadem ie der Wissenscha ften ihn zum korrespondierenden Mitg l ied der h is torisch-philologischen Klasse ernann te.
Am 1 6 . Oktober erbot er si ch in e inem an die Verw a l tung derKgl. Bib l iothek geri chteten S chre iben „
aus w issenscha ft l i chemC . har . Cat . 45 der Hof 11 . S taatsbibl.
Gefl. Mi tte ilung des Herrn B ibliothekar e Prof. Ha l l e aus den Akten
der Kgl. B ibliothek in Ber lin .
Karl F riedrich Neumann 447
In teres se und Vor l iebe für Preußen , das v on jeher das Vaterlandj edes w is sens cha ft l i chen Deutschen sei“
,fü r die Kgl. Bib l iothek zu
Samme ln. Nach l änge ren Ve rhand l ungen , die s i ch bis Anfang 1 830hinzogen, w u rde ihm endl ic h auf Verw endung des Oberb ib l iotheka rsW i l k e n der Betrag von 1 500 Re i ch sta lern zum Ankau f v on
ch ines ischen Büchern oder anderer w issenschaftl i cher Gegenstände “
vom Kul tusm ini ster von A l t e n s t e i n zur Verfügung geste l l t . Die Wartezei t benützte er zu vorbere i tenden S tud ien in
der ch inesis chen Bücherei der Kgl. Bib l iothek ; auch sch rieb er
ve rs ch iedene Ar tike l für das und Besprechungenfür die Jah rbücher für w i ssens cha ftl i che nachdem er im
Januar 1 830 Mitgl ied der S ocietät für w issen s chaft l i che Krit ikin Ber l in gew orden w ar . Wen ige Tage vor seiner Abrei se sandteer den Jahrbüchern noc h e ine kurze Bes chreibung der armen is chenund ch ines i schen Handschr iften und Bücher
,w e l che Alexander
von Humbo l dt von seiner russ isch-sib ir ischen Re ise m i tgebracht undder Kgl. Bib l iothek zum Ges chenk gemach t hatte. Die in Eileh ingew orfenen zu den fünf ch ines is chen Werkender S amm l ung enth ie l ten e ine Rei he v on Unrichtigkei ten, die ihmvon sei ten se ines Landsmannes He inr i ch Kurz e ine gehässige, dasMaß des Er laubten w e i t überschre i ten de
,w enn auch sach l i ch
berech tigte KritikEnd l i ch
,am 1 6 . Februar 1 830
,s ch l ug die langersehnte Ab
schiedsstunde . Die an ernsten und hei teren Zw is chenfäl len rei cheRe i se führte unseren Chinafahrer über Kö ln durch Flandern nachCa lais . An der hol l ändis ch - französi schen Grenze erregte der
deutsche Professor mit se inen Kisten vol l deuts cher,engl is cher
,
griech is cher, latein is cher , armen i s cher, hebräis cher und ch ines is cherBücher, h inter deren krausen Ze i chen s ich vie l lei cht staatsgefähr
Die dr amat ische Poesie der Chinesen . Von Karl F riedrich NeumannAusland 1829
,Nr . 231 , 233 und 237 .
3) Han k o o n g t sew . or the S orrow s of Han . Trans l . from the
Chinese by J. F . Dav i s. London 1829 : Jahrbücher f . w iss . Kri t ik 1830 (Januar),Sp. 101— 104 . Konrad Man n e r t
,Geograph ie von Indien . 2. Aufl. Leipz i g
1 829 : ib id. 1830 (März) , Sp. 445— 451 .
Jah rb . f. w iss . Kri t. 1 830 Anzeigebl. Nr. 2.
U ber e in i ge der neuesten Leistungen in der ch inesischen Litteratur .
S endschreibeu an Herrn Professor E wald in Gö ttingen v on Dr . He in richK u r z . Paris 1 830 (Bez. in Nouv . J . A s. 7 p. 373 Vgl. auchK l apr o t h gegen Neumann , Nouv . J . A s. 8 p. 66 — 80.
4 48 Georg Reismüller
l i cher Inha l t b erg, die schw eren Bedenken des französis chen Zo l lbeam ten, die erst durch ein gew i ch tiges Fünffrankenstück zerstreu tw erden konnten . E in ku rze r Aufen thal t in Li l le , w o er der w ertv o l len, aber v erw ah rlosten S tadtb ib l iothek e inen flüchtigen Besu chabstattet, läßt ihn die „
barbar is chen Zus tände“und die U nb i l dung
na ch a l len Richtungen des Gei stes und des Lebens “ in der frauzösischen Prov inz b eklagen . Die Überfahrt ges chah v on Ca lai snach Dover, w o ihm w ieder w egen seiner Bücher S chw ier igkeitengemach t w urden . Mi tte Mär z tra f er in London ein, v on F reundenund Gönnern lebhaft begrüßt. Die Ze i t
,die ihm noch b is zur
Aus rei se zur Verfügung s tand, verbrachte er m eis t in den Bib l iotheken,um s i ch e in en Überb l i ck üb er die ch inesi s chen Druckerzeugn issezu vers chaffen. S e in Hauptaugenmerk w endete er diesma l dergroßen Büchersamm lung zu
,die Dr . Mo r r i s on
,der berühm te
Miss ionär und S inologe , aus China m i tgeb racht hatte. Wie das
Tagebuch vermerkt, besu chte er sie am 28 . März zum erstenma lund arbe i tete w ährend der fol genden Tage fleißig in ihr . Erfertigte si ch ein Verze i chn is der ihm w i chtig erscheinenden ch inesischen Bü cher an
,um es bei seinen Ankäufen in Kan ton zugrunde
zu legen. S o ha tte er Ge legenhei t, noch in Europa ein ige sehrw i ch tige Werke kennen zu lernen , w ie z. B. die große S amm l ungder Re i chsanna len , dann S ze Ma-kuangs um fangrei ches Geschichtsw erk
,den T‘
ung kien , sow ie e in ige enzyk lopädis che S amme lw erke ,das S an ts‘ai t‘u hu i und das Yüan kien Iei han . Tatsäch l i ch istes ihm auch ge l ungen
,diese grundlegenden Werke mit Ausnahme
des S an ts‘a i t‘u hai in China zu erw erben. Den S itzungen derAsiatis chen Gese l l schaf t w ohnte er am 20 . Marz und 3 . Apr i l b ei ;b ei letzterer Ge legenhe i t erhie l t er von seinem Par iser S tudiengenossen Ju l ius Moh l die Nach r i ch t v on der Ermordung des an
gl ück l ichen er sei v on e inem Kurden erschlagen w orden,
der ges chw oren habe,für seinen von e inem Engländer erschossenen
Vater an dem ers ten Europäer Rache zu nehmen , der ihm in den
Weg käme. Bei se inem a l ten Gönner S taun ton tra f er m it demNordpol fahrer F r a n k l i n zu sammen . Auch der dama l ige preußi scheGesandte v on B ü l ow
,dem er v on Wilhe lm von H um b o l d t emp
foh l en w erden w ar , interess ier te si ch für se ine Re ise und l u d ihn
S . o. p. 44 1 .
4 50 Georg Reismüller
Der deutsche Professor und Chinafahrer 1 ) ga l t bei der rauhen ,nur auf s chne l len Ge l derw erb erpi chten S chiflsmannschaft als
sonderbarer S chw ärm er ; er w urde übr igens v om Kapi tän und den
anderen Offizieren n i cht zum Matrosendienst herangezogen,zu dem er
e igent l i ch verpfl ich tet w ar,sondern als einer i hresgle i chen b e tr achtet.
Er konnte a l so im Rahm en der s trengen S chifl°sordnung be l ieb igübe r se ine Zei t verfügen und s ic h für die fas t fün f Monate dauerndeFahrt einen rege l rechten S tudienplan ausarbei ten, an den er si chauf das strengste h ie l t
,sow e i t ihn n i cht s ch lech tes Wetter oder
die Tropenh itze daran h inderte . Die Morgens tunden w urden m it
dem Lesen und Exzerpieren der antiken und m i tte la l terl i chenS ch r if ts te l ler zugebracht
,die Nachri chten über den Orien t
,
namen tl i ch über Ind ien und China,en tha l ten; Die Tagebüch er
zeigen re iche Spur en diese r Arb ei ten,die s i ch auf Xenophon ,
Po lyb iu s , S trabo, A rriau und Pto lemäus , auf Marco Polo und
Ruysbroek ers treckten . Daneben las er neuere Werke über denOsten
,w ie Abu lfazls Ain -i-Akbari “ in der Gladw inschen Über
setzung, Regina l d Hebers indis che Ber i chte, Dobells 2) S ch i l derungenaus China , sow ie die Lebensbes chre ibungen v on Munro “
) und
Raffles Der Vorm i ttag w ar dem Sprachstud ium gew i dm et, demCh ines is chen , dem S anskr i t, dem Persis ch en und Armen is chen ; derS chuking, das T a Tsing lü Te i le des Mahabharata w urdendurchgearbei tet. Nach dem zw eiten F rühstück s chr ieb er am
T agebuche . Der so m it s trengster ge i stiger Arbe i t erfü l l te T agw ur de bes ch lossen m it der Lesung des Alten Testaments
,Goethes,
S hakespeares ; manchma l gr iff er au ch zu Co leridge und Wa l terS cott.
Am 6 . August s teuerte das S ch iff Anjer an der Westspi tzeJavas an. Z um ers tenma l berührt sein F uß asiatis che Erde, v er
1) Von h ier ab faß t die Sk izze im w esentlichen auf Neumanns Re ise
tagebuch und seiner im Jahre 186 1 n iedergeschriebenen zusammenhängendenDarste l lung
„Me ine Reise nach Ch ina v or dre iß i g Jahr en“
.
2) Peter D o b e l l , T rave ls in Kamtchatka and S iberia ; w ith a Nan ative
of a Res idence in Ch in a. 2 v ol. London 1 830.
3) George Rob . G le ig , T he Life of Maj or-General S ir T. Mauro
,late
Gov ernor of Madras. 3 v ol. London 1830.
Lady Soph ia R a f f l e s , Memoi r of the Li fe and Public S erv ices of
Sir T. S . Raffles. London 1830 .
5) Das S trafgesetzbuch der T sing-Dynastie.
Karl F riedrich Neumann 45 1
n imm t se in Oh r neben m a la i i schen auch ch inesi sche Laute ; j a , es
ge l ingt ihm,si ch mit den S öhne n des Mittelre iches zu v e rständ igen .
Am 20 . A ugus t w u rde S ingapore e rre i cht,w o e r b is zum 28 . ve r
w e i l te. Die S tadt m it i h rem bun ten Vo lks l eben w i rd k reuz und
quer du rchstrei ft, den protes tan ti s chen Miss ionaren und i h ren S chu lenw erden Besu che abgestattet . Die a rm en is che Ko lon ie behande l tden ihrer S prache kund igen Ge leh rten aus dem fernen Deutsch landm it großer A usze i chnung . Um den Pre is von ach t Do l la r erstehter ein japan is ches Vokabu la r . E nd l i ch
,am 8 . S eptember 1 830 ,
l ie f der S ir Dav i d S cott in den Ha fen v on Macao ein , und
k lopfenden He rzens betrat Neumann zum erstenma l ch inesis chenBoden. E r e i l te
,s i ch Dr. Mo r r i s o n
,der s ic h dama l s in der
S tadt aufh ie l t, vorzuste l len, fand aber trotz der Empfeh l ungen, dieihm S taun ton m i tgegeben hatte
,e ine küh le Au fnahm e . W ie ihm
de r Miss ionar später se l bs t gestand , hegte er gegen ihn als e inenS chü ler der Pariser S ino logen, insbesondere ein ge
w is ses Mißtrauen, das s ic h aber s chne l l zerstreute , als er s ich v on
dem w i ssens chaftl i chen Ernst u nd der E hrl i chkei t des j ungenBayern überzeugt hatte . Auf das herz l i che Einv ernehmen
,das
si ch gar b a l d zw i schen den be i den en tw i cke l te,fäl l t ein w arm es
Lich t aus e inem Briefe , in w e l chem Morr i son seinem F reundeS taunton uber den güns tigen Eind ruck ber i chtet
,den dessen
S chützl ing auf ihn gemach t Er unterw arf den angehendenS ino logen eine r rege l rechten Prüfung
,indem er ihm seine e igene
ch inesische B ibe l übersetzung und die Gesmäche des Kon fuzi us , dieLun-
yü, zum Übersetzen vorlegte . Von e inem A ufen tha l t in Macaoriet er ihm d r ingend ab
,da d iese S tadt w egen der U nw is senhe i t
i hrer Bew ohner n i cht der geeignete Ort für den Sprachbeflissenenund Büchersamm ler sei
,und empfah l ihm ,
gle i ch nach Kan tonw e i terzu re i sen . Doch Neumann
,der die teure Großstadt s cheute ,
1) K . hatte kurz zuv or e inen se iner b em eh tigteu giftigen A ngriffe gegen
M. w egen se ines ch inesischen W örterbuchs geschleudert.2) „dly Dear S ir , I ha ve had the ple asu r e to hear from you thr ice, by
the ships of the season . Once by Professor N euman n , to w hom. I have r ender ed
every ci vility in my power . His general kn owledge and good sense made him
an agreeable c is-itor in ou r fam ily, fr equen tly befor e I came up to Can ton .
Mr . B en t has liberally giv en him a room and place at his table a t Can ton .
“
(Mem o ir s of the Life and Labours ofRobert M o r r i s o n,D. D. ,
compi led byb is W idow ,
I I [London p. 437 , Br ief aus Kanton v om 8 . Nov .
4 52 Georg R eismüller
l ieß s i ch n i cht abs ch recken und fand au ch ba l d e inen passendenU n ters ch lupf bei den por tugies i sch en Mönchen des Klos ters S an José ;der freundl i che Pater G o n ga lv e s l ) , der Verfas ser e iner Re ihev on bekannten ch in es is chen Lehrbu chern
,verschaffte ihm auch
e inen gee igne ten Mentor in der Person e ines au fgew eckten ch ines iechen Klosterzögl ings . Mit d iesem jungen Manne trieb er nun
j eden T ag Chinesi s ch und l ieß s i ch auch sonst in zw anglosen Gesprächen über die ihm unvers tänd l i chen Besonderhe iten der frem denUmgebung aufkl ären . P. Gonca lves führt ihn m it dem portugiesischen Konsu l in Bangkok , da S i l v e i r a , zusammen ; durchMorr ison l ernt er Dr . K n ox , e inen eben aus Bi rma zurückgekehrtenArzt
,kennen ; aus ih ren Beri ch ten gew inn t er die Überzeugung,
daß S iames is ch u nd Birman i s ch n i ch ts w e i ter als Dia lekte des
Ch ines ischen Über die Phi l ippinen erfährt er manchesWissensw erte v on dem engl is chen F aktoreibeamten Hugh Ham i l tonL i n d s ay 3 ) , der ihm e inen in der T agalasprache verfaßten Beichtspiege l zum Ges chenk m ach t . An ein systemati sches Bü chersammeln a l lerdings w ar , w ie er s i ch nun se lb st üb erzeugen mußte
,
in Macao n ich t zu denken . S o siede l te er denn ni i t der engl is chenFaktorei , w enn au ch schw eren Herzens
,im Oktober nach Kanton
üb er . Das Glü ck w ar ihm ho l d . Der j unge Launce lot B e n t,
ein rei cher hochgesinn ter Kau fmann, nahm ihn als Gast in seins tatt l iches Haus auf. Auf diese unerw artete Wei se a l ler materie l lenS orgen üb erhoben , konnte er si ch nun frohgemut se iner doppe l tenAufgabe des Lernens und S amme lns w i dm en . Hören w ir ihn se lbst :„ I ch suchte nun me ine Zei t nach al len Rich tungen vortheilhaft zu
verw enden . E in ge leh rter Ch inese w urde für theueres Ge l d als
Lehrer angew orben,w e l cher dreima l w öchen tl i ch im Geheimen
zu mir kam . Den F rem den Un terri ch t in der Kenn tn is der
ch inesi s chen Sprache zu erte i len,w ar dama l s verboten . I ch offen
barte dem .Manne, daß i ch vorhabe , eine große Büchersamm l ung
1) P . Joaquim A lfonso G o a ca l v e s , Priester der portugiesischenMissions
gesellschaft,w i rkte 18 12— 1841 in Macao .
M o rr i s o n , Memoirs II, 440 . Z ur Verwandtschaft dieser dre iSprachen vgl . E rnst Ku h n U eber He rkunft und Sprache der transgangetischenV ö lker (München p. 9 fi .
Verfasser mehrerer F lugschn'
ften über die anglo-chines ischen Be
ziehtxngen ,
454 Georg Reismüller
v erbo rgene S chätze heben , Krankeiten hei len usw . Ich erw iderte,so m öge S eine Hochw ü rden das Zeug beha l ten . Es dauerte n i ch tlange
,so hab e i ch die Bücher um geringes Geld erhal ten .
“ Der
re ine Ankaufspre i s der ch ines is chen S amm l ung in Kan ton bel iefs i ch
,w ie aus e inem Brief Neumanns an die Di rektion der
Kgl. Bib l iothek in Berl in vom 5 . Oktob er 1 831 1) hervorgeh t, auf
1 850 span i s che Do l lar (etw a 8800 Daneb en hatte er noch80 Dol lar an die Zo l lbeam ten da für zu b ezah len , daß sie die an
und für s ich e inem s trengen Ausfuhrverbot un terl iegenden Bücherals Papier dek larierten und v erzol l ten . Erl e i chtert atm ete er auf
,
als seine Bücherschätze end l i ch w oh l verw ah rt in zw ö l f K istenauf dem S ir Dav i d S cott in se ine r Kaj ü te s tanden, w ohin er sie
h atte verbr ingen lassen, um die F rachtkosten im S ch iffsraum zuersparen.
Das v on den Chinesen a l len F remden en tgegengeb rachte m it
Verachtung gepaa r te Mißtrauen , m it dem Neumann bei se inenBücherankäufen zu kampfeu hatte, erschw erte ihm auch den Verkehr m it gebil deten Landesbew ohneru , nach dem es ihn so sehn l i chverlangte ; ein rege lmäßiger Austausch w ar unm ögl i ch . Einmalw i der fuhr ihm die Ehre, m it anderen Europäern zu e iner Gas tere ider ch ines is chen Kaufl eute einge laden zu w erden , die ihn als
Kenner der ch inesi s chen S chri ftze i chen b esonders au fm erksam be
hande l ten .
“
E in anderma l ve rm i tte l te Dr . Morrison e ine U n terredang m it e inem mohamm edan is chen Ge istl i chen
,mit dem er s ich
über die Ein füh rung des I s lam in China un terh ie l t. Mit e inemMandsch u aus Peking konn te er s i ch im Kuan -hua (der offizie l lenRe i chssprache) un terhal ten, w äh rend er des Kautoner Dia lektes ,des Pun ti
,n i cht m ächtig w ar . S ehr häufig b esu chte er die Pars i s
aus Bombay, die als re i che Kau fherren in Kanton leb ten .
Dem Vie l bes chäftigten s ch l ug die S che ides tunde v ie l zu fruh .
Anfangs F eb ruar 1 831 trat er auf dem S ir Dav i d S cott die Rückrei se nu
,w e l che
,e inen Besu ch auf S t. He lena abgerechnet, ohne
besondere Zw i s chen fäl le ras ch und glü ck l i ch v erl ie f. Während
der fast v ier Monate dauernden Fahrt w urde flei ß ig gearbei tet.Die berei ts auf der E infahrt b egonnenen U nternehm ungen, e ine„S taaten und Kul tu rges ch i chte Asiens “ , sow ie die Übersetzung
Nach Mittei lung von Prof . H ü l l e .
Karl Friedr i ch Neumann 4 55
des Laza r v on Pa rb s che int e r ni cht w e i ter fortge füh rt zu ha ben ;dagegen nahm er die Übe rtragung e ines arm en ischen und zw e ie rch ines ischer Tex te , die er a us se i ner B ib l io thek ausgew ähl t ha tte ,in Ang ri ff und fö rderte sie fast b is zu r Druckre i fe
,so daß er sie
ba l d nach se ine r Rückkun ft in die Pressen des O r ien ta l T rans la tionF und ") geben konnte . Am 24 . Mai 1 83 1
,nach e ine r Abw esenhe i t
v on m ehr als d reizehn Mona ten,betra t er w iede r den Boden Al t
erm lands .Er ha tte se in Zie l e rre i ch t, dank se iner e isernen Ausdauer
und se inem unermü dl ichen w i ssens cha ftl i chen S treben . E r keh rtezu rück m it e iner vertie ften Kenntn i s der ch ines is chen S pracheund im Bes i tz einer re i chen und fü r dama l ige Verhäl tn is se kos tba ren Büch ersamm l ung
,die an Zah l der Bände und Vie l se i tigkei t
des Inha l ts die ch ines i schen Bestände der eu ropäis chen Bib l iothekenw e i t in den S cha tten ste l l te und se l bst Morr isons berühm te Bib l iothekum ein S echste l an Größe 3) übertraf .
Der Baum' verb ietet,auf die genauere Besch re ibung und die
ferneren S ch i cksa le der S amm l ung e inzugehen . Nach v ie len v er
geb l i chen Bemühungen , sie ganz und ungete i l t in der Kön ig l i chenBib l iothek in Ber l in un terzub r ingen
,en tsch loß s i ch der Ge lehrte
s chw eren Herzens zu e iner Te i l ung derse lben . Berl in erh ie l t fürdie seinerze i t angew iesenen 1 500 Ta ler 24 1 0 Bände ; die zw ei tegrößere Häl fte , rund Bünde
,w anderte nach München und
g ing dank dem persou lichen Eingrei fen Ludw igs I . , an den s ichNeum ann in e ine r E ingabe ö) v om 1 . Mai 1 832 unm i tte lbar gew andt hatte
,am 7 . März 1 833 in den Bes itz der Hof und S taats
b ib liothek deren w ei tb l i ckender Direktor Lichtenthaler den1) A rm enischer Gesch ichtschreiber des 5 . Jahrb . n . Chr. ; v gl. über ihn
Neu m an n , Versuch e iner Gesch ichte der arm enischen L i teratur (1836) p. 7 0 f.
Trans lat ions from the Ch inese and A rmenien , w i th notes and i l lustrations , by Charles F ried. N eum an n. London 1831 .
Morrison se lbs t gibt in e inem Briefe v om 24 . Marz 1824 (Memo irs II , 252)fur se ine S amm lung „
1 0 000 vo lumes of Ch inese books“an , eine Zahl , die
j edenfa l ls w ieder v om S tandpunkt der ch inesischen B ib l iograph ie aus zu v er
stehen ist . Vgl . dazu Neumanns 12000 Bände , 3 . o . p. 4 53.
N icht 10 000 oder 12000 Bände, w ie immer noch in der L i teraturanfrancheude A ngaben beh aupten !
6) Reg.
-Akt HS tB.
, B 140,Nr . 3.
6) N . hat der B ib l iothek seine S amm lung demnach n icht h i n t e r l as s e n ,
w ie die A l lg. Deutsche B iogr. 23,530 ann imm t.
4 56 Georg Reismüller
Erw erb der S amm lung gegen Err i chtung e ines fü r Neumann ge
e igneten Lehrstuh les an der Un ivers ität München in seinem der
Akadem ie der Wissenschaften am 8 . Jun i 1 832 erstatt eten Ber i chtangelegentlichst b efürw or tet hatte . Mit d ieser Erw erbung rü ckteBayerns Nat iona lb ib l iothek , dam a l s nach Zah l und Erlesenhe i t derv on i hr behüteten S chätze die zw eite Bib l iothek Eur opas, auchm it i hrem ch ines is chen Bes tand d i cht an Par is ? ) heran und b e
hauptete d iesen Ehrenplatz durch mehrere Jah rzehn te h indu rch,
w ährend w e l cher sie noch einige ‚ um fangreiche und w ertvo l lech ines is che Neuzugänge zu verzei chnen hatte.
Die bayerische U nterrichtsv erw altuug aber, die vorher imGegensatz zu Preußen Neumann w en ig Interesse entgegengebrach thatte
,förder te ihn j etzt um so energis cher ; auf ih ren Vors ch lag hin
w urde er dur ch kön igl i ches Dekret vom 2. März 1 833 zum außerorden t l ichen, am 30 . Dezember des gle i chen Jahres zum orden tl i chenProfessor der a l l geme inen Literärgeschich te, der chines i schen und
armen is chen Sprache und Literatur und der a l l gemeinen Länderund Völ kerkunde ernann t und ihm zugle i ch die S te l le e ines Konservators der in das Eigen tum der Hof und S taatsb ib l iothek übergegangenen S amm l ung ch inesi s cher Bücher
,Gemäl de und sonstiger
Merkw ü rdigke i ten übertr agen . S o ehrte Bayern s ic h und den
Mann , dem Deu ts ch land die erste große S amm l ung chinesi sc herBücher verdankte, indem des Landes vornehm ste Un iversi tät alsdie ers te 3) in Deutsch land die S ino logie unter die von ordent l i chenLehrkräften vertretenen Di sz ipl inen aufnahm .
1) R eg.
-Ak t E stB.
,B 140 , Nr . 6 .
Die Biblioth éque Nat ionale besaß dama ls ungefähr 5000 ch ines ischeBande .
3) S chott hatte s ich am 8. Dezember 1 832 an der Un iversi tät Berlin
fur ch ines ische Sprache und Li teratur hab i l i t iert , w urde aber erst am 23. Juli1 838 zum außerorden tl ichen Professor für das F ach des Ch inesischen
,der
tatarischen und anderer ostasiat is'cher S prachen ernann t (Hess ische Bio
graphien 1, p.
4 58 P . W . S chm idt
diese Beze i chnung so l l in fo l gendem e iner kriti s chen Nachprufungun terzogen w erden .
Die B e d e u t u n g s f u n k t i o n des Infixes mn i sta) in der übergroßen Mehrzah l der F äl le die e ines Verba l
s ub s tantiv s, ähn l i ch den deutschen S ub stantiven auf -uug“
,oder
e ines Abs tr aktum s , ähn l i ch den deutschen S ub s tant iv en auf„hei t “
ham -
nai} Boshei t (had b öse), ga ’"
nnor Erziehung (guor entsprechend).b) S e l tener is t die Bedeutung des dur ch eine Handl ung er
zie l ten Resu l tats ; imm er ist dann w oh l die Nuancieruug e inergew i ssen Abs trakthe i t dam i t verbun den : hu ’m
nat tranche (hat ta il ler),kam nap vergrab ene S ache , S chatz (hop vergrab en), kum noh v er
haftet (koh verhaften), pa'mnüh
' Haufen phnülc ; pülc Hocker).c) Mehr fach tritt dabe i die I dee e iner gew i ssen Plura l is ierung
auf: Apanage , Vasa l len (kan erha l ten), j am nän S achen, die
zu Boden gew or fen s ind (j an zu Boden w erfen , j nan das zu BodenGew orfene), j am näb Tiefebenen am F uß der Berge (jab anhaften).
d) S e l tener sin d die F äl le,w o die Bedeutung e ines Werk
zeugs gegeb en i st,vie l fach i st h ier die Bedeu tun g einer Spezi
alisierung gegenüber dem durch Infigieruug v on n geb i l deten gew öhnlich en Instr umentalsubstantiv vorhanden : j am nah ein F o l terinstrum ent j näb Presse, j ab pressen), kum nä Amu lett (ha beschützen).
Merkw ü rdig s ind e in ige Fäl le m it d-An laut,w o e ine ran-Form
e in e rn-F orm ,die sonst n i ch t h äufig ist, in gle i cher oder ähn l i cher
Bedeutung zur S e i te hat : dam nül auf dem Kopf getragene Las tdrenül (dal auf dem Kopfe t ragen), dam näb Niederungen : dr enäbTeppi ch , etw as un ten Ausgeb re ite tes (dab unten), dam nic
'
: S t i c heiner Biene u . a , : dr enie S tache l (did stechen), dam nn b Damm
drenab (du b en tgegen ste l len). Nu r e in en Fa l l d ieser Ar t finde i chauch m it p
-An laut : pamnek Bru chs tü ck pr eneh (pek brechen).Die Auffassung
,daß ann ein Deppe l in fix sei
,zusammengesetzt
au s e inem Infix m und e inem Infix n,kann si ch zunächst darau f
s tützen,daß tatsachlich d iese b ei den letzteren „ ein fachen “ Infixe im
Khmer in geläufigem Geb rau ch s ind . Auch die Bedeutungsfunktionender b ei den s che inen e iner derartigen Auffassung güns tig zu se in .
Denn durch Iufigierung v on m entstehen überw iegend Persona ladjektive, Personalpartizipien , die den Tater ausdrücken ; durchInfigierung v on n w erden Instrum entalsub stautiva geb i l det : durchdie Verb indung des tätigen S ubj ekts m it dem Instrum en t des
E in iges uber das Infix nm und dessen S tel l vertre ter usw , 4 5 9
Hande lns käme die Hand lung se l bs t zus tande . Diese r Auffassu ng ,ganz abgesehen davon
,daß sie zunäch st n i chts w e i te r is t a ls e ine
gedankl iche Konstruktion i st es fre i l ich n icht günstig,daß es
sozusagen ke inen e inzigen Wo rtstamm g ib t , be i w e l chen a l le d re iInfixb ildungen zugle i ch vorkämen ; das i s t se l bst n i cht b e i densons t in Wortb i l dungen so re i ch v erzw e igten d rei S tämmen hätab schne iden“
, peh „b rechen “
,räh
„ eben“ der Fa l l I ch finde nu r
e inen e inzigen F a l l , w o aber der Zusammenhang der Bedeutungengerade n i c h t v orhanden i st : b ew achen
,beach ten
,
Wächter,
Jah r,
Kennze i chen,Zeugn is .
Dagegen l iegt ein unverkennba res Zeugn i s fü r den zusammengesetzten Charakter des m a - In fixes in den oben (p. 4 58) angefüh rten F ormen
,w o ein r n - l n fix ihm fas t para l l e l geht ; denn
hie r ersche in t m a l lein du rch r ausgew echse l t,m uß a l so v on n
ab l ö sbar se in . E s i s t desha lb v on Interesse,
auch die übrigens icheren Fäl le ? ) m it ma -Infix h ier auzuführen : tr enam Entha l tung(tum s ich entha l ten), drenmi Kamm,
Verl ängerung ((lllfl , ziehen,
zie len), dr eht} S tü tze (do auf etw as s te l len) , dr enam Hühnersteig
(da” s ic h n ieder lassen sr onah Jägerhu tte auf e inem Baum
(sah. e rbauen , kons tru ie ren) , sr enuh Vergnügen (su/ch Glück). W ie
m an sieht,hande l t es s ich auch h ier um lauter denta l an lau tende
S tämm e ; die Bedeutungsfunktion i st ana log der der Infigierung nm,
nu r w iegt die Instrumentalbedeutung etw as vor .
Keine Au fklärung für unsere F rage kann bezügl i ch des Khm eraus der Beziehung des Infixes m n zu P r äfigie r u nge n gew onnenw erden , aus denen es h ervorgegangen w äre . Es ist aber dabeizu berücks i ch tigen, daß im Khmer überhaupt sehr w en ig Nasa leals Präfix v orkommen, so daß au ch für die Infixe n und m
,deren
Hervorgang aus früheren Präfixen n bzw . an in andern S prach enposi tiv da rge tan w erden ein derartiger U rsprung im Khm ern i ch t nachw e i sbar is t. Das s i chere Herauskenneu der Fäl le v on
m und n -Präfigierung w i rd noch dadurch erschw ert, daß vie l facheine Ass im i l ierung des Nasal s an den Au lautkonsonanten des Wort
S . die B i ldungen bei S c hm i d t , Die Sprachen der S akai und
Semang p. 170 ,
2) A ls solche betrachte ich diej en i gen , w o die Ab le i tung v on dem auf
gefundeneu e in fachen Verbalstamm zw eife l los festzustel len ist .S . S c hm i d t . Die Mon-Khm c ölker p . 45 ff .
4 60 P . W . S chm idt
s tamm es si ch vo l l zogen hat : vor Guttura len oder z (und Z) zu iz, vor
Pa lata len zu ü,v or Den ta len zu n , v or Lab ia len zu m . E in (Doppe l
Präfix m n gibt es im Khm er aber ub erhaupt n i cht. Denn die s che inba ren Fäl l e bei S tämmen m it voka l i s chem An laut
,z. B. a
mna t Gedul d
(a t ertragen) vermag ich n i cht h ierher zu rechnen ; sondern ich
betrach te den voka l i s chen An laut des Wortstamm es als e ine ArtKonsonant, als „
check glott i d “ der engl i s chen Phonetiker, dasAl i f oder Hemzah des Arab i sc hen h inter den m n (a
mp ) ebenso
w irk l i ch infigiert w ird w ie b ei anderm konsonan ti schen An lau t.Diese Tatsache nun
,daß ein Präfix m a im Khmer vol l s tän dig
feh l t,dagegen n und an.—Präfix si cher vorhanden s ind, fäl l t a l ler
dings in die Wagschale zugunsten der Auffassung als zusammengesetztes
,als
„Doppelinfix
“
2. Nikobar .
S tarkeres Licht fa l l t auf d iese ganze F rage, die w ir a l le inv om Khmer aus n i ch t zur vo l len Klarhe i t b r ingen können
,v om
Nikobar her,der zw e i ten Mon-Khm erß prache, b ei der das Infix m n
s ich findet. Der in jegl icher Hinsi ch t noch un glei ch flüssigere Z u
s tand der Wortb i l dung des Nikobar l äßt au ch m it größerer Deutlichkeit die S e lb ständigke i t der Komponenten in zusamm engesetztenF ormen zutage treten .
Die Anzah l der vorhandenen F ormen m it Infix um ist in
dem uns bekannten Wortmater ia l 2) n i ch t a l l zu groß , abe r die B ede u t u ngsfu n k t i on tr i tt doch deu tl ich genug hervor :
a) Zunächst e in ige F äl le nach Art der großen Meh rzah l derse lbenbei Khm er, Ver balsubstantiva und Abs trakta : lam anüa Bünde l ,Packung (Zoe Kle id , lanüa Einhü l l ung aus éamaneäl
Löfie lvoll (saneal Löffel , das S tammw ort s'
eäl ist n i cht zu finden),éamayäw a S ackvo l l (éäya S ack), temneäla Glass cheibe (teal-éo hin
1
) S c h m idt , Die Sprachlaute und ihre Darstellung in e inem al lgeme inenl ingu istischen A lphab et (Salzburg 1907 ) 5 265 .
2) Hier b ietet E . H . Man in seinem „Dictionary of the Central N icobarese
Language“
(London 1889) sow ohl durch °
die v orzügl iche phonet ische Dar b ietungals auch durch die innere Zuv erlässi gke it gegenüber F . A . de R o eps t o r ffs
„Dictionary of the Nancow ry Dialect of the N icobarese Language“
(Calcutta1884) die bei w e i tem gesich er tere Grundlage dar .
4 62 P . W. S chmidt
Am deutl i ch sten ab er tr i tt der z u s am m e ng e s e t z t e C h a r ak t e rdes m n-Infixes und die Entstehung desse lben aus der Verb indungder e infachen Infixe m ,
n bei Nikob ar zutage in e iner ganz spezie l lenF unktion desse lben bei der Verb in dung m it Zah lw ö rtern ‘
)
d) s'
äm zehn , s'
amäm nur zehn,sznnäm o zehn F aden
,s'
am innäm o nur
zehn Faden ,(“
im zw ei,äm 7na
2) nur zw e i ; ennäyo zw e i F aden , m e7w ayo n ur zw e i
Faden,
löe d rei , lam üe nur d re i ; lemzäyo d re i F aden , Zcunennäyo nur dreiF aden
,
föan vier, fomöan nur vier ; hem zöanno vier F aden,m ahennöanno
nur v ie r F aden,
tanai fünf,tanianaz
'
nu r fünf ; tennéyo fll [ lf F aden tamenneyo nur
fünf F aden,
tafanl sechs, iam afüa l nur sechs ; tenfüalo sech s F aden ,ta-m enfüalo
nur sechs F aden .
Auch in d ieser Kategorie gib t es neben den infigierten auchpräfigierte F orm en, bei denen die Zusamm en setzung des Prafixesn i cht m inder deu tl i ch ist :d) iss
-di s ieben, m issät nur s ieben ; en .m to s ieben Faden,m ensato
nu r sieben F aden ,enföan ach t
,m enföan nu r ach t ; enföanno ach t F aden
,m en/
”öanno
nur ach t F aden .
In diesen F äl len von d und 6 l iegt die S ache sogar so, daß
die bei den Te i le des Infixes n i ch t nur äußerl i ch getrennt von
e inander auftreten,sondern e inem jeden v on i hnen auch eine
b esondere Bedeutungsfunktion ausdrückl i ch b e ige legt w ird : an so l lnur
“ bedeuten,
n hätte die Bedeutung„F aden “
,die bei dem
Zah lw ort für e ins ‘s) n i cht du rch Infigier ung von n
,sondern du rch
Be i setzung v on tamäka,dem S ub stan tiv m it der Bedeutung „
Faden “
,
hergeste l l t w ird :heaiz e ins
,hem éari nur e ins ; leéah tamd7-ca ein F aden
,hem éari tamälca
nur ein
1) S . E . H . Man a. a. 0 . p. XLI I I .2) Ich v ermute, daß diese F orm richtig ai näm lautet.3) U nd demen tsprechend auch bei dem Zahlw ort für „
nenn“
,das mit
„ eine“zusammengesetzt ist : heä7'z hata (acht) eins dazu .
Auch bei zw ei “ komm t neben ennäyo die F orm äm tamdko v or.
E i n i ges a ber das I nfix nm und dessen S tel l v ertreter usw .
lndes is t zu bemerken,daß die m it in tigierte F orm zu
gle i ch noch m it o suffigi er t i s t,das si cher l ich auch an der Be
deutungsfnnktion e inen Ante i l hat,der m it in Betracht gezogen
w erden m uß.
Andere F ä l le e iner Verb indung v on Infigierung m it n und
S uffigierung m it 0,aus denen man auf die e igent l i che Bedeutungs
funktion auch im vo r l iegenden Fa l le sch l ießen könnte,gib t es im
Nikobar n i cht,sondern nu r die V e r b i n d u n g v o n In figie r u ng
m it n u nd S u f f i g i e r u n g m it a,die zume i st das Resu l tat eine r
Hand lung und das abstrakte Verba l sub stan tiv W ir
müssen a l so von den bei den Einze le lemen ten (lnfix n und S uffix 0 )se l b s t ausgehen H ier beze i chne t nun das S uffix 0 fas t ausnahms losAdj ekt ive , die das Versehensein m it e tw as ausd rücken (käu o bew eibt.von kän We ib? ) Das In fi x n dagegen b i l det s tets Instrumen ta lsubstantiva Es is t n i cht le i ch t, d iese be iden Bedentungselementein unserem Denken bei dem vorl iegenden Fa l l m i te inander zu v er
b inden . Man w ird der Richtigkei t w oh l am nächsten komm en ,w enn man
,. z . B. bei „
s ieben “tafüal, durch die Infigierung m it n
zunächst ein lnstrumentalsubstantiv en ts tehen l äß t,w e l ches ein
Instrument bezei c hnet, durch w e l ches man „ siebnet“
,d . h . s ieben
abmißt,a l so e inen S ieb ner “
. Die Hinzu fügung des S uffixes 0
w ü rde daraus ein Adj ekt iv machen, w e l ches das m it e inem„ S iebner
“ Versehensein beze i chnet.U ntersu chen w ir j etzt die Bedeutung des Infixes m
,so m uß
erw ähnt w erden,daß es im a l lgeme inen die F unktion hat
,Persona l
adjektiva zu b i l den (pöap arm , pomöap arme Pe rson) ; s chon h ier inl iegt un leugbar e ine gew i sse K ra ft der Restringier ung einer ins ich unbegrenzten Bedeu tungsw eite . Gerade durch d iese Restringierung w ird aber dann auch e ine b estimm te Klasse geschatlen , undin der Beziehung der zu ihr gehörigen Ind ividuen untereinander dochauch w ieder e ine Art Pl u ra l i s ierung hergeste l l t . Etw as Ähn l i chesw ar uns oben (p. 46 1 ) s chon begegnet, w o w ir in der Kategor ie bund
‚8,durch In oder Präfigierung v on m n
,S ubstan tiva, die einer
b e s t imm t e n Gruppe angehören,beze i chnet finden ; h ier geht , w ie
w ir gle i ch zeigen w erden, gerade von m d iese F unktion aus . Wir1) S . „
Mon-Khmer-Volker“ p.74 .
2) S .
„Mon-Khmer-V ö lker“ p. 7 5, E . H . Ma n a. a . 0 . p. XXL
3) S .
„Mon-Khmer-V ö lker“ p. 74 .
4 64 P . w . Schm id t
w erden a l so au ch in F orm en w ie ta -manaz nur funf“ (tanaz' fünf)
und tam em zeyo „nur fün f F aden “
(tenneyo fün f F aden) die dem
Infix m beige l egte Bedeutungsfunktion v on „nur“
aus der all
geme inen F unkt ion der Restringierung ab le i ten, w e l che dem In
und Präfix m auch sonst e igen is t.Wenden w ir uns j etzt den oben (p. angefüh rten Kate
gorien der In und Präfigierung v on m n zu,um auch deren Be
deutungsfunktion genauer festzuste l len . Hier ist zunächst daraufh inzuw ei sen
,daß die b ei den Kategorien a und a in vie l geringerer
Anzah l v orhanden s ind,und die Hauptmasse der F ormen zu den
Kategor ien 5 und ß gehö rt, b ei denen dann auch die Bedeutungsfunktion eine ungle i ch strafi
‘
ere und bestimm tere i st,so daß w ir
v ermu ten können , h ier das U rsprüngl i chere zu finden . Zu beach teni st nun au ch h ier
,daß bei de Kategorien n i ch t nur das In oder
Präfix nm,sondern in der großen Mehrzah l der Fa l le au ch das
S uffix a (oder e) aufw e i sen , ferner daß in e iner ganzen Re i he v on
F äl len Formen vorhanden sind,in denen S nffigierung v on a (e)
m it In oder Präfigierung v on b loßem n verbunden erscheint(ken täka Tanz , ka täk[a] tanzen ; enkäüa Männ l i chkei t
,käfi. Mann) ,
aber ke in F all,w o In oder Prafigierung a l le in v on m m it S uffi
gierung v on a v erbunden w äre. Wir können daraus sch l ießen,daß die In oder Präfigierung v on m immer erst später zu Formenh inzugetreten ist
,die durch Verb indung v on In oder Präfigierung
von n m it S uffigierung v on a ber ei ts e ine feststehende Bedeutungerlangt hatten. Die Bedeutungsfunktion dieser letzteren Verb indungnun kann , w ie oben (p. 4 63) s chon fes tgeste l l t, keine andere sein
,als
die des ab strakten vera l—lgemeinernden S ubstantivums. Wenn keineandere als d iese Bedeu tung
'
für die Kategorien a und or in den Que l lenangegeben is t
,so m uß man a l so s ch l ießen
,daß d iese Angaben ent
w eder ungenau s ind,oder daß die spezifis che Bedeutungsfunktion
von m,die doch noch h inzutreten muß, ab ges chw ächt w orden ist
oder ganz aufgehört hat . Bei den Kategorien b und tri tt d iese nun
noch deutl i ch in i hre r besonderen Eigenart hervor ; denn sie bew i rk tauch h ier jene Restringierung eines a l lgeme in eren Begri ffes und diedaraus hervorgehen de (begrenzte) Plur a l is ierung, die w ir auch vorh in(p. 463) als dem In oder Präfix m zukommend erkann t hatten .
Z u s amm e n fa s s e n d können w ir a l so die w i chtigen T at
sachen fes ts te l len
4 66 P . W . S chm idt
l i ch nie ohne S uffigierung von a (oder 0) vorkamen, d ieses S uffixin Wegfa l l ger iet, da ha tt e der noch üb rig b le ibende Te i l derF orm an s ich überhaupt keinerle i b estimm te Bedeu tung mehr, und
das s che in t e ine Veran lassung geboten zu hab en,auf diese a l so
v acierende äußere F orm die unterstan ds los gew ordene Bedeu tungsfunktion des Verbalsubstantivs zu übertragen ; nur in den Fäl len,w o auch jetzt noch im Khm er eine Art Plura l i s ierung m it der
Doppelinfigierung nm verbun den ers che int, i st ein abges chw äch terRest der a l ten Bedeutungsfunktion der Verb indung von Doppe linfigier ung v on ma m it S uffigierung von a geb l ieben.
Im Khmer geht d ieser Ein fügung des Doppelinfixes m a,w ie
s chon oben (p. 459) hervorgehob en , keine Anfügung des ana logenDoppélpräfixes
«
parallel, w oh l aber im Nikobar . F ür die F äl lenun
,w o s ich die I dee der Plu ra l is ierung an dieselbe he ftet, haben
w ir ab er Ähn l i ches in aus trones is chen Sprachen . S o im Ma lai i s chenm an tuw a S chw iegere l tern, dem auch noch para l le l gehen Mal. und
Javan i sc h m ara tuw a , S undanes. m ér étuw a, S amoan. und Maori
m ätu al). Diese F orm i st auch dadurch m erkw ürdig, daß neben
dem nen -Präfix auch ein m r -Präfix v orhanden i s t,w odurch die
U nabhängigke i t der b e i den Bes tandte i le in nm gew äh r le istet ers che int. Ab er abgesehen davon , daß bis jetzt nur diese e ine F ormdes m n(m r )—Präfixes aus dem Aus trones i schen bekann t i st
,w urde
b is j etzt auch noch kein Fa l l des Infixes n m in austrones ischenSprachen festgeste l l t.
Hins i cht l i ch des Verhaltnisses von Nikobar und Khm er ind ieser F rage muß s ch l ieß l i ch noch auf den Unters ch ied h ingew iesen w erden, daß das Khmer ein m n -InfiX n i ch t kennt b eiS tämm en
,die m it y, r oder an lauten ; statt desse lben erschein t
h ier das Infix p. Das Nikobar dagegen w e ist m n-Infix auch beiS tämmen m it l-An laut auf (s. oben p. 460 bei y
-An laut ist bis jetztke in F a l l festges te l l t w orden ; bezügl i ch r -An lau t i st zu b emerken ,daß d ie ser im Nikobar bei Wortanlaut so gu t w ie ganz geschw unden und auch im Anlau t innerer S i lben se l ten gew orden i st.
Mit dieser E igen tümliehkeit des Nikobar w i rd es dann w oh lin direktem Zusammenhang stehen
,daß bei ihm das Infix n i cht
1) S . H . K e r n ,
De F idptaal v ergeleeken m et bare v erwanten in Indonesié
'
en Polynesiö, Verb . K . Ak . v an Wetenschapen , A id. L etterkunde ,
1 6 deel , p. 35 f . Vgl. dazu mein Mon-Khmer-Vö lker“ p. 43.
E in iges aber das Infix nm und dessen S tel lvertreter usw . 4 6 7
anzutreffen zu se in lm ge raden Gegensa tz dazu w endenunter den Mundä-Sprachen das S antäli u nd das Mundär i nur das
Infix aber ni cht das Infix nu r an . Wi r erha l ten dam i t fo l gendesS chema über das Vorkommen d ieser be iden Infixe
a l l e i n um z u s am m e n nen u n d a l l e i nNikobar Khme r S antäli-Mnndäri.
lm Khmer treffen a l so be ide F ormenreihen zusammen,w as
auch seiner sons tigen re i cheren Formenfülle du rchaus en tspr i cht .Wenden w ir uns je tzt der Betrachtung des p— Infixes etw as
näher zu .
II. D a s I n f i x 10.
Von a l len andern Infixen der austroasiatischen (und austronesischen) Sprachen is t das Infix dadu rch untersch ieden
,daß
,
w ährend jene nur Nasa le (n , m) und „Liqu idae
“
(r , 1) a l so S onanten,um fassen
,d ieses einen stammen E xplosivkonsonanten darb ietet 2).
Da man verm uten kann,daß gerade die lei chte r an v o r a u f gehende
Ew losivkonsonanteu s ich anschm iegende Natur der Nasa len und
Liqu idae es m indes tens er le i ch tert hat, daß aus der ehemal igenPräfigierung der Nasa l und Liqu ida-Präfixe die Infigierung der
se lben entstand (z . B. nka t kun t,lpa t pla tt so w irf t
s i ch die Frage der Entstehung der p-Infigierung m it doppe l tem
Nachdruck auf. Man könnte auf die Vermutung komm en,daß
die sekundäre We iteren tw i ck l ung aus dem Lab ia l -Nasa l m sei,
um so meh r, da beim Bahnar in gew is sen Fäl len die ana logeEntw i ck l ung eines d-Infixes aus dem Denta l-Nasa l -Infix n positiv
1) Gegenuber der in me inem „
Mon-Khmer-V ölker“ (p. 43) ausgesprochenenAn sicht , daß das Infix p im Nikobar zw e i fe lhaft sei, gehe ich j etzt nach dernegat iven S ei te einen S chri tt w ei ter als damals. Die ebendort (p. 42) v er
tr etene A ns icht , daß es bei einzelnen Malakka-Sprachen s icher anzutreffen sei,
hal te ich n icht m ehr aufrecht. Was dort w i rkl ich,in dre i n icht al lzu
authentischen und klaren F äl len , v orkomm t, ist ein Infix am b,amp, das ich
früher e inmal (Die Sprachen der S ake i und Semang p.1 16) zuerst als
Infix an,dann (a . a. 0 . p. 1 70 A nm .) als U bergang zw ischen m u nd p
-Infix
bezeichnet hab e. Was an dem letz teren hal tbar ist , sol l w eiter unten (p. 47 1 )
noch untersuch t w erden .
2) Über den sekundaren Charakter des d-Infixes im Bahnar bei mit
muta cum l iqu ida anlautenden S tämmen 8 . S c hm i dt , Die Sprachen der S ake iund S emang p. 1 7 3 .
4 68 P . W. S chm idt
nachgew iesen i st (s . oben 4 67 Anm . Da aber für ein
derartiger d ir ekter und pos it iv er Bew e i s n i ch t vorl iegt,so bedar f
es einer näheren U n tersu chung,um zur Klarhei t zu ge langen .
1 . Khm er.Wenden w ir uns zunächst w ieder dem Khmer zu . F o l gende
s ind die in A ym on ie r s Di c tionnai re “ vorhandenen F äl le von
p-Infix
1 . yopa l E inb i l dung (ya ! erb l i cken).2. yopa
m S eufzer (yam seufzen).3. zopu7
'
i Zaun (m ia abs ch l ießen).4 . r apip Konfiskation konfiszierte Personen oder S achen
konfiszieren) .
5 . r api7’
z Eigen sinn (riiz robust) .6 . m pz
'
en S tud ie,Wissens chaften (rien lernen) .
7 ,r ap iep O rdnung (n
'
eb ordnen).8 . mpeia S ieb (r eiz s ieben).9 . r ap@ requ irier te S achen (räy requ ir ieren) .1 0 . rapu
’” Hül le (m m e inhü l len) .l l . r apä
”” Theater (rä' m tanzen).1 2. rapä
m7
'
z S chutzge le i te ab sperren) .1 3. lepalz S tr0phenteiler ([ab zerstücken) .1 4 . lepak Rinne (Zalc s chn i tze ln).1 5 . lepafz Ve rsu ch fa ir).1 6 .
_
lepay Mi schung (lag m i schen) .1 7 . lepäs zarte Pflanzen (fäs sprossen) .1 8 . lepiy Ruhm (Ziy hö ren) .1 9 . Zepu on s chmei che ln luon).9 0 Zepök Gebäude (lök err i chten).21 . Zapu ön S chne l l igke i t (Zu ön s chne l l) .
lepeq'
z Spie le (Zér'
z spielen).Was die B e d e u t u n g s f u n k t i on b e trifft
,so treffen w ir fas t
das gl ei che Bi l d an w ie be im ma —Infix . Z ur Kategorie a ) Abs tr akta,Verbalsu bstantiv e
,gehören di e me i sten : 1 , 2, 4 , 5 , 6 , 7 , 1 1 , 1 2, 1 5 ,
1 6, 1 7 , 1 8, 20, 21 , 22; zur Ka tegor ie Resu l tat e iner Han d lung
9,1 4 zur Kategorie c) Pl ura l is ierung : 4 , 6
,9,1 7
,a l so
verhältn ismäß ig vie le ; zu r Kategor ie d) Werkzeuge : 3, 8, 1 3,
4 7 0 P . W . S chm idt
zutage . S o kennen die S tämm e m it w -An laut uberhaupt keiner le iun d dassel be gi l t von säm tl i chen S tämmen mit na
sa lem (iz, a, n,m ) An lau t. Jeden fa l l s d iese letztere Rege l ist so
kräftig und um fassen d,daß sie
,sow e i t i ch jetzt sehe
,w oh l für
a l l e austrischen , und dem zufo l ge auch für die aus tronesi schen ,Sprachen Ge l tung hat .
Könnte man a l so fol gern, daß das Infix ke ine se lb s tänd igeF orm
,sondern nur e ine durch phonetis che F aktoren bed ingte
S te l lvertre tung des Infixes mn ist ? Von m zu p w äre die E nt
w i ck l ung n i cht so w ei t, da beides Lab ia len sind . Dazu komm t,daß bei den Mon-Khmer-Sprachen überhaupt d iese Entw i ck lung,zunachs t im Aus lau t
,sehr begünstigt w ird durch das Vorkommen
v on Nasalexplosiven , die zw i s chen re inen Nasa len und Ora lexplos iv en in der Mi tte Aber e inersei ts ist eine ähn l i cheEn tw i ck l ung für den An laut w en igstens n i ch t in dem gle i chenUm fang nachgew iesen
,und dann b l iebe auch noch unerk l ärt, in
w e l cher Beziehung das zw ei te Elemen t des Doppelinfixes ann,
näm l i ch n,zu p s teh en so l l .
S ehen w ir,ob s ich bei den andern austroasiatischen Sprachen,
w e l che das Infix aufw e i sen , e ine Lösung der ve rb leibendenS chw ier igke i ten finden l äß t.
2. Die übrigen austroasiatischen Sprachen .
Hier i st zuna chst das S t i e n g zu nennen , bei w e l chem i chschon früher 3) auf fo lgende F äl le hingew iesen habe : sepa Spe ise(sa essen), sépilz Hecke (cih Hecke m achen), sépir m eiße ln sfr)r époeh trockener Bambus (w eh trockene Bl ätter raffen). E s
s ind ihrer zu w en ige, um m it Bestimm the it die Bedeutungsfun ktionfests te l len zu können ; beim ers ten , zw ei ten und vierten F a l l s timm tsie jeden fa l l s m it der bei Khmer erm ittel ten übere in. Abw ei chendvom Khm er i s t das Vorkommen des Infixes b ei s-An laut, dem im
F a l le sepa (sa) in anderen austroasiatischen Sprachen ein 6 oder
Auch n icht die Infigier ung m it p , vie l le icht w ei l dieses m it w in demlab ialen Charak ter ubereinkorrim t .
Vgl. S c hm i d t , Die Sprachen der S akei und S emang p. 103 ff 166 ;
id. ‚ Grundzüge einer Lautlehre der Mon-Khmer-Sprachen 55 7 9 , 8 4, 89 ; id. ,
Grundzüge einer Lautlehre der Khas i-Sprache 55 1 10— 1 12.
3) Die Sprachen der Sakei und S emang p. 1 72.
E in iges aber das Infix nm und dessen S tel lvertreter usw . 4 7 1
e in Khm er, das h ier (neben 3 ) au fw ei s t, hat dasnu r-Infix : S pe ise («Ey essen), w äh rend Mon und Bahnar, von
denen jeden fa l l s letzte res w eder vu n noch p- In fix kennt ?) in
d iesem F a l l das n -Infix v erw enden,so Mon : S pe ise («a essen),
Bahnar : éuna S pe i se essen) . In e inem F a l le m it -An lau tw endet au ch S tieng das nen -Infix an : 4 emnam -E r innerungsze i chen(iam s ich er inne rn) ; es i st der e inzige F al l
,w o i c h m it Zu
v er lässigkeit vun -Infix bei S t ieng fes tste l len kann
Die Form säpa bei S tieng ist nun a be r auch desha lb merkw ü rd ig
,w e i l derse l ben noch e ine Neb en form m it m l)
-Infix
sémpa para l le lE ine ähn l i che Neben form
,mb
,d iesma l aber zu e inem m -In fix
,
w i rd bei e iner der S em an g - S pr a c h e n auf Ma lakka augetrotfen
Pen-
gambns ‚Leben “
neben gamas, gumos ‚Leben “
. Dies i s t dase inz ige s i chere Be ispiel dieser Ar t in d iesen Sprachen ) bei denen
w obe i a l lerd ings auch die Dü rftigke i t des b isher von ihnenv orl iegenden Mater ia l s in Betracht zu ziehen b le ib t w eder ein
re ines p noch ein m a -Infix bis jetzt nachgew iesen w ar . Hervorzuheben ist noch
,daß dieser F al l von m b-Infigier ung s i c h bei g
An laut zei gt .1) S . Ill on-Khmer-Sprachen p. 90.
Bezügl ich Mon 8 . w ei ter un ten p. 472.
3) Viel le icht w ird m an auch diesen F al l als E ntlehnung aus dem Khmer
(von eatfl , cam i_iäm ) b ezeichnen , und H . M a spe r o w i rd v on neuem ,
w ie in
seinen üb ri gens v ortreffl ichen E tudes sur la phoné t ique h istorique de la
lang ue annam i te“
, p. 6 A nm . 1 (Bul letin de l’E cole F rancaise d
’E xtréme)
Orien t XII [ 19 12] Hano i) , den E inw arf erb eben ,daß das S tieng nur ein
Dialekt des Khm er, also auch h ier n icht v on selbständiger Bedeutung sei.
E s w ürde zu w eit führen , h ier auf diese F rage naher e inzugehen . I ch sprechejetzt nur meine Ans icht dah in aus
,daß das S t ieng al lerdings bedeutend
näher zum Khm er steht,als das Bahnar und Mon
,und daß es b ei näherer
Bekann tschaft noch anderer benachbarter Sprachen w ahrsche in l ich mit diesenund dem Khmer zu einer besonderen Gruppe zusammengefaß t werden muß ;
aber es als e inen bloßen Dialekt des Khmer zu bezeichnen , sche int m ir derv o l l e n W ahrhe i t n icht zu en tsprechen . Dagegen gestehe ich berei tw i l l i g zu ,daß das S tieng sehr v ie le Lehnwort er vom Khmer übernomm en hat , und daß(ram
,éemn<m m ögl icherw eise auch zu d iesen geb oren .
Die Fäl le aus den S ake i-Sprachen kampok"
„Vogel“ und kampot
"
„Weib “
,die ich früher schon mit Bedenken angeführt (Sprachen der S ake i
und S emang p. 1 16,1 70 Anm .) ersche inen mir jetzt noch bedeutend
zw eifelhafter.
4 7 2 P . W. S chm idt
Auch b ei Mo‘
n,bei dem si ch sons t ke in Fal l von m n -In
figierung nachw e isen l äßt,
findet s i ch nur ein ganz s icherer Fa l lv on Infigierung m it p ,
das h ier in w übergegangen i st : yawa’m
Wehk lage (yä‘m w einen) , vgl . Khm er ybpam (yam ), ob en p. 4 68 .
E in anderer F a l l , der au ch e in igermaßen s i cher is t,abe r doch
noch e in ige Bedenken zurückläßt, i st fo lgender : swau Eid (kasau)Der sporad is che Charakter dieser b ei den F äl le b le ibt etw as Rätse lhaftes, da h ier be im Mon v on Dü rftigke i t des vorhandenen Ma teria l sn ic h t die Rede se in kann . Der Bedeutungsfunktion na ch fügens ich b e i de F äl le gu t dem bei Khm er erm i tte l ten an ; w as die Formangeht, so i s t der y-An laut bei dem e rsten Be i spie l auch denVerh äl tn i ssen bei Khmer en tsprechend, w ähren d das zw e ite mit
dem s cheinbaren s—An laut davon abw i che , aber zu S tieng sepa zuste l len w äre
,da es auf S anskri t s'ap zurückgeh t.
F ur die zw e i bedeutendsten M unda- S pr a c h e n ,das S antäli
und das Mundäri, hatte i c h schon früher die Existenz des p-Infixes
festgeste l l t Aber abgesehen davon,daß dam a l s die Abw esenhe it
des m n-Infixes n ich t genügend deutl i ch hervorgehoben w urde,s ind
auch die Bedeutungsfunktionen des p-Infixes se lb st n i cht um fassend
und n i ch t s char f genug dargeste l l t w orden. Wie i ch jetzt sehe,
sind der Fäl le, w o p-In fix b eim S antäli Abs trakta bew i rkt, doch
verhäl tn ismäß ig w en ige ; i c h finde in A . C am pb e l l s trefi'
lichem
und sehr rei chha l tigem „ S anta l-Engl ish Di ctionary “
(PokhariaManbhum 1 89 9) nur fo lgende Fäl le dieser Art :
1 . kepon Kind , Spröß l ing , zeugen (kan Kind) .2. yopon v on glei cher Größe (gew i sse Tiere) (yon ein Paar ,
s i ch paaren [gew isse3 . lczpatié Invers ion des Augen l i des (la _
tié to shrink back ,to recoi l).
4 . napa e Woh l se in (nae0p7
’
ad Verbrechen (am d vermuten , s ch l ießen).opsor Ge legenhe i t (osor w e i t
,w e i ten).
mpeg? gern , e i fr ig (r e; w ettei fern).repet
" Paket (r ein packen) .sapap
m Werkzeuge ha l ten).1) Vgl. zu beiden F al len , besonders zu dem letztem S c hm i d t
,Grund
zuge einer Lautlehre der Mon-Khmer-Sprachen 10,228.
2) Mon-Khmer-Sprachen p. 1 4 .
4 74 P .W. S chm idt, E in iges aber das Infix n mund dessen S tellvertreter19 usw .
s chei den, die Frage nach der e igen tl i chen Natur und Herkun ftdes Infixes zurze it als n i cht lösbar h inzuste l len. E s ist aberglei chw oh l ges tattet, hervorzuheben, daß eine Reihe w i ch tiger Indizien dafur sprechen, daß es n i cht e ine originale se lbs tändigeB i l dung ist, sondern nur aus phonetischen Einw irkungen sekundäraus e inem andern Infix entstanden ist. Der vö l l igen Glei chhe itder bei dersei tigen Bedeu tungsfunktionen w egen kann h ier nur an
das Infix mn gedacht w erden , m it dem es auch phonetis ch w egendes lab ialen Charak ters be i der eng zusammenhängt. E s b leib t dieS chw ierigkei t, w e l ches dabei die Rol le des zw ei ten Bestandteilesvon m n
,des n
,gew esen sei. Besonders für diese S chw ier igke it
ist zurze it eine befr iedigende Lösung n i cht zu finden .
B em e r kun g. Besonderer Umstände halber war es mir nicht mogl ich ,in diesem Beitrag die phonetische Transkription durchzuführen , die ich sei tAufstellung des „
Anthr opos-A lphabetes“
(1907) s. darüber S chm idt,Die
Sprachlaute und ihre Darstel lung in einem allgemeinen l inguistischen A lphabet(Anthropos H dann S eparatausgabe Salzburg 1 907) in meinen
l ingu istischen A rbeiten zu geb rauchen pflege.
E in e m erkwü rdige Beziehung zw ischen den
austrischen und den indochinesischen
S prachen .
A. Conrady (Leipzig) .
E s ware n i c h t zu verw un dern , wenn der sac hkundige L eserdiese Arb eit m it b efrem de tem Kopfs chü tteln zur H an d nähme.
Ist doch sc hon längs t und von b e i den S ei ten h er durc h eine gan zeR eihe gr ün dli c her und grun dlegen der U n tersu chungen worun terE . K u h n s bahnb re chen de „Be i t räge zur S pfachenkunde Hin terin d ien s“ nich t b loß zei tli c h in der ers ten L in ie s tehen e in eans che inend unüb er steiglich e S che i dew and zw i s chen der ideh .Sprachfam i l ie und i hrer südlichen Nac hb ar in , der austr oasiati
s chen , er r i ch tet , und sei tdem vo l len ds P. S c hm i d t in seinemepochemachen den W erke : Die Mon und Khm er -V ö lker , ein
B in deglied zwis chen V ö lkern Zen tralasien s und A ustron esiens“
,
dem S chlußglied einer Ke t te ni c h t m inder w er tvo l ler Vorarb e i ten ,
die au stroasiatische m it der aust ronesi sc hen zu dem R iesengeb i l deder austr ischen S pra chfam ilie zu samm engefaßt und deren engelexika lis che, gramma t i s c he und syn tak ti s c he V erwan d ts chaft m ethod is ch nac hgew iesen hat se itdem s chein t do ch der gegense i tigeAb s c hluß fes ter denn zu se in.
U nd doch i s t es in e igenar tigem Spiele des Zufa l l s geradedieses W erk , das An s toß und G run d lagen zu den nachs tehen denAusführungen gegeb en und so , w enn sie si c h b es tätigen , w en igs ten s m i ttelbar se lb e r B res che in die s tarre G renzm auer ge
31*
4 7 6 A . Con radys chlagen hat ab er freil i c h au ch zu m e iner e igenen gr oßten
Üb erras chung, da i c h ja vor dem selb s t den e in en und an derenS tein dafür herb e izu tragen v ersu ch t hab e.
A l lerdings w ar m ir , s chon eh e i c h es kennen lernt e, e ine A nzahl idch .
-au stroasiatisch er Ä hnli chke i ten in Wor ts chatz, W or tb i l dung und Wor tfügung aufgefallen : es hatten si c h da außer allerhan d Gle i chungen b esonders von Z ahlw ö r tern und Pronom inibus
zw i s c hen Miao-tze undMon-K hm er—Sprachen (wie Misc pi, pieh ,pn , pa : Mon-Khm er pi, peh , pai Phö-Mi ao psu : Mon p
’sun ,
m’su n PhöoMiao vai „ i c h“
, pieh „Wir “
; Mon püi dass ; PhöMiao tu : Mon gta die s chließl i c h das E rgebni s alterMi s c hungen se in konn ten , vers chi eden tli ch au ch Parallelen gem einindoch inesisch er
'
oder gar vorw iegen d oder aussch l ießli c h ch inesisch er Gr undw or ter m it au stroasiat ischen gefun den , z. B . :
G em einidch . twi, da i, dai, tye, dyak, ti, chh t'
, tsü u sw . , ch ines.‘
S-u i (s in i co-ann am . t’u i ; 1 0128 , B ild) t ib et . öhu : austr oasiat . ät't i,
dai, fick, diak usw . „W a sser“ ;Tib e t. l)äag(s, T ai-Spr . klek, Zelt , Pho-Miao b lau (vgl. chines .
S tah l , s chon S o h n - k i n g III) , Miao-T ze dlau , t’au , lo,
sons t no ch thi, tech, ch ines . t’ iet, (1 1 156 : au stroasiat. tek, télc, tsighEisen “
;
I deh . (1) t ib e t . drug, son s t no ch trak, dok, drü, true, trao, ta,da
'
, ta)ruk, ta)rü‚ k) trü‚ rük, ra, ch in es . Zu7c (j . léo, (2) b ir
man . k’r ok, anderwe i t ig krülc(zka, Irak, khra, krö, Ich -
ü; ke)ruk usw . ;
(3) pa)r uk, pa)rük; (4) a)zok, pü)sauk, sap, chhö, sa)r uk, sü)ru u sö.,
Pho tsau austr oasiat . (1 ) t’rau , trau , to)trou , thra, to, tür id,
hin)r iw ; (2) kr ong. Mon (call ) k’r au ,
‘
(3) prau ; (4) sau „se ch s “ ;
Tib et . za-ba (Perf. za(s b i rm ari. öä, sons t no ch chä, aha, j ü ,
j e(e7ze, jhi(sa , tga, j yü, tia u sw ., Man v. Y unnan (H ou -H a n - s c h u,
L . Tsch . 76 ,‘
tsu chin . ät'
lü (997 1 , Symb ol) : austroasia t . aha, so, si, chi, tj z
'
, chiah , chia, in)tia u. dgl. „essen“
; fernerC hines. ti3 Sym b . ; mundar tl. tei, tie, phonet . E lem .
1 ) Nach chines. V organg b eze ichne ich h ier w ie Spater die Tonakzen teder h o h e n S erie durch den e in fachen Halbkre is , die die t i e fe n dur ch e inenso lchen m it S trich . Dam i t ist zugle ich die ursprüngl iche A rt des Anlauts
stimmloser b ei hochtonigen , stimm hafter b ei tieftonigen W örtern ohn ew e i teres gekennze ichn et . Die e in fachen Zahlen v erw e isen au f G i l e s‘
Ch inese-english D ict ionary, die doppel ten au f das T z e - t ie n .
478 A . Con rady
„gerade, gerec h t“ ; la zmöph „gier ig“
: löph (skr . labha ! ) dass ;k
’
ämnü’ng „
gedenken, nac hdenken “: k
’änü
’
ng „d s. gedenken“.
-y khdyäb „
si c h zur ü ckziehen , w eggehen“
(of. hyäb dass ) :khäb „
aus treib en , verjagen“
; käyäk „B odensa tz , Kehri c h t“ (of.
hyäk dass ) : käk dass .-r chir it „
kle in , s chwac h“
(de"
k „kl. chit kle in ,
w inzig“
(dek „kl . ma :ra
’i ma : r o
’ i xö’i nachlässig ,
sorglos “ : ma’i, mo
’
i-xö’i „sorglos , glei c hgült ig“
; wolkigwa äfii dunkel“ .
-Z xälik „e in gekerb t, zerb roc hen“
: wik s c hneiden , spalten ,
zerreißen“; scilü
’ek „si c h drehen und win den sü
’
ek dass ) : sü’
ek
vorwär tsschieb en , s i c h rollen“.
(Vgl. S c h au salit n iedergle i ten“: sit „
s i c h herab s türzen [vonRaub vöge ln]; talang „
geebneter P latz“ : tang „ebener oder ge
ebn e ter P latz am Berghang“
)-d-) z pm : däk „
mit Muhe, m it Bes chwer de“: präk
-
pr a'
th prdm
A n s trengung, Mühe“.
-b kra : b'
éng „enger m achen , b efes t igen : kr eng „
har t , fes t ,voll“ ; m : bäm tanzen
,springen“
(rdm „tan zen und s ingen“
;
a7eäb das S chauspiel rdm Pan tom im e“
fan
ra : bdm Tan z ,(mm chäfimöt anklagen , b ean spru chen “
chöta m a : dass .)chöt (aus skr . choda ! ) „
A nklager , anklagen“chöthana
„das
G er i c h t sämm eng „S timm e , T on , S prache“siéng
dass ) : siéng „Wor t , S pra che , T on“
(chines . ée7i) .(m tr säaizru el „
lachen , lächeln “: su él dass. (von F ur sten) ;
sa"
mruei„G igerl“ : suei „
wohl geklei de t , s chön“
; :camr'
ilc ein
dr ingen in , s inken“: zik „
e in d ringen“.
B i r m an i s c h .-n tsanak „
Zünder , Z undlinie aus Pulver “tsak „e inen A nstoß ub er tragen , fortle i ten oder s i ch for tpflanzen ,wie F euer von Haus zu Haus “ : Ö anwat „eine A r t Harpun e“
&w at„h ine ins tecken “
(b ei kle iner Öffnung).-m tazna
‘
m „zu r E insaat fer t ige r Bo den e ines R ei sfeldes“tan „
for tpflanzungsfähig zu w erden b eginnend“
(von weibl. Tieren ).-1
°
tsarw é „Zapfen : tsw é „
fes ts tecken (w ie Pfe i l oder&arz nahe vorb e igehen “
: &i dass ; pharu i-phard „zerb ro chen , zer
s treu t“ : pht'i (Tran s. zu pä) „abb rechen “
, a-
phu i „Te il “.
E ine m erkw u rdigc Bez iehung zw ischen den au st r . und den ideh . Sprachen 47 9
-I khalu t„sc harfer Vorsprung aus E rde , H o l z oder S tein “
(z. B. als Wegsperre u . Aku t m it der s charfen S pi t ze schla
gen“; khalok „h ö l zerne ode r m eta llne S c hel le“
: 7Jzak „(s cha l lend )kl opfen“
(vgl. palu t tut kl. Tromm e l : pu t „klopfen “u. lcalau
„m it e inem H eb el emporhcb en “
: hau. dass .T i b e t i s c h .
-n gna-bo alt“ : r )ya-ba
„alt sein “
, r )yad-
pa ‚
r )gan—
pa „alt“ ; nmad-mnad Fa l s c h hei t , V er leum dung : *
mad (of.
ma n iedr ig“
) in s)w adpa „s chm ähen , h erab se tzen , l äs tern“
, s)mod
pa „afterreden “
, d)mad(-pa) „S chm ähung“
; zu d erse lb en S ippe wohlnma „
E id“. d)macl»pct „verfl uchen , schw e ren “
.
(m e dmar„Nu tzen , Gew inn , gu ter F or tgang“
: dar —ba S i c hausb rei ten ‘
-I blad-pa „Ausl o sung“
(N bf. glml-pct woh l sekundar ) , bluba „ loskaufen “
: a)bud-pa (Perf. (1)bltd) „fo r tgehen “
, Haus. a)bzcd-pd
(Perf. phucl) , „an tre i ben ,los frei lassen“
; glat-ba „
gähnen “: m )gal
„K innb acke“
.
-
g dye-ba „G l u ck , H eil“ : b)dc-ba „glucklich , G l uck“
-d ldag(s}-pa „g i eßen “: lugs „
das G ießen , der Guß“
; Idah
öd „erb l in den , b l in d se in “: lan-ba „b l ind sein“
; Man-pa (cf. k)lan
pa, g)lan-
pa) „zurü ckgeb en“
, auch ,an twor ten“: lan „
W en d ung, A n t
w o r t“ ; ldab-pa „lei c h t b egre ifen“: Zabo
pa „ lernen“(Haus. s)lab-pa
(dag-
pa „ zur ückkeh ren “: lag
-
pa dass . (Hau s. s)lag-pa) .gdu
-
gn , gdub-bu (b e i de aus gdug
-bu ) „A rm r ing, Fußring“: guy
„geb ogen “
; bda—ba „Überfluß, s . end los ausb re i ten “: (t)bO-btl (Perf.
ba u . a .) „auss chüt ten , aufs chwe llen“
; verwandt wohl bdog-
ptt „in
Bes i tz b r ingen , einheim sen,Rei c h tum “
: bag(s „G ew inn , V or tei l “ .
(o b dbyifz(s „Ausdehnung , Raum “: {t)dift-bd „
hinb r eiten , aus
s treuen“
; dbal-ba „b ohren , s te c hen “: r )tol-ba dass.
Das a lles sah ja fre ilic h rec h t verdäc h t i g aus, zum al d ieseInfixb ildung m it i hrer pr inzipie l len und m e i s t auc h form e l lenÜbere in s t imm ung m it de1 Nachbar sippe ; a l lein es war do c h vielzu un s i cher , um m e ine Überzeugung von der U nverwandtschaft
b e i der F am i l ien ern s tli ch zu erschü t tern : die an s c he inenden lex ikalischen und syn takt is chen Parallelen konn ten s ch l ießli c h doc hau ch bloß zu fäl l ige Ä hn l i chkei ten sein , w ie sie die Bes ch ränk thei t der Lau t und \Vor tverb indung in d iesen einsi lb igen Sprachenm it i hrem abges chliffenen und v erhältnismaßig ärm l i c hen Lau t
480 A . Con radysys tem le i c h t genug hervorzub r ingen v ermoch te an fes ten Lau tgesetzen zur E n t s che i d un g fehlte es ja noc h und di e Infix
b ildun g ließ si c h am E n de au ch als eine Kontakter sch einung er
klären , um someh r als sie nur b ei e in igen und dazu am stärks tenin der Nähe ges chlossener A ustroasiatenm assen en twi ckelt s chien.
Imm erh in w ar es ein Prob lem , das L ösung he is c h te ; ab er diekonn te eb en w egen dieser E igenar t der Sprachen letzten E nd esdo ch nur dur ch e ingehen de l exika l i s c he Verglei chung gefun denw er den , und dazu fehlte m ir n och das N ö t igs t
_e : ein ausgieb iges
au stroasiatisches Wor tmat er ial in handli c her Z usamm en s tellungund wom ögli ch s chon sow e i t b earb e i tet , daß das Gem einsamau stroasiat ische und viellei c h t auch dies oder jenes Lau tgesetzhervor tra t. Denn nur so konn te der lei di gen Un s i cherhe i t derV erglei chung ein gew i s ser R iegel vorges c hob en und gegeb en enF a l les sogar e ine gesetzmaßige E ntsprechung fes tges tellt w er den .
Es läßt s i c h daher denken , m it w e l cher F reude ich das
S c hm idt’sche B üchelchen w illkomm en h ieß w ar hier doch , wie
s chon ein fiüch tiger B l i ck zu erkenn en gab , all es w as i ch m irgew ün s ch t ha t te , v orab ein re i ch halt iges v ergle i c hen des W ör terb uch ! H ier durfte i c h also, des war i c h üb erzeugt, darauf re c hnene ine E n t sc hei d ung zu fin d en und daß i ch ’ s nu r ges tehe, ichhoffte im S t i llen , daß sie zugun s ten einer en dgült igen Trennungder b e iden F am i lien ausfallen w er de .
A b er es kam an ders . Denn w er b es chreib t m e in E rs taun en ,
da i c h dor t (p. 54) als e in e der Ers cheinungsform en „des int ims ten , um n i ch t zu sagen geheim s ten Merkmals dur ch w elc hesi hre“ der austr ischen S prachen „Z usamm engehorigkeit zur
v ollen E videnz b ew iesen w i rd“
, und zwar als dasjen ige „was da
zuer s t einem zum Bew ußtse in komm t“ , a l so als etwas g an z ty o
p i s e h A u s t r i s c h e s , e ine E rs cheinung b eze i c hnet fan d die
m i c h m eine idch . Fors chungen als geradezu typ i s c h fu r da sI n do c h in e sisc h e an zu sehen gelehr t ha t ten ! Nämli c h „die Durc hgängigke it , m it der die A uslau te auf auftreten b ei W ör tern ,w elche b ezei c hnen ein Z usamm enfassen , F assen , Kn eifen , Z wa cken ,dann Be ißen , E ssen , Kauen , üb erhaupt Gen ießen , dann au ch
1) Nam lich e iner früheren „prim ar-su ffigierenden S tufe“
; doch ist dieserre in hypo thet ische U r sp r u n g h ie r ohne Bedeu tung .
482 A . Com edy
ohne w e i teres D rum und Drau , und des Raum es w egen auch n ur
als m eh r o der min der ausgeführ ten Um riß, den fa chm änn i s chenU r tei l v or lege.
I . A u s la u t -
p ,-m .
1) „F a s s en , kn e i fe n , zw a c k en“
u . dergl.
a) G u t t u r a l -A n la u t. (lt
A u s t r i s c h . Khm .l) kiep, thkz
'
ep „kne ifen “, taizkiep „
Zange“,
S . giep „kneifen “, M. kep „Haar schn eideu “
, B . éölcép „Zange“
K has i khap „ zw i cken , kneifen “
,K . gäb, B. S . gap „zwicken“
, Khm .
pr e—käp „ab zwacken , ab s chne i den “
, käp „ab t rennen “
; N . ap—kap
714t „b ei ßen“
, koäp-hgt
-fzq „ab b e ißen “, S an t . äa7cap „G erau sch b .
E ssen “
, öakap „han dv o ll“ ; B . S . kap „b eißen“. K has i kap „grei
fen“
, N . köp—katgi „die Hand s chließen “
, kap-hatq „festhalten “
;
Austronesi s c h ta »ikap , taoikep , takap , takip , sikop , siv'
zkap,takup
„n ehm en , greifen , fassen“
, Mal. dakap , Bat . dokop „ umfassen , umarm en “ M. lrém die Han d s chl ießen“
, K hasi k(h) em „fassen ,gre i fen “
; A u str ones. r oitham , la izlrum „han dvoll “.
I n do c h in e s i s c h . Chin es . kiap , Map : , lriep (1 1 32) (Bildzei chen ) ; „von zw ei S e i ten fes thalten , un term A rm halten , m it einerZ ange fes tha l ten “
, „ si c h zw ängen an“(S c h u -k i n g III , S c h i -kin g)
(of. Map : , hiep ., tsap ., sep . [ 1 1 337] dass ) , k’iap . (1 1 91 ) „zwi cken ,
kn e ifen “
; k’ap . (27 8) „
E ngpaß, Zw änge“
, hiap ; (421 9) „eng“
(S c h u IV) . Vgl. h — Jr’
iem (1 707) „Zange“
,
‘
hiem (4458) „E ngpaß
(S c h u IV , S 0 h i , Y i h kin g) .— Tib e t . s)kaw -
pa „Zange“
, a)gr um-
pa
„abkne ifen“
, a)gram-
pa „Kinnlade, Backe“
; kham „Bi s sen“
, a)gam
pa „in den Mun d s tecken oder w erfen“
. B i rman . kyap „eug
se in “
, krap „dur c h B in den enger mac hen“. khwaa
_
n „in d . Munds tecken“ S iam es. k’äb, k
"e
'
b „eug“
, kab „Mausefalle“
, k’ib „m it
der Pin cet te ergre ifen “
, lzib „zw i s c hen zw e i Mühls te in en pressen“
,
köb „m it b eidenl i ändeu nehm en“
, k’
ab „m it dem Munde fassen“
,
khöb „b eißen“. lc
’
äm Handvoll,mit der Han d nehm en
“
, k’im
„Z ange“
<h
A u s t r i s c h . S an t. hap „essen , e inen Happen nehm en“.
I n do c h i n e sisch . Chin es . hop e , k’op „ t
’ap . ; kinp i
1) Die A bkürzu n gen n ach S c hm i d t , dem ich auch b ei den austri sch en
Gleich ungsreih eu m e isten s gefo lgt b in .
E in e m erkw ü rd ige Bez iehung zw ischen den au str . und den ideh . Sprachen 483„ essen , kauen ; e twas im Mun de ha l ten “
.— Vgl . draw (38 18) „ im
Munde ha l ten , (dem To ten Kaurimuscheln) in den Mun d ste cken“
(T sc h o u - l i) ; J i iem (4506) „im Munde tragen, m it s i c h t ragen“
(S c h i — k i n g) ; . ham (37 79) „zweiklappige Mus che l“ , Tibet . hab„ H an dvo l l “ , hub „ S ch l uck , Z ug“
.— B i rman . hap „schnappcn nach“
.
S ism es . hüb „ers chnappen , erhas chen “
(iz
A u s t r is c h . Khasi nt„K innba cken
,W ange“
, ty1'
1am „Kinn
backen. Mon aizäp, S . gäm „Backen zahn“. Khm . süc7p, S .
gab-
ga , N i c . hz'
fzäp , S an täli afzgap , A u strones. ahap , miap ‚ taJ«ap,
t’
alafzap „gähnen“.
I n do c h in e s is c h . Chines . ldap ldap . (1 138) K innb acken ,
W ange“
, hop‘
ham (3824 ; im E r h —
ya dur ch J zam (38 18)
„im Mun de ha l ten“erkl är t ; vgl . d . phone t . E lem .) K innbacken“
hip . (4 132) den Mun d aufspe rren , gähnen“
(S c h i -k i n g) ..ngam „schnar cheu
“ ? k’ie m
’
(1 750, B ild) „G ähnen“.
S iam . ngab „m it dem Mun d ergre ifen , b eißen “
; 7c’
r am „Mah l zähne“
;
kém „Wange“.
b ) P a l a t a l - A n l au t (ö
A u s t r is c h . M. gap „s chlürfen
,kos ten“
,N i c . g
'
aüg'
äb „die
Lippen anpressen“
, S . g'
up „den W e in kosten“
, K has i kyyjap„s ch l ürfen , saugen ,
kos ten“. Khm . c
'
ap „ergreifen“
, S . c'
ap „ fas ten“
,
B . (ep „in der H an d halten“, S t ieng ödp „nehm en “
. S an t . y'
om
„essen“
, S . g'
c'
im „v erzehren , ze rre ißen “
.
I n do c h in e s is ch . Chines . tsap . (1 146 1) „ saugen , lecken“
,
tsap .,
'tsam (1 1463) „ saugen“
, s'
ap (9 636) „ t r inken“
, sap „ Imp .,
hop . (3754) „s ch l ürfen , es sen“. öip . (17 95) „
ergreifen,festhalten “
(S o h n —k i n g,S c h i -k i n g) , Zip . (17 9 7 ) „
m it der H an d ergre ifen“.
tsap . „ergreifen“. Vgl. .äem (26 7 , Symb .) „wahrsagen “
„L osstäb e ausklaub en“
; S oh n V , S c h i) . Ti bet . g)éab-palecken “
, a)g"
ib(s-pa (Perf. b)äib(s) „ saugen“. a)c
'
hem(s-pa (Perf.bäem(s) „
kau en“
, a)y"
ab-tse „kl. Zange, Pin ce tte“.
— B i rman . öhup „die
H an d (und in der Hand) ba l len“. S iam es. claéb „s ch l ürfen“
, chüb
„küssen“
, sich „einsaugeu
“
(m it dem Munde) . chdb „ergreifen “.
(5a ) .
A u s t r is c h . N i c . op-sap „fangeu
“
, S an t . sap „ ergreifen , hal
ten , fassen“
, K has i .s'
ap „ergreifen“.
484 A . Conrady
I n do c h in e sis c h . Ch ines . sep . , l dap . (1 133) „ergreifen‘
,
s*ep sep ., yep ., t
’ip ; (9 797) „
ergre ifen , L osstäb e au sklaub en“. Vgl.
sfam (64 1 7 , B i l d) „un ter dem A rm halten “
, sam (969 1) „ergre ifen“
(S c h i -k i n g) . S iam es. sam v on b e i den S e i ten s tü tzen“.
(it 77,
A u s t r i s c h . N i c. n iama Zange aus Rat tan“
, K . aim , S .
n im „Gespann , J o ch“
I n do c h in e s i s c h . Chines . ‚nem (829 7) „in die F inger neh
m en , ausklaub en“, nep . (827 5) „Zange , Zängle in “
, 7'
zep nep i ,
$
h em
(8266) mit den F ingern abkneipen ,m it der Zange aufnehm en“
,
nep . (8262) „kneifen , kne ten“. Tib e t. s)izim-
pa „F lüssigkeita
m aß, b e i de Hände zusamm engelegt voll“ , r )fiab-r )iiab-pa „ohneW ah l zu samm en raffen “
. B i rman . fiab „gezw i ck t, gedrü ck t w erden“
(T r s. fihab) ; i“
zhab „Zange“. S iam es. hnäb „kl. Z ange“
, Im ib
„m it e iner Zange fassen“
, hj ib „m it dre i F ingern nehm en
“.
0 ) D en t a l u n d Z e r eb r a l-A n la u t . (t d
A u s t r i s c h . Khm . ketap „die Han d s chließen “
, B . ködop
„Faus t , Han ds chließen “
, S . södop „m it der Han d F l iegen fangen“
,
N . Zra1_zc‚lap „Vogelfa lle“
, S an t . sitap „plötzli ch s ch l ießen “. S an t .
thep „m it dem Daum en for t s chn ellen“
, B . tep „zw . Daum en und
Z e igefinger n ehm en“
. S an t . datam „m it K lauen o der Z angegre ifen “
, S . tam „greifen
,fangen“
, M. timz Fa lle“. S an t. Zatum
„Mun dvoll“ .
I n do c h in e s is c h . Chines . t’ap . mit e inem Lassofangen“
, tiep äep ., nep i (64 + 7 ) m it den F ingern fassen“
, t’iep .
,
nep i , yap .,
s
gem (12999) „m it dem F inger n ieder drü cken , ergrei
fen“
;£
tam (10605) „in der Hand halten“ iam (10688) „aus der
E n tfernung ergreifen , auf s i ch ziehen“
(S oh n V ) . Vgl. tam
(10645) „b e ißen , kauen , fangen“
, t’ap . „essen“
, t’ap . (135
+ 8) „ s chlürfen ‘. Tibet . a)tham-
pa „festpacken (bes. mit den
Zähnen) , fest zusammenb in den , fes t zus chließen“
(den Mun d) ; theb«ma „Daum en
“ ? Birman . thw ap „quet schen“, tap „fes t h inein
s tecken “. S iames. t
’
ab „pressen , zusamm end ru cken“
, t’iem „
ins
J o ch spannen “.
(l r
A u s t r i s c h . K has i khillip , b7 ip „b l inzeln“
,khap
-r ip „ zw inkern , w inken“
, M. damr ip „b l in ze ln“
, S . r ip „(die A ugen) s chließen“
,
486 A . Con rady
k’
udm „auf das Gesi c h t gelegt se in , das Ob erste zu unters t gekehr t“ , Zcöm „b eugen (Kopf) , niederw erfen “
, ham „niederdrüoken ,
n iederwerfen“.
(h '
:fh "
!
A u s t r is c h . N i c . höp „ tauc hen b e im Baden“, M. hit, B . ham
,
S an t . um „b aden“
. Khas i team , B . nam „ s inken , ein tauc hen“.
I n do c h in e s is c h . Chines. kiap. (aus*hop. ; 4233) „durch
t rankeu “
(S oh n II , V , S c h i) ; J iam (alt*.ham ; „un ter
s inken“
(m it Lau tw er t .kam dass . .kam ,t ham ghani ,
J itam (38 10) „dur ch tränken , dur ch s ickern“
(S c h i) : ham’
„im
W asser versinken , un tergehen“. .yem , J lam „un ter
s inken“
, asia n (1 30 1 6) F lei s ch in heißes W asser ein
tau chen “
,
"‘
yim (Can t . ; yem ; 1 3244) „dur ch tränken , un ter tau c henin , E xzeß“
(S o h n II , IV , V), of.'“
7'
zam „den Kopf
n eigen“.
b ) P a la t a l-A n l a u t. (g"
5 [s
A u s t r is c h . S an t . y’
apao „s terb en , gefähr li c h krank“
, g'
apua
„ s c hwa ch , zusamm engesohrumpf B . s'
ap „s chwächer w erden“
;
K has i sep „un tergehen M. gag’
ä, gag'
a’
„si tzen“.
K has i sum „baden“.
I n do c h in e s is c h . Ch ines. . öep. (mundar tl. äap. ; yep
alle in und in Z ss. m it yep . in der A u 38pr .
s
gem „s terb en“
) krank“
, äep . 559) „b es chäd igen , zers tö ren ,
b ü cken , falten“
, öep .‚ tiep., sip., z“
ep. 568) „s i ch un terw erfen , s chwachherzig , s chwach“
,äep . (2014) „n iedersteigen“
c'
ip . „in die Tiefe gehen“
, öap . (104 + 9) in Z ss.„A ussehen der
Haut al ter L eu te“„ runzl ig, v er schrumpft “ ; tsap . ts
’iep :
Ziep. und Doppe lung) „die S onne im Begriff un terzugehen“
, sip. (4 126) „n iedrig und eb en , feuch te N iederung“
(S oh u III , S c h i), sap .-sap . (32 1 3) „T on herab s türzender E rde“
.
sim’
, ts’im
’
(Can t. ‘
sem , tsem’
21 10) „etw . ins W asser tanohen“,
sem’
, tsim ’
(9826) „dur ch tränken “
, .5im (9823) „t ief (Wasser)“(S oh n IV , S c h i , T s o h on -li) ; of. 11 . a.
$
ö’
em , oem (649) „un ters inken , vers inken “
(S oh n III , IV , V , S c h i) , ds’iem (1 739) „un ter
tauoh en , auf dem G runde des W asser s liegen “
(S oh n V , S c h i) ,
ts’im
’
(2090) „üb ers c hwemmen“
(S c h i) . Tibet . zab-pa „ t iefzab(s „Tiefe“
; iam „zerb ro chen“
, éam-
pa „üb erwält igt“ , a)g“am(s-pa
E ine m erkw u rdige Beziehung zw ischen den au str . und den idch . Sprachen 487
(P . b)öam) „üb erw ä l t igen , zer storen“
, (ham „n ieder“ , Sam, g)äam
„U n ter tei l “ . B i rman . Eine „ d ur c h tränken“. S ismes . chs
chüm , china „eintauohen“
, chöm „ un ters inken“.
["DA u s t r i so h . S . 72ap „ S onn enun tergang“
, B . hap „vers torb en“
,
Lynggam my-wm iap „ s terb en“
, N ic . paaiai_op „Ab en d“
, pain-aiap
„s terb en“
, pmn-gniäp „ L ei c hnam “
; Khas i gap „ s terb en“
,Khmu
y0pa „Ab en d “
, S an t ayup „A bend, Dämm erung“
; P . R . ganz, A .
pam , yöm, yim , W . pam , y'
a'
m „ s terb en“. Khas i iap-0p „
un te rs inken“
, N ik . ap-op
—hgzm „sioh umdrehen , um s türzen“
, komöp „ein
Kanu um s türzen“
, S an t . ap „ s i ch n ieder lassenI n do c h in e s is c h . Chines . hap. (j . nap .; 8 106 , un prgl.
81 7 7 , S ym b . ) „untergehen “
(v. der S onne , in nap i ätt i „die un tergehen de S onn e“
: S oh n I , 6 ; vgl . ha t. mit d em se lbenphonet . E lem .
, a l so aus nap.] „Farb e der un tergehen den
é ip. (aus*fzip. ; 5690, S ym b .) „hine ingehen , s terb en “
, h ap .
s terb en“
, fiep , (1 1207) „fall en , s inken “
; yep .,
‘
yem „krank ,s terb en“
, (y)ap . „n iederdrücken, um s türzen“
: yep. „sioh
b eugen“
, (y)ap . (aus*kiap . ; 12825) „
n iederdrüoken“. Tib e t.
m tb-pa „s inken“
(Kaus . s)nub-pa m tb „W es ten “
,
nub-mo „A b end“
; nem(s „ s i c h senkend, e las t i s c h“. B i rman . h ttp
nu ter tauohen , verloren gehen“
, h ip , h im , a im n iedergeha l tenwer den“
(Trs . nhip, nhim) . S ism es . nöb „grüßen , sich verb eugen ,
si c h un terw erfen “
, Kau s . hnöb b eugen“
, vgl . nam. „si c h b eugen ,
si c h un terwerfen“
, nöm „beugen , dur c h Bengen ern iedrigen“
; jöb
n iedergehen w elken , ern iedrigt w er den“
, jab „n iedergehen , v er
m indern“
, j üb-jab „zerb r oohen , ruin ier t sein“.
o) Deu t a l u n d Z e r e b r ah A n la ut . (t d
A u s t r i s c h . Khm . dab „nn ten , un ters t“ , S an t . dab-dab auf
e inm al sinkeu “
, dub „zusamm en s inken“
. K hasi them,M. thu im
n iedrig,hohl“ , P . deöm , dem , tiam ,
A . tem , den, W . tayim ‚ tim ,
tom n iedrig“
, K has i dem. beugen , n iede rb eugen , knien“, Khm .
dä , .sioh n ieder lassen M. dam „s i c h niederlassen“
, K has iclaim -tale „ si ch vorüb ergehen d n iederlassen“
.
I n do c h in e sis c h . Chines . tap . n iederfa llen , nie
drig“, tap . (86 + 1 8) „
zusammenges türz t , n iederfallen“
,t’ap . (105 12)
Vgl. auch „b edecken“.
488 A . Con radyni edrig, nieder zusamm en s inken“
, tap. , t’ap . (10496) „n ieder
treten“
; tiep. (11 141 ) n iederfallen , s i c h n ieders türzen (Vogel)“(of. t
’ap „T on eines fallen den tiem
’
,
tiem (1 1 203) „n iedr ig m ac hen , n ieders teigen , im Wasser v er
sun ken , üb er sc hwemm t se in “
(S oh n n 1eders teigen“
,
‘
t’iem (1 1209) en tehren , S chan de m ac hen “
(S o h n I , IV ,
V , S c h i) , .tam (313) „versunken sein in“
(S c h i) : c'
aml
„t ief
, sin
ken, einw ei c hen“
, tam*
, Zam* kl . G rub e“
. Tib et. a)du b
pa „ermündet sei u“
, Kaus . thub-pa „üb erw inden konnen“
, r )dib-pa
e infallen , zusamm en stür zen“
(Kan s . z)tib-pa) . thim-
pa
B i rman . tup „kn ien , b eugen tup-w ap „gesenk ten Haup
t es kn ien“.
—° S iam es. t
’äb „ drücken , un ter drücken“
, dab „hr icc hen “
. iam „n iedrig, ern iedrigt“ , dam „h inein sprin gen ,
v er
s inken in“
, t’üm „n iedr i g, ern iedr igen “
, tham un ten , n iedr ig, demüt ig, sanf dam „
gesenkten Hauptes“(l
A u s t r i s c h. S an t . Zap „ausfa llen , verlorengehen “, alap
-alap
dumm “
, a-Zap-alap „
m nde , ers c höpft“ , Khm . panlap „b etäub en ,b es türzt m a chen“; sanlap „O hnm ach t“ , N . pamlöp „ sinken“
, Pal.
sah é-Zip „S onnenun tergang“
, B . kölup „um s türzen“
, K has i pyllupflach auf dem Gesi c h t“ (B. Zap , Zöp „
b edecken , üb ers chwemm en ,u nter tanoh en“
, M. balu ip , blüp „un ter tau chen“
, S . bl'
0'
p „herabs türzen A ustrones. t’elap , titip ,
dzdip , d010p „ [un ter]K hasi ai-liam „üb erfließen“
,A ustr on es. malam
,ma
Zém , alim , madilim , silem v ersinken“
, N ic . Zöm „arm , verlassen“
B . pöläm , M. palüm „zers t ö ren “
, S an t. g'
ulam „Gewalt , Unterdrüokung
“.
I n do soh in e s isoh . verfall en , ve rro ttet“h ip . „ab sturzdr ohend, gefährdet“ ; vgl. hap., atep.
,-7iep . (j . yep ,
-
yep. [2991] „ab sturzdrohend, gefahrdroh end, Gefah r fürch tend“
S o h n II , S c h i) , Zap. (1 12 1 3) „herabfal len der S tein“, Zap .
(559 , neb en up .,11 . 6662) „zer st ö ren , zer trümm ern“
; Ziap i (7 104,
phon . E lem . au c h Zap) „b esturzt m achen , ersc hü ttern“
; Ziep z,-Ziep .
s . o . , nach T z e - t i en au ch selbstdg.) „di e S onne im B e
gr iff un terzugehen“
(zu Ton s . didip vgl. tap . „üb erschw em
Zum. (6 728) üb erfl ießen , über tre ib en“
(S c h i) , „ iu sWasser tau c hen (N „
verworren“:
‘
lam‘
Zam „ein
490 A . Con radyA u s t r is ch . Khm . kap „b edecken , e in s chließen“
,M. h ttp
ei ns c hließen“, Khasi shap „Hulle , S chale“
, loop „B ettdecke“
, kap
„kleiden“
, S . kap , a öp „Hau t , F ell“
, kap „ si c h verb ergen“
, S em .
gap „N ach t“, M. gaka ip „Deckel“ , Kaw i , J avan . sikep „anfassen ,
Bewaffnung“. W a kim Haus“ B . gam „blau , s chwarz“
K has i gir 1'zam „grün“
, W a hsün nam „b lau“.
I n do c h in e s is c h . Chines . kiap . (1 1 67 , B i l d) S chale , Har
nisoh“
(S oh n IV , S c h i) , k’
iep., h’ iep . (1570) „K i ste“
, hip . (845)Bü chse“
, k’
op . „die T u r s c h l ießen“
, k’
ap . b e
decken“
(in k’ap .
-.tang „F rauenob ergew and
“
,w tl. b ed e cken d die
kai’
, alt*kap . „b ed ecken , Deckel“ (S c h u V ) .
‘mm (5882, B ild) „Behäl ter , en thalten “
(vgl. altsüdohin es k’am
[5866] en thalten , Gefäß“: F a n g -ye n 6 , k
’im (2107) Bet t
decke“
(S c h i) ,‘
kim (1 3259) „ s chl ießen“.
— J c’im (1 701 ) „ s chwa rz“ .
Tib et . gab-pa „ s i c h verb ergen“
, s)yab-pa „b edecken “
, g)geb(s-pa
(Per f. b)kap) , g)kheb-pa „b edecken“
, kheb(s „Decke“
, khrab „Har
n is c h“. Zthgim „Haus“ , ggam „Ob dach“
, s)gam „Kas ten , K i ste“
,
s)gram „Kofi er “
, khom „Lederkoffer“ . S ikk. B hu t . 7’zöm-ba „blau“
.
B i rm an . khyao_n „b edecken“
, khram „Zaun“
. S iam es. käb
Hülle , S oha l e“
, k’
r aib alte Hau t der S ohlangen “u sw . , kt „b e
deckter S i tz auf e inem E lefan ten“
, k’
röb, klöb „b edecken“. khdm
„he imli c h, verborgen “
, k’üm
„s chü tzen , b edecken “
, k’
li‘
tna „b edecken “
,
um geb en“. k
’
aim „Na ch t“ , k’
ram „Ind igo“
, 18d „ziem li c h dun
kel, b ew ö lk t(h
A u s t r i s c h . B . höp „eiuw ickeln , b edecken und ers t i cken “
,
Khm . hap „vor dem Winde ges chü tz t“ , K hasi Z’hop „gesc hlossen“
;
A ltjavan . hab, h ib „Bede ckung , S chat ten“
, mah-habi (Neujavan .
h ahabi) b es ch i rm en , b escha t ten “
, S amoa afi, F idji av ida „b e
de cken “. W a him „Haus
“ ?
I n do c h in e s is c h . Chines . hop. „b edecken“
, hop .
(3962) „ s chließen , b ede cken , Torflügel“ , hapi (3947) s chl ießen ,
v erb inden “
, hop . (3954) „Buch se mit Deckel“ , Map . (421 3)
„Bü ch se“
, hiep. (1 1 33) „verb ergen “
. Jzam (3809 , Bild) „ent
halten , einw i ckeln“
(S oh n IV ,V ) . Tib e t. gr ib „S chat ten“
,
(a)grib—
pa „ dunkel s)gr ib-ba „verfinster n“, s)kyib(s „O b
dac h“
; s)kyob-pa „ s chü tzen , ret ten “
, s)kyab(s, s)kyob(s „S ohutz, H ulfe“.
E ine m erkw u rdigc Beziehung zw ischen den au str . u nd den ideh . S prachen 49 1S iamos . he „ s ch l ießen , si c h v erb ergen , H oh le“
, h ib „ Koffe r ,K i s te“
. höm „den O b erkorper b edecken“
, ham „b edecken , ver
s chleiern “.
(ii
A u s t r isc h . Khas i h em , B . fac'
im „geheim “.
I n do c h in e s is c h . Chines . .yint (60) „die T ur schlie
ßen , heim li c h , d unke l“ . B i rman . ham „b edecken“. S iames .
ngaem , a em „b ed e cken , verb ergen“
(of. ngueb
b ) P a la t a l- A n la u t . (ti 5
A u s t r i s c h . K . kana'
ap „Packet“ , B. göéap „einpa cken“
.
Indo c h in e s is c h . Chines . ö’dp . (204 ) „das S tadt tor schlie
ßen “
(öap. [ 143] 5ip . (560) „ sioh v erb ergen , W in ters c h laf ha l ten“
(T s o h o n - s c h u) . Vgl . ‘
sem (9707 , Symb .) s i c hv e rs tecken v or
“. Tib et . g:)öhab-pa (Perf. b)äab(s ) „verb ergen“
q)g'
ab-pa „heim li ch sohleichen“
; s ab(s „Fu t teral , Gehäuse“. S iam es.
chäm „e inkerke rn “.
(ü'
l
A u s t r is c h . Mal., S an d . Zenap „vers chw in den“
, Kawi , J avan .
le"
yép „un deutli c h“
, Ziyep „halb ges ch lossen N . pmm'
zap
haha auslösohen“. B . iüp , ip „S chat ten“
, K hasi gab „F ins tern i s“ ,Khm . gab „Nac h t , F in s tern i s“ , N . op
-
yap-hata „S ohw eine b ei
Nacht jagen “. M. öp „verb orgen “
. Pal. iyam‚ „schwarz‘U )
I n do c h in e s is c h . Chines . fiep. (8290, S ym b .) „s tehlen , v er
s tecken“, üep . (8267) „(ein L och) zu decken“
(S o h n V ) ; yep.
(1 2999) „w egstauen
“
,
'"
yem (13057) „b edecken , verb ergen , schließen “
, gem (1 31 48 , B ild) „Dach, Ob dac h“
,
‘
yem (1 3058) Dunkelhe i t“ : $ gem „ si c h zusamm enziehen de Wolken“
(S ch i) ,‘
yi1n (1 3224)
„dunkel , S chat ten , verborgen sein“11 . a. (S o h n III— V , S c h i ,
T s o h on —l i) . (y)ap . (6 109) verbergen , mit der H an d b edecken“
, (y)ap . (6108, aus„verb ergen , a
' ufspe i chern“.
‘
yem ,
'
(g)am „blaus chwa rz“ , ‘
(li)am „ t iefs chw a rz“ , -h)am‚
‘
gim (70) „s c hw arze Farb e“
. Tib et .gab
-
pa „verschließen , über de cken“
, yab-
yab-
pa , gib-
pa „ s i c h ver
s te cken“
; Man v. S ze-tsch ’
uan nyim (13244) „H aus , Fam i l ie‘
(H on -H a n - s o h u o . 7 6, B i rman. ap „b edecken“
V e rgl . die S ippe „n iedrig“un ter 77 die Grenze ist h ie r gan z b e
sonders fließend.
492 A . Con radyip „s ch lafen“
; im Haus“ . S iamos. ngzeb, ngzeb-chieb „s c hw eigen ,heim li c h“
, j eb „ L is t , h eim li che Küns te“
; db, äb „Bü chse. am
„b raun , s chwärzlic h“.
c) D en t a l u n d Z e r e b r a l -A n la u t . (t d
A u s t r is c h . K has i tap „b edecken , üb ereinanderlegen“, Khm .
tantup, B . ddp, döp „b ede cken“
, S . dup „verb ergen“
, S an t. dapb edecken , Dach“
, Zadap „bedeck t se in “, dap-dap „wolkig“
. N.
kendap „Deokel aus B lat tern “, M . gadap „b rü ten“
; A ustrones.
tatap, tatab „ s chl ießen , b edecken“
, atap , atap , atep, atip , ataf-nai
„ de cken , b edecken“
; Kh asi lehyrdap „s chließen “
(dab, dab „ver
sperren , S . köldop „Tür s chließen “
; S an t. ladap „halbs chließen“
; Mon thap , B . atap, K has i ky-nthap „e inw i cke ln“
. K has itep , M. ta ip , S . tap „b egrab en “
, P .-täp , täp „in di e E r de senken“
;
S öm top, S ak. atap , atäp „A b en d“
, S un aaZtam „Mi t ternach t“ ,Mon b
’tam, A nnam . dem
,K has i j ingdam (zu dam N .
hq _
tom ,dam „Nach t“ , S an t. g'adam-
g’
adam „jede Nach t“ , kadamkadam „im Dunke ln“
. A ustr ones. itam, hitam , pitam , item , istem ,
itim , item „ s chwarz“I n do c h in e si s c h . Chines . t’ap ., t
’
ap. (10503) „mit E i sen b ede cken“
, t’
ap . , t’ap. (10500) „Decke , b edecken“
, t’iep. (1 1 130)
„Z imm er decke“. t
’
ap . t’
ap. „s chwarz“ , t’iep .
schw arzköpfig“
(liep . „ inn en s chw arzer .t’
am (10700)
(.t’
am „ s chwarze W o l ken“,
‘
t’am (
£
sim ,
$
c'
im ,
"‘
yam) (9845)
„s chwarz ; Maulb eere (S c h i) . Tibet. deb(—ma) „Um schlag üb ereineW unde“
, a)thib(pa , g)tib(s—
pa „s i c h di ch t zusammen zieh en (vona)thib(s—
pa „finster , d iok“
, thib-thib „gan z dunkel“ .
a)them (s—
pa „s chließen , um fas sen , b edecken“
, a)tham-
pa, g) tam-
pa
„üb erdecken , verhüllen “
, tham(s) „Um sch lag, Umhüllung“, s)dam
„Hau s“ ; a)tham(s)-pa „getrüb t sein , verfinster t se in“. K ir an t i-Sprr . .
dom-sd, dam’ma „Nach t“ . B i rm an . tap „S ohranke, Wall“.
thim „verb ergen “
,thim „Wolke“
. S iames. t’ap „Hut te“
, ddb
„ ausloschen“
; tham „Bü chse“
, t’im „G efängnis“ ; ddm „s chwarz“ ,
of. T ai-Spr r . dam , da’m „Nach t , s chwarz“ (T ’
onng-
pao 2. S er . VI II ,
A u s t r i s c h . K hasi sap „b edecken , Dac h decken“. Palaung
u . a. söm , sam , kaisem , L em et dissem „Nach t“
494 A . Con radym eln“
(haka'
m gam „ s i c h zur Hulfe vere in igen“
, M.
kam „zusammen“
(kö zu samm en K has i khüm „b in den“
, S .
kam „um geb en , drehen ,
flech t en“
, Khm . phgii „vereinen , gruppier en
“
; c'anham „S trauß, Traub e“
; S an t . angom „im allgem e inen“
,
g(Z „Dorf“ (oder S kr . N ik . hen —köm „A n sammlung v on
K lei dern“. A u strones. P i dj i dah -kam —aka „znsamm enfügen
“.
I n do c h in e s is c h . C hines. loop . (kap (3947 , Symb ol) „(sich)samm e ln“
: hop . (dass ) verb in den , vere in igen , üb erein st imm en“
(S o h n , S ch i) , hiap. (Imp.) (4233) „verein igen , vere inigt se in , üb ere in s t imm en , durchdr ingen“
(S o h n II , V ; S c h i) , hiep. (4385, S ym
b ol) ‚üb erein s t imm en , ein igen , zu samm en“
(S oh n II , IV , V) , hip .
(41 32) „üb ereins t imm en , in sgesam t“ (Hia -S i a o - oh eu g [T a -T a i
L i — k i 2 S oh n II , S c h i) , hip -hip. (4 133) „e in t räch tig“
(S c h i). .kiem (1630) „zusamm en , verein igen “
(S o h n IV , V ) ,.kiem , Jciem (1 612) „znsamm enb inden “
; Jaiem (.ham) „üb er ein stim
m en , H arm onie“
(S oh u II , V ) , J item (J zam) „all e, säm tli ch , verein i gen (S o h n , S c h i , Y i h ) . Tib et . grab „a lle“
, grab-ba „fer tig
gem ach t, vol lkomm en “: s)gr ab-pa „vollbringen“
. khr om „Marktplat z , Men schenm enge“
. B i rm an . kap „verh in dert , flach an
einanderlegen“
,kwop „b inden “
, khyap „nähen“. krim „zusamm en
treffen “. S iam es. kdb „
m it , zusammen “
, köb „ si c h vermi s chen ,
üb erein s t immen“
, k’öb „si c h m it Jmd. verb inden , Jmd. treffen “
, ké'
b
„samm eln “
, kib „falten “
, h’ueb „falten ,
drehen , an häufen “
; [k’äb, k
’éb
‚ eng, k’
röb „ganz , voll s tand i g“
[vollen det], hdb s chließen ,
falten“
, hob „ samm e ln , zu samm enpaokeu“
. k'
ém „m is chen , ge
m is c h t“ , kröm A b te i lung,Truppe“
, kZém em L och zu stopfen ,b efes t igen , mis chen“
; höm „begle i ten“.
b ) P a la t al -A n la u t . ((F g"
A u s t r i s c h . M. bc'
ap „verb inden“
, c'
her'
z-c'
ap „zngehorig“
, Khm .
gab „anhaften , fes t , soli de“
, B . kög'
äp , S . g'
äp „ solide“
; N ik. hü
a'
dp „m it Ket ten festb in den “
; B . g'
ap „v erb in den“
,K hasi pyr
g'
ap „S trauß , Traub e“. Khm . g
’
ii „Umfang, V erein igung“
, S .
g'
am „Umgeb ung“
, S an t. g'
am „b egle iten , samm eln“
, g'
ama-g'
am i
„zusarnm en“
; S an t . g'
amao „fr ieren ,diokflüssig w erden “
[gain
I n do c h in e s is c h .
_
C hines . c’ap . sip hip ., k’ip .) (226)
„ samm eln, . n ehmen “
, tsap. (1 1454) „gem i s ch t“ (S c h i) ; c' ip . (1 798)
E ine m c rkw u rdigc Bez iehung zw ischen den au st r . und den ideh . Sprachen 495lestb inden , verb inden , S t r i ck (S c h i ) , öip > -äip ., (up. (560) „
in
H aufen , in S c hw ärm en“
(S c h i) , tsip. (906 , B i l d) „sic h v e r sam
m cln ,vo l len de t se in “
(S o h n III , IV, V , S c h i) , ts’
1
'
p . (1094) „ge
samm e l t , fa l ten “
(S c h i) . .ts’
a-m (1 1 51 8) „gesamm e l t , geordne t
se in“
(S o h n) , „Dre izah l “ (of. .sam (9552) .is
'
iem (1 7 1 3)
„a l le , insgesam t“ (S oh u II) , [.Ecm , .t’
iem , tsam’
(1 1 653)
T ibet . -
pa,-
pd „übe rein s timm en
“,Fam -
pod „S t rauß,H an dvoll B lum en “
, (1)dzom(s-pa „zusamm en komm en
“,
-
pa
„übereins timm en
“
, thsom-
pa „Bundel , Bus ch [<z)thsem -
pa
B i rm an . Kap „v erb inden ,
vorein igen“
.
*Iz’zun „
zusamm enkomm en “
, (um „vo l l s tän di g sein “
. S iam os . chäb ent3prechen ,
zusamm enfa ssen“
, dell) „fa l ten , zusammenro l len “
, ch öb „üb ere in
s t imm en d , gerech t“ [chuéb chém „zu sammcnm ischen “
,
chüm-chüm si c h versamm e ln“
, chüm-nüm V er samm l ung“
[ch’üm
‚in Üb erfluß da
s
A u s t r i s c h . Khasi s'em fin den , t reffen “; M. su im , B . éc
'
im
m it“, S . aéc'
im „ s toßen gegen “
(of. K has i Icyréea-nK has i ia-éom B . s
'
om in E int rach t leb en“
K . sä zut rägl i c h “
, ph .9ä „v ereinigen “
.
I n do c h in e s is c h . Chines . ‘
Svim Bun del“ (T e c h o uäem (1 1 548) „
fes tha l ten , ergre ifen “
(S c h i) . Vgl. sep . (9806) ord
nen , an‘
h äufen (S c h i) , sip i (9963) „ an samm eln , samm eln , or dnen “
,
of. sipi (9959) „zehn , vo l l s tänd ig“
, tsip ., ä’ep . (9962) v o ll, s i ch
versamm e ln“, tsiep . (1480) „
empfangen ,verein igen , si c h treffen“
.
— Tib et . äom-
pa (P . b)äam(s) „zureoh tmach en“, sum
-
pa „zusamm en
b in den , verd i c h ten “
(of. y)sum drei “ vgl . g)seb „H aufen , Menge“
,
g)sob-pa (P. b)sab) ausfüllen , erganzen“. B i rman . simh „
ein .
samm eln“. samh dre i “ ? S iam es. so
'
m an häufen , verein igen ,verb inden , samm e ln“
, söm „en tsprechen d , geeignet “ [sö’m „v er
süm v ersamm eln“. sam dre i “ ? Vgl . söb tr effen ,
finden “, söb „verglei c hen “
[söb „gefa l len , an genehm sip
„zehn “ ?
c) D en t a l (und Z e r e b r a l ) -A n la u t. (t d) .
A u s t r is c h . Khm . kan_
tap „sammeln (B l ät ter) , S an t . Zutap ,
ladap „e inzeln aufsamm e ln “. Kh as i ddp „
vo l l“ , B . ddp „ganz“
.
Khas i dep „b een digen , fü l len“
, thep „füllen , hineins tecken “
,M.
496 A . Con rady
dép „aufspei c hern “,B . thep „ s topfen “
; K has i kydap „einn i s ten “,
K . dap „gegen anlehn en “
, phdäb „n eb en s i c h ans chm iegen “
, M.
srap—
phadap „naher h eranziehen “
. K hasi iam,S . tanz „ samm eln “
,
B . atam , tam „h inzufügen “
,M. ta (Plu r . B . töm „
voll stau »
d ig, a lle“
, atum „zusamm en
“, S . röthum „Traub e“
; N ik. hatöm
hgztgz „versammeln “, töm NW (Büs chel v on Pflanzen) . K hasi
them „in großer An zahl“ , K . thim , S . them „w ach sen , zunehm en “.
S an t . atom „der Re ihe na ch “.
I n do ch in e s is c h . Chin es top . (top , ) (10485) hmzufugen“,
tap ., t’ap . (10497 , Sym bol) „si ch verein igen , Ü bers chwall “ (of.
A u strones.) (S c h i) , tap. (10499) „aufgehäufte E r de“
, t’ap. t ap.
„rei ch l i c h samm eln “, tap . (10507) „gem is c h t , aufe inan der
fo l gend“
; t’iep . (1 1 1 38) „aufe inan derlegen , aufhäufen , verdoppeln ,
fa l ten “. .t
’am (10659) [ „sioh verm eh ren], zunehmen “
(S c h i) ,.t
’z'
em (1 1212) „verm ehren ,
zunehm en“
. Tib et . l)tab-pa „fa l ten ,
zu samm enlegen “, s)deb—
pa „m i s chen , b inden , vere ini gen “
, theb(s
„Folgen rei he“
, tls „vo l l “ . dam „geb unden , fes t“ ; a)dom-
pa
„zu samm enkommen “; s)dom-
pa „b inden , fes tmachen , vers ch l ießen “
(s)dom Inhaltsangab e ; tham-
pa , them (-pa) , l) tam-
pa,
g)tam(s)-pa „v oll “ [tham(s-öad a)dum
-
pa „ s i c h versöhnen “
(Trs . s)dam -
pa). B i rman . thap „aufeinan derlegen , verm eh ren ‘“
tap „zusammenb inden , thap „einw i ckeln ,verb inden“
;
thumb „verknoten “. S iam es. [ddp (L ehnw ?) „S er ie , ordnenj
“
,
t’öb „fa l ten , ro l len “
, t’
it’
b d i ch t , d ick“ tém vo ll,gan z, sehr “ ,
them , to’
m „h inzufugen“, tho
’
m „auffullen , „rei c h l i ch , m ehren“
;
iam „gem äß, fo l gen “, dam „ säum en , verb in den “
, dam „w eb en “
, of.
P a i dam „Kn ospe“
.
Vgl. hierzu die S ippe „r u n d , r o l len “
.
A u s t r is ch . S an t . patent „ rund h er umvvickeln,b edecken “
,
latum „zu e iner Kugel rollen und in den Mun d s tecken “, Khm .
ph _
ia „zu e inem Ba ll rollen“
, ta „S tü ck, Küge l chen“. B . lem ,
Zum rollen“.
I n do c h in e s is c h . Chin es. .t’
aan (121 52) „run d ,rollen“
; Juan (.lün) „run d , kuge l ig“
, lan (7476) Tib et .dum-
pa „run d“
, s)dom -
pa „Ba ll
,Kugel“ , z)lumpa „
rund, sammeln “.
1) A n al . -n w ohl du rch D iss im ilat ion au s -m ; Ch in es . duldet ke in -m
h inter —u .
498 A . Com edy
A u st r i s c h . B . höiam „samm eln , aufhaufen “
, S an t . yayam„b eendi gen , das G esam te“
.
I n do c h in e si s c h . Ch ines . ‘
yem (1 3052) „ganzlioh“
(S oh n V )
alt-südchines.
‘
yem (1 3057) „zu samm en “, F a n g —
yen 3, yim
(1 321 3) „Keller , A ufb ewahrungsor t“ , of. .yung (1 3224 , aus yim
’
)
„E i skeller “ (S c h i) oder b e i des zu „dunkel“ ? S iam os . hj ömA nsamm l un g“
II . A u s la u t —t.
1 ) „R e ib en , p r e s s en , zw i c k en “u . dgl.
a) G u t t u r a l-A n la u t . (Au ) .
A u s t r i s c h . S . kiet, Khm . n iafz-dylchiat „ju cken “
, of. B . kae'
,
kai„kratzen “
,Kb. kaid „
Klaue, K ra lle “, N ik. s
'
akaé-kgato „m it
den Nagel zw i cken “, S an t . p iskz
'
é „m it den Daum ennägeln ent
fe rnen “. Khm . kiet „
kni r s chen “, safzkiet „Zähnekn ir s chen “
, N .
Ä'
igzt-éakä „kn i r s chen “
; M. kit, Mal. , J avan . yigit (Nbf. gét, ged) ,
Mad. kekiträ, Meta mt (Nbf. gét, ged) „be ißen “.
I n do c h in e s i s c h . Chines . k’
t'
at Mat . kratzen “,
lt’iat ., kiat ., kuat ., Zap. (j . kat . 6070) „
kra tzen , s chab en “
, kiet . (1489 )
„abkratzen , b ür s ten “, kiet . (1466) „
m it den K rallen fassen “(S c h i) ,
kuat . (6267 ) kra tzen ,s chab en , re ib en , _
b ürsten “
, kiuet. (521 1 )
„ re ib en “; Mat . (6342) kra tzen “
. 7'
ziet. (aus*
git, get) (8295)
„b eißen , nagen “, kiu et . (3219) zerb eißen “
, hiat . „T on
des Knir s c hen s“ ; kuat . „T on des Nagen s“ , hat . (3988)
„nagen “
. B i rm an . khraö „kratzen “
, kr it „zerquets chen , zer
m ah l en “. S iam es. khöt kra tzen , s chab en “
, küct „Metall po
lieren “
, keit „b eißen “.
b ) P a la t a l-A n la u t . (ö 3‘ [s
A u st r is c h . B . s'
a t, Khm .
_
(jüt, S . j a t , M. y'
üt, S an t. g'
ot
„w egw i s chen “
. Mal. (W u l ff ZDMG 62, 6 79) kesu t, esa t (u . ähnl .)
„üb er e ine F lache hin schieb en ,vers chieb en “
, hinsu t „auf dem
H in ter s ten vorw är t s rut s chen “, sotsot „
reib en , s cheuern “
, rosat
„hernn t ergleiten“, szj at „
in d ünne S treifen s chneiden , zerre ißen “,
kés(s)et, bes(s)et „ab s t reifen , reib en “.
I n do c h i n e s i sch . Chines . äuat . (10099) reib en , b urs ten ,fegen “
(T s o h o n - li) , su t ., sa i’
, sao’
(9596, S ym bol) „Besen “
, siu et.
(4853) „w egkehren , w egw i s chen“
, sat . (1 12 -MO) „reib en , mahlen“
,
E ine m erkw urdige Bez iehung zw ischen den austr . und den ideh. Sprachen 499-‘
at . (1 1 47 7) „ re iben , w i sc hen“
, s iet . (4369 ) „zerre iben , ger ing
ach t en “
(S o h n V , S c h i) , siet. (4365) „ reib en , w i s chen “. T ibe t .
Sau l-pa (Perf. äud-pa „re ib en “
; zed „Bürs te“. B i rman .
sa t „w i s c hen , e in reib en“
, Eat „Pinse l . S iames. chüt „ kratzen ,
rei ben“
,Fhét „w i s c hen , abw i s c hen “
, stät „berü hren , reiben “.
(S ippe „a b s c h n e i d en ,
t ö t e n “
)A u s t r is c h . Khm . ée
'
t, B . dot „ab s c hne i den “
,M. gaéa t „ to ten“
,
khyat „ s terben“
, S . éöt „ s terb en“
, g'
é t „b een digt“ , B . Zröc'
z'
t „ s terben“
,
S an t . muéqzt , muéet „endigen , aufh ö ren“
, oäet „ t o ten , üb e rw inden‘.
I n do c h in e s isch . Chine s . E’
tt . „ab s chne i den “(wo
zu feet. [8283] äot . (1 1 31 2) „w egsc hnei den “
,tsiuet.
(3213) „ab s c hnei den , t ö ten “
(S o h n III , IV ,V , S c h i) ; Cat . (78
Get . „jung s terb en“
, kiüt. „tot , s ta r r“ (vgl. kinet .
[321 9, S oh n I l], kat . [6055 ; S oh n V] „ab s chneiden) , sat . (9632)„ t ö ten “
(S o h n II , III , V , S c h i) , tsa t . (1 1833, S ymb . ) „ s terb en ,en den“
(S oh n II , V , S c h i) . Tib et . g)c“ od-pa (P . g)äad ) „ab
s chne i den , tö ten “
,(1)ä
’
ad-pa „zers chn i t ten w e rden“
,ö
’
od-pa „ab ge
s c hn i t ten w er den“
, g)sod-
pa „t ö ten“
. B i rman . sat „endigen ,
t ö ten“. S iam es. sé t „es i s t zu Ende“
süt „äußers t , En de“
('fi '
7
A u s t r i s ch . B . riet, niet „pressen , que ts c hen“
, J avan . pe”
fiet,
pé-net „ drücken , pressen “
,Khm . éafe
’z'
et, S .
-aiet „eng, gedrängt“ ;Kha c 7
‘ iat-byniat „m it den Zähn en kn ir s chen“.
I n do c h i n e s i s c h . Chines . fact. (mundar tl. nyp.,8262)
‚m it den Fingern zw i cken , pressen , kneten“
, feet. (8282) „B e
drängn i s“ (S oh n IV , S c h i) , nat. (8 109) „fes t n iederdrü cken“
; yat.
(64 + 8) dass. ; yet. (12980) „ers t i cken“
(S c h i) ; mit., ött .
„m it den Zähnen knirs ch en“. Tib et . m)fied-pa „
zw i sc hen den
H änden und Füßen re ib en , gerb en “
; ßen , g)a”
zen , fie „ V erwan d ter“ ,bs)üe
-
n-pa „s i ch nähern“. S iam es. m
‘
wt „kne ten , mass ieren“.
c) D en t al und Z e r eb r a l-A n la u t . (t d
A u st r isc h . S . tit „pressen , s chnü ren“
, Khm . tit „b eruhren ,
fes t anliegen“
, pr olit „eng s chnüren“
, S an t . gotet „b erüh ren“
, betet
„ärgern“
, B . diet , S . Icoldz'
et „pressen“
, M. diät „zu Pulver zer
rieb en “.
I n do c h in e si s c h . Chines . tiet., ti’ (75 + 7) m it den F ingerspi tzen nehm en , mit b eiden Händen heft ig anpacken “
, ttet. (1 1 1 1 6)
500_
A . Conradyangreifen ,
anfal len “
, tsit. (aus*dit) (9 18) „Bedrangn is, Kran k
hei t, zorn ig sein , eifr ig“
(S oh n , S c h i) , tot. (11 320) „ enger W eg“
.
ts’
iet . ts’a t . „ reib en“
, siet . (sinioo-annam . tiet) (4365) dass ,
sa t . (1 12 1 0) dass . Tib et . gi)dea-pa „ t reib en , verfolgen“
, a)drad
pa „re ib en , fe ilen“ B i rm an . thit „Fußblo ck (zurS iam es. tit „fes thalten an , verb unden sein“
(l' v
A u s t r is c h . Khm . Ziet „le i c h t M. kalit „glat t“ ,
K ha Zit „ s c här fen , w e tzen“
, Mal. J av ., S und. ka lit, Mad. haditrä;
son s t kalt, w eZi, w ili „F e ll“ ; Kha trad „kra tzen , s chramm en“
,
khrüd radieren “
, K . dik kr a t „ seh r ätzen des W asser“ , S . sörat
„ b eißen d , ätzen d “
; J av . , Mal. karu t‚ Bnl. S ea , Tond. ke'
r ot,Day.
gar t „kratzen , schrammen“
.
I n do c h in e s is c h . Chines . lit . (697 7) „etwas m it der Hand
glat ten“
, Zi“
(alt* Zit., 6885 , S ymb .) s charf“ (S oh n V ) ; Zot. ,
Ziet. (7095) m it der Han d ab s tre ifen (Blät ter , am Z weig en tlang) ,h er au sreib en , auskernen “
(S c h i) , Ziet. (6990) dass , la t. (64 +
dem fo l gen den) dass , ya t. (1 3644 , B ild) „S ch reibgr iffe l (zum E inkratzen der lat . (6656) „
zerrei ben“
[lat. (6655) „zer ren ,re iben , lat. (6659) „
b e ißen d (v. Birm an .
7-it „ras ieren , m ahen “
. S iam es. r iet „m el ken , reib en , e inreiben“
.
d) L a b i a l-A n la-
u t . (p m
A u s t r is c h . B . bet „h in einsteoken , dur c hb oh ren“
,B . hat „
in“,
S . ha t ein tau chen S an t. bit „pflanzen , h ineins tecken “
,
rehet „hin ein s tecken“
, J av . Zébét „ hineingehen , un ter tanoh en“
.
I n do c h inesi s c h . Chines. pit . pit ., p’
it . (8926)
„ s techen ,dur chb ohren“
. m iet. (7874) „auslös chen , un ter tauc hen“
(Y i h) . mu t., mat. (801 5 , Symb .) „nach etwas tau chen“
, ma t.
(801 6) im W asser v ers inken , vers chw in den , s terb en“
(S c h i) , mut.,ha t. dass . Tib et. (l)bt td-pü „vers c hw inden , for tgehen ,n i ch t m eh r zu sehen se in“ (of. a)byid-pa „gle i ten , en tgle i ten ,
ver
S iam es. müt „im S c h lamm vers inken “
, möt
s terb en“.
A u s t r is c h . Khm . piet „reib en , pre ssen“
,B . pit „auf etwas
drucken “
,J av . pip it, m ipit „drü cken , pressen auf“, F idji bita
„d rü cken auf“
I nd o c h in e s i s c h . Chines . p ’
iet ., p iet. (9 164) „reib en , ab
502 A . Con rady
I n do c h in e s isc h . Ch ines . kuat ., kuot . (6288) „b inden , zu
b inden ; angeb un den“
(Y i h , S oh n IV ) : huot., huat. (dass ) srchv erb in den ,
si ch vereinigen“
(S c h i) ; ka t. (6238) b inden , kno ten“
(kiet . [ 1470] -ka t . (hat ., k’inet .
kiet . (1470) b inden , umb inden , knupfen“
(S oh n V,
S c h i) ; haat., huat . (501 6) Kn eb el, kneb eln“
, h ieß , hiet . (1493)
„Bündel , b inden “
, ha t. (3986) „Bun del“ . Tibet . a)khyud-pa
umarm en“
, s)kud-pa „Faden , Drah t“ , r )gyud „Faden , S chnur“ ,r )yyud-pa „auf an rei hen “
, br )gyad „F am ilie“. B i rman . khyaä
d i ch t flechten“. S iam es. khöt „b indeu
“
, k’
cit „gür ten , umgeb en“.
b ) P a la t a l -A n l a u t. (c'
g'
A u s t r is c h . Khm . g'
uot „gur ten“
; S ant . kag’
ot „ Einkerkerung“.
I n do c h in e s is c h . C hines . öot . Symb .) v erb inden ,verb un den“
, öot ., äu i’
(120 + d. vor . ; 2814) „zusamm enb in den ;
verb unden se in mit“ (N gi-li ; S oh n V , S c h i) ; s'
a t ., litt. (7533)
(Bamb us éut. S tr i ck“ Tib et . g)äud—
pa ,
Z)öud-pa drehen , flechten“
, éud-pa „zw i s ten, zw i rnen“
e) D en t al - A n la u t .A u s t r is c h . Mal. , J av ., S un d . , Bat , Day. Zilit, Mad. Ziliträ °
gewun den “
, A lt Neujav . w ilét „verw i ckelt“ , Bul. w eh t „Drah t“
,
B is. bilit „um säumen“
; B . Zit „verw i rrt se in“
, N . Zi mt-na „v er
w i ckelt“I n do ch in e s i sc h . Chines . Ziet., lit. (6990, phone t . E lem .
au ch Za t, Züt) w inden , drehen“, litt . Symb .) S t ri ck“
la t., s“
u t . s . B i rman . moat „ein doppeltes S eil“ (of. rwansrc h in W indungen bew egen“
, Iwan „fleohten“: chines . .Zan [ 7472]
s10 l1
c) L a b i a l -A n l a u t . (pA u s t r i s c h . Mal. , J av . ramhu t, Mad. ramba „Haare, Be
haarung“
, Bat . ramba t, F idji w hat-aka „ si c h vers tr icken“
, rabo
„S tr i ck“
, Day. rambo „Fad en“
,Baj ., Mak. ramba ti „Haargew eb e
“;
Khm . bat „ro llen , hin und her drehen “
, M. ha t „drehen“
, S . bot
„rollen , fallen ; si c h hin und herd rehen“
; B . höhnt „W irb elwin d“
,
Mal. , S und., J av . r ibu t „S turm , U ngew i tter“.
I n do ch in e s is c h . Chines . fat . (alt *
pat ., phon et . E lem au ch “
-u t) „Kopfhaar (S c h u V , S c h i) , pot., puat. (8528) Be in haare“
;
f a t . (alt*
put ., 3699) „S chnur , S eil“ , fa t . (*put ; 3622) „S e il“ (S c h i) ,
E ine m erkw ü rd ige Beziehung zw ischen den au st r . und den ideh . Sprachen 503
fa t . 3500) „S ei l zum S argziohen “
(T s c h e u - l i) ; pot ., puat .(9 365) „herum dr ehen , um d rehen“
(S c h i ) , pot„ puat. (8527 ) „um
keh ren , si c h um d rehen , en tw urze ln“
(S oh n V , S c h i) , pu t.in Z ss. „gerol l t“ , pot., pu t. (9422) in Z ss., „
he rum d rehen“
; .p’
iao ,
.piao (9 1 33, alt woh l *bot, *pot, phonet . E l em .-t in p’
iet .
„ H aa r“ , vgl . .p iao, p’
iao’
, .peu ([alt*
pot . ; 1 90 , S ymb .] „langes
weh endes „W i rb e lw in d“
(S c h i) , pu t. Win d “
[put. (9358) aufwirb e lnder S taub “
, pu t. „au fw i rb e lnder
I ch glaub e, d ieser Befun d spr i c h t fur s i c h sel bs t. Das i s tkeine zufällige A hnliohkeit , n i c ht s von außen H ereinge tragenes ,ja au c h ke in e b loß grund sätzl i c he Ü b ereins timm ung m ehr : d iesedur chgre ifen de , von Lau t zu Lau t gehende und oft geradezu v er .
b lüffend genaue E n t sprechung , die in i h rem glei chförm igen Dah inziehen dur ch die Begriflskategorien un d die A nlau tklassen üb erd ies e twas G ese tzm äßiges hat , sie kann m . E . nur als l e x ika l i s ob o V e rw an d t s c h a ft , um n i c h t zu sagen I d en t i t ä t b eze i c hn e t w er den .
U nd dam i t gera t denn freilich die b i sherige E in tei l ung ganzb edenkli ch ins S ehw anken . Denn es folgt daraus doch , s che in tm ir , zum m indesten , daß den zw e i Fam ilien von U r väter tagen
h er (w ie das Chin es is c he leh r t) e ine g em e i n s am e U n t e rs c h i c h t zugrun de liegt , und zwar , um das gl ei c h h inzuzufügen ,eine U nter schioht v on großer Mäch t igkei t , da sich d iese S ippenw en igs tens im Chinesi s chen nac h dem Z eugn i s nam en t l i c h se inerphonet i s chem E lem en te t ief in den ganzen W or ts cha tz h inein ver
zweigen w ie s i c h d enn üb r i gens im Laufe der Un tersu c hungso n eb enher au ch noch e ine ganze R e ih e an derer W or tglei chungene inges tell t hat .
O der dürfte m an wohl gar noch e inen S chr i t t w eitergehn ?D enn nunmeh r rü cken ja au c h jene e ingangs b esprochnen E rsch einungen in ein n eues L i ch t : aus ein er m ögl i c hen S chw äc hungder alten w erden sie zu einer en t sch iedenen V ers tärkung derneuen Pos i tion , ind em sie dieser lex ikali s c hen auc h noch die
grammat i s che und syntak t i s che Üb erein s t imm ung , der G le i c h hei tder äußern die der inn eren F orm gesel len. Da i s t es doc h vie l
504 A . Con rady, E ine m erkwürdige Bez iehung u sw .
le i c h t n i ch t allzu kuhn , an e ine w i rkl i c he U r v e rw a n dt s c h a ftzu denken .
A b er das m ag b is zu genauerer Un tersu chung dahingeste l l tb le iben , und eb enso m öcht e i c h auf zw e i w e i tere F o l gerungen , die
s i c h spezie ll fur das A u str ische aus alledem zu ergeb en s cheinen :daß es si c h näm lich b ei jenen A uslau ten n i ch t um eine (üb r igensau c h dur ch das Herein ragen von S challnachahmm gen unwahrscheinliche) S uffi x noc h b ei den A nlauten um Präfixb ildungen ,
son dern nach A uswei s der ch ines . Phonetica und der i deh . T on
akzen te um e infachen W andel und W echsel stammhafter Laut ehan del t , und daß ferner das Chinesi s c he kraft dieser zwe i s tarkenHülfsm ittel künftig ein e große m e thod is che Bedeutung, ja ge
w isserm aßen die Rolle e ines S chiedsr i c h ters für das A ustr ischegew innen dürfte auf diese m ö ch te ich h ier nur eb en leise hindeu ten . Die F ern s i c h t , die s i ch er öffnet hat , is t ja au ch ohn ed ies s chon so s chw in de ln d w ei t daß man i hr fast m it Zagengegenüb ers teh t .
506 Lucian und Christine S cherman
sei zum zw e i ten Punkt e iniges gesagt, über den die Literatur zurVo l k skunde der Kach in, die durchaus n i cht spär l i ch b emessen ist,b isher zu ach tlos hinw eggeglitten ist. Der S tand der Webkun sti s t in ganz Birma beachtensw ert hoch ; die typis chen Gew eb e derBirmanen und S han s ind b ekann t und geschätzt . Aber neben
i hnen fert igen draußen im „Ds chunge l “ Wa
,Taungyo, Karen und
andere in s t i l ler Abge legenhei t hausende Gruppen m it oft rühr ende infachem Webgerät Kle i dungsstücke in einer Vol lendung, die
techn i s ch und äs thet isc h uns Achtung abzw ingt. Bei ke inem diesersog. halbzivilisier ten S tämm e ab er entfa l tet die Fran am Web stuh le in e so l che S umm e v on F leiß , Gesch i ck l i chke i t und Phan tasie, w iesie auf die re i ch ornamentierte Kachingew andung verw endet w ir d .
Der Zensus v on 1 9 1 1 bezifler t die Kach in in Birm a auf über1 60 000 ; e ine noch größere Zah l i s t für den auf unverw altetem
und auf ch inesis chem Geb iet w ohnenden Vo l ks tei l zu rechnen.
In der F rage nach der ältesten erkundbaren Heimat treffen e igeneÜber l ieferungen der Kach in und a l l gem eine e thno logische Erw ägungen zusamm en ; man w ir d h ierfür nach dem östl i chen Assamund der sndöstlichen Grenzecke des zerkl üfteten tibetis chen Hochlandes
,dem Geb iete der Irraw addyquellflüsse zu b l i cken hab en
Vor zw e i bis dre i Jahrhunderten m ögen ihre Wanderungen nachS üden begonnen haben
,die sie in zume is t fe ind l i che Berührung
mi t S han und anderen S tämmen am obern Irraw addy b rachten .
Am Westufer des Mälihka-Irraw addy vordringend, w arfen sie s i chzu Herren der Hkam ti-S han auf
,ergr iffen Bes i tz vom Hukongtal
und taten das i hrige,um die Res te des e ins t so b l ühenden A hom
re i ches in Assam zu vern i chten . Die w e iter sü dw ärts ziehendenKach in finden s i ch einer gesch lossenen Masse von S han und Bir
manen gegenüber , die sie zw ingt, in der Gegend des heu tigen
My i tky ina den I rraw addy zu übers ch reiten . Von da ab fol gen
O . Han s e n ,T h e Kach ins (Rangoon 1 9 13) p. 1 6 11 . mein t, daß sie in
diesen Wohnsi tzen e ine Reihe von Jahrhunderten geb lieben se ien, nachdemsie die t ibeto b i rman ische S tammesheim at (zw ischen dem östl ichen Tibet undw estlichen S süch‘
uan , vgl. schon E . K u h n ,Herkun ft 11 . Sprache der trans
gaugetischen V ö lker (München 1883) p. 4 — 6) v erlassen hatten . Das w e i tereVordringen nach Süden erm ögl ichte ihnen erst der N iedergang der S hanmach tin A ssam und Y iinnan ; s . auch L . W. S h ak e spe a r , History of Upper A ssam(Land. 1 914) p. 1 63, 1 72.
c 1nus ter de r bir 1nanischen Kach in , ihre Namen usw .
sie den Be rgzllgen am O stu fe r des S trom es , w obe i sie den Pa laungund den ande ren dort ansässigen S tämmen ge fäh r l ich w erden .
G röße re Massen s iede ln s ic h im Hllgellnnd um Bhamo an,w o sie
m it den ch ines is chen G renzprovinzen F llhlung gew innen . S o dehnens ich s ch l ießl ic h , da e inze lne G ruppen am Ober lauf des lr raw addyzur tickgeb lieben s ind , die Wohns i tze der Kach in i so l ierte Geme inden in den süd l ic hen S hanstaa ten m it e ingerechne t vom
29 . bis fast zum 20. G rad nö rd l icher Brei te, und schon d iesegeographische Verte i l ung ma cht es verständ l ich
,w ie das F or t
sch rei ten nach S üden die Anähnlichung an höhe re Ku l turen be
günstigt, zugle i ch aber die e thnographische S onders te l l ung si chm ehr und m ehr verflii ohtigeu läßt .
Den fo l genden Da r legungen l iegen fas t ausschl ießl ic h die
S amm l ungen fü r das Kgl. E thnographisché Museum in Münchenzugrunde , die im Jah re 1 9 1 1 in den Dö rfern am oberen Chindw inund e inige Monate später im Di strikt Bharno sow ie in den nörd
l i chen S haustaaten erw orben w u rden . Der Kü rze ha lbe r m ögendie Chindw in—Kach in als w es t l i che
,die übr igen als östl i c he benann t
w erden ) ln der Kl ei dung sow oh l , w ie im S ti l der Webmus te rbesteht zw i s chen be i den e ine deutl i c he S che idung (vgl. Abb . 1
Dabe i i s t v on der Männerkle idung fre i l ich so gut w ie ganz ab
zusehen . Diese hat s i c h fast übe ral l l ängst der umgebenden S hanbev ö lke rung angepaßt ; w ieder sehen w ir die Rege l bestätigt, daßdie F rauen tracht ungl e ic h zähe r ihre Eigena rt bew ah rt .
Der S to l z der ö s t l i c h e n Kachinfrauen (Abb . 1 u . 2) i s t derRock (ldbu) , ein aus d re i Webebahnen zusammengesetztes S tückS toß" v on m Bre i te und 111 Länge, der um
den Leib be fes tigt und se i t l i c h übere inander gesteckt w i rd ; eineAnzah l loser Robrreife (hang) w erden als Hüftenringe darüber geschoben . S e l ten s ieht man j e tzt noch die aus rohw eißem Garngew eb ten Röcke (nhpraw nba ‘
w eiße die früher auch dieMänner trugen ; sie s ind nur an den se i tl i chen Enden m it O rnam enten in s chw arz und kupferrot du rchw eb t. Vere inze l t w erdenauch Röcke aus rot und s chw arz gest rei ftem Gew ebe getragen.
Diese S cheidnng w i rd auch sprachl ich e ingehal ten, vgl. B . K uh n ,
Die Sprache der S ingpho oder Ka-khyen , F estschr ift Bast ian (Berl in 1896)
p. 359 f. ; H . J . W eh r l i , Be itrag zur E thno logie der Ch ingpaw (Kach in) v onOberburma, Int . A rch . f . E th nogr .
,Suppl . zu Bd. 1 6 (L eiden 1 904) p. 66 .
33 *
5 08 Luc ian und Ch : ist ine S cherman
We itaus die geb räu ch l i chste F arbe i s t ein dunk l es , zuw ei l en fas ts chw arzes Indigob lau , in Abs tänden v on etw a 6 cm m it j e zw e ife inen h el l b lauen Lin ien du rchzogen. S ol che Gew änder he ißenmähtat aba ‘Indigodecken
’
. Die A lltagsröcke hab en nur an den
S ei ten rote Ornam en te, b ei den bessern Röcken aber s ind außerdem noch die S e i ten und au ch der un tere Rockrand, oft bis zu
zw ei Dr i tteln der Höhe,m it e iner F ü l l e von Mustern in den leb
haftesten F arben bedeckt . Die einfarb ig roten oder b lauen Randstrei fen en tstehen dadu rch , daß der rote, bzw . b laue S chußfadend ich t und in loser Spannung zw i s chen Gruppen v on mehrerens chw arzb lauen Kettfäden durchge füh r t w ird , so daß v on diesenn i chts m ehr s ich tbar ist ; die Web erinnen gebrau chen h ierfü r denA usd ruck haj ii und m e inen dam i t das „
Endmuster des Rockes “(of. Hanson
l) Ebenso nur aus S chuß und Kette gew eb t
i s t das zw is chen den Randstrei fen eingesetzte Musterband aus
e iner oder m ehreren Re ihen ine inander geschach te l ter Bauten
(s . un ten p. 5 1 1 Fig. das si ch au ch bei den Umhängetaschenv ers ch iedener S tämm e in dem oberen glatten Rand der Taschefindet. Der Nam e ist kann ‘Mutter ’ , figürlich auch ‘Hauptgrund ,Hauptpr inzip’
. Das bedeutet a l so sovie l w ie
l ei tendes Grundmuster des betreffen den S tü ckes ; bei Tas chenSpr i cht man v on tingsan küh n (tingsan Es ist j edenfa l l s dasjen ige Muster , das selbt den e in fachsten Röcken n i ch tfeh l t. Nur vere inzel t fanden w ir dafür in den Kachinb ergen um
Bham o bei s chw arz und rot gestreiften Röcken e inen S trei fen, derm it se inen m äandr i schen Haken und den dazw is chen gesetztene ckigen Linienbruohstücken als Abs chni tt eines F l ächenmustersersche in t und pägang kann. ‘hauptsäch l i che gestre i fte S ti ckerei ’
1) Mit
‘Hanson ’ ist z i tiert : O . Han s e n , A d ic tionary of the Kach inlanguage (Rangoon Der hier befo lgten Um schrift die Kach inhatten nie e ine eigene S chri ft sind unsere sprachl ichen Notizen h ngepaßt
w erden (also Icy usw . für Palatale, A spirat ionsbezeichnung durch v o r gesetztesh
, aw für ri) , w obei k leinere U ntersch iede in der Vokal i sation , in den Präfix
s i lben n und m,im W echsel v on Media und T ennis u sw . ausgegl ichen w urden .
Herrn Dr . Hansen, der s ich als Mi tgl ied der American Baptist M iss ionum die Vo lkskunde der Kach in hochverdient gemacht hat , sei auch an dieserS tel le herzlicher Dank für die in Namhkam erw iesene Gastfreundschaft undfür m ann i gfache F örderung ausgesprochen .
2) Hansen 257 gib t kann als ‘
a pattern of carv ing er emb ro idery’
an.
Lucian und Christine S cherman
Mit den F rauenrocken w ette i fern in F arbenpracht und Re ichhaltigkeit der Wirkmuster die Umhängetaschen , me i s tens tinggan
oder nhpye (vom Hkauriw ort m'
ngfe übernommen) genannt, die v on
b eiden Ges ch lech tern über die l inke S chu lter gehängt w erden(Abb . 1 l inks) ; sie en tsprechen in der F orm den S hautaschen und s indaus 1 2— 1 5 cm bre i ten S toffstrei fen zusammengesetzt, v on denenein kur zer das Mittel s tü ck , ein langer S ei tentei le und Tragband b i l det (Abb . Beim Wehen d ieser S tofi‘
streifen w irdb ere its in der Anordnung der O rnamen te auf die Gesam tw irkungb e im Zus amm en setzen Rü cks i cht genomm en ; der Träger b le ib tglatt
,zuw e i len i st er m it einze lnen S treum ustern durchw i rkt ; die
Enden an be iden S e i ten haben en tw eder F ransen oder Verzierungenaus Grassam en‘
(hlcitra Coix Lacryma) . Die jungen Bu rschen habenan ihren Taschen oft ganze Bünde l v on besonders rei ch und feingew eb ten h ansenbesetzten S chärpen (hpaj et) angeknüpft (Abb .
das s ind etw a w ie unsere Gu itarrenbänder Lieb esze i chenv on zarter Hand
,die m it S to l z getragen w erden . Auch viereckige
und langlich e Tüch lein (ebenfa l l s hpaj et genann t) zum Einw i cke lnv on Betelbüchsen u . dgl . , me i st hellgrundig, s ind rot und s chw arzdu rchw i rk t oder bes ti ck t.
Das Materia l der Gew eb e i st nur zum Te i l noch einhe im i scheselbst gesponnene Baumw o l le, es w i rd s chon sehr vie l fe ines
,im
Bazar gekauftes Garn verw endet. Ebenso i s t es b ei den b unteneingew irkten Musterfäden ; die e inh eim i s chen derben kupferroten ,s chw arzen und b lauen F arben w erden überschrieen von den
leuchtenden Anilintönen der eu ropäischen Wo l l und Baumw oll
ga me .
Das Webgerät der Kachinfrau is t hochst dü r ftig ; es bestehtaus e inem B ünde l Bam busstäbe, auf das die Kette aufgeroll t is t,et l i chen S chlingstäben zum Heben der Kettfaden für das Grun dgew ebe, e inem großen Ho l zmesser zum F ests ch lagen der S chußfäden und einem e in fachen S chiflchen ; d ieses i st m ei stens nur ein
an be i den Enden gab e l förm ig ausges chn i ttenes Hol zstü ck . Der
ganze Apparat w ird auf der e inen S ei te an einem Pfosten be
festigt,am anderen Ende w i rd ein Gürte l aus Kuh oder Büffe l
haut an die Enden des Bamb usstab es gehängt, auf den s i ch dasfertige Gew ebe au frol l t ; den Gürte l legt s i ch die Weberin rückw är ts um die Hüften
,und so häl t sie
,an der Erde s i tzend und die
W ebmuster der b irmauisch en Kach in , ihre Namen usw . 5 1 1
1 — 32 Kach in-Muster, 33— 35 Shaw-Muster .
5 1 2 Luc ian und Christ ine S cherman
F üße gegen ein im Boden b efestigtes Brett oder Bambu srohr gespreizt, den Apparat in Spannung. F iir die bun ten Wirkmusterw ird jeder Kettfaden m it der l inken Hand gehoben und m it den
F ingern der rechten der ganz kurze farb ige F aden durchgezogen ;die Musterse i te is t nach un ten gekehrt, und nach jeder gemuster tenReihe fo lgt ein
'
ein farb iger S chuß . In den Kachindörfern am
Chindw in sahen w ir das ebenso au fgespann te, gle i ch ärm l i che Gerätm it einer T rittvorrichtung ausgerüstet, die be im f lachen S i tzen auf
der Erde m it den Zehen b ew egt w urde . Bei den vorw iegendglatten Bockstofien dieser w es tl i chen Kachin l äßt s i ch e ine derartvorges chrittene Mechan ik , die S han und Birmanen an i hrem großenT rittw ebstuhl a l l gemein haben , m it m eh r Nutzen verw enden
,als
bei den dur chw irkten S toffen im Osten .
Al le Web und Wirkmuster der öst l i chen Kach in sind s trenggeome tr i s ch ; e infache und mäandr is che Haken
,Bau ten und Zick
zacklinien s in d die Hauptmot ive . Den mannigfachen Abw andlungsformen hat der Vo l k sm und allerhand Nam en b eige legt
,darunter
m an che recht drastis c he .
Besonders typis ch und verb re i tet s ind fol gende[dpawp hlcgz
'
(F ig. eine s chm a le Bordüre, die sehr haufigverw endet w i rd ; läpawp oder pawp i s t ‘S chnecke ’
,hkya
'
‘Auss chei dung ’
. Geme in t i s t die Wegspur der S chn ecke,kenntl i ch
durch ihr sch le im iges S ekret.pawp [a i und pawp y<m oder pawp hpycm (Fig . 3) s ind Ab
w and l ungen des vor igen Musters : die Verbindunglinie zw i s chenden b e i den Mäanderhaken i s t im Zickz ack verlängert und die
hin tere Häl fte der E inzelfigur s chräg ans teigend über den An fangshaken der nächs tfo lgen den ges choben . Das w i l l
,s chein t es
,auch
der Nam e andeuten : laz' ‘üb ersteigen ’
,
‘überschre i ten ’
, yan oderhpyan
‘ausgedehn t ’ , ‘
ausgero l l t ’ a l so ‘übereinandersteigende oder
ausges treckte S chnecken ’
.
1
)1
) F ig. 2 und 3 ist den w estlichen Kach in ebenso gelaufig, auch den
sudlichen Shan , von denen charakterist ische Gew ebe m it diesem Muster sogarzu den Lo lo in Ssüch
‘uan v erschleppt w orden -s ind (vgl. Herb ert Mu e l l e r ,
Be i träge zu r E thnograph ie der L O10 , Baessler-A rch iv 3 p. 67,F ig. 82a
und b) . F ig. 2 zeigen auch Gewebe der Laotier und S iamesen, die sich als
nächste S tammverwandte auch im kunstgew erb l ichen S ti l den hirmanischen
Shan ansch l ießen . Üb rigens tr ifi t m an Fig. 2 auch auf Taschen aus dem
Kaukasus. (8 . auch unten p .
5 1 4 Luc ian und Christ ine S eherm an
singgaw . Dieses Wor t i st in Hansons Lexikon 5 9 1 als ‘bend, turn.
w ind ing '
neben sz'
ngga w mal-a.
‘a pat tern of emb roi dery ’
aufge füh rt.U nsere Kachininterpreten üb erse tzten das Wort als ‘F lügel
'
und
erklärten, daß b ei der Musterbenennung an die spitzw inkl igeS te l l ung des F lügelpaares bei Käfern , Zikaden usw . gedacht
sei (vgl. Hansen : s-
z'
ngkaw‘Flüge l ’ ; s . auch unten p.
Bei arme singga zc (F ig. 8) haben die angere ih ten Hakenaugenschein l i ch an ein Ackergerät er innert ; ur aw i st e in e zackigeHa cke aus Bamb us . Das gle i che Zickzack , nur e inse itig m it
Haken b esetzt. w e i sen au ch die Rö cke der w es tli ch en Kach in auf;
b em erken sw ert i st. daß die Kach in des Bhamo-Dis tr iktes das Musteral s hlca ku -önälzz beze i chneten d . i . Muster d er Hl°alzku ‘F luß
haupt ’) so w erden die im Nordw esten am Ober lauf des Ir raw add
_v zunächst ihr er alten He im at s i tzenden Kach in genann t.Öfters s che in t b ei der Wah l des Namen s auss chl ießli ch auf
die Bew egung der Hauptl inie Rü cks i ch t genomm en zu sein oderes feh l te vi el le i ch t den Auskunftg ebern eine spezial is ierende Beze i chnun g
,w ie z. B. b ei der Benennung kälztan singgaw (kähtan
‘auf un d n ieder ’) für e ine m it Mäan dern e inse i ti g b esetzte Zick
zacklin ie , sow ie fü r e ine s chm a le Bordüre aus doppe l ten We l lenl in ien m it v erstär kenden Pun kten an den Biegungen .
sh1'
ngna t1) singgaw
‘Web litzen-Zi ckzack ’ i s t ein w e iter er Nam efür das doppe l sei tig m it Mäan dern b esetzte Zickzack
,abe r au ch
für e in e e in fache s chma le Zickzac kl in ie . In bei den Fäl len s chw eb teder Namengeb erin die Re ih e der Fadenschlingen v or m it denensie die Kett fäden zur B i l dung des Faches emporheb t.
Bei shingna t chyai (Hg. 9)‘Weblitzen-L
'
mkreisen’ um randen
die Haken e in e Raute 2), deren Mitte eine S enkrechte ann imm t ;b ei einer gle i chnamigen Var iation stehen die Haken um ein aus
neun Renten zusamm engesetztes F e l d . Zw e i ine inander ges chach te l teRau ten
,deren Innense i ten mit Haken b esetzt s ind
,he ißen shing
w ang mä]:a ‘Reif-Muster ’ .A uch als sc
'
mat not iert ; vgl. Hansen 624 uber die Aussprache v on
shi-ngnat als säna t .
S o lche Rhomben ,maan drische Haken und S vast ika s ind auch dem
Kunstgew erbe des indischen A rchipels w ohlv ertr aut, w as b ei den Beziehungenzwischen malai ischer un d indoch inesischer Kul tur n icht v erwunder l ich ist ;vgl. J. E . J a s pe r en Ma s P ir n ga d i e , De inlandsche kunstnijv erheid in
Keder i . Indie“ III (’s-Grav enhage 1 9 1 6) p. 1 1 1 , 1 1 5 , 248.
“'
ebmusfer der b irmauisch cu Kach in , ih re Namen usw .
F ür F ig . 10 gab en die Kach in den Nam en mülu . m it de r Aus
l egung ‘
uberzogen'
. abs ch l ießende S t i cke re i des le tzte n '
l‘
e l los ' (of.Hansen Man m ein t dam i t w oh l das Übe rziehen e ines E ndstückes m it der Ab s ch luß -S t i ckere i . obw oh l d iese s Muster du rchausn i ch t immer als Ran dborte geb rauch t is t. Auch den w es tl i chenKachin i s t das Moti v v er traut . und in abgew ande l ter F orm e rschein tes auf Laos-Röcken .
E in mit Rau tenmiiandern bese tztes Z ickzackmotiv v e rdanktse inen Nam en luts i singgaw
"T abak ütenzickzack’ j eden fa l l s den
b ei den k le inen , durch e ine S enk rech te ges ch iedenen Bauten , die inden durch die Bewegungen en ts tehenden rau ten fö rm igen Zw is chenräum en s itzen ; lu ts i bedeutet Bl ü te oder S amenkapse l des
Fig . 1 1 Ä‘
alzkum ‘Kürb i s ’ ist ein S treumuster seh r m e rkw ürdigerForm ,
für die s i ch aus der Benennung ke in Anha l t b ietet ; es
m ach t deutl i c h den Eindru ck e ines Musterfragments.
F ig. 1 2. v on den Kach in m it dem S han-Namen m aw l ‘
yä‘Bl ume ’
b e l egt , hat auch in der Form große Verw andts cha ft m it S hanMustern
,w ie sie
'
auf Turban und Um s ch lagtüchern,Rockbesätzen
und S ch la fdecken der Namhkam und ch ines is chen S hanfranen
gebräuch l i ch s ind . Para l le len seien hier in Fig. 33 — 35,Bau ten
m ustern v on T urbantüchern aus Nam hkam,gezeigt ; sie s ind m it
b unter S e i de u nd Gol_
dfäden zw i schen die farb igen E ndstreifen ders chw arzen Tücher e ingew irkt. Auch die S han haben dafür besondere Namen , poeti scher als die der Kach in ; F ig. 34 z. B. he iß tmand.: m ö
‘Bl um e-Lotus ’ , Fig. 35 nam nar i‘Dernen-Kette ’
.
Den S vast ika 2) den F ig. 33 und 34 von den S han an der
ch ines i s chen Grenze zeigt,hab en au ch die Kach in m it großer V or
l ieb e ia Verw endung genomm en ; er tri tt an den Gew eb en unserer1) cf. Hansen 351 lu tsi mäka
‘a kind of embro idery ’
.
2) Die Namhkam -Shan nann ten dieses Hakenkreuz dolai ; in den uns be.
kannten S hant extilien ersch ien es immer in rech tsläufiger R ichtung ; auchLesl ie M i l n e ‚ Shans at home (London 1 9 10) p. 1 70 häl t d iese für die Norm ,
aber auch die umgekehrte Richtung komme b isw e i len v or .
‘
Der Nam e‘Mohn
b lume’
,den sie v on den Namhkam-Shan für das Sv ast ika-Mot iv erh iel t , könn t e
m it dem übere inst immen , den man uns für die zur Verz ierung v on K0pfpelstern v erwendete S tickerei angab , b ei der v ier blätterbesetzte Zw ei ge, v on e inerv ierb lättr igen zentralen Rosette ausgehend, in F orm eines Hakenkreuzes gebogen sind (ci. M i l n e p. m it dem h ierfür v on uns notierten m awk nau m
hkö (Blum e-Schlaf-Pfianze) ist e ine M imese oder aber der Mohn gem eint .Vgl. unten p. 523.
5 1 4 Luc ian und Christ ine S cherman
singgaw . Dieses Wort ist in Hansons Lexikon 5 9 1 a ls ‘bend, turn,w ind ing ’
neben singgaw m äka ‘a pat tern of emb roi dery ’
aufgeführt.U nsere Kachininterpreten übersetzten das Wort als
‘Fl üge l ’ und
erk l ärten,daß b ei der Musterbenennung an die spi tzw inkl ige
S te l l ung des F lugelpaares bei Käfern , Zikaden usw . gedach tsei (vgl. Hansen : singkaw
‘F l üge l ’ ; s . auch unten p.
Bei uraw sz'
nggaw (Fig. 8) haben die angere ih ten Hakenaugen s chein l i ch an ein Ackergerä t erinnert ; ur aw ist eine zackigeHacks aus Bamb us . Das glei che Zickzack , nur einse itig m it
Haken besetzt. w e isen auch die Röcke der w es tl i chen Kach in auf;
b em erkensw ert i st, daß die Kach in des Bhamo-Di s tr iktes das Musterals hkahku -fa dka b eze i chneten, d . i . Muster -der H7cahku ‘F lußhaupt ’ ) so w erden die im Nordw esten am Ober lauf des Irraw addy , zunächst ihrer a l ten Heimat s itzenden Kach in genann t.
Öfters s che int b ei der Wah l des Namen s auss ch l ieß l i ch auf
die Bew egung der Hauptl inie Rücks i cht genomm en zu se in oder
es feh l te viel le ic ht den Auskunftgebern ein e spezia l is ierende Beze i chnun g
,w ie z . B. b ei der Benennung kälztan singgaw (kähtan
‘auf und n ieder’) für e ine m it Mäandern e insei tig b esetzte Zick
zacklin ie,sow ie fü r e ine s chma le Bordüre aus doppe l ten We l len
l in ien mit v erstarkenden Punkten an den Biegungen .
shingna t1
) singgaw‘Web litzen-Zickzack ’ i s t ein w ei terer Nam e
für das doppe l se i tig m it Mäandern besetzte Zickzack , aber au chfü r e ine e in fache s chma le Zickzack l in ie . In be i den Fäl len s chw eb teder Namengeb erin die Reih e der F adensch lingen vor , m it denensie die Kett fäden zur Bi l dung des F aches erriporhebt.
Bei shingna t chye i (Fig. 9)‘Weblitzen-Umkre isen ’ um randen
die Haken e in e Baute 2), deren Mitte e ine S enkrechte ann imm t ;bei e in er gl e i chnam igen Variation s tehen die Haken um ein aus
neun Bauten zusammengesetztes Fe l d . Zw e i ine inander ges chachte l teBauten
,deren Innensei ten m it Haken besetzt s ind
,heißen shing
w cmg mäka‘Re if-Muster ’ .
1) A uch als sänat notiert ; vgl. Hansen 624 über die Aussprache von
shi-ngnat als sä-na t.
2) S olche Rhomben ,
m aandr iseh e Haken und S vastika s ind auch demKunstgew erbe des indischen A rchipels w ohlv ertraut, w as bei den Beziehungenzw ischen m alai ischer un d indochinesischer Kultur n ich t v erwunderl ich ist ;vgl. J . E . J a s pe r en Ma s P ir n gadi e , De inlandsche kunstnijv erheid in
Nederl . Ind ie III (’s-Grav enhage 19 16) p. 1 1 1 , 1 1 5 , 248 .
5 1 6 Luc ian und Christ ine S cherman
S amm l ung vo rw iegend in linkslaufiger Bew egung auf. Die Leutenann ten ihn fas t s tets npau (F ig. w ofü r sie ke inerl e i Erkl ärungzu geb en verm ochten; au ch Hansons Lexikon gib t da ke inen Aufsch luß . Wahrsche in l i ch i st es ke in spez ifi s cher zuma lauch andere kle ine Mot ive, die, w ie zuw ei len der S vastika
,in
irgend e iner gezahn ten oder hakenbesetzten Umrahmung si tzen,
npau kaclzz'
t k le ines npau , npau l.:äw an um randetes ' npau usw .
genann t w e rden . Vere inze l t konnte m an auch andere Benennungendes S vas t ika hören , z. B. shaukaw n
, w om i t der b i rman i sche oderch ines is che T eetopf gemein t i st . Neben shaukawn w i rd für d iesenau ch ngoi gebraucht (Hansen d ieser Ausdruck
,m ägoi ge
Spre chen , w urde von Kach in der Mission Nam hkam e inem viereck ig um rahm ten, ande rw ärts als npau b est imm ten h ufeisen förm igenOrnamen t (F ig. 1 4 ) gegeben und m it
,sw inging pot “ übersetzt
(vgl. dazu Hansen 489 : n —
gei‘a In Namhkam geb rau chten
die Kachin für den S vastika noch den Ausd ruck ldlrä ‘Hammer“sie me inen dam i t den Hahn e iner a l ten Kachinflinte , gedacht inder Bew egung
,w ie er auf die Pulv erpfanne s ch l ägt.
Einesder volkstüm lichsten Mo t i v e i st shu shutin ‘F resch—Hin tern ’
,
das m ann igfach abgew ande l t w i rd (F ig. 1 5 , 1 6 , 1 7 , Die ein
fachste F orm (Fig . 1 5) w u rde e inma l auch w agen c/zyz'
nhlqyz' getauft
,
d . i . der Nam e e ines Baum es m it gekrümm ten Zw e igen,für den
unser Kac h in- In terpret die Übersetzung ‘banyan hook ’
gab2
) .
Jeden fa l l s hat das Motiv, so w ie es h ier dargeste l l t is t , e ine gew is seA hnlichkeit m it dem knochigen Rücken des Fresches ; w o es auf
w ärtsgedreht vorkomm t, erinnert es an e inen flach da l iegen den Froschm it ansgestreckten Füßen . F ig. 1 8 is t s chon erheb l i ch umstilisiert
,
es w underte uns daher n i ch t,dafür noch e inen e igenen Namen,
udang käsha3), zu hören . udang oder w udang i s t ein Ba l kenk reuz,
am häufigsten in der Form des Andr eask reuzes (aber auch oft ein
Ba lkengerüst), an dem die Opferbüifel ges ch lachtetw erden . In den Wirkmustern komm t zvudang als e infaches S chräg
1) Ist es zu pau (Hansen
‘to be knobby
’
) zu stel len ,das auch als läpau
v orkomm t ? cf. akku-m neb en lähku nt (Hansen2) Hansen 444 “
a k ind of b anyan ,ticus glomerata ? ’
8) käsha m äka be i Hansen 267 als ‘
a kind of emb ro idery ’. kcisha ,Kind’
scheint h ier im Gegensatz zu dem oben p. 508 erwähnten käm e‘Mutter’
,
‘Hauptmuster ’ ein nebensächl iches oder k lein eres Muster zu bedeu ten .
\Velnuuster der b irmanisc lw n Kach in ,ihre Namen usw . 5 1 7
k reuz m it gla tten (vgl. die Ta sche A b b . 4) ode r in Haken endigenden
Ba lken vor (F ig. 1 9,
Zu den kreuzfö rm igen Muste rn gehö rt auch da nghl.yam and/ca
(F ig. 2 1 ) vgl. hierzu die oben 5 10 gem ach tenBem e rkungen übe r das Webgerät .
E benso p0pu liir w ie S/u t slu 7tiu i st a ls S t reum uster Mm al:kang
(F ig. 29 u . A bb . in de r M i ss ion Bhamo a ls,Wiese l oder
Mu rderspur“ ü be rsetzt (bei Hausen p. 292 und He rtz a . a . 0 . p. 14 7
Wilti li ittZ 6) .Die gezahn te Lin ie s ieht m an a ls S ch rägstre i fen
,Zickzack
,
Raute und Quad rat un ter v ers ch iedenen Namen . Den gezahntenS ch rägstrei fen nannten die Leute das e ine Mal npan chyen.
‘Zaunte i l ' ; die w ört l i che Üb ersetzung fü r okpen i st ‘Hälfte ’
,
‘hal b iert ’ .In Namhkam sagte man w a gär ep
‘S chw einsr ippe’
; d ie ser Ausd ruckw u rde anderw ärts w iederum fü r e ine doppel se i t ig gezahnte Zickzacklinie (F ig. 23) geb raucht . E in nur e inse itig gezahn tes Z i ckzack he iß t ka h i Zap singgazc
“O pium -Bl att-Zickzack’
. Ve rs ch iedenhei ten in der Musterbenennung erkl ären s i ch oft au ch daher
,daß
der e inen Web er in die Um randung, der andern die F üllfigur fürdie N amengebung m aßgebend dünkte ; so ersch ien für F ig. 1 4
neben npau und m agoz'
auch noch die Bezei chnung kam'
Zap käs/za
w om i t, w ie bei dem ob engenannten Zickzack d ieses Nam ens jedenfal l s die Zähne der Um randung gemein t s in d (v ie l le i cht m it Beziehung auf das zackige B latt der Mohnpflanze). Ähn l i ch. verhä l tes s i ch b ei e inem Muster aus v ier s chräg gekreuzten Linien , derenE nden zahnartig aus dem Viereck vorragen (Abb . 4 u . es w ir de inma l als S chl inge betrach tet und shingna t singgaw
‘Web litzen
z i ckzack ’ genann t,das andere Mal im H inb l i ck auf die gezahnte
A ußense i te gappen Zap andererse i ts führen d ieseZ ahnfortsätze an Vierecken und S chrägl inien zu der Beze i chnungpüsi m äka
‘Kammuster’
; vgl. F ig.
1) A n einem in Knupffarberei ornam ent ierten S eiden tuch aus den sud
l ichen S hanstaaten findet s ich das Mus ter als Zw ischenfigur in einer Bordüre.
2) Über käsha s. oben p. 5 16 A . 3.
yapyen sagen die Hkauri-Kach in an der ch ines ischen Grenze fu r käml‘Opium ’
.
Z u d iesem Muster l iefert schon die m i tte lal terl iche zentralas iatischeund ch inesische Kunst Paral lelen : A . G r ün w e de l , A ltbuddhist . Kultstätten
5 1 8 Lucian und Christ ine S eherm an
Kle ine rau tenformige Geb i l de ge l ten als‘Augen ’ z . B. Fig. 25
u r i myi‘F asanenauge
’
,F ig. 26 bainam myi
‘Z iegenauge’ Fig . 27
gehört dem Namen nach auch noch h ierhe r, es he ißt, w iew oh l es
ganz an ders auss ieh t,myi pawng m äka (pawng
‘Ansamm l ung’
,
vie l le i cht als zw e i Mens chenaugen gedeutet?Die Vorderse i te der Um hängetas chen is t b ei e in igen S tamm en
m it sechs längl ichen roten Flanellstreifen verz ier t (c f. Abb . 1 l inks ;bei Abb . 5 dur ch S ilberbuckel und Fransen fast v erdeck t), dieglei ch den als Ohrschm uck benu tzten F lanellstreifen lätsun genanntw erden. In ihrer Mitte i s t ein rech teckiges F e l d aus k le inenrosetten oder sternar tigen S tr i chen
,die u rsprüngl i ch m it Bastfäden
(wa baw ng m‘Ba
'
mbus - Sprossen jetzt aber vie l fach m itb un ten S e iden oder Garnfäden ausgeführ t s in d . Diese S ti ckere ihei ß t bau bau; (Fig. m it ban beze ichnet man ein blumenart iges
Ornamen t,ban baw i st spezie l l die ‘Bl um e
’
auf e iner Tas che oderauf dem erw ähnten Oh rs chm uck (Hansen S e l ten nur b egegnetm an in der Ornam en tik der östl i chen Kach in e inem von den
eck igen Formen abw e i chen den Motiv; ein so l ch vereinze l tes Beispie l i st Fig. 29 sumpragyi m älca ; s umpra i st ein langes , w e inrankenar tiges Dschungelgras, gyi
‘geringe l t ’,
‘ges chl ungen’
,
‘
ge
kräuse l t ’
Wir komm en nunmehr zu den der w e s t l i c h e n G r uppe an
gehorigen Kach in am Die Frauenkle idung dieserS tämm e (Abb . 3) besteht aus e inem oberha lb der Brust befestigten ,aus dre i S toffbreiten zusammengefügten Rock . Er ist in b reitenroten und schw arzen S trei fen gemustert
,die m it feinen w e ißen,
ge lben und grünen Lin ien abgegrenzt s ind . Nur ganz s chma leBordüren von bun t e ingew i rkten Ornam en ten laufen an den S e i tenln Chinesisch-Turkestan (Berl in 1 91 2) Fig. 310 p. 140 (S im sverzierung in
e iner Höhle v on Ming-Oi) ; E . C h av an n e s , Bul l . des Mus. de F rance ’08,
p. 239 und M ission arch . dans la Chine septentr . , T afelbd. (ParisNr. 536 ; O . Mü n s t e r b e r g , Ch ines . Kunstgesch ichte I I (E ß l ingenp. 238 Aber auch auf den schon oben p. 512 A nm . erwähntenKaukasus-Taschen ist ein ganz ähnlicher S tre ifen zu sehen.
Vgl. h ierzu auch die in der v orangehenden A nmerkung erwähn tenT
‘
angziegel.2) Von H e r t z a. a. 0 . p. 13 1 als
‘Htingnai’ bezeichnet.
5 1 8 Lucian und Christ ine S ehermau
Kleine rau tenförm ige Geb i lde ge l ten als‘Augen ’
z. B. Fig. 25
«M mye'
‘Fasanenauge’
,F ig. 26 bain um myz
'
‘Z iegenauge’
F ig. 27
gehört dem Namen nach auch noch h ierher, es he ißt, w iew oh l esganz anders aussieht
,myi paw ng m aka (paumg
‘Ansamm lung’
,
vie l lei ch t als zw e i Mens chenaugen gedeutet?Die Vorderse i te der Umhängetas chen i st bei e in igen S tamm en
m it sechs längl ichen roten Flanellstreifen verz iert (cf. Abb . 1 l inks ;bei Abb . 5 durch S ilberbuckel und F ransen fast verdeck t), dieglei ch den als Ohrschmuck benutzten F lanellstreifen latsua genanntw erden . In i hrer Mitte i s t ein rech teck iges F e l d aus k leinenrosetten oder sternar tigen S tri chen, die ursprüngl i ch m it Bastiäden(wa baw ng r u
‘Bambus - Sprossen jetzt aber viel fach m itb unten S e iden oder Garniäden ausgefuhrt s in d. Diese S ti ckere iheiß t ban bau; (F ig. m it ban bezei chne t m an ein blumenartiges
Ornamen t, ban baw i st spezie l l die ‘B lume’
auf e iner Tasche oderauf dem erw ähnten Ohrschm uck (Hanson S e l ten nur begegnetman in der O rnam en t ik der östl i chen Kach in e inem von den
eckigen F ormen abw ei chenden Motiv; ein so l ch vere inze l tes Beispie l is t F ig . 29 sumpr agyi m älca ; s umpra i st ein langes , w e inrankenar tiges Dschungelgras, gyi
‘ger inge l t ’,
‘ges chl ungen’
,
‘
ge
kräuse l t ’
Wi r komm en nunmeh r zu den der w e s t l i c h e n G r uppe an
gehör igen Kach in am Die F rauenkle idung dieserS tämm e (Abb . 3) besteht aus e inem oberhalb der Brus t b efestigten ,aus dr e i S toffbreiten zusamm engefügten Rock . E r ist in b re i tenroten und s chw arzen S tre ifen gemustert
,die mit fe inen w e ißen,
ge lben und grünen Lin ien abgegrenzt sind . Nur ganz s chma leBordüren von bunt e ingew irkten O rnamen ten laufen an den S ei tenin Chinesisch-Turkestan (Berl in 1 9 1 2) Kg. 310 p. 140 (S im sv erzierung in
einer Höhle v on Ming-Öi) ; E . C h av a n n e s , Bull . des Mus. de h ance ’08
,
p. 239 und Miss ion arch . dans la Ch ine septent r . ‚T afelbd. (Paris
Nr. 536 ; O . Mü n s te r b e r g , Ch ines . Kunstgesch ichte II (E ß l ingenp. 238 Aber auch auf den schon oben p. 512 A nm . erwahnten
Kaukasus—Taschen ist ein ganz ahnlich er S treifen zu sehen .
1) Vgl. h ierzu auch die in der v orangehenden Anmerkung erwahnteu
T‘
angziegel.2) Von H e r t z a . a. 0 . p. 131 als
‘Htingnai’ bezeichnet.
Webmaster der b i rmanischen Kach in , ihre Namen nsw .
rz'
indern des Rockes U ber dem noch m it e inem farb igdurchw irkten Gü rte l festgeha l tenen Rock w i rd
,w ie b ei den do rtigen
S han,ein Tuch um die Brust gesch lagen und da rübe r ein offenes
w e i ßes ode r schw a rzes Jz' ickchen gezogen . (Das a uf Abb . 3 von
der d ri tten F rau getragene J iickchen ze igt S hanform . ) E in s chma lesw eißes T urbantuch deck t den Kopf. Die Umhänge taschen s indaus rohw eißem ,
m it bunten Mustern rei ch durchw irktem Gew ebe .
Wadentücher und Hüftenreife w erden n i cht getragen .
Z um Te i l finden s ich,w ie s chon mehrma l s bem erkt , die
Muster der östl i chen Kachingruppeu auch bei diesen S tämmenw ieder. a l lerd ings v ie l e infacher u nd sparsamer ; nur die Gü rte lb iinder s ind re i cher durchw irkh (Abb . 3 rechts) .
In den s chma len S eitenbordüren der Rö cke i s t m it Vor l iebeein achtzackiger , in rechteckige F orm verzogener S tern verw endet ,der auf den Gew eben der öst l i chen Kach in nur vere inze l t, seh rhäufig ab er auf den Webere ien , namen tl i ch den Bett undMatratzenb ezügen der Namhkam -S han vorkomm t ; auch se i dene
,in Knüpf
fiirberei herge ste l l te Um s ch lagtücher aus den süd l ic hen S hanstaatenund Gew ebe aus Laos zeigen d ieses S ternmuster. Ganz besondersw e i chen die Umhängtaschen in Mater ia l
,Muster und A rbe i t v on
dem S chema der öst l i chen Ka ch in ab . S ie tragen e ine F ül le v on
m eis t figürlichen Motiven, die tei l s m it S eide, te i l s m it fe inerBaumw o l le in schw arzen , roten, l i chtgrünen, v io letten Tönen ein
gew irkt sind . Die S tücke unserer S amm l ung s ind n i ch t v on ein
heitlichem Charakter ; zw e i von i hnen w u rden durch gütige Ver
m it tl un g des eb enso erfahrenen w ie gefäl l igen Apost. Pr iifektenv on Assam Dr . C . Be c k e r erw orben und v on diesem als ‘Hkam t iTas chen ’
beze i chnet,sie s tamm en a l so aus dem Geb iet zw ischen
dem nordös tl i chen Assam und nordw estl i chen Bi rma, das von
Hkam ti-S han und von den hier einged rungenen Kachinstämmen
bew ohnt i s t. Diese be i den Taschen und e in e d r i tte (Abb . am
oberen Chindw in erw orbene gle i chen s ich in Machart undMusterung
Nur an einem Rö cke unserer Samm lung , der beze ichnender W e isevon einer Nägafrau gew eb t w ar , ist auch der untere Rand durchw irkt ; derSe itenrand zei gt e ine b re ite Bordüre aus hakenbesetzten Zickzackl in ien , dasoben p, 514 erwähnte hkahku -mäka . Die einw andernden Naga gesel len sich
m it Vorl iebe zuerst zu Kach in , assim i l ieren sich diesen und w erden dann m it
ihnen Shau .
520 Lucian und Christine S cherman
vol l ig . Eine mehrfarb ige, v ierkan tig geflochtene d i cke S chnurdeckt die S eitennähte der Tas che, b i l det das Tragband und endigtin Quasten . Die Musterung i st auf bei den S ei ten gle i ch und
nach str engem S chema in F e l der abgete i l t . In der Mitte ist ein
F el d v on S echsecken , in denen ein s til i s ierter Baum oder B l umentopf ge lb und s chw arz zw i schen den roten F ullmustern desHin tergrundes steht (F ig. Diese lassen si ch b ei genauererBetrachtung als s ti l is ierte, gegene inander gew endete Vögel mithornartigen Kopfaufsätzen e rkennen . Die s chma len Musterstreifen ,die das Mi tte l fe l d um rahm en und
,v on d iesem durch ein glatt
gew eb tes S treifenstück ges ch ieden , den obern Rand der Tasches chmü cken, b es tehen aus k le inen Gitter Zickzack S tern und
Rautenmustern , Sow ie aus Re ihen von s ti l i s ier ten Vöge ln und v ierfüßigen Tieren . Die Haken und Maander -Mo tive der östl i chenS tämme feh len h ier gänz l i ch .
Die übrigen aus dem Chindw intal s tamm enden Tas chen s indin Machart w ie Musterung Mischprodukte ; sie haben n i ch t diebunte geflochtene S chnur als S e i tenw an d und Tragband, sondernes i st dafür, w ie bei den Ta s chen im Osten des Kachingeb ietes,
ein S toßstreifen e ingesetzt (Abb . 7 ) a l lerdings der Länge nachzusammengel egt als s chma les Band der in dem zw is chen die
T aschenteile gesetzten S tück m it Re i hen v on Hakenb ordüren aus
dem Musterschatz der öst l i chen Kach in in s chw arz und rot durchw eb t ist. Zw e i Tas chen ze igen
,w en igstens an der Vorderse i te,
noch ungefähr das oben bes chrieb ene Musterschema der Hkam tiTas chen ; die Einze lmuster se lbs t aber s ind konfus und en tartet
,
statt der ges ch lossenen s chma len Rand und E infassungsstr eifen
s ind Musterbru chstücke und Einze lfiguren,Vöge l , Mens chen , pyra
m i den oder pagodenar tige Geb i l de nebene inander geste l l t. Aufden Rückse iten s in d Reihen e inzelner F iguren und Motive in v er
sch iedenar tiger Abw and lung, die bei andern Taschen (Abb . 7 ) abe i den S ei ten die Ornam en tierung b i l den : vierfüß ige Tiere m it
Quastenschw anz u nd stark eingesenktem Rücken , auf dem zuw e i lenm ens ch l i che Gesta l ten s tehen ; manchma l s ind die Tiere auch so
dargestel l t,daß vorn der Körper die Erde berührt und das Hinter
te i l auf zw e i Be inen s ch räg ans te igt ; neben Mens chen und baumoder pyram idenartigen F iguren ist besonders häufig der sti l isier te Voge l zu sehen
,e infach und in Doppe l s te l l ung (F ig. 30
,32)
5 22 Lucian und Christine S chermau
e infaches Durchschne i den endloser Musterfe l der zu S tre ifen und
Einzelmot iv en oder durch Zusammens te l l ungen e inze lner Formenzu neuen Mustern en tstehen . Diese Mögl i chke i ten nützen die
Kachinw eb erinnen r eichlichst aus,und so s chaffen sie neb en e iner
Zah l in F orm und Benennung fests tehender Muster nach Launeund Zufa l l noch man cher lei Geb i l de, bei denen au ch der Namem it der . indiv i due l len Auffassung w echsel t . Jedenfa l l s en tfa l tendie Kach in eine w ei t größere Bew egl i chke it und b inden sichw eniger an die Üb er l ieferung als die i hnen s tammverw andtenVö lker, w ie z. B. Naga und Chin
,in deren Gew eben fast aus
s ch l ieß l i ch das s ch räge Kreuz und die dam i t zusammenhängendeF orm zw e ier m it der Spi tze aufe inander gesetzter Dre iecke v or
herrs cht. Der äl tes te Kachinmusterschatz w ar s icher auch auf
e ine ger inge Zah l v on Mot iven bes chränkt,und w as heute von
Ornamen tik in anderen Arbe i ten als den Texti l ien bei ihnen v or
komm t, i s t hö chst Spärli0h : außer den rohen symbo l i s chen Z eichnungen v on S chmuck
,Waffen, Reisähren usw . auf den a l ljährl i ch zur
Erlangung guter E rn te aufges tel l ten Opferbalken und auf ihren Tanztromme ln sehen w ir nur Zickzack und quadratis che Linienmusterin den bes che idenen Ritzarbeiten , die sie auf Bambushülsen fürF ächer und Mau l tromm eln und auf i h ren Holzflöten anbringen .
Zw e i fel los a l so haben die Kachinw eberinnen bei Auffü l l ung ihres„Musterbuches “ m it na chbar l i chem Gut fre i ges chal tet, u nd hier
w erden stets die S han die Hauptrechnung begl i chen haben. Übera l lbr ingen diese ja in der Web techn ik Mustergül tiges hervor, man
denke nur an die go l d und seidedurchw irkten Rockbesätze,
Tu rban u nd Um s ch lagtücher der Namhkam-S han und der Chinesischen S han (S han—Tayok) an der Yünnangrenze, an die ‚präch tigenS e i denstoffe der süd l i chen S han in Birma
,der Laotier und der
S iamesen und an die phantasiereicheu figuralen Wirkmuster auf
den Votivflaggen in S han-Kl östern und Pagoden . Treffen w ir nun
von den Kach in benutzte Muster w ie Mäanderhaken und S vastika,Doppelhakenbordüre, achtzackige S terne , sti l i s ierte Vöge l u sw . bei
heißen (Ornam ente p. 57 ff.,Muster und noch merkw ürdi ger ist die
Benennung ‘F r o s c h b e in e’
(Ornam ente p. 1 7 Nr. 1 26 , Muster 7 ) für eineunserer aufw är tsgedrehteu F igur 1 5 (‘F r o s c h h in t e r n ’
oben p. 516 ) ent
sprechende Zeichnung . Das sv astikoide Ornament p. 28 Nr. 1 90 (vgl.Muster 1 1 ) bei S chvindt ist ausgesprochen ch ines isch .
Webmaster der b i rman ischen Kachin,ihre Namen usw .
S lam ode r bei ku ltu re l l von ihnen abhängigen S tämmen sogar inGeb ie ten
,w o ke ine Kach in w ohnen
,so spr i cht das au fs deu tl i c hste
fü r die Que l le , aus der die Kach in s chöpf ten . Die Ro l le der
S han a ls Ku l tu rträger in Bi rma und den östl i ch daran grenzendenS taaten w i rd n i ch t genügend geschätzt ; er innert man sich , w as
sie im in der Herstel l ung von S i lberschm uck,als
S chm iede usw . fü r ih re Umgebung ge l e is tet haben und großentei l sheute noch le i s ten
,so w ird man i h re Bedeutung, w enn man
Kle ines m it G roßem vergle i chen dar f, etw a dem E influsse an die
S ei te ste l len,den e inst Korea in der We itergabe ch ines ischer
Bi l dung auf Japan geüb t ha t.1) Hier is t in erster Lin ie an die Kesse lgongs zu erinnern ,
die auf die
sudchinesisch en Aboriginer zuruckleiten und bei den Shan s ich zu e inemeigenen auch im Mün chener E th nogr . Museum gu t v ertretenen T yp
(vgl. W . F oy , Über al te Bronzet rommeln aus S üdostas ien,M itt. anthr . Ges.
W ien 33 p. 395 ff.) entw ickel t haben . In ihrer Ornam en t ik sind m ancheder oben besprochenen Kachinmuster zu finden , besonders häufig den F ig. 1 ,
26 u . 27 verw andte Bauten,ferner mäandrische Geb i lde ; vgl. auch F . H e g e r ,
A l te Metallt rouimelu aus Südost—A s ien II (L eipz i g T af. 38,1 — 5 ; l inks
läufiger S v astika (vereinzel t ; v gl. oben p. 5 15) ebenda I , p. 127 ; I I , T af. 29 , 7 .
Daß Bronzet rommel-0 rnameute auf Tex ti l ien üb ertragen w urden, und zw arbei der Deckfärberei m it W achsdruck
, berichtet für die K‘
i-man-Aboriginer
aus ch ines . Que l len F r . H i r t h , Ch ines . Ansichten über Bronzetrommeln , Mitt.S em . f . or . Spr . Berlin 7
,I p. 14 (der m ißv erstandene Ausdruck
„S c hnitzb löcke v on Wachs“ ist leicht richt ig zu stel len) .
N a c h t r a g. Während der Korrektur erha l ten w ir v on Prof. H . Weh r l i(Zurich) e ini ge dankensw erte auf Besprechung mit Miss ionar G e i s (My itkyina)zurückgehende Mi ttei lungen . S ie bestätigen die oben p. öl 8 f. gegebene E rläuteru ng v on singyaw ; als läpa
-wp hkyi (p. 5 12) bezeichnen sie ein Musterv on kreuzweise ane inandergere ihten Haken
,ähnl ich dem p. 5 13 unter käran
angeführten ; w ir hat ten dafür m äm w ng‘Vorsprünge ’
notiert. Dagegen istunsere F ig. 2
,die Haken v ert ikal gestel l t, v on Wehrl i chyinghka hkai ‘T ür
riegel‘ benannt . Z n p. 51 5 f. ist anzufügen,daß W . für den S v ast ika den
Kachinnamen kawl pn v erzeichnet,der w iederum ‘Mohnb lüte ’ bedeutet .