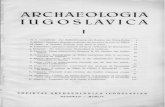Die Moritzkirche in Mittenwalde - neue Forschungen zur Baugeschichte
Neue Befunde zum Scharfenberger Silberbergbau des 13. Jahrhunderts, 2014
Transcript of Neue Befunde zum Scharfenberger Silberbergbau des 13. Jahrhunderts, 2014
293ArchaeoMontan 2014
Yves hoffmann und Eva Lorenz
Neue Befunde zum Scharfenberger
Silberbergbau des 13. Jahrhunderts
Der Scharfenberger Silberbergbau ist der zweitälteste
in den Schriftquellen belegte Silberbergbau in der
Mark Meißen. Vor einigen Jahren sind die zum Teil
sehr widersprüchlichen Angaben zur Datierung der
ältesten Urkunden und zur ersten Bergbauperiode
aufgehellt worden, sodass im vorliegenden Aufsatz
vielfach darauf zurückgegriffen werden kann (Hoff-
mann 2006). Inzwischen konnten erstmals mittel-
alterliche Bergbaureste archäologisch untersucht
werden, die nach einem Abriss der schriftlichen Über-
lieferung Thema des vorliegenden Aufsatzes sind.
Scharfenberg liegt etwa 6 km südöstlich von Mei-
ßen auf dem linken Hochufer der Elbe. Der seit 1920
offiziell als Scharfenberg bezeichnete Ort besteht
aus der Gutssiedlung Reppnitz, dem Rundweiler
Pegenau (beide mit Gutsblockflur), den regellosen
Häusleransiedlungen Gruben, Bergwerk und Rep-
pina innerhalb der Fluren von Reppnitz und Pegenau
sowie dem Schloss Scharfenberg auf einem Sporn
über dem Fluss (Abb. 1). Im Mittelalter gehörte die
um 1200 gegründete Burg Scharfenberg (Hoffmann
2006, 17–19; Stuchly 2009, 328) den Bischöfen von
Meißen.
Bei den Scharfenberger Erzgängen handelt es sich
um Mineralgänge im Meißner Granit-Syenit-Massiv,
deren wichtigste Erze Bleiglanz (Galenit), Zinkblende
(Sphalerit) und Fahlerz sind, während Pyrit, Kupfer-
kies (Chalkopyrit), Glaserz (Argentit), dunkles Rot-
gültigerz (Pyrargyrit), gediegen Silber, Malachit und
Rotheisenocker (Hämatit) eine untergeordnete
Rolle spielen. Die Scharfenberger Gänge gehören
der edlen Bleierzformation an und bilden den nord-
östlichen Ausläufer des Freiberger Reviers. Haupterz
ist auch in Scharfenberg der Bleiglanz, dessen Silber-
gehalt nach Untersuchungen des 19. Jahrhunderts
zwischen 0,015 und 0,36 % schwankt (vgl. zur Lager-
stätte Zinkeisen 1890, 48–61; Siegert 1906, 18–22).
Die Sekundärliteratur zu den beiden ältesten
Schriftquellen, in denen der Edelmetallbergbau im
Herrschaftsbereich der Meißner Bischöfe fassbar
wird, ist außerordentlich widersprüchlich. Neben
allgemeinen Unsicherheiten einiger Heimatforscher
beim Umgang mit den Quellen hatte auch ein Zah-
lendreher in der Urkundenedition Ernst Gotthelf
Gersdorfs für Verwirrung gesorgt, sodass auch einige
namhafte Mediävisten nicht die richtige Erstnen-
nung angegeben haben. Statt „1222. 23. März“ hatte
Gersdorf im Jahre 1864 irrtümlich „1223. 22. März“
geschrieben (CDS II 1, 89 f. Nr. 96). Dieser Fehler zieht
sich durch die gesamte Literatur, obgleich sämtliche
andere Urkundeneditionen und Regestenwerke, so
beispielsweise auch der von Otto Posse 1898 in der
sächsischen Codex-Reihe bearbeitete dritte Band
der Urkunden der Markgrafen von Meißen (CDS I 3,
216 Nr. 302), die richtige Datierung bringen (vgl. dazu
ausführlich mit Nennung der entsprechenden Editi-
onen Hoffmann 2006, 23, 33 f. Anm. 33–35). Darüber
hinaus sind zahlreiche weitere Jahreszahlen aus den
20er- und 30er-Jahren des 13. Jahrhunderts genannt
worden, für die es mit Ausnahme einer Urkunde
vom Mai 1232 keine Belege gibt.
Zusammenfassend stellt sich die frühe urkund-
liche Überlieferung zum Bergbau der Bischöfe von
Meißen wie folgt dar: Im Jahre 1222 befahl Kaiser
Friedrich II. (1212–1250) dem Landgrafen von Thü-
ringen und der Markgräfin Jutta, die in Vormund-
schaft des Markgrafen Heinrich (1230–1288) regier-
ten, den Meißner Bischof Bruno II. (1209–1228) in
seinen Rechten der im Meißner Bistum liegenden
Silbergruben nicht zu beeinträchtigen (CDS II 1, 89 f.
Nr. 96; CDS I 3, 216 Nr. 302; O. U. 244). Bei der Schrift-
quelle handelt es sich um einen offenen Brief (Abb.
2), dessen Form bei Gersdorf einen Fälschungsver-
dacht erregte, der sich als irrig herausgestellt hat
(Hoffmann 2006, 22 f., 33 f. mit Anm. 28, 31, 35).
Die zweite Schriftquelle ist eine von der Kanz-
lei Kaiser Friedrichs II. im Mai 1232 ausgestellte
Urkunde, deren äußere Form der eines Herrscher-
diploms dieser Zeit entspricht (Abb. 3), und mit
der dem Meißner Bischof Heinrich (1228–1240) der
Ertrag der Gold- und Silbergruben in seinem Gebiet
übertragen wird (CDS II 1, 101 Nr. 112; CDS I 3, 320
Nr. 462; O. U. 308). Obgleich sämtliche anderen
Urkundeneditoren von Jean-Louis-Adolphe Huil-
294 AFD . Beiheft 29
In beiden Schriftquellen wird Scharfenberg nicht
ausdrücklich erwähnt. Aus diesen geht lediglich her-
vor, dass es innerhalb des Bistums Meißen spätestens
seit den frühen 20er-Jahren Silberbergbau gegeben
hat, über den der Bischof mit dem Markgrafen von
Meißen, bzw. mit dessen Vormündern in Streit gera-
ten war. Dieser wurde vom Kaiser zweimal zuguns-
ten des Oberhirten der Meißner Kirche entschieden.
Erst im Jahre 1294 werden Scharfenberger Sil-
bergruben erstmals direkt erwähnt („de argen-
lard-Bréholles über Johann Friedrich Böhmer, Julius
Ficker, Friedrich Philippi, Otto Posse, Otto Doben-
ecker, Harald Schieckel bis hin zu Paul Zinsmeier,
Dieter Hägermann und Klaus Höflinger, aber auch
Hans Patze und Herbert Helbig das hier ebenfalls
von Gersdorf ausgesprochene Fälschungsverdikt
zurückgewiesen haben (vgl. mit Belegen Hoffmann
2006, 22 f., 33 f. mit Anm. 30, 31, 35), findet sich die-
ses nicht nur in heimatkundlicher Literatur immer
wieder (Leisering 2012, 194 f.).
Abb. 1. Karte von Schar-fenberg, Lkr. Meißen, mit Eintragung verschiedener
Bergbauspuren, so auch dem Pingenfeld im Bereich
des Ortsteils Gruben, der silberhaltigen Erzgänge und der archäologisch
untersuchten Bergwerke. 1 – Bergwerk des 13. Jahr-
hunderts; 2 – Bergwerk des 18. Jahrhunderts.
Obr. 1. Mapa Scharfenber-
gu, okr. Míšeň se zakreslený-
mi stopami důlní činnosti,
tedy i pinkovými poli v ob-
lasti Gruben, stříbronosnými
rudnými žilami a archeo-
logicky zkoumanými doly.
1 – důl ze 13. století; 2 – důl
z 18. století.
295ArchaeoMontan 2014
tifodinis sive montibus circa Scharfenberg“), als
Markgraf Friedrich der Freidige (1291–1296 und
1307–1320/23), der sich zu dieser Zeit in heftigen
Auseinandersetzungen mit dem Königtum um die
Mark Meißen befand, dem nunmehrigen Meißner
Bischof Bernhard (1293–1296) den Silberzehnten,
den sein Großvater Kaiser Friedrich II. dem Meißner
Bischof verliehen habe, bestätigte (CDS II 1, 254 f.,
Nr. 315; O. U. 1464). Da der Bischof ausdrücklich in
diesem Zusammenhang dem Markgrafen die Kai-
serurkunde von 1232 vorlegte und in dem Diplom
von 1294 (Abb. 4) Silberbergbau ausschließlich bei
Scharfenberg erwähnt wird, war immer schon ange-
nommen worden, dass es diese Silbergruben waren,
die zur Ausfertigung der beiden Schriftstücke von
1222 und 1232 geführt hatten. Diese Hypothese wird
durch die jetzt erstmals erfolgte Lokalisierung von
Bergbau des 13. Jahrhunderts im Herrschaftsgebiet
der Meißner Bischöfe nachdrücklich gestützt.
Bezüglich der Herrschaftsrechte des Meißner
Bischofs über Scharfenberg im 12./13. Jahrhundert
gibt es keine Zweifel. Bereits aus der Erstnennung
der um 1200 gegründeten Burg Scharfenberg im
Jahre 1227 kann auf entsprechende Besitzrechte
geschlossen werden (CDS II 1, 95 f. Nr. 103) und mit
einer Urkunde aus dem Jahre 1288 (CDS II 1, 223 f. Nr.
287) sind solche sicher bezeugt.
Schließlich ist der Reihe dieser Schriftquellen ein
Privileg Kaiser Karls IV. (1346–1378) vom Jahre 1372
anzufügen (Abb. 5), in dem dieser dem Meißner Bis-
tum verschiedene Rechte bestätigte, darunter auch
– unter Bezug auf die inserierte Kaiserurkunde von
1232 – die mit dem Edelmetallbergbau zusammen-
hängenden Rechte (CDS II 2, 136 f. Nr. 621, 622; O. U.
4038).
Gänzlich anderen Charakter hat hingegen eine
Erwähnung im 1349/50 aufgezeichneten Lehnbuch
Abb. 2. Ofener Brief Kaiser Friedrichs II. vom 23. März 1222 mit Erwähnung der Silbergru-ben im Bistum Meißen.Obr. 2. Mandát císaře Fridricha II. ze dne 23. března 1222 se zmínkou o stříbrných dolech
v míšeňském biskupství.
Abb. 3. Urkunde Kaiser Friedrichs II. vom Mai 1232, in der dem Meißner Bischof die Gold- und Silbervorkommen in seinem Territorium übertragen werden.Obr. 3. Listina císaře Fridricha II. z května 1232, v níž předává míšeňskému biskupu naleziště
zlata a stříbra na jeho území.
296 AFD . Beiheft 29
Bischofs des 13./14. Jahrhunderts sind bislang nicht
bekannt geworden. In zwei Lehnsregistern von
1487/95 (Schöttgen 1717, Anhang Einiger Docu-
menten ..., 32; Lippert/Beschorner 1903, 394) und
von 1555 (Huth 1973, 7) behaupten die Bischöfe von
Meißen noch die Lehnshoheit über Scharfenberger
Silbergruben. Hier ist jedoch nicht nur fraglich, ob
dies den tatsächlichen Machtverhältnissen ent-
sprach, sondern auch, ob die Bergwerke zu dieser
Zeit überhaupt noch in Betrieb waren (Hoffmann
2006, 26 f.). Sehr wahrscheinlich war, wie in der
gesamten Mark Meißen mit Ausnahme von Frei-
berg, auch in Scharfenberg der Silberbergbau spätes-
tens in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum
Erliegen (ebd., 26–28) und erst kurz vor der Mitte
des 16. Jahrhunderts (Renckewitz 1745, 17 f.; Müller
1854, 235, 239–242) wieder in Gang gekommen.
Von besonderer Bedeutung sind drei Karten,
die der kursächsische Vermesser Matthias Oeder
(† 1614) wahrscheinlich um 1610 angefertigt hat:
Alle drei Pläne zeigen in etwas unterschiedlicher
Friedrichs des Strengen. In dieser nichturkundlichen
Schriftquelle wird „das schenkenlehen in Grubin in
dem silberwerke“ genannt (Lippert/Beschorner 1903,
14), das sich auf ein Bergwerk im Scharfenberger
Ortsteil Gruben bezieht.
Weitere mittelalterliche Schriftquellen zum
Silberbergbau im Herrschaftsgebiet des Meißner
Abb. 4. Urkunde mit dem Reitersiegel des Markgrafen Friedrichs des Freidigen vom 25. August 1294, in der dieser die bischölichen Besitzrechte am Scharfenberger Silber-bergbau bestätigte.Obr. 4. Listina s jezdeckou pečetí markraběte Bedřicha I.
Pokousaného ze dne 25. srpna 1294, ve které potvrzuje
právo biskupa na těžbu stříbra na Scharfenbergu.
Abb. 5. Urkunde Kaiser Karls IV. vom 12. Dezember
1372 (Ausfertigung A) mit der Bestätigung verschiede-ner Rechte und der inserier-
ten Urkunde von 1232.Obr. 5. Listina císaře
Karla IV. ze dne 12. prosince
1372 (vyhotovení A) s potvr-
zením různých práv a uvede-
né listiny z roku 1232.
297ArchaeoMontan 2014
Abb. 6a–c. Drei Risse von Matthias Oeder mit dem Schloss Scharfenberg links (dieser Bereich ist auf der Karte unten verloren gegan-gen), Reppnitz rechts unten, Naustadt rechts oben und dem Pingenfeld im Bereich des Ortsteils Gruben in der Mitte, wohl um 1610.
Obr. 6a–c. Tři mapy
Matyáše Oedera se zámkem
Scharfenberg vlevo (tato
část na dolní mapě chybí),
Reppnitz vpravo dole,
Naustadt vpravo nahoře
a pinkovým polem v části
Gruben uprostřed, zřejmě
kolem 1610.
298 AFD . Beiheft 29
bezeugten bischöflich-meißnischen Bergbaus fest-
gehalten worden. Nicht auszuschließen ist dabei
natürlich, dass sich dieser auch darüber hinaus im
Bereich der anderen Erzgänge der edlen Bleierzfor-
mation erstreckte (Abb. 1) und in der frühen Neuzeit
bereits teilweise eingeebnet war.
Damit stützen die Pläne aus der Zeit um 1610
nachdrücklich die bereits 2006 unter Berücksich-
tigung der Lage der silberhaltigen Erzgänge ausge-
sprochene Vermutung, dass die damals nicht lokali-
sierbaren Bergwerke des 13. Jahrhunderts u. a. in der
überbauten Ortslage Gruben zu suchen sind (Hoff-
mann 2006, 25). Dies konnte kürzlich durch datierte
archäologische Befunde bestätigt werden.
Auslöser für die Untersuchungen im Jahre 2013
war ein Tagesbruch vor der Garageneinfahrt des
Grundstückes Am Silbergraben 2 in der Flur Repp-
nitz (Abb. 1, Nr. 1). Der Schacht, der den Bergscha-
den verursacht hatte, wurde durch Mitarbeiter der
Bergsicherung Freital GmbH aufgewältigt, was durch
das Landesamt für Archäologie Sachsen baubeglei-
tend betreut wurde (RPN-07; Grabungsleitung Eva
Lorenz; Vermessung Fanet Göttlich). Nach Beendi-
gung der Arbeiten ist das Bergwerk mit Beton ver-
wahrt worden.
Das vollständig erfasste Grubengebäude
bestand aus einem im verwitterten Gestein abge-
teuften seigeren Schacht, einem Querschlag und
dem davon abgehenden Abbau (Abb. 8–9). Der
rechteckige Schacht reichte bis in eine Teufe von
etwa 9,1 m (212,71 m ü HN) unter die heutige Gelän-
deoberkante. Im Zuge der Aufwältigung ist dieser in
erheblichem Umfang nachgerissen worden, sodass
dessen Querschnitt lediglich im Bereich der Sohle
mit etwa 1,2 m x 1,0 m bestimmt werden konnte. In
einer Teufe von etwa 8 m ging nach Südosten ein
4 m langer Querschlag ab. Dieser hatte bei einer
Maximalhöhe von 0,8 m und einer Breite von 0,6 m
ein im oberen Bereich gerundetes Profil und knickte
nach etwa 1,8 m nach Süden ab. Am südöstlichen
Ende des Querschlages ging dieser in einen Abbau
eines offenbar silberhaltigen Bleierzgangs über,
der noch in letzten Resten gefasst werden konnte.
Der West-Ost ausgerichtete Abbau nahm bei einer
Breite von 1,0 m eine maximale Höhe von 3,7 m ein
und reichte bis in eine maximale Tiefe von 12,6 m
unter der Geländeoberkante (209,23 m ü HN). Ins-
gesamt hatte dieser unregelmäßige Abbau eine
Längserstreckung von 4,8 m und endete in vier ver-
schiedenen Orten.
In dem Schachtgebäude konnten einige wichtige
Detailbefunde untersucht und dokumentiert wer-
Ausführung das Gebiet zwischen dem Schloss
Scharfenberg, dem Vorwerk Reppnitz und dem Dorf
Naustadt mit den zu dieser Zeit betriebenen Berg-
werken. Besondere Aufmerksamkeit verdient ein in
der Mitte der Pläne dargestellter Bereich im Ortsteil
Gruben (Abb. 1). Während bei zwei Plänen in diesem
lediglich eine dichte Ansammlung von Kreisen – in
einem Fall mit Hervorhebung des Mittelpunktes –
eingezeichnet ist (Abb. 6a–b), hat Oeder das Gebiet
in einem dritten bislang unpublizierten Plan in einer
perspektivischen Ansicht wiedergegeben, die damit
eindeutig als Ansammlung von bereits verbroche-
nen Schächten angesprochen werden kann (Abb.
6c). Auch auf den betreffenden beiden Blättern der
seit 1586 erfolgten ersten kursächsischen Landes-
aufnahme hat Matthias Oeder nicht darauf verzich-
tet, dieses Pingenfeld darzustellen – hier allerdings
wesentlich schematischer (Abb. 7).
Derartige dicht nebeneinanderliegende Tages-
schächte sind für den Gangerzbergbau der ersten
Bergbauperiode des 12.–14. Jahrhunderts typisch.
Vergleichbare archäologisch datierte Pingenfel-
der haben sich in Sachsen beispielsweise auf dem
Treppenhauer bei Sachsenburg (Bleiberg), dem
Hohenforst bei Kirchberg (Fürstenberg) und dem
Ullersberg bei Wolkenburg (Ulrichsberg) erhalten
(Schwabenicky 2009). Da der Silberbergbau der
zweiten Bergbauperiode des 15./16. Jahrhunderts
nach bisherigen Kenntnissen nicht mehr mit einer
Vielzahl von nur wenigen Metern voneinander ent-
fernt liegenden Schächten betrieben wurde, spricht
alles dafür, das Pingenfeld auf den Plänen Matthias
Oeders in den Zeitraum zwischen dem 12. und dem
ausgehenden 14. Jahrhundert zu datieren. Somit ist
durch den kursächsischen Vermesser offenbar die
Lage des für das 13. und 14. Jahrhundert schriftlich
Abb. 7. Ausschnitt aus der kursächsischen Landesauf-
nahme von Matthias Oeder („Ur-Oeder“), um 1600.
Obr. 7. Výřez z kuriřtského
saského mapování Matyáše
Oedera („Ur-Oeder“),
kolem 1600.
299ArchaeoMontan 2014
den: Bemerkenswert sind zehn Nischen in dem 4 m
langen Querschlag, die 0,14–0,24 m unterhalb der
Firste eingehauen worden waren (Abb. 10). Drei der
Nischen befanden sich am südwestlichen Stoß und
sieben auf dem nordöstlichen. Ihre Breite schwankt
von 10–18 cm und die Höhe von 7–11 cm.
An einer Ortsbrust im östlichen Bereich des
Abbaus konnte der auch für die Datierung wich-
tigste Befund dokumentiert und geborgen werden.
Es handelt sich um eine in situ befindliche hölzerne
Arbeitsbühne, die aus zwei an den Stößen verkeil-
ten, 52 und 70 cm langen Querhölzern und noch
einem darauf liegenden Weichholzbrett mit Nut
und Feder bestand (Abb. 11). Letzteres war radial
aus einem Stamm gespalten worden und hatte eine
Größe von 87,5 cm x 14,5 cm. Weitere sieben gleich-
artige, mit Nut und Feder versehene Spaltbretter
mit einer Länge von 73–82 cm und einer Breite von
14–16,5 cm wurden unterhalb der Bühne aus dem
Versturz geborgen. Eines davon konnte als Tannen-
holz bestimmt werden. Es kann mit großer Sicher-
Abb. 8. Reppnitz, Lkr. Mei-ßen. 3D-Drahtmodell des Grubengebäudes aus dem 13. Jahrhundert mit dem Schacht, dem Querschlag und dem Abbau sowie der Arbeitsbühne.Obr. 8. Reppnitz,
okr. Míšeň, trojrozměrný
drátový model dolu ze
13. století se šachtou, chod-
bou, dobývkou a lešením.
Abbau
Schachtrekonstruktion
Schachtsohle
Geländeoberkante
Bühne
Querschlag
Nischen
0
5 m
4
3
2
1
N
5 m
0
Abbau
Querschlag
Schachtsohle
Schachtrekonstruktion
Geländeoberkante
Bühne
Nischen
dobývka
chodba
dno šachty
rekonstrukce šachty
hrana povrchu
lešení
výklenky pro kahany
Abb. 9. Reppnitz, Lkr. Meißen. Aufsicht auf das Grubengebäude des 13. Jahrhunderts mit dem Schacht, dem Querschlag und dem Abbau mit der Arbeitsbühne. Obr. 9. Reppnitz, okr. Míšeň, pohled na důl ze 13. století se šachtou, chodbou, dobývkou a lešením.
2 m0
N
300 AFD . Beiheft 29
heit von der Zugehörigkeit auch dieser Bretter zu der
Arbeitsbühne ausgegangen werden.
Von den Hölzern, bei denen sämtlich die Wald-
kante erhalten geblieben war, ist eines der Versturz-
bretter dendrochronologisch durch Dr. Thorsten
Westphal (Deutsches Archäologisches Institut,
Berlin) auf den Winter 1214/15 bestimmt worden.
Darüber hinaus wurden fünf ebenfalls aus dem Ver-
sturz geborgene Buchenhölzer beprobt und jeweils
mit Waldkante in den Winter 1284/85 sowie vier-
mal in den Winter 1287/88 datiert (Protokolle vom
07.04.2013 und vom 23.05.2013), wobei es sich in
einem Fall um ein Holz vom selben Baum zu han-
deln scheint.
Damit bleiben vorerst gewisse Unsicherheiten
hinsichtlich der Datierung der Arbeitsbühne: Das
einzige Holz, das mutmaßlich mit dieser in Verbin-
dung zu bringen ist, datiert noch in das hohe Mittel-
alter, während die Buchenhölzer, die mit der Bühne
sehr wahrscheinlich nichts direkt zu tun haben,
erst sieben Jahrzehnte später geschlagen wurden.
Da die dendrochronologische Untersuchung der
Bühnenhölzer aus konservatorischen Gründen erst
später erfolgen kann, lässt sich vorerst nicht ent-
scheiden, ob die Bühne aus dem zweiten Jahrzehnt
des 13. Jahrhunderts stammt oder ob es sich nur um
ein sekundär verwendetes Holz handelt und das
gesamte Bergwerk erst in die zweite Jahrhundert-
hälfte zu setzen ist. Beim Dippoldiswalder Bergbau
hat sich gezeigt, dass dort die Zweitverwendung von
Hölzern unter Tage geradezu die Regel ist, was durch
die gute Bearbeitbarkeit der ständig durchfeuchte-
ten Einbauten im Unterschied zu getrockneten
Übertagehölzern problemlos möglich war (Hoff-
mann 2014, 68).
Für die somit vorerst noch offen zu haltende
Datierungsfrage helfen leider die anderen Fundstü-
cke auch nicht weiter, da diese nicht hinreichend
genau datiert werden können. Die einzigen drei in
dem Grubengebäude gefundenen Keramikfrag-
mente grauer/blaugrauer Irdenware lassen sich als
unverzierte Wandungsstücke nur allgemein in das
13./14. Jahrhundert (nach 1220) setzen. Auch mit
diesen kann eine Datierung des Bergwerkes in das
frühe 13. Jahrhundert nicht ausgeschlossen werden,
obgleich diese Funde um mindestens einige Jahre
jünger sind als das Holz von 1214/15.
Von den erwähnten, aus der Verfüllmasse gebor-
genen Einzelfunden sind neben undefinierbaren
Holzfragmenten, zum Teil mit Bearbeitungsspuren,
vor allem Textilreste von der Schachtsohle, drei
Bruchstücke eines Erztroges, ein Werkzeugstiel (sog.
Abb. 10. Reppnitz, Lkr. Meißen. Querschlag mit den Nischen unterhalb der Firste, nordöstlicher Stoß.Obr. 10. Reppnitz, okr. Míšeň, chodba s výklenky pod
stropem, severovýchodní bok.
Abb. 11. Reppnitz, Lkr. Meißen. Arbeitsbühne des 13. Jahr-hunderts.Obr. 11. Reppnitz, okr. Míšeň, lešení ze 13. století.
301ArchaeoMontan 2014
Helm) mit einer Länge von 32 cm und einem Durch-
messer von 2,5–4 cm sowie eine gedrechselte Holz-
schale besonders zu erwähnen.
Die in mehrere Teile zerbrochene Schale mit
zwei kreuzförmigen Zeichen auf dem Boden hat bei
einer Höhe von 7 cm einen Maximaldurchmesser
von 26 cm (Abb. 12). Bemerkenswert ist, dass bereits
im Mittelalter von der Schale etwa ein Drittel fehlte
und die alte Bruchkante Abarbeitungsspuren auf-
weist und deutlich gerundet ist. Diese rühren ganz
offensichtlich von einer Sekundärnutzung der offen-
bar zerbrochenen Schale her, als das nicht mehr für
den ursprünglichen Zweck zu gebrauchende Gefäß
wahrscheinlich für das Zusammenkratzen von
Gesteinsmaterial oder vielleicht auch zum Wasser-
schöpfen verwendet wurde (Lentzsch 2014).
Bei einer weiteren baubegleitenden archäolo-
gischen Untersuchung konnte im Jahr 2012 etwa
200 m nordöstlich des Grubengebäudes aus dem
13. Jahrhundert auf dem Grundstück Am Silbergra-
ben 10 außerdem ein Schacht des 18. Jahrhunderts
erfasst werden (Abb. 1, Nr. 2), auf den hier nur kurz
hingewiesen werden soll (RPN-06). Dabei handelte
es sich um einen Tagesschacht auf dem Neuglücker
Morgengang mit kleineren Abbauen, der bis in eine
Teufe von 47 m reichte. Ab dieser Tiefe war das Berg-
werk über einen nicht aufgewältigten Blindschacht
weiter betrieben worden. Die dendrochronologische
Untersuchung von drei Versturzhölzern aus einem
tonnlägigen Abbau in etwa 30 m Tiefe ergab Datie-
rungen von 1776 bis 1779. Als wichtiger Einzelfund ist
eine 2,82 m lange und 0,24 m breite Fahrt zu nennen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der
seit Jahrhunderten aus den Schriftquellen bekannte
(Albinus 1590, 16 f.; Renckewitz 1745, 28–30; Klotzsch
1764, 120 f., 309–312) und mindestens in das 13. Jahr-
hundert zurückreichende Silberbergbau der Bischöfe
von Meißen erstmals archäologisch erfasst werden
konnte. Das untersuchte Grubengebäude kann der-
zeit allerdings noch nicht mit letzter Sicherheit in
das hohe Mittelalter datiert werden. Es bestand aber
nachweislich bis in das ausgehende 13. Jahrhundert
und wurde demzufolge erst im späten Mittel alter
aufgelassen. Somit kann der mehrfach bezeugte
mittelalterliche Silberbergbau der ersten Bergbau-
periode im Bereich des Scharfenberger Ortsteiles
Gruben lokalisiert werden. Zeugnis der mittelalter-
lichen Bergbautätigkeit sind ganz sicher auch die
mindestens 300 Jahre später angefertigten Risse
Matthias Oeders. Ein in nur geringer Entfernung lie-
gendes Bergwerk des 18. Jahrhunderts, das auf einen
bereits im 13./14. Jahrhundert vom Abbau erfassten
Erzgang liegt, vervollständigt die wichtigen neuen
Erkenntnisse zu dem bedeutenden Silberbergbau-
gebiet bei Scharfenberg.
Hinweise zu den PlänenDie hier abgebildeten Scharfenberger Pläne von Matthias Oeder werden im Sächsischen Staatsarchiv, Hauptstaats-archiv Dresden, 12884, Karten und Risse, Schrank 1, Fach 30, Nr. 3 (Pingenfeld mit Kreisen und Mittelpunktmarkie-rung), Nr. 4a (Pingenfeld mit einfachen Kreisen), Nr. 4b (Pingenfeld mit perspektivischer Darstellung) aufbewahrt. Die Datierung geht aus den Findbüchern hervor, wobei der Plan Nr. 3 „um 1610“ eingeordnet wird, während die beiden anderen in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gesetzt worden sind. Sehr wahrscheinlich stammen jedoch alle drei Pläne aus derselben Zeit. Plan Nr. 3 ist bei Richter (2003, 52 f.) und bei Penndorf (2008, 14) abgebildet. Die Kenntnis der beiden anderen Karten verdanken wir dem Heimatfor-
Abb. 12. Reppnitz, Lkr. Meißen. 3D-Scan der gedrechselten Holzschale aus dem Bergwerk, 13. Jahrhundert.Obr. 12. Reppnitz, okr. Míšeň, trojrozměrný sken soustružené misky z dolu, 13. století.
10 cm
302 AFD . Beiheft 29
scher Heinz Wagner, Dresden, dem für seine Unterstützung herzlich gedankt sei! Der „Ur-Oeder“ beindet sich ebenfalls im Sächsischen Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, 12884, Karten und Risse, Schrank R, Fach 4–6, Nr. 179, 157-299B (Makro 00801-00900). Dieser Plan ist teilweise bei Burghardt/Hofmann (2013, 27) abgebildet.
QuellenCDS I 3: Urkunden der Markgrafen von Meißen und Land-
grafen von Thüringen 1196–1234. Hrsg. v. O. Posse. Codex diplomaticus Saxoniae regiae I, 3 (Leipzig 1898).
CDS II 1: Urkundenbuch des Hochstifts Meissen, I. Band. Hrsg. v. E. G. Gersdorf. Codex diplomaticus Saxoniae regiae II, 1 (Leipzig 1864).
CDS II 2: Urkundenbuch des Hochstifts Meissen, II. Band. Hrsg. v. E. G. Gersdorf. Codex diplomaticus Saxoniae regiae II, 2 (Leipzig 1865).
LiteraturAlbinus 1590: P. Albinus, Meißnische BergChronica (Dresden
1590).Burghardt/Hoffmann 2013: I. Burghardt/Y. Hoffmann,
Geschichte neu schreiben. Arch. Deutschland 2013, Heft 4, 26–27.
Hofmann 2006: Y. Hofmann, Scharfenberg und der Schar-fenberger Silberbergbau im Mittelalter. Mitt. Freiberger Altertumsverein 98, 2006, 15–37.
– 2014: Vom Waldhufendorf zur Bergstadt – Dippoldis-walde in der 1. Bergbauperiode [Od lesní lánové vsi po hornické město – Dippoldiswalde v prvním hornickém období]. In: R. Smolnik (Hrsg.), Silberrausch und Berg-geschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen [Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách]. Ausstellungskatalog der Wanderausstellung des Ziel 3-Projektes ArchaeoMontan (Dresden 2014) 63–70.
Huth 1973: J. Huth, Der Besitz des Bistums Meißen. In: F. Lau (Hrsg.), Das Hochstift Meißen. Aufsätze zur sächsischen Kirchengeschichte. Herbergen der Christenheit, Son-derbd. (Berlin 1973) 77–97.
Klotzsch 1764: J. F. Klotzsch, Ursprung der Bergwerke Sach-sens, aus der Geschichte mittlerer Zeiten untersuchet (Chemnitz 1764).
Leisering 2012: E. Leisering (Bearb.), Regesten der Urkunden des Hauptstaatsarchivs Dresden 1366–1380. Veröfent-lichung des Sächsischen Staatsarchivs A 15 (Halle 2012).
Lentzsch 2014: S. Lentzsch, Fragmente einer Holzschale. In: R. Smolnik (Hrsg.), Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen [Stříbrná horečka a volání hor. Archeolo-gie středověkého hornictví v Sasku a Čechách]. Ausstel-lungskatalog der Wanderausstellung des Ziel 3-Projektes ArchaeoMontan (Dresden 2014) 239 (Katalog-Nr. 40).
Lippert/Beschorner 1903: W. Lippert/H. Beschorner (Hrsg.), Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, Markgrafen von Meissen und Landgrafen von Thüringen, 1349/1350. Schr. Kgl.-Sächs. Komm. Gesch. 8 (Leipzig 1903).
Müller 1854: H. Müller, Ueber den Scharfenberger Bergbau und dessen Wiederaufnahme. Jahrb. für den Berg- u. Hüttenmann auf das Jahr 1854, 235–268.
Penndorf 2008: H.-G. Penndorf, Scharfenberg bei Meißen – ein fast vergessener sächsischer Silberbergbau. Lapis 33, 2008, Heft 6, 13–19, 70.
Renckewitz 1745: B. Renckewitz, Entwurf oder Bergmänni-sche Nachrichten von dem Bergwercke zu Scharfen-berg, und dessen Gebäuden, so wohl von den alten, als wo ietzo gebauet … (Leipzig 1745).
Richter 2003: R. Richter, Scharfenberger Silberbergbau e. V. Scharfenberger Heimatbl. 4, 2003, 51–54.
Schöttgen 1717: C. Schöttgen, Historie Der Chur-Sächsi-schen Stifts-Stadt Wurtzen (Leipzig 1717).
Schwabenicky 2009: W. Schwabenicky, Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge unter besonderer Berücksichtigung der Aus-grabungen in der wüsten Bergstadt Bleiberg bei Franken-berg (Chemnitz 2009).
Stuchly 2009: D. Stuchly, Archäologische Untersuchungen auf der Burg Scharfenberg bei Meißen in den Jahren 1981 bis 1983. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. 50, 2008 (2009) 307–331.
Siegert 1906: T. Siegert, Erläuterungen zur geologischen Spe-cialkarte des Königreiches Sachsen. Section Kötzschen-broda-Oberau. Blatt 49 [4848] (Leipzig 21906).
Zinkeisen 1890: H. Zinkeisen, Über die Erzgänge von Güte Gottes zu Scharfenberg. Jahrb. für das Berg- u. Hütten-wesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1890, 40–64.