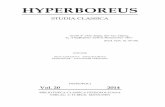„Ein seltsamer Körper war diese Universität im Krieg.“ Über die Alma mater Rudolphina in den...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of „Ein seltsamer Körper war diese Universität im Krieg.“ Über die Alma mater Rudolphina in den...
„Ein seltsamer Körper war diese Universität im Krieg“
Über die Alma mater Rudolphina in den Jahren 1914
bis 1918 – und danach
Klaus Taschwer
Symposion der Ignaz-Lieben-Gesellschaft am 15. November 2013, TU Wien
Überblick I. Die Universität Wien als Hilfslazarett II. Auswirkungen auf Lehre (und Forschung) III. Volkstümliche Universitätsvorträge auf Kriegskurs IV. Studentenbewegungen 1914 bis 1918 V. Universitätspolitische Folgen für die Zeit danach
I. Die Universität als Hilfslazarett „Die Räume des Universitätshauptgebäudes werden für Zwecke der Kriegsverwaltung als Verwundetenspital zur Verfügung gestellt“
Rektor Richard von Wettstein am 11. August 1914
600 Studierende melden sich zur Krankenpflege
Ein Teil des Universitätsgebäudes am Ring wird in ein Hilfslazarett umfunktioniert
Finanzierung durch großzügige Spenden von patriotischen Universitätsangehörigen und Institutionen, z.B.: Akademie der Wissenschaften 20.000 Kronen, Chemisch-physikalische Gesellschaft 20.000 K., Wilhelm Fidgor 4000 K., Prof. Karplus und Frau 2000 K., Karl Kupelwieser 1000 K., Fürst Liechtenstein 20.000 K., Karl Przibram 2000 K., Hans Przibram 500 K., Institut für Radiumforschung 1000 K., Emil Reich 1000 K. u.v.a.m.
Der große Festsaal als Speise- und Aufenthaltsraum, Foto vom 27. September 1914 Der anschließende kleine Festsaal diente als Operationsraum. „In den Hörsälen des ersten und zweiten Stockwerks wurden 26 Krankenzimmer mit 800 Betten eingerichtet. Bald waren auch die Gänge belegt.“
Der Arkadenhof der Universität Wien als Spitalsgarten zwischen 1914 und 1916, Foto vom 6. November 1914
Bilanz des Hilfslazaretts Ist mehr als zwei Jahre in Betrieb, schließt am 15. September 1916 (so wie die anderen „akademischen“ Hilfslazarette) 14.997 Patienten mit 406.297 Verpflegungstagen werden bis dahin versorgt Die Zusatzeinnahmen werden nach dem Krieg unter anderem für den „Siegfriedskopf“ verwendet
II. Auswirkungen des Kriegs auf die Lehre
Eugen Stinach
Auf den ersten Blick so gut wie keine
Ausnahmen sind einige wenige Lehrveranstaltungen in der Medizin:
Spezielle Kurse über „Kriegs-Röntgenologie“ (a.o. Prof. Guido Holzknecht im Wintersemester 1915/16) Privatdozent Erhard Glaser unterrichtete „Militärhygiene“ Prof. Alfred Fuchs referiert über „Kriegsverletzungen des Zentralnervensystems“
III. Volkstümliche Universitätsvorträge im Krieg
Eugen Stinach
Gegründet 1895; vor allem Dozenten halten Vorträge für Nicht-AkademikerInnen
Historiker und Sozialdemokrat Ludo Moritz Hartmann ist Spiritus rector und Sekretär des Unterfangens, stellt es sofort ganz auf den Krieg um.
Motivation: Krieg als Kampf gegen die Unkultur, „gegen geistig stumpfsinnige russische Muschiks“ (= Bauern)
Mehrere Initiativen, eine davon: Sieben Vorträge von Professoren zur Zeit- und Weltlage
„Volkstümliche Kriegskurse“
Ab August 1914 eigenes Kursprogramm („Kriegskurse“) zu Themen wie: „Wirtschaftliches Verhalten in Kriegszeiten“, „Krankenpflege und Erste Hilfe“, „Verhalten der Bevölkerung bei Epidemien“, „Über das Verhalten der Bevölkerung bei Volks- und Kriegsseuchen“ (sechs Mal wiederholt)
Im Oktober und November 1914: erste reguläre Kurszyklen
Bald drastische Einbrüche bei den HörerInnenzahlen
Erfolgreiche Rückumstellung auf kriegsfernes Kursprogramm 1916
„Auch die volkstümlichen Universitätskurse, die am 12. Oktober in verschiedenen Bezirken beginnen, sind in diesem Jahre als Kriegskurse eingerichtet. Die Gegenstände der sechsstündigen Kurse sind die folgenden: ,Der östliche und der westliche Kriegsschauplatz‘ (Montag, Alsergrund); ,Die Literatur der Befreiungskriege‘ (Dienstag, Alsergrund); ,Das Verhalten der Bevölkerung bei Epidemien‘ (Dienstag, Simmering); ,Geschichte der Befreiungskriege‘ (Dienstag, Döbling); ,Das Wesen der Kriegsseuchen und ihre Verhütung‘ (Dienstag, Währing); ,Das Recht im Kriege‘ (Mittwoch, Margareten, Volksbildungshaus); ,Krankenpflege und erste Hilfe‘ (Mittwoch, Alsergrund); ,Die Völker Rußlands‘ (Donnerstag, Alsergrund); ,Ueber Volksseuchen, insbesondere Kriegsseuchen‘ (Donnerstag, Alsergrund); ,Fichte und die deutsche Philosophie der Befreiungskriege‘ (Donnerstag, Ottakring); ,Die Hauptströmungen der europäischen Politik seit 1871‘ (Freitag, Alsergrund).“
Ankündigung in der Arbeiterzeitung
Volkshochschulen hinter der Front
Entwicklung der HörerInnenzahlen an den Volkshochschuleinrichtungen im 1. Weltkrieg Die Volkshochschulen selbst stellen ihr Programm so gut wie gar nicht auf den Krieg um, mit Erfolg beim Publikum
Nur Ludo Moritz Hartmann bleibt hartnäckig und bietet dem Armee-Ober-Kommando noch im Juli 1918 volkstümliche Kurse für Soldaten hinter der Front an. Aber da war es schon zu spät
„Die Bildung“ und ihre Kriegs-Ausgaben
Gegründet 1908 (existierte bis 1934); zu Kriegszeiten das einzige populärwissenschaftliche Magazin Österreichs (Auflage: 10.000 Stück)
Ab September 1914: Umstellung auf „Kriegs-Ausgaben“. Der gesamte Inhalt der Hefte wurde „den großen Ereignissen angemessen“ gestaltet
In 47 Heften bis zum Oktober 1918 dominierte fortan in allen drei Bereichen des die Berichterstattung über neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Entwicklungen, die für den Krieg von Bedeutung waren Eugen Steinach
IV. Veränderungen bei den Studierenden 1914–1918
„Ein seltsamer Körper war diese Universität im Krieg. Geblieben waren die alten Professoren. Die jüngeren, die Dozenten namentlich, waren eingerückt. Die Hörer waren vorwiegend Frauen. Was an männlichen Hörern da war, war dienstuntauglich, aus besonderen Gründen enthoben, oder es waren Urlauber, die nach wenigen Vorlesungen ein Kriegsexamen machten.“
Sozialwissenschafterin Käthe Leichter (immatrikuliert 1914) – Zahl der Studierenden geht von 9000 auf 4000 bis 6000 zurück – Anteil der Studentinnen steigt von 7 auf rund 35 Prozent – Anzahl der Studierenden aus Galizien und der Bukowina übertrifft die Anzahl der Studierenden aus Niederösterreich/Wien – Anzahl der jüdischen Studierenden erreicht (weit) über 50 Prozent
Studierende an der Universität Wien nach Herkunft
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Studierende aus NÖ
Studierende aus Galizien und der Bukowina
Studierende an der Medizinischen Fakultät nach Konfession
Obacht: In den Kriegsjahren ist der Anteil wesentlich höher! 1916/1917: 496 Medizinstudentinnen, von diesen kamen 239 aus Galizien sowie 45 aus der Bukowina – und 376 waren jüdischer Herkunft.
Eine Reaktion eines Professors
„(...) das Lesen an der Alma mater macht mir jetzt sehr wenig Freude. Meine tüchtigen Studenten stehen an der Front und was zurückgeblieben ist, sind polnische Juden und Jüdinnen, deren Anblick allein schon Brechreiz erregt. (...) Das Gesindel, das jetzt die Hörsäle füllt, ist entsetzlich. Im Vorjahre hatte ich noch wenigstens ein paar Krüppel, einen mit Herzklappenfehler, einen schwer tuberkulösen, einen sehr braven Studenten mit doppelseitiger Netzhautablösung, dann ein Student (...) mit Kinderlähmung, aber selbst diese stehen zwar nicht an der Front wohl aber in Uniform, (...) sind ihren Studien entzogen, weil sie in Schreibstuben oder Kasernen untätig herum sitzen müssen. (...) Kurz, es ist für einen Universitätslehrer jetzt kein Vergnügen zu leben.“ Paläobiologe Othenio Abel am 20. Mai 1917 an Pater Leopold Angerer
V. Universitätspolitische Folgen nach 1918 Die demografischen Veränderungen in der Studentenschaft während des Ersten Weltkriegs trugen nach 1918 zusätzlich zur politischen und wirtschaftlichen Krisensituation zu einer im deutschen Sprachraum ziemlich einzigartigen Radikalisierung bei, zu Antisemitismus und einen Rechtsruck
Die dominierende Koalition der Katholisch- und Deutschnationalen mit einer offen gewalttätigen Studentenschaft und geheimen politischen Netzwerken unter den Professoren (inklusive Akademie) forderte der Primat der Lehre/Erziehung vor der Forschung ein (insbesondere an der philosophischen Fakultät)
An der philosophischen Fakultät der Universität Wien hatten nach 1918 die antisemitischen Geisteswissenschaftler die Hegemonie, was in etlichen Disziplinen (in mehreren Geisteswissenschaften, der Zoologie, z.T. der Physik...) lange vor 1934 und 1938 für einen hausgemachten wissenschaftlichen Niedergang sorgte.
Antisemitische Radikalisierung nach 1918
Engelbert Dollfuß am 24. September 1920 in der Reichspost: „Hier hilft kein Herumdoktern, weg mit allen fremden Juden aus dem Osten, Beschränkung aller derer, die diesen den Weg vorbereitet haben, den so genannten bodenständigen Juden, auf die ihnen nach dem Friedensvertrag zustehenden Rechte, auf die ihnen nach ihren Köpfen gebührende Zahl!“
Der „Siegfriedskopf“, das Symbol für den Rechtsruck
Errichtet von der Deutschen Studentenschaft, dem katholisch- und deutschnationales Vertretungsorgan der deutsch-arischen Studierenden In Auftrag gegeben von Rektor Karl Diener 1922 („Der Abbau der Ostjuden muss heute im Programm jedes Rektors einer deutschen Hochschule einen hervorragenden Platz einnehmen.“) Spielt auf Siegfried-Mythos der Nibelungensage und die „Dolchstoßlegende“ des Ersten Weltkriegs an: die deutsche und die österreichische Armee vor allem von Sozialdemokraten und dem Judentum verraten worden. Eingeweiht am 9. November 1923, Tag des gescheiterten Hitler-Putsches
Siegfriedskopf-Kontexte nach 1923, drei Beispiele
7. November 1936: Heinrich Drimmel, Sachwalter der Hochschülerschaft, also: austrofaschistischer Studentenführer, am 7. November 1936. (Drimmel war von 1954 bis 1964 österreichischer Unterrichtsminister)
11. November 1938: „Langemarck"-Feier des NS-Studentenbundes, Studentenführer Robert Müller bei seiner Rede, zwei Tage nach den November-Pogromen
22. Juni 1958: Feier zum 50-Jahr-Jubiläum der CV-Verbindung Rugia mit Rektor Erich Schenk
Beschluss auf Übersiedlung 1990, Einspruch des Bundesdenkmalamts
Übersiedlung und re-kontextualisierte Neuaufstellung 50 Meter weiter im Arkadenhof im Jahr 2006 (!)
Auch noch danach: Regelmäßige Treffen von Burschenschaftern halten an