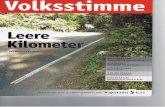Körper und Karte. Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in...
Transcript of Körper und Karte. Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in...
Hans Aurenhammer und Daniela Bohde (Hrsg.)
Räume der Passion
Raumvisionen, Erinnerungsorte und Topographiendes Leidens Christi in Mittelalter und Früher Neuzeit
Sonderdruck
PETER LANGBern • Berlin • Bruxelles • Frankfurt am Main • New York • Oxford • Wien
ISBN 978-3-0343-1535-7 pb.
© Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2015Hochfeldstrasse 32, CH-3012 Bern, Switzerland
[email protected], www.peterlang.com, www.peterlang.net
Inhaltsverzeichnis
Hans Aurenhammer und Daniela BohdeDie Räume der Passion – eine übersehene Dimension? ................................. 1
1. ‚Loca sancta‘
Bruno ReudenbachGolgatha – Etablierung, Transfer und Transformation. Der Kreuzigungsort im frühen Christentum und im Mittelalter ................... 13
Yamit Rachman SchrireThe Rock of Golgotha in Jerusalem and Western Imagination .................... 29
Birgit Ulrike MünchKörper und Karte. Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in der Frühen Neuzeit bei Christiaan van Adrichem und anderen .................................................... 49
2. Re-Inszenierungen
Johann Schulz Ereignisraum Jerusalem. Zur Konstituierung eines Sakralraumes vor den Mauern der Stadt Nürnberg ............................................................. 83
Christian FreigangBildskeptische Nachbildungsmodi der Passionstopographie Christi im Spätmittelalter: der Görlitzer Kalvarienberg ............................. 117
Achim TimmermannGolgatha, Now and Then: Image and Sacrificial Topography in Late Medieval and Early Modern Europe ............................................... 151
vi
3. Schauspiel, Liturgie, Prozession
Margreth EgidiTheatralität und Bild im spätmittelalterlichen Passionsspiel. Zum Verhältnis von Gewaltdarstellung und compassio .............................. 181
Anja Rathmann-LutzRäume der Passion im spätmittelalterlichen Basel. Eine Lektüre des Ceremoniale Basiliensis Episcopatus ............................. 205
Heike SchlieDer bildmediale Parcours durch den Passionsraum. Immersive und operative Praktiken in dem Pariser Holzschnitt der Grande Passion und in Memlings Turiner Passion ............................... 233
4. Das Buch als Andachtsraum
Jeffrey F. HamburgerThe Passion in Paradise: Liturgical Devotions for Holy Week at Helfta and Paradies bei Soest ...................................................................... 271
Andreas KrassRäume des Mitleidens. Text-Bild-Beziehungen in einem spätmittelalterlichen Mariengebetbuch (Frankfurt, UB, Ms. germ. oct. 45) ....................................................................................... 311
5. Bildräume der Imagination
Hans AurenhammerSchräge Blicke, innere Landschaften. Räume der Kreuzigung Christi bei Jacopo Bellini, Giovanni Bellini und Antonello da Messina ................ 335
Daniela BohdeBlickräume. Der Raum des Betrachters in Passionsdarstellungen von Schongauer, Baldung und Altdorfer ............................................................ 377
vii
6. Bilder im Raum
Saskia Hennig von LangeIm Raum des Bildes. Die ‚fehlenden‘ Passionsszenen in der Karlsteiner Heilig-Kreuz-Kapelle ............................................................... 415
Jason Di Resta Violent Spaces and Spatial Violence: Pordenone’s Passion frescoes at Cremona Cathedral ................................................................... 445
Die Autorinnen und Autoren des Bandes .................................................... 479
Birgit Ulrike Münch
Körper und Karte. Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in der Frühen Neuzeit bei Christiaan van Adrichem und anderen
Look, I´m not saying maps had no role in human affairs prior to 1500, but that after 1500 maps began to play the role they continue to play today. The decision to draw the line here is like Ian Hacking´s drawing of the line for the birth of statistics at 1660. […] I am inclined to think that the preconditions for the emergence of our concept of probability determined the very nature of this intellectual object […].1
Die Zäsur in der Geschichte der Kartographie, die Denis Wood in Anlehnung an David Buisseret2 formulierte, reflektiert die Erkenntnis, dass die bloße De-finition des Begriffs Karte nicht ausreicht, um das frühneuzeitliche Medium zu beschreiben, und dass die Kartographie gerade im 16. Jahrhundert einen nie wieder in dieser Form erlebten rasanten Wandel erlebte. Für die Beschäfti-gung mit heiliger Geographie im 16. Jahrhundert und der Frage, wie das Wis-sen um die wahren Umstände der Passion Christi in diesen Themenkomplex eingewoben wurde, ist diese Erkenntnis von großer Relevanz.3
Jerusalemkarten sind hierfür ebenso wichtige Seismographen wie Kunst-werke, die bibelarchäologisches Interesse demonstrieren, beispielsweise der zwischen 1634 und 1642 von Nicolas Poussin für Cassiano dal Pozzo, den Sekretär des Kardinals Barberini, geschaffene Zyklus Die sieben Sakramente
1 Denis Wood: Rethinking the Power of Maps. Unter Mitarbeit von John Fels und John Krygier, New York 2010, S. 22f.
2 David Buisseret: Monarchs, ministers, and maps: the emergence of cartography as a tool of government in early modern Europe, Chicago 1992, S. 109. Die Positionen stehen in scharfer Abgrenzung zu: James I. Nienhuis: Ice Age Civilitations, Houston 2006, S. 19–28.
3 Zum Verhältnis von Kartographie und Wissenschaftsgeschichte siehe auch Peter Burke: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, Berlin 2001, S. 71f., sowie Nigel Thrift: Flies and Germs. A Geography of Knowledge, in: Derek Gregory und John Urry (Hg.): Social Relations and Spatial Structures, Basingstoke 1985, S. 366–403; Nigel Thrift und Driver D. Livingstone: The Geography of Truth, in: Society and Space 13 (1995), S. 1–3; C. Jacob Harris: Mapping in the Mind, in: Denis Cosgrove (Hg.): Map-pings, London 1999, S. 24–49.
50 Birgit Ulrike Münch
(Abb. 1).4 Eine zweite, leicht veränderte Version dieser Serie gab der Kunst-sammler Paul Fréart de Chantelou hiernach in Auftrag.5
Die Darstellung des Abendmahls ist in beiden Zyklen als ungewöhnlich zu bezeichnen: Neben der textgetreuen Umsetzung von 1. Korinther 11,236 ist vor allem auffällig, dass Poussin eine nach historischen Vorlagen rekonstru-ierte Abendmahlsdarstellung auf einem Triclinium wählte, bei der die Gesell-schaft um einen niedrigen Tisch lagert. Chantelou war zunächst wenig angetan von dieser ikonographischen Spielart, die Poussin selbst als „quelque chose nouveau“ angekündigt hatte. Auf die Kritik Chantelous antwortete er: „Nos appetits n´en doivent pas juger seulement, mais la raison“.7 Bei der Beurtei-lung eines Bildes solle man sich nicht nur von seinen persönlichen Vorlieben (dem appetit) leiten lassen, sondern vor allem auch la raison, die historische Angemessenheit, berücksichtigen. Auch Joachim von Sandrarts Äußerung, Poussin habe die Sakramente „nach Gebrauch der römischen Kirchen“8 ge-malt, zeigt sein Bewusstsein für den Wunsch nach angemessener bildlicher Umsetzung des Passionsgeschehens, die an eine historische Verifizierung ja zwangsläufig rückgekoppelt sein muss. Um diese historische Verifizierung in vormodernen Bild- und Textquellen soll es im Folgenden gehen.
Bereits die ersten christlichen Pilger ab dem 4. Jahrhundert hatten im Heiligen Land primär ein Interesse, zu erfahren, wo genau sich das Pflaster von Gabbatha befand, welchen Weg sich die Via Dolorosa entlang wand und wie die Ädikula aussah, unter der die Überreste des Heiligen Grabes ver-borgen lagen.9 Golgatha als Kulminationspunkt der Aneignung von Wissen über die Passion Jesu ist hier selbstverständlich besonders hervorzuheben.10
4 Allgemein zum Zyklus: AK Nicolas Poussin 1594–1665, hg. von Pierre Rosenberg und Louis-Antoine Prat, Paris (Galeries nationales du Grand Palais), Paris 1994, S. 240f.; zu Cassiano Dal Pozzo noch immer grundlegend: Ingo Herklotz: Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts, München 1999 (Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana; Bd. 28).
5 Charles Jouanny (Hg.): Nicolas Poussin. Correspondance, Paris 1911, S. 272, 268, 440, 443; Reiner Haussherr: Convenevolezza. Historische Angemessenheit in der Darstellung von Kostüm und Schauplatz seit der Spätantike bis ins 16. Jahrhundert (Akademie der Wissen-schaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse; 1984/4), Wiesbaden 1984, S. 8–10; Herklotz 1999 (wie Anm. 4), S. 73.
6 Der Raum wurde dieser Bibelstelle zufolge nur von einer Lampe beleuchtet.7 Jouanny 1911 (wie Anm. 5), S. 272.8 Joachim von Sandrart: Teutsche Akademie, Nürnberg 1675, II, Buch 3 (niederl. u. dt.
Künstler), S. 368.9 Shimon Gibson: The Final Days of Jesus. The Archaeological Evidence, New York 2009,
S. 12f.10 Die Schädelstätte steht im Zentrum des verdienstvollen interdisziplinären Sammelbandes:
Johann Anselm Steiger und Ulrich Heinen (Hg.): Golgatha in den Konfessionen und Medi-en der Frühen Neuzeit, Berlin/New York 2010 (Arbeiten zur Kirchengeschichte; Bd. 113).
Körper und Karte 51
Zu untersuchen ist, inwiefern sich im 16. Jahrhundert neben den zahlreichen und vielschichtigen (Neu-)Schöpfungen Heiliger Landschaften in Literatur und Druckgraphik11 auch ein neuer Wunsch nicht mehr nur allein nach theo-logischer Verifizierbarkeit, sondern auch nach der Verifizierbarkeit des his-torischen Geschehens der Passion greifbar machen lässt, und ob sich dieses Interesse in den unterschiedlichsten bildlichen wie textuellen Medien nieder-schlägt. Wie, so ist zu fragen, unterscheidet sich dieses gesteigerte Interesse von jenem des Spätmittelalters?
Das neu erwachte Interesse an einer noch jungen Form der Bibelarchäo-logie ist nicht nur mit dem Phänomen der Verwissenschaftlichung zu erklären, sondern auch in der Glaubensspaltung begründet, die augenscheinlich einen neuen Modus der Verifizierbarkeit der Passion im Sinne ihrer historischen Rückbindung gesteigert notwendig machte.12
Jerusalem als topographisches Zentrum des Heiligen Landes und gleichzeitig als Dreh- und Angelpunkt christlicher Geschichtsdeutung ist zwangsläufig der am häufigsten behandelte Gegenstand der mittelalter-lichen Pilgerliteratur.13 Die Textgattung des christlichen Pilgerberichts entwickelte sich von einfachen Frühformen zu aufwendig gestalteten Repräsentationsschriften, so etwa dem illustrierten und in zwölf Sprachen er-schienenen Pilgerbericht Bernhards von Breydenbach aus den 1480er Jahren.14
Die Verortung Golgathas innerhalb der heiligen Geographie und Kartographie des Heili-gen Landes wurde in dieser Publikation jedoch ausgespart.
11 Zum Thema Natur als Medium und Verortung des Heiligen siehe: Denis Ribouillault und Michel Veemans (Hg.): Le paysage sacré. Le paysage comme exégèse dans l´Europe de la première modernité / Sacred Landscape. Landscape as Exegesis in Early Modern Europe, Florenz 2011.
12 Siehe zum Folgenden auch: Birgit Ulrike Münch: Geteiltes Leid. Die Passion Christi in Bildern und Texten der Konfessionalisierung. Von der Reformation bis zu den jesuitischen Großprojekten um 1600, Regensburg 2009, S. 217–252.
13 Heike Schwab: Toleranz und Vorurteil. Reiseerlebnisse spätmittelalterlicher Jerusalem-pilger, Berlin 2002 (Spektrum Kulturwissenschaften; Bd. 4); Aryeh Grabois: Les pèler-ins occidentaux en Terre sainte au Moyen Âge, in: Studi medievali 30 (1989), S. 15–48; Dietrich Huschenbett: Von landen vnd ynselen. Literarische und geistliche Meerfahrten nach Palästina im späten Mittelalter, in: Norbert Richard Wolf (Hg.): Wissensorganisie-rende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung, Wiesbaden 1987 (Wissensliteratur im Mittelalter Bd. 1), S. 187–207; Peter Welten: Reisen nach der Ritterschaft. Jerusalempilger in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Zeitschrift des deutschen Palästinavereins 93 (1977), S. 283–293; Reinhold Röhricht: Bibliotheca geographica Palaestinae. Chronologisches Verzeichnis der auf die Geographie des Heili-gen Landes bezüglichen Literatur von 333 bis 1878, Berlin 1890.
14 Vgl. Frederike Timm: Der Palästina-Pilgerbericht des Bernhard von Breidenbach von 1486 und die Holzschnitte Erhard Reuwichs. Die Peregrinatio in terram sanctam (1486) als Propagandainstrument im Mantel der gelehrten Pilgerschrift, Stuttgart 2006; Bernhard Jahn: Raumkonzepte in der Frühen Neuzeit. Zur Konstruktion von Wirklichkeit in
52 Birgit Ulrike Münch
Bemerkenswert an diesem erfolgreichen Werk ist, dass sowohl der Text als auch einige der den Text illustrierenden Holzschnitte in deutlicher Abhän-gigkeit zu älteren Pilgerberichten – etwa von Ludolf von Sudheim oder Jean de Mandeville – stehen und somit vorgeprägte literarische und bildkünst-lerische Topoi fortschreiben. Auch die Illustrationen Reuwichs erweisen sich bei genauerer Analyse als deutlich traditionsgebunden. Keinesfalls ist die aktuelle Situation einer osmanischen Siedlung wiedergegeben, sondern dem Betrachter wird vielmehr ein Jerusalem gemäß biblisch-legendari-scher Tradition vor Augen geführt, mit dem Felsendom nicht in Form einer muslimischen Moschee, sondern entgegen allem Wissen der Zeitgenossen als templum Salomonis.15 Bekanntermaßen bedeutete nun die Reformation eine Zäsur für die Pilgerschaft nach Jerusalem: Der mit dieser aufs engste verbundene Gedanke des Ablasserwerbs stand im Widerspruch zu Luthers Rechtfertigungslehre, was zunächst zu einem fast vollständigen Erliegen des Pilgerverkehrs führte.16 Erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts erholte er sich langsam wieder.17 Die Frage, ob sich in einem der nachreformatorischen Pilgerführer etwa im Vergleich zu Breydenbach Unterschiede zeigen, lässt sich beispielhaft anhand der 1582 erschienenen Beschreibung der Rheyß Leonhardi Rauwolffen skizzieren.18 Gegenüber vorreformatorischen Werken fällt die wiederholte Betonung der curiositas als eigentlichem Reisegrund ins Auge. Der Autor Rauwolff ist ferner vor allem an der Vermehrung seines eigenen Wissens durch direkten Augenschein interessiert, ein Charakterzug, den er in der Vorrede als Initialzündung seiner Pilgerfahrt erklärt:
[…] dingt mich doch die Warheit zu bekennen / daß ich Hochgelehrter beruehmpten Leuten nach zu reysen / frembde Nationes vnd mores zu besichtigen / vnd dardurch etwas zu erlehrnen / von Jugendt auff grossen begir vnd lust gehabt.19
Pilgerberichten, Amerikareisebeschreibungen und Prosaerzählungen (Mikrokosmos; Bd. 34), Frankfurt a.M. u.a. 1993, S. 33; Heinrich Rohrbacher: Bernhard von Breydenbach und sein Werk Peregrinatio in Terram Sanctam, in: Philobiblon 33/2 (1989), S. 89–113. Siehe hierzu auch den Beitrag von Christian Freigang in diesem Band.
15 Timm 2006 (wie Anm.14), S. 577. Reuwichs Illustration waren noch Vorbild für Matthäus Merians d. Ä. Jerusalemplan, der die Heilige Stadt mit 24 Nummern beschriftete und trotz Tempel keine biblischen, sondern einige wenige Staffagefiguren einfügte, siehe hierzu: Anemone Bekemeier (Hg.): AK Reisen nach Jerusalem. Das Heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Sammlung Loewenhardt, Wiesbaden 1993, S. 112f.
16 Vgl. Anne Simon: Sigmund Feyerabends „Das Reißbuch des heyligen Landes“. A Study in Printing and Literary History, Wiesbaden 1998 (Wissensliteratur im Mittelalter. Schrif-ten des SFB 226 Würzburg / Eichstätt), S. 5.
17 Vgl. Justin Staigl: Die Methodisierung des Reisens im 16. Jahrhundert, in: Peter J. Brenner (Hg.): Der Reisebericht, Frankfurt a.M. 1989, S. 140–177.
18 Dieter Henze (Hg.): Leonhard Rauwolff, Aigentliche Beschreibung der Raiss inn die Morgen-laender, Klagenfurt 1971 (Frühe Reisen und Seefahrten in Originalberichten; Bd. 9).
19 Ebd., Bl. Iiijr.
Körper und Karte 53
Die angesprochene große „begir vnd lust“ auf das noch Unbekannte füh-ren in seinem Reisebericht zu einer Neuaufnahme zahlreicher Reiseziele und deren intensive Beschreibung, wodurch sein Buch den Kanon der Orte erheb-lich erweitert. Auch im opulenten Großprojekt der nachreformatorischen Pil-gerliteratur, dem Reyßbuch des heyligen Lands des Sigmund Feyerabend, wird die curiositas als anthropologische Grundkonstante ausgewiesen. In diesem zuerst 1584 erschienenen Kompendium versammelte Feyerabend achtzehn verschiedene spätmittelalterliche peregrinationes. Jeder Mensch trage „ein natuerliche begierd / lust vnd liebe viel vnd mancherley ding zu wissen.“20 Eine genaue Kenntnis der heiligen Stätten, verifiziert durch die primäre Evi-denz der Autopsie und im Anschluss daran beständig aufs Neue verifizierbar durch sekundäre Lektüre von aus dem Augenschein abgeleiteten Beschreibun-gen, evoziere compassio beim Leser. Diese Wirkung kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn die zugrundegelegten Texte zwei Qualitäten aufwei-sen: ihre Berichte müssen, wie der Autor beschreibt, „augenscheinlich“ und „eygentlich“ sein. Dies bedeutet, dass bloße Bewährung der Richtigkeit der Darstellung und des Dargestellten durch Traditionsgebundenheit und Autori-tätenbezug in der Frühen Neuzeit nicht mehr ausreichend ist.21
Geographia sacra: Kartographie und Kreuzweg
Textlich wie bildkünstlerisch wurde Feyerabends Postulat in einem Werk Christiaan van Adrichems umgesetzt. Dessen zu Unrecht heute weitestgehend unbeachteten Werke waren in unterschiedlichen Formaten und hoher Auflage gedruckt worden und müssen bei der Bearbeitung der vorliegenden Frage-stellung zentralen Raum einnehmen. Der Autor, auch Christian Adrichomius oder Christiaan Cruys genannt, wurde 1533 in Delft geboren und starb 1585 in Köln.22 Zu seinen Lebzeiten erschien eine Reihe seiner Schriften im Druck, darunter 1578 bei Plantin in Antwerpen eine Evangelienharmonie mit dem Titel Vita Jesu Christi ex IV Evangelistis breviter contexta sowie ein Jahr vor seinem Tod, somit 1584, eine Darstellung der Stadt Jerusalem in ihrem Bezug
20 Sigmund Feyerabend: Reyßbuch des heyligen Lands, Frankfurt a. M. 1584, fol. 4.21 Dennoch ist es anscheinend nebensächlich oder diesem Umstand nicht widersprechend,
dass manche der von Feyerabend versammelten Texte die beiden genannten Qualitä-ten gerade nicht besitzen, sondern mehr oder minder vollständig aus älteren Quellen kompiliert sind.
22 Zu seiner Biographie vgl. Rob Koper: Adrichem, Christiaan van, in: 2LThK 1 (1957), Sp. 158f.
54 Birgit Ulrike Münch
zur Passion Christi: Iervsalem, sicvt Christi tempore florvit, et suburbanorum, insigniorumque historiarum eius breuis descriptio.23
Dieses 228 Seiten umfassende Werk wurde bei Gottfried Kempen in Köln gedruckt. Es kann als eine Art Stationsbuch bezeichnet werden. Aufgelistet sind Wegstationen der Passion, die von der Nummer 1 bis zur Nummer 270 durchnummeriert sind. Sowohl die Stationen innerhalb der Stadt Jerusalem als auch jene der näheren Umgebung werden aufgeführt. Den 170 Stationen schließt sich ein Autorenkatalog an, der „Catalogus autorvm quibus in con-cinnanda delineatione & descriptione Hierosolymitana sum vsus“24, wo mit Angabe der Druckorte und -jahre die verwendete Primär- und Sekundärlite-ratur aufgelistet wird, angefangen mit der Bibel „originali textu Hebraico et Graeco“ und endend mit Flavius Josephus. Das Werk diene, so das Dedika-tionsschreiben Adrichems dazu, „illustrandam sacrae Scripturae ac Passionis Christi intelligentiam“.25 Das Ausschmücken der Heiligen Schrift und der Passion Christi zur Beförderung des Verstehens war somit die hauptsächliche Antriebsfeder von Adrichem.
Seine ausführliche Darstellungsweise lässt sich beispielhaft am 118. Kapi-tel, der Schilderung des Kreuzwegs Christi, ablesen.26 Ausgehend vom Palast des Pilatus, in dessen Innenhof die Geißelung stattfand, begann der Kreuzweg und zog sich bis zum Kalvarienberg hinauf. Adrichem erwähnt alle markan-ten Stellen und gibt die genauen Entfernungen in Form von gressus (Schritt) und pedes (Fuß) an, wobei der Schritt mit ca. 1 m und der Fuß mit ca. 30 cm bemessen wurden. Unter Aufmerksamkeit der gesamten Stadt sei Christus 80 Schritte lang „versus Caurum seu Corum“, somit entweder Richtung Caurus oder Corus gegangen, dies sei 200 Fuß von jener Stelle entfernt, wo er das erste Mal unter dem Kreuz zusammenbrach.
Die nächste markante Station, auch wiederum mit Angabe der genau-en Abstände, sei jener Ort, an dem die Heilige Maria mit Johannes dem Gottessohn begegnete. Das Prinzip der Wegstationen ist bei Adrichem, wie
23 Bearbeitete Exemplare: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Signatur: 327 Hist. (3) sowie 398 Hist. (3). Der Nachweis im Verzeichnis Deutscher Drucke des 16. Jahrhunderts lautet VD 16 A 297. Siehe hierzu Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 235f.
24 Adrichomius, Iervsalem, S. 222.25 Ebd., S. 3, das gesamte Dedikationsschreiben, das der Autor an den Kölner Erzbischof
Ernst von Bayern (1583–1612) gerichtet hatte, erstreckt sich von S. 3–7.26 Ebd., S. 124–127: „Via Crucis, quà Christus in tribunali cruci adiudicatus, accerrimis ac
cruentis gressibus ad montem Caluariae iuit. Incipiens enim à Palatio Pilati per viginti sex gressus, qui faciunt sexaginta quinque pedes, ad locum processsit, vbi Crux ei imposita est. Vnde tota spectante vrbe super saucios humeros suam baiulans crucem, versus Cau-rum seu Corum per octaginta gressus, hoc est, ducentos pedes ad locum vbi primò cum cruce cecidisse traditur, progressus est. Inde statim per sexaginta gressus & tres pedes, id est, centum quinquaginta tres pedes, ad locum vbi B. Maria cum Ioanno filio suo occurrit.”
Körper und Karte 55
sich zeigt, bis zur letzten Konsequenz konkretisiert, denn jeder bedeutungs-tragende Punkt des Kreuzwegs wird im Text exakt abgeschritten und dadurch für den Leser nachvollziehbar gemacht – bis hin zur einen Viertelfuß langen, genauen Maßangabe und der Angabe der „sieben Fußfälle Christi“. Dies erlaubt es den Gläubigen, die imitatio passionis so exactè wie nur möglich zu imaginieren. Der Leser hat die Wahl, dies realiter, auf dem Weg in Jerusalem selbst zu tun, in seinem Garten oder an einem völlig anderen Ort bzw. mentaliter in einem individuellen Gedankengebäude.
Fünf Jahre nach seinem Tod wurde in Köln eine Erweiterung von Iervsalem, sicvt Christi tempore florvit herausgebracht, die nun mit zahlrei-chen großflächigen ausfaltbaren Karten versehen war, das Theatrvm Terrae Sanctae et Biblicarvm Historiarvm cum tabulis geographicis aere expres-sis, 1590 in Köln von Arnold Mylius in der Offizin Birckmann gedruckt.27 Das Titelblatt zeigt oben die Berufung des Mose in einer ländlichen Szene und seitlich des Titels links Mose mit der Gebotetafel „ego sum Deus tuus“ nach Ex. 20,2 (Abb. 2) sowie ihm gegenüber apollogleich mit flammender Sonne den militärischen Führer Josua, für den nach Jos. 10,12f. die Sonne im Kampf durch göttlichen Eingriff angehalten wurde. In einer weiteren Kartusche wird unten der Beginn der Landnahme mit dem Zug der Israeliten durch den Jordan illustriert.
Die Karten des Bandes wurden in der Werkstatt Frans Hogenbergs ge-stochen und sind mit dem Familienwappen Adrichems, der aufsteigenden Schlange, gekennzeichnet.28 Da man bislang keine Vorbilder ausmachen konnte, gelten sie als Neuschöpfungen des Autors für sein Werk. Es handelt sich im Grunde um ein umfangreiches topographisches Lexikon, das nach den Siedlungsgebieten der 12 Stämme nach Josua gegliedert ist, gefolgt von dem übernommenen Jerusalem-Kapitel und einem weiteren Abschnitt zu heiligen Orten außerhalb des Landes.29 Laut Adrichems Vorwort sei die Wahrheit der Geschichte die Basis für den Glauben und das richtige Verstehen. Dies ist insofern bemerkenswert, als nicht der Glaube als die Basis angesehen wird,
27 Christianus Adrichomius: Theatrvm Terræ Sanctæ Et Biblicarvum Historiarvm, cum tabulis geographici ære expressis, Köln 1590. Das Werk wurde im gleichen Jahr in italienischer Sprache aufgelegt. Eingesehenes Exemplar war eine Ausgabe von 1628: Wolfenbüttel, HAB, Gv 2° 15; B 130 2Helmst. Siehe hierzu Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 248f.
28 Das entsprechende Kapitel „Vrbis Hierosolymae, qvemadmodvm ea Christi D. N. tempore florvit, et svb vrbanorvm eivs brevis descriptio“ findet sich auf den Seiten 145–181. Zuvor ist eine ausfaltbare Karte Jerusalems von 76 x 53,5 cm eingeklebt. Der Text zum Jeru-salemabschnitt entspricht vollständig dem älteren Werk von 1584, die Identifikation der einzelnen Stationen der Passion auf der Karte stimmt ebenfalls genau überein. Der im Text zitierte Abschnitt zur via crucis ist auch im Theatrum unter der Nummer 118 zu finden.
29 Siehe hierzu: AK Jerusalem 1993 (wie Anm. 15), S. 98.
56 Birgit Ulrike Münch
sondern die historische veritas,30 die nur über die Kenntnis der historischen Topographien zu erlangen ist. Die Ordnung der Aufzählung geht von größeren zu kleineren Einheiten vor, so dass zunächst die Zweiteilung der Stadt entspre-chend der beiden Berge Zion und Moria vorgenommen wird, um schließlich die relevanten Gebäude innerhalb dieser Einheiten zu benennen. Im Gegen-satz zu früheren Jerusalemdarstellungen, die auf dem Tempelberg das 586 v. Chr. zerstörte Heiligtum Salomons abbildeten, findet sich hier gemäß des An-spruchs historischer Authentizität der herodianische Tempel illustriert. Dieser Anspruch wird unter anderem auch durch die Wiedergabe der direkt über eine Brücke mit dem Tempelareal verbundenen Festung Antonia eingelöst.
Der topographischen Stadtansicht ist eine Handlungsebene überblendet, und zwar jene der Passion (Abb. 3). Alle dargestellten Personen vom Ein-zug bis zur Himmelfahrt sind Akteure dieser Passion, bloße Staffagefiguren sind nicht zu finden. So ist in den Tempelvorhof die Vertreibung der Wechsler eingezeichnet. Der Beginn des Kreuzwegs am Palast des Pilatus wird mit ge-strichelter Linie dem Leser vorgestellt (Abb. 4), sowohl der im Text genannte erste Fall unter dem Kreuz als auch Maria und Johannes am Wegrand sind illustriert (Abb. 5).
Der linke untere Bildrand wird von der Golgathaszene und dem Grab Christi eingenommen. Hier löst sich die Beschriftung von der objektiven Schil-derung, der Leser wird direkt angesprochen und zur Imitatio aufgefordert: „Christus se tibi. Tu te Christo“, wie es auf einem Titulus unterhalb des „mons Calvariae“ geschrieben steht. Sowohl die Kreuzannagelung und das Würfeln um das Gewand als auch die Kreuzigung mit Schächern, die Beweinung und die Auferstehung sind in diesem Bildausschnitt visualisiert. Das Grab Christi in der unteren linken Bildecke ist von einem niederen Zaun umgeben, ganz vorne ist Maria Magdalena, dem Christus als Gärtner erscheint, zu sehen, rechts des Grabes die schlafenden Wächter und auf dem Grab stehend der nimbierte Auf-erstandene (Abb. 6).
Aufgrund der zahlreichen biblischen Akteure und der diversen unter-schiedlichen Formate eignete sich die Jerusalem-Ansicht für die Nutzung als nachträglich eingeklebte Bibelkarte in Bibeln und Erbauungsbüchern.31 So wie das Phänomen der Bibelkarte allgemein zunächst ein vorrangig
30 Adrichem 1628 (wie Anm. 27), Vorwort: „Cum historae veritas, fundamentum sit & fidei & intelligentiae spiritalis, Christiane lector, rerum autem gestarum historia absque lo-corum cognitione caecasit, eorum vero cognitio multum lucis, tum historae veritati tum spritiuali euus internretationi praebat, idcirco hoc in opere duo summa diligentia mihi observanda existimaui.“
31 So wurden Adrichems Karten nachträglich eingefügt beispielsweise in Wolfenbüttel, HAB, 317.29 Theol., oder in die Evangelienharmonie von Jacob Beringer: Das Nüw Testament, Straßburg 1526, HAB H: A 206.2 Helmst. (1); siehe hierzu Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 247.
Körper und Karte 57
protestantisches ist, das sich in katholischen Bibeln erst gegen Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts etablieren kann, so findet sich auch die Karte des katholischen Adrichem bemerkenswerterweise primär in protestantischen Bibeln32, während sie erst gegen Ende des Jahrhunderts Aufnahme in katho-lischen Bibeln findet.33 Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Chassagnette, wobei hier primär die unterschiedliche Nutzung der Karten als Distinktions-merkmal der Konfessionen angesetzt wird: Die calvinistische Tradition drängt nach Chassagnette weitaus häufiger als die katholische oder lutherische auf den didaktischen und pädagogischen Wert der Bibelkarte, während das natur-wissenschaftliche Interesse an der Glaubenswahrheit primär der lutherischen Kartennutzung eigen ist.34
Neben Adrichem gibt es weitere Autoren, Kartographen und Künstler, die betonen, auf ihren Karten das Heilige Land explizit „zur Zeit Jesu Christi“ ab-bilden zu wollen,35 so etwa innerhalb der Bibel Benito Arias Montanos.36 Die berühmte Polyglott-Bibel des Theologen und Orientalisten Montano war von 1569 bis 1572 bei Plantin gedruckt worden37 und hatte die primär auf Peter Laicksteins basierende Karte der Heiligen Stadt korrigiert, indem er an die Stelle des Salomonischen Tempels eine durch ihn verifizierte Rekonstruktion
32 Primär in englischen, deutschen, französischen und niederländischen Bibeln lassen sich die Karten finden, ausführlich hierzu: Catherine Delano-Smith und Elizabeth Morley Ingram: Maps in Bibles 1500–1600. An Illustrated Catalogue, Genf 1991 (Travaux d’Humanisme et Renaissance; 256), S. XVI; Wilco C. Poortman und Joost Augusteijn: Kaarten in Bijbels (16e-18e eeuw), Zoetermeer 1995, S. 141–156 und 179–182.
33 „Bibles that contain maps are overwhelmingly Protestant editions, or, in the case of the half-dozen Latin Bibles and even fewer Paris-printed and polyglot Bibles, were published by printers known to have had reformist sympathies or to have been willing to print reformist literature”, vgl. Delano-Smith / Morley Ingram 1991 (wie Anm. 32), S. XVI. Zu den Unterschieden lateinischer und volkssprachlicher Texte im Zusam-menhang mit den Karten am Beispiel von Ortelius siehe: Marcel van den Broeke: The Significance of Language: The Texts on the Verso of the maps in Abraham Ortelius ´Theatrum orbis terrarum, in: Imago Mundi 60, Teil 2 (2008), S. 202–210.
34 „Importance de l´émotion produite par les images dans le contexte catholique, importance du raisonnement, de l´appréhension mathématique et de la perception de la Providence divine dans le contexte lutherién, importance enfin de la clarté de l´information transmise, et de sa fidélité à la lettre de l´Écriture sainte, dans le contexte calviniste“, in: Axelle Chassagnette: Geographia sacra. Usages confessionnels de la cartographie biblique au XVIe siècle, in: Kaspar von Greyerz u. a. (Hg.): Religion und Naturwissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert, Gütersloh 2010, S. 102–122, Zitat S. 118.
35 Vgl. Delano-Smith / Morley Ingram 1991 (wie Anm. 32), S. 137, Nr. 5.1–5.5.36 Vgl. ebd., S. 121, Nr. 7.1. Des weiteren spätere Ausgaben: Genf 1588 (S. 122, Nr. 7.2.)
sowie Haarlem (?) 1598 (S. 122, Nr. 7.3.).37 Benito Arias Montano: Biblia sacra, hebraice, chaldaice, graece, & latine, Philippi II.
Reg. cathol. pietate, et studio ad sacrosanctae ecclesiae usum, Antwerpen, bei Christophe Plantin, 1569–1572.
58 Birgit Ulrike Münch
des zweiten, Herodianischen Tempels einfügte (Abb. 7).38 Zuvor, etwa im Bibelkommentar Heinrich Büntings von 1581, war der Tempel nach idealen Kriterien illustriert worden, ohne archäologische Korrektheit zu bieten. So schmückt hier beispielsweise eine goldene Tonnenwölbung das Dach, während es sich laut Bibeltext um ein Flachdach aus Zedernholz handelte.39 Auffällig ist im Gegensatz hierzu bei Montano, dass in die mit Antiquae Ierusalem vera iconographia betitelte Karte bewusst einzig eine Zutat neutestamentlicher Provenienz hinzugefügt wurde: Im linken vorderen Bildrand findet sich der Kalvarienberg mit drei im Gegensatz zu Adrichems Illustration nunmehr lee-ren Kreuzen. Montano gibt somit auch in der Darstellung der Heiligen Stadt zu erkennen, dass zu einer im theologischen Sinne historisch korrekten Wie-dergabe einer heilsgeschichtlich so bedeutsamen Stadt die eine überzeitliche christliche Wahrheit – Christi Passion – stets mit dazugehört. Die Einfügung der Kreuzigung Christi am Rand – und eben nicht innerhalb der Karte – als bloßes illustratives Element findet sich primär im 17. und 18. Jahrhundert in di-versen Bibeln, so etwa in Willem Albert Bachienes Afbeedling van t´joodschen Land von 175040 oder Romeyn de Hooghes De Reysen Christi des Heylands von 1702, wo in einer Kartusche unterhalb der Karte wichtige biblische Szenen vom Sündenfall bis zur Himmelfahrt illustriert werden.41 Auf einer Jerusalemansicht des gleichen Autors finden sich Didaskalierungen innerhalb der Stadt, am linken unteren Bildrand über der Aufschrift Calvaria aber nur ein einziges leeres Kreuz (Abb. 8).42 Auch der Kreuzweg ist hier nicht mehr ins Bild eingefügt – eine detailgenaue Rekonstruktion ist somit im Gegensatz zu Adrichem nicht mehr angestrebt. Dies vermag auch nicht die Jerusalem-karte zu bewerkstelligen, die Johann Daniel Herz d.Ä. im Jahr 1735 entwarf (Abb. 9). Die Karte, die Jerusalem „zur Zeit Jesu“ abbilden sollte, wurde zwar von einem Begleitbuch ergänzt, ist jedoch ein wahres Sammelsurium antiker Bauten, Tempel, Stadien und Paläste ohne Anspruch auf Richtigkeit. Vorne
38 Zur „heiligen Geographie“ der Polyglotta umfassend Zur Shalev: Sacred Geography, An-tiquarianism and Visual Erudition. Benito Arias Montano and the Maps in the Antwerp Polyglot Bible, in: Imago Mundi 55 (2003), S. 56–80, hier S. 62f. Eine ausführliche Arbeit unter dem Titel „Sacred Words and Worlds” steht darüber hinaus kurz vor dem Erscheinen im Leidener Verlag Brill.
39 Heinrich Bünting: Itinerarium S. Scripturae. Das is: Een Reys-boeck over de gantsche heylighe Schrift. In dry deelen onderscheyden: Het eerste vervaet Alle de reysen der Pat-riarchen / […] Arnheim 1630 (mit sieben Karten); eingesehenes Exemplar: Wolfenbüttel, HAB, A 5.7 Geogr.
40 Kaarten in Bijbels, S. 262.41 Ebd., S. 228.42 Romeyn de Hooghe: Hierusalem, 302x379 mm, Kupferstich. Geostete Karte eines ima-
ginären Plans aus der Vogelschau, vgl. Eran Laor und Shoshana Klein: Maps of the Holy Land. Cartobibliography of Printed Maps, 1475–1900, New York, Amsterdam 1986, Kat. Nr. 1045.
Körper und Karte 59
links scheint die Passion im Sinne eines volkreichen Kalvarienberges darge-stellt zu sein, doch der erste Eindruck täuscht, da die meisten Figuren sich nicht für das Passionsgeschehen interessieren und ohne Bezug zur Historie über die Eingänge in die Stadt drängen.43
Zwei Werke seien genannt, die zeitlich einerseits vor, andererseits nach Ad-richems Jerusalemkarte stehen und bei der Bearbeitung des Themas eine wich-tige Rolle einnehmen. Im Jahr 1570 erschien die noch den spätmittelalterlichen Stationsbüchern nahestehende und bei Jobst Gutknecht in Nürnberg gedruckte Geystlich straß des Nikolaus Wanckel44, der die einzelnen Kreuzwegstationen in Anlehnung an die Nürnberger Via crucis des Adam Krafft als Holzschnitte beigefügt wurden (Abb. 10).45 Am Ende seiner Vorrede betont Wanckel, dass der Leser den Kreuzweg ein „yetzlichs solche verzeychnu[n]g thun in sein seinem hauß / oder hoff stuben / oder kam[m]ern / oder andern füglichen örtern“, um das Leiden Christi nachvollziehen zu können. Die Holzschnitte werden jeweils von erklärendem Text begleitet, der die Wegstrecken der einzelnen Abschnitte angibt. So findet sich neben der Illustrierung des Falles Christi unter dem Kreuz die Angabe, dass der Fall „auch geschehen[sei] an einem eck einer gassen ein gutten stainwurff oder bey achtzig schrifften von der begegnu[n]g Marie“.46
Erst im Jahr 1600 erschien hingegen das Diarivm hvmanitatis des Bartho-lomäus Scultetus;47 der zu den wichtigsten Kartographen des mitteldeutschen Raumes im 16. Jahrhundert zählte.48 Persönlicher Austausch zum Beispiel mit dem Prager Hofastronom Tycho Brahe ist nachweisbar.49 In der zweiten Vor-rede werden als Gründe für die Abfassung die allgemeine Unwissenheit sowie die Expertenstreitigkeiten bezüglich der richtigen zeitlichen Verortung der Ereignisse angeführt – vor allem im Hinblick auf die Daten der Passion Christi oder der Einsetzung des Abendmahls.50
43 Johann Daniel Herz d. Ä., Jerusalem zur Zeit Jesu, Augsburg 1735, Abb. in: AK Jerusalem 1993 (wie Anm. 15), S. 127.
44 Notger Eckmann: Kleine Geschichte der Kreuzwegsandacht, Regensburg 1968, S. 12–17.45 Nikolaus Wanckel: Die Geystlich Straß, Nürnberg, bei Jobst Gutknecht, 1521; Münch 2009
(wie Anm. 12), S. 235. Vgl. dazu auch den Aufsatz von Christian Freigang in diesem Band.46 Wanckel 1521 (wie Anm. 45), S. 272; g3v (Holzschnitt) u. g4r.47 Bartholomäus Scultetus: Diarium humanitatis Domini nostri Jesu Christi, Frankfurt /
Oder 1600, Eingesehene Exemplare: Wolfenbüttel, HAB, A 117.11 Hist.; A 491 Theol.; A 231.118 Theol.; G 140.4° Helmst.; S 126b.4° Helmst; siehe hierzu Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 237f.
48 Ernst Kroker: Bartholomäus Scultetus und seine Karten von Sachsen (1568), in: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 42 (1921), S. 270–277.
49 Jürgen Helfricht (Hg.): Fünf Briefe Tycho Brahes an den Görlitzer Astronomen Bartho-lomäus Scultetus (1540–1614), in: Wolfgang R. Dick und Jürgen Hamel (Hg.): Beiträge zur Astronomiegeschichte, Frankfurt a.M. 1999 (Acta Historiae Astronomiae; Bd. 5), Bd. 2, S. 11–33.
50 Scultetus 1600 (wie Anm. 47), S. 69f.
60 Birgit Ulrike Münch
Der der Passion gewidmete Abschnitt des Hauptteils51 ist der um-fangreichste. Wie der Text aufführt, fiel die Passion ins Jahr 4003 seit der Erschaffung der Welt, was dem 48. Lebensjahr Mariens und dem 33. Lebensjahr Christi entspricht. Scultetus handelt sodann die Ereignisse der Karwoche in chronologischer Reihenfolge mit möglichst genauer Angabe des Datums und der Tageszeit ab: Der Einzug nach Jerusalem fand dem-entsprechend am Morgen des 29. März, eines Sonntags, statt,52 die Feier des Passah sowie die anschließende Einsetzung des Abendmahles durch Christus ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag, dem 2. April.53 Am 3. April habe sich schließlich das eigentliche Passionsgeschehen in zeitlich gedrängter Abfolge ereignet. Es habe von „Mitternacht anzufahen / funfft-zehen gantzer Stunden hienaus biß zum Tode am Creutz gewehret“ und Christus sei genau 32 Jahre, 14 Wochen und einen Tag sowie die Mutter Gottes 47 Jahre, 29 Wochen und fünf Tage alt gewesen54. Den „Historien Von dem Leiden vnd Sterben vnsers HErrn Jesu Christi“ ist ein eigener Un-terabschnitt gewidmet, in dem zum Beispiel Christi Wegführung zu Pilatus am 3. April zwischen sieben und acht Uhr morgens stattfindet,55 Christus zur Mittagsstunde das Kreuz nach Golgatha trägt und dort kurz vor ein Uhr nachmittags gekreuzigt wird,56 um schließlich um sechs Uhr nachmittags in sein Grab gelegt zu werden.57
Die allgemeine Tendenz des Werks dürfte aus den zitierten Textpassagen deutlich werden: Zwar handelt es sich bei Scultetus’ Diarivm hvmanitatis noch um eine die Berichte der Evangelien harmonisierende Stationsschrift zur Passion. Doch im Gegensatz zu Wankels Geystlich strass oder Adrichems Werken sind es nun nicht die Weg-, sondern vielmehr die Zeitstationen der vita Christi, die mit mathematischer Genauigkeit im Verlauf der Heilsge-schichte festgemacht werden. Damit wird die Größe der messbaren, kalku-lierbaren Zeit, die allgemein im 16. Jahrhundert zunehmend an Bedeu tung gewinnt, auch in die Darstellung der Passion integriert.
51 Ebd., S. 313–501.52 Ebd., S. 383f.53 Ebd., S. 431–442 u. 455–461.54 Ebd., S. 453–501.55 Ebd., S. 470.56 Ebd., S. 482.57 Ebd., S. 495.
Körper und Karte 61
Der heilige Körper und seine wissenschaftliche Konstruktion
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die in der heiligen Geographie gemachten Beobachtungen auch auf andere Illustrationen bibelar-chäologischen Inhalts beziehen lassen. Die Illustration opaker Textstellen zum besseren wissenschaftlichen Verständnis ist sicherlich keine Erfindung der Neuzeit, wie etwa die zwischen 1322 und 1330 entstandene Postilla litteralis super totam Bibliam des Nicolaus von Lyra zeigt.58 Seine figurae etwa zur Arche zeigen bereits einen Ansatz quellenkritischer Darstellung der bib lischen Geschichte, wenn auch nur für das Alte Testament. Ähnlich verhält es sich noch bei späteren Arbeiten mit wissenschaftlichen Illustrationen: Das Neue Testament und damit auch die Passion werden komplett ausgespart, sie sind nicht Teil archäologischen Interesses.59 Um 1540 druckte Robert Estienne eine polyglotte Bibel in Paris.60 Der wissenschaftlich korrekte Anspruch lässt sich auch von der Tatsache ablesen, dass François Vatable, Lektor für hebräische Sprache am Collège de France, die Bibel zur Durchsicht über-sandt worden war.61 Doch auch hier finden sich allein zwanzig Abbildungen der bekannten und bereits seit Lyra institutionalisierten loci biblici wieder, wie Schaubrottisch, siebenarmiger Leuchter, Tempel Salomons oder Arche Noah.62 Erläuternde Detailangaben zu den Bildern wie korrekte Maßangaben finden sich im Text, wobei dem Bild von Estienne eine herausragende Stel-lung eingeräumt wird: Die Bilder illustrieren nicht nur – wie zuvor – den Text. Vielmehr habe er, Estienne, mit Vatable einen Spezialisten gewonnen,
58 Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam, 4 Bde., Nachdruck der Ausgabe Straßburg 1492, Frankfurt a.M. 1971; Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 239f.
59 Siehe zum Folgenden Münch 2009 (wie Anm. 12), S. 241–252.60 Biblia Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina nomina virorum, mulierum, populorum, ido-
lorum, urbium, fluviorum, montium, caeteroriumque locorum quae in Bibliis leguntur, restituta, cum Latina interpretatione […] His accesserunt schemata Tabernaculi Mosaici et Templi Salomoni, quae praeeunte Francisco Vatablo Hebraicarum literarum Regio pro-fessore doctissimo, summa arte et fide expressa sunt, Paris 1540; eingesehenes Exemplar: Wolfenbüttel, HAB, Bibel-S. 2° 183.
61 Vgl. Elisabeth Armstrong: Robert Estienne, Royal Printer. An Historical Study of the Elder Stephanus Oxford 1986 (Courtenay Studies in Reformation Theology; Bd. 6), S. 72–75.
62 Vgl. Paul Naredi-Rainer: Between Vatable and Villalpando. Aspects of postmedieval reception of the temple in Christian art, in: Bianca Kühnel (Hg.): The real and ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art. Studies in Honor of Bezalel Narkiss on the Occasion of his Seventieth Birthday, Jerusalem 1998, S. 220, Abb. 3 u. 4. Zu den Abbildungen vgl. umfassend Max Engammare: Cinquante ans de révision de la traduc-tion biblique d’Olivétan: les bibles réformées genevoises en français au XVIe siècle, in: Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 53 (1991), S. 369–371.
62 Birgit Ulrike Münch
der die bibel archäologischen Illustrationen entworfen habe, da es ohne die-se überhaupt nicht möglich sei, die Konstruktion vom Salomonischen Tem-pel oder der Wohnung des Mose zu begreifen.63 Ein weiterer Theologe, der zwischen 1551 und 1573 fünf Ausgaben der Bibel herausgab, ist Sebastian Castellio.64 Im Gegensatz zu Vatable sind die Illustrierungen nicht im Text, sondern im Anhang zu finden. Der Holzschnitt, der die Arche zeigt, wird in der letzten Ausgabe von einer Legende begleitet, die diesen erläutert, während Didaskalien von A-C der Schemazeichnung der Arche eingegeben sind.65 Max Engammare bezeichnet diese Bilder treffend als „type d´illustration de repré-sentation archéologique savante“ und weist sie als ein Novum aus.66 Auch die Zeitgenossen hoben diese wissenschaftlichen Bilder definitorisch von vorheri-gen Bildern der Kultgeräte ab, wie Sixtus da Sienas 1566 eingeführter Begriff sciographica für diese Art der Bebilderung belegt.67
Dennoch gibt es im Laufe des 16. Jahrhunderts kaum wissenschaftliche Illustrationen zum Neuen Testament, in sehr eingeschränktem Maße etwa in der bereits genannten Polyglotta Montanos.68 Band 5 handelt über das Neue Testament, enthält jedoch kein Titelblatt, Band 6 bis 8 beinhalten einen um-fangreichen wissenschaftlichen Apparat, der Wörterbücher, Grammatiken und kirchen- wie kulturgeschichtliche Abhandlungen umfasst.69 Neben Weltkarten sowie Illustrationen einer hebräischen Münze, die des ersten Schmieds Thu-bal-Kain gedenkt, finden sich vor allem Illustrierungen der Stiftshütte. Dies alles erscheint für die hier aufgeworfene Frage wenig interessant. Doch findet sich in Montanos Werk eine Illustration des toten Christus und zwar innerhalb
63 Biblia Hebraea 1540 (wie Anm. 60), Vorwort: fol. iir-v: „Quibus breviter resondeo, etiam hanc operam nostrum in bonam partem accipienda esse, quod constructionem Taberna-culi Mosaici, de qua in Exodo agitur, et fabricam illam Templi Salomonis, de qua in terio Regum libro tractatur, sine his schematibus nemo quisquam facile et cito assequi queat.“
64 Zu den einzelnen Ausgaben ausführlich Max Engammare: L’illustrations de la Genèse, in: ders. (Hg.): La Genèse 1555. Sébastien Castellion, Genf 2003, S. 93–105.
65 Sébastien Châteillon: Biblia Interprete Sebastiano Castalione, Basel 1573, gedruckt bei Petrus Perna, neunte Illustration. Eingesehenes Exemplar: HAB Bibel-S. 2° 196.
66 Engammare 2003 (wie Anm. 64), S. 99. 67 Vgl. Sisto da Siena: Bibliotheca Sancta a F. Sixto Senensi, ordinis Prædicatorum, ex præ-
cipuis catholicæ Ecclesiæ Auctoribus collecta, et in octo libros digesta […]. Nunc vero a Joanne Hayo Scoto, Societatis Jesu, plurimis in locis a mendis expurgata, atque scholiis il-lustrata, Paris, bei Rolin Thierry, 1610 (identisch mit der Ausgabe von 1566), S. 162–165, eingesehenes Exemplar: HAB A 136.6 Theol. 2°, sowie Engammare 2003 (wie Anm. 64), S. 99f. mit einer Interpretation des Textes.
68 Vgl. Montano 1569–1572 (wie Anm. 37).69 Der wissenschaftliche Apparat mit geographischen, philologischen sowie wirtschafts-
und sozialgeschichtlichen Erläuterungen des Kompendiums wurde weitestgehend von Andreas Masius und Guy Lefevre de la Boderie verfasst, vgl. Leon Voet: The Plantin Press. A Bibliography of the work printed and published by Christophe Plantin at Antwerp and Leiden, Amsterdam 1980, Bd. 1, S. 287–315, Nr. 644.
Körper und Karte 63
einer alttestamentlichen Abbildung der Arche. Die Aufrissmaße des Schiffs werden in Bezug gesetzt werden zu den Körpermaßen eines toten liegenden Menschen.70 Diese Inbezugsetzung erscheint zunächst als rein exegetisches Traditionsgut. Hänsel weist darauf hin, dass schon Augustinus in De civitate Dei XV,26 und hiernach auch Nicolaus von Lyra die Arche als „Vorzeichen Christi interpretiert“ hatten.71 Bei genauerem Hinsehen erweist sich Monta-nos Auslegung jedoch als wesentlich spezifischer: In einer 1556 in Basel bei Johann Oporinus und Michael Martin Stella gedruckten lateinischen Bibel72 finden sich als Anhang zum Alten und Neuen Testament aus der Feder Castel-lios73 unter der Überschrift „Longitudo trecentos cubitos pateat“ folgendes ausgeführt: „Huius arcae dimensionis eadem proportio est, quae hominis supini iacentis, ut me quidam Italus docuit. Erat enim ea arca imago quae-dam hominis mortui iacentis, & tamen reuicturi, ac resurrecturi.“74 Montanos Arche ist analog als lange schmale Kiste sowohl im Längsschnitt in Ober-sicht als auch in Seitenansicht wiedergegeben (Abb. 11). In schwacher Um-risszeichnung ist in die Arche der Leichnam Christi eingepasst. Seine von den Wundmalen gekennzeichneten Füße sind parallel angeordnet, während seine ebenso durchbohrten Hände über die Scham gelegt sind. Zusammen mit dem gescheitelten Haar des frontal wiedergegebenen Kopfes weisen diese Cha-rakteristika eindeutig auf den Leichnam Christi nach dem corpus des Turiner Grabtuches hin. Projiziert wird somit das Bild, das sich anhand des kurz zuvor nach Turin gebrachten Grabtuches rekonstruieren lässt. Zeitgenössische Sin-done-Wiedergaben finden sich etwa auf dem Titelblatt der Sacra Sindone von Alfonso Paleotti, gestochen von Francesco Brizio (Abb. 12).75 In der Polyglot-ta wird also der bei Augustinus lediglich vorbereitete enge Bezug zwischen Christus und der Arche bis zum äußersten konkretisiert – aus irgendeinem Bild eines toten Menschen („imago quaedam hominis mortui“) ist bei Mon-tano das Bild des toten Menschen schlechthin, des toten Christus geworden. Gleichzeitig greift Montano bei dieser typologischen Konkretisierung auf aktuelles Wissen seiner Zeit zurück, wenn er den Leib des Menschensohnes in der zeitgenössisch als historisches Abbild verstandenen Erscheinungsform des Grabtuchs von Turin wiedergibt.
70 Vgl. Montano 1569–1572 (wie Anm. 37) “Haec autem hominis in terra iacentis & mortui secundum longum, latum & altum observata mensuram ratio est”, zu Gen. 6,15.
71 Sylvaine Hänsel: Der spanische Humanist Benito Arias Montano (1527–1598) und die Kunst (Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft; II/25), Münster 1991, S. 42.
72 Sébastian Châteillon: Biblia Interprete Sebastiano Castalione. Unà cum eiusdem Annota-tionibus, Basel 1556. Eingesehenes Exemplar: Wolfenbüttel, HAB, A 70.2° Helmst.
73 Ebd., Sp. 1587–1743.74 Ebd., Sp. 1592.75 Gabriele Wimböck: Guido Reni (1575–1642). Funktion und Wirkung des religiösen Bil-
des, Regensburg 2002 (Studien zur christlichen Kunst; Bd. 3), S. 141.
64 Birgit Ulrike Münch
Montanos Vorgehensweise ist somit zugleich ein Beleg für die zunehmende Archäologisierung der Passionsillustration im Verlaufe des 16. Jahrhunderts, wenn sie auch in der Polyglotte singulär steht. Zu fragen ist, wie das wich-tigste Element dieser „verwissenschaftlichten Glaubenstatsache“ – der Leib Christi – in (bibel-) archäologischen Traktaten geschildert wird. Befragt wer-den soll hierzu die Abhandlung De Crvce Libri Tres76 des Humanisten und Altphilologen Justus Lipsius (1547–1606).77 Innerhalb der drei Bücher zum Thema Kreuzigung bewegt sich Lipsius, der oft als einer der ersten nordal-pinen Antiquare bezeichnet wird, fort von einer rein religiös-dogmatischen Schilderung der Kreuzi gung hin zu einem Katalog der verschiedenen Facetten dieser antiken Todesstrafe. Diese Ausrichtung wird bereits im Untertitel des Buches in der Formulierung, das Werk sei „ad sacram profanamque historiam utiles“ geschrieben, angedeutet und zieht sich als hermeneutischer Leitfaden durch den gesamten Text, der durch 19 Kupferstiche Pieter van der Borchts unterstützt wird, die das Geschriebene illustrieren und besser nachvollziehbar machen sollen.
Lipsius’ Vorgehensweise weist sein Werk deutlich als historisch-archäo-logisches und nicht etwa als theologisches aus. Vielmehr vollzieht er die Ent-wicklung der antiken Kreuzigungspraktiken bis hin zu Christus in einer Art evolutionärem Prozess nach, der ohne Unterbrechung und in gerader Linie auf Christi Kreuzigung zuläuft, also christlichen Heilsplan und Profangeschichte in eins denkt. Die Kreuzigung Christi ist so nur ein Teil einer historischen Ent-wicklung, die man mit den Mitteln deduktiver Geschichtsforschung erläutern kann. Nach Anthony Grafton war für Lipsius „the paganness of the pagans, their historical and cultural distance from modern Europeans […] impossible to ignore“.78 Kann Lipsius bestimmte Sachverhalte nicht anhand von Quellen-material belegen, so will er sich nicht zu Vermutungen hinreißen lassen, son-dern lässt diese ungelösten Fragen als Probleme für spätere Forschung stehen. Als ein Beispiel sei hier die Anzahl der bei der Kreuzigung Christi verwendeten Nägel und der daraus resultierende Nageltypus genannt: Da er sich aufgrund lückenhafter Quellenlage nicht für eine bestimmte Zahl entscheiden will, be-tont Lipsius „si de Christo tamen quaeritur; nescio, et in dissensu Patrum non
76 Justus Lipsius: De Cruce libri tres, Antwerpen 1593; eingesehene Exemplare: Wolfenbüttel, HAB, P 596.4° Helmst.; P 696.4° Helmst.
77 Zu Werk und Biographie vgl. Anthony Grafton: Bring out Your Dead. The Past as Revela-tion, Cambridge 2001, S. 227–241. Zur Profanisierung der Kreuzigung bei Lipsius siehe auch Birgit Ulrike Münch: Towards a Transconfessional Dialogue on Pre-Modern Theo-logical Texts and Images: Some Adnotationes on Nadal, Lipsius and Rubens, in: Celeste Brusati, Karl Enenkel und Walter Melion (Hg.): The Authority of the Word: Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400–1700, Turnhout 2011 (Lovis Corinth Collo-quia; Bd. 3), S. 505–532, sowie dies. 2009 (wie Anm. 12), S. 249–252.
78 Grafton 2001 (wie Anm. 77), S. 242.
Körper und Karte 65
est meum arbitrari“79, er wisse also keine Antwort, wenn diese Frage in Bezug auf Christus untersucht wird, und es sei nicht seine Aufgabe, die Meinungs-verschiedenheit der Kirchenväter zu entscheiden. Was die Form des Kreuzes Christi betrifft, so befürwortet Lipsius die übliche lateinische Form, wie er es im zehnten Kapitel des ersten Buches beschreibt.80 Die im Zusammenhang mit Christus wichtigste Beobachtung ist jedoch, dass Lipsius gerade bei der Diskussion um die Kreuzigung des Gottessohnes auf jegliche Illustration ver-zichtet, sondern den Viernageltypus der Kreuzigung an anderer Stelle ohne Nennung Christi behandelt (Abb. 13). Möglicherweise ist er auch hier in relevanten Einzelpunkten unschlüssig, was eine in seinem Sinne korrekte Illus-trierung im Grunde verbietet.
Die Visualisierung der „historisch wahren Kreuzigung Christi“ wird so-mit bewusst im wissenschaftlichen Apparat und wissenschaftlichen Diskurs des 16. Jahrhunderts vermieden. Dies geschieht erst 1640 in der Arbeit des protestantischen Theologen Georg Calixt (1586–1656) unter dem Titel De vera forma crucis.81 Lipsius habe zwar, so der Text, bezüglich der Kreuzes-form recht gehabt, allerdings in seiner Rekonstruktion ein wichtiges Detail übersehen: das sustentaculum, die zwischen den Beinen befestigte Stütze des am Kreuz hängenden Rumpfes.82 Diese Vorrichtung wird in einem Kup-ferstich in das Bild des im Viernageltypus an das Kreuz gehefteten Christus integriert, während die erste Abbildung der Abhandlung das leere Kreuz mit sustentaculum präsentiert (Abb. 14 und 15). Das Wissen um die profanhisto-rische Kreuzigung einerseits und die heilsgeschichtliche andererseits sind hier nun erstmals zu einer Glaubenswahrheit geworden.
Geglaubtes Wissen – wissender Glaube
Im Prozess der proto-wissenschaftlichen, bibelarchäologischen Exegese der Passion fallen in der Frühen Neuzeit verschiedene Momente eines sich
79 Lipsius 1593 (wie Anm. 76), Lib. II, Cap. IX, S. 47.80 Ebd. Lib. I, Cap. X, S. 22–24.81 Georg Calixt: De vera forma crvcis, Braunschweig, 1640; eingesehene Exemplare:
Wolfenbüttel, HAB, xb 1769; Li 5042. Vgl. zu Calixt in diesem Zusammenhang Christian Thorsten Callisen: Georg Calixtus, Isaac Casauban and the Consensus of Antiquity, in: Journal of the History of Ideas 73 (2012), S 1–23.
82 Calixt 1640 (wie Anm. 81), S. 1: “Quin recte Lipsius: Nimis accurata ea fabbrica, imò delicata. Nempe exobuiis & rudibus lignis crucis structae: & impacto in stipitem susten-taculo, quo uectari corporis moles posset, de pegmate operosè addendo, cui cruciarius commodè pedes imponeret. haut verosimile est sollicitos fuisse.”
66 Birgit Ulrike Münch
verändernden Verständnisses von Glauben und Wissen zusammen: Mit der Reformation entstehen nach einer Überlieferungspause neue Texte, die in beiden Konfessionen von einem deutlichen Drang zur authentischen Bewäh-rung des Beschriebenen durch Augenschein geprägt sind und sich somit nicht mehr auf die Repetition autoritativen Wissens beschränken. Ebenso wird die quellenkritische Beleuchtung opaker Textstellen, wie es sie bereits im Bereich der alttestamentlichen Exegese gegeben hatte, nunmehr auch auf das Neue Testament angewendet. Damit wird dessen Überlieferung als im Modus des historischen Wandels darstellbar und nicht mehr nur als permanent fortdau-ernde, die Gegenwart einschließende Glaubenswahrheit und Glaubenszeit be-griffen. Insbesondere im Medium der Bibelkarte drückt sich diese spezifische Kombination von Glaube und Wissen aus, die nun vermehrt die Lebenszeit und Lebensumstände des menschgewordenen Gottes historisiert. Diese Form frühneuzeitlicher Bibelarchäologie kulminiert in der Historisierung der einen Kreuzigung Christi in einer quellenkritischen Untersuchung zu den vielen Kreuzigungen der Antike durch Justus Lipsius, um dann von Calixt wieder an die religiöse Figur Christi rückgebunden zu werden.
Abschließend sei ein weiteres interessantes Phänomen skizziert: Die Ein-fügung einer Kartenlegende, etwa in Form von geometrischen Figuren, findet sich ebenfalls bereits im 16. Jahrhundert, und zwar im Parergon von Abraham Ortelius aus dem Jahr 1584.83 Zuvor war zwar eine Kombination von raum-struktureller und physiognomischer Ikonizität angestrebt worden. Letzteres ist die abstrahierte Darstellung der Landschaft durch sich wiederholende graphi-sche Einheiten mit Hilfe jeweils feststehender Zeichen – geometrische Signa-turen wurden aber vermieden und kleine Stadtbilder an die Stelle bestimmter Orte eingefügt. Im Parergon, dem umfangreichen „ersten Geschichtsatlas“, findet sich nur in einer Karte eine solche Legende – und dies ist just eine Karte des Heiligen Landes, die nun die beginnende Geometrisierung sehr gut belegen kann. Die Karte wurde von Tilemann Stella geschaffen, ursprünglich bereits um 1557, und war – noch ohne Legende – bereits im Theatrum orbis terrarum des Ortelius enthalten.84 Wie Gyula Pápay betont, können die von Stella verwendeten Signaturen der Legende als Frühform der Figurenkarto-gramme betrachtet werden. Das Ziel sei gewesen, eine möglichst weitgehende physiognomische Ikonizität zu erreichen, was lange Zeit das Grundprinzip der kartographischen Darstellung bleiben sollte.85 Die Tatsache, dass eine Legende
83 Abraham Ortelius: Parergon Sive Veteris Geographiae Aliquot Tabulae, Antwerpen 1584, eingesehenes Exemplar: München, BSB, 2 Mapp. 139.
84 Peter H. Meurer: Fontes Cartographici Orteliani. Das Theatrum Orbis Terrarum von Abraham Ortelius und seine Kartenquellen, Weinheim 1991, S. 244–247.
85 Gyula Pápay: Kartenwissen–Bildwissen–Diagrammwissen–Raumwissen. Theoretische und historische Reflexionen über die Beziehung der Karte zu Diagramm und Bild, in:
Körper und Karte 67
versehen war, zeigt für die hier aufgeworfenen Fragen wiederum, dass die Topographie des Heiligen Landes und insbesondere Jerusalems sowie seine Vermessung von außergewöhnlicher Relevanz waren und Innovationen der Kartographie gerade im Umgang mit diesen besonders erklärungswerten, aber auch besonders erklärungsbedürftigen Karten der geographia sacra nachweis-bar sind.
Abbildungsnachweis
Abb. 1–15: Archiv der Autorin.
Stephan Günzel und Lars Nowak (Hg.): KartenWissen. Territoriale Räume zwischen Bild und Diagram, Wiesbaden 2012 (Trierer Beiträge zu den historischen Kulturwissenschaf-ten; Bd. 5), S. 45–61, bes. S. 54–57, ebenso: Ders.: Die Anfänge der Geschichtskartogra-phie, in: Dagmar Unverhau (Hg.): Geschichtsdeutung auf alten Karten. Archäologie und Geschichte, Wiesbaden 2003 (Wolfenbütteler Forschungen; Bd. 101), S. 165–191, hier bes. S. 177f.
68 Birgit Ulrike Münch
Abb. 1: Nicolas Poussin, Die Eucharistie, aus dem Gemäldezyklus ‚Die sieben Sakramente‘, 1644–1648, National Gallery of Scotland, Edinburgh.
Körper und Karte 69
Abb. 2: Christiaan van Adrichem: Theatrvm Terrae Sanctae et Biblicarvm Historiarvm cum tabulis geographicis aere expressis, Köln 1600, Titelblatt mit Moses und Josua.
70 Birgit Ulrike Münch
Abb. 3: Christiaan van Adrichem: Iervsalem et suburbia eius, sicut tempore Christi floruit, Köln 1590, Karte der Stadt Jerusalem, 515×715 mm.
Abb. 4: wie Abb. 3: Detail des Palastes von Pilatus.
Körper und Karte 71
Abb. 5: wie Abb. 3: Detail: Der erste Fall Christi und die Begegnung mit Johannes und Maria.
Körper und Karte 73
Abb. 7: Pieter Huys, Jerusalem Antiqua, Kupferstich, in: Benito Arias Montano, Biblia Poly-glotta, Antwerpen, 1569–1572, Karte des alttestamentlichen Jerusalem mit Golgatha und drei leeren Kreuzen.
74 Birgit Ulrike Münch
Abb. 8: Romeyn de Hooghe, Hierusalem, Kupferstich, um 1660. Geosteter, imaginärer Jerusa-lemplan mit dem Salomonischen Tempel mit zwei Legenden, 302×379 mm.
Abb. 9: Johann Daniel Herz d.Ä., Jerusalem, Kupferstich, Augsburg um 1735. Karte der Stadt Jerusalem mit Szenen der Passion Jesu, 795×1185 mm.
Körper und Karte 75
Abb. 10: Nikolaus Wanckel, Die Geystlich straß, Nürnberg 1521, Kreuzannagelung, Holzschnitt, fol. g4 r.
76 Birgit Ulrike Münch
Abb. 11: Pieter Huys, Die Arche Noah mit den Idealmaßen des toten Christus, Kupferstich, aus: Benito Arias Montano, Biblia Polyglotta, Antwerpen, 1569–1572.
Abb. 12: Francesco Brizio, Titelblatt des Autors mit dem Grabtuch Christi, Holzschnitt, in: Alfonso Paleotti, Esplicatione del sacro lenzuolo, Bologna 1599, Detail: obere Hälfte des Titels.
Körper und Karte 77
Abb. 13: Pieter van der Borcht, Gekreuzigter im Viernageltypus, Kupferstich, in: Justus Lipsi-us, De cruce libri tres, Antwerpen 1594, 2. Buch, S. 51.
78 Birgit Ulrike Münch
Abb. 14: Das leere Kreuz mit sustentaculum, Kupferstich, in: Georg Calixt, De vera forma crucis, Braunschweig 1640, S. 16.