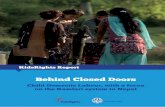"Doors of perception" versus "Mind control". Experimente mit Drogen zwischen kaltem Krieg und 1968
Transcript of "Doors of perception" versus "Mind control". Experimente mit Drogen zwischen kaltem Krieg und 1968
Jakob Tanner, "Doors of perception" versus "Mind control
". Experimente mit Drogen zwischen kaltem Krieg und 968, in: Birgit Griesecke u.a. (Hg.), Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2009, S. 340-372.
Koloniale Humanexperimente in Togo, medizinische Versuche in den NSKonzentrationslagern, Drogenexperimente im kalten Krieg: Menschenexperimente sind ethisch brisant und kein beliebiges wissenschaftliches Verfahren unter .anderen. In Menschenexperimenten fallen Subjekt und Objekt des Wissens zusammen und werden Forschungsinteressen nicht selten von ideologisch motivierten Interalnionsformen überlagert. Das betrifft die Sozialstrukturen innerhalb eines Labors ebenso wie die anthropologischen Vorannal,men sowie die populärkulturellen Phantasmen, die die Geschichte des Menschenversuchs prägen. Die Beiträge dieses Bandes befragen die vielfältigen und nicht selten tödlichen Menschenversuche in Medizin, Psychologie und Gesellschaftswissenschaften des 20. Jallfhunderts auf solche kulturellen Kontexte und beleuchten die fundamentale Bedeunmg, die dem experimentellen Blick für das Menschenbild der Moderne zukommt.
Birgit Griesecke ist Philosophin und Japanologin sowie wissenschaftliche Mirarbeiterin am Zentrwn für Literatur- und Kulturforschung in Berlin.
Mareus Krause ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kulturwissensehaftlichen Forschungskolleg »Medien und kulturelle Kommunikation« an der Universität zu Köln.
Nicolas Pethes ist Professor für Neugermanistik an der Ruhr-Universität Bochum.
Kat ja Sabisch ist Juniorproressorin für Gender Studies an der Ruhr-Universität Bochuffi.
Im Suhrkamp Verlag haben sie herausgegeben: Menschenversuche. Eine Anthologie I750-2000 (srw 1850).
KUlturgeschichte des Menschenversuchs
im 20. Jahrhundert Herausgegeben von
Birgit Griesecke, Marcus Krause, Nicolas Pethes
und Kat ja Sabisch
Suhrkamp
2003
Jakob Tanner )Ooors of perceptioll< versus )Mind control<
Experimente mit Drogen zwischen kaltem Krieg und 1968
Drogen sind polyvalente und multifunktionale Substanzen; die Wirkung, die sie auf Menschen haben, ist nicht erklärbar, wenn nicht die Gebrauchsweisen, die institutionellen Settings, der rechtliche Status, das vorhandene Wissen, die vielfältigen Wünsche und Ängste sowie die gesellschaftliche Stellung jener, die sie konsumieren, berücksichtigt werden. Stoffe, die unter die Sammelbezeichnung »Drogen« fallen, können ebenso als Medikamente fiir die fuchgerechte Behandlung physischer und psychischer Störungen, als Bestandteile medizinischer Experimente, als Vehikel fiir Bewußtseinserweiterungen, als illegale Sucht- und Fluchtstoffe, als militärische Kampfmittel, geheimdienstliche "Wahrheitsdrogen« oder auch ganz einfach als Gift genutzt werden. Zwischen Verwendung und Bedeutung bestehen Wechselwirkungen, und es sind gesellschafTliche Zielsetzungen, politische, militärische oder kulturelle Projekte, welche diese doppelte Kontingenz durchbrechen und die Bewertung dieser SubstalYlen in bestimmten Kontexten stabilisieren.'
1. Drogen, kalter Krieg und Konsumkultur
In den 1950er und 1960er Jahren fungierte insbesondere Lysergsäurediäthylamid (LSD-25) als Aufmerksamkeitsattral<tor in ganz unterschiedlichen Bereichen. Diese Substanz, die 1938 von Albert Hofmann in den Basler Sandoz-Laboratorien erstmals synthetisiert worden war und deren radikale bewußtseinsverändernde EigenschafT dieser Chemiker 1943 per Zufall an seiner eigenen Person erfuhr,
1 Einen brcircn Überblick über die Gcschich(C der Drogen geben: Richard Davenport-Hine" The Purmit ofObliviol1. Ag!oba! Hutory ofNarcotics, I500-2000, London 2001; Richard Rudgley, Thc Alchemy ofCulture.lntoxicants in Society. London 1993·
Zur wissenschafdich-experimentellen Verwendung von Drogen vgl. Nicolas Pethes!
ßirgit Gricsccke/Marcus Krause/Katja Sabisch (Hg.), Menscbenversuche. Eine Anthologie I?SO-2000, Fral;kfurt am Main 2008, Sektion I (S·33-89)·
:::A ()
spielte in naturwissenschaftlichen, medizinischen, psychiatrischen, psychologischen und militärischen Forschungsfeldern eine Rolle. LSD regte Experimente an, alimentierte künstlerische Ambitionen und inspirierte kontestativ-rebellische, aber auch konsumistischrekreative Pralruken. Im gesellschaftlich Imaginären standen sich mind controf und die doors of perception spiegelbildlich gegenüber: LSD als schier omnipotenter Stoff schien kollektive Bewußtseinssteuerung und individuelle Selbstverwirklichung gleichermaßen zu ermöglichen, es stand auf paradoxe Weise sowohl fiir neue Machttechniken, die bei einer Kontrolle der Hirne ansetzen, als auch für die Kritik an gesellschaftlichen HerrschafTsstrul<turen, die ebenfalls hirnchemisch auf das Bewußtsein einwirken.2 Auch wenn die »Gehirnwäsche«, ein Mythos des kalten Krieges? als das genaue Gegenteil der psychedelischen Mystik der counterculture wahrgenommen wurde, läßt sich doch eine seltsame Nähe zwischen den beiden Phänomenen konstatieren. Die paranoiden Ängste vor der totalen mentalen Kontrolle durch unsichtbare Machtz:entren mittels psychoaktiver Agenzien4 und die delirierenden Heilserwartungen, die in chemische »Türöffner«5 zu neuen Bewußtseinsräumen gesteckt wurden, sind seitenverkehrter Ausdruck der Vorstellung, Bewußtsein ließe sich mit Substanzen nicht nur beeinflussen, sondern grundlegend neu konfigurieren. Beide Male wurden Stoffen metaphysische, das heißt über die menschliche Physis hinausreichende Wirkungen zugeschrieben. Es brauchte zwar den stofflichen Hebel, wn geistige Prozesse eines neuen Typs in Gang zu bringen; die spiri-
2 Eine ernüchternde Analyse des LSD leistet Günrer Amcndt, Die Legende vom LSD, Frankfurt am Main 2008. Vgl. auch: Stanislav Grof, Topographie des Unbewliflten. ISD im Dienst der tiefenp.sychologischen Forschung, Stuttgart 1991.
3 101m Buckman, ))Brainwashillg, LSD, and CIA: Historical and Ethical Perspectivc«. in: Internationaljournal ofSocial Psychiatry 23 (1977), S. 8-19.
4 Fran Mason. »Mind Control .. , in: Peter Knight u. a. (Hg.), Conspirary Theories in American History. An Encyclopedia, Santa Barbara 2003. S. 480-489; Martin A. Lee, Bruce Shlain. Acid Drcams - Thc Completc Social HIStory of LSD. Thc cu thc Sixties. andBeyond, London u.a. 2001 (erstmals 1985); MartinA. Lee, )Truth Serums & Tonure,c, in: The Journal ofCognitive Liberties 3/2 (2002), S. 77-82. Zur fiktionalen Psychodynamik des kalten Krieges vgl. auch: Eva Horn. Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion, Frankfurt am Main 2007.
5 Die Bezeichnung ><foors of perceptionc stammt VOll Aldous Huxley, Die Pforten der wahrnehmung. Himmel und fIölle. Eifahrungen mit Drogen, München 1981 (erst
mals 1954 bzw. 1956); ins Esoterische gewendet wird die Erwanung bei Timothy Leary, Thc Polities ofEestasy, London '970.
tuelIen Durchbrüche bzw. die Umpolung der Persönlichkeit folgten indessen nicht einer Logik, die sich mit biologischen Dispositionen erldären ließe. Das Menschliche wies ein unabsehbares Transformationspotential auf und konnte somit zur Projektionsinstanz für alles mögliche werden." .
In der »Kultur des kalten Krieges« der 1950er und 1960er Jalrre kontrastierten die Wahrnehmungs- und Deutungshorizonte von Drogen besonders stark. Für die einen waren Stoffe wie LSD wirksame WatTen in der Auseinandersetzung mit einem Feind, dem man ebenfalls Experimente mit bewußtseinsverändernden Stoffen unterstellte. Für andere dienten sie als Vehikel der Gegenkultur und der Protestbewegungen. Und dann gab es jene Strömungen, vor allem in der Psychiatrie, welche in diesen Drogen ein Therapeutikum salren, das »verrückten« Menschen einen Weg zurück in die Normalität eröffnen konnte. Diesen medizinisd,en Gebrauch von LSD und andern psychoaktiven Stoffen betonend, kritisierte Erika Dyck7 die Fokussierung der historischen Forschung auf militärisches mind controlund psychedelische doors ofperception. Die Autorin weist darauf hin, daß sich in den 1950er Jalrren diese »much more complex hisrolY ofLSD in psychiatry«8 in einem durch Tausende von wissenschaftlichen Studien dokumentierten Enthusiasmus manifestierte, der davon ausging, mit Hilfe psychotomimetischer, psychotroper und anti psychotisch wirkender Stoffe könnten psychisdIe Störungen auf neue Weise verstanden und die therapeutische Praxis nachhaltig verändert werden.' In diese Anstrengungen waren unterschiedliche Substanzen involviert. Ab 1951 löste das als Largactil und Megaphen vermarktete Chlorpromazin in der psychiatrischen Praxis eine »chemische Revolution« aus.!O Als PsydIopharmaka eines
6 VgL zu dieser Überlegung: Michael HagneriErich Hörl (Hg.), Die Transformation des HUlJutnen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik. Frankfurt am Main 2008. Auf denselben Annahmen beruhte auch die Erwartung, Intelligenz ließe sich >kllnsdich< herstellen.
7 Erika Dyek, >,Flashbackt Psychiatrie Experimemacion with LSD in Historical Perspccüvc«, in: Canadian}ournalofPsychiatry 50/7 (2005), S.381-387.
S Ebd., S. 382. 9 Ebd.
10 Katharina ßrandenberger, Wissen ums Nichtwissen. Psychopharmaka-Prüfong an tier PsychiatrischeJJ Universitiitsklinik Zürich in den I970er Jahren, unveröffentlichte Lizcmiarsarbcir, Zürich 2007. VgL des weiteren: Brigitte Wo&gon, »Entwicklung der Psychophannakothcmpieil, in: Schweizer Archiv for Neurologie und Psychia-
342
neuen Typs, die später als Neuroleptika bezeichnet wurden, beinhalteten sie nicht nur das Versprechen, Psychosen medikam~ntös heilen zu können. Sie sollten es auch ermöglichen, die »Natur{( des menschlichen Geistes besser erfassen und kontrollieren zu lernen. Mitte der 1950er Jalrre wurde das psydIopharmazeutische Arsenal um Antidepressiva und gegen Ende des Jalrrzehnts um Pillen auf Benzodiazepin-Basis, sogenannte Tranquilizer wie Valium und Librium, ergänzt, deren Verwendungsspektrum über die Anstalten hinaus in die Gesellschaft hinein ausgeweitet wurde. Auch die Idee, mittels LSD Modellpsychosen zu erzeugen, die neue Einsichten in die Wirkungsmechanismen arzneimittelgestützter Therapieformen und in die Verlaufsform geistiger Störungen in Aussicht stellten, fand in den 1950er Jalrren zunehmende Resonanz in der medizinischen und psychiatrischen Scientific CommuniryY Es wurde versucht, unter Laborbedingungen schizophrene Symptome bei normalen Freiwilligen nachzualrmen - vo1). dalrer der Begriff »psychotomimetisch{(. LSD wutde - zusammen mit anderen Halluzinogenen wie Meskalin, Psilocybin, Cannabis - zur Ingredienz der medizinisch-psychiatrischen ExperimentalkulturY An einer der ersten wissenschaftlichen LSD-Konferenzen, deren Finanzierung die Josialr Macy-Foundation ermöglidIte, wurde 1959 eine Bilanz über unterschierlliehe Erfalrrungen mit dieser »Wunderdroge{( l3 und insbesondere deren therapeutisches Potential sowie die psychedelischen Eigenschaften gezo-
trie 125 (1979), S. 271-285; Philippe Pignarre, Psychotrope Kräfte. Patienten, Macht, Psychopharmaka, Zürich, Berlin 2006; Ray Moynihan/ Alan Cassds, Selling Sickness. How the Worfti's Biggest Pharmaceutical Companies are Ttlrning #s alt into Patients, New York 2005.
I I Roy E BaumeisterlKathleen S. Placidi, »A Socia! HisrolY and Analysis of the LSD Controversy«, in: Journal of Humanistic Psychology 23/4 (r983), S. 25·58; Jolm R. Neill, »)More than Medica! Significance<. LSD and American Psychiatry 1953-'966«, in: Journal ofPsychoactive Drugs 19/r (1987), 5.39-45; E. Gouwulis-MayfranklL. HermleIB. Thelen/H. Sass, »History, Rationale and Potential ofHuman Experimental Hallucinogenic Drug Research in Psychiatry«, in: Pharmacopsychiatry31 (1998), Supp!. 2, S. 63-68;J. Fadiman/C. Grob/G. BravolA. Agar/R. Walsh, »Psychedelic Research Revisited«, in: Journal 0/ Transpersonal Psychology 3512 (2003), S. IU-125.
12 Besonders bekannt wurden die von Abram Hoffer und Humphry Osmond in Saskatchewan unternommenen Versuche, mit LSD eine Model1psychose zu konstruieren. Vgl. Dyck, »Flashback« (wie Anm. 7), S. 383.
13 So wurde sie vom Entdecker Albert Hofmann bezeichnet. VgL ders., LSD _ mein Sorgenkind. Die Entdeckung einer »Wimderdroge«, München 1994.
,,"
gen.'4 Der Psychiater Paul H. Hoch (Columbia University) erklärte in der Eröffnungsrunde, in welcher sich alle Teilnehmer in einem kurzen Statement über ihren Umgang mit LSD äußerten, in verallgemeinernder Weise:
Drugs are one avenue through which to find out whether or not mental states can be altered experimentally; whether similar responses can always be cvoked, or whether the responses vary; whar the similarity is between experimentally-produced mental stares and those occurring spontaneouslyP
Gleichzeitig interessierten sich in der Ära des beginnenden kalten Krieges auch Armeen und Geheimdienste für das bewußtseinsverändernde Potential und die Kontrollkapazität von Substanzen wie LSD. Das »Gleichgewicht des Schreckens«, alsbald mit dem Akronym MAD (mutual assured destruction) bezeichnet, war darauf angelegt, eine direkte militärische Konfrontation zu verhindern. Die Abschreckungslogik (»Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter!«) ging davon aus, daß die Perfektionierung von ABC-Waffen ihren Einsatz effektiv verhindern würde. Atomare, biologische und chemische Kampfstoffe richteten sich allerdings auch direkt gegen die feindliche Zivilbevölkerung und waren Teil einer psychologischen Kriegsführung. Sie waren etwa mit der Vorstellung verbunden, es könnte gelingen, den Gegner mit neuen Kampfformen rasch außer Gefecht zu setzen (z. B. »LSD im Trinkwasser«). Auch der Einsatz von »Wahrheitsdrogen« stellte ein obsessiv verfolgtes Ziel der »neuropharmakologischen Militärforschung«16 dar. Schon in den flühen 1950er
14 Dieser Anlaß wird in der Regel als »erste wissenschaftliche Konferenz über LSD«
bezeichnet. Vgl. z. ß. Amend(. Die Legende vom LSD (wie Anm. 2), S. 10. Frank Fremont-Smith eröffnet die ,)Imroductory Remarks{{ zu dieser Konferenz allerdings
mir der Bemerkung: ))During rhe two and a half years sillce our earlier conference on the use of LSD as an adjuvam in psychorherapy«. Harold A. Abramson (Hg.), Thc Use vf LSD in Psychotherapy. Transactions of a Conftrcence on D-lysergic Acid Diethylamide (LSD-25), April 22, 23, and 241959, Princeton N.]., New York 1960, S.7. LSD-25 wurde bis 1966 von der Sandoz AG (in den USA vor allem über die dortigen 'T'ochtergcscllschaften) für die experimemellc Überprüfung seiner Wirkung meist gratis zur Verfügung gestellt. VgL u. a. Dyck, )}Flashback« (wie Anm.
7), S, 386. Allerdings in abnehmendem Maße, so daß RichardAlpers und Timo(hy Lcary den Stoff schon 1961 über die britische Firma Lights & Co. bes<;:hafften. Roben Greenfidd, Timothy Leary. A Biography, Harcourt 2006, S. 330.
[5 Macy-Konfcrcnz 22. bis 24. April 1959: Abramson (Hg.), The Use o[ LSD {wie Anm.14),S.2I.
16 Amendt, Die Legertde voni LSD (wie Anm. 2), 5.120.
344
Jahren - und zeitlich parallel zum Aufstieg von Psychopharmalm in der Psychiatrie - setzte ein verborgener Wettlauf um die militäri-· sche Verwendung von »Substanzen mit Waffenpotential" ein, der in den USA Forschungsprogramme wie MK-ULTRA auslöste, welche auch die chemisch unterstützte radikale Umprogrammierung von Individuen anstrebten.'? Zwischen diesen Armeeanflrägen, Geheimdienstaktivitäten und den psychiatrischen Kliniken gab es intensiv genutzte Schnittstellen: Medizinische und militärische AufgabensteIlungen gerieten in ein osmotisches Austauschverhälrnis.
Für neue bewnßtseinsverändernde Stoffe wie LSD blieb allerdings anßerhalb dieser Militarisierung und Medilmlisierung ein beträchtlicher experimenteller Spielraum. Dieser war so groß, daß 1957 der Psychiater und »ModeUpsychosenbauer« Humphry Osmond, angeregt durch den Erfolgsanror und Selbstexperimentator Aldons Huxley, den Begriff psychedelic prägte, und zwar in Absetzung zu psychopathisch oder psychotomimetisch. Das Attribut psychedelic soUte Distanz zu einem patllOlogisierenden Disknrs schaffen und die kreative Qualität einer durch LSD, Psilocybin oder Meslmlin, oder auch durch DMT (Dimethyltryptamin), MDMA (Ecstasy) und Cannabis ansgelösten Rauscherfahrung betonen. Es kam zu heftigen Kontroversen zwischen den Anhängern eines elitären Gebranchs bewußtseinserweiternder Drogen (zu denen Aldous Huxley gehörte) und Psychedelic-Proselyten wie Timothy Leary.18 Letztere strebten durch eine geeignete Erziehung einen gleichsam flächendeckenden Zugang zu drogeninduzierten persönlichkeitsverändernden und im Mengeneffekt auch geseUschafisbefreienden »grandiosen Erlebnissen« an; erstere warnten vor den Horrortrips sowie letalen Abstürzen, die aus einem undifferenzierten LSD-Kult resultierten, nnd prägten 1970 das Adjektiv entheogen, mit dem rirnell kontrollierte schamanistische und religiöse Gebrauchsweisen bezeichnet wurden. l9
Vor allem nach 1964 nahm der Konsnm bewußtseinsverändernder Drogen zu, um schließlich zum kontestativen Markeuzeichen
17 Ebd.) S. 120; zur halluzinatorischen Qualität dieser Forschung mit Halluzinogenen vgl. Horn, Der geheime Krieg (wie Anm. 4).
18 Vgl. (Imp:llwww.entheogene.de).
19 Vgl. dazu die Schilderwlgen in Grof, Topographie des UnbewtljSten (wie Anm. 2). Eine EnClauberung dieses Kultus leistet Amendt, Die Legende vom LSD (wie Anm.2).
345
der Kulturrevolution von I968 bzw. - etwas weiter gefaßt - der annr!es 68 zu werden. Als Reaktion darauf wurde das Prohibitionsregime ausgeweitet.20 Während Opiate (Morphium, Heroin), Kokain und Cannabis (Haschisch und Marihuana) in der ersten Hälfte des 20; Jahrhunderts in die Illegalität abgedrängt wurden, handelte es sich bei den Psychedelika um Sroffe, die nach einer Phase medizinischer Wertschätzung und militärischer Vereinnahmung seit den frühen I960er Jallren mit sozialer Unrast und politischen Unruhen in Verbindung gebracht undöffenclich angegriffen wurden. Aufgrund dieser symbolischen Starusdegradierung geriet LSD 1966 auf die Liste der illegalen Stoffe der US Food and Drug Administration?!
Das Verbot trug dazu bei, daß psychedelische Drogen gegenläufig zur Einbuße an offizieller Reputation an gegenkulrureller Attraktivität gewannen. Wurden sie auf der einen Seite mit Normübertrerung, Ordnungsstörung sowie Sittenverfall assoziiert und mit a1armistischer Rherorik bekämpft, so stiegen sie auf der anderen Seite zum signifikanten Symbol für ein alternatives Lebensgefühl im Zeichen von Sex, Drugs 6-Rock 'n' Roll auf. Die Prohibitionspolitik verstärkte die Neigung, die inkriminierten Drogen zum Vehikel für politischen Protest und persönliche Verweigerungshalrung zu machen. Der I966 von Timothy Leary verkündete Dreisprung turn on, tune in, and drop out wurde, zeitlich stimmig, zum Menetekel einer Jugend, die sich gar nicht mehr mit den Normen der Mehtheitsgesellschaft identifizieren, sondern »anssteigen« wollte. Weil das Establishment prompt repressiv reagierte, wie die Gegenseite dies elwartet hatte, eignete sich fortan insbesondere LSD für Provokationen. Das begann schon im Momenr des Verbots am 6. Oktober 1966, als zeitgleich mit dem Verbot im Golden Gate Park in San Francisco mit einem ersten Human Be-In eine neue Phase gegenkultureller Manifestationen eröffnet wurde. Eine »Declaration of Independence« markierte den Gegenpol zum »unamerikanischen« Verbot, und die Ordnungshüter wurden durch das öffentliche »Ein-
20 Siehe z, B. Jcromc L. Him01dsrcin. The Strange Career ofMarihua~a. Politics and ldeo!ogy ofDrug Contro! in America, Westport, Cono., London I983. Das Eioheitsabkommen über die Betäubungsmittel aus dem Jahr 1961 bezog sich auf Cannabis, Kokain und Opium. Die Konvention über psychotrope Substanzen, die 1971 zustande kam und 1976 in Kraft trat, verbot die bekannten Halluzinogene nahezu vollständig.
21 Im sclbenJahr zog Großbritannien nach, 1967 folgte Deutschland.
346
werfen« der psychedelischen Pille herausgefordert. Die Polizei war durchaus bereit, den brachialen Part in der Konflilneskalation zu spielen, wmrend Timoiliy Leary LSD neu als »Let the State Disintegrate« ausbuchstabierte.22
Zu Beginn der 1970er Jahre brach allerdings die zunächst produktive Dynamik dieser kulturellen Auseinandersetzung zwischen Establishment und revoltierender Jugend ein. In Westeuropa und den USA zeichnete sich eine Verschärfung des Abwehrkampfes gegen die Drogengefahr ab, die in einen veritablen Krieg gegen diesen »Feind Nummer eins« überführt wurde. Zeitgleich zerstreute sich der breite gegenkulrurelle Aufbruch von 1968 in politische Parteien und Lebensstilgruppen. Das soziale Korrelat zum ebenso erbittert geführten wie aussichtslosen war on Drugs war die No-Future-Generation, die sich nun verstärkt auf Opiate (vor allem Heroin) verlagerte und die den 1970er Jahren das Gepräge gab.
Im Folgenden wird zunächst - anhand eines berühmt gewordenen Beispiels - auf die psychedelischen Drogenexperimeme der frühen 1960er Jahren eingegangen; anschließend ist von militärischen Kampfstrategien die Rede. Dabei zeigt sich, wie nahe sich (militärische) BeWußtseinskontrolle (mind controt; und (psychedelische) Bewußtseinserweiterung (doors ofperception) kommen.23 Psychedelisches Ausbrechen aus der normierten Kontrollgesellschafi:, »chemische« Heilung von Geisteskranken, »Um-Erziehung« (re-education) von autoritären Charakterrypen sowie Steuerung und Re-Programmierung von Menschen in militärischer Absicht: All diesen Vorstellnngen und Projekten liegen dieselben kognitiven Ermögliclmngsbedingnngen zugrunde. Es ist eine These dieses Aufsatzes, daß es in diesen von mrer politischen Zielsetzung her teilweise kontrastierenden Handlungsfeldern und Forschungsrichrungen eine Familienähnlichkeit der Bewußtseinskonzepte gibt und daß sich weitgehen-
22 Diese erste Demonstration fand im Panhandle (einer Verlängerung des Golden Gate Parks) statt. Über die Rolle, welche LSD nach dem Herbst 1966 in einer ganzen Reihe von Be-Ins spielte, gibt es unterschiedliche Berichte. Wichcig war das große Be·lnam 14-lanuar 1967. VgL 2.B. Greenfield, TimothyLeary{wieAnm.14), S. 297-309; lohn Higgs, I Have America Surrouncled. The Lift ofTimothy Leary, Fort Lee 2006, S. 85-87.
23 DieserTeil stützt sich auch auf Recherchen von MagalyTornay, die an der Universität Zürich an einer Dissertation zur Geschichte der Psychopharmaka in der Schweiz arbeitet. Ein Dank geht auch an Nicolas Langlitz fürvide weiterführende Hinweise.
,.~
;::1
lil ,'d
de Überschneidnng in den theoretischen Begründungsmustern und formale Homologien in Experimentalsystemen zeigen, was anch seltsame Forscherkarrieren zur Folge hatte.
2. Good Friday, 20. April 1962: Psilocybin und Religion
In den beginnenden 1960er Jahren ging die relative Unbeschwertheit, mit der zuvor in nnterschiedlichen Kontexten Experimente mit psychedelischen Drogen durchgeführt werden konnten, zu Ende. Ein Menschenversuch, der in dieser Übergangsphase stattfand, ist das berühmt gewordene Good-Friday-Experiment, das von dem Arzt, Theologen und Religionsphilosophen Walter N. Pahnke am 20. April 1962 in Boston durchgeführt wurde.24 Pahnke, der bei Timothy Leary und Richard Alpert eine Dissertation in Religionsphilosophie schrieb, wollte herausfinden, ob mittels Psilocybin -auch magie mushroom genannt - eine tiefe religiöse, mystische Erfahrung gemacht werden könne. Es ging um nichts weniger als um den Nachweis, daß psychoalnive Stoffe ein funktionales Äquivalent für ein Sakrament darstellten. Für das Experiment, das von Leary zunächst kritisiert und abgelehnt wurde, hatte Pahnke eine soziokulturell relativ homogene Testpopulation zusammengestellt: Bei allen Teilnehmern handelte es sich um protestantische Theologiestudenten mit middle-elass-baekgroundY Die Versuchspersonen wurden in den Wochen vor dem Experiment sorgfältig ausgeleuchtet und intensiv auf ihre Rolle vorbereitet. 26 Auf Drängen Learys be-24 PalmIn! beschreibt das Experiment in seiner Dissenation Drugs andMysticism: An
Analysis oftbe Relationship between Psychedelic Drugs and the Mystical Consciousness, unpublishcd Ph. D. Thesis, Harvard Univer~jty, Cambridge, Mass. 1963. und in verschiedenen Aufsätzen, so in )JLSD and Religious Experience(( im Sammelband Richard C. DeBold!Russei C. Leaf (Hg.), LSD, Man & Soci,ty, Middletown 1967. Hier wird die Internet-Version zitiert (hrtp:llwww.dtuglibrary.org/schafferllsdl pahnkc3.l1tm>. Eine Kurzheschreibung dcs Experimcnts findet sich auch in: Reto U. Schneider. Dtfs Experiment - Karfreitag auf Drogen. [962 erlebte11; zehn Theologiestudenten in Bostoll den besten Gottesdienst ihres Lebells, NZZ-Folio 2004 Nr. 8 (h up:1 J www-x.nzz.ch!folio!archiv!2004l08!articles/cxperiment.htm1). Vgl. auch: Rcto lJ. Schneider, Das Buch der verrockten Experimellte, München 2004. VgL auch: Higgs. I Have Ameriea Surrolmded (wie Anm. 22), S. 35; Greenfield, Timothy [eflry (wie Anm. 14), S.180-184.
25 Die Studenten kamen aus der Andover Newton Theological School. 26 I)In (he wecks beforc the experimem, each subject participated in five hours of va-
348
schränkte Pahnke die Teilnehmerzahl auf zwanzig, und am Gründonnerstag trafen die bei einem Psychiater bestellten Psilocybin-Pillen ein. Diese wurden pulverisiert und' in numerierte Umschläge abgefüllt.
Dies war nötig, weil Pahnke das Experiment als Doppelblindtest konzipiert hatte. Die Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Zehn der Probanden, die Experimentiergruppe, erhielten je 30 Milligramm Psilocybin,27 die anderen zehn, die als Kontrollgruppe fungierten, schluckten ein al{tives, ebenfalls zu körperlichen Reaktionen führendes, jedoch nicht psychedelisch wirkendes Placebo, das aus 200 Milligramm Nikotinsäure bestand. Dazu kamen noch zehn Begleitpersonen, die ebenfalls zur Hälfte auf Psilocybin, zur· andern Hälfte auf Placebo gesetzt wurden. Pahnke wollte zunächst die Leitungspersonen aus dem Drogenkonsum herausnehmen, doch Leary widersetzte sich diesem Plan mit dem Argument, man wolle kein »doctor-patient-game« spielen.2• Am nächsten Morgen versammelte sieh die Gruppe, schluckte die vorbereiteten Pulver und wartete ab. Trotz der strengen methodischen Testvorkehrungen wußten allerdings nach einer halbe Stunde alle, wer the real thing und wer bloß Nikotinsäure bekommen hatte. Anschließend verlagerten sich die Teilnehmer in die Marsh Chapel, die auf dem Campus der Boston Universiry steht. Hier wurden sie von Howard Thurmond, dem afroamerikanischen Pastor und Mentor Martin Luther Kings, empfangen. Er begleitete die Gruppe in einen Raum unterhalb der Kapelle, wohin die oben stattfindende »Sacred-Three-HourVigil« per Lautsprecher direkt übertragen wurde. Das »Miracle of Marsh Chapel« nahm mit Orgelmusik, Chor- sowie Sologesang und Beten seinen Gang.29
fious preparation and screening procedures which included psychological tcS[S, medical history, physical exatnination, questionnaire evolution of previous religious experience, intensive interview, and group imeraction.« Wal[cr N. Pahnke, })LSD and Religious Experience(, in: LSD, Mall & Soeiety 1967. S. 634 (http://psychedelic-library.org/pahnke3·htm) . .
27 Psilocybin (nach der IUPAC-Nomenklatur O-Phosphoryl-4-Hydroxy-N, N-dimethyltryptamin, Trivialnarnen: CY-39, Indocybin) gehärt zur Gruppe der Allmloide. Es kommt in verschiedenen Pilzen vor, welche landläufig als Zauberpilze oder magie mushro.oms bezeichnet werden.
28 Greenfield, Timotlry Leary (wie Anm. 14), 5.180. 29 Walter N. Pahnke, ))The Contribution of the Psychology ofRe1igion (0 ehe Thera
peutic Use ofme PsychcdeIic Substanccs«, in: HaroldA.Abramson (Hg.). Thc Use
349
Während des Experiments wurden die Versuchspersonen intensiv beobachtet,. und unmittelbar danach fand eine ausfuhrliehe Befragung über ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle statt. Dies wiederholte sich einige Tage später und dann wiederum nach einem halben Jahr, wobei die Gespräche auf Tonband aufgezeichnet wurden. Zusätzlich hatten alle Beteiligten ihre Erfahrungen in einem schriftlichen Bericht festzuhalten. Darüber hinaus füllten sie einen oder zwei Tage nach dem Experiment einen Fragebogen mit 147 Punkten aus; weitere hundert Fragen folgten anläßlieh des follow-ups sechs Monate später.
Walter N. Pahnke, der das Unteruehmen praluisch im Alleingang durchführte, legte großes Gewicht auf eine fundierte wissenschaftliche Methodologie. Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung wurden minutiös und in Übereinstimmung mit medizinischen Testanforderungen geplant. Pahnke stützte sich auf die Methode des RCCT, das heißt des randomized double-blind-controlled clinical trial, die sich damals als ldinischer state ofthe art gerade erst etabliert hatte.30 Er kombinierte das Double-blind-Verfahren mit einer minutiösen statistischen Auswertung der gewonnenen Daten; er sej:zte überhaupt alle Standards einer wissenschaftlichen Objektivierung der Forschungsarbeit ein, die damals zur Verfugung standen. Nicht alle Beobachter fanden diese Doppelblindtest-Methodik angemessen. An der im South Oal<S Hospital in Amityville (New York) stattfindenden »Second Conference on the Use ofLSD in Psychotherapy and Alcoholism« vom Mai 1965, anläßlich welcher Pahnke die Re-
0fLSD in Psychotherapy andAlcoholism, Indianapolis, New York, Kansas City 1967,
S, 629-649, hier S. 634-30 Noch in Freuds Kokain-Experimenten der Jahre 1884-1887 und in vielen Versuchen,
die im ausgehenden 19. und beginnenden 2o.Jahrhundert unternommen wurden. erfolgten klinische Tests und Drogenversuche bzw. -selbstversuche nach einem willkürlich-kasuistischen Muster. Man experimentiene mit sich selbst, notierte sich aufmerksam Eindrücke und bezog. nach Opponunitätskritericn, Freunde und Verwandte mit ein. So ging noch 1imothy Leary bei seinen umstrittenen LSDund Psilocybin-Experimenten Anfang der 1960er Jahre an der Harvard University vor, und dies steUte sich rasch als Problem heraus. Die Veränderwlg der methodischen Standards bei klinischen Tests, die damals deutlich sichtbar wurde. hatte bereits in den 1930er Jahren eingesetzt. als Blindversuche aufkamen; in den 1950er Jahren schließlich setzte sich der Doppelblindversueh durch. bei dem weder die Versuchsperson noch der Experimentator wußten, wer den Wirkstoff und wer das Placebo erhalten haue. Auf diese Weise sollte die Übenragung von Erwartungen im experimentellen Setting verhindert werden.
350
sultate seines Experiments nochmals zusarnmenfaßte, bemängelten mehrere Teilnehmer - unter anderem der Organisator der Tagungdiese Vorgehensweise. Jarnes Ketchum vom Chemical Warfare Service erklärte: »! do believe that double blind procedures are either totally impossible or inappropriate to most of the problems under discussion.«31 Dabei wurde er von den Organisatoren der Tagung, Franlc Fremont-Smith und Harold A. Abramson, unterstützt, die beide erldärten, es gehe bei vielen Experimentell um ein »psychoanalyzing a person«. Für die Erforschung dieser subjektiven Seite eigne sich die Methodik eines Doppelblindversuchs gerade nicht, weil sie fur die Beurteilung objektiv meßbarer Ergebnisse, vor allem fiir die Quantifizierung von therapeutischen Erfolgen in Patientenpopulationen, entworfen worden sei. 32
Pahnke sah dlll'chaus das Problem, wie die objektivierende Vorgehensweise mit dem Ziel des Experiments, nämlich die Erforschung religiöser Erfahrung und veränderter Subjektivität, vermittelt werden könne. Heure würde man von der Schwierigkeit sprechen, eine »Erste-Person-Perspektive« auf eine »Dritte-Person-Perspektive« zu beziehen." Pahnke interessierte sich primär fur mystisches Erleben, fur tiefe religiöse Erfahrung. Diese setzt er ab von vier anderen »psychedelischen Erfahrungen«, nämlich von der psychotischen, der psychodynamischen, der kognitiven und der ästhetischen.34 Den funften Typus, auf den er es abgesehen hatte, bezeichnete er als »psychedelic peak, transcendental or mystical«.35 Er beschrieb das Experiment, in welchem die Experimentalgruppe diese peak-experience machen konnte, in seiner Dissertation und in verschiedenen Aufsätzen llnd Tagungsbeiträgen. Wie viele andere Experimentatoren - so etwa auch Abramsoll- ging Pahnke von der These einer Ra-
3' James Kerchum, in: Abramsoll (Hg,), The Use ofLSD inPsychotherapy andAlcoholism (wie Anm. 29), S. 649,
32 Ebd., (Voten von Fremont-Smith und Abramson). 33 VgL ecwa Daniel Hell, Seelenhunger. Der fohlende Mensch und die Wissenschaften
vom Leben. Bern u. a. 2003; Wolf Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt am Main 2003, S.49.
34 Walther N. PahnkefWilliam A Richards, l)Implications ofLSD and Experimental Mysticism«, in: Journal of Religions Health 5/3 (1966), S, 175-208, Pahnke, "LSD and Religious Expcrience« (wie Anm. 26), S. Ij Walter N. Pahnke, »Thc Psychedelic Mystical Experience«, in: Psychedelic Review II (I971), S.3E <http://www.drug library.orgl schafferllsdl pahnke2.htm).
35 Pahnke, »LSD and religious experience« (wieAnm. 26), S. 3.
351
tionalisierung der Gesellschaft und einer »Entzauberung der Welt« durch Modernisierungsprozesse aus. Mystisches, Archaisches, Primitives und Religiöses wurden in eine Analogie gebracht und als Antithese zu einer rationalisierten, explizierbaren Weitsicht betrachtet. Pahnke schreibt dazu: »The assumption was made that for experiences most likely to be mystical, the atmosphere should be broadly comparable ro that achieved by tribes who actually use natural psychedelic substances in religious ceremonies.«36 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer führten sich also während der Exploration anderer Zustände in der Kapelle wie ein »Stamm« auf, der im Akt seiner Vergemeinschaftung in neue Bewußtseinssphären vorstieß. Der performative Widerspruch bestand darin, daß dieses mystische Erleben empirisch untersucht und quantifIziert werden mußte. Für die Operationalisierung des Phänomens teilte Pahnke das ekstatische religiöse Bewußtsein in neun Variablen ein, die er auch )>universelle Charal((eristika« nannte und auf die er später immer wieder Bezug nehfllen wird: 1. Einheit, 2. Transzendenz in Raum und Zeit, 3. eine tief gefühlte positive Stimmung, 4. ein Sinn für das Heilige, 5. die intuitive Einsicht in die Wirldichkeit des Innenlebens (die >>Iloetische Qualität«), 6. die Paradoxie (einer Identität oppositioneller Pole), 7. die angebliche Unbeschreiblichkeit, 8. Vergänglichkeit und 9. eine nachhaltige Wirkung auf Verhalten und Umgang mit anderenY Der Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe zeigte nur geringe Abweichungen bei der EmpfIndung von Heiligkeit, bei der tief gefühlten Stimmung der Liebe sowie bei der positiven Einstellungsveränderung gegenüber anderen und gegenüber dem Experiment selber. Bei allen andern Variablen zeigten sich hingegen signifikante Unterschiede.
Für Pahnke machten die Ergebnisse ldar, daß es möglich ist, Drogen für mystische Erfahrungen zu nutzen, und daß der Experimentalkontext sowie die Dosiernng des Stoffes entscheidend sind für deren Qualität und Intensität. Er ging davon aus, daß die Stabilisierung religiöser Erfahrung nur gelingt, wenn sie in eine liturgische Struktur und in sal((ale Rituale eingebunden ist. Die Auswahl der Probanden zeigt, daß Mystik nicht gleichsam out 0/ nothing ins Bewußtsein beliebiger Menschen treten kann, daß vielmehr bestimmte
)6 Pahnke in: Abramson (Hg.), The Use 0/ LSD in PsychotherapyandAlcoholism (wie Anm.29),5.634.
37 Vgl. die Tabellen ebd., 5.636 f.
352
Voraussetzungen und ein Vorwissen nötig sind. Nur so können ein bereits vorhandenes Zusammenspiel von persönlichem Erfahrungsraum und überindividuellem Erwartungshorizont sowie der "profound emotional impact«38 ausgelöst werden. War diese Bedingung allerdings erfüllt, konnte der Weg zur mystischen Erfahrung, die nicht unbedingt mit einer religiösen zusammenfallen mußte, durch Drogenkonsum nicht nur abgekürzt, sondern das Erlebnis in präzedenzloser Weise verdichtet werden. Für Kundige gab es also Abkürzungsstrategien. Nicht aber für Normalverbrancher. Pahnke erklärte 1967 in einem Aufsatz über "LSD und religiöse Erfahrung«, es sei"a misconception that LSD is the magic answer to anything« und er wies auf die Gefahren hin, die mit einem "unsupervised and unslcilled use« bewußtseinsverändernder Drogen verbunden sind - er sprach von "psychiatric casualties«.39 Dies gab ihm vor allem deshalb Anlaß zur Sorge, weil er eine rasche Ausbreitung von psychedelischen Drogen konstatierte. Deshalb interessierte er sich nun auch für die Rolle, welche die "psychedelic churches« spielen könnten, und nannte als die vier wichtigsten The League for Spiritual Discovery, The Neo"American Church, The Native American Church, The Church 0/ the Awakening. Diese Religionsgemeinschaften versuchten auch nach 1966 den legalen Rahmen für die Einnahme von LSD, Meskalin und Psilocybin im Namen der Religions- und Kultfreiheit zu verteidigen sowie stimmige institutionelle und emotionale Rahmenbedingungen für die Einnahme solcher Substanzen anzubieten; sie müßten - so Pahnke - aber umgekehrt auch mehr über die Drogenwirkung lernen und dafür seien weitere, wissenschaftlich kontrollierte Experimente nötig.40
3· Experimente zwischen psychedelischer Esoterik
und wissenschaftlicher Expertise
Pahnkes Dissertation, die 1963 unter dem Titel Drugs andMysticism: An Analysis 0/ the Relationship between Psychedelic Drugs and the
38 Pahnke, »LSD and ReligiOllS Ex:perience~( (wie Anm. 26). In diesem Buchkapitd diskutiert Pabnke das Good-Friday-Expetiment. Download (http://www.druglibra ry.orglschafferflsdfpabnke3.htm),5.4.
39 Ebd., 5.r~ 5.9. 40 Ebd., 5.8.
353
Mysticttl Consciousness erschien,41 wurde von Timothy Leary und Richard Alpen betreut. Leary experimentierte unter unldaren Voraussetzungen mit LSD und hatte damals gerade das Harvard Psilocybin-Project abgeschlossen, das im März 1962, also kurz vor dem Good-Friday-Experiment, von anderen Experten auf grund seiner diffusen Methodik massiv kritisiert wurde. Die Tatsache, daß Leary und Alperr 1962 die Universität verlassen mußten, hing auch damit zusammen. Alpert schloß sich der New-Age-Bewegung an und nannte sich fortan Baba Ram Dass. Leary bemühte sich zunächst noch um wissenschaftliches Renommee, was sich z. B. in einem Forschungsbericht zeigt, den er 1965 zusammen mit Ralph Merzner, Madison Presnell, Gunther Weil, Ralph Schwitzgebel nnd Saralr Kinne in der Zeitschrift Psychotherapy veröffentlichte.4i Berichtet wurde hier vom» Prisoner Rehabilitation Program«, das die Forscher zwischen Januar 1961 und Januar 1963 in der Massachusetts Correctional Institution in Concord, einem Hochsicherheitsgefängnis für junge Straftäter, durchgeführt hatten. Ziel war die Senkung der Rüclcfallquote durch eine Verbesserung der mental health und eine Veränderung der Persönlichkeit von Schwerkriminellen durch Drogenerfalrrung. Für dieses Experiment wurden fünf konsekutive Programmschritte konzipiert, Fallgeschichten dargestellt und statistische Auswertungsmethoden diskutiert. Die Autoren betonen, daß ihr Ansatz nicht medizinisch, sondern »existentiell« sei; es gehe nicht um Heilung und Kranldleir, sondern um die Veränderung von ,Nerhaltensspielen« (behavioral games).43 Als wichtigstes Ergebnis wird die substantielle Abnalrme der Zalrl von Rüclcfälligen anderthalb Jahre nach Abschluß des Programms hervorgehoben44
- ein Resultat, das 1998 von Rick Doblin, dem Gründer der Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, in einem follow-up des Experiments mit ehemaligen Teilnehmern und weiteren Beobachtungen grundlegend in Frage gestellt wurde. Leary und seine Mitarbeiter
41 Pahnkc, Drugs and Mysticism (wie Anro. 24). '+2 Timothy Leary/Ralph MerznerlMadison Presnell/Gumher Weil/Ralph SdlWi(zge
bcl/Sarah Kinne, »A New Behavior Change Program Using Psilocybin«, in: Psychotbetapy 212 (1965), S.61-72. Zu diesem Programm vergleiche auch: Greenfield, Timothy Leary (wie Anm.14), S. 148-153; Higgs, I Have America Surrounded (wie Anm. 22), S. 33-35.
43 Lcary u. a., A New Behavior Change Program (wie Anm. 42), 5.64-
44 Ebd., S. 69.
354
hatten grundlegende Statisrikfehler gemacht und später (I973) die Primärdaten vernichtet.45 Die weiteren Publilcationen Learys verflüchtigen sich dann in die kybernetische Esoterik und psychedelische Exotik; er hatte den wissenschaftlichen Mainstream der Forschung verlassen und wurde alsbald durch die StrafVerfolgungsbehörden, die nun gegen Drogenkonsum vorgingen, eingeholt. I977 publizierte er das im Gefängnis verfaßte »haßtriefende Pamphlet« Neuropolitics, in dem er sich verschwörungstheoretischer und antisemitischer Stereotypen bedient, um mit der Pop-Generation abzurechnen.46
Man kann also die beginnenden 19 60er J alrre als eine wichtige Verzweigung sehen; es gab Forscher, welche in der gesellschaftlichen Aufbruchsrimmung, die sich nun Balrn brach, psychedelisch abdrifteten, während andere um so konsequenter akademische Spielregeln einzuhalten und ihre wissenschaftliche Reputation zu bewalrren versuchten. Das Bemühen um methodologische Perfektion und minutiöse Auswertung der Resultate, das Palrnke in seinem Experiment von I962 an den Tag legte, war ein erfolgreicher Versuch, solche Vorwürfe ausznllebelnY Walter Houston Clark - der I96I von der American Psychological Association den William James Memorial Award für Beiträge der Religionspsychologie erhalten hatte und als unbestrirtene Kapazität auf diesem Gebiet galt - beschrieb später Palrnkes Experiment folgendermaßen: »There are no experiments known to me in the history of the scientific study of religion better designed or dearer in their condusions than this one.«48
Da die gesamten Rohmaterialien des Experiments verlorengingen, wissen wir über viele Details nur auf grund eines weiteren follow-ups Bescheid, welches Rick Doblin Ende der 1980er Jalrre (also
45 Greenfield, Timothy Leary (wieAnm.I4), S. 152[ 46 TImothy Leary, Neuropolitics. The Sociobiology of Human Metamorphosis, Los An
geles 1977. Die treffende Qualifikation findet sich bei Amendt, Die Legende vom LSD (wieAnm. 2), S. 80f., der auch bemnt, daß in der später publizierten Aumbiographie alles ))wieder ganz anders" töne (5.81), und die innovativen überlegungen Learys würdigt.
47 Harry M. Marks, The Progress ofExperiment. Science and Therapetttic Reform in the United States, I900-I990, Cambridge, New York 1997. Vgl. auch: Dyck. ))Flashback« (wieAnm. 7), S.L
48 Walter Housmn Clark, Chemica! Ecstasy. Psychedelic Dmgs and Religion, Ncw York 1969. 5.77- Daß Pahnke einiges an seinem Experiment beschönigend dargestellt hat, weist Rick Doblin im unten zitierten Evaluatiq,nsbericht nach.
355
ein Jahrzehnt bevor er sich vernichtend über Learys Gefängnis-Experiment äl,lßerte) unternahm.49 Mittels detektivischer Recherchen gelang es ihm, neun Versuchspersonen der Kontrollgruppe und sieben der Experimentalgruppe ausfindig zu machen und zwischen 1986 und 1989 nod,mals zu interviewen. Daraus resultierte eine kritische Würdigung des Experiments. Doblin warf Pahnke vor, er habe einem sich nicht regelkonform aufführenden Teilnehmer eine Thorazinspritze appliziert (ein Neuroleptikum mit sedierender Wirkung, das er für den Fall, daß unkontrollierbare Reaktionen auftreten sollten, in GriffWeite hatte), diesen Vorfall aber in der Auswerrung des Experiments und in seiner Dissertation nicht erwähnt, wohl weil er fürchtete, dies könnte von Kritikern aufgebauscht werden. Auch habe Pahnke die psychischen Schwierigkeiten, die viele Teilnehmer vor allem in der Anfangsphase des Experiments hatten, unterschätzt und jedenfalls nicht genügend in die Bewerrung einbezogen. Gleichzeitig nimmt Doblin aber Pahnke gegen Kritiker wie R. C. Zaehner50 in Schntz und zeigt auf, daß dessen Einwände auf einer ungenauen Lektüre der Ergebnisse des Experiments berulren. Doblin spricht von »one of rhe preeminent psychedelic experiments in the scientific literature«.51
Doch auch Pahnke verspürte nach 1962 Gegenwind; ein zweites Experiment wurde nicht mehr bewilligt, worauf er am Massachusetts Mental Healrh Center neue Forschungsmöglichkeiten fand. 52
Als er 1965 anläßlich der genannten ,,5econd Conference on rhe Use ofLSD« seine Forschungsergebnisse präsentierte, hatte sich das Blatt gewendet. Noch unterhielten sich zwar die 26 an dieser Konferenz versammelten Psychiater aus Amerika und Europa angeregt über drogenbasierte Erfallfungen und Therapien. Doch LSD war zu diesem Zeitpunkt für ldinische und andere Experimente bereits nicht mehr erhältlich, und nach der IIIegalisierung ein Jahr darauf begann der Schwarzmarkt für den Stoff zu florieren. In diesem neuen Kon-
49 Vgl. dazu: Kick Doblin, »Pahnke's IGood Friday Experiment<. A Long Term Follow-Up and Merhodological Cririquc«, in: The Journal ofTranspersonal PS)'chology '3" (I99I), S. I-28. (httpdlwww.druglibrary.orgischaffer/LSD/doblin.1uml).
50 Robere C. Zaehner, Zen, Drugs and Mysticism, New York 1972. 51 Doblin, ))Pahnke's ~Good Friday Experiment«' (wie Anm. 49), S. 15. Weil Doblin
als Promotor von psychedelic research auftritt, wird seine Evaluation allerdings auch als 1eil einer Lobbying-Kampagne bezeichnet.
52 Darüber berichtet Cf z.B. in: Pahnkc, »LSD and rcligious experiencc« {wie Anm.,6),S·4f.
356
text schien es alsbald eine verheißungsvolle Perspektive zu sein, religiöse Erleuchtung gleichsam gehirnchemisch zu produzieren und auf instant mysticism zu setzen. Daß Albert Hofmann in seinem autobiographischen Rückblick LSD als sein »Sorgenkind« bezeichnen sollte, hängt mit der Erkenntnis zusammen, daß psychedelische Drogen im Verlaufe der 1960er Jahre zunehmend vom Medium für anspruchsvolle Selbstexploration zu banalen Unterhaltungsstoffen mit trivialer Erfahrungsqualität zu werden drohten. 53
4. )Mind contra!<: Militärische Phantasmen und Verschwörungstheorie
War für Leary und andere das LSD ein potentes Mittel, um die Barrieren, welche gesellschaftliche Konventionen gegen ein radikal entgrenztes Bewußtsein aufrichteten, zu durchsroßen, so sahen militärische pressure groups darin umgekehrt ein Medium für mind controL Jedenfalls lassen sich in diesem Bereich viele geheimdiensdiche Initiativen und militärische Interessen konstatieren, so daß sich sagen läßt, daß Experimente mit Drogen durch die Konstellation des kalten Krieges angeregt Wllfden, im Kontext von 1968 jedoch eine subversive Bedeutung erlangten. 54
53 Hofmann, LSD - mein Sorgenkind (wie Anm. 13). Von einer Verschiebung vom Willen zur Selbstcxploration zum Wunsch nach Unterhaltung sprechen auch Baumeister/Placidi, ),A Social Hisrory and Analysis of the LSD Comroversy« (wie Anm. 11). Ein anders gelagerter Ver5~ch, das Bewußtsein aus vorgegebenen Reizmustern herauszulösen und dadurch zu ))emgrenzen,(, wurde vom Biophysiker und Neuropsychologen John C. Lilly mit seinen Isolations- und Floating-Tanks entwickelt. Lilly berichtet später in verschiedenen Publikationen über seine Experimente, u. a. in: John Cunningham Lilly, Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer Theory and Experiments. Miami 1968; John Cunningham Lilly, The Scientist. AMetaphysicalAutobiography. Berkeley 1988. Zu Lillyvgl. auch: Birgit Griesecke, »)Einleitung«, S. 53-55 und "Kommentaru, S.89 in: Pernes u.a. (Hg.), Menschenversuche (wie Anm. I).
54 Vgl. etwa John Lillys Neunpunkt-Liste nicht akzepderbarer Praktiken der Metaprogrammierung von Menschen. die genau mit dem übereinstimmt, was bei einer Gehirnwäsche üblich war. Diese neun Ausschlußlaiterien werden diskutiert bei: Rüdiger Lutz, )John C. Lilly- Pionier der Bewußtseinsforschung«, in: ders. (Hg.), Bewußtseins-(R)evolution. Veränderungsmodelle von Gregory Bateson, Robert Jungk, Fritjof Capra, Marilyn Ferguson, Stanislav Grof, jolm C Lilly, Charlene Spretnak u.a., Weinheim 1983, S.126f.
357
Zu Beginn der 1950er Jahre begann das bipolare Freund-FeindSchema der Blocldwnfrontation gerade seine volle Wirkung zu entfalten. Damals führte die CIA - in Fortsetzung von Anstrengungen, die weiter zurüekreichren - Mind-control-Projekte durch. 55 Die 150 wichtigsten liefen ab 1953 unter dem Code-Namen MK-ULTRA.56 Dazu gehörten auch verdeckte Drogenexperimente. Als diese geheimen, über komplex verschachtelte Institutionen finanzierten Projekte aufgedeckt wurden und ruchbar wurde, daß auch wichtige Exponenten der Bewußtseins-Experimentierszene Geheimdienstgelder angenommen hatten, wurden - im Anschluß an den Watergate-Skandal von 1974 zwei parlamentarische Kommissionen gebildet und verschiedene Hearings angeordnet, welche die nötige Aufklärung liefern sollten. 57 Berühmtheit erlangte vor allem der Abschlnßbericht des Kongress-Komitees unter der Leitung von Frank Church, der sogenannte Chnrch-Berichtvon 1976. Darin wird u.a. vermerkt:
ßctwccn [955 and [958 research was initiated by the Army Chemical Corps to evaluate the potential of LSD as a chemical warf are incapacitating agent. In the course of this research, LSD was administcred to more man 1000
Amcrican volunteers who then patticipated in aseries of tests designed to ascertain the effects of the drug on their ability to fUnction as soldiers.58
Im Fokus der CIA-Programme stand die EntwiddllI1g eines ,,wahrheitsserums«. Die Versuchsserien lassen daranf schließen, daß man eine Zeitlang der Auffassnng war, mit LSD diesem Ziel. nahe zn
55 Vgl. Rebekka Lcmov, )Thc Binh ofSoft Tonure. CIA-Interrogation TechniquesA Hiswry{!, in: Slate, 16. Nove[Ilber 2005 (http://www.slate.comlidhI30301?nav=
wp); lohn Buckman, )Brainwashing, LSD, and CIA: Historical and Ethical Perspect1vc(, in: International Journal oi Social Psychiatry 23 (1977), S. 8-19; Marcus Krause, »Einleitung Sektion J ,Kontrollieren.;<, in: Pemes u. a. (Hg.), Menschenversuche (wie Anm.1), S. 175-200; John Marks, The Sem·eh Jor the "Manehurian CandidrU'e«(, 7'lie CIA and.Mind Contro/. Thc Secret History oithe Behavioral Sciences, New York 1978; Dominic Streatfeild, Brainwtlsh. The Seeret History of Mind Conn:ol, London 2006.
56 Später erhielten die Programme auch andere Namen. 57 Fran Mason, »)Mind Contral«, in: Peter l<!1ight u. a. (Hg.), Conspiracy Theories in
American Histary (wie Anm. 4), S. 49L 58 US Congrcss, Thc Seleet Committee to 5tudy Governmenml Operations with Respect
to Intelligent Activites, Foreign and Military Intelligence (Church Committee Report), Reporr Nr. 94-755, 94th Congress, 2nd Session, Washington D. C. 1976 (Church-Bericht), S. 4'2 <http://www.aardibrary.org/publib/church/reporrs/book r1 con(ems.lum).
358
sein.59 Bei diesen Experimenten kamen auch Menschen zu Tode, wobei nur ein Fall- jener von Frank Olsen, der 1953 verstarb - dokumentarisch verbürgt ist. GO
Eine für die CIA wichtige - und berüchtigt gewordene - Experimenralanordnung wurde im nahen Ausland, im McGill-Universitätsspital in Montreal, aufgebaut. Hier entwickelte der diunals international renommierte Psychiater Ewen Cameron seit den frühen 1950er Jahren eine Technik, die er psychic driving nannte und die darin bestand, das ,Selbst, eines Menschen vollständig durch Methoden der sensorischen Deprivation, dnrch serielle Elektroschocks, systematische Desorganisation des Tagesablaufs, Einwirkung von Lärm und Stimmen, sowie mittels Drogen wie LSD, Sodium, Amytal und Desoxyn zu brechen.G[ 1958/59 wurden diese experimentellen Methoden auf nochmals härtere Zielvorgaben hin ansgerichtet. Involviert waren 53 psychisch kranke Patienten, die »depatterned« -umprogrammiert - werden sollten. Es ging nm das komplette breaking der Persönlichlceit mit anschließender Rekonfiguration. Wenn ein Individuum kein Gedächtnis mehr hat und von seiner Lebensgeschichte völlig abgeschnitten ist, wenn es selbst elementare Lebensverrichtungen wie essen oder auf die Toilette gehen »verlernt« hat, dann beginnt der Experimentator, »Heilungsangebote« zu machen, die darauf angelegt sind, diesen Menschen mit einer veränderten Identität gleichsam neu starten zu lassen. Die CIA und die Armee inreressierten sich für dieses völlige Anslöschen llI1d Umprogrammieren eines Individnums, weil sie davon ausgingen, daß der kommunistische Gegner solche Techniken bereits beherrsche und raffiniert gestenerte Zombies auf die Reise schicken könne mit dem Ziel, Sabotageakte dnrchzuführen oder pharma1mlogische Apostaten auf den Bildschirmen in Erscheinnng treten zu lassen.
Der zitierte Chutch-Bericht von I976 zeichnete die Genese dieser
59 Lemov, ))The Biech ofSoft Torture« (wieAnm. 55). 60 Church-Bericht, Kapitel 2, S.394-399. Allerdings konnte der Fall bisher nicht
vollständig geklärt werden; die im Church-Bericht geäußerte These, der Tod habe in direkcem Zusammenhang mit einem LSD-Experimeut gestanden. wurde später
in Frage gestellt. 61 Vgl. Lemov, »The Birth of Soft Torture« (wie Anm. 55), S.2; Naomi Klein, Die
Schock-Strategie. Der Aufitieg des Katastrophen-Kapitalismus, Frankfurt am Main 2007,' Kapitel I, S. 41-74; Thomas Gordon, Journey infO Madness. Medical Torture and the Mind Controllers, London u.a. '988.
359
psychophysischen Experimentalsysteme ebenso nach wie deren globalpolitischen Hintergrund. Es wird hier festgehalten:
Thc !ate 1940S and early 1950S were marked byconcern aver the threat pased by activities of the Soviet' Union, the Peoples Republic of China, and other Communist bloc countries. Uni ted Stares concern over the use of chemical and biologieal agents by these powers was acute. The belief that hostile powcrs had used chemical and biological agents in intcrrogations, brainwashing, and in attacks designed to harass, disable, or kill Allied personnel created considerable pressure for a >defensive< program [Q investigate chemieal and biological agents so that the intelligence communiry could nnderstand the mechanisms by which these substances worked and how their effects could be defeated. G2
Es lägt sich also sagen, dag die Konstellation des kalten Krieges antikommunistische Feindbilder plausibilisierte, die es wiederum angezeigt erscheinen ließen, Abwehrmailnahmen zn ergreifen und die Strategie des containment auch auf dem chemisch-biologischen Sektor voranzntreiben. Die Bedrohungsperzeption der CIA weist dabei -wie die mentale Konfiguration des kalten Krieges insgesamt - eine ausgeprägt phantasmatische Dimension auf. Der imaginierte Feind bekam seine schreckerzeugenden Konturen in Worst-case-Szenarien; der innere Wunsch, das bedrohliche Augen auszulöschen, reproduzierte sich so in einer autistischen Wahrnehmungsstrukrur, die wiederum ein manichäisches Weltbild und den Wunsch nach sicheren Grenzen unterstützte. Das Böse griff systematisch von augen an, während das Gute von innen her verteidigt werden mußte. Auch Drogen wurden znm Aspekt einer psychologischen Kriegsführung. Gerade der »freie Westen« war auf dem Weg in die Konsum- und Freizeitgesellschaft anflillig für eine gegnerische Low-intensity-Strategie. Dazu gehörte die Einschleusung zersetzender Substanzen, die einen Angriff von augen vorbereiten konnten.
Daß diese Bedrohungswahrnehmung von solcher Dauer war, hing mit ihrer symmetrischen Anlage zusammen: Aus einer solchen Feindbildkonstruktion konnten in der Konstellation des kalten Krieges beide Blöcke Nutzen ziehen; die Blockkonfrontation kann deshalb - wie Mary Kaldor vorgeschlagen hat - als ein hoch riskantes, jedoch durchaus funktionales Joint-venture charal(terisiert werden, das den US- und UdSSR-Interessen gleichermailen entsprach und
62 Church-Bericlu (wie Anm. 58), S. 392.
360
den jeweiligen nach innen gerichteten Stabilisierungs- und Integrationssrrategien zum Erfolg verhalf.63 Verschwörungstheoretiker drehten weiter an dieser Schraube der eingebildeten Bedrohung. Sie gingen davon aus, der Feind sei längst im Innern präsent. So wurden die Mind-control-Projekte der CIA, die sich gegen den äugeren Feind richteten, unter der Hand zu einem Dispositiv der Bewugtseinskontrolle im Inneren Amerikas, Mind controlhieß nun der geheime Plot einer raffiniert herrschenden Clique, die auch daran interessiert war, junge, militante Dissidenten in passive und frieclliche Aktionsformen abzudrängen; statt laud,als zu protestieren, sollten sie als politisch neutralisierte Hippies Make love, not war propagieren nnd auf der wunderschönen Wolke eines psychedelischen Rausches von der Bildfläche verschwinden. Aus dieser Perspektive war es nur lmnsequent, in Timothy Leary und weiteren Wissenschaftlern, die in den 1950er und 1960er Jahren mit Drogen experimentierten, gut getarnte Agenten des eigenen oder des gegnerischen Geheimdienstes, zu sehen.
5. Von der phantastischen Kybernetik zum biologischen Realismus
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten sich in den USA, aber auch in europäischen Ländern konzeptionelle und kognitive Gemeinsamkeiten zwischen mind control, re-education, kybernetischen ftedbacks und der psychedelischen Drogenerfahrung. Diese verschiedenen Wissensfelder, Forschungsbereiche nnd Hancllungskontexte teilten basale Konzepte von Bewuiltsein und Persönlichkeit, was die Zirkulation von Erkenntnissen und Vorstellungen anregte und unterstützte. Die Kybernetik trieb seit den ausgehenden 1940er Jahren den strukturfunktionalistischen Paradigmenwechsel in der Sozialtheorie voran und versprach neue, gesamtgesellschaftlich nmsetzbare Kontroll- und Steuerungsstrategien. Diese sollten Individuen auf nene gesellschaftliche Zielvorgaben und Srrukrurmuster einstellen.64 Darin wurden kybernetische Ansätze vom Behaviorismus un-
6, Vgl. Mary Kaldor, Der imaginäre Krieg. Eine Geschichte des Ost-West-Konflikts, Harnburg 1992 .
. 64 So ergaben sich bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen dem Re-educaclon-Programm der US-Army in Europa und den zwischen 1946 und 1953 sranfil1-
361
terstützt, der das menschliche Verhalten systematisch als kontroIlierbar ansah und nach Formen einer »operanten« - über Belohnung auf das Verhalten zurückwirkenden - Konditionierung suchte.65 Im Gefolge der transdisziplinären Macy-Konferenzen, die zwischen 1946 und 1953 stattfanden (und die auch, wie erwähnt, LSD zum Thema hatten), wurden solche Konzepte auf unterschiedlichste gesellschaftliche Anwendungsbereiche und technische Umserznngsformen hin diskutiert.66 Verband sich Kybernetik auf der einen Seite mit der Vision einer umfassend normalisierten und voll adaptierten Gesellschaft - wie sie etwa, auf behavioristischer Grundlage, in Skinners utopischem Roman waiden Two aus dem Jahre 1945 (vor)gezeichnet wird6? -,so transportierte sie auf der anderen Seite auch das Versprechen einer Befreiung des Bewußtseins. Sie verstand sich als wirksames Moment einer geistigen Befreiungsbewegung, die über Rücldcoppelungsschlaufen selbstgesteuerte Lernprozesse in Richtung erweiterter individueller und gesellschaftlicher Freiheitsgrade auslösen konnte.68
denden Macy-Konferenzen, welche die Kybernecik gesellschaftlich relevant machen wollten. Vgl. Claus Pias (Hg.), Cybcrnetics - Kybernetik. The Macy-Conferences 1946.1953, Bd. I, Zürich, Berlin 2003; ders. (Hg.), Cybemetics - Kybernetik. The Maq-Conforences 1946-I953. Bd.2, Zürich, Berlin 2004. Zur Geschichte der Kybernetik vgl. auch: HagnerlHöcl, (Hg.), Die Tramformation des Humanen (wie Anm.6).
65 Vgl. Burrhus Frederic Skinner, About Behaviorism, New York 1974. 66 Pias, Cybemetics, Band I; ders., Cybernetics. Band 2 (beide wie Anm. 64). 67 Huxlcy war in Brave New World sensibilisierter für totalitäre Dynamiken als etwa
B. F. (Burrhus Frcderick) Skinner, der die Frage nach »freedorn and control« zwar stellt, jedoch mit der behavioristischen Versicherung weglegt, der Verzicht auf Bestrafung könne )das Gefühl von Freiheit steigern«.
68 Exemplarisch dafür war der Versuch einer Kybernetisierung der ))chilenischen" Revolution« zu Beginn der 1970er Jahre. Dabei sollten die Regierungsfunktionen systematisch optimiert werden mittels ausgeklügelter Informations-Feedbacks. Im angestrebten gesellschaftlichen Transformadonsprozeß, der die Nationalisierung des Finanz- und Industriesekwrs sowie des Bodens vorsah, sollte die Rationalität wirtschaftspolitischet und umernehmcrischer Entscheidungen nicht durch engagierte revolutionäre Politiker, sondern durch eine distanzierte )amomatischc« Regierung sichergestellt werden. 1973 wurde dieses Experiment durch einen von den USA unterstützten Militärputsch blutig zu Fall gebracht. Einen Überblick gibt: Stafford Beer, Fanfare for Effictive Freedom. Cybernetic Praxis in "Government, 1973 (hnp:llwww.staffordbeer.com). Vgl. auch: Claus Pias. »Der Auftrag. Kybernetik und Revolution in Chile«. in: Daniel Gethmann, Markus Stauff (Hg.), Politiken der Medien. Berlin 2004.5.131-153.
362
Die dystopische Antizipation einer kybernetischen Kontfollutopie findet sich in Aldous Huxleys ·Brave New WorId aus dem Jahre 1932. In dieser Parabel des Paradise-Engineering werden Theorien politischer Verführung mit neuen Konzepten bio technologischer Macl,barkeit verbunden.69 Mit der Exorzierung von Leiden und Mitleid aus einer Gesellschaft ist auch die Vorbedingung fur Gerechtigkeitsempfinden und fur eine Haltung, die Ungerechtigkeit bekämpft:, verschwunden. Alle ·Probleme, die mit Protest, sozialer Unrast, politischen Emanzipationsbestrebungen und materiellen Forderungshaltungen zu tun haben, sind gelöst. Das politisch-technisch hergestellte Paradies ist von emotionaler Teilnahmslosigkeit charakterisiert. Allen geht es gut, alle sind zufrieden und ergeben sich in das Schicksal, das die »Schöne Neue Welt« fur sie vorgesehen hat. Restschwierigkeiten werden mit einer Psychopharmakologisierung des Alltags aus der Welt geschafft. Sämtlichen Bewohnern steht eine massenhaft produzierte, perfekte Designerdroge mit der Bezeichnung »Soma« zur freien Verfugung. Soma wird in unterschiedlicher Form, z. B. wie Zncker zum Kaffee serviert und steigert das Glück am Gehorsam. Soma ist frei von störenden Nebenwirkungen, ein schnelles Vehikel fur »chemische Ferien«, ein flächendeckendes Medium fur effiziente mind contro!.
Die anpassungsgetrimmten Normoparhen, welche die »Scl,öne Neue Welt« bevölkern, sind die Gegenthese zum Menschen, der sich selber verwirldicht. Die Droge Soma errichtet eine undurchdringbare Wand zwischen funktionstüchtigen Menschen und den unendlichen Bewnßtseinsräumen, in die hinein sie sich entfalten könnten. Huxley hält sich deshalb persönlich an Drogen, die das genaue Gegenteil von Soma darstellen. Psychedelika sollen altered states ermöglichen, sie fungieren als chemische »Bewnßtseinsmodifikatoren«, die ein »Paradies UIlverstellter Wahrnehmung« öffnen?O In seinen 1954 bzw. 1956 publizierten Essays »The DoOfs of Perceprion« und »Heaven and Hell« beschreibt Huxley solche Erfahrungen. Er geht hier davon aus, daß das Gehirn als Kontrollapparatur und Re-
69 Aldous Hux.ley, Brave New World, hg. von Dieter Hamblock., 5tuttgarr 1999· 70 Michad Horowitz/Cynthia Palmer (Hg.), Moksha. Aldous Huxleys Classic Writings
on Psychedelics and the Visionaty Experience, South Paris 1999. Die beiden zitierten Begriffe stammen, wie alle weiteren Huxley-Zitate, aus der deutschen Übersetzung: Aldous Hux.ley, Die Pfo1·ten der Wahrnehmung. Himmel und Hölle. E1jährungm mit Drogen, München 1981, hier 5.49, 5.43.
363
duktionseinrichtung funktioniert. So schreibt er in »Pforten der Wahrnehmung« die» Fnnktionen des Gehirns, des Nervensystems und der Sinnesorgane« seien »hauptsächlich eliminierend". Zwar verfüge »potentiell jeder von uns über das größtmögliche Bewußtsein«. Doch um uns als »lebenden Wesen« das »biologische Überleben zu ermöglichen, muß das größtmögliche Bewußtsein dnrch den' Reduktionsfilter des Gehirns und des Nervensystems hindurcbfließen. Was am anderen Ende herauskommt, ist ein spärliches Rinnsal von Bewußtsein, das es uns ermöglicht, auf ebendiesem unserem P1<111eten am Leben zu bleiben«.71
Viele Bewußtseinsforscher der Nachkriegszeit waren von der Idee fasziniert, die ganze Batterie von Filtern und die gut gescbützte Hierarchie von Bewußtseinskontrollen könnte sich durch meditative Praktiken, durch religiöse Erlebnisse oder mittels entspre~hend wirkender »chemischer Substanzen«n ausschalten lassen. Dies bot auch Raum für hintergründige Vermutungen. Von Huxleys plastisch-phantastischer Bewußtseinskonzeption ist es nur ein Schritt zu Konspirationstheorien, welche die Frage nach dem cui bono von Bewußtseinsveränderungen stellen, um dann messerscharf zu schließen, die herrschende Realitätsmatrix sei Resultat einer absichtsvollen Verstellung der Machtverhältnisse und als solche der Funktionsmodus eines hintergründigen Komplotts. Solche Verschwörungstheorien sind widerlegungsresistent. Tatsachen können ihnen nichts anhaben, im Gegenteil, ihre willkürlicbe Gemachtheit und ihre Deutungsoffenheit produzieren permanent die Illusion neuer »Faleten«/3 die als »das Gemachte« einer Logik hermetischer Evidenzstiftung unterliegen. Konspirative Welterldärungen weisen deshalb die Tendenz auf, den für sie konstitutiven »Dahinterismus«
71 f-<..bd., S, 19 f. Diese Sicht ist stack durch die Vorstcllungcines »)largerconsciousness<1 bceinflll{~t, die William J~unes in seiner 1902 veröffenrlichtcn, einflußreichen Studie zur ,Nielfah der religiösen Erfahrung« entwickelt hatte (vgl. Frankfurt am Main 1997). Einen weiteren philosophisch-epistemologischen Anknüpfungspunkt bot Henri ßcrgsons These. daß Leben unmöglich wäre, wenn die Myriaden von Reizen, welche ständig auf die Sinne einwirken. ungefiltert auf den Organismus einwirkten. Diese Annahme führte zur Frage, nach welchen Kriterien die Filter und Selektionsmechanismen funktionieren, damit strukturierte Lebensprozesse in Gang gehahcn werden (vgl. dazu: Vladimir JankeIevitch. Henri Bergson [1931], Paris 1959).
72 I-Iuxley, Die Pj0rten der Wizhrnehmung (wie Anm. 70), S. 68. 73 Im Unterschied zum Gegebenen (Damm) sind Fakten das Gemachte (Faktum).
364
zu radikalisieren und die duniden Mächte nicht mehr nur beim äußeren Feind zu suchen und damit zu exterritorialisieren, sondern im eigenen Land zu orten?4
Anstatt von einer angsteinflößenden, unsicbtbaren Macbt kann aber auch vom Wunsch nach undenkbaren Möglichleeiten ausgegangen werden. Das Argument lautet dann, daß ein Bewußtsein, welches nahezu beliebig manipulierbar ist,sicb .gerade deshalb auch auf Neues, Nie-Dagewesenes hin öffnen und »außergewöhnliche Bewußtseinserfahrung« machen kann?5 Da dieses durch das Normalbewußtsein nicht antizipierbar ist, kann nur das Selbstexperiment weiterhelfen. Aus Aldous Huxleys Sicht sollten diese riskanten Expeditionen in spirituelles Neuland einer elitären Gruppe darauf eingestimmter Künstler und Intellektueller vorbehalten sein. Sein >;demokratischer« Gegenspieler Timothy Leary enrwarfhingegen eine kybernetische Theorie der Wirklichkeit, die diese als sozial synchronisierte Täuschung darstellte. Bewußtseinsmodi sind für Leary mit der spezifischen Funktionsweise neuronaler Schaltlcreise korreliert. Er unterscheidet insgesamt acht interdependente, auf einer Freiheitsskala angeordnete circuits; die aInueIle Gesellschaft vermag aus seiner Sicht nur die vier einfachsten davon zu alnivieren, wällfend die vier höheren neuro-circuits - vom neurosomatischen über den neuroelektrischen und -genetischen bis hin zum neuroatomaren -im Normalleben gar nie starten könnten.'6 Die meisten Menschen sind deshalb zu desolater Bewußtseinsarmut verdammt. Dadurch wird der Mensch als ein Wesen, das zur lcreativen Selbststeuerung und zur Autonomie gegenüber Umwelteinflüssen fäl1ig ist, darniedergehalten und kann sein kybernetisches Potential nicht entfalten - was ihn für Fremdsteuerung durch mächtige Gruppen in der Gesellschaft anfällig machr.77
Learys Kybernetik-Paradigma ist deswegen symptomatisch, weil es mind control in ein reziprokes Verhältnis zur psychedelischen
74 Vgl. Eva Horn/Anson Rabinbach (Hg.), Dark Powers. Conspiracies and Compiracy Theory in History and Literature. New·German Critique 35 (2008). NI'. I 103·
75 Vgl. etwa (mit Rückblick auf die I960er Jahre): Stanisla.v Grof, Impossible - 1-V'Cnn Unglaubliches passiert. Das Abenteuer außergewöhnlicher Bewusstseinseiftthrungen. München 2006.
76 Timorhy Leary/Joanna Leary, Neurologie (1973), Löhrbach 1993· 77 Timothy Leary, Neuropolitik. Die Soziobiologie der menschlichen Metamorphosis.
Basd 1981; Robere A. Wilson, Der neue Prometheus. Die Evolution unserer Intelli
genz. Kreuzlingen 2003·
365
Erfahrung rückt. Normale Menschen, die das Glück der Bewußtseinserweiterung nie gekostet haben, werden aus dieser Perspektive anfällig für Manipulation und steuerbar. Die Macht funktioniert über die Exekution von Normalität. Wir finden hier die beiden Momente einer technokratischen Ideologie, nämlich Autonomie und Kontrolle, in einer argumentativen Konstrul<tion vereinigt. In vielen Diskursen, die psychedelische Drogen zum Thema haben, findet sich dieses Spannungsverhältnis. Wenn davon ausgegangen wird, daß die Gesellschaft einen funktional organisierten und deshalb kulturell repressiven Sozialzusammenhang darstellt, wird die Verrückung durch Erfahrungsdtogen positiv gewerret. Gegenüber der Zwangseinrichtung nnd Kontrollinsranz »Gesellschaft« kann es gar nie genug Aussteiger geben; es sind vielmehr diese dropouts, die zu neuen Einsichten fähig sind und demokratische, selbstbestimmte Umgangsformen stärken können. Politische Protestaluionen werden in einem positiven Licht wallrgenommen. Die drogeninduzierte Rebellion erweist sich als synergetische Verdichtung von Ordnungsstörungen, die das System aus den Angeln heben können. Damit verändert sich auch der Status von Experimenten. Diese dienen nicht - wie etwa bei der »Modellpsychose« - der Erforschung geotdneten Funktionierens und normaler Zustände auf dem Umweg über pathologische Abweichungen. Vielmehr stellt die phantastische Deregulierung des Normalbewußtseins durch Drogen ein Versprechen anf etwas Neues, auf eine andere Gesellschaft dar.
Dieses Neue entsteht als Vorstellung in einem Möglichkeitshorizont, in dem eine Hermeneutik des Verdachts omnipräsent ist: des Verdachts nämlich, daß den Normalbürgern das Wichtigste im Leben vorenthalten wird. In ihrem Bemühen, ein korrektes, kalkulierte~, angepaßtes Leben zu führen, nehmen die meisten Menschen andere Möglichkeiten nicht wahr. Sie können sozial nicht fundamental enttäuscht werden, weil sie nie dahinterkommen, daß die Welt, die sie sinnlich erfal,ren, eine Täuschung ist. Verschiedenste kritische Theorieansätze artiknlierten in der Nachkriegszeit eine solche kritische Gmndbefindlichkeit. So etwa die »Kritische Theorie« der Frankfurter Schule, für welche die kapitalistische Kulturindustrie einen gigantischen Verblendungszusammenhang erzeugte, der den Einzelnen instrumentalisiert und ihn auf die Verwertungsbedürfnisse der Kapitalakkumulation hin funktionalisiert. Auch in diesem Argumentationsmuster erhält das Experiment gleichsam ver-
)66
kehrte ethische Vorzeichen. Es wird nicht primär - womit sich heure Ethikkommissionen befassen - mit dem Generalverdacht einer Instrumentalisierung von Menschen assoziiert, sondern als ein Mittel gesehen, um die Herrschaft der instrumentellen Vernunfi: zu beenden und damit Befreiung zu ermöglichen. Denn psychedelische Drogen konnten die durchgreifende Machtwirkung der gesellschaftlichen Prozesse und Strukturen aufheben: Dies war eine Erwartung, die in der Annahme grundete, das individuelle Bewußtsein habe trotz seiner permanenten Prägung durch gesellschaftliche Funktionsanforderungen seine transgressive Kapazität bewahrt und könne - das Wagnis des Drogenkonsums vorausgesetzt - einen Zugang zu einem Jenseits im Diesseits gewinnen.
Daß eine solche Öffnung des Horizonts des Machbaren auch Kontrollaspirationen anf den Plan rufen konnte, die auf funktionale Emulation und instrumentelle Gestaltung setzten, zeigt der zur gleichen Zeit aufkommende Behaviorismus. Behavioristischen Bewußtseinskonstrul<teuren boten der potentielle Überschuß an Lebensformen und die enorme Plastizität menschlichen Verhaltens gerade den zentralen Ansatzpunkt für die habituelle Konditionierung von Individnen in Richtung auf eine rational funktionierende, harmonisch interagierende Gesellschaft. Dieselbe Erwartungshaltung läßt sich unter anderen gesellschaftspoli tischen Zielsetzungen auch bei Mindcontrol-Projekten konstatieren, die - hierin mit Pychedelikern und Behavioristen übereinstimmend - an die Möglichkeit eines »umgepolten Menschen« glaubten. Ob der Weg in eine neue Freiheit unter der Epochensignatur der »Selbstverwirldichung« angestrebt, ob eine Strategie der verbesserten, ja der totalen Kontrolle einzelner nach dem Paradigma der mind control oder ob behavioristische Machbarkeit, kybernetische Steuerbarkeit oder wirtschaftliche Planbarkeit anvisiert wurden: Immer war eine Vorstellung von Alternativen, ein Glaube an Veränderbarkeit im Spiel.
Inzwischen wird der Verlust dieses exzessiven Glaubens an Alternativen, der sich etwa im Alrronym TINA (there is no alternative) äußert, beklagt oder gefeiert. Mit dem Aufstieg eines »realistischen Kopfmodells<J8 erhalten Drogen eine neue kulturelle Wertigkeit. Die Hirnforschung versucht Bewußtsein aus dem Zusammenspiel von neuronaler Struktur und Hirnfunktionen zu erklären. Während
78 Michael Hagner, Geniale Gehirne. Zur Geschichte der Elitegehirnforschung, Göttin-gen 2004, S·303.
)67
die Psychedeliker der 1960er Jahre in der Anerkennung der gesellschaftlichen .Realität eine resignative Haltung, ja eine Niederlage des freien Geistes sahen, wird nun umgekehrt versucht, soziale und kulturelle Phänomene aus neurobiologischen Veranlagungen und Vorgängen heraus zu erldären. Hirnforscher wie Wolf Singer sprechen ganz nüchtern davon, daß »wir Welt nur durch die Filter von Sinnessystemen wahr[nehmen]« und daß »wir [ ... ] gefangen [sind] im Regelwerk unseres Gehirns«, wobei »Modelle von Welt« auf der Basis von »sehr eingeschränkten Wahrnehmungsleistungen« entstehen?' Das »Gefängnis« hat hier seinen Schrecken verloren; die Erkenntnis, »dass ins Bewusstsein ja nur ein ganz Ideiner Teil der Information kommt, die im Gehirn ständig verarbeitet wird«, und daß »Aufmerksamkeit« das entscheidende Selektionskriterium ist, wird als zentrale Einsicht herausgestellr.80 Gleichzeitig wird dem »Hintergrundrauschen« eine neue Rolle zugemessen. Dabei geht es um die Rolle von »Intuitionen« für menschliches Handeln und Entscheiden. Unter Intuition wird dabei jener ,>feil des Wissens« verstanden, »der im Unbewussten bleibt« und der »durch keinen Denkvorgang gefiltert, weder analysiert noch im deklarierten Gedächtnis gespeichert« wird.81 Die Konzepte einer materialistischen Psychologie bzw. eines psychologischen Materialismus gehen allerdings von einer festen Koppelung von gesundem neuronalen Substrat, normalem Bewußtsein und realitätstauglichen Weltmodellen aus. Der Begriff der Störung wird aus dieser Perspektive grundsätzlich defizitär. Er verliert seine konstruktivistische Produlnivität, denn die »Gehirnarchitektur« kann zwar durch die Aufnahme von Information aus der Umgebung »optimiert« werden, dieser Vorgang bleibt indessen zurückgebunden an »genetisch verankertes Vorwissen«.82
Diese naturalistische Sicht ist keineswegs statisch; Neurowissenschaftler wie der zitierte Wolf Singer betonen immer wieder, daß die Hirnemwicldung des Menschen zeit seines Lebens im Fluß bleibt und die Interalnion mit einer kulturellen Umwelt die »Überformung der ursprünglichen Architektur« zur Folge hat. Auch wenn das »Hirn genetisch vorprogrammiert ist für ganz bestimmte Lei-
79 Singc:r, Ein nettes Menschenbild (wie Anm. 33), S. 72. So Ebd., S. 106. SI Ebd., S. 120. Einen anderen Zugang zu dieser ))[acit dimension<, des Wissens bietet:
Michael Polanyi, Inplizites Wissen (1966), Frankfurt am Main 1985. 82 Singer, J:.:ln neues Menschenbild (wie Anm. 33), S. 71. S. 97·
368
stungen«, wird beim Menschen »die Architektur durch Erfahrung verändert und ein Teil des Programms installiert«."3 Dieses Zusatzprogramm, das auch Weltbilder und religiöse Überzeugungen umfaßt, ist jedoch Rationalitätsktiterien unterworfen; Singer vermutet deshalb, daß "Inhalte von Religionen das Destillat kollektiver Erfahrung darüber sind, wie man am besten miteinander umgeht«.84 Was die funktionalen Standardprozeduren des neuronalen Systems sowie bewährte, weil erfahrungsgesättigte soziale Normen beeinträchtigt, ist abnormal. Wenn es um die Manipulation von Bewußtseinsvorgängen geht, zählt Singer »Drogen« in einem Atemzug auf mit "Indoktrination und Demagogie, mit denen Millionen dazu gebracht werden können, Abschenliches zu run«."5 Konsequenterweise qualifizieren Hirnforscher "gesteigerte Wahrnehmung und Halluzinationen« als "Bewusstseinsstörungen« und identifizieren die chronische Einnahme von "Rauschgiften« als Ursache für das "Absterben ganzer Nervenzellverbände«. 86
Nun haben in den 1960er Jahren auch Experimentatoren wie Pahnke vor einem repetitiven, routinisierten Konsum von psychedelischen Stoffen gewarnt, jedoch nicht mit neurowissenschaftlichen Argumenten, sondern aus der Einsicht heraus, daß dies die Qualität der Drogenerfahrung herabsetzte. Obwohl Pahnke mit seinem GoodFriday-Experiment auf methodische Rigorosität und empirische Objektivierung der Resultate setzte, ging es primär um das Erleben, um den persönlichen Zugang zum Mystischen, um die sogenannte "Erste-Person-Perspektive«. Heure argumentieren Neurowissenschaftler aus einer naturwissenschaftlichen, durch bildgebende Verfallren objektivierenden "Dritte-Person-Perspektive« und hegen den Verdacht, die "Erste-Person-Perspektive« sei bloß eine Illusion."? So wird dann der "freie Wille« zum subjektiven Gefühl, das Prozesse begleitet, die sich im Hirn abspielen. In anthropomorphisierender Sprache beschrieben, steigt die "graue Masse« zum Hauptalcteur auf, während Bewußtsein zum Derivat neurologischer, physiologischer
8) Ebd.,S.97. 84 Ebd., S. 94-85 Ebd., S.63' 86 Vgl. dazu verschiedene Einträge in: Hartwig HauserlChrisrine Schöltyssek (Hg.),
Lexikon der Neurowissemchaft, 4 Bde., Berlin 2000 (Zitate: Bd. I, S. 176; Bd.), S.155)·
87 Sioger, Ein neues Menschenbild (wie Anm. 33), S. 49 f.
369
und biologischer Prozesse absinkt.·· Drogen können aus dieser Sicht zwar dazu dienen, in medizinischen Anwendungskontexten Dysfunktionen zu beheben. Chemisch induzierte »Bewußtseinserweiterung« erscheint hingegen als doppelte Störung - einerseits der Hirnfunktionen, die dadurch strukturell geschädigt werden können, andererseits der gesellschaftlichen Konventionen, die sich durch pathologische dropouts in Frage gestellt sehen.
Die fortschreitende Psychopharmalcologisierung der Gesellschaft dreht sich somit nicht mehr um den »neuen Menschen« - weder in seiner emanzipatorischen Selbstbespiegelung noch in der dystopischen Fluchtperspektive einer totalen Kontrolle in der »besten aller Welten«. Die durch Pillen moderierte Persönlichkeit, die immer mehr zu einem Normalfall modernen Lebens wird, steht vielmehr für einen Menschen, der konturlose Flexibilität und flexible Normalisierung in perfekter Funktionsanpassung verbindet.89 Wenn wir »unser Hirn« sind, so gibt es keine Alternative zum Normalfunktionieren - Protesthaltungen, wie sie in den Jahren um 1968 üblich waren, geraten in den Dunstkreis des Kranldlaften. So liegt es nahe, in Terroristen, welche die europäischen Gesellschaften in den I970er Jahren in höchste Alarmbereitschaft versetzten, rückblickend eher ,,verrückte« denn politische Radikale oder Kriminelle zn sehen. Sie werden somit Teil einer »düsteren Geschichte der psychopamologisehen Stigmatisierung [ ... J, mit der Abweichnngen politischer oder ästhetischer Art überzogen worden sind«.90 Diese Pathologisierung
88 Dies ist die rosinon eines kruden psychologischen Materialismus. Forscher wie WolfSinger formulieren vorsichtiger und erklären, es gelte. ))ruese heiden Beschreibungssystcmc einander anzunähern oder gar ineinander überzuführen« (ebd., S. 50); zur Kritik dieser ))Homunculus-Konzeptiollu des Bewußtseins vgl. M. R. Bennett/P.M.S. Hacker, PhilosophicalFoundations o[Neuroscience. Maiden, Mass., Oxford 200}; zur Kritik des Naturalismus: Peter Janidl, Was ist Infonnation? Frankfurt aln Main 2006.
89 Von daher ist es auch verkürLt, von einem Revival des LSD in der klinischen Forschung zu sprechen. Die vor kurzem in der Schweiz bewilligte befristete Pilotstudie zur Erforschung der Auswirkungen des LSD bei schwerkranken Krebspatienten stelh zwar nach dreieinhalb Jahrzehnten der Ächtung von LSD einen Durchbruch dar, der Kontext, in dem diese Substanz nun diskutiert wird, hat sich gegeniiber den I960er Jahren jedoch stark verändert. Vgl. Neue Zürcher Zeitung 60
(2008), S. 13. 90 Hagncr, Geniale Gehirne (wie Anm. 78), S. 307. Diese Pathologisierung und Natu
ralisierung des »Bösen« im Menschen wird etwa durch die Forschungen von Adrian Raine angesrrebc. Vgl. Adrian Raine, The Psychopathology o[ Crime: Cri-
370
wirkt im Gleichtal<t mit der Normalisiernng. Wenn pharmakologisch hergestellte Fitneß zur zentralen Zielgröße individueller Lebensführung aufsteigt, setzt sich ein neuer Typus von Experiment durch. Dieser dient dem Schutz der Gesellschaft vor Überraschungen. Soziale Kontexte werden mittels neuer Forschungszugänge in ein "Labof« verwandelt, in dem permanent Gefahren abgearbeitet nnd in Risiken transformiert werden. Auch die Drogen, die als Heilmittel im Dienste der Gesnndheit stehen, werden Standardisierungsprozednren nnterworfen, die ihre Risiken und Nebenwirkungen minimieren. Die »Gesellschaft als Labor« experimentiert nicht mehr mit revolutionärer Selbstveränderung oder fundamentaler Transformation, sondern arbeitet an Normierung und Kontrolle. Es scheint, als tendiere die »Natur des Menschen« auf eine ,matürliche Gesellschaftsform« hin, welche die bisher existierenden Spannungen, Konflikte und Inkommensurabilitäten in einer prästabilierten Harmonie zwischen "normalem Hirn« und "normaler Gesellschaft« zu neutralisieren in der Lage wäre.
Daß eine solche Perspektive selbst einen illusionären Projektionsraum darstellen und einem halluzinatorischen Sicherheits bedürfnis entsprechen könnte, dafur spricht vieles. Es läßt sich insbesondere konstatieren, daß der grundlegende Freiheiten sistierende Hang zn security mit einer ungestillten Nachfrage nach Verschwörungsmeorien einhergeht. Man könnte also davon sprechen, daß die eliminierten Alternativen mit geballter Wucht als illusionäre Konspirationsplots wiederkehren und der Unterstellung einer mind control anhaltende Konjunktur verschaffen. Solche Formen der Kontingenzreduktion sind heute Teil der Unterhaltungskultur. Die Vermutung von etwas anderem müßte sich allerdings nicht in der gespenstischen Hohlform von Verschwörungstheorien erschöpfen. Die Denk- und Suchbewegungen der ersten Nachkriegsjahtzehnte sind nicht zu einem Abschluß gekommen. Die gesellschaftliche Dynamik der Gegenwart beruht anf Entdeckungsverfahren, die mehr denn je die Tendenz haben, das Modell einer vorausgesetzten Wirldichkeit in Frage zu stellen. Dadurch werden die gewußten Räume des Nichtwissens ausgeweitet und der Möglichkeitssinn gestärkt. In dieser anhaltenden experimentellen Selbsterkundung und Selbstreflexion von Menschen nnd 'Gesellschaften reproduzieren sich Fragen, wel-
minal Behavior os a Clinical Disorder, San Diego u. a. 1993; Adrian Raine (Hg.), Crime and Schizophrenia: Cames and Cures, New York 2006.
371
ehe "Psychonauten« wie Albert Hofmann9' und die Psychedelilcer der 1960er Jahre bewegten; diese Probleme verschwinden nicht dadurch, daß der heute vorherrschende Naturalismus dazu nichts zu sagen hat.
91 Albert Hofmann, Erinnerungen eines Psychollauten [Ton/CD}: Von der E~tdeckung entheogener Drogen. Köln 2003 (Konzeption und Produktion: Thomas Knoefel).
372
~
.~