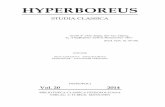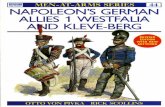Ein neuer Krieg um Berg-Karabach? Eine Prognose
Transcript of Ein neuer Krieg um Berg-Karabach? Eine Prognose
Ein neuer Krieg um Berg-Karabach? Eine Prognose
Jeannette Bell
Einleitung
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Südkaukasus von
gewaltsamen Konflikten geprägt. Nach dem Zerfall der
Sowjetunion (UdSSR) breiteten sich Unabhängigkeitsbewegungen
und der Kampf der Eliten um politische und wirtschaftliche
Macht im post-sowjetischen Raum aus. Die Region zwischen dem
Schwarzen und dem Kaspischen Meer, welche die Staaten Georgien
(4,7 Mio. Einwohner), Aserbaidschan (8 Mio. Einwohner) und
Armenien (3 Mio. Einwohner) umfasst, beheimatet die
sezessionistischen Gebiete Berg-Karabach, Abchasien und Süd-
Ossetien. Die beiden letzteren wurden von Russland, Nicaragua,
Venezuela und Nauru nach dem „Kaukasuskrieg“ zwischen Georgien
und Russland im August 2008 als unabhängige Staaten anerkannt.
Alle de facto-Regime weisen zusammen eine Gesamtbevölkerung von
weniger als einer halben Millionen Menschen auf.1
Die Auseinandersetzungen um die de facto-Republiken sind
inzwischen nahezu chronisch, vielschichtig und komplex. Die
Konflikte bergen regionale, aber auch internationale
Sicherheitsrisiken und Eskalationspotenzial in sich. Eine
Verschärfung des Berg-Karabach-Konflikts ähnlich wie im Sommer
2008 zwischen Georgien und Russland ist nicht auszuschließen
und bedarf daher einer realistischen Betrachtung. Von den
Medien, aber auch in der bi- und multilateralen Zusammenarbeit
mit Armenien und Aserbaidschan wird die Sprengkraft des Berg-
1 Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, SWP-Studie, StiftungWissenschaft und Politik/ Deutsches Institut für Internationale Politik undSicherheit, Berlin, März 2010, S. 7.
1
Karabach-Konfliktes unterschätzt, und das, obwohl er sich
derzeit merklich zuspitzt. Ende August kam es zu Feuergefechten
zwischen der Armee Aserbaidschans und Berg-Karabachs.2
Gründe für eine mögliche Eskalation liegen auf der nationalen
sowie auf der internationalen Ebene. Diese Analyse versucht
daher einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten,
welche Prognose die geopolitische und innenpolitische Lage, in
der sich Aserbaidschan befindet, im Hinblick auf einen
dauerhaften Frieden momentan zulässt?
Im Folgenden soll ein Abriss der Geschehnisse zeigen, wie es
zum Status quo zwischen der im Jahre 1991 proklamierten
„Republik Berg-Karabach“, Aserbaidschan und Armenien kam und
welche Forderungen auf dem Verhandlungstisch liegen. Eine
Analyse der geopolitische Lage und der internationalen
Beziehungen sind anschließend im Fokus der Betrachtungen. Eine
„Innensicht“ Aserbaidschans soll das Bild, soweit wie im Umfang
eines solchen Beitrages möglich, abrunden. Besonders soll in
diesem Teil hervorgehoben werden, dass es nach wie vor Opfer
des Konfliktes gibt. Menschen kommen auch heute noch in Kämpfen
oder durch Landminen und Unexploded Ordinances ums Leben.
Außerdem befinden sich Hunderttausende Vertriebene und
Flüchtlinge in Aserbaidschan in einer prekären Lebenssituation
als „Menschen zweiter Klasse“. Darüber hinaus leben ca. 30 000
Armenier in Aserbaidschan, die besonders gefährdet sind durch
das Eskalationspotenzial.3 2 Ria Novosti: Bergkarabach-Streit: Feuergefechte an armenisch-aserbaidschanischerWaffenstillstandslinie, 01.09.2010:http://de.rian.ru/security_and_military/20100901/257203484.html (Stand: 14.09.2010)3 „Armenians in Azerbaijan are at a high risk of conflict as long as the Nagorno-Karabakh issue remains unsettled.“Assessment for Armeniens in Azerbaijan, Minoritiesat Risk Project, 2004-2010: http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=37301 (Stand: 14.09.2010)
2
Der Beitrag gründet sich neben wissenschaftlichen und Presse-
Quellen auf Gespräche mit aserbaidschanischen
Regierungsmitgliedern sowie lokalen und internationalen
Organisationen in Aserbaidschan, die im Rahmen eines
Forschungsaufenthaltes 2009 geführt wurden.
1. Analyse im Rückblick: Wo liegen die Ursprünge desKonfliktes?
Man wandte während des Zerfalls der Sowjetunion die Prinzipien
der KSZE-Schlussakte von Helsinki (1975)4 zum Selbstbestimmungsrecht der
Völker und der territorialen Integrität von Staaten an. Dies
hieß für die Nachfolgestaaten der UdSSR, dass als unabhängige
Staaten nur die ehemaligen Unionsrepubliken anerkannt wurden,
jedoch keine nachgeordneten Gebietskörperschaften wie Distrikte
oder Provinzen. Die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung
ethnischer Gruppen stand daher zwangsläufig in Konflikt mit
territorialen Gebietsansprüchen der Nachfolgestaaten.
Ethnisierung der Politik und ein Mangel an demokratischen
Regelungsmechanismen waren die Folge.5
Durch erbitterte Kämpfe wurden in der Folge territoriale de
facto-Grenzen in der Region gezogen. Der Konflikt um das Gebiet
Berg-Karabach (ca. 4400 km2 Fläche und ca. 140 000
hauptsächlich armenische Einwohner)6 wird zumeist als in der
4 Zum Prinzip der territorialen Integrität (in Betrachtung des Kosovo-Falls) machtHans-Joachim Heintze hierzu nähere Ausführungen in: Prinzipien der HelsinkiSchlussakte im Widerspruch? Selbstbestimmungsrecht der Völker versus territorialeIntegrität der Staaten: http://www.core-hamburg.de/documents/jahrbuch/04/Heintze-dt.pdf (Stand: 14.09.2010)5 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, Berlin, März 2010, S. 10.6 Hier Angaben nach Orth, Stephan: Berg-Karabach, Auferstehung aus Ruinen, SpiegelOnline, 19.02.1008: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,533194,00.html(Stand: 14.09.2010). Die Angabe zu der Größe des Territoriums variiert jedoch je
3
ethnisch geprägten Politik Josef Stalins begründet gedeutet.
Armeniens kurze Unabhängigkeit zwischen 1918-1920 endete mit
der Invasion der Bolschewiki in der transkaukasischen Region
und deren Einverleibung in die Sowjetunion. Die Sowjetische
Führung entschied, Karabach und Ganja dem Aserbaidschanischen
Gebiet zuzuschlagen, und transformierten außerdem „Nachičevan“
(das traditionell ein Teil des persischen Armeniens war) zu
einer Enklave in Aserbaidschan. Der Großteil des historischen
Armeniens wurde von den Sowjets zwischen Georgien und der
Türkei aufgeteilt, u.a. auch der für Armenier bedeutende Berg
Ararat. Das Gebiet, das letzten Endes zur Sowjetrepublik
Armenien, und somit zur kleinsten aller Sowjetrepubliken wurde,
umfasste nicht wesentlich mehr als den administrativen Distrikt
Jerevan.7
Stalin verlieh Berg-Karabach den Status eines autonomen
Gebietes (oblast) innerhalb der Sowjetunion und Nachičevan den
einer autonomen Republik. Als Motiv der Sowjets, Aserbaidschan
Berg-Karabach als Territorium zuzuschlagen, wird häufig
angenommen, es handele sich um eine Strafmaßnahme für den
armenischen Widerstand:
„The Armenians, who had traditionally backed the Czars,initially resisted the Bolsheviks. This resistance was centeredin Karabakh, which may help explain the retention of Karabakhas a part of Azerbaijan.“8
Seit der Autonomieregelung kam es immer wieder zu Spannungen
und Protestbewegungen in der oblast Berg-Karabach, nichtnach Quelle und wird zwischen 4000 und 12000 km2 angegeben.7 „Armenians in Azerbaijan are at a high risk of conflict as long as the Nagorno-Karabakh issue remains unsettled.“Assessment for Armeniens in Azerbaijan, Minoritiesat Risk Project, 2004-2010: http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=37301 (Stand: 14.09.2010)8 Ibid.
4
zuletzt wegen unterdrückender Maßnahmen durch Moskau und Baku.
Im Jahre 1979 beispielsweise lebte eine Mehrheit von 74%
Armeniern in Berg-Karabach, doch es wurde ihr während der
gesamten Sowjetherrschaft versagt, höhere armenische
Bildungsinstitutionen zu gründen oder armenisches Fernsehen zu
empfangen.9 Die Unzufriedenheit spitzte sich bis zum Ende der
1980er Jahre daher immer weiter zu. In der Zeit von „glasnost“
stellte die Frage um die Zugehörigkeit Berg-Karabachs ein
zentrales Thema für die meisten Armenier, insbesondere der
Diaspora, dar. Michail Gorbatschow10 distanzierte sich derzeit
stark von einem „Missbrauch von glasnost“, der auf den Versuch
abziele, „internationale Grenzen neu zu ziehen.“11
In den 1970er Jahren gab es Forderungen in Jerevan und
Stepanakert (der Hauptstadt Berg-Karabachs) nach einem
Zusammenschluss mit Armenien. 1988 gingen Hunderttausende
Menschen in Jerevan auf die Straße, um für diese Forderung zu
demonstrieren. Immer öfter kam es in dieser Zeit zu gewaltsamen
Ausschreitungen zwischen Armeniern und Aseris. Mit dem Massaker
von Sumgait im Februar 1988 war ein erster trauriger Höhepunkt
der Gewalt erreicht.12 Gorbatschow versprach, in der Berg-
Karabach Frage zu handeln. Doch er tat es nicht im Sinne der
Armenier: am 18. Juli 1988 lehnte das Präsidium des Obersten
Sowjets in Moskau die Vereinigung Berg-Karabachs mit
9 Ibid.10 Gorbatschow bekleidete von März 1985 bis August 1991 das Amt des Generalsekretärsdes Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und von März 1990 bisDezember 1991 war er Präsident der Sowjetunion.11 Jacoby, Volker: Geopolitische Zwangslage und nationale Identität: Die Konturender innenpolitischen Konflikte in Armenien. Diss., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 1998, S. 198.12 Zeit Online Archiv: Massaker von Sumgait, 1991, Ausgabe 35:http://www.zeit.de/1991/35/Massaker-in-Sumgait (Stand: 14:09.2010)
5
Sowjetarmenien einstimmig ab.13 Die Anzahl sowjetischer Truppen
in Berg-Karabach wurde im Herbst 1988 zudem erhöht,
Demonstrationen und Streiks verboten.14 Die Entscheidungen
empfanden die Armenier als ungerecht. Man zeigte sich
enttäuscht von Moskau und Gorbatschow. In dieser Zeit wurde, so
Jacoby, das erste Mal die Idee einer Nationalbewegung
formuliert.15 Am 10. Dezember 1991 erklärte sich Berg-Karabach
nach einem Referendum für unabhängig.
Der Konflikt um Berg-Karabach erreichte zwischen 1991 und 1994
seinen blutigen Höhepunkt im Krieg zwischen Armenien und
Aserbaidschan. Armenier wurden während des Krieges aus
verschiedenen Städten und Dörfern in den umkämpften Gebieten
vertrieben, ebenso erging es Aseris. Es wurden zudem Massaker
an Armeniern in Aserbaidschan verübt. Mahr als 800 000
Menschen, zumeist Aseris, wurden von den besetzten Gebieten und
aus Armenien vertrieben. Ca. 230 000 Armenier hingegen flohen
aus ihrer Heimat Aserbaidschan nach Berg-Karabach und
Armenien.16 In Aserbaidschan leben heute, je nach Quelle,
zwischen 640 000 und 690 000 Heimatvertriebene.17 Es ist in
Summe von ca. 1 Mio. Flüchtlingen auf beiden Seiten die Rede.18
13 Jacoby: Geopolitische Zwangslage und nationale Identität, Frankfurt am Main,1998, S. 201.14 Ibid., S. 212.15 Ibid., S. 206.16 CIA World Factbook, Armenien: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html (Stand: 14.09.2010)17 CIA World Factbook, Azerbaijan: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html (Stand: 14.09.2010)18 Auswärtiges Amt: Der Konflikt um Nagorny-Karabach, 30.06.2010:http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Armenien/ArmenienLinks/080306-KarabachKonflikt.html (Stand: 14.09.2010)
6
Im Jahre 1994 wurde unter der Vermittlung der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die sich seit 1992 um
Annäherung der Kriegsparteien Aserbaidschan und Armenien
bemühte, ein Waffenstillstand vereinbart. 30 000 Menschen waren
den Kämpfen jedoch bereits zum Opfer gefallen. Leider blieb der
Waffenstillstand, bis heute fragil:
„The cease-fire agreement that theoretically terminated theAseri-Armenian war was by no means a peace treaty, for tensionsand rhetoric remain high on both sides, and the truce has beena number of times, with border incidents and other isolatedskirmishes still an occasional feature in the region, resultingin deaths for both Aseris and Armenians.“
Das Gebiet Berg-Karabach sowie sieben aserbaidschanische
Grenzdistrikte sind derzeit noch von Armenien besetzt. Das
entspricht ca. 16% des Gesamtterritoriums Aserbaidschans.19 Nur
wenige Aseris sind in der umkämpften Region geblieben.20 Erst
seit 2008 sind Vertriebene im Zuge des „Repatriation Plans“ der
aserbaidschanischen Regierung in die Nähe der besetzten Gebiete
zurückgekehrt.
Die selbstproklamierte „Republik Berg-Karabach“ wird bis heute
hauptsächlich von Geldern der armenischen Diaspora finanziert.
Es gilt die armenische Währung, und 20 000 Soldaten des
armenischen Militärs bewachen die Waffenstillstandslinie zu
Aserbaidschan.21 Die Bewohner leben nicht zuletzt wegen der
19 CIA World Factbook, Azerbaijan.20 Als Soforthilfe wurden im Jahre 1989 Zeltcamps von islamischen Organisationen,von lokalen NGOs und hilfsbereiten Landsleuten erstellt. Zelte und Kleidung kamenhauptsächlich aus der Türkei und dem Iran. Erst im Jahre 1994 schalteten sichinternationale Hilfsorganisationen, allen voran das Internationale Komitee vom RotenKreuz (IKRK) und der Hohe Kommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR),in die Konfliktnachsorge ein. Auch der aserbaidschanische Staat begann, Vertriebenesystematisch zu unterstützen.21 Orth: Berg-Karabach, Auferstehung aus Ruinen, Spiegel Online, 19.02.1008:
7
regionalen und internationalen Isolation in Armut, und aufgrund
der steten Kämpfe in Unsicherheit.22
2. Analyse der Verhandlungen: Aussicht auf Erfolg in 2010? Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) nahm nach Ausbruch der Kämpfe 1992
Vermittlungsbemühungen durch die sog. Misk-Gruppe mit den Ko-
Vorsitzenden USA, Russland und Frankreich auf.23 Die Mink-
Gruppe, bestehend aus 13 Teilnehmerstaaten, begleitet seit 1992
„track 1“ und „track 2“-Treffen der aserbaidschanischen und
armenischen Seite. Vertreter von Berg-Karabach sind zu den
Verhandlungen nicht eingeladen.
In der Vergangenheit gab es bereits Grund zur Hoffnung auf
Fortschritte, doch weder der Prag-Prozess von 2004, noch die
Verhandlungen von Rambouillet 2006 brachten Erfolge. Ende 2007
unterbreitete die Minsker Gruppe dann Armenien und
Aserbaidschan einen vertraulichen Verhandlungsvorschlag in
Madrid, der seither unter „Basic Principles“ bekannt ist. Die
Grundaussagen machten die Präsidenten der Ko-Vorsitzenden
Staaten auf dem G8-Gipfel im Juli 2009 öffentlich:24
1. Rückgabe der um Berg-Karabach liegendenaserbaidschanischen Gebiete unter aserbaidschanischeKontrolle,
2. Interim-Status für Berg-Karabach einschließlichSicherheitsgarantien und Selbstregierung,
3. Verbindungskorridor zwischen Armenien und Berg-Karabach,
22 Minorities at Risk Project, Center for Development and Conflict Management,Maryland, 2004-2010.23 Weitere Mitglieder sind neben Aserbaidschan und Armenien Belarus, Finnland,Italien, Schweden, die Türkei, Deutschland und die rotierende OSZE-Troika.24 Nach Auswärtiges Amt: Der Konflikt um Nagorny-Karabach, 30.06.2010.
8
4. Zukünftige Bestimmung des endgültigen Status‘ von Berg-Karabach durch bindende Willensäußerung,
5. Rückkehrrecht von Flüchtlingen zu ihren früherenWohnorten; internationale Sicherheitsgarantien einschließlichfriedenserhaltender Operationen.
Doch eine Unterzeichnung oder gar Umsetzung der Vorschläge
durch die Streitparteien ist bisher nicht in Sicht.25 Es bleibt
aber zu hoffen, dass eine Unterzeichnung der Madrider
Vorschläge ein Ergebnis der diesjährigen Gespräche sein wird,
denn:
„Importantly, both the Armenian and Azerbaijani sides havelargely accepted the basic principles as a framework fornegotiations, which make it harder and politically more riskythan before for either party to the conflict to reject it andexpect to start negotiations on different grounds.“26
Allerdings sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Die
Bewohner Berg-Karabachs haben entgegen internationaler Proteste
im Mai 2010 Parlamentswahlen abgehalten. Die regierende Partei
„Freies Mutterland“ („Freiheitliche Heimat“) siegte mit 45,8%
der Stimmen. Aserbaidschan regierte ungehalten und betonte, die
Wahl verstieße „gegen alle Normen des internationalen Rechts“,
wie der österreichische Standard berichtete.27 Aserbaidschan
ist nach wie vor nicht gewillt, über einen Status zu
verhandeln, der über eine umfassende Autonomie innerhalb
Aserbaidschans hinaus geht. Auch die EU lehnte die Wahlen ab.
25 Siehe hierzu: OSCE: Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries, OSCEPress Release, 26.06.2010: http://www.osce.org/item/44971.html (Stand: 14.09.2010)26 Hysenov, Tabib: A Moment of Truth in the Nagorno-Karabakh Talks? 16.06.2010:http://aussenpolitik.net/themen/eurasien/kaukasus/a_moment_of_truth_in_the_nagorno-karabakh_talks/ (Stand: 14.09.2010)27 Der Standard: Internationale Proteste gegen Wahl in Nagorno-Karabach, 23.05.2010:http://derstandard.at/1271377301673/Internationale-Proteste-gegen-Wahl-in-Berg-Karabach (Stand: 14.09.2010)
9
Russland unterstütze Aserbaidschan in seiner Forderung nach
territorialer Integrität.28
In diesem Jahr nahm zudem das Säbelrassen an Häufigkeit und
Schärfe nicht ab. Aserbaidschan versäumt nicht zu betonen, es
sei bereit, militärische Gewalt anzuwenden. Im Juli kaufte es
außerdem russische S-300 Raketen, angeblich „der teuerste
Einzelkauf neuer Militärtechnik im GUS-Raum“.29 Die
aserbaidschanische Regierung prangert zudem Übergriffe auf ihre
Soldaten an der Waffenstillstandslinie an. Im Februar wurden
beispielsweise die Anschuldigen laut, armenische Scharfschützen
hätten drei aserbaidschanische Soldaten erschossen.30 Zur
gleichen Zeit erschienen Berichte darüber, dass Armenien „im
Notfall“ gewillt sei, um Berg-Karabach mit Waffengewalt zu
kämpfen.31 Ein aserbaidschanischer Minister des
Verteidigungsministeriums, Safar Abiyev, soll nach einem
Bericht der Nachrichtenagentur Reuters Ende Februar 2010 gesagt
haben:
„Now it is up to the military, and this danger is gradually approaching. If theArmenien occupier does not liberate our lands, the start of a great war in the SouthCaucasus is inevitable.“32
28 Ibid.29 Ria Novosti: Aserbaidschan kauft russische S-300-Raketen, 29.07.2010:http://de.rian.ru/business/20100729/127293716.html (Stand: 14.09.2010)30 Afet Mehtiyeva: Azerbaijan warns of „great war“ in the South Caucasus, ReutersAlertNet, 25.02.2010: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61O244.htm (Stand:14.09.2010)31 Ria Novosti: Armenien will Bergkarabach im Notfall auch mit Waffen schützen,11.03.2010: http://de.rian.ru/post_soviet_space/20100311/125444231.html (Stand:14.09.2010)32 Afet Mehtiyeva: Azerbaijan warns of „great war“ in the South Caucasus, ReutersAlertNet, 25.02.2010: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61O244.htm (Stand:14.09.2010)
10
Armenien vereinbarte mit Moskau indes im August 2010 im Rahmen
des Vertrages über den Stützpunkt im nordarmenischen Gjumri,
der als Bestandteil der Luftabwehr der GUS gilt und 1995
eingerichtet worden war, eine längere russische Militärpräsenz
in Armenien. Es befinden sich dort derzeit 5000 Soldaten, ein
Flugabwehrsystem S-300 und mehrere MiG-29-Jäger. Der
ursprünglich bis 2010 befristete Vertrag wurde bis 2044
verlängert.33
Dem entgegen stehen die durchaus positiven Annäherungen von
Ende 2009. Im Dezember hatte eine Sitzung des OSZE-
Außenministerrates stattgefunden, das mit einer gemeinsamen
Erklärung mit den Außenministern Armeniens und Aserbaidschan
abgeschlossen wurde, in der es hieß, dass die Bereitschaft
bestehe, das Beste für die Klärung der ungeregelten Fragen zu
tun. Dies solle in Übereinstimmung mit der Schlussakte von Helsinki
passieren, die Gewaltverzicht oder Androhung von Gewalt
verbietet und die territoriale Integrität, die Völkergleichheit
und das Recht der Nation auf Selbstbestimmung hervorhebt.34 In
Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker wird von
Armenien seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo
allerdings vermehrt darauf hingewiesen, dass den Armeniern in
Berg-Karabach das gleiche Recht zugebilligt werden müsse:
„Altough all existing similar cases differ from each other, the Nagorno-Karabakhright to self-determination is no less substantiated than that of Kosovo and someothers.“35
33 Ria Novosti: Medwedew beschwichtigt Baku: Basis in Armenien sorgt für Frieden imKaukasus, 03.09.2010 (Stand: 14.09.2010)34 Ria Novosti: Karbach-Konflikt: Licht am Ende des Tunnels? 27.01.2010:http://de.rian.ru/comments_interviews/20100127/124862427.html (Stand: 14.09.2010)35 Rede von E.H. Edward Nalbadian, Außenminister der Republik Armenien bei der DGAP,Berlin, 15.03.2010: Armenia and Her Neighbourhood: Prospects for New Dynamics.
11
Beunruhigend ist jedoch besonders, dass laut Presseberichten am
31. August Feuergefechte an der Waffenstillstandslinie zwischen
der aserbaidschanischen und der Armee von Berg-Karabach mit
Todesopfern stattgefunden haben sollen. Bis heute ist nicht
geklärt, welche Seite in der Nähe des Dorfes Werin Tschailu die
Gegenseite zuerst angriff.36
3. Fallstricke durch Internationale Beziehungen und das
Geopolitische Umfeld
Ein Fallstrick für demokratische und friedensfördernde
Entwicklungen stellt die geopolitisch günstige Lage
Aserbaidschans zwischen Iran und Russland dar. Die Region
zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, insbesondere
Aserbaidschan, liegt an der Schnittstelle zwischen Europa, dem
Nahen und Mittleren Osten und Zentralasien. Es ist nicht mehr
länger sowjetische Peripherie, sondern wirtschaftliches
Zentrum, und Knotenpunkt für Transitwege. Während der
Vermittlungen in den 1990er Jahren nahmen die USA zunächst die
Haltung Russlands ein und unterstützten Armenien. Dies ist im
Besonderen auf die Lobbyarbeit der armenischen Diaspora in den
USA zurückzuführen.37 Zunehmend sahen die USA jedoch
Aserbaidschan als strategischen Partner in der Region,
vorwiegend auf wirtschaftlicher Ebene wegen der reichen Öl- und
Gasvorkommen im Kaspischen Meer, jedoch auch in militärischer
Hinsicht aufgrund seiner geographischen Nähe zu Iran, aber auch
36 Ria Novosti: Bergkarabach-Streit: Feuergefechte an armenisch-aserbaidschanischerWaffenstillstandslinie, 01.09.2010.37 Minorities at Risk Project, Center for Development and Conflict Management,Maryland, 2004-2010.
12
zum Irak und Afghanistan.38 Aserbaidschan beteiligte sich
beispielsweise an Antiterroraktionen der USA. US-amerikanische
Flugzeuge seien von Aserbaidschan nach Afghanistan gestartet,
so Leyla Yunus, die wegen ihrer Demokratiebemühungen genauso
wie ihr Mann Arif in Aserbaidschan nicht sicher ist und derzeit
in Hamburg lebt.39 Darüber hinaus wollen die USA ein
Gegengewicht zu Russland in der Region aufbauen.40 Russland
nimmt heute eine neutrale Haltung ein. Es betont, dass die
Konfliktparteien selbst die Verantwortung für eine Regelung
trügen und man keine „Rezepte aufzwingen“ wolle.41 Es
kooperiert mit beiden Seiten.
Der Iran hingegen hat das Ziel, die Präsenz der USA im
Kaspischen Raum minimal zu halten. Die guten Beziehungen
Aserbaidschans zu den USA und Israel ist Iran ein Dorn im Auge,
fürchtet die iranische Führung doch auch ein Näherrücken der
NATO. Der Iran hat daher seine militärische Zusammenarbeit mit
Armenien intensiviert. Ende 2007 haben beide Länder einen
Militärvertrag unterschrieben, in dem sich der Iran
verpflichtet, die Logistik der armenischen Armee vollständig zu
übernehmen.42 Der iranische Botschafter in Baku äußerte sich
2008 auch in Bezug auf die Radaranlage Gabbala sehr kritisch:
38 Ibid.39 Hangen, Claudia: Die doppelgesichtige Demokratie. Aserbaidschan: Ölinteressen undinnere Freiheit, 08.08.2010: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33071/1.html(Stand: 14.09.2010). Siehe auch das hier verwendete Buch von Arif Yunusov:„Azerbaijan in the Early of XXI Century: Conflicts and Potential Threats“.40 Ibid,41 Ria Novosti: Russand, Aserbaidschan und Armenien verhandeln über Berg-Karabach,25.01.2010: http://de.rian.ru/world/20100125/124818386.html (Stand: 14.09.2010)42 Abdolvand, Behrooz/ Liesener, Michael/ Feyzi Shand, Nima: Aserbaidschan - eineUS-Militärbasis gegen den Iran? Eurasisches Magazin, 31.03.2008:http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20080306 (Stand: 14.09.2010)
13
„In der Geschichte der Beziehungen beider Republiken gab es immer Höhen undTiefen. Wir betrachten die Frage der Radaranlage mit großer Sensibilität, weil wirden Frieden in Aserbaidschan und Iran erhalten möchten. Wir sind der Meinung,dass weder die aserbaidschanische Regierung, noch die aserbaidschanische Nationzulassen dürfen, unter dem Deckmantel der Sicherheit betrogen zu werden.“43
Gemeint ist ein Betrug durch Russland und die USA, die erwägen,die Anlage gemeinsam zu nutzen.
Iran sieht mit Spannungen auf die aserbaidschanisch-
amerikanischen-russischen Beziehungen und positioniert sich,
entgegen religiöser und kultureller Nähe, gegen Aserbaidschan.
Sollte es zur Eskalation im Berg-Karabach-Konflikt kommen,
würde Iran Armenien unterstützen, möglicherweise mit
militärischen Ressourcen.
Trotz aller Streitpunkte lässt sich das gemeinsam Interesse an
Prosperität und Fortschritt in der Region ausmachen. Für die EU
spielt die Region für die zukünftige Energieversorgung eine
Schlüsselrolle – Stichwort Nabucco-Pipeline, aber auch wegen
Sicherheitsfragen. Die Bekämpfung von Menschen-, Waffen-, und
Drogenhandel sind ein vordergründiges Anliegen der EU im
Transkaukasus. Auch Russland hegt energiewirtschaftliches
Interesse, ebenso die USA. Hinzukommen militärisch-strategische
Überlegungen von Seiten der USA und der NATO auf der einen, und
Russland auf der anderen Seite. Russland bezeichnet den
Schwarzmeerraum als „Zone privilegierten Einflusses“.44 Die USA
verfolgen eine Reihe politischer, wirtschaftlicher und
militärischer Pläne zur Sicherung des Energietransits und zur
Förderung der Terrorismusbekämpfung im Bereich des „Greater
43 Ibid.44 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, März 2010, S. 6. Zu dengeopolitischen Interessen externer Akteure bezüglich Georgien aber auch derGesamtregion Südkaukasus siehe auch: Werkner: Die Rolle der EU zwischen westlichenund östlichen hegemonialen Interesen – Eine Analyse des Russisch-GeorgischenKrieges, 2010, S. 95 ff.
14
Middle East“ und des „Wider Europe“.45
Als Fallstrick für vermehrten internationalen Druck in Richtung
demokratischen Wandels und friedenspolitische Fortschritte kann
die pro-westlichen Haltung des aserbaidschanischen Präsidenten
Heydar Aliyevs und dem Öl- und Gasreichtum der Republik gesehen
werden.46 Die reichen Öl- und Erdgasquellen ermöglichen Europa
eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber russischem Öl, was nicht
zuletzt das Pipeline-Projekt Nabucco sicherstellen soll. Das
Gas, das einmal durch die geplante Nabucco-Pipeline unter
Umgehung Russlands aus dem Kaspischen Raum nach Europa gepumpt
werden soll, soll u.a. aus Aserbaidschan kommen. Genau deshalb
scheint das Ausland allerdings den Konflikt um Berg-Karabach
und die regionalen Spannungen in der Zusammenarbeit mit
Aserbaidschan als Thema und Betätigungsfeld zu meiden. Dies
geschieht vermutlich, um wirtschaftliche Beziehungen nicht
durch (vermeintliche) Parteinahme zu gefährden.
Die ausländischen Diplomaten kennen die sozio-politische
Situation sowie die Lebensumstände der Bevölkerung am
Kaspischen Meer. Demokratiedefizite und
Menschenrechtsverletzungen sind hinlänglich bekannt und
dokumentiert.47 Das Ausland „hütet sich aber vor Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der Republik im östlichen Südkaukasus.“48 Auch Hillary
Clinton war bei ihrem Besuch am 4. Juli 2010 in Aserbaidschan
45 Werkner: Die Rolle der EU zwischen westlichen und östlichen hegemonialenInteresen, 2010, S. 99.46 Hangen: Die doppelgesichtige Demokratie. Aserbaidschan: Ölinteressen und innereFreiheit, 08.08.2010.47 OSZE: Wo die Medienfreiheit in Europa eingeschränkt ist. , Die Presse (Wien),29.07.2010: http://diepresse.com/home/kultur/medien/584447/index.do?_vl_backlink=/home/kultur/medien/index.do (Stand: 14.09.2010) 48 Hangen: Die doppelgesichtige Demokratie. Aserbaidschan: Ölinteressen und innereFreiheit, 08.08.2010.
15
vorsichtig in ihrem Urteil: "Auch die USA haben 230 Jahre auf dem Weg
zur Demokratie gebraucht"49, lautete ihr Resümee.
Dass die Konflikte bisher stiefmütterlich behandelt wurden,
zeigen nicht zuletzt die Dokumente der EU zur
Nachbarschaftspolitik im Südkaukasus, zum Schwarzmeerraum oder
zur Östlichen Partnerschaft.50 Umso wichtiger ist es, dass die
EU nicht weiterhin „working around conflict“, sondern „working
on conflict“ betreibt. Die EU hat sich bisher mehr im Konflikt
um Süd-Ossetien engagiert, am wenigsten in der Karabach-
Frage.51 Dieser ist jedoch der Schlüsselkonflikt in der Region
und ist am tiefsten historisch verankert. Wenn er nicht
beigelegt wird, werden die Menschen in der Region nicht zur
Ruhe kommen.
Dazu kommt, dass trotz des positiv erscheinenden Einsatzes des
Auslandes in Aserbaidschan in zivilen wie Regierungskreisen
Frustration über dessen Rolle bei den Verhandlungsrunden,
jedoch insbesondere bezüglich ihres Handelns im Land
vorherrscht. Besonders die Regierung betonte in Gesprächen
2009, dass sie nicht auf finanzielle Hilfe aus dem Ausland
angewiesen sei, das im Konflikt mit Armenien bei der
Durchsetzung, ihrer Ansicht nach legitimer Gebietsansprüche
keine Unterstützung zeige. Diese Kritik bezog sich auch auf die
humanitären und Entwicklungsorganisationen im Land. Mit fast
allen ausländischen Nicht-Regierungsorganisationen wurden
deshalb 2009 keine Kooperationsabkommen mehr geschlossen und
sie verließen das Land. Die offizielle Begründung von beiden
49 Ibid,50 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, März 2010, S. 5.51 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, März 2010, S. 5.
16
Seiten lautet, Aserbaidschan käme aufgrund des Ölwohlstandes
ohne internationale Gelder und Aufbauhilfe zurecht. Sehr gerne
wird hierbei auf die Siedlungsprojekte in den Kriegsgebieten
verwiesen, die die Regierung selbständig finanziert.
Ein weiterer Fallstrick für ein Vorwärtskommen in den
Verhandlungen könnte außerdem durch die Dreiecksbeziehung
Armenien-Türkei-Aserbaidschan drohen. Der Konflikt um Berg-
Karabach entfaltet auf dem diplomatischen Prozess der türkisch-
armenische Annährung eine „Störwirkung“. Für Armenien ist daher
die Lösung des Berg-Karabachs-Konfliktes oder zumindest eine
Annäherung an Aserbaidschan auch im Hinblick auf eine positive
Entwicklung seiner Beziehungen zur Türkei wichtig.52 Denn durch
Baku, das fürchtet, dass die im Jahre 1993 geschlossene
türkisch-armenische Grenze geöffnet werden könnte, ohne dass
die armenischen Truppen zuvor von aserbaidschanischem Gebiet
abgezogen sind, wird eine mögliche Aussöhnung zu einer
„trilaterale Angelegenheit“.
3. Innenpolitische Zwänge und Konfliktpotenziale
4.1. Aserbaidschan als „No War, No Peace Society“
Versucht man die Ursachen des Konflikts um die Bergregion
Karabach zu verstehen, stößt man auf vielschichtige
Erklärungsversuche in der Literatur. Historische, religiöse,
territoriale Motive sind ebenso von Bedeutung wie
nationalistische Trends, geopolitische Einflüsse und sozio-
ökonomische Gegebenheiten. Eine Einordnung in Kategorien wie
52 Ria Novosti: Karbach-Konflikt: Licht am Ende des Tunnels? 27.01.2010:http://de.rian.ru/comments_interviews/20100127/124862427.html (Stand: 14.09.2010)
17
„Territorialkonflikt“, „Regionalkonflikt“, „ethnischer“ oder
„religiöser Konflikt“, trägt zwar zum Verständnis einzelner
Facetten bei, der Komplexität der Gegebenheiten wird ein
solches „definitorisches Korsett“ jedoch nicht gerecht.
In der historischen Betrachtung des Berg-Karabach-Konfliktes
wurde deutlich, dass ethnische und religiöse Aspekte im Diskurs
innerhalb der betroffenen Gesellschaften und im Gespräch mit
der Konfliktpartei an Bedeutung zunahmen. Geschichtsdeutungen
in Abgrenzung zum „Feind“ und religiöse Unterschiede wurden auf
allen Seiten mehr und mehr betont. Ein in seiner Schärfe und
Abgrenzung als neu zu charakterisierendes, historisch-
ethnisches Selbstverständnis wurde etabliert.53 Häufig wurde
der Armenisch-Aserbaidschanische Konflikt aufgrund dieser
Rhetorik als „religiöser“ oder „ethnischer Konflikt“ in der
Literatur gedeutet. Die Autoren des „Minority at Risk Project“
interpretieren beispielsweise die armenischen Sentiments in die
ethnische Richtung:
„The Azerbaijani control of Karabakh represented the continuingsubjugation of Armenians by Turks (as Armenians tend to see allAseris as Turks) and ultimately would lead to calls foroverarching political reform in the Soviet Union. Turkicnationalism has been a powerful force in Baku and hasundoubtedly contributed to the conflict with the Armeniansgiven the lingering historical enmity between Armenians andTurkey.“54
Die Unterschiede in Religion und Volkszugehörigkeit stellen
53 Hierzu unternimmt insbesondere Volker Jacoby sehr interessante Analysen, in:Geopolitische Zwangslage und nationale Identität: Die Konturen der innenpolitischenKonflikte in Armenien. Diss., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main,1998, S. 198.54 Die türksich-armenisch-aserbaidschanische Konfliktlinie ist auch heute noch vonBedeutung, wie der Abriss über geopolitische Zusammenhänge verdeutlichen wird. Zitataus: Assessment for Armeniens in Azerbaijan, Minorities at Risk Project, 2004-2010.
18
jedoch nicht die Ursprünge (root causes) des Konfliktes dar.
Diese Aspekte wurden im Konfliktprozess in eine
„ethnonationalistische“ Rhetorik von Identitätspolitik
eingebettet. Diese Politik stellt zunächst eine Folge des
Konfliktes, und im fortschreitenden Verlauf einen erneuten
Auslöser für Gewalt dar.
Die Sezessionskonflikte des südlichen Kaukasus wurden zudem
häufig als „frozen conflicts“ – einem Zustand zwischen Krieg
und Frieden55 – bezeichnet. Diese Überlegung geht zurück auf
Johan Galtungs Verständnis von Krieg und Frieden. Nach der
Beendigung eines Krieges folgt zunächst eine Phase des
negativen Friedens (die pure Abwesenheit von Krieg) bevor
positiver Frieden (die Verwirklichung von Gerechtigkeit)
erreicht werden kann.56 Spätestens seit August 2008 ist die
Bezeichnung „eingefrorener Konflikt“ jedoch eine überholte
Bezeichnung für die Konflikte im Südkaukasus, da Krieg zwischen
Georgien und den separatistischen Gebieten Süd-Ossetien und
Abchasien mit militärischer Unterstützung Russlands ausbrach.
Die zwischenstaatlichen Konfrontationen zwischen Russland und
Georgien hatten bereits seit 2006 „besorgniserregende Ausmaße“
angenommen.57 Der Konflikt war niemals „frozen“ im Sinne von
statisch vereist, er war stets dynamisch und „brodelte“. Der
Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ebenfalls nur
oberflächlich betrachtet als eingefroren zu deuten. Aufrüstung
wird vor allem auf aserbaidschanischer Seite betrieben, und in
55 Vgl. Dijkzeul, Dennis: Towards a Framework for the Study of „No War, No Peace“Societies, Swiss Peace Working Paper, 2/ 2008, S. 17.56 Ferdowsi, Mir A.: Der Positive Frieden. Johan Galtungs Ansätze und Theorien desFriedens. Minerva Fachserie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, München, 1981(Diss.), hier insbesondere S. 99 ff.57 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, März 2010, S. 6.
19
Umfragen unter aserbaidschanischen Bürgern sind Militärgänge
als nicht auszuschließen und sogar als wünschenswert bewertet
worden. Beide Gesellschaften scheinen in einem
Sicherheitsdilemma zu verharren. Das Misstrauen ist auf beiden
Seiten groß, man sucht Verbündete und rüstet auf.
In Anlehnung an Galtungs Model entwickelten Dennis Dijkzeul et
al. „Societal Models of War and Peace“, und unterscheiden hierin
neben Gesellschaften in Krieg oder Frieden auch Gesellschaften
in einem Zustand/ einer Phase von „weder Krieg, noch
Frieden“.58 Dieser Ansatz versucht, der Komplexität und Dynamik
von Nachkriegsgesellschaften Rechnung zu tragen. Er beschreibt
eine „no war, no peace“ society als:
„(…) a complex and dynamic social system in which institutions become reproducedwith the potential for – positive or negative – conflict transformation.“59
Unter Institutionen, die Friedens- und Konfliktpotenzial
tragen, sind gesellschaftliche Strukturen wie das politische,
kulturelle oder religiöse System zu verstehen, Organisationen
wie beispielsweise Diasporagruppen, politische Parteien oder
Nichtregierungsorganisationen (NRO), sowie informelle
Strukturen wie Normen und Werte, Mythen oder Identitäten.60 Die
Ideen dieses Ansatzes, der noch in der Entwicklung ist, sind
hilfreich, um die Geschehnisse in Aserbaidschan (aber auch in
58 Dijkzeul: Towards a Framework for the Study of „No War, No Peace“ Societies, 2/2008, S. 17. Zu diesem Thema wurden ebenfalls u.a. veröffentlicht: Richards, Paul:No Peace, No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts, Ohio UniversityPress, Athen, 2005, siehe auch: African Studies Quarterly, Volume 8, Issue 3, Spring2006: http://www.africa.ufl.edu/asq/v8/v8i3a12.pdf (Stand: 14.09.2010); Mac Ginty,Roger: No War, No Peace: The Rejuvenation of Stalled Peace Processes and PeaceAccords, Palgrave Macmillian, Houndsmills, 2006.59 Dijkzeul: Towards a Framework for the Study of „No War, No Peace“ Societies, 2/2008, S. 17.60 Ibid., S. 26.
20
Armenien, Berg-Karabach und anderen Gesellschaften) zu
verstehen.
Nimmt man den Ansatz als Grundlage und denkt an Diskurse in den
Gesellschaften, kann man folgern, dass Institutionen nicht
zuletzt Einfluss nehmen auf die Wahrnehmung und das
Selbstverständnis der Menschen in der Gesellschaft als
Individuum oder Teil des Kollektivs. Öffentliche Meinung wird
geprägt, der Konflikt geschürt oder ihm die Schärfe genommen.
Umfragen, die versucht haben die Stimmung in Aserbaidschan
abzubilden zeigen, dass die Mehrheit nicht mehr an eine
friedliche, politische Lösung glaubt. 2006 sprachen sich mehr
als 60 Prozent der fast 1000 Befragten für eine militärische
Lösung des Konfliktes aus. Die Stimmenzahl der
Kriegsbefürworter in Aserbaidschan war drei Mal so hoch wie die
derjenigen, die an eine friedliche Lösung glaubten. Persönliche
Gespräche 2009 belegen diese Einstellung.61
Ein eindringliches Beispiel, wie institutionelle Gewalt in
Aserbaidschan gelebt wird, zeigt die Situation der im Berg-
Karabach-Krieg Vertriebenen in Aserbaidschan.62
4.2. Institutionelle Gewalt gegenüber der Opfer des Berg-Karabach-Konfliktes63
Nach Angaben der aserbaidschanischen Regierung wurden nach dem
Krieg zwölf Camps für ca. 640 000 Vertriebene gebaut sowie
Unterkünfte in alten Zugwaggons und in unfertigen Gebäuden
61 Yunusov, Arif: Azerbaijan in the Early of XXI Century: Conflicts and PotenialThreats, ADILOGLU, Baku, 2007, S. 209.62 An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass auch Armenien Defizite bei derVerwirklichung von Menschen- und Bürgerechten aufweist. 63 Die folgenden Ausführungen gründen auf Interviews, die in Aserbaidschan im Mai2009 geführt wurden.
21
geschaffen. Es kamen auch viele Aserbaidschaner aus Armenien,
um bei Verwandten und Freunden in Aserbaidschan Zuflucht zu
finden. Bis heute ist gesetzlich festgeschrieben: wenn
Vertriebene vor 1998 ein leer stehendes Haus besetzten,
genießen sie Bleiberecht bis sie nach Berg-Karabach
zurückkehren können. Selbst die Eigentümer dürfen sie nicht des
Hauses verweisen. Allein die Regierung kann sie im Zuge des
„Repatriation Plans“ verpflichten, in die alte Heimat
zurückzukehren. Bereits an diesem Beispiel zeigt sich, dass die
Heimkehr, im Gegensatz zur Integration in das Heimatland und
den neuen Wohnort, institutionell in Aserbaidschan verankert
sind.
Auch gesetzlich wurden Regelungen institutionalisiert, die den
Status (das Stigma) des Opfers aus dem Berg-Karabach-Konflikts
dauerhaft festig. Den Vertriebenen wurde ein besonderer
rechtlicher Status verliehen. Sie sind durch ein Dokument
ähnlich eines Personalausweises zu erkennen. Der Status geht
bei Geburt auch auf Kinder über. Das Dokument berechtigt
Vertriebene dazu, durch den Staat eine Unterkunft und gewisse
Unterstützungen zu erhalten. Internationale Hilfsgelder flossen
bis 2008 ins Land und wurden zentral von der
aserbaidschanischen Regierung an ausführende Organisationen
verteilt. Ende 2008 wurde jedoch von den internationalen Gebern
entschieden, dass die Regierung aufgrund ihres Ölreichtums
allein in der Lage sei, das humanitäre Problem zu bewältigen.
Indikator dafür waren vor allem die neuen Dörfer, die von der
Regierung nahe der Waffenstillstandsgrenze errichtet wurden.
Die Bau- und Umsiedelungsbemühungen dauern an.
22
Der Repatriierungsplan der Regierung kommt jedoch im Gewand von
Zwangsmaßnahmen daher. Internationale Standards – die UN
Guiding Principles on IDPs64 – werden nicht erfüllt. Ein
Mitspracherecht bei der Umsiedelung haben die „Heimatlosen“
nicht. Zudem wurde ihnen die patriotische Verpflichtung
auferlegt, zurückzukehren, um die Heimat „heim zu holen“, sie
können sich nicht gegen die Umsiedelung wehren. Öffentlich
würde niemand an der Pflicht zur „Heimkehr“ zweifeln, weder
Regierung noch Bürger, am wenigsten die Vertriebenen selbst.
In der Praxis und auch rechtlich hat kein Vertriebener die
Entscheidungsfreiheit, wo er sich ansiedeln möchte und ob er in
die umkämpften Gebiete zurückkehren will. In Nacht- und
Nebelaktionen werden Menschen und Habseligkeiten aus den
Notunterkünften in LKW verladen und in die Grenzregionen
gebracht. Alternative Wohnmöglichkeiten oder Entschädigungen
werden nicht angeboten. Die Siedlungspolitik soll Fakten
schaffen, die die Armenische Regierung und die Bewohner Berg-
Karabachs nicht ignorieren können.
Doch die Kämpfe haben bisher nicht aufgehört, die Minen sind
nicht vollständig geräumt. Die neu gebauten Siedlungen in den
Distrikten um Berg-Karabach sind deshalb für ihre Bewohner ein
unsicherer Ort. An der nahen Waffenstillstandsgrenze wird nach
wie vor gekämpft und wöchentlich gibt es Verletzte oder sogar
Tote. Bis Mai starben nach Angaben des Aserbaidschanischen
Roten Kreuzes im Jahre 2009 in den kampfnahen Siedlungen 17
Menschen, d.h. ein Mensch pro Woche.
Besonders in diesen neuen Siedlungen ist die Arbeitslosigkeit
ein drängendes Problem, da sie sich weit entfernt von
64 Internally Displaced Persons
23
ökomischen Zentren befinden. Für wirtschaftliche Interaktion
fehlt es an Infrastruktur wie Straßen oder Bahnverbindungen und
Stromversorgung. Der Mangel an Wasser- und Bewässerungssysteme
macht zudem das Bestellen von Feldern mühselig und ertragsarm.
Ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit ist, als Arbeitspendler in
die Städte, hauptsächlich nach Baku, zu gehen, was zur
Abwanderung der Männer beiträgt. Der „Männermangel“ ist ein
besonders schwerwiegender sozialer und wirtschaftlicher Faktor.
Denn auf dem Land gilt es auch heute noch als ehrlos, wenn
Frauen außerhalb des häuslichen Bereiches tätig sind. Allein
stehende Flüchtlingsfrauen sind somit zweifach stigmatisiert.
Da Vertriebene in ihrem „Heimat“ort registriert sind, besitzen
sie keine Arbeitserlaubnis in den Städten. Damit nehmen die
pendelnden Siedlungsbewohner ein großes Risiko auf sich. Werden
sie von den Behörden kontrolliert, droht ihnen der Verlust des
Status` und somit ihrer Wohnung. Das Pendler-Dasein stellt
dennoch die Regel, nicht die Ausnahme dar, und wird durch das
komplizierte Geflecht von Schmiergeldern ermöglicht.
Politisch nimmt die institutionalisierte Ausgrenzung z.B.
dadurch eine maßgebende Dimension an, dass Vertriebene nicht
berechtigt sind in der Stadt zu wählen, in der sie ansässig
sind. Sie sind lediglich bezüglich ihrer Gemeinden im Exil
wahlberechtigt.
Dazu kommen Nachteile durch separate Schulen für Vertriebene
und ihre Kinder. Es ist ihnen nicht erlaubt „normale“ Schulen
zu besuchen. Damit fehlt es neben Integration an guten
Bildungsmöglichkeiten, was eine der größten Belastungen für die
junge Generation darstellt. Das Bildungssystem zementiert zudem
die Ausgrenzung der Vertriebenen und trägt zur Stigmatisierung
24
und damit zu weitverbreiteten psychischen Problemen bei. Zudem
unterrichten fast ausschließlich Lehrer aus der Gemeinschaft
der Vertriebenen an den extra eingerichteten Schulen, was
wiederum ein Aufrechterhalten der Gruppengrenzen festigt und
die Entwicklung und Beibehaltung einer Opferidentität
begünstigt.
Heimatvertriebene aus Berg-Karabach und den besetzten Gebieten
sind also bis heute nur mangelhaft in das gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Leben integriert. Sie
unterliegen struktureller Gewalt, durch ungerechte politisch,
juristische und gesellschaftliche Institutionen fortgepflanzt.
Das Hauptargument der Regierung von Aserbaidschan für das
Separieren ist der „Great Return Plan“. Der Aussage eines
Regierungsvertreters zufolge, schließe das Ziel der Heimkehr
jegliche Integration als nachhaltige Lösung aus. Das Ziel der
Wiederansiedlung nach der Rückgewinnung der Territorien von
Armenien mache alle Maßnahmen für Vertriebene und ihre
Lebensumstände zu einer Zwischenstation auf dem langen Weg nach
Hause. Es bestehe kein Interesse daran, dauerhafte
Eingliederung in die lokalen Gruppen und Gesellschaften zu
fördern. Vertriebene sitzen also aufgrund ihres rechtlichen
Status` in der Falle. Sie befinden sich in „politischer
Geißelhaft“, denn ihr Schicksal und die Heimkehr nach Berg-
Karabach sind das „Ass“ im Ärmel der Regierung in den
Verhandlungen mit Armenien, und der humanitäre Grund für
Unterstützung aus dem Ausland. Sie wurden zum Instrument der
Außenpolitik ihrer Regierung.
25
Fazit und Ausblick
Hinsichtlich der Analyse des internationalen und nationalen
Umfelds, welches die Verhandlungen mit Armenien beeinflusst,
erscheint die Prognose für den Frieden in der Region mehr denn
je abhängig vom Willen der Eliten. Es gibt Anzeichen, dass es –
sollte es kein Umdenken geben – kurz-oder mittelfristig erneut
zum Krieg kommen könnte. Der internationale Rahmen ist
begünstigend für den Frieden, die innenpolitische „no war, no
peace“-Situation mit hohem Konfliktpotenzial durch
institutionelle Gewalt in Aserbaidschan jedoch ein Risiko für
dauerhaften Frieden.
Die internationalen Voraussetzungen für Frieden:
Der Friedensprozess um Berg-Karabach befindet sich derzeit in
einem entscheidenden Stadium. International sind die
Voraussetzungen für eine Einigung gut, denn Russland, die USA
und die EU nutzen die Verhandlungen im OSZE-Rahmen, um ihre
nach dem Georgienkrieg 2008 beschädigten Beziehungen zu
reparieren.65
Für alle Friedensbemühungen gilt: Vertrauensbildende Maßnahmen,
wirtschaftliche Zusammenarbeit und vor allem
zivilgesellschaftliche Verbindungen müssen etabliert und, wenn
vorhanden, verstärkt werden. Es ist wichtig, dass externe
Akteure, allen voran die EU, verstehen, dass
Konfliktbearbeitung und -transformation mindestens
gleichgewichtet sein müssen, wie die Förderung demokratischer
Entwicklung und (energie)wirtschaftlicher Kooperation.
Der Türkisch-Armenische Annährungsprozess muss nachdrücklich
unterstützt werden und Aserbaidschan muss überdies begreifen,
65 Hysenov: A Moment of Truth in the Nagorno-Karabakh Talks? 16.06.2010.
26
dass ein Rückbezug auf Berg-Karabach nicht zu machen ist. Dies
ist keine leichte Überzeugungsarbeit und Einsicht, doch vor
allem die Türkei mit Unterstützung der EU muss für ein solches
Verständnis werben. Wichtig ist es außerdem, die Annäherung der
Türkei und Armeniens auch als symbolisches Ereignis zu
erkennen. Es kann als Vorbild im Südkaukasus dienen und zeigen,
dass historische Feindseligkeiten überwunden werden können –
und müssen! 66
Problematisch ist indes auch das fehlende Engagement
internationaler Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Denn
durch ihren Rückzug sind nur wenige ausländische Beobachter der
gesellschaftlichen und politischen Situation im Land. Die
aserbaidschanischen NRO, die sich für die Rechte der
Vertriebenen einsetzen, müssen vorsichtig agieren.
Zivilgesellschaftliche Organisationen - lokale und
internationale - haben jedoch eine Schlüsselrolle. Sie sind es,
die langfristig von innen heraus Druck auf die jeweilige
Regierung ausüben und Missstände aufdecken können. Sie prägen
den Diskurs zur Bildung der öffentlichen Meinung und wirken im
Bereich der Konfliktbearbeitung.
Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Frieden:
Versteht man Gewalt und Krieg wie in diesem Beitrag als
dynamischen Prozesse, betont man gleichzeitig die Möglichkeit
der Konflikttransformation durch friedensfördernde,
vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien und
in den betroffenen Gesellschaften. Wie der historische Abriss
zeigte, handelt es sich vor, während und nach dem Krieg
zwischen Armenien und Aserbaidschan um einen nie komplett
66 Halbach: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, März 2010, S. 8.
27
abreißenden Diskurs zwischen den Streitparteien unter
Einbeziehung internationaler Vermittler. Durch diese Tatsache
besteht die Hoffnung, dass sich individuelle und kollektive
Wahrnehmungen positiv und friedensstiftend ändern. Doch ist
auch das Gegenteil möglich, sollte die Gewalt, wie sie im
September 2010 aufflammte, nicht abreißen.
Problematisch ist jedoch, dass die Verwirklichung von Bürger-
und Menschenrechten, vor allem die der Vertriebenen aus den
umkämpften Gebieten, durch das Andauern des Konfliktes gehemmt
wird. Das autoritäre System der aserbaidschanischen
„Scheindemokratie“ kennt keine Verteilungsgerechtigkeit,
sondern lässt weite Bevölkerungsteile in Armut hinter dem
Ölreichtum der wenigen Oligarchen zurück. Aliyev versucht sein
Wahlvolk deshalb umso mehr durch die Karabach-Frage zu binden
und verliert den Blick für das Eskalationspotenzial dieses
Weges.
Wichtige Schritte zum Frieden:
Vor einer möglichen Rückkehr der Vertriebenen müssen ihre
Lebensbedingungen nachhaltig verbessert und Integration
ermöglicht werden. Denn eine Masse junger, perspektivloser
Menschen mit diskriminierendem Vertrieben-Status wird nicht die
Geduld aufbringen, eine Generation länger auf eine positive
Veränderung zu warten. Geschichtsverklärung und Feindbilder
verfestigen sich in die nächste Generation hinein. Die
Verstaatlichung der Opferrolle und die Instrumentalisierung der
Heimat sowie die politische Geißelhaft der „Bürger zweiter
Klasse“ muss ein Ende haben. Auf Dauer wird dieser Zustand
sonst die fragile Waffenruhe gefährden. Sollte sich die
Situation der Überlebenden des Konfliktes mittelfristig nicht
28
nachhaltig verbessern, werden die Menschen für militärische
Maßnahmen Stimmung machen. Sie sind als Wahlvolk zu groß und
bedeutend, als dass die aserbaidschanische Regierung solche
Forderungen langfristig ignorieren könnte.
Es müssen deshalb bald tragfähige Absprachen bezüglich ihrer
Rückkehr getroffen werden. Aseris und Armenier sollten den
Schutz internationaler Friedenstruppen genießen. Ein erster und
wichtiger Schritt wäre die offizielle Annahme der „Basic
Principles“ durch Armenien und Aserbaidschan als verbindliche
Roadmap im Friedensprozess.
Literatur
Adomeit, Hannes: Russland – Vom „Euroatlantismus“ zurGroßmachtpolitik Putins, in: Ferdowsi, Mir A.: Sicherheit undFrieden zu Beginn des 21. Jahrhunderts, BayerischeLandeszentrale für Politische Bildung, München, 2004, S. 233-267.
Dijkzeul, Dennis: Towards a Framework for the Study of „No War,No Peace“ Societies, Swiss Peace Working Paper, 2/ 2008.
Ferdowsi, Mir A.: Der Positive Frieden. Johan Galtungs Ansätzeund Theorien des Friedens. Minerva Fachserie Wirtschafts- undSozialwissenschaften, München, 1981 (Diss.).
Gall, Julia: Aktuelle Entwicklungen in der Außen- undSicherheitspolitik Russlands: Russland als Großmacht in einer„multipolaren Welt“? in: Österreichisches Studienzentrum fürFrieden und Konfliktlösung (Hrsg.): Die Neue Weltordnung in derKrise. Von der uni- zur multipolaren Weltordnung?Friedensbericht 2008, LIT-Verlag, Wien/ Berlin, 2009, S. 174-193.
Mac Ginty, Roger: No War, No Peace: The Rejuvenation of StalledPeace Processes and Peace Accords, Palgrave Macmillian,Houndsmills, 2006.
Werkner, Ines-Jacqueline: Die Rolle der EU zwischen westlichenund östlichen hegemonialen Interesen – Eine Analyse desRussisch-Georgischen Krieges, in: Österreichisches
29
Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.): Auf demWeg zum neuen Kalten Krieg? Vom neuen Antagonismus zwischenWest und Ost. Friedensbericht 2009, Band 57, LIT-Verlag, Wien/Berlin, 2009, S. 88-112, hier S. 94.
Yunusov, Arif: Azerbaijan in the Early of XXI Century:Conflicts and Potenial Threats, ADILOGLU, Baku, 2007.
Online Berichte, Artikel und Webseiten
Abdolvand, Behrooz/ Liesener, Michael/ Feyzi Shand, Nima:Aserbaidschan - eine US-Militärbasis gegen den Iran?Eurasisches Magazin, 31.03.2008:http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20080306(Stand: 14.09.2010)
Afet Mehtiyeva: Azerbaijan warns of „great war“ in the SouthCaucasus, Reuters AlertNet, 25.02.2010:http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61O244.htm
„Armenians in Azerbaijan are at a high risk of conflict as longas the Nagorno-Karabakh issue remains unsettled.“Assessment forArmeniens in Azerbaijan, Minorities at Risk Project, 2004-2010:http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=37301(Stand: 14.09.2010)
Auswärtiges Amt: Der Konflikt um Nagorny-Karabach, 30.06.2010:http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Armenien/ArmenienLinks/080306-KarabachKonflikt.html (Stand:14.09.2010)
CIA World Factbook, Armenien:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html (Stand: 14.09.2010)
CIA World Factbook, Azerbaijan:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html (Stand: 14.09.2010)
Der Standard: Internationale Proteste gegen Wahl in Nagorno-Karabach, 23.05.2010:http://derstandard.at/1271377301673/Internationale-Proteste-gegen-Wahl-in-Berg-Karabach (Stand: 14.09.2010)
E.H. Edward Nalbadian, Außenminister der Republik Armenien,Rede, gehalten bei der DGAP, Berlin, 15.03.2010: Armenia andHer Neighbourhood: Prospects for New Dynamics.
30
Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik/ Deutsches Institutfür Internationale Politik und Sicherheit, Berlin, März 2010:http://www.swp-berlin.org/produkte/swp_studie.php?id=12108&PHPSESSID=cdff83222d15686b997f5c0775cf61b2 (10. Juni2010)
Hangen, Claudia: Die doppelgesichtige Demokratie.Aserbaidschan: Ölinteressen und innere Freiheit, 08.08.2010:http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33071/1.html (Stand:14.09.2010)
Heintze, Hans-Joachim: Prinzipien der Helsinki Schlussakte imWiderspruch? Selbstbestimmungsrecht der Völker versusterritoriale Integrität der Staaten: http://www.core-hamburg.de/documents/jahrbuch/04/Heintze-dt.pdf (Stand:14.09.2010)
Hysenov, Tabib: A Moment of Truth in the Nagorno-KarabakhTalks? 16.06.2010:http://aussenpolitik.net/themen/eurasien/kaukasus/a_moment_of_truth_in_the_nagorno-karabakh_talks/ (Stand: 14.09.2010)
ICC: Abkhasia: Deepening Dependence, 26. Februar 2010. Online:http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2010/europe/Abkhazia%20Deepening%20Dependence.aspx (10. Juni2010)
Jacoby, Volker: Geopolitische Zwangslage und nationaleIdentität: Die Konturen der innenpolitischen Konflikte inArmenien. Diss., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurtam Main, 1998
Orth, Stephan: Berg-Karabach, Auferstehung aus Ruinen, SpiegelOnline, 19.02.1008:http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,533194,00.html(Stand: 14.09.2010)
OSCE: Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries,OSCE Press Release, 26.06.2010:http://www.osce.org/item/44971.html (Stand: 14.09.2010)
OSZE: Wo die Medienfreiheit in Europa eingeschränkt ist. , DiePresse (Wien), 29.07.2010:http://diepresse.com/home/kultur/medien/584447/index.do?_vl_backlink=/home/kultur/medien/index.do (Stand: 14.09.2010)
31
Ria Novosti: Bergkarabach-Streit: Feuergefechte an armenisch-aserbaidschanischer Waffenstillstandslinie, 01.09.2010:http://de.rian.ru/security_and_military/20100901/257203484.html(Stand: 14.09.2010)
Ria Novosti: Armenien will Bergkarabach im Notfall auch mitWaffen schützen, 11.03.2010:http://de.rian.ru/post_soviet_space/20100311/125444231.html(Stand: 14.09.2010)
Ria Novosti: Karbach-Konflikt: Licht am Ende des Tunnels?27.01.2010:http://de.rian.ru/comments_interviews/20100127/124862427.html(Stand: 14.09.2010)
Ria Novosti: Russand, Aserbaidschan und Armenien verhandelnüber Berg-Karabach, 25.01.2010:http://de.rian.ru/world/20100125/124818386.html (Stand:14.09.2010)
Richards, Paul: No Peace, No War: An Anthropology ofContemporary Armed Conflicts, Ohio University Press, Athen,2005, siehe auch: African Studies Quarterly, Volume 8, Issue 3,Spring 2006: http://www.africa.ufl.edu/asq/v8/v8i3a12.pdf(Stand: 14.09.2010)
Zeit Online Archiv: Massaker von Sumgait, 1991, Ausgabe 35:http://www.zeit.de/1991/35/Massaker-in-Sumgait (Stand:14:09.2010)
32