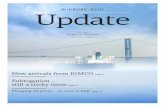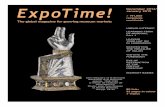"Du kommst hier nicht rein!" – Neue Erkenntnisse zu den Befestigungsanlagen am Hinteren Berg bei...
-
Upload
denkmalpflege-bw -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Du kommst hier nicht rein!" – Neue Erkenntnisse zu den Befestigungsanlagen am Hinteren Berg bei...
Inhalt
Thomas Link, Markus Roth, Markus Schußmann „Du k o m m s t hier nicht rein!" Neue Erkenntn isse zu den Befes t igungsan lagen am Hinteren Berg bei Landersdor f Fo rschungsgesch ich ten mit (Reiter-)Hindernissen 4
Manfred Horndasch Ein f rühmit te la l ter l icher Wall als Schu tz gegen die Ungarneinfä l le 15
Albert Rösch Schicksa le aus d e m Ersten Weltkr ieg Dargestel l t anhand der Sammingen von Kaspar Eigner, La ibs tadt 29
Claus Wittek Wel tk r iegsausbruch 1914: Leonhard Kühnle in und Leonhard Bergmann Zwe i Einzelschicksale aus Eckersmühlen 34
Robert Unterburger Ein Kriminalfal l aus d e m Jahre 1758 42
Paula Waffler Was Minet tenhe im so besonders mach t Die Gewerbeko lon ie Mine t tenhe im unter d e m Freiherrn von Eckart in der Zeit von 1789 bis 1798 50
Gertrud Weber Ein Pfarrherr in Bar the lmesaurach 1 8 0 4 - 1 8 2 8 61
Hermann Lahm Die roman ische Kirche St. Mart in in Gred ing Eine sehr subjekt ive Beschre ibung 69
Otto Heiß Flaschenpost in der Drei fa l t igkei tskapel le Euerwang 75
Norbert Herler, Eva Schultheiß Die Kar ten des Amtes He ideck 78
Robert Unterburger In format ionsfahr t der He imatkund ler führ te nach Mi l tenberg, Wer the im und H o m b u r g am Main 89
Buchbesprechungen 93
2
Thomas Link, Markus Roth, Markus Schußmann
„Du kommst hier nicht rein!" Neue Erkenntnisse zu den Befestigungs
anlagen am Hinteren Berg bei Landersdorf Forschungsgeschichte mit (Reiter-)Hindernissen
Der sogenannte Hintere Berg ist als Ge ländesporn unwei t west l i ch von Landersdor f aus d e m Albtrauf herausgeschn i t ten . Er weis t mit se i ner Spi tze nach Osten und besitzt in d iese Richtung auch ein f laches Gefäl le, sodass er weder von der Jurahochf läche noch v o m Tal der hier vorbei f l ießenden Thalach aus exponiert erscheint . Seine Unauf fä l -l igkeit w i rd auch der lokalen m ü n d l ichen Über l ie ferung gerecht , in der er wahrsche in l i ch seit d e m Mi t te l
alter unter der Beze ichnung „d ie Be rch " (von „bergen" ) als Fl iehburg bekannt ist. Dieser Rolle als Refu-g ium für Notzei ten konnte die A n höhe zum Teil schon durch ihre natür l ich geschütz te und in gewisser Weise auch vers teck te Lage gerecht werden , denn für eine mi l i tär isch ungeüb te , en tsp rechend sch lecht ausgerüste te und woh l auch nicht übermäßig zahlreiche ländl iche Bevö lkerung stellt das Unen tdeck tb le i -ben stets den besten Schutz dar.
Abb. 1: Hinterer Berg (rot umrandet) bei Landersdorf, Gemeinde Thalmässing. Grundlage: Topographische Karte M. 1 : 50 000. © Bayerische Vermessungsverwaltung (http://geodaten.bayern.de)
4
Da sich der Sporn j edoch zur H o c h f läche öffnet, waren zusätz l iche künst l iche Fort i f ikat ionen (Befest i gungen) uner lässl ich. Sie gehören untersch ied l ichen Ze i tper ioden an und präsent ieren s ich als ein gestaffe l tes Sys tem aus Wäl len und in den Kalkfels gehauenen Gräben, die s ich te i lweise heute noch im Gelände a b zeichnen.^ Dennoch war der [Hintere Berg erst Ende der 1930er Jahre als a rchäo log isches Bodendenkma l erkannt und durch den Laienforscher Franz Kerl der Naturh is tor ischen Gesel lschaft (NHG) Nürnberg bekannt gemach t wo rden . Die w issenschaf t l iche Er forschung wu rde unter deren Lei tung in Angri f f g e n o m m e n , und bereits im Jahr 1941 legten Hans Walter Ehrngruber, Walter Ul lmann und Franz Kerl einen 3 m breiten Grabungsschn i t t an , um die noch am besten s ichtbare - w ie wir heu te w issen : hochmi t te la l ter l iche - Be fes t igung zu untersuchen (Abb. 2: 2,6,7)} Weitere archäo log ische Arbei ten wurden durch den Krieg vereitelt.
Erst 1988 bis 1991 fo rsch te man unter der Lei tung von John P. Zeit ler weiter, n a c h d e m Lesefunde von Kar l -Heinz Denzler und die Revision der S a m m lung der N H G zahlre iche Fragen zur Dat ierung der G rabungsbe funde
au fgewor fen hat ten. Au fg rund dieser neuen Ausg rabungen der N H G (Abb. 3, Grabung 1988-91) konnte ein w e i terer, den mit te la l ter l ichen St rukturen west l ich vorgelagerter und im Ge lände ebenfal ls noch s ichtbarer Graben ins Spätneo l i th ikum dat iert we rden . Ferner ge lang es, den öst l ich nach ge lager ten, f lachen Wall (Abb. 2: 10) der Urnenfe lderkui tur zuzuschre iben und zu jeder der drei Per ioden in g e w i ssem Umfang auch S ied lungsbefunde au fzudecken .
Eine geomagne t i sche Prospekt ion , d ie die N H G 2005 in Zusammenarbe i t mit der Professur für Ur- und Frühgesch ich t l i che Archäo log ie der Un i versi tät Bamberg durchführ te , griff d iese Vorarbei ten auf und sol l te den wei teren Verlauf der s ich im Ge lände te i lweise ver l ierenden Befes t igungss t rukturen klären.' ' Au fg rund des widr igen Wet ters konnte nur eine relativ ger inge Fläche untersucht und daher das Ziel nur unzure ichend erreicht werden . Jedoch ze ichneten s ich unmi t te lbar öst l ich der b o g e n fö rm igen , urnenfelderzei t l ichen Mauerru ine wei tere Grabens t rukturen ab (Abb. 2 :11 ,12) . Diese gaben 2007 Anlass zu wei teren Grabungen im Rahmen des DFG-geförder ten Projektes „S ied lungshierarch ien und Zent ra i is ierungsprozesse in der S ü d -
1 Für die spätneoiithisclie Anlage ist neben dem fortifikatorischen beispielsweise auch ein nichtprofaner (kultischer) Hintergrund denkbar.
2 Zum Frühstadium der Forschungsgeschichte vgl. v. a. J. P. Zeitler, Eine Siedlung der jungsteinzeitlichen Chamer Gruppe und des Mittelalters auf dem Hinteren Berg bei Landersdorf, Gde. Thalmässing, Lkr. Roth. Natur und Mensch 1989, 107 ff.
3 Zu diesem Forschungsabschnitt vgl. ebd. - Ders., Ausgrabungen auf dem Hinteren Berg bei Landersdorf. Arch. Jahr Bayern 1991, 56 ff. - Ders., Frühe Bauern auf dem Fränkischen Jura. Begleitheft zur Ausstellung im Vor- und Frühgeschichtlichen Museum Thalmässing (o. O. 1992). - K.-D. Dollhopf, Der Hintere Berg bei Landersdorf. Beitr Vorgesch. Nordostbayern 4 (Nürnberg 2006).
4 P. Honig, Die Ergebnisse der geomagnetischen Prospektion auf dem Hinteren Berg bei Landersdorf, Gde. Thalmässing, Lkr Roth, Natur und Mensch 2005, 55 ff.
5
Abb. 2: Digitales Geländemodell (1 m-Raster) des Hinteren Bergs mit Umzeichnung der magnetischen Anomalien und der im Modell sichtbaren Geländestrukturen. -Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de); Geophysik: Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Würzburg.
6
Abb. 3: Orthophoto des Hinteren Bergs mit Magnetogramm. Dual-Huxgate-Gradiometer Bartington Grad 601-2, Dynamik ±12 nT in 256 Graustufen, /Wess-punktdichte 12,5 cm x 50 cm (interpoliert auf 12,5 cm x 25 cm), 20 m-Gitter -Luftbild: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de); Geophysik: Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Würzburg.
7
Abb. 4: Magnetometer-Prospektion auf der Fläctie (Juni/Juli 2013). Foto: M. Roth
liehen Frankenalb zwischen dem 9. und 4. Jh. V. Chr." Man hoffte auf eine herrenhofartige Anlage.^
Dabei konnte der Aufbau der urnen-felderzeitlichen Befestigung (Abb. 2: 10) abschließend geklärt und rekonstruiert werden. Es handelte sich um eine 1,5 m breite Mauer mit einer aus Kalkpiatten trocken gemauerten Vorder- und einer aus Holz gefügten Rückfront. Stabilisiert wurde das erd-und steingefüllte Bauwerk durch eine entlang der Fronten in den Fels eingelassene Doppelpfostenreihe, die mit Quer- und Längsankern ausgesteift war. Ein aus einer der Pfostengruben gewonnenes C 14-Datum er
gab als Bauzeit die erste Hälfte bis Mitte des 9. Jh. v. Chr. und damit relativchronologisch die Stufe Hallstatt (Ha) B3. Vor dieser Mauer war nach einer auffällig breiten Berme (Bereich zwischen Mauer und Graben) von etwa 4 m ein 3 m breiter und etwa 1,2 m tiefer Graben aus dem Fels gebrochen worden (Abb. 2: 9).
Die im Einzelnen weiter unten vorzustellenden, jüngsten geomagnetischen Messungen (Abb. 4) geben eine weitere Linie mit Annäherungshindernissen im Vorfeld zu erkennen, die sich eindeutig auf dieses Befestigungswerk bezieht.*^ Es handelt sich dabei um eine dicht aufeinander
5 Vgl. dazu M. Schußmann, Archäologische Forschungen bei Landersdorf, Markt Thalmässing. Heimatkundliche Streifzüge 26, 2007, 12 ff. - ders., Ausgrabungen auf dem Hinteren Berg bei Landersdorf. Arch. Jahr Bayern 2007, 41 ff. - ders., Siedlungshierarchien und Zentralisierungsprozesse in der Südlichen Frankenalb zwischen dem 9. und 4. Jh. v. Chr. Berliner Arch. Forsch. 11 (RahdenAA/estf. 2012).
6 In der Grabungskampagne von 2007 war dieser Bereich nicht mehr erfasst worden.
8
folgende Reihe langovaler Anomalien, die in etwa 2-2,5 m Entfernung strahlenförmig vor dem Graben angeordnet sind (Abb. 2: 8). Sie weisen untereinander einen Abstand von ungefähr 1 m auf. Bei etwa gleicher Breite variiert ihre Länge zwischen 2,5 und 4,5 m. 15 derartige Grubenstrukturen lassen sich in der Plateaumitte sehr deutlich erkennen, da sie im obersten Bereich vermutlich ausschließlich mit Rendzina (steinfreiem Humus) verfüllt sind.^ Nördlich davon können sie aufgrund von Lücken in der Messung bzw. wahrscheinlich auch durch die Erosion im beginnenden Hangbereich nicht (mehr) nachgewiesen werden.
Im Südteil des Plateaus zeichnen sich weniger deutliche, überwiegend mit Steinen verfüllte Anomalien ab, bevor dort der wiederverfüllte Grabungsschnitt der NHG die Messungen stört und die Situation unklar macht. Darin konnten sie jedenfalls nicht als in den Fels eingetiefte Strukturen erkannt werden, was für eine Befundtiefe unter 0,5 m spricht. Der Aushub aus den Gruben dürfte in den Zwischenräumen als dammartige Aufschüttung gelagert gewesen sein. So entstand ein ausgeprägt wellenförmiger Geländestreifen vor Mauer und Graben der Urnenfelderzeit.
Vergleichbare Annäherungshindernisse sind an mehreren oberbayerischen und schwäbischen Wallanlagen noch im Gelände erhalten, werden dort allerdings als „Ungarnhindernisse" interpretiert und, da Ausgrabungen fehlen, ohne stichhaltigen Nachweis ins 10. Jh. n. Chr. datiert.** Zwar fehlt auch für Landersdorf dieser Beleg, doch liegen die Hindernisse hier nicht nur innerhalb der Ottonischen Befestigung, sondern sie nehmen auch eindeutig Bezug auf die Ha B3-zeitlichen Befunde. Diese waren - wie die Grabungen zeigten - nachweislich im Zuge der hochmittelalterlichen Baumaßnahmen eingeebnet worden.
Zwar können dadurch ebenso wenig alle „Ungarnhindernisse" pauschal in die späte Urnenfelderzeit umgewidmet werden, denn grundsätzlich sind ähnliche Reaktionen auf ähnliche Bedrohungen zu unterschiedlichen Zeiten durchaus möglich. Es ist aber bemerkenswert, dass von nahezu jeder der in Frage kommenden Anlagen urnenfelderzeitliche Funde vorliegen^ während die ottonische Nutzung häufig nur postuliert ist.
Worin liegt die Funktion dieser Hinderniskette? Da eine derartige Sperre für Infanterie nur bedingt eine Hür-
7 Der urnenfelderzeitliche Graben stellte sich in der geomagnetischen Messung von 2005 in ähnlicher Weise dar, was durch die Ausgrabungen klar auf die humose oberste Restverfüllung zurückgeführt werden konnte.
8 Vgl. z. B. H. R Uenze, „Birg" bei Kleinhöhenkirchen. In: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 18 (Mainz 1971) 193 ff. bes. 198 f. - O. Schneider, Befestigungen auf dem Weiherberg. In: H. Frei/G. Krähe, Archäologische Wanderungen im Ries. Führer arch. Denkm. Bayern, Schwaben 2 (Stuttgart/Aalen 1979) 234 ff. bes. 238 f. - Zuletzt dazu: M. Schulze-Dörrlamm, Die Ungarneinfälie des 10. Jahrhunderts im Spiegel archäologischer Funde. In: J. Henning (Hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internat. Tagung in Vorber. der Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und Europa" (Mainz 2002) 114 m. Abb. 3.
9 Angabe aufgrund der Erfassung im BayernViewer Denkmal.
9
de darstellt, sollten mit ihr offenbar berittene Krieger in größerer Distanz zur Mauer gehalten werden.
Da zudem der Einsatz des Bogens als Fernwaffe beim Kampf um spät-urnenfelderzeitliche Befestigungen durchaus die Regel gewesen zu sein scheint^°, wirft dies ein neues Licht auf die Art der Bedrohung. Demnach könnten die Hindernisse gegen berittene Bogenschützen gerichtet gewesen sein, welche aber im einheimischen Milieu (in der Region) bislang nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können. Sie sind jedoch ein typisches Element reiternomadischer Kriegsführung. Es gilt also zu erwägen, ob in den Auseinandersetzungen während der klimatisch bedingten Krise um 800 v. Chr (Kaltphase mit steigenden Gewässerpegeln) neben den wohl überwiegend indi-genen (heimischen) Bevölkerungsgruppen vielleicht auch reiternomadische „Pferdebogner" wie etwa die Kimmerier verwickelt gewesen sein könnten." Ihnen wäre eine derartige Kampfesweise in dieser Zeit am ehesten zuzuschreiben. Dann hätten die Hindernisse vor der urnenfelder-zeitlichen Mauer am Hinteren Berg den Zweck, diese Bogenschützen auf Distanz zu halten und ihnen so im Vorbeireiten treffsichere Schüsse
auf die Verteidiger zu erschweren. Im 9. Jh. V. Chr. könnten dafür - die Effizienz der Landersdorfer Sperre vo-rausgesetzt^^ - schon wenig mehr als 20 m ausreichend gewesen sein. Im Vergleich dazu werden für hunnische Bogenkrieger, die allerdings bereits einen horn- oder knochenversteiften Reflexbogen besaßen, wie er für die ausgehende Bronzezeit noch nicht nachweisbar ist̂ ^^ Schussweiten zwischen 50 und 60 m angenommen^". Zusätzlich stellt die topografisch vorgegebene Einengung auf nur eine mögliche Angriffsrichtung - gewollt oder ungewollt - eine Beschneidung der bei offenen Feldschlachten über die Zeiten nahezu unverändert bleibenden reiternomadischen Kampftaktik dar, nämlich dem gleichzeitigen Angriff kleinerer Trupps aus mehreren Richtungen und das In-die-Zange-Nehmen des Gegners.
Durch die neuesten Forschungen kamen die Reiterhindernisse als Teil der urnenfelderzeitlichen Befestigung hinzu. Die oben erwähnten, seit 2005 bekannten Grabenstrukturen in der Innenfläche (Abb. 2: 11,12), die den Ausschlag zu den Ausgrabungen von 2007 gaben, stellten sich eindeutig als Sohl- und Palisadengräben der spätneolithischen Cha-mer Gruppe heraus. Ihre wissen-
10 Vgl. Schußmann 2012 (Anm. 5) 37 ff. 11 Zur Verbreitung von Gegenständen „kimmerischer" Form in Europa vgl. H. Sauter, Studien
zum Kimmerierproblem. Saarbrücker Beitr. Altkde. 72 (Bonn 2000) 21 Abb. 4. 12 Diese ist nicht per se anzunehmen, denn die urnenfelderzeitliche Befestigung wurde nicht
allzu lange nach ihrer Errichtung, d. h. noch vor dem Beginn der Hallstattzeit um 800 v. Ohr zerstört.
13 H. Eckhardt, Der schwirrende Tod - die Bogenwaffe der Skythen. In: R. Rolle/M. Müller-Wille/K. Schietzel, Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine (Neumünster 1991) 143. - M. Schmauder, Die Hunnen. Ein Reitervolk in Europa (Darmstadt 2009) 95.
14 B. Anke, Der reiternomadische Steppenkrieger. In: Attila und die Hunnen. Begleitbuch zur Ausstellung (Stuttgart 2007) 223.
15 Vgl. I. Bona, Das Hunnenreich (Stuttgart 1991) 17.
10
Abb. 5: Luftbild mit dem bislang unerforsctiten äußersten Graben (gelbe Pfeile) - Blick von Westen. Quelle: J. P. Zeitler, Ausgrabungen auf dem hlinteren Berg bei Landersdorf. Arcti. Jafir Bayern 1991, Abb. 29.
schaftliche Bearbeitung wurde 2013 im Rahmen einer Würzburger Abschlussarbeit aufgenommen und durch die nachfolgend darzustellende neue Magnetometer-Prospektion entscheidend ergänzt.
Markus Schußmann
Spätneolithische (?) Befunde im Magnetogramm
Auf der bislang unerforschten Fläche im Westen des Sporns sind sowohl im digitalen Geländemodell als auch im Gelände und in einem Luftbild (Abb. 5) zwei Gräben auszumachen, die parallel zueinander in ca. 17 m Abstand leicht gebogen über den Bergsporn verlaufen (Abb. 2: 1,2). Im Magnetogramm zeichnen sich beide nur als sehr schwache Anomalien ab. Es könnte sich um zwei Abschnitts
gräben der jungsteinzeitlichen Cha-mer Kultur handeln, da aus der Fläche westlich des mittelalterlichen Walles bislang ausschließlich Funde aus dieser Zeit zutage traten. Hinzu kommt eine schmale, ebenfalls leicht bogenförmig verlaufende Anomalie (Abb. 2: 3), die jedoch nicht mit den Geländebefunden deckungsgleich ist. Neben einer geologischen Erklärung ist auch die Deutung als ein mit der Grabenanlage in Verbindung stehendes Palisadengräbchen denkbar.
Ein bemerkenswerter Befund (Abb. 2: 4) befindet sich im Südwesten auf der Flucht des Grabens 2. Er besitzt einen rechteckigen Umriss und ist 4,5 m breit und 5,3 m lang. Aufgrund von Form und Größe könnte es sich um ein Grubenhaus handeln. Entsprechende Befunde sind aus dem
11
Abb. 6: Graben der Chamer Gruppe - Foto aus der Grabung 1988-91. aus: K.-D. Dolltiopf, Der Hintere Berg bei Landersdorf. Die Ergebnisse der Grabung
von 1988-1991. Beitr Vorgescfi. Nordostbayern 4 (Nürnberg 2006) Abb. 27.
Spätneolithikum beispielsweise vom Alten Berg bei Burgerroth oder vom Goldberg im Nördlinger Ries *̂* bekannt. Eine mittelalterliche Datierung ist nicht auszuschließen, jedoch unwahrscheinlich, da sich der Befund weit außerhalb der ottonischen Befestigungsanlage befindet. Die nordwestlich vorgelagerte, kleinere, ovale Anomalie stellt möglicherweise eine mit dem Haus in Verbindung stehende Grube dar. Des Weiteren scheint eine Überlagerung mit dem Graben 2 vorzuliegen.
Bereits durch die Ausgrabungen der NHG konnte ein auch im Gelände sichtbarer Graben (Abb. 2: 5) in das Spätneolithikum datiert werden. Es
handelt sich um einen Sohlgraben von bis zu 2,2 m Breite und 75 cm Tiefe (Abb. 6), an den sich vermutlich ein aufgeschütteter Erdwall an der Innenseite anschloss.^' Er wurde im Magnetogramm fast vollständig erfasst und verläuft ebenfalls leicht gebogen in ca. 15-20 m Abstand zur Ottonischen Befestigung (Abb. 2: 6,7). Die Unterbrechung im nördlichen Abschnitt stellt mit großer Wahrscheinlichkeit einen Tordurch-lass dar.
Östlich der urnenfelderzeitlichen Befestigung befindet sich ein weiterer beachtlicher Abschnittsgraben der Chamer Kultur (Abb. 2: 11). Die Deutung des Befundes und seine Zeit-
16 P. Schröter, Zur Besiedlung des Goldberges im Nördlinger Ries. In: Ausgrabungen in Deutschland RGZM Monogr 1,1 (Mainz 1975) 108 m. Abb. 5.
17 K.-D. Dollhopf [Anm. 3] 47 f.
12
Stellung wurden bereits durch die Ausgrabung 2007 geklärte» Sein Verlauf hingegen konnte erst durch die Magnetometer-Prospektion ermittelt werden. Es handelt sich um einen Sohlgraben von 4 m Breite und 1 m Tiefe (Abb. 7). Analog zu den anderen Befestigungsanlagen verläuft der Graben leicht gebogen von Süden nach Norden. Er gliedert sich in mehrere Segmente, die durch Unterbrechungen voneinander abgesetzt sind und von denen zwei eindeutig als Tordurchlässe angesprochen werden können. Der südliche wird durch zwei längliche, an die Innenseite des Grabens angesetzte Gruben zu einer knapp 2 m breiten Gasse verengt.
In circa zwei Metern Abstand verläuft parallel zur Innenseite des Grabens eine nur ca. 30-80 cm schmale Anomalie (Abb. 2: 12). Nach den Grabungsergebnissen handelt es sich um ein zweiphasiges Palisadengräbchen. Zwei Unterbrechungen korrespondieren mit denjenigen des Grabens 11 und unterstreichen den Zusammenhang beider Strukturen. Eine weitere Lücke im Süden ist durch den Grabungsschnitt bedingt.
18 Schußmann 2012 [Anm. 5] 49 f.
Abb. 7: Planumszeichnung der Grabung 2007 - östliche Hälfte von Schnitt 1 mit
. ' ; • Graben (Bef. 3) und Palisadengräbchen (Bef 1&2) der Chamer Gruppe. Striche geben 1 m Abstand wieder Quelle: M.
• Schußmann, Siedlungshierarchien und ' , Zentralisierungsprozesse in der Süd
lichen Frankenalb zwischen dem 9. und " i " -Y' " ' I " I " 4. Jh. V. Chr Berliner Arch. Forsch. 11
t. 1 (Rahden/Westf 2012) Beilage 3.
13
Auffällig und funktional schwer zu erklären ist, dass die Palisade ohne Unterbrechung unmittelbar hinter der südlichen Torgasse durchzieht. Zusammen mit dem Befund des zweiphasigen Palisadengrabchens spricht dies für eine komplexe Bau-abfoige und ein Zusetzen des Durchgangs in einem späteren Nutzungsabschnitt.
Mit der Struktur 12 in Ausrichtung, Verlauf und Breite vergleichbar sind die zwei Anomalien 13 und 14, die sich möglicherweise zu einem weiteren Palisadengräbchen zusammenschließen. Ein geologischer Ursprung ist allerdings nicht gänzlich auszuschließen.
Hingegen handelt es sich bei einigen Befunden (Abb. 2: 15,16,18,19) mit einem Durchmesser von ca. 2,3-4 m wahrscheinlich um Siedlungsgruben, bei der knapp 7 m breiten und 7 m langen, annähernd quadratischen Anomalie 17 eventuell sogar um ein weiteres spätneolithisches Grubenhaus.
Abgesehen von den beschriebenen, archäologisch deutbaren Befunden fallen im Magnetogramm zahlreiche weitere unregelmäßig verlaufende Strukturen ins Auge. Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei jedoch um Klüfte und Spalten in den obersten Verwitterungsschichten des anstehenden Jurakalks.
Neben Informationen zum Verlauf der bereits sicher datierten spätneolithischen Befestigungsstrukturen (Abb. 2: 5,11,12) erbrachte die Magnetometer-Prospektion einige unerwarte
te und interessante neue Erkenntnisse. Sollte sich die wahrscheinliche, aber bislang nicht bewiesene spätneolithische Zeitstellung der beiden äußeren Gräben (Abb. 2: 1,2) sowie des möglichen Palisadengrabchens (Abb. 2: 13,14) durch zukünftige Untersuchungen bestätigen, handelt es sich beim Hinteren Berg um eine äußerst aufwendig befestigte Höhensiedlung der Chamer Kultur. Die Ergebnisse der Magnetik eröffnen jedenfalls zahlreiche neue Fragestellungen, denen nur im Rahmen zukünftiger Feldforschungen nachgegangen werden kann.
Thomas Link, Markus Roth
Institut für Altertumswissenschaften, Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Residenzplatz 2, Tor A, 97070 Würzburg
14
















![L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63226acd807dc363600a6f67/limmigration-hier-aujourdhui-demain-immigration-yesterday-today-tomorrow.jpg)