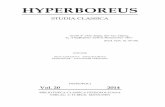Zum Wandel von Krieg und Kriegslegitimation in der Neuzeit, in: Journal of Modern European History 2...
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Zum Wandel von Krieg und Kriegslegitimation in der Neuzeit, in: Journal of Modern European History 2...
Forum s
Dieter Langewiesche
Zum Wandel von Krieg und Kriegslegitimation in der Neuzeit*
i . Ende des Krieges als Staatsmonopol
Im Zweiten Weltkrieg erhielt ein Kriegstypus, der alle bisherigen geschichtlichen Erfahrungen zu sprengen schien, seine schärfste Ausprägung: der totale Krieg1. Zu seinen zentralen Merkmalen gehört der Widerruf einer Entwicklung, welche die europäischen Staaten seit dem Dreißigjährigen Krieg mit ihrer Politik der Einhegung des Staatenkrieges vorangebracht hatten - die Trennung zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung. Sie war auch in Europa nie vollständig durchgesetzt worden, und in den Kolonialkriegen verstießen europäische Truppen massiv dagegen.2 Doch innerhalb Europas brachen die kriegführenden Staaten mit der Tradition des <gehegten> Krieges offen erst im Zweiten Weltkrieg, als alle Seiten Waffengewalt gegen die Zivilbevölkerung, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven, gezielt als Kampfmittel einsetzten. Während der Zweite Weltkrieg damit
* Dieser Aufsatz ist im Sonderforschungsbereich «Kriegserfahrung» der Universität Tübingen entstanden. Dort, im Institut für Europäische Geschichte Mainz und in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften wurde er zunächst vorgestellt. Eine vorläufige, erheblich kürzere Fassung ist auf russisch erschienen in: Ab Impe-rio. Theory and History of Nationalities and Nationalism in the Post-Soviet Realm 4 (2001), 7-28.
1 Den Forschungsstand repräsentieren fünf Bücher, die aus einer Serie von internationalen Tagungen hervorgegangen sind: S. Förster/J.Nag-ler (Hg.), On the Road to Total War. The American Civil War and the German Wars of Unification, 1861-1871, Cambridge 1997; M. F. Boemeke/ R. Chickering/S. Förster (Hg.), Anticipating Total War. The German and American Experiences, 1871-1914, Cambridge 1999; R. Chickering/S. Förster (Hg.), Great War - Total War. Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, Cambridge 2000; dies. (Hg.), The Shadows of Total War. Europe, East Asia, and the United States, 1919-
1939, Cambridge 2003; dies./B. Greiner (Hg.), A World at Total War. Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937-1945 (im Druck). Als Resümee: S. Förster, «Das Zeitalter des totalen Krieges, 1861-1945. Konzeptionelle Überlegungen für einen historischen Strukturvergleich», in: Mittelweg}6 8 (1999), 12-29.
2 Zur strittigen Frage, inwieweit der Kolonialkrieg als Genozid ein deutscher Sonderfall gewesen sei, abwägend und mit der internationalen Literatur: A. Eckert, «Namibia - ein deutscher Sonderweg in Afrika? Anmerkungen zur internationalen Diskussion», in: Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen. Hg. J. Zimmerer und (. Zeller, Berlin 2003, 226-236, 262-265. Hel-muth Bley (Afrika: Geschichte und Politik. Ausgewählte Beiträge 1967-1992, Berlin 1996) argumentiert, die im Kolonialkrieg angewandten totalitären Methoden härten auf das Mutterland zurückgewirkt.
6 Dieter Langewiesche
eine Schwelle durchbrochen hat, die bislang nicht wieder errichtet werden konnte, scheint er in einer anderen Hinsicht einen Abschluß zu bilden. Er steht am Ende einer langen Entwicklung, die den Krieg zum Staatsmonopol werden ließ. Der Staat als Monopolherr des Krieges ist eine neuzeitliche Entwicklung, gänzlich realisiert wurde sie nie, und was an staatlichem Kriegsmonopol erreicht worden ist, verfällt zunehmend seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.3
Die Zahlen sprechen hinsichtlich des dramatischen Wandels, den der Krieg seit der Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr, eine eindeutige Sprache. Das Ende des Zweiten Weltkrieges markiert hier eine historische Zäsur. Der internationale Krieg - definiert als Krieg zwischen zwei oder mehreren Staaten - überwog zuvor weltweit den inneren Krieg, den Bürgerkrieg. Nach 1945 verkehrt sich dieses Verhältnis ins Gegenteil. Die Zahl der Kriege, die Staaten gegeneinander führen, ist klein und sie sinkt, und dennoch steigt die Zahl der Kriege dramatisch, denn die inneren Kriege heizen die Kriegskonjunktur an. Provokativ gesagt: An der Wachstumsdynamik der Weltgesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nimmt der Krieg kräftigen Anteil. Der Krieg gehört global zu den dynamischen Wachstumsbranchen. Daran läßt die sozialwissenschaftliche Kriegs- und Konfliktbeobachtung keinen Zweifel.4
Bevor deren Ergebnisse für das Thema Krieg und Kriegslegitimationen diskutiert werden (Abschnitt 3), gilt es zunächst kurz die Verbindung zwischen Krieg
3 Überblick über die Ausbildung moderner Staatlichkeit und die damit einhergehende Verstaatlichung des Krieges mit Hinweis auf die gegenläufige Tendenz seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bei W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, München 2000; B. D. Porter, War and the Rise of State. The military Foundations of Modern Politics, New York 1994. Außerordentlich anregend zum Prozeß der Entstaatlichung: T. von Trotha, «Die Zukunft liegt in Afrika. Vom Zerfall des Staates, von der Vorherrschaft der konzentrischen Ordnung und vom Aufstieg der ParaStaatlichkeit», in: Leviathan 28 (2000), 253-279. Ebenfalls mit Rückgriff auf die <alten> Kriege - hier auf den Dreißigjährigen -, um die <neuen> zu verstehen: H. Münkler, Die neuen Kriege, Reinbek 2002. Eine vehemente Kritik gegenüber denen, die die Kleinkriege der Gegenwart als neue Kriege verstehen (auch an Münkler u. von Trotha): K. ). Gantzel, Neue Kriege? Neue Kämpfer? Universität Hamburg. Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung, Arbeitspapier 2/2002 (per Internet zugänglich bei AKUF (Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung): http://www.sozialwiss. uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/index.htm).
4 Vgl. mit dem Datenmaterial und der Fachliteratur insbes. K. J. Gantzel/T. Schwinghammer, Die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg 194 s bis 1992.
Daten und Tendenzen, Münster 1995; K. J. Gantzel, «Tolstoi statt Clausewitz!? Überlegungen zum Verhältnis von Staat und Krieg seit 1816 mittels statistischer Beobachtungen», in: Kriegsursachen. Red. R. Steinweg, Frankfurt/M. 1987, 25-97. Fortlaufende Informationen geben die jährlichen Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (http://www. hiik.de) sowie die Bände der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung; s. zuletzt: Das Kriegsgeschehen 2002. Daten und Tendenzen der Kriege und bewaffneten Konflikte. Hg. W. Schreiber, Opladen 2003. Grundlegende Pionierstudien zur langfristigen quantitativen Erfassung und Analyse von Kriegen: L. F. Richardson, Statistics of Deadly Quarrels. Hg. Q. Wright und C. C. Lienau, Pittsburgh/Chicago i960; Q. Wright, A Study of War. Second Edition, with a Commentary of War since 1942, Chicago 1965; P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics. A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships. Rev. and abridged in one vol. by the author, Boston 2i97o; M. Small/J. D. Singer, Resort to Arms. International and Civil Wars, 1816-1980, London u.a. 1982; I. Kende, Kriege nach 1945. Eine empirische Untersuchung, Frankfurt/M. 1982.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 7
und Terrorismus, welche die <neuen> Kriege kennzeichnet, zu erörtern (2). Der Hauptteil (4) fragt dann nach langfristigen historischen Entwicklungslinien im Wandel von Krieg und Kriegslegitimationen in Europa.
2. Terrorismus und Krieg
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist der innere Krieg, der zwischen einem Staat und nichtstaatlichen Gruppen geführt wird, weltweit zur Normalform des Krieges geworden. Die Öffentlichkeit nennt diesen asymmetrischen Krieg meist Terrorismus - ein Begriff, der für die Analyse von Kriegstypen nur bedingt brauchbar ist.5 In den sozialwissenschaftlichen Erhebungen der gewaltsamen Konflikte in der Gegenwart ist der Übergang von terroristischen Gewaltakten zur Kriegsgewalt gleitend, definitorisch getrennt nur hinsichtlich des Organisationsgrades und der Dauer der Gewalt. Scharf zugespitzt: Die Fähigkeit, mit einiger Dauer organisiert, massenhaft und zielgerichtet Gewalt auszuüben, verwandelt in der Sprache der sozialwissenschaftlichen Beobachter des Geschehens Terrorismus in Krieg. Denn als Krieg wird jeder gewaltsame Massenkonflikt verstanden, in dem zumindest auf einer Seite reguläre Streitkräfte eingesetzt und die Gewalthandlungen mit einer gewissen Kontinuität organisiert ausgetragen werden.6
Gegenwärtig lassen sich diese gleitenden Übergänge zwischen Terrorismus und Krieg und die Versuche von Staaten, sie aufzuhalten, in den Medien täglich beobachten. Die Ereignisse des 11. September 2001 sind zum dramatischen Symbol dieser Situation geworden, in der Krieg nicht mehr das sein muß, was er dort, wo das staatliche Gewaltmonopol in einem Jahrhunderte währenden Prozeß durchgesetzt werden konnte, gewesen ist. Wenn der Präsident der USA den Terrorangriff auf New York und Washington den «Krieg des 21. Jahrhunderts» nennt7
und für die Gegenwehr, die er damals ankündigte, Kooperationsangebote vieler Regierungen, einschließlich der russischen, erhielt, so darf diese alle ideologi-
5 Zur Abgrenzung vgl. J. Bakonyi, «Terrorismus, Krieg und andere Gewaltphänomene der Moderne», in: Terrorismus und Krieg. Bedeutung und Konsequenzen des 11. September 2001. Hg. (. Bakonyi, Universität Hamburg. Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung, Arbeitspapier 4/2001 (per Internet zugänglich bei AKUF: http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/ publish/ Ipw/Akuf/index.htm).
6 Diese Definition folgt derjenigen, mit der das «Correlates of War»-Projekt an der University of Michigan in Ann Arbor alle Kriege in der Zeit zwischen 1816 und 1980 zu erfassen und zu analysieren suchte (s. Small/Singer, Resort to Arms) und die von der AKUF weiterentwickelt wurde. Vgl. deren Kriegsdefinitionen bei Gantzel/ Schwinghammer, Die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg oder Die Kriege 1985 bis 1990. Analyse
ihrer Ursachen. Red. ). Siegelberg, Münster 1990, 4. Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung verwendet Konflikt als Oberbegriff für eine Intensitätsskala, die vom «latenten Konflikt» über «Krise» und «ernste Krise» (mit sporadischer Gewalt) bis zur vierten und obersten Stufe reicht, dem Krieg. Konflikte werden definiert als Interessengegensätze um «nationale Werte (Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Grenzen, Territorien etc.) von einiger Dauer und Reichweite zwischen zwei Parteien», von denen «auf mindestens einer Seite die organisierte Staatsmacht involviert» sein muß. Kriege sind «organisierte Kampfhandlungen» von einiger Dauer, in denen getötet und zerstört wird.
7 Bush bestätigte dies auch in späteren Interviews, s. B. Woodward, Bush at War, New York 2002,15.
8 Dieter Langewiesche
sehen und machtpolitischen Gegensätze übergreifende Gemeinsamkeit als ein Versuch verstanden werden, das staatliche Kriegsmonopol zurückzugewinnen, zumindest aber zu erzwingen, daß die neue Form des Krieges innerstaatlich begrenzt bleibt auf den gewaltsamen Konflikt zwischen der Staatsgewalt und einem inneren Feind.
Denn das ist das Neue an den Ereignissen vom n . September 2001: Eine nichtstaatliche Gruppe überzieht nicht den eigenen, sondern einen fremden und dazu noch räumlich weit entfernten Staat mit Gewalthandlungen, die beide Seiten als Krieg verstehen, und sie droht damit, dies auch künftig global zu tun, wo immer sie Feinde erkennt. Gelänge dies, so würde der kriegerische Haupttypus seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der asymmetrische Krieg, vom innerstaatlichen zum globalisierten Krieg entgrenzt. Deshalb die Bereitschaft von Staaten ganz unterschiedlicher Herrschafts- und Werteordnungen, den militärischen Einsatz der USA zu akzeptieren oder zumindest hinzunehmen. Die Fähigkeit einer nichtstaatlichen Macht, global Krieg gegen Staaten zu führen, soll vernichtet werden.
Die Globalisierung des Krieges und der Kriegsgefahr stellt die Fähigkeit der Menschen, das Kriegsgeschehen wahrzunehmen und in Erfahrung zu verwandeln, vor völlig neue Herausforderungen, denn der geschichtliche Erfahrungsschatz, der bereitsteht, Kriege erkennen und in ihren Wirkungen einschätzen zu können, wird entwertet. Das beginnt bereits mit der neuen Unwägbarkeit der räumlichen und zeitlichen Begrenzung des Krieges. Kriege wurden und werden vor allem um Territorien geführt. Der Gegner und die Kriegsziele sind bekannt, und jeder kann beurteilen, was erreicht wurde und von wem, sofern Beginn und Ende des Krieges zu erkennen sind. Wenn aber Kriegshandlungen geographisch nicht zu verorten sind, weil die nichtstaatliche Gruppe, die sie ausübt, territorial ungebunden ist, nicht um ein Territorium kämpft und auch ihre Feinde nicht genau benennt, dann bleibt der potentielle Kriegsraum grundsätzlich unbestimmt. Unbestimmt sind in einem Krieg, in dem die eine Seite geographisch unverortet bleibt und nur sporadisch Gewalt ausübt, auch Kriegsdauer und Kriegsende. Niemand weiß, ob dieser Feind, den man nicht exakt lokalisieren kann, weiterhin zur Gewalt fähig ist und wann und gegen wen er sie ausüben wird. Ein Krieg, von dem nicht bekannt ist, ob er zu Ende ist oder nicht, hat auch keine eindeutigen Sieger und Besiegten. Denn die Entscheidung über Sieg und Niederlage bleibt für alle Seiten offen.8
Dieser Kriegstypus hat historisch keine Vorbilder, derer man sich erinnern könnte. Er ist im historisch gewachsenen kollektiven Gedächtnis nicht vorhanden. Er setzt eine medial vernetzte Weltgesellschaft voraus, die in der Lage ist, die von
8 In langfristiger Perspektive seit dem Mittelalter Kriegsniederlagen. Erfahrung und Erinnerung, Ber-bis zur Gegenwart dazu: H.Carl et al. (Hg.), lin 2004.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 9
dezentral organisierten nichtstaatlichen Gruppen begangenen Gewaltakte, wo immer auf der Welt sie geschehen, sofort weltweit bekannt zu machen und einem globalen Krieg zuzuordnen.9 Dieser kennt kein «Kriegstheater» mehr, wie frühere Jahrhunderte die räumliche und zeitliche Begrenzung des Krieges bildhaft umschrieben haben. Zum Krieg werden diese terroristischen Gewaltakte nur durch die Deutung, die ihnen Täter und Betroffene zuschreiben. Überzeugen wird diese Sicht die Bevölkerung der bedrohten Staaten dauerhaft allerdings nur, wenn die latente Gefährdung aller hinreichend oft durch Gewaltakte verwirklicht wird und die Gewaltobjekte so ausgewählt werden, daß sie zum Symbol für eine ständige Bedrohung durch diese neue Form des zeitlich und räumlich unbegrenzten Krieges taugen. Ob diese Wahrnehmung durchgesetzt werden kann, entscheiden jedoch die Betroffenen. Nur wenn sie bereit sind, eine Kette terroristischer Gewaltakte, welche die Täter als Krieg bezeichnen, als Krieg anzuerkennen und mit Krieg darauf zu reagieren, wird weltweiter Terror zum globalisierten Krieg werden können. Diese Möglichkeit eines globalen «Kriegstheaters», in dem grundsätzlich jeder zum Beteiligten werden kann, ist historisch neu, nicht jedoch der Krieg ohne Staatsmonopol.
3. Anthropologische Konstanten?
Die historische Kriegsforschung hat noch zu wenig zur Kenntnis genommen, was Nachbarfächer, vor allem Politikwissenschaft und Soziologie, Ethnologie und Religionswissenschaft, aber auch die Evolutionsbiologie, zum Thema Krieg zu sagen haben. In zwei Richtungen halten diese Fächer Angebote für Historiker bereit: Zum einen fragen sie nach überzeitlichen anthropologischen Konstanten in der Einstellung des Menschen zum Krieg. Und zum zweiten suchen sie auch dort, wo sie sich mit dem historischen Wandel auseinandersetzen, nach allgemeinen Erklärungen, die sich als Gesetzmäßigkeiten verstehen lassen. Beides mögen Historiker in der Regel nicht. Geschichte, davon sind sie meist überzeugt, ist weder durch überzeitliche anthropologische Verhaltensmuster von quasi ewiger Gültigkeit festgelegt noch folgt sie sozialen Gesetzlichkeiten von begrenzterer, aber doch langer Dauer. Dennoch lohnt es sich für Historiker, die Angebote von Fächern, die anders fragen und erklären, zu beachten, zumal wenn man sich mit etwas beschäftigt, was die Spezies Mensch seit ihren Anfängen bis heute unaufhörlich macht und bei dem auch kein Ende abzusehen ist: Krieg.
Zunächst einige wenige Hinweise zu überzeitlichen Grundmustern in der Einstellung des Menschen zum Krieg - also das, was Historiker auf der Suche nach dem Besonderen gerne ausklammern. Solche Grundmuster zu erkennen, nimmt
9 Daß auch diese Fähigkeit, global präsent zu sein, daran gebunden ist, territorial fundierte Machtpositionen aufzubauen, analysiert G Elwert, «Charismatische Mobilisierung und Gewaltmärkte.
Die Attentäter des 11. September», in: Gewalt und Terror. Hg. W. Bergsdorf, D. Herz und H. Hoff-meister, Weimar 2003, 91-117.
niemandem das Geschäft ab, einen bestimmten Krieg in seinen zeitbedingten Besonderheiten zu betrachten, wohl aber können sie den Blick schärfen für Mechanismen und Verhaltensformen, die offensichtlich immer wiederkehren, wenn auch zeittypisch verändert und angepaßt.
Die einschlägige Fachliteratur läßt sich zunächst einmal als eine Warntafel lesen: Nicht selten führt der Versuch, Einsichten in Gattungseigenschaften der Spezies Mensch zu gewinnen, zu Aussagen, deren Allgemeinheit von einer Banalität ist, die nicht nur erschreckend, sondern auch unbrauchbar ist. Doch auch Historiker mit ihrer zeitlich begrenzteren Perspektive sind gegen die Verführung durch solche Allgemeinheiten nicht gefeit, scheinen sie doch allgemeingültige Erklärungen bereit zu halten. Ein Beispiel bietet Martin van Creveld, einer der international bekanntesten Militärhistoriker der Gegenwart. In seinem Werk Die Zukunfi des Krieges - der Titel der amerikanischen Ausgabe ist präziser: The Transformation of War- versucht er eine Weltgeschichte des Krieges in Auseinandersetzung mit der berühmtesten aller Militärtheorien, der Clausewitzschen. Das Buch van Crevelds ist doppelpolig aufgebaut: zum einen eine Geschichte, zum anderen eine Anthropologie des Krieges, also historischer Wandel und zugleich überzeitliche Dauer. Beides betrachtet er, doch diese vielversprechende Koppelung mißlingt, denn das Überzeitliche gerät ihm zum Allgemeinplatz, der lediglich die Überzeugung umschreibt: Krieg gab es immer und wird es immer geben. Warum? Die Antwort van Crevelds ist verblüffend schlicht; sie läßt sich in einem einzigen Satz bündeln: Männer lieben den Kampf, und Frauen lieben kämpfende Männer.10 Und deshalb werde es auch in Zukunft Krieg geben, denn - so van Creveld -«Krieg ist, ganz offensichtlich, Leben». Genauer: Leben in allen seinen Möglichkeiten, denn nur der Krieg fordere «den Einsatz aller Fähigkeiten des Menschen.»11
Was hier in die Nähe von Stammtischgewißheit zu rücken scheint, läßt sich im Lichte der Forschung, die sich mit anthropologischen Fragen befaßt, aber auch anders lesen. Krieg als kollektives Töten hat sich in seinen kulturellen Bedingungen offensichtlich trotz aller Veränderungen in der Kriegsführung und in der Kriegslegitimation nicht verändert.12 In «systematisierter, kollektiver Weise Mitglieder der eigenen Spezies» zu töten unterscheide, so der Religionswissenschaftler Burkhard Gladigow, den Menschen von den anderen Lebewesen - nicht allein
10 Dieter Langewiesche
10 M. van Creveld, Die Zukunft des Krieges. Mit einem Vorwort von P. Waldmann, München 1998 (The Transformation of War, New York 1991), s. insbes. 322.
11 Ebenda, 331. 12 Vgl. zum Folgenden insbes. B. Gladigow, «Homo
publice necans. Kulturelle Bedingungen kollektiven Totens», in: Saeculum 37 (1986), 150-165; H. von Stietencron/J. Rüpke (Hg.), Toten im Krieg, Freiburg/München 1995; M. Fried/M. Harris/ R. Murphy (Hg.), Der Krieg. Zur Anthropologie der
Aggression und des bewaffneten Konflikts, Frankfurt/M. 1971 (The Anthropology of Armed Conflict an Aggression, New York 1967); R. B. Ferguson (Hg.), Warfare, Culture, and Environment, New York u.a. 1984; W. Sofsky, Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg, Frankfurt/M. 2002. Informativ zum Krieg im Mittelalter: H. Brunner (Hg.), Der Krieg im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit: Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht, Wiesbaden 1999; H.H. Kortüm (Hg.), Krieg im Mittelalter, Berlin 2001.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 11
darin, aber doch auch. Gladigow schlägt deshalb als eine mögliche Gattungsbezeichnung für den Menschen vor: homo publice necans. Auf diese Gattungseigenschaft hin haben Ethnologie und Evolutionsbiologie Theorien entwickelt, um die spezifische Bereitschaft des Menschen zur Aggression in Form von kriegerischer Gewalt aus kulturellem Lernen auf der Grundlage genetischer Disposition zu erklären.13 Krieg erscheint so als eine genetisch nicht festgelegte, aber doch ermöglichte kulturelle Handlung, die dazu dient, bestimmte Ziele zu erreichen, die ihrerseits kulturell bestimmt sind. Die Kriegsziele weisen eine große Spannweite auf, wenngleich sich doch immer wiederkehrende Muster erkennen lassen: Der Wettbewerb um Ressourcen steht ganz oben, vor allem um Land und Leute.
Um den Einsatz von Krieg für solche Ziele zu legitimieren, muß individuell und kollektiv die Bereitschaft erzeugt werden, andere zu töten und sich selber töten zu lassen. Die Instrumentarien, die dazu eingesetzt werden, um Hemmungen der Tötungs- und der Todesbereitschaft abzubauen, hängen zwar von dem jeweiligen Umfeld ab, in dem dies geschieht, doch auch hier kehren die Grundmuster immer wieder, die sich in der Geschichte bis heute in ganz unterschiedlichen Kulturen und politischen Ordnungen erkennen lassen. Unsere Vorfahren und wir waren und sind dabei zwar im einzelnen phantasievoll, aber auf einem sehr schmalen generellen Pfad. Unverzichtbar ist, die als Feind ausgemachte Gruppe zu dehumanisieren. Die Evolutionsbiologie spricht von Pseudospeziation oder Pseudoartenbildung. Innerhalb einer Gattung, hier der Gattung Mensch, wird der Feind so gekennzeichnet, daß er wie gattungsfremd erscheint. Damit verschafft man sich die Rechtfertigung, ihn zu töten und dabei auch Mittel einzusetzen, die man ansonsten als ethisch illegitim, als unmenschlich ansähe.14
Ein Beispiel: Der ritterliche Ehrenkodex in den Kriegen des abendländischen Mittelalters galt vor allem dem Gegner aus dem eigenen Stand. Gegenüber dem sozial Niederrangigen im eigenen Kulturkreis, dem nichtadligen Krieger, fühlte man sich an die Moralregeln im Krieg nicht gebunden, und erst recht nicht im Kampf gegen Nicht-Christen als Kultur- und Religionsfremde oder gegen Ketzer als Abtrünnige im eigenen Religionsbereich.15 Im Heiden- und Ketzerkrieg, auf
Tierreich meist destruktiv». Eibl-Eibesfeldt, Krieg und Frieden, 147. Vgl. als Überblick L. Auer, «Formen des Krieges im abendländischen Mittelalter», in: Formen des Krieges. Vom Mittelalter zum «Low-lntensity-Con-flict». Hg. M. Rauchensteiner und E. A. Schmidl, Graz 1991, 17-43; G. Kretschmar, «Der heilige Krieg in christlicher Sicht», in: Toten im Krieg. Hg. Stietencron/Rüpke, 297-316; als Bilanz des heutigen Forschungsstandes mit weiterführenden Perspektiven: H.-H. Kortüm, «Der Krieg im Mittelalter als Gegenstand der Historischen Kulturwissenschaften. Versuch einer Annäherung», in: Krieg im Mittelalter. Hg. Kortüm, 13-43.
13 Vgl. E. Orywal, «Krieg als Konfliktaustragungsstrategie - Zur Plausibilität von Kriegsursachentheorien aus kognitionstheoretischer Sicht», in: Zeitschrift für Ethnologie 121 (1996), 1-48; T. von Trotha (Hg.), Soziologie der Gewalt, Opladen/ Wiesbaden 1997; I. Eibl-Eibesfeldt, Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung, 4. erweiterte Aufl. Zürich 1997; J.M. van der Dennen, The Origin of War. The Evolution of a Male-Coalitional Reproductive Strategy. 2 Bde., Groningen 1995.
14 Die kulturelle Pseudospeziation verschiebe den «Konflikt auf das Niveau einer zwischenartlichen Auseinandersetzung», und diese sei «auch im
12 Dieter Langewiesche
dem Kreuzzug herrschten andere Regeln. «Wenn es um die causa fidei ging, waren nahezu alle Mittel erlaubt.»16 Im christlichen Kriegsgegner den Türken im übertragenen Sinne zu erkennen, schied ihn aus dem Kulturkreis derer aus, welche die Einhaltung von Moralregeln auch im Krieg beanspruchen durften.17
Die Konstruktion von Rassenhierarchien diente später demselben Zweck: Die Feinde wurden in abgestufter Form dehumanisiert, und damit fühlte man sich gerechtfertigt, sie im Extremfall jenseits aller Kriegsregeln zu vernichten.18
Die Ausstoßung des Feindes aus dem Geltungsbereich der eigenen Gattung, um die Bereitschaft zu erzeugen, sich über kulturspezifische Tötungsregeln hinwegzusetzen, scheint eine überzeitliche Verhaltensweise zu sein. Was sich ändert, ist die Konstruktion des Fremden, der aus der Wertegemeinschaft der kulturell Gleichrangigen ausgeschlossen wird und damit den Schutz der Verhaltensregeln verliert, die auch in Kriegszeiten in diesem Kreis eingehalten werden sollen. In den Kolonialkriegen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, fühlten sich Europäer zu einer Kriegsführung berechtigt, die auf die europäischen «Kriege der gesellschaftlichen Vernichtung»19 des 20. Jahrhunderts vorauswies. Umgekehrt befürchteten die Europäer, daß die «Wilden», in der Sprache der damaligen Zeit, im Kampf gegen weiße Soldaten sich ebenfalls nicht an die Verhaltensregeln im sog. «zivilisierten» Krieg halten würden. Deshalb klagten sie den Kriegsgegner des Sittenverfalls an, wenn er «Wilde» gegen sie einsetzte.20 Erwähnt sei nur die öffentliche Empörung in Deutschland, als Frankreich 1870 «Turcos» - gemeint waren algerische Truppenteile - in den Krieg schickte.
Religion spielt bei der Konstruktion von Feindbildern, die den Krieg moralisch rechtfertigen oder sogar verlangen und es dem einzelnen ermöglichen, Tötungshemmungen zu überwinden, seit jeher eine große Rolle. Religiöse Begründungen
16 V. Schmidtchen, «lus in hello und militärischer D. Goldhagens (Hitler's Willing Executioners. Ordi-Alltag - Rechtliche Regelungen in Kriegsordnun- nary Germans and the Holocaust, London 1996) gen des 14. bis 16. Jahrhunderts», in: Krieg im Erklärung desselben Phänomens auf einer Mittelalter. Hg. Brunner, 25-56, 27. anthropologischen Grundannahme über die
17 Vgl. etwa C. Sieber-Lehmann, Spätmittelalterli- Deutschen. eher Nationalismus. Die Burgunderkriege am Ober- 19 Zu diesem Kriegstypus anregend, wenngleich rhein und in der Eidgenossenschaft, Göttingen 1995; wenig präzise argumentierend M. Geyer, «Eine Auer, Formen des Krieges, 24-25. Zur Entrege- Kriegsgeschichte, die vom Tod spricht», in: Mit-lung, aber auch zu den Versuchen, die christliche te/u>eg3Ö 4 (1995), 57-77, 72. Zur Frage, ob Kolo-Kriegsführung gegen die Türken zu <humanisie- nialkriege als Vorformen des genozidalen Krie-ren>, s. die Beiträge in: Europa und die Türken in ges zu betrachten sind, s. am Beispiel deutscher der Renaissance. Hg. B. Guthmüller und W. Kühl- Kolonialkriege neben der Literatur in Anm. 2: mann, Tübingen 2000. G Krüger, Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußt-
18 Wie dieser Prozeß historisch-situativ erklärt wer- sein. Realität, Deutung und Verarbeitung des deut-den kann, wird an der schrittweisen Radikalisie- sehen Kolonialkrieges in Namibia 1904 bis 1907, rung der nationalsozialistischen Judenpolitik bis Göttingen 1999, insbes. 62-68. zur Verbindung von Krieg und Genozid überzeu- 20 Vgl. C. Koller, «Wilde» in «zivilisierten» Kriegen gend analysiert bei C Browning, Die Ent/esse/ung - Umrisse einer vergessenen Völkerrechtsde-der «Endlösung». Nationalsozialistische Judenpoli- batte des kolonialen Zeitalters», in: Zeitschrift für tik 1939-1942, München 2003. Während Brow- Neuere Rechtsgeschichte 23 (20011,30-50. ning historisch-situativ argumentiert, beruht
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 13
können aber auch ersetzt werden durch säkulare oder säkularreligiöse - eine Weltanschauung etwa, die ein besseres, gerechteres Diesseits verspricht, in dessen Namen dem Feind das Existenzrecht abgesprochen wird. Revolutionäre Bürgerkriege verlaufen nach diesem Muster.21
Im spätneuzeitlichen Europa, seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert hat vor allem die Ordnungsidee Nation und Nationalstaat die Aufgabe der Einheitsstiftung nach innen durch scharfe Abgrenzung nach außen übernommen. Diese Idee erwies sich als so außerordentlich kriegsmächtig, weil in ihr hehre Zukunftsvorstellungen, vor allem politische und gesellschaftliche Egalitätsverheißungen, mit dem Machtapparat des Staates und meistens auch mit der Vorstellung verschmolzen, ein ethnisch homogenes Volk zu sein, dem in einem bestimmten Territorium die Herrschaft zustehe. Im Krieg spricht sich die Nation einen sakralen Rang zu, indem sie von ihren Gliedern das Opfer des eigenen Lebens verlangt und dafür ewiges Gedächtnis durch die nationale Erinnerungsgemeinschaft verheißt. Die Nation im Krieg neigt zur Selbstvergöttlichung.22
Aber nicht erst die moderne Nation verlangt Kriegsbereitschaft, Bereitschaft zum Töten und sich töten zu lassen. Das Ideal des Kriegstodes für das Vaterland - in der Antike meist auf die Stadt bezogen, in der man lebte23 - ist durch das Christentum zunächst zum Tod für das ewige Vaterland aller Christen spiritualisiert worden. Doch schon im mittelalterlichen Denken ist es wieder vom Himmel auf die Erde herabgestiegen, als die christliche Idee des corpus mysticum auf den weltlichen Herrn übertragen wurde. Später traten an seine Stelle der Staat, schließlich in der Neuzeit die Nation und Weltanschauungslehren. Dieses Denken, in dem es stets auch um die Rechtfertigung des Krieges und der Bereitschaft ging, das eigene Leben im Krieg zu opfern, hat bereits Ernst H. Kantorowicz in seinem berühmten Aufsatz Pro Patria Mori als in seinem Grundmuster dauerhaft - so sehr auch das Objekt der Verehrung und der Todesbereitschaft wechselte - glänzend dargestellt.24
Pflicht zur Intoleranz», in: Intoleranz im Zeitalter der Revolutionen. Europa 1770-1848. Hg. A. Mat-tioli, Zürich 2004, 272-295; P. Berghoff, Der Tod des politischen Kollektivs. Politische Religion und das Sterben und Töten für Volk, Nation und Rasse, Berlin 1997; A. Giddens, The Nation-State and Violence, Cambridge 1985.
23 Überblicke bei K. Raaflaub/N. Rosenstein (Hg.), War and Society in the Ancient and Medieval Worlds. Asia, The Mediterranean, Europe, and Mesoamerica, Cambridge/Mass. 1999; V. D. Hanson, The Wars of the Ancient Greeks, London 1999; Warfare in the Ancient World. Hg. General Sir J. Hackett, London 1989.
24 E.H. Kantorowicz, «Pro Patria Mori in medieval political thought» (1951), in: ders., Selected Studies, New York 1965, 308-324; s. vor allem auch O'Brien, God Land.
21 Vgl. etwa als Überblick J. R. Adelman, Revolution, Armies, and War, Boulder/Col. 1985.
22 Vgl. dazu die außerordentlich anregenden, aber wenig rezipierten Essays von C. Cruise O'Brien, God Land. Reflections on Religion and Nationalism, Cambridge/Mass. 1987. Isaiah Berlin sprach von der Neigung der Nation zur «collective self-worship»: «Nationalism: Past Neglect and Present Power» (1979), in: ders., The Proper Study of Mankind, New York 1997, 580-604, 593. Vgl. J. R. Llobera, TJie God of Modernity. The Development of Nationalism in Western Europe, Oxford 1994. Zum Verhältnis von Nation und Krieg s. D. Langewiesche, «Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert: zwischen Partizipation und Aggression», in: ders., Nation, Nationalismus und Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 2000, 35-54; ders., «Nationalismus als
14 Dieter Langewiesche
Ein weiterer Aspekt in den Versuchen, überzeitliche Konstanten in der Begründung von Krieg und Verhalten im Krieg zu erkennen, soll noch kurz betrachtet werden. Der Blick in Fächer, die nach anthropologischen Grundmustern in der Einstellung von Menschen zum Krieg fragen, warnt davor, Krieg und Kriegslegitimationen einseitig vom Staat her zu betrachten. Gewiß, Staaten sind im Krieg entstanden, und sie blieben Kriegsmaschinen. «War made the state, and the state made war»,25 lautet die ebenso pointierte wie zutreffende Charakterisierung von Charles Tilly. Doch wir würden die Frage: was ist Krieg und wie wurde und wird er legitimiert, unangemessen räumlich und zeitlich begrenzen, wenn wir Krieg ausschließlich als staatliches Handeln verstünden. Frühere, vorstaatliche Zeiten würden ausgeklammert, aber auch die weitaus meisten Kriege seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ließen sich ebenfalls nicht erfassen. Und schließlich würde übersehen, daß auch die Hochzeit der europäischen «Staatsbildungskriege», wie Johannes Burkhardt die Kriege der Frühen Neuzeit genannt hat,26 erfüllt war mit Kriegen anderer Art - mit Bürgerkriegen und mit Kriegen, die man irregulär nennt, weil sie keine Staatenkriege sind: Guerillakrieg, Partisanenkrieg, der «kleine Krieg», wie man damals sagte.27
Um den staatsfixierten Blick des Neuzeithistorikers auf den Krieg zu korrigieren, lohnt es sich, Ethnologen zu befragen. Sie bieten reiches Anschauungsmaterial für Studien über den Krieg, obwohl sie darauf verzichten, den Begriff Krieg nur jenen organisierten Gewaltakten vorzubehalten, an denen Staaten als Akteure beteiligt sind.28 Die Politikwissenschaft geht bei der Entstaatlichung der Kriegsdefinition nicht ganz so weit, doch auch sie sucht nach einem Begriff, der berücksichtigt, daß seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges die wachsende Zahl von Kriegen ganz überwiegend innerstaatlich und nicht zwischenstaatlich geführt wird. Die politikwissenschaftliche Forschung registriert deshalb als Krieg alle organisierten Kampfhandlungen von einiger Dauer, an denen mindestens auf einer Seite die Streitkräfte der Regierung beteiligt sind.29
25 C. Tilly, «Reflections on the History of European geburt des Krieges aus dem Geist der Revolution. Stu-State-Making», in: The Formation of National Sta- dien zum beüizistischen Diskurs des ausgehenden tes in Western Europe. Hg. C. Tilly, Princeton/N. J. 18. und beginnenden ig. Jahrhunderts, Berlin 1999; 1975,3-83,42. zum Forschungsstand vor allem zur Militärge-
26 J. Burkhardt. Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/ schichte der späteren Neuzeit und mit umfang-M. 1992, 27. reicher Bibliographie: T. Kühne/B. Ziemann (Hg.).
27 Vgl. mit der internationalen Literatur G Schulz, Was ist Militärgeschichte'?, Paderborn 2000. «Die Irregulären: Guerilla. Partisanen und die 28 Orywal, «Krieg als Konfliktaustragungsstrategie», Wandlungen des Krieges seit dem 18. Jahrhun- 41, schlägt als Definition vor: «Der Krieg ist eine dert», in: Partisanen und Volkskrieg. Zur Revolutio- kognitiv-emotiv motivierte und strukturell orga-nierungdes Krieges im 20. Jahrhundert. Hg. G Schulz, nisierte Angriffs- oder Verteidigungshandlung Göttingen 1985, 9-35; W Hahlweg, Typologie des einer überfamiliär strukturierten Gruppe gegen modernen Kleinkrieges, Wiesbaden 1967; J. Ku- eine andere Gruppe zur Durchsetzung von Ziel-nisch, Fürst -Gesellschaft- Krieg. Studien zur belli- Vorstellungen unter Einsatz von tödlichen Waf-zistischen Disposition des absoluten Fürstenstaates, fen.»
Köln 1992; ders./H. Münkler (Hg.), Die Wieder- 29 Vgl. die Literatur in Anm. 4 u. 6.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 15
In der konkreten Situation kann das, was sich als Staatsmacht versteht, allerdings bis zur Unkenntlichkeit zerfallen. Hans Magnus Enzensberger hat die neue Szenerie, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist, früh außerordentlich imaginativ dargestellt: Der Staat als Monopolherr auf Gewalt dankt ab, Kriege werden ohne ihn geführt, und wenn er eingreift, gewinnt er sie trotz überlegener Kriegsmacht nicht; zwischen Krieg und dem, was man als Terrorismus davon abzugrenzen sucht, ist kein Unterschied mehr zu erkennen, doch auch die altvertrauten Legitimationen für den Einsatz von Gewalt verlieren an Bedeutung. Wenn heute Bürgerkriege «im Namen irgendwelcher Nationalitätenkonflikte ausgetragen werden», handelt es sich, meint Enzensberger, nur noch um «Reste von Begründungen», um «bloße Fetzen aus dem historischen Kostümfonds».30
Wie auch immer man zum Realitätsgehalt dieses Verfallsgemäldes stehen mag und ob man die dramatischen Ereignisse des 11. September 2001 als Beglaubigung dieser dunklen Prognose verstehen will - unzweifelhaft ist: Das historische Muster vom neuzeitlichen Krieg, auf das sich die staatliche Politik und die gesellschaftlichen Erwartungen ausgerichtet haben, verliert an Wert. Die Kriege des letzten halben Jahrhunderts waren überwiegend und zunehmend keine Staatenkriege mehr. Der «Krieg der Zukunft» scheint in die Zeit vor der Verstaatlichung des Krieges zurückzuführen.31 Was bedeutet dies für die historisch überlieferten Formen von Kriegsvorstellungen und Kriegslegitimationen? Um dies einschätzen zu können, soll nun deren Wandel - begrenzt auf Europa, doch zurückgreifend bis ins Mittelalter - skizziert werden.
4. Kriegsvorstellungen seitdem Mittelalter. Kontinuitäten und welthistorische Zäsur
Begonnen sei mit der Beobachtung eines Militärexperten. Als der deutsche Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke seine Geschichte des deutsch-französischen Krieges von lSjo/ji verfaßte, fragte er, was den modernen Krieg von den Kriegen früherer Zeiten unterscheidet. Seine Antwort: «Es sind vergangene Zeiten, als für dynastische Zwecke kleine Heere von Berufssoldaten ins Feld zogen, um eine Stadt, einen Landstrich zu erobern, dann in die Winterquartiere rückten und Frieden schlössen. Die Kriege der Gegenwart rufen die ganzen Völker zu den Waffen, kaum eine Familie, die nicht in Mitleidenschaft gezogen würde. Die volle Finanzkraft des Staates wird in Anspruch genommen, und kein Jahreswechsel setzt dem rastlosen Handeln ein Ziel.»32
Moltke blickte auf einen Krieg, der ihn berühmt gemacht hatte, den deutschfranzösischen. Ebenso hätte er den Amerikanischen Bürgerkrieg anführen kön-
30 H. M. Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt/M. 1996, 23.
31 So - als Frage - Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, 359-363.
32 H. v. Moltke, Vom Kabinettskrieg zum Volkskrieg. Eine Werkauswahl. Hg. S. Förster, Bonn 1992, 236-295, 241.
i 6 Dieter Langewiesche
nen, einen der blutigsten Kriege des 19. Jahrhunderts (s.Tabelle S.17), der - das erkannten auch Beobachter in Europa - im Unterschied zum deutsch-französischen Krieg die Trennung zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung erneut aufzuheben begann. Wenn dies geschah, hatte man in Europa den Dreißigjährigen Krieg als Menetekel vor Augen.33 Hatte bereits die Französische Revolution den Schritt vom Kabinettskrieg zum Volkskrieg eingeleitet,34 deutete sich nun der nächste an: vom Volkskrieg zum «Totalen Krieg».
Ob der Amerikanische Bürgerkrieg ein «totaler» war, ist unter den Experten umstritten.35 Manche Autoren lassen diesen Typus bereits mit den französischen Revolutionskriegen beginnen. Geprägt wurde der Begriff «Totaler Krieg», dessen Definition bis heute in der Fachliteratur uneinheitlich blieb, bekanntlich erst später, im Ersten Weltkrieg. Zu seinen Hauptmerkmalen gehört, daß die <Heimat> vornehmlich für die <Front> arbeitet, so daß der größte Teile der Menschen und des Nationaleinkommens über einen längeren Zeitraum der Kriegsführung dient. Diese Form des Krieges ist an einen hohen Entwicklungsstand der Industrie und der Waffentechnik gebunden. «Entwickelte Industrie, hohe Zerstörungsfähigkeit und Zerstörbarkeit von Waffen und Kriegsmaterial in großen Materialschlachten, Loslösung der Waffe von der Person des Kriegers und Mobilmachung der < Heimat) gehen miteinander einher und ergeben den <totalen> Krieg. Nur eine industrielle Gesellschaft ermöglicht die rasche massenweise Produktion und Beförderung von Kriegsgütern, die anschließend von Massenheeren konsumiert werden. Und nur auf dieser Basis entsteht die enge Verbindung von <Front> und <Hei-mat>.»36 In dieser Sicht mündete im «TotalenKrieg» eine Entwicklungslinie, die -in der Theorie, wenn auch noch nicht in der Praxis - in den Kriegen der Amerikanischen und der Französischen Revolution einsetzte. Was änderte sich damals in der Art der Kriegsführung, vor allem aber in seiner Legitimation? Um das skizzieren zu können, muß man historisch weit zurückblicken.
Die neuzeitliche Geschichte Europas ist gekennzeichnet durch den Versuch, die Gewalt zu verstaatlichen. Nur der Staat soll legitime Gewalt ausüben dürfen. Im Mittelalter hingegen hatte es noch eine spezielle Form von Krieg gegeben -nicht die einzige damals, das sei nachdrücklich betont -, nach welcher Krieg als
33 Vgl. H. Medick/B. von Krusenstjern, «Die Nähe tion since the French Revolution, Cambridge 2003. und Ferne des Dreißigjährigen Krieges», in: Zwi- Daß die Realität dieser Kriege noch stark früh-schen Katastrophe und Alltag. Der Dreißigjährige neuzeitlicher Tradition folgte, zeigt U. Planert, Krieg aus der Nähe. Hg. H. Medick und B. von Leben mit dem Krieg. Baden, Württemberg und Bay-Krusenstjern, Göttingen 1999, [3-36. em zwischen Französischer Revolution und Wiener
34 Mit der umfangreichen Literatur: W. Kruse, Die Er- Kongreß, Habilitationsschrift Tübingen 2003. findung des modernen Militarismus. Krieg, Militär 35 Vgl. Förster/Nagler, On the Road to Total War. und bürgerliche Gesellschaft im politischen Diskurs 36 P. Kondylis, Theorie des Krieges. Clausewitz-Marx-der Französischen Revolution 1789-1799, Mün- Engels-Lenin, Stuttgart 1988,140. Vgl. Förster, «Das chen 2003; D. Moran/A. Waldron (Hg.), The Peo- Zeitalter des totalen Krieges, 1861—1945». pie in Arms. Military Myth and National Mobiliza-
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 17
Europäische Kriege 1816-1918 und Amerikanischer Bürgerkrieg: Verlustquoten Getötete Militärpersonen je 10 000 Personen der Bevölkerung kriegführender Staaten
Rußland,
Osmanisches Reich 1828-1829 16,1
Deutschland,
Frankreich 1870/71 23.1 Rußland 8,8 Deutschland 11.6
Osmanisches Reich 33.5 Frankreich 36,4
Habsburg, Italien 1848-1849
Habsburg
Piémont
2,1
1.5
6,9
Russisch-türkischer Krieg 1877-
Rußland
Ottomanisches Reich
1878 23,1
12,6
58,5 Modena
Römische Republik 1848-1849
Papststaaten
Sizil ien
1.7
0,2
4.7 0,1
1. Balkan-Krieg 1912-1913
Bulgarien
Serbien
Griechenland
25.5
72.7
50,0
18,5
Frankreich 0,1 Osmanisches Reich 13.6
Habsburg
Preußen, Dänemark 1848-1849
Preußen
0,0
3.2
1.5
2. Balkan-Krieg 1913
Serbien
Bulgarien
15.6
61,7
40,0
Dänemark 15.2 Osmanisches Reich 9.4
Kr im krieg 1853-1856
Vereinigtes Königreich
Königreich Piémont
15.8
7.9
4.4
Griechenland
Rumänien 9.3 2,0
Frankreich
Osmanisches Reich
26,2
15.5
/. Weltkrieg 1914-191837
Rumänien 141.5 471.8
Rußland 14.4 Frankreich 329.3 Italienischer Einigungskrieg 1859
Piémont
2,8
4.9
Deutschland
Österreich-Ungarn 268,7 228,1
Habsburg
Frankreich 3.3 2,1
Vereinigtes Königreich
Italien 196.5
184.7
Italienischer Einigungskrieg i860
Piémont
Papststaaten
Schleswig-Holstein 1864 Dänemark
0,4 0,4 2,2
0,8
11.1
Türkei
Belgien
Serbien
Rußland
USA
175.7 115.1 106,7
104.9
13.1
Preußen
Habsburg
Deutscher Bundeskrieg 1866
Habsburg
0,8
0.5
5.8
Amerikanischer
Bürgerkrieg 1861-1865 20,2
Preußen 4.5 Hannover 2,6
Sachsen
Mecklenburg 2,5
1.7
Quelle: Small/Singer, Resort to Arms, 82-95, 223-232.
37 Andere Berechnungsgrößen in: G.Hirschfeld/ G. Krumeich / 1 . Renz (Hg.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn 2003, 664-665.
i 8 Dieter Langewiesche
eine besondere Art von Rechtsstreit aller Herrschaftsfähigen galt. Man wollte dabei den Gegner nicht vernichten, sondern ihn zwingen, den eigenen Rechtsstandpunkt anzuerkennen.38 In der Fehde lebte diese Praxis lange fort. Mit der Ausbildung von Staaten verschwand keineswegs diese Form des «privaten Krieges», wie ihn noch die deutschen Lexika des 19. Jahrhunderts genannt hatten. Doch zweifellos ging mit dem Prozeß der Staatsbildung die Verstaatlichung des Krieges einher, der «öffentliche Krieg», wie er in den Lexika heißt. Bis zum 16. Jahrhundert hatten es die regierenden Fürsten geschafft, das Recht zum Krieg in ihren Händen weitgehend zu monopolisieren. Es gehörte nunmehr zum Kern staatlicher Souveränität. Dieses machtpolitische Ergebnis wurde in den bekannten Werken dann auch juristisch legitimiert.
Mit der Verstaatlichung des Krieges nahm die Häufigkeit von Kriegen keineswegs ab. Ganz im Gegenteil. Als die Staaten für sich das alleinige Recht zum Krieg durchzusetzen suchten, nahmen sie dieses Recht häufiger und massiver in Anspruch als je zuvor. Darin zeigte sich, mit Rudolf Schlögl zu sprechen, die «Affinität des frühmodernen Staates zu einem organisierten Raubunternehmen».39
Der Staat als alleiniger Kriegsherr, der er zu sein beanspruchte, wurde zur Kriegsmaschine. Genauer gesagt: Der Staat der Frühen Neuzeit ging aus Kriegen hervor. Es waren weniger Staatenkriege als vielmehr «Staatsbildungskriege», um nochmals Johannes Burkhardts Begriff zu benutzen.40 Er entwarf eine komplexe Theorie, um die spezifisch frühneuzeitliche «Bellizität Europas» zu erklären,41 die er in einer dreifachen Unvollendetheit der frühneuzeitlichen Staatlichkeit Europas begründet sieht:
Erstens ein Egalitätsdefizit. Das moderne Staatensystem beruht darauf, daß sich die Staaten als grundsätzlich gleichberechtigt anerkennen. Dies mußte aber erst erlernt werden. Die Suprematieansprüche der universalistischen Gewalten mußten gebrochen, die ständisch-partikularen Staatsbildungsversuche mußten unterbunden oder anerkannt werden, beides löste Kriege aus, und die Zerstörung des dualen Reichssystems schuf zusätzliche Kriegsanlässe. Die Frühe Neuzeit erscheint so als eine blutige Lehrzeit.
Zweitens konstatiert Burkhardt ein Institutionalisierungsdefizit, begründet zum einen in einer spezifischen Instabilität, die davon ausgehen konnte, daß die
38 Vgl. W. Janssen, «Krieg», in: Geschichtliche Grund- Bauernwirtschaft und frühmodemer Staat im 17. begriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Jahrhundert, Göttingen 1988,21; s. insbes. G. Parker, Sprache in Deutschland. Hg. O. Brunner, W. Conze The Military Revolution. Military Innovation and und R. Koselleck, Bd. 3, Stuttgart 1982, 567-615. the Rise of the West 1500-1800, Cambridge 2 i9g6. Daß damit nicht der gesamte Bereich Krieg im 40 Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, 27. Mittelalter abgedeckt wird, sei nochmals hervor- 41 J. Burkhardt, «Die Friedlosigkeit der frühen Neugehoben, zumal Janssen die anderen Seiten des zeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität mittelalterlichen Krieges nicht beleuchtet. Zur Europas», in: Zeitschrift für Historische Forschung Korrektur s. die Studien von Auer, Brunner und 24 (1997). 509_574: vg'- ders., «Religionskrieg», Kortüm (Anm. 15). in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. XXVII. Ber-
39 R. Schlögl, Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische 1^11997.681-687.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 19
Staaten ihre Stabilität überwiegend aus der Kontinuität der dynastischen Spitze bezogen, und zum anderen im frühneuzeitlichen Militärwesen. Das professionelle Söldnertum, sei es in Gestalt der Landsknechte oder des stehenden Heeres, habe als Anreiz zum Krieg gewirkt. Die Ethnosoziologie würde von Gewaltmärkten sprechen, unter denen die frühneuzeitlichen nur eine besondere Spielart sind.42 Von «der Verfügbarkeit des noch nicht voll verstaatlichten Mittels des Krieges für den ebenfalls noch nicht voll verstaatlichten Herrscher» konnte «ein kriegerischer Handlungsanreiz ausgehen - ein doppeltes institutionelles Defizit frühmoderner Staatsbildung von bellizitärer Bedeutung». 43
Drittens schließlich sei ein Autonomiedefizit hinzugekommen, das ebenfalls kriegstreibend gewirkt habe. Denn der institutionell noch unfertige Staat habe kräftige Stützen gebraucht, die durchweg auf Krieg angelegt gewesen seien. Die Stütze Konfession zielte in zweifacher Weise auf den Religionskrieg: einmal «als militärische Konfliktlösung konfessioneller Besitzstand-Wahrung oder -Eroberung»;44 und zum anderen als «Religionskrieg der zweiten Art», wie Burkhardt den «Konkurrenzkampf um die innerkatholische Führung» nennt.45 Er begünstigte eine spezifisch frühneuzeitliche «mediengestützte historisch-politische Kultur»,46 in der Burkhardt einen weiteren starken Kriegsfaktor sieht. In der «strukturellen Statik des frühmodernen Geschichtsbildes»47 sei der Krieg als das «Wiederholung heischende Exempel»48 eingebaut gewesen. Diese Memorialkultur habe den Staat gestützt und den Krieg provoziert.
Burkhardts stimulierende Deutung frühneuzeitlicher Bellizität bestätigt und verschärft die historische Einsicht: Staatsbildung treibt Kriege hervor. Diese Traditionslinie endete aber nicht mit der Frühen Neuzeit. Auch der Amerikanische Revolutionskrieg, die Kriege der Französischen Revolution und Napoleons, die Kriege des 19. Jahrhunderts waren Staatsbildungskriege,49 nun aber in der spezifischen Gestalt des Nationalstaates. Dies gilt schließlich auch für die meisten Kriege, die im Europa des 20. Jahrhunderts geführt wurden, einschließlich der Kriege der jüngsten Gegenwart im ehemaligen Jugoslawien und in Randzonen des zerfallenen Sowjetimperiums. Nahezu überall war der Versuch, bestehende Staaten aufzulösen und neue zu formen, mit Krieg verbunden. Staatswerdung ohne Krieg war und ist etwas außerordentlich seltenes. In der Gegenwart sind die staatliche Trennung der Tschechoslowakei und die Vereinigung der beiden deut-
G. Elwert, «Gewaltmärkte. Beobachtungen zur 46 Ebenda, 561. Zweckrationalität der Gewalt», in: Soziologie der 47 Ebenda, 562. Gewalt. Hg. von Trotha, 86-101. 48 Ebenda, 568. Burkhardt, «Friedlosigkeit», 548. 49 Für den deutschen Einigungskrieg betont dies K. Repgen, «Was ist ein Religionskrieg?», in: zu Recht J. Burkhardt, «Alte oder neue Kriegsur-ders., Von der Reformation zur Gegenwart. Beiträge Sachen? Die Kriege Bismarcks im Vergleich zu zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte. Hg. den Staatsbildungsrlcriegen der Frühen Neuzeit», K. Gottound H. G Hockerts, Paderborn 1988,84- in: Deutschland in den internationalen Beziehun-97, 97. gen des 19. und 20. Jahrhunderts, München 1996, Burkhardt, «Friedlosigkeit», 553. 43-69. /
20 Dieter Langewiesche
sehen Staaten zu nennen. Für die Zeit davor gelang in Europa nur mit der staatlichen Trennung Norwegens von Schweden und Islands von Dänemark die friedliche Ablösung eines Territoriums von einem Nationalstaat. Die historische Normalität sieht anders aus: der Krieg als Staatsschöpfer, die Geburt des Staates aus dem Krieg.
Im europäischen Vergleich lassen sich entstehungsgeschichtlich drei Typen von Nationalstaaten unterscheiden, deren Entstehung fast immer, allerdings mit charakteristischen Unterschieden, mit kriegerischer Gewalt verbunden ist: der transformierende, der unifizierende und der sezessionistische Nationalstaat.50 Im ersten Fall wird ein Staat, der sich im Laufe von Jahrhunderten konkurrierende Herrschaftsträger auf seinem Territorium einverleibt hat, in einen Nationalstaat transformiert. Auf diesem Entwicklungsweg wurde dem Nationalstaat das blutige Geschäft der Zentralisierung von Staatlichkeit durch Unterwerfung von Herrschaftskonkurrenten von seinen Vorgängern abgenommen. Ernest Renan hat dies für Frankreich in seinem berühmten Vortrag Qu'est-ce qu'une nation? von 1882 eindrucksvoll beschrieben: «Die Vereinigung vollzieht sich immer auf brutale Weise. Die Vereinigung von Nord- und Südfrankreich ist das Ergebnis von fast einem Jahrhundert Ausrottung und Terror gewesen.»51 Die Revolutionäre von 1789 konnten aus diesem Erbe des absolutistischen Staates einen Nationalstaat formen. Auf Krieg, inneren und äußeren, konnten aber auch sie nicht verzichten. Umformung eines bestehenden Staates war in den beiden anderen Fällen, dem unifizierenden und dem sezessionistischen Typus, nicht möglich. Hier entstand der Nationalstaat, indem er Staaten, die zu einer gemeinsamen Nation gerechnet werden, zusammenzwang oder Staaten, die aus mehreren Nationen bestanden, in Nationalstaaten zertrennte.
Im Typus des transformierenden Nationalstaates konnte das territoriale und teilweise auch das institutionelle Erbe bestehender dynastischer Staaten übernom-
Diese Typisierung verwendet und verändert Be- die Frage der Machtsteigerung bzw. des Machtgriffe, die Theodor Schieder und Michael Mann Zerfalls durch Staatsbildung oder Staatszerstö-vorschlagen. Schieder hat zwischen dem «integrie- rung. Er unterscheidet zwischen den drei Typen renden Nationalstaat des westeuropäischen Typs», «nation as state-reinforcing» (als Hauptfälle der dem «unifizierenden Nationalstaat» (Deutsch- französische und der britische), «state-creating» land, Italien) und dem «sezessionistischen Na- (Preußen-Deutschland) und «state-subverting» rionalstaat» (hervorgehend aus übernationalen (Habsburgermonarchie). M. Mann, The Sources Imperien wie der Habsburgermonarchie) unter- of Power. Bd. II: The Rise of Classes and Nation-schieden. S. seine gesammelten Aufsätze: Natio- States, 1760-1914, Cambridge 1993, 218. nalismus und Nationalstaat. Studien zum nationa- 51 «L'unité se fait toujours brutalement; la réunion len Problem im modernen Europa. Hg. O. Dann de la France du Nord et de la France du Midi est und H.-U. Wehler, Göttingen 1991, 2I992. Die été le résultat d'une extermination et d'une ter-Formulierung <integrierend> kann mißverstan- reur continuée pendant près d'un siècle.» Œuvres den werden. Sie spricht nicht die Gewalt und die Complètes de Emest Renan. Hg. H. Psichari, Bd. 1. Machtsteigerung an, die mit diesem Prozeß ver- Paris 1947, 891. Die deutsche Übersetzung von bunden war, und sie verdeckt, daß es auch in den H.Ritter in: E.Renan, Was ist eine Nation? und beiden anderen Typen um Integration geht. andere Schriften, Wien/Bozen 1995, 45. Michael Mann zielt mit seiner Begrifflichkeit auf
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 21
men und umgeformt werden. Dieser Typus ist nur in Westeuropa zu finden: England, Niederlande, Frankreich und auch Schweden, Spanien, Portugal. Die Nationalstaaten, die im 19. Jahrhundert entstanden, gehören hingegen alle zum Typus des unifizierenden oder des sezessionistischen Nationalstaates oder sie verbinden beides, wie z. B. im Falle Italiens und Deutschlands. Um den italienischen Nationalstaat schaffen zu können, mußten die bestehenden Einzelstaaten vereinigt und zugleich die norditalienischen Gebiete aus dem Deutschen Bund und dem Imperium der Habsburgermonarchie herausgesprengt werden. Ebenso in Deutschland: Der 1871 verwirklichte kleindeutsche Nationalstaat verlangte die Unifizierung der Einzelstaaten und zugleich die Sezession von der Habsburgermonarchie. Beides erforderte militärische Gewalt. Und dies war überall der Fall, nicht nur in Italien und in Deutschland. Am dramatischsten verlief die Entwicklung dort, wo multinationale Imperien zerlegt - dies gilt für das osmanische und das habsburgi-sche - oder durch revolutionäre Gewalt erhalten, aber in ihrer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung völlig umgebaut wurden. Dies geschah in Rußland.52
Unifikation und Sezession gelangen von den erwähnten sehr wenigen Ausnahmen abgesehen stets nur durch Krieg. Hier wurde - und wird noch heute, wie die Staaten zeigen, die aus dem Zerfall des Sowjetimperiums hervorgingen - im Akt der Nationalstaatsgründung an Vereinigungs- oder Sezessionsgewalt nachgeholt, was im westeuropäischen Transformationstypus dem Nationalstaat vorausgegangen war. Der Erste Weltkrieg und seine blutige Nachgeschichte gerieten zum Höhepunkt der gewaltreichen Staatsbildung und Staatszerstörung im Namen der Nation. Joseph Roth, der in seiner Dichtung der untergegangenen vielnationalen Habsburgermonarchie ein wehmütiges Denkmal gesetzt hat, sieht in ihrem Ende das Sinnbild «der allgemein besiegten europäischen Welt». Zu deren «Leichenfraß» versammelt er die liederlichen Repräsentanten der «neugeborenen Nationen und Sezessionsstaaten» in der «American Bar» der «sittsamen Stadt Zürich», wo er einen verkommenen russischen Bankier jede Nacht mit einer anderen «Krone der entthronten Monarchen» tanzen läßt.53
Staatsbildung durch Krieg steht also in einer langen geschichtlichen Tradition. Doch in ihr ereignet sich im ausgehenden 18. Jahrhundert, im Umfeld der Französischen und der Amerikanischen Revolution, etwas fundamental Neues, eine weltgeschichtliche Zäsur, die seit damals - zunächst in der Programmatik, erst später in der Praxis - den Kriegen der Moderne eine neue Qualität gibt: eine neue Legiti-
52 Vgl. u.a. A. Roshwald, Ethnic Nationalism and the A. Kappeier, Rußland als Vielvölkerreich, Mün-Foll of Empires. Central Europe, Russia and the chen 1992; M. Hildermeier, Geschichte der Sowjet-Middle East, 1914-1923, London 2001; P. F. Sugar, union 1917-1991, München 1998; J. Baberowski, East European Nationalism, Politics and Religion, Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, Aldershot 1999; ders., Nationality and Society in München 2003. Nicht überholt: E. Lemberg, Na-Habsburg and Ottoman Europe, Aldershot 1997; tionalismus, 2 Bde., Reinbeki9Ö4. M. Teich/R. Porter (Hg.), The National Question 53 «Die Büste des Kaisers» (1935), in: J. Roth, Werke in Europe in Historical Context, Cambridge 1993; 5. Hg. F. Hackert. Köln 1989, Zitate 665-666.
22 Dieter Langewiesche
mation, eine neue Dynamik und wohl auch, aber das wäre erst noch im Vergleich zu untersuchen, eine neue Dimension von Gewalt,54 ein neues Verhältnis von Militär und Zivilbevölkerung, ein neues, zuvor nicht gekanntes Maß von Totalität des Krieges. Diese Zäsur hat Carl von Clausewitz in seinem berühmten, erst post-hum erschienenen Buch Vom Kriege in eine Theorie gefaßt, die bis heute für alle Militärtheoretiker Dreh- und Angelpunkt ist, und dies auch dann, wenn sie ihre Bücher schreiben, um Clausewitz zu widerlegen. Letzteres gilt etwa für van Crevelds Die Zukunft des Krieges und ebenso für das Werk Die Kultur des Krieges des international renommierten britischen Militärhistorikers John Keegan.55
Clausewitz entwickelte zwar eine Theorie, die den Krieg der alleinigen Verfügungsgewalt des Staates zuordnen will, doch - das sei gegen die beiden Experten für Militärgeschichte hervorgehoben - er tat das mit dem Blick des Anthropologen, der erkennt, daß die Bereitschaft, die eigenen Interessen mit Gewalt durchzusetzen, zur überzeitlichen Grundausstattung des Menschen gehört.56 Den Krieg nennt er einen «Akt gegenseitiger Vernichtung»,57 bei dem der Gesellschaftshistoriker Clausewitz im Gegensatz zu Denkern der Aufklärung58 keine Milderung mit steigender Kulturhöhe erkennt. Die heutige Kriegsforschung muß ihm recht geben. Diese äußerste Form der Gewalt will Clausewitz politisch zweckrational kanalisieren; die Möglichkeit, sie ganz abschaffen zu können, widerspricht hingegen seinem Bild vom Menschen. Clausewitz verschränkt also Anthropologie und Historie in seiner Theorie vom Kriege.
Die Revolution, das hat er grundlegend durchdacht und in seiner Kriegstheorie verarbeitet, veränderte im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht nur Staat und Gesellschaft, sie veränderte auch den Krieg. Der Revolutionskrieg ist kein Kabinettskrieg mehr, sondern ein Volkskrieg. Der Krieg wird <demokratisiert>, in dreifacher Hinsicht:
Erstens, nicht mehr das dynastische Staatsoberhaupt, der König, entscheidet über Krieg und Frieden, sondern der neue Souverän, das zur Nation gewordene Volk muß überzeugt werden. Zweitens, der Krieg wird in den Dienst der revolutionären Nation gestellt. Kriegsziel ist nicht mehr das Interesse des Monarchen,
54 Die Gewaltintensität und die Verlustquoten in 56 C.vonClausewitz, «Vom Kriege»(Erstdruck 1832/ vormodernen Kriegen waren außerordentlich 34), in: Kriegstheorie und Kriegsgeschichte. Carl von hoch. Wenn man sie mit den Bevölkerungszahl- Clausewitz, Helmuth von Moltke. Hg. R. Stumpf, len korreliert, ist es keineswegs sicher, daß die Frankfurt/M. 1993, 9 - 4 2 3 . Am klarsten hat das Kriege des 20. Jahrhunderts verlustreicher waren; Kondylis, Theorie des Krieges, 12 -28 , herausgear-die europäischen Kriege des 19. Jahrhunderts ge- beitet. wiß nicht. Vgl. dazu vor allem L. H. Keeley, War 57 Clausewitz «Vom Kriege», 240 (3.18). before Civilization. The Myth of the Peaceful Savage, 58 Vgl. etwa I. Kant, «Idee zu einer al lgemeinen Oxford 1996; D. Langewiesche, «Eskalierte die Geschichte in weltbürgerlicher Absicht», in: Kriegsgewalt im Laufe der Geschichte?», in: J. Ba- ders. , Werke. Hg. W. Weischedel, Bd. 6, Darm-berowski (Hg.), Krieg und Geivalt im 20. Jahrhun- Stadt 1966, 33-50, v. a. 47; F. Schiller, «Was heißt dert. Festschrift für D. Beyrau (in Vorbereitung). und zu welchem Ende studiert man Universalge-
55 J. Keegan, Die Kultur des Krieges, Reinbek 1997, 21 schichte?», in: ders., Sämtliche Werke, Bd. 4, (A History of Warfare, New York/London 1993). München 1 9 5 8 , 7 4 9 - 7 6 7 , v. a. 756.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 23
gekämpft wird nun um den Sieg der Revolution, zunächst im Innern, dann zu ihrer Absicherung gegen die feindliche Außenwelt, als diese gegen die Revolution mobil macht, und schließlich trägt die Revolution ihre Vision einer neuen Gesellschaft mit militärischer Gewalt über die Grenzen des eigenen Staates, um auch den anderen Völkern die Demokratie zu bringen. Der Revolutionskrieg wird zum Missionskrieg im Namen der Demokratie. Drittens, diese neue Art, den Krieg zu legitimieren, erfordert auch eine neue Form der Kriegsführung. Die Zeit des stehenden Heeres, zusammengesetzt aus einer Mischung von angeworbenen Söldnern und zwangsrekrutierten Soldaten,59 läuft nun aus. Das stehende Heer als Instrument des Monarchen geht mit der Staatsform des Absolutismus unter, und die Revolution schafft sich einen neuen Typus der Armee und des Soldaten. Die Revolution im Dienst der Nation verlangt im Prinzip von jedem Mann, bereit zu sein, für die eigene Nation in den Krieg zu ziehen. Die allgemeine Wehrpflicht ist die Rückseite des neuen Ideals einer staatsbürgerlichen Egalität unter Männern.60
Die revolutionäre Forderung der Gleichheit verlangt nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten, einschließlich der Pflicht der Männer zum Kriegsdienst. Die enormen Erfolge der Revolutionsarmeen überzeugten auch die Gegner der Revolution von der Überlegenheit der Wehrpflicht. Ihr gehörte die Zukunft.
Was sich damals vollzog, war eine Revolution des Krieges, seiner Organisation und seiner Legitimierung.61 Clausewitz' berühmte Formulierung vom Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln steht ganz im Bann dieses neuen Typus von Krieg, dessen Durchsetzungsgewalt er als preußischer Offizier erfahren hatte. Er brachte den Unterschied des Volkskrieges zum Kabinettskrieg des absolutistischen Monarchen scharf auf den Punkt: «Der Krieg einer Gemeinheit -ganzer Völker - und namentlich gebildeter Völker, geht immer von einem politischen Zustande aus, und wird nur durch ein politisches Motiv hervorgerufen. Er ist also ein politischer Akt.»62 Er fährt fort: «Je großartiger und stärker die Motive eines Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht, um so mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern»,63 d.h. «einem Vernichtungskrieg um das politische Dasein».64
Der Volkskrieg, das erkannte Clausewitz, wird anders sein als der Krieg der Vergangenheit, dessen Zweck der Monarch bestimmte und nicht die «Massen».65
M. Sikora, «Söldner - historische Annäherung an einen Kriegertypus», in: Geschichte und Gesellschaft 29 (2003), 210-238. Vgl. die Beiträge in: U. Frevert (Hg), Militär und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1997. Vgl. G. Best, War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870, Leicester 1982; die konkreten Auswirkungen auf die Kriegführung untersuchen P. Browning, The Changing Nature of War
fare. The Development of Land Warfare from 1792 to 1945, Cambridge 2002; zeitlich breiter W. H. NcNeill, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft vom Altertum bis heute, München 1984 (The Pursuit of Power, Chicago 1982).
62 Clausewitz, «Vom Kriege» 36. 63 Ebenda, 37. 64 Ebenda, 50. 65 Ebenda, 26.
24 Dieter Langewiesche
Nur noch die Berufung auf die Nation, auf ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Interessen, rechtfertigte den Krieg. Die Nation wurde zum neuen Kriegsgott. Das hatte sich in der Amerikanischen und der Französischen Revolution abgezeichnet, und 1848 wurde es zur europäischen Realität. Diese neue Legitimation zum Krieg entstand in den Revolutionen des späten 18. und setzte sich im 19. Jahrhundert durch. Kriege können seitdem nur noch geführt werden, wenn sie vor der eigenen Bevölkerung als Kriege im nationalen Interesse gerechtfertigt werden.
Wenn aber der Krieg zwischen Nationalstaaten geführt wird, dann wird es schwer, zwischen Regierung und Volk zu trennen. Ein solcher Volks- oder Nationalkrieg erfordert und erzeugt andere Feindbilder als der Kabinettskrieg früherer Zeiten, die Kriegsziele verändern sich, und er wird anders geführt, auch verlustreicher. Manche Zeitgenossen des amerikanischen und des deutschen Einigungskrieges verglichen beide und zogen daraus den Schluß, die Demokratie amerikanischen Musters sei dazu disponiert, verlustreichere Kriege zu führen als ein Staat, in dem wie in Deutschland der Monarch starke Prärogative besitze und der Appell an die Nation zurücktrete.66 Ein aufmerksamer Beobachter schrieb schon 1845: «Der Nationenkrieg sieht in jedem Gliede des feindlichen Volkes einen Feind, der bekämpft oder wenigstens unschädlich gemacht werden muß.»67 In dieser Einsicht wird eine Vorahnung des «Totalen Krieges» des 20. Jahrhunderts erkennbar, der die gesamte Gesellschaft erfaßt und alle Kräfte der Gesellschaft in seinen Dienst nimmt.
Allerdings, das sei zum Abschluß nochmals betont, darf man eins nicht übersehen: Diese Vergleiche und Zukunftsblicke gehen von jenem Krieg aus, den man damals gerade im Begriff war zu verlieren - dem frühneuzeitlichen Kabinettskrieg. Das 19. Jahrhundert hat zwar die Idee des Volks- oder Nationalkrieges entwickelt, doch geführt hat es nach dem Ende der Kriege im Zeitalter der Revolution und Napoleons durchweg <gehegte> Kriege. Von der Nation wurde zwar Dienst an der Heimatfront verlangt, doch alle Staaten waren darauf bedacht, die kämpfende
66 «vielfache Erfahrung hat aber gelehrt, daß der 39 u. 40, Leipzig 1886/87, 380-388. 383. Zu den Krieg um so langdauernder, um so kostspieliger, Debatten im deutschen Bürgertum, das damals um so blutiger und grausamer wird, je weniger seine Konzeption des Bürgerheeres so umdeu-derselbe durch geordnete, schon im Frieden gut tete, daß das preußisch-deutsche Militär auf der disciplinirte Heere geführt wird und je mehr an Basis der allgemeinen Wehrpflicht als Erfül-das Volk selbst appellirt werden muß und dessen lung alter bürgerlicher Vorstellungen erschien, Leidenschaften aufgeregt werden.» Dann ver- s. F. Becker, Bilder von Krieg und Nation. Die gleicht das Lexikon den «Secessionskrieg in Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Nordamerika» mit seinen hohen Verlusten an Deutschlands 1864-1913, München 2001. Menschen und Geld mit dem preußisch-öster- 67 J.Weiske, Rechtslexikon für Juristen aller Teutschen reichischen Krieg. Auch die Pariser Commune Staaten, Bd. 6, Leipzig 1845, 221, zit. nach Jans-diente als Vergleich, der die Überlegenheit der sen, «Krieg», 592. Vgl. zur damaligen Diskussion deutschen Staats-und Militärorganisation bele- N.Buschmann, Einkreisung und Waffenbrudergen soll. Artikel «Krieg», in: Allgemeine Ency- schuft. Die öffentliche Deutung von Krieg und Na-clopädie der Wissenschaften und Künste. Hg. J. S. tion in Deutschland 1850-1871, Göttingen 2003. Ersch und J. G.Gruber. Zweite Section H-N, Fasz.
Wandel von Krieg und Kriegslegitimation 25
Front der Zivilbevölkerung fern zu halten. Wenn dies nicht geschah und Zivilisten getötet wurden, registrierte die Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts es als einen Regelverstoß, der nach Rechtfertigung verlangte. Erst in den beiden Balkankriegen von 1912/13 wurde er zur Normalität. Die europäische Öffentlichkeit empfand dies als einen Akt der Inhumanität in einem <unzivilisierten> Krieg, den man dem «balkanischen Orient»,68 wie der französische Sozialist Jean Jaurès die «Türkei in Europa»69 damals genannt hat, anlastete. Man glaubte den grausamen Krieg von «Halborientalen» zu erkennen, in denen «ein entsetzlicher Kern unmenschlicher Barbarei»70 stecke. Die Londoner Times sprach von einem «European scandal»,71
wenn es den Großmächten nicht gelingen sollte, diese Kriege zu beenden, die «a phase of modern warfare» einzuleiten drohten, für deren Gewaltsamkeit gegen die Zivilbevölkerung es seit dem Dreißigjährigen Krieg keine Parallele gebe. Den Hauptgrund für diesen Verstoß gegen die Regeln <zivilisierter> Kriegsführung, wie sie sich in den Kriegen zwischen europäischen Staaten - nicht in ihren Kolonialkriegen - in den letzten Jahrhunderten herausgebildet hatten, sah die britische Zeitung darin, daß auf dem Balkan die gesamte Nation in den Kampf ziehe: «Whole nations are marching forth to battle, leaving behind them only the women and the children and the old men.»72
Die Balkankriege führten Europa einen Krieg vor Augen, den man längst überwunden zu haben glaubte. Sie bildeten jedoch den Auftakt zu den Kriegen des 20. Jahrhunderts. Erst mit ihnen ging die Ära des gehegten Staatenkrieges blutig unter. Im militärischen und politischen Denken hatte man sich von ihnen schon ein Jahrhundert zuvor, im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons, gelöst. Dies in der Kriegspraxis noch abgewehrt zu haben, gehört zu den großen,
68 J. Jaurès in: L'Humanité (Paris) v. 27. 07.1913. 69 Allgemeine Zeitung (München) v. 4. 01.1913. «Eu
ropäische Türkei» war ebenfalls eine gebräuchliche Bezeichnung in der Presse. Zu den empirischen Merkmalen, die den Balkanraum kennzeichnen, und zu den Wahrnehmungsmustern von diesem Raum s. insbes. H. Sundhaussen, «Europa balcanica. Der Balkan als historischer Raum Europas», in: Geschichte und Gesellschaft 25 (1999), 626-653. Sundhaussen setzt sich hier mit M. Todorova, Imaging the Balkans, New York 1997 auseinander. Fortgeführt wurde diese Kontroverse mit H. Sundhaussen, «Der Balkan. Ein Plädoyer für Differenz», in: Geschichte und Gesellschaft 29 (2003), 608-624; M. Todorova, «Der Balkan als Analysekategorie: Grenzen, Raum, Zeit», in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 470-492.
7° Neue Preußische Zeitung (Berlin) v. 27. 11. 1912 (Theodor Schiemann).
71 The Times (London) v. 13. 03. 1913.
72 The Times v. 17. 10.1912. Vgl. zu diesen Kriegen K. Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg, München 1996. Materialreich für den Verlauf und aufschlußreich hinsichtlich der Deutung dieses Krieges: Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars (Carnegie Endowement for International Peace, No. 4), o.O. 1914. Zur Deutung der ethnischen Gewalt auf dem Balkan, welche die europäische Öffentlichkeit seit den nationalen Staatsbildungskriegen der 1870er Jahren mit Erschrecken zur Kenntnis nahm, vgl. W. Höpken, «Blockierte Zivilisierung? Staatsbildung, Modernisierung und ethnische Gewalt auf dem Balkan (19./20. Jahrhundert)», in: Leviathan 25 (1997), 518-538; ders., «Gewalt auf dem Balkan - Erklärungsversuch zwischen <Struktur> und <Kultur>», in: Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa und Lateinamerika. Hg. W. Höpken und M. Riekenberg, Köln 2001,19-37.
26 Dieter Langewiesche
bislang kaum gewürdigten Leistungen des 19. Jahrhunderts. Das Zeitalter nationalen Denkens par excellence verkündete den Nationalkrieg, führte ihn aber als gehegten Krieg in der Tradition frühneuzeitlicher Staatsbildungskriege. Offen ist, wie die Zäsuren zu setzen wären, wenn andere Vergleichmaßstäbe gewählt würden: die Zeit davor, außereuropäische Räume und die Entwicklungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dies zu tun, um den Blick zu weiten - zeitlich, geographisch und auch methodisch, indem die Angebote anderer Disziplinen genutzt werden - , ist eine der wichtigsten Aufgaben künftiger historischer Kriegsforschung. Nur so wird sich entscheiden lassen, wo kultur- und epochenspezifische Besonderheiten zu erkennen sind, also das, worauf Historiker zu achten pflegen, und wo Verhaltensformen sichtbar werden, die anthropologischen Grundmustern von überzeitlicher Dauer folgen. Eine Kriegsforschung, die sich als Friedensforschung versteht, muß dies unterscheiden können. Hier stehen wir noch ganz am Anfang.
ABSTRACTS On the Transformation of War and its Legitimation
in Modern Times The history of war in the twentieth century is characterised by two overriding de
velopments. 1. The state's monopoly over war declined. 2. The separation between
combatants and the civilian population was systematically undermined. Thus two
important developments that had been under way since the seventeenth century
were put into reverse. The article first discusses the typical war of the twentieth
century: namely the asymmetrical war. Then the anthropological factors common
to the situation of human beings at war are summarised. The main part of the
article recounts how in Europe wars for the purpose of state-building have been
acknowledged as legitimate ever since the Middle Ages. But around 1800 the idea
of the nation as the embodiment of the principle of legitimacy reached new
heights, signifying a major international turning-point in the history of the legi
timation of war. From then on the concept of a people's war or a national war
dominated political thinking, though wars in Europe during the nineteenth century
would henceforth be managed according to the tradition of <limited> war - one
of the important achievements of that century in thinking about questions of
nationality.
Abstracts
La Guerre et la légitimation de la guerre aux Temps modernes L'histoire de la guerre au cours du 20e siècle est caractérisée par deux traits
majeurs: la fin du monopole étatique de la violence et l'abolition de la distinction
entre combattants et civils. Deux évolutions acquises en Europe depuis le 17e
siècle furent ainsi annulées.
L'article évoque tout d'abord le type de guerre prédominant au 20e siècle - la
guerre asymétrique - , avant d'esquisser les constantes anthropologiques présen
tes dans le rapport de l'homme à la guerre. La partie principale montre comment
les guerres liées à la construction de l'Etat ont été légitimées en Europe depuis le
Moyen Age. L'élévation de la nation au rang de principe de légitimité suprême
autour de 1800 entraîna une césure historique dans la légitimation de la guerre.
L'idée de la guerre populaire ou nationale domina dès lors la pensée politique,
et pourtant les guerres du 19e siècle continuèrent à être menées dans la tradition
de la guerre «régulée», un phénomène remarquable en cette haute époque de la
pensée nationale.
Prof. Dr. Dieter Langewiesche Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Historisches Seminar Wilhelmstraße 36
72 074 Tübingen [email protected]