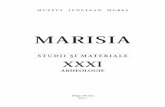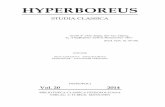Mathes 1998: Vordergründige und höchste Wahrheit im gźan stoṅ-Madhyamaka
Krieg und Wahrheit. Michel Foucault als Sprengmeister, in: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für...
Transcript of Krieg und Wahrheit. Michel Foucault als Sprengmeister, in: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für...
Philipp Sarasin
Krieg und Wahrheit: Michel Foucault als Sprengmeister
Das vorliegende Interview, das wir hier erstmalig in deutscher Übersetzung (und
mit einer Auslassung, die vor allem in biographischer Hinsicht von Interesse ist)
abdrucken, entstand im Juni 1975, d.h. wenige Monate nach der Veröffentlichung
von Surveiller et punir. Es war Teil eines Versuchs Foucaults, mit dem jungen Phi
losophiestudenten Roger-Pol Droit als Gesprächspartner und Gegenüber in einer
Weise über sein Denken zu sprechen und dieses weiterzutreiben, die den üblichen
Zwängen des »Büchergekritzels« 1 entkommen sollte. Doch Foucault war vom
respektvollen Interview-Gestus Droits bald enttäuscht und brach die Übung ab.2
Die drei bis dahin entstandenen entretiens sind nicht in den Dits et Ecrits, den
gesammelten Schriften Foucaults, erschienen. Roger-Pol Droit hat das »Spreng
meister«-Interview erstmals am 1. Juli 2004, zum zwanzigsten Todestag Foucaults,
im französischen Nachrichtenmagazin Le Point der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt und es mit den beiden anderen von ihm geführten Gesprächen im Septem
ber 2004 im Verlag Odile Jacob in Buchform publiziert.
Dieses Interview ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Selten hat sich Fou
cault so ausführlich über sein eigenes Schreiben geäußert wie hier: Schreiben ist
eine handwerldiche Arbeit, und die kleinen Errungenschaften eines schönen Stils,
die er sich gerade noch attestiert, dienen nur wie erotische amuse-bouches dazu,
dem Genealogen die Arbeit mit seiner tristen historischen Materie soweit zu ver
süßen, daß er durch den Tag kommt ... Foucaults dezidierte Ablehnung dessen,
- was er mit oder vielmehr gegen Barthes l' ecriture nennt, hat allerdings System. Sie
gehört zu seiner großen Bewegung weg von der Literatur und der Literaturkritik,
die er zu Beginn der 1970er Jahre vollzogen hat, während er sich indenWerken der
1960er Jahre von Walmsinn und Gesellschaft bis mindestens zur Ordnung der Dinge- immer wieder in positiver, ja emphatischer Weise auf die Literatur als eine
seiner wichtigen Referenzen bezogen hat. Doch seit seiner Arbeit an Überwachen und Strafen geriet ihm die literarische ecriture zunehmend in den falschen Hals.
Als er am 2. Dezember 1970 in seiner Antrittsvorlesung am College de France über
den Diskurs sprach, bezeichnete er »das Schreiben der >Schriftsteller<« sogar als ein
»Unterwerfungssystem«, ebenso wie das »Gerichtssystem und das institutionelle
System der Medizin«.3 Foucault träumte von einem Schreiben, das ganz anders
wäre: instrumentell, auf schnellen V erbrauch ausgerichtet, sich mit anderen
!I HD 205
n I
Philipp Sarasin
206
Medien vermischend, fern aller literarischer Prätention, die den Schreibenden in
eine Genealogie mit anderen »Schriftstellern« einfügt und ihm eine Identität als
Autor verpaßt. Sein Traum, von all dem Abschied nehmen zu können, liest sich
heute erstaunlich aktuell. Hat nicht das »Schreiben am Netz«,4 haben nicht web
logs und andere Formen der Internet-Publizistik diesen Traum heute wahr ge
macht? Mischen sich im Netz nicht die Texte eines Autors mit jenen anderer, mit
anderen Zeichen, Bildern und Medien? Foucault hätte, so scheint es, an dieser
weltweiten Text- und Bildmaschine, die längst schon keinen Autor mehr braucht,
um zu funktionieren, wohl seine Freude gehabt, auch wenn daneben und dank der
Fortexistenz von »Tinte und Papier« weder Literatur noch Autorschaft aufgehört
haben, Leser/innen von ihrer Notwendigkeit zu überzeugen.
Der Sprengmeister
Der Philosoph mit den vielen Masken hat sich im vorliegenden Interview aber
nicht nur einfach als Schreibhandwerker präsentiert, sondern sich vor allem den
Blaumann eines »Sprengmeisters« übergezogen, der »zunächst ein Geologe ist«
und das Terrain untersucht, um seine Dynamitladungen anbringen zu können.
Und zugleich ist dieser Sprengmeister auch ein Krieger, der das Gelände für den
militärischen Sturmangriff vorbereitet und die feindlichen Festungen beobachtet.
Ja- Foucault meint das metaphorisch: Das, was er in seinen Büchern »macht«, ist
dasselbe wie die Arbeit des Sprengmeisters, es dient wie diese »einer Belagerung,
einem Krieg, einer Zerstörung«. Seine Bücher sollen Druckwellen auslösen, sie sol
len Türen und Fenster aufsprengen wie »Sprengstoff« - »effizient wie eine Bombe
und schön wie ein Feuerwerk« ... Foucault spielt hier mit Metaphern der Gewalt,
die in den heutigen wie den damaligen Zeiten des Terrors zweifellos einen speziel
len Klang haben. Aber man darf nicht vergessen, daß sich Foucault immer und in
aller Deutlichkeit etwa vom Terror der RAF distanziert hatte: »Ich habe«, sagte er
im November 1977 zu Claude Mauriac als Erldärung für sein Zerwürfnis mit Gilles
Deleuze, »den Terrorismus und das Blut nicht gebilligt und auch Baader und seine
Gruppe nicht gutgeheißen.«S
Was also sagen diese kriegerischen Metaphern, falls Metaphern eine solche Frage
denn überhaupt zulassen?6 Klar wird zumindest: Das, was der militärische Spreng
meister tut, ist wesentlich Nicht-Geschichte und Nicht-Philosophie. Foucault
sucht ein »Durchkommen«, er will Schneisen in ein »Gelände« sprengen, das von
der Philosophie und der Geschichte besetzt gehalten wird, von jenen Mächten, die
dem dialektischen Narrativ der weltgeschichtlichen »Entwicldung«, des »Sinns«
und der» Totalität« verhaftetet sind und mit ihren, wie Foucault im Interview sagt,
Krieg und Wahrheit
»apokalyptischen« Perspektiven das Denken gefangen halten. Sogar Nietzsche und
Heidegger, sonst Foucaults verläßliche Referenzen, erscheinen hier als Apokalyp
tiker, von deren trügerischen Verheißungen eines hellen Morgens oder einer kom
menden Nacht sich der Sprengmeister in seinen technischen und taktischen Ob
liegenheiten nicht ablenken lassen will. Es geht ihm darum, in der »Aktualität«
Kämpfe zu bestehen- und nicht, sich auf den »Sinn« der Geschichte einzustellen.
Geschichte und Diskontinuität
Wenn man versuchen will, einige der Bezüge und V erweise dieses Interview zu ent
flechten, dann kann Foucaults Ablehnung der dialektisch und totalisierend gedeu
teten Geschichte als Einstiegspunkt dienen. Es ist dies konkret seine explizit be
nannte Frontstellung gegen Jean-Paul Sartre- das heißt, die Geschichte einer alten
Gegnerschaft, die Mitte der fünfziger Jahre mit der Abwendung einer ganzen
Generation junger französischer Intellektueller von der Bewußtseinsphilosophie
von Busserl bis Sartre und vom Regelmarxismus begonnen hatte und die Foucault
de facto an die Seite der Strukturalisten führte. In seiner literaturkritischen Studie
Raymond Raussei von 1963 (die weit »strukturalistischer« und signifikantentheo
retischer war, als er je eingestehen wollte) findet sich daher zum Beispiel der fol
gende kräftige Tritt ans Schienbein des Meisterdenkers: »Im konfusen Spiel von
Existenz und Geschichte« - was ist das, wenn nicht Sartre? - »entdecken wir ganz
einfach das allgemeine Gesetz des SPIELS DER ZEICHEN, in dem sich unsere ver
nünftige Geschichte abspielt« und was ist das, wenn nicht de Saussure, Barthes,
Greimas, Lacan ... ?7
Damals und noch im späteren Rückblick stellte sich Foucault entschieden auf die
Seite Lacans, um Sartres Ablehnung des Freudschen Unbewußten zu kritisieren.s
Doch auch als er seinerseits dieses psychoanalytische Konzept immer mehr in
Zweifel zu ziehen begann- der Sprengmeister kennt weder die Entfremdung noch
ein U nbewußtes, sondern allein die kapillaren Wirkungsweisen der Macht-, führ
ten ihn seine Ablehnung der Dialektik, sein gelinde gesagt komplexes Verhältnis
zum Marxismus und seine »archäologische« Auffassung von Geschichte gleich
wohl in die direkte Konfrontation mit dem Marxisten Sartre. In Die Ordnung der
Dinge (Les mots et les choses, 1966) konstatierte Foucault in jenen drei Sätzen, die
ihn im marxistischen Frankreich so einsam gemacht hatten, mit ebenso trockenem
wie unverhohlenem Spott: »In der Tiefe des abendländischen Wissens hat der Mar
xismus keinen wirldichen Einschnitt erbracht«; er hatte »weder das Ziel«, die
erkenntnistheoretische Disposition seiner Zeit zu verwirren, >>lloch vor allem die
Kraft, sie zu verändern, sei es auch nur um eine Daumenbreite, weil er völlig auf ihr
.. 207
Philipp Sarasin
208 lJ
beruhte. Der Marxismus ruht im Denken des neunzehnten Jahrhunderts wie ein
Fisch im Wasser.« Die Auseinandersetzungen zwischen dem Marxismus und der
bürgerlichen Ökonomie seien daher »lediglich Stürme im Wasserglas«. 9 Das waren
Sätze wie Hiebe in die Weichteile der Linken, das war Krieg in jenem verminten
Gelände, in dem der Sprengmeister sich bewegt, und es war, zusammen mit Fou
caults Rede vom »Tod des Menschen«, eindeutig zu viel. Sartre persönlich sprach
in der Zeitschrift L'Arc nach dem Erscheinen von Les mots et les choses das Verdikt
aus: »Diese neue Ideologie ist das letzte Bollwerk, das die Bourgeoisie noch gegen
Marx zu errichten vermag«.1 0
Foucault ist glücldicherweise das Lachen nicht vergangen. In den Jahren nach
1966 attestiert er sich das »Temperament [eines] glückliche[n] Positivismus«11
und nennt sich einen »kalten Systematiker«, 12 dessen Arbeit darum kreist, die
»Modernitätsschwelle« am Ende des 18. Jahrhunderts zu beschreiben. Nie hat er so
deutlich wie in diesem Interview vom Juni 1975 bekundet, daß das, was man in
Deutschland mit Reinhard Kaselleck die »Sattelzeit« nennt, in der langen Arbeits
phase von ca. 1955 bis Ende der siebziger Jahre, bis zu seinem der Antike gewidme
ten Spätwerk also, sein eigentliches Forschungsthema war: ein Thema, das von der
Frage nach der Genealogie der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts (in Wahnsinn und Gesellschaft) bis zum Problem der sich am Ende des 18. Jahrhunderts formierenden
liberalen Gouvernementalität (in den Vorlesungen der Jahre 1977-79) nicht auf
hörte, sich in produktiver Weise zu wiederholen. Es ist kein Zufall, daß er im
Anschluß an die Bemerkung »Im Grunde habe ich nur einen einzigen historischen
Untersuchungsgegenstand: die Schwelle der Modernität«, diese Schwelle mit fol
genden, etwas dunlden Worten kennzeichnete: »Wer sind wir, die wir diese Spra
che sprechen, die sich uns ebenso aufdrängt wie jene Mächte, die sich uns selbst, in
unserer Gesellschaft, und anderen Gesellschaften aufzwingen?« In Les mots et les choses hieß es zu diesem »wir«, das heißt zum Problem des »Menschen« am Ende
des 18. Jahrhundert präziser: »Wie kann der Mensch dieses Leben sein, dessen
Netz, dessen Pulsieren, dessen verborgene Kraft unendlich die Erfahrung über
schreiten, die ihm davon unmittelbar gegeben ist? Wie kann er jene Arbeit sein,
deren Erfordernisse und Gesetze sich ihm als ein fremder Zwang auferlegen? Wie
kann er das Subjekt einer Sprache sein, die seit Jahrtausenden ohne ihn gebildet
worden ist [ ... ] und innerhalb deren er von Anfang an sein Sprechen und sein
Denken plazieren muß [ ... ] ? « 13 Das war das Thema Foucaults 1966: Wenn es wahr
ist, daß die am Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen neuen Wissenschaften der
Biologie, der historischen Linguistik und der Ökonomie jene »dunlden« Kräfte des
Lebens, der Sprache und der Bedürfnisse bzw. der Arbeit entdeckten, die sich nicht
mehr im Zeichenraum des 18. Jahrhunderts repräsentieren ließen, sondern die
Krieg und Wahrheit
gleichsam als ein Reales diesen Zeichenraum sprengten, dann machten diese
»Quasi-Transzendentalien « 14 den Menschen zwar ebenso denkbar und denknot
wendig, wie sie ihn de facto auch gleich wieder dezentrierten, indem sie als über
individuelle Kräfte über ihn hinausweisen. Es war damals bekanntlich Foucaults
Pointe, daß nur der »anthropologische Schlaf«, d. h. die angesichts dieser Kräfte
illusionäre Traum-Gestalt des »Menschen«, die Humanwissenschaften entstehen ließ.
Daß das »Tableau«, der mathematisch formalisierte Zeichenraum des Zeitalters
der Repräsentation, wie Foucault das Klassische Zeitalter nannte, gesprengt wurde,
erwies sich ihm mehrfach und vielfältig: im Übergang vom eingesperrten Wahn
sinn als dem reinen Gegenteil der Vernunft im 18. Jahrhundert hin zur Befragung
des Wahnsinns in der Psychiatrie des 19.; von der »Medizin der Arten« vor der
Revolution zur pathologischen Anatomie Bichats danach; oder dann im Wandel
von den das V erbrechen »spiegelnden« Körperstrafen hin zur Bestrafung und
Erziehung der »Seele« im Gefängnis der Moderne. Doch so augenscheinlich dieser
Übergang auch sein mochte, so sehr warf er ein doppeltes methodisches Problem
auf: Wie ist ein solcher Kontinuitätsbruch in der Geschichte zu denken- und welche Gründe könnten sich finden lassen, ihn zu erklären?
Zwei Bemerkungen Foucaults im Gespräch mit Roger-Pol Droit dazu scheinen
mir von Gewicht zu sein. Erstens die Aussage, daß der Geologe/Genealoge, zu dem
Foucault mit dem erneuten und vertieften Bezug aufNietzsche in »Nietzsche, die
Genealogie, die Historie« von 1971 endgültig wurde, 15 sich durch seine intellektu
ellen »Sprengungen« in den frühen siebziger Jahren, die zur Publikation von Surveiller et punir führten, einen Durchblick verschafft habe, der dem Archäologen
noch verwehrt gewesen sei. Er konnte nun sagen, daß die Diskontinuität am Ende
des 18. Jahrhundert als ein Effekt der Veränderungen der Machtverhältnisse und
Machttechnologien verstanden werden müsse. Noch 1971 hatte er mit Blick auf die
Modernitätsschwelle bekannt: »Es ist mir noch nicht gelungen, die Wurzel dieser
Veränderungen genau zu lokalisieren. Aber eines weiß ich mit Sicherheit: Diese
Veränderungen haben wirldich stattgefunden, und nach ihrem Ursprung zu
suchen ist kein Hirngespinst«. 16 Jetzt, 1975, war ihm klar: In dem Maße, wie der
»Mensch« mit seiner »Seele« aus den Prozeduren der Disziplinierung, des Strafens
und der Geständniserzwingung entstanden war, erschien daher die in überwachen
und Strafen entfaltete kalte Institutionen- und Apparategeschichte der modernen
Seelenzustände- die man »Psyche, Subjektivität, Persönlichkeit, Bewußtsein, Ge
wissen, usw.« genannt und worauf man »die moralischen Ansprüche des Huma
nismus gegründet« hat 17 - als genau jene wirldiche Genealogie des von den Hu
manwissenschaften erträumten »Menschen«, die er seit langem gesucht hatte.
IIHB 209
----- -------
Phitipp Sarasin
210
Daran ändert nichts, daß er wenig später diese Genealogie des Menschen von den
Disziplinarinstitutionen weg auf die Ebene der Bevölkerungstechnologien gerückt
hat: Seit 1976 war es für ihn die »Biomacht«,18 die- produktiv wie jede Macht
nun als die genealogische Erldärung für den Übergang zum »Leben« am Ende des
18. Jahrhunderts fungiert; in den Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalitätvon 1977/78 nannte er das Auftauchen des neuen Objekts »Bevölkerung« gar
explizit den » Transformationsoperator« dieser Modernitätsschwelle.19
Die Macht rückte zu einem Zeitpunkt ins Zentrum seines Denkens, als Foucault
eben erst begonnen hatte, seine archäologische Auffassung von Geschichte zu
systematisieren. Denn während in der Archäologie des Wissens von 1969 noch die
Regelmäßigkeiteil und Ordnungsstrukturen als der bevorzugte Gegenstand der
Analyse, ja der kalten Systematik dieser neuen Form von Geschichtsschreibung
vorgestellt wurden, geraten - und das ist die zweite Bemerkung, die mir zentral
erscheint- diese Regelmäßigkeiten im Interview von 1975 ihrerseits in den Ver
dacht, die »Zackenlinie« der sprunghaften, nicht-linearen Geschichte durch eine
dem Diskurs eigene »Linearität« zu verdrängen. Foucault hatte sich zwar auch
schon in der Archäologie deutlich gegen jede Form einer Geschichte des kontinu
ierlichen Werdens und der begriffenen Totalität ausgesprochen:20 Geschichts
wissenschaft, wie er sie denkt, favorisiert das kontingente Ereignis und die Serie
solcher Ereignisse gegenüber der ldassischen Auffassung des Ereignisses als Mani
festation einer letztlich, mit Hegel, metaphysisch begründeten »Entwicldung« oder
»Tradition«. 21 Doch nun scheint er diese in der Archäologie des Wissens entwickelte
Vorstellung noch einmal zu radikalisieren und zuallererst die Unvorhersehbarkeit,
Unregelmäßigkeit, ja »Unmöglichkeit« des Ereignisses herauszustellen, der gegen
über selbst noch das »lineare«, das heißt Regelmäßigkeiten und Ordnungsmuster
identifizierende Denken des Diskursanalytikers als inadäquat zu erscheinen droht.
Das einzige, was in diesem Feld der >>Universellen Schlacht« bleibt, ist das Experi
mentieren, das Herumtasten und Herumtappen beim strategischen Versuch, »vor
anzukommen«.
Wissenschaft und Krieg
Foucaults Auffassung, daß gleichsam >hinter< der Wahrheit die »universelle
Schlacht« und der »Krieg« um die richtigen Interpretationen tobt, ist nicht erst in
den siebziger Jahren entstanden, sondern läßt sich u. a. auf einen Vortrag zurück
führen, den er 1964 hielt und in dem er über das Problem der Interpretation bei
Freud, Marx und Nietzsche sprach. »Für Nietzsche«, so heißt es hier, »gibt es kein
ursprünglich Bezeichnetes. Die Worte sind selbst nichts als Interpretationen; in
Krieg und Wahrheit
ihrer ganzen Geschichte sind sie Interpretationen, bevor sie Zeichen sind, und sie
haben nur deshalb eine Bedeutung, weil sie Interpretationen sind.« Zeichen, so
Foucault weiter, gebe es nur, »weil unter allem, was spricht, ständig das große
Gewebe' der gewaltsamen Interpretationen liegt«22 - und daher sei »das Zeichen
bereits eine Interpretation, die sich nicht als solche zu erkennen gibt«. 23 Das Pro
blem des Zeichens ist, anders gesagt, nicht fundamental; dem Zeichen und auch
jeder Aussage liegt immer schon die Gewalt der Interpretation zugrunde. Die
Interpretation, so Foucault, ist jeder ihrer Gestaltwerdungen in Zeichenform und
dann als Aussage vorgängig und begründet diese. Daher habe man letztlich nicht
nach Bedeutungen von Zeichen zu fragen, sondern danach, »von wem die Inter
pretation stammt«, denn »das Prinzip der Interpretation ist nichts anderes als der
Interpret«. 24
Wie das zu verstehen ist, hat Foucault in einem Vortrag in Rio de Janeiro von
1973 dargelegt. Wie kommt Wissen bzw. Erkenntnis zustande, fragt er hier mit
Nietzsche. Die Antwort konnte nur lauten: »durch dunlde Machtbeziehungen«,
durch »schäbige« und »!deine« »Erfindungen«, hinter denen eben nicht ewige
Ideen, sondern die List und Hinterlist der Interpreten stehen.25 Erkenntnis gehört
zum Repertoire der »Triebe«, ohne selbst ein angeblich der Wahrheit verpflichteter
Trieb zu sein; vielmehr seien »die Triebe die Grundlage und Ausgangspunkt der
Erkenntnis«, und folglich ist »die Erkenntnis nur das äußere Ergebnis ihrer Kon
frontation«.26 Weil Erkenntnis sich, wie Foucault betont, seit Kant nicht mehr
intrinsisch von den Dingen, den Objekten der Erkenntnis her ableiten läßt, und
weil auch kein Gott mehr die Beziehung zwischen der Erkenntnis und den Dingen
garantiert, sind Wahrheit und Erkenntnisse nur noch strategische Einsätze: »Die
Erkenntnis hat mit einer Welt ohne Ordnung, Gliederung, Form, Schönheit und
Weisheit zu kämpfen. Darauf bezieht sich Erkenntnis. Nichts in der Erkenntnis
gibt ihr ein Recht darauf, diese Welt zu erkennen. Für die Natur ist es keineswegs
natürlich, erkannt zu werden. Zwischen Trieb und Erkenntnis besteht also keine
Kontinuität, sondern ein Verhältnis des Kampfes, der Herrschaft, der Knechtschaft
und des Ausgleichs, und ebenso wenig kann es zwischen der Erkenntnis und den
zu erkennenden Dingen ein Verhältnis natürlicher Kontinuität geben, sondern nur
ein Verhältnis, das durch Gewalt, Herrschaft und Macht gekennzeichnet ist.
Erkenntnis kann den zu erkennenden Dingen nur Gewalt antun; sie kann nicht
wahrnehmen, akzeptieren, sich mit ihnen oder sie mit sich identifizieren.«27 Mit
anderen Worten: »Nietzsche rückt [ ... ] als Wurzel der Erkenntnis Haß, Kampf
und Machtbeziehungen in den Mittelpunkt.«28 Erkenntnis wird auf diese Weise
nicht nur strategisch, sondern vor allem auch perspektivisch, weil es »Erkenntnis
stets nur in Gestalt diverser unterschiedlicher Handlungen gibt, in denen der
• 211
Philipp Sarasin
212
Mensch sich gewaltsam Dinge aneignet, auf Situationen reagiert und sie in Kräfte
verhältnisse zwingt«. Daher wäre es »vollkommen widersinnig, wenn man sich
eine Erkenntnis vorzustellen versuchte, die nicht zutiefst parteiisch und perspekti
visch wäre.« Hier geht Foucault mit Nietzsche entschieden über jeden Symbolisie
rungsrelativismus beiNeu-Kantianern wie Max Weber oder Ernst Cassirer hinaus:
»Der perspektivische Charakter der Erkenntnis resultiert nicht aus der mensch
lichen Natur, sondern aus dem polemischen und strategischen Charakter der
Erkenntnis. «29
Wenn Foucault daher im Gespräch mit Roger-Pol Droit sagt, er mache einen
radikal »instrumentellen Gebrauch« von Geschichte, dann ist eine solche Bemer
kung zweifellos nicht nur dazu angetan, empfindliche akademische Gemüter zu
schoclderen, sondern muß tatsächlich in diesem »perspektivischen« Sinne der
Genealogie verstanden werden, die sich in einem Schlachtfeld der Interpretatio
nen, in einem Kampf um Wahrheiten befindet, in welchem sie sich ihre Angriffe
genau zu überlegen und ihre Sprengladungen zu plazieren hat. Das darf man aller
dings nicht mißverstehen: Foucault ist kein Zyniker, der die Quellen und die histo
rische Wahrheit manipuliert, und der ebenso lügen würde, wie er nach der Wahr
heit der historischen Erkenntnis sucht: Dazu setzt er sich zu sehr der öffentlichen
Kritik und, trotznotorischer Kargheit der Fußnoten-Verweise, der akademischen
Überprüfbarkeit seiner Aussagen aus, und dazu hat er in der Archäologie des Wissens auch zu explizit seine eigenen Analyse-Regeln dargelegt: »Insoweit kann alles«,
so Foucault im Gespräch mit Ducio Trombadori 1978, »was ich in meinen
Büchern sage, verifiziert oder widerlegt werden, nicht anders als bei jedem anderen
historischen Buch.«30 Aber Foucault wußte gleichzeitig, daß alle seine Arbeiten
»Erfindungen« sind- Erfindungen im Sinne Nietzsches, Erfindungen, die ihre
Ursprünge in persönlichen Erfahrungen haben und die ihrerseits auch dazu die
nen, »eine Erfahrung zu machen und die andern aufzufordern, vermittelt über
einen bestimmten historischen Inhalt an dieser Erfahrung teilzunehmen: nämlich
an der Erfahrung dessen, was wir sind und was nicht nur unsere Vergangenheit,
sondern auch unsere Gegenwart ausmacht; an einer Erfahrung unserer Moderni
tät, derart, daß wir verwandelt daraus hervorgehen.« 31 Hier ldingt möglicherweise
schon jenes Motiv der Wandlung des Subjekts im Hinblick auf die Wahrheit an, die
Foucault später »Spiritualität« nennen wird, weil er sich zur Konzeptualisierung
dieser Wandlung des Subjekts im Spätwerk zunehmend an außereuropäischen
und antiken Beispielen orientieren wird. 32 Vor allem aber zeigt sich, daß auch der
Genealoge darauf zielte, sich selbst bzw. »uns« zu verändern. Denn in dem Maße,
wie die genealogische Geschichtsschreibung »instrumentell« ist und von den
Nöten der Gegenwart daraufzielt, »unsere Modernität« zu verstehen, ist sie ihrem
Krieg und Wahrheit
Wesen nach nichts anderes als der Versuch, uns als politische Erkenntnissubjekte
zu verände1·n, die die Mächte der Gegenwart mit ihren Identitätsbehauptungen
kritisch auf ihre »unreinen« Wurzeln, ihre »schäbigen« Ursprünge zurückführen.
Damit aber, von der Möglichkeit ihrer machtanalytischen Antwort her, erweist
sich nachträglich auch die scheinbar akademische Frage nach der »Modernitäts
schwelle« als eine genealogische.
Der blinde König
»Wenn du König wirst, wirst du wahnsinnig, leidenschaftlich und blind sein.« Mit
diesem ein wenig rätselhaften Satz charakterisiert Foucault die traditionelle Auffas
sung desVerhältnissesvon Wissen und Macht, die dieUnabhängigkeitdes Wissens
von der Macht behaupte. Daß Foucault das anders sah, ist bekannt; wesentlich
scheint mir, daß er immer wieder auf die Figur jenes blinden Königs zurücldcam,
um das Verhältnis von Wissen und Macht und ebenso den Mythos ihrer Unverein
barkeit darzulegen- auf König Ödipus. Unter anderem sprach er im zweiten Vor
trag in Rio de Janeiro 1973, d.h. im Anschluß an den oben zitierten Vortrag über
Nietzsche Erkenntnistheorie, ausführlich über das Drama König Ödipus von
Sopholdes. Foucault argumentiert, es gehe hier nicht um die Blindheit des Ödipus,
die zum Modell für den Freudschen Mythos wurde, sondern um die Königsmacht
des Ödipus: das heißt um die Frage, ob ödipus die Macht behalten könne, obwohl
die Wahrheit seiner Verfehlungen an den Tag kommt. Für Foucault war die Tat
sache entscheidend, daß Ödipus ein Mann des Wissens, des Sehens, der offenen
Augen gewesen sei, der das Rätsel der Sphinx löste und sich dann zum Tyrannen
von Theben aufschwang. Der Ödipusmythos behaupte zwar mit dem V erweis auf
das Scheitern des Ödipus, daß die Macht und das Wissen einander fremd seien,
doch diesen Mythos gelte es im Anschluß an Nietzsche zu zerstören:33 Anhand des
Sopholdes-Dramas konnte Foucault die aus seiner Perspektive manifeste und fun
damentale Rolle der Gewalt und der Macht darlegen, während Freud an diesem
Ausgangspunkt einen Mythos eingesetzt habe, der die Unterwerfung des Subjekts
unter das Gesetz des Vaters als Notwendigkeit behaupte, und der bei Lacan dazu
geführt hat, dieses Gesetz des Vaters mit der Ordnung der Sprache in eins zu setzen
und so als unausweichlich und universell zu setzen. 34 Mit anderen Worten: In
Foucaults jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit König Ödipus- implizit schon
in Walmsinn und Gesellschaft 196135 bis zur Vorlesungsreihe Hermeneutik des Subjekts 198236 - geht es um die Frage, ob jede Form eines Gesetzes, eines Allgemeinen
oder einer Regel, wie Lacan sie zusammenfassend als das »Symbolische« bezeichnet
• 213
Philipp Sarasin
und im Ödipus-Mythos fundiert hatte, auf ein Strategem im Feld von universellen
Machtkämpfen reduziert werden kann oder muß.
In dem Maße allerdings, wie Foucault selbst mit Bezug aufNietzsche einen Dis
kurs des »Ursprungs« führt- des gewalthaften Ursprungs vonWerten und sozialen
Verhältnissen ebenso wie von Erkenntnis und Wahrheit -, wird deutlich, an wel
chem Punkt die Genealogie in jene Ursprungsmystik zurückfällt, die sie um jeden
Preis verhindern will: dort nämlich, wo sie die Dekonstruktion von gesellschaftli
chen Verhältnissen soweit treibt, diese vollständig auf Kämpfe um Macht zurück
zuführen, auf ein Ursprüngliches der Gewalt und der Überwältigung. »Die Regel«
der gesellschaftlichen Verhältnisse und Auseinandersetzung »ist«, so Foucault in
»Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, »die kalkulierte Lust am Gemetzel und
die Hoffnung auf Blut.« Alle Regeln haben ihre Wurzel in diesem Krieg; alle Regeln
und alle Zeichen sind nichts als »>nterpretationen« oder strategische Kalküle;
daher fährt Foucault fort: »Das große Spiel der Geschichte dreht sich um die Frage,
wer sich der Regeln bemächtigt; wer an die Stelle derer tritt, die sie für sich nutzen;
wer sie am Ende pervertiert, in ihr Gegenteil verkehrt und gegen jene wendet, die
sie einst durchsetzten«.37
Die Frage muß erlaubt sein, ob Foucaults Annahme, daß das tiefste, zugleich
aber offen zutage liegende Geheimnis sozialer wie epistemologischer Verhältnisse
der Krieg sei, zwingend oder zumindest plausibel ist. Ich vertrete die These, daß
dies nicht der Fall ist. Es ist vielleicht sinnvoll, sich daran zu erinnern, daß Nietz
sche selbst, in dem von Foucault in Rio de Janeiro ausführlich zitierten Text
»Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn« von 1873 zwar notierte,
der Intellekt des Menschen sei »das Mittel, durch das die schwächeren, weniger
robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit
Hörnern oder scharfem Raubthier-Gehiss zu führen versagt ist«, und daß das Indi
viduum, »soweit es sich gegenüber anderen Individuen erhalten will, in einem
natürlichen Zustande der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung be
nutzte«. Das bezieht sich wie gesagt auf den »natürlichen Zustande«, d. h. auf eine
Art Vorgeschichte. Weil jedoch, so fährt Nietzsche fort, »der Mensch zugleich aus
Nothund Langeweile gesellschaftlich und heerdenweise existiren will, braucht er
einen Friedensschluss und trachtet darnach daß wenigstens das allergröbste bell um
omnia contra omnes aus seiner Welt verschwinde.« Es ist für unsere Diskussion
von Belang, wie Nietzsche diesen Übergang deutet: »Dieser Friedensschluss bringt
nun aber etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes räthselhaften
Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an >Wahr
heit< sein soll d. h. es wird eine gleichmässig gültige und verbindliche Bezeichnung
214 Ll B
Krieg und Wahrheit
der Dinge erfunden und die Gesetzgebung der Sprache giebt auch die ersten Gesetze de1: Wahrheit.«38
Irgendwann einmal wurden also gewisse Tiere so ldug, daß sie begonnen haben,
ihre fehlenden Hörner und Raubtiergebisse durch Täuschung und Verstellung,
List und Hinterlist zu ersetzen, um sich im Dasein zu halten. Aus »Noth und Lan
geweile« wollten diese Tiere aber überdies nicht alleine leben, sondern »gesell
schaftlich«. Die ldugen Tiere haben damit zwei Dinge getan: Einerseits haben sie
Frieden geschlossen, um dem gröbsten Krieg unter ihnen zumindest Einhalt zu
gebieten. Und gleichzeitig- Nietzsche sagt: »bringt mit sich« -wurde »eine gleich
mäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden«.39 Mit anderen
Worten, der Friedensschluß von Tieren, die gesellschaftlich existieren wollen,
wurde begleitet von der Erfindung der Sprache. Damit aber konnten sowohl das
Problem der Wahrheit als auch der Lüge entstehen, denn »die Gesetzgebung der
Sprache giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit«. Wenn am Anfang von Gesell
schaft der Friedensvertrag steht, steht am Anfang der Wahrheit die sprachliche
»Convention«. Das aber würde heißen, daß diese Konvention und nicht die »uni
verselle Schlacht« der Ausgangspunkt des »räthselhaften Wahrheitstriebes« ist. Der
von Nietzsche angedeutete Übergang von den »Individuen« im Naturzustand zu
den »Menschen« im Gesellschaftszustand ist daher wohl so zu verstehen, daß die
Tier-Individuen erst dann zu Menschen wurden, als sie nicht nur in Herden, bzw.
Gesellschaft existierten, sondern vor allem, als sie sich »Conventionen« unterwar
fen: der Konvention eines Friedensvertrags und zugleich auch jener »Gesetzgebung
der Sprache«, die die konventionellen Bezeichnungen der Dinge festlegt. Ist es
daher nicht plausibel anzunehmen, dieser ursprüngliche Friedensvertrag sei in
Wahrheit nichts anderes als genau jenes Gesetz der Sprache?
Die doppelte Aufgabe der Genealogie
Von einer solchen Lektüre Nietzsches ausgehend ließe sich folgern, daß Erkenntnis
und Wahrheit nicht ausschließlich und »ursprünglich« aufnichts anderes denn auf
das belZum omnia contra omnes zurückzuführen sind; vielmehr wären Menschen
zugleich und gewissermaßen gleichursprünglich immer schon in ein Symbolisches
eingehüllt: sprechend und kämpfend. Dieses Symbolische wäre eine Ordnung, die
man mit Nietzsche mit der »Ordnung der Sprache« identifizieren kann, und die
selbstverständlich vollkommen fiktiv ist: Es gibt kein fundamentum in re dieser
sprachlichen Konventionen, es gibt keine transzendentale oder metaphysische
Stütze dessen, was Menschen in historisch je vollkommenkontingenterWeise als
eine ihnen übergeordnete Gerechtigkeit oder Wahrheit imaginieren. Es scheint
CJ II 215
Philipp Sarasin
216 •
allerdings so zu sein, daß Menschen das mit Notwendigkeit tun. Es ist plausibel
anzunehmen, daß sie, weil sie sprechen, in symbolischen Ordnungen leben, die ihr
Handeln ebenso strukturieren, wie es der Kampf ums Überleben und damit die
Gewalt tun. Symbolische Systeme »rahmen« die Kämpfe um Macht und Einfluß
ein, indem sie ihnen einen Ort, eine Struktur und eine Bedeutung geben. Wir ver
stehen mit Foucault besser, daß diese symbolischen Ordnungen selbst Objekt von
Kämpfen sind und darin oft tiefgreifend modifiziert werden; es gibt wenig Grund,
an seiner illusionslosen Diagnose zu zweifeln, daß die Kämpfenden letztlich da
nach trachten, die jeweils geltenden »Regeln« zu ihrem Vorteil zu ändern. Aber
Nietzsches Überlegungen zum Ursprung des »Wahrheitstriebes« legen es nahe
anzunehmen, daß die »Regeln« und damit die Sprache kaum ohne Rest auf den
Krieg reduzierbar und damit in reine Strategeme auflösbar wären- und auch nicht
auf strategische »Kopplungen« in einem Netzwerk von Aktanten, wie Bruno
Latour in Anschluß an Gilles Deleuze und implizit auch an Foucaults Genealogie
sagt.40 Daher stellt sich an diesem Punkt die theoretische Aufgabe, die Genealogie
mit einem Ansatz zu verbinden, der die Notwendigkeit der Filetion des Symboli
schen zu denken gestattet, der es, mit anderen Worten, zu verstehen erlaubt, daß
Menschen sich auf wissenschaftliche Wahrheiten zu einigen vermögen, wenn und
weil sie sich auf ein gemeinsames Symbolisches als ein »Drittes« beziehen können.
Dann sind wissenschaftliche Wahrheiten eben mehr als nur strategische Hinterli
sten von Kämpfenden, bzw. mehr als strategische Kopplungen, die zerfallen müs
sten, wenn die strategische Situation sich ändert. Ein illustratives und zugleich
ungemein kontrastives Beispiel für reine »Kriegs-Wissenschaft«, für »Wissen
schaft« im Dienste nationaler Propaganda im Krieg - und das kann im Rahmen
dieses Kommentars nicht mehr als ein einfaches Beispiel und ein kurzer Hinweis
sein - lieferte etwa die französische Anthropologie im Ersten Weltkrieg in ihren
Beschreibungen der Physiologie der »Boches«.41 Diese »Wahrheiten« waren zwar
im Netzwerk mächtiger Institutionen und anerkannter Wissenschaftler entstan
den, sie waren wirkungsvoll und überzeugend ... - dochnurums Jahr 1917 herum,
nach dem Waffenstillstand zerfielen sie ziemlich schnell zu Staub. Daß solche
»Wissenschaft« zumindest intuitiv mit aller Deutlichkeit von Normal-Wissen
schaft unterschieden werden kann und muß, ist keine Frage. Dieser intuitiv leicht
zugängliche Unterschied kann wahrscheinlich - das wäre die These - nur mit
Bezug auf die notwendigerweise gemeinsame Fiktion eines Symbolischen der Wis
senschaft begründet werden, was allerdings nicht bedeutet, daß man damit
zugleich auch zu unterstellen gezwungen wäre, Wissenschaft sei nach dem idea
listischen Prinzip des »besseren Arguments« bzw. des »Zwanglosen Zwangs der
Vernunft« (Habermas) zu modellieren. Jedenfalls wäre das Funktionieren von
Krieg und Wahrheit
Wissenschaft in emer so verstandenen genealogischen Perspektive jeweils in
gleichsam doppelterWeise zu beschreiben: als Produkt von permanenten Konflik
ten und Kämpfen und damit weit jenseits der Möglichkeit, irgendetwas als »wahr«
oder auch nur »gewiß« von diesen Auseinandersetzungen auszunehmen, und
zugleich als ein symbolisches System, das immer auch ein Stück weit den Regeln zu
folgen gezwungen ist, die zwar ebenso aus diese Kämpfe hervorgehen, wie sie diese
aber immer auch »rahmen« und auch die Kontrahenten eine Zeit lang verbinden.
Genealogische Wissensgeschichte hat, so scheint mir, nur dann die Chance, nicht
reduktionistisch zu werden, sondern komplex zu bleiben, wenn sie sich diese dop
pelte Fragestellung offen hält. Sie wüßte zwar mit Foucault, daß sie der Wissen
schaft keine teleologischen Garantiescheine auf die hyperbolische Annäherung an
die Wahrheit qua »besseres Argument« ausstellen kann. Aber sie könnte dennoch
verstehbar machen, warum gewisse Wahrheiten eine Weile lang im Fluß der Zeit
Bestand haben und nicht im Strudel der Kriege untergehen.
Anmerkungen
1 Michel Foucault: Schriften in vier Bänden (Dits et Ecrits), hg. von Daniel Defert und Fran<;ois
Ewald, Frankfurt 2001-2005, Bd. II, S. 374 (im folgenden zitiert als >>Schriften«).
2 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. I, S. 73 (Zeittafel).
3 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am College de France -
2. Dezember 1970, Frankfurt/M. 1991 (L'Ordre du Discours, Paris 1970), S. 31.
4 Johannes Fehr und \'\~'alter Grond (Hg.): Schreiben am Netz. Literatur im digitalen Zeitalter, Innsbruck 2003.
5 Didier Eribon: Michel Foucault. Eine Biographie, Frankfurt/M. 1991, S. 372f.
6 Vgl. MaxBlack: »Die Metapher<<, in: Anselm Haverkamp (Hg.): Theorie der Metapher, Darm
stadt 1996, S. 55-79.
7 Michel Foucault: Raymond Roussel, Frankfurt/M. 1989 (Paris 1963), S. 191 (Großschreibung
im Original, Ph.S.).
8 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. III, S. 741.
9 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frank
furt/M. 1978 (Les mots et les choses, Paris 1966), S. 32lf.
10 >>Jean-Paul Sartre repond<<, in: L'Arc, No 30, 1966.
11 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, a.a.O., S. 48.
12 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. I, S. 670.
13 Foucault, Ordnung der Dinge, a.a.O., S. 390.
14 Ebd., S. 307.
• 217
~----------- --------
Philipp Sarasin
218
15 Michel Foucault: >>Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, in: ders.: Schriften, a.a.O., Bd. II,
s. 166-190.
16 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. li, S. 199.
17 Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M. 1976
(Paris 1975), S. 42.
18 Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am College de France (1975-76),
Frankfurt/M. 1999, S. 276, 280; ders.: Der Wille zum Wissen, Frankfurt/M. 1977 C=Sexualität 11nd
Wahrheit, Bd. 1), S. 166, 168.
19 Michel Foucault: Geschichte der Gouvemementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölkemng.
Vorlesung am College de France 1977-1978, hg. von Michel Sennelart, Frankfurt/M. 2004, S. 118-
120.
20 Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 1995 (Paris 1969), S. 23.
21 Vgl. dazu Hans-Georg Gadamer: Wahrheit 11nd Methode, Tübingen 1975, S. 324f.
22 Michel Foucault: »Nietzsche, Freud, Marx«, in: ders.: Schriften, a.a.O., Bd. I, S. 735 (Hervor
hebung durch mich, Ph. S.).
23 Ebd., S. 736.
24 Ebd.
25 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. II, S. 677.
26 Ebd.
27 Ebd., S. 679.
28 Ebd., S. 682.
29 Ebd., S. 684 (Hervorhebung durch mich, Ph.S.).
30 Michel Foucault: Der Mensch ist ein E1jahnmgstier. Gespräch mit D11ccio Trombadori, Frank
fm"t/M. 1996, S. 28.
31 Ebd., S. 28f.
32 Michel Foucault: Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung am College de France (1981/82), Frank
furt/M. 2004 (Paris 2001); vgl. dazu Philipp Sarasin: Michel Foucault zur Einführung, Hamburg
2005, Kap. 7.
33 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. II, S. 686-706.
34 Vgl. Jacques Lacan: >>Funktion und Feld des Sprechensund der Sprache in der Psychoanalyse
(Bericht auf dem Kongress von Rom 1953)«, in: ders.: Schriften, hg. von N. Haas und H. J, Metz
ger, Berlin 1991, Bd. 1, insb. S. 112-119.
35 Michel Foucault: Walmsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Walms im Zeitalter der Ver
mmft, Frankfurt/M. 1973 (Paris 1961), S. 512.
36 Foucault, Hermeneutik des Subjekts, a.a.O., S. 541.
37 Foucault, Schriften, a.a.O., Bd. II, S. 177.
Krieg und Wahrheit
38 Friedrich Nietzsche: >>Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne« [1873], in:
ders.: Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, hg. von G. Colli u. M. Montinari, München,
Berlin, NewYork 1980, Bd, 1, S. 873-890, hier S. 877.
39 Ebd.
40 Bruno Latour: >>On Actor-Network Theory. A few Clarifications<<, in: Soziale Welt, 1996, 47, S.369-381
41 Michael Jeismann: Das Vaterland der Feinde. Studien z11m nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 1992, S. 349-355.
" 219
Herausgegeben von
David Gugerli, Michael Hagner, Michael Hampe, Barbara Orland, Philipp Sarasin und Jakob Tanner
Nach Feierabend Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 1
Bilder der Natur
Sprachen der Technik
diaphanes
Publiziert mit freundlicher Unterstützung der OPO-Stiftung, Zürich und des Zentrums >>Geschichte des Wissens«, gemeinsam getragen von ETH und Universität Zürich.
Redaktion: Barbara Orland Zentrum »Geschichte des Wissens<< ETH Zentrum RAC 8092 Zürich
ISBN 3-935300-97-2 ©diaphanes, Zürich-Berlin 2005 www.diaphanes.net Alle Rechte vorbehalten
Satz und Layout: 2edit, Zürich www.2edit.ch Druck: Königsdruck, Berlin
Inhalt
Editorial 7
" Bilder der Natur- Sprachen der Technik
• Essay
Philipp Felsch Aufsteigesysteme 1800- 1900 15
Charlotte Bigg Das Panorama, oder La Nature A Coup d'CEil 33
Erich Hörl Zahl oder Leben: Zur historischen Epistemologie des Intuitionismus 57
Wolfgang Pircher Die Sprache des Ingenieurs 83
Valentin Groebner Historische Kostüme 111
• Lektüre
Michael Hagner Du störst! Menschen im Labor und Fallibilismus: über Benjamin Libets »Mind Time« 127
• Dialoge
lan Hacking Ein Stilbegriff für Historiker und Philosophen 139
Michael Hampe Die Archäologie vorgeschichtlicher Fliegengläser: lan Hackings historische Ontologie 169
Michel Foucault »Ich bin ein Sprengmeister« Ein Gespräch über die Macht, die Wissenschaften, die Genealogie und den Krieg 187
Philipp Sarasin Krieg und Wahrheit: Michel Foucault als Sprengmeister 205