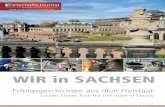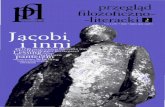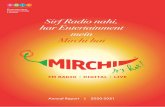„Eine Stadt müssen wir erbauen, eine ganze Stadt!“ “A city, we ...
»Mit Dir hätten wir jeden Krieg gewonnen ...sagt mein Opa!« Weltkriegsrepräsentationen im...
Transcript of »Mit Dir hätten wir jeden Krieg gewonnen ...sagt mein Opa!« Weltkriegsrepräsentationen im...
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTS- UND KULTURWISSENSCHAFTEN HISTORISCHES SEMINAR
Andreas Greiner
»Mit Dir hätten wir jeden Krieg gewonnen ...sagt mein Opa!« Weltkriegsrepräsentationen im Computerspiel
II
Inhalt
1. Einleitung ...................................................................................................................... 1 2. Der Historiker als Spiel(e)verderber: Anmerkungen zum Vorgehen ................................ 5
2.1. Forschungsstand ...................................................................................................... 5 2.2. Methode .................................................................................................................. 6 2.3. Quellenauswahl ....................................................................................................... 8
2.3.1. ›Sudden Strike 1 & 2‹ ................................................................................ 9 2.3.2. ›Panzer General‹ ..................................................................................... 10 2.3.3. ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ ................................................................. 10
3. Narratologische Analyse .............................................................................................. 11 3.1. Kontrafaktizität und Kriegsverlauf ......................................................................... 11
3.1.1. Lineare Spiele .......................................................................................... 12 3.1.2. Offene Spiele ........................................................................................... 13
3.2. Nationalsozialismus im Spiel ................................................................................. 16 3.2.1. Rechtliche Grundlage .............................................................................. 16 3.2.2. Darstellung nationalsozialistischer Ideologie ......................................... 17 3.2.3. Verhältnis der Wehrmacht zum Nationalsozialismus ............................ 21
3.3. Darstellung des Kriegsalltags ................................................................................. 22 3.3.1. Kriegsverbrechen und Vernichtungskrieg .............................................. 22 3.3.2. Die SS im Spiel ......................................................................................... 24 3.3.3. Zivilgesellschaft und Totaler Krieg .......................................................... 25
4. Ludologische Analyse ................................................................................................... 27 4.1. Spielziele ................................................................................................................ 27 4.2. Kriegstaktik ............................................................................................................ 27 4.3. Vernichtung des Gegners ...................................................................................... 28
5. Rezeption des Geschichtsbildes .................................................................................... 29 5.1. Forschungsstand .................................................................................................... 30 5.2. Untersuchung ausgewählter Foreneinträge ......................................................... 31
5.2.1. Grundlegende Überlegungen ................................................................. 31 5.2.2. Motivation und Rezeptionskompetenz .................................................. 32 5.2.3. Authentizitätsversprechen und Rezeption ............................................. 34
6. Fazit ............................................................................................................................. 35 7. Quellen- und Literaturverzeichnis ................................................................................. 38
7.1. Quellen .................................................................................................................. 38 7.2. Literatur ................................................................................................................. 39
1
1. Einleitung
»Nach dem Ende des Monopols der professionellen Geschichtswissenschaft gehört Geschichte heute einer ständig wachsenden Gruppe von Sachwaltern:
neben den Professoren auch den Politikern, […] den Filmregisseuren, den Künstlern, den Infotainern und den Eventregisseuren. […]
Die Geschichte verlagert dabei ihren Schwerpunkt von der Universität zum Kulturbetrieb des Marktes.«1
»Erleben Sie simulierte Kampfhandlungen des 2. Weltkrieges in noch nie da gewesener
Realitätstreue.« – verspricht das Computerspiel ›Sudden Strike 2‹ (Fireglow Games, 2002)
seinen Käufern; und weiter: »[K]eine Sorge – mit Sudden Strike II geht der Krieg weiter, und
wie!«2 Der Krieg geht weiter – längst nicht mehr auf den realen Schlachtfeldern, dafür aber
im allabendlichen TV-Programm, auf der Kinoleinwand, in Groschenromanen und Comics,
bei Reenactments und eben auch in Computerspielen. Wenn Norbert Frei sechzig Jahre nach
1945 argwöhnt »So viel Hitler war nie.«,3 beschreibt er damit einen Trend, der ausgehend
von der amerikanischen TV-Serie ›Holocaust‹4 (NBC, 1978) den Zweiten Weltkrieg aus der
Nische des universitären Betriebs gerückt, ihn als Gegenstand populärkultureller
Repräsentation und Produktion spätestens seit den 1980er Jahren zum festen Repertoire der
Kulturindustrie hinzugefügt hat und dessen Höhepunkt bislang noch aussteht. Denn je ferner
der Krieg rückt, scheint es, umso mehr entwickelt er sich zu einem Medienerlebnis für die
breite Öffentlichkeit.5
Dementsprechend sind es die Massenmedien, die heute die Grundversorgung der Gesell-
schaft mit Geschichtsbildern weitestgehend übernommen haben.6 Dem Fernsehen mit
seinen massentauglichen Histotainment-Formaten kommt dabei sicherlich eine heraus-
1 ASSMANN, Aleida: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung,
München 2007, S. 178. 2 CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG: Sudden Strike 2, online unter:
http://web.archive.org/web/20020320012247/http://www.suddenstrike2.de/deutsch/index1.htm [12.06.2012]. 3 FREI, Norbert: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2005, S. 7.
4 Zu Rezeption und Einfluss der Serie vgl. u.a. WILKE, Jürgen: Die Fernsehserie ›Holocaust‹ als Medienereignis, in:
Historical Social Research 4 (2005), S. 9-17. 5 Vgl. KNOCH, Habbo: Die lange Dauer der Propaganda. Populäre Kriegsdarstellung in der frühen Bundesrepublik,
in: HARDTWIG, Wolfgang/ SCHÜTZ, Erhard: Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2005, S. 208. 6 Vgl. WOLFRUM, Edgar: Neue Erinnerungskultur? Die Massenmedialisierung des 17. Juni 1953, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte 40/41 (2003), S. 36.
2
ragende Rolle zu, doch war es einem ganz anderen Medium vorbehalten, neue und vor allem
jüngere Rezipientenkreise für populäre Weltkriegsrepräsentationen zu erschließen:7 dem
Computerspiel.
Dieses vollzog parallel zum besagten »Erinnerungsboom«8 seit den 1980er Jahren eine
rasante Entwicklung vom kulturellen Nischenprodukt zu einem »Leitmedium des 21.
Jahrhunderts«9 und stellt heute neben einem gewichtigen ökonomischen Faktor – die
Spielebranche erwirtschaftete 2011 in Deutschland insgesamt 1,99 Milliarden Euro10 – ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen dar, das über alle Bildungsniveaus, soziale Schichten
und Altersgrenzen hinweg genutzt wird: Mit knapp 25 Millionen Deutschen spielte 2011 fast
ein Drittel der Gesamtbevölkerung regelmäßig Computerspiele, unter den Jugendlichen
waren es sogar drei Viertel.11
Der Zweite Weltkrieg beherrscht dabei wie kein anderes historisches Ereignis die
Themenwahl der Spiele: Von den über 1.750 PC-Historienspielen12, die neben Fantasy-,
Science Fiction- oder Sport-Spielen seit Einführung des ersten markttauglichen Personal
7 Vgl. SCHWARZ, Angela: Siegen ist erst der Anfang. Oder: Was kommt nach der Annäherung an die Geschichte im
Computerspiel?, in: dieselbe (Hrsg.): »Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?«. Eine fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel, Münster 2010, S. 217. 8 MEYER, Erik: Problematische Popularität? Erinnerungskultur, Medienwandel und Aufmerksamkeitsökonomie,
in: KORTE, Barbara/ PALETSCHEK, Sylvia (Hrsg.): History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009, S. 267. 9 Siehe NEITZEL, Britta: Das Computerspiel als Leitmedium des 21. Jahrhunderts, in: KAMINSKI, Winfred (Hrsg.):
Clash of Realities 2008. Spielen in digitalen Welten, München 2008, S. 61-75. 10
Vgl. BUNDESVERBAND INTERAKTIVE UNTERHALTUNGSSOFTWARE (Hrsg.): Marktzahlen, online unter: http://www.biu-online.de/de/fakten/marktzahlen [12.06.2012]. 11
Vgl. BUNDESVERBAND INTERAKTIVE UNTERHALTUNGSSOFTWARE (Hrsg.): Gamer-Statistiken, online unter: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken.html [12.06.2012]. Wenngleich zu beachten ist, dass die hier untersuchten Spiele eher ein geringeres Publikum ansprechen. Dennoch fanden sich etwa 2009 unter den Top Ten der umsatzstärksten PC-Spiele drei Historienspiele, vgl. MEDIA CONTROL GFK INTERNATIONAL GMBH: Top 50 PC-Spiele für den Zeitraum KW 01 bis KW 53 2009, abgedruckt in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, S. 200. 12
Damit sind PC-Spiele gemeint, die nach MacCallum-Stewart/ Parsler zwei Voraussetzungen erfüllen: »The game has to begin at a clear point in real world history and that history has to have a manifest effect on the nature of the game experience.« Siehe MACCALLUM-STEWART, Esther/ PARSLER, Justin: Controversies: Historicising the Computer Game, in: BABA, Akira (Hrsg.): Situated Play. Proceedings of DiGRA 2007 Conference, o.O. 2007, S. 204, online unter: http://www.digra.org/dl/db/07312.51468.pdf [12.06.2012]. Ähnlich subsumiert Pöppinghege all jene Spiele »unter dem Genre-Begriff ›historische Computerspiele‹ […], die sich vor einem mehr oder minder konkreten historischen Hintergrund bzw. in einer historisch fassbaren Epoche abspielen und auf Fantasy-Elemente verzichten.« Siehe PÖPPINGHEGE, Rainer: Wenn Geschichte keine Rolle spielt, in: HARDTWIG, Wolfgang/ SCHUG, Alexander (Hrsg.): History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, Stuttgart 2009, S. 132.
3
Computers durch IBM im Jahr 1981 auf dem amerikanisch-europäischen Markt erschienen
sind (Stand 2010),13 widmet sich mit 27,5 Prozent über ein Viertel thematisch den Jahren
1939 bis 1945, wohingegen etwa das gesamte Mittelalter im Vergleich dazu mit nur acht
Prozent deutlich zurückfällt.14
Diese große Beliebtheit ist zum einen auf den Umstand zurückzuführen, dass der Zweite
Weltkrieg als Szenario mit seiner Vielzahl von Schauplätzen und Teilgeschichten den
Entwicklern ausreichend Stoff für die Produktion immer neuer Spielhandlungen bietet.15
Zum anderen können die Entwickler bei diesen Spielen auf das durch Unterricht und andere
(mediale) Sozialisatoren sichergestellte historische Vorwissen der Spieler aufbauen, was eine
lange Erläuterung bzw. Begründung der Spielwelt überflüssig macht, wie sie etwa bei einem
Fantasy-Spiel nötig wäre.16 Daraus ergibt sich allerdings gleichzeitig, dass sich die Entwickler
bei der Konzeption ihrer Spiele stets in den Grenzen der kollektiven Erinnerung an den
Zweiten Weltkrieg bewegen müssen, was im Wesentlichen eine strikte »Gut-Böse-
Dichotomie«17 mit der Freien Welt auf der einen, dem Nationalsozialismus als klares, den
Krieg erst legitimierendes Feindbild auf der anderen Seite bedeutet.
Dies aber sollte zunächst einmal wenig Möglichkeiten zur Identifikation mit der deutschen
Fraktion bieten und damit wenig Anreiz, auf ihrer Seite in den virtuellen Weltkrieg zu ziehen.
Mehr noch: Für die Deutschen zu sein, wird selbst unter Spielern als moralisch bedenklich
angesehen.18 Für das Spielkonzept bedeutet das, dass der Spieler zwar auf Seiten der
Alliierten gegen die Bösen kämpfen kann, ihm das Kommando über deutsche Truppen aber
verwehrt bleibt. Diese scheinen sich dagegen als umso bessere Gegner zu erweisen:
»[T]here's not a lot of room for ideological ambiguity with Nazis«, schreibt etwa das
Webmagazin IGN, das »Nazis« auf Platz sechs der 100 größten Schurken der Video-
13
Vgl. SCHWARZ, Angela: Neue Medien – alte Bilder. Frauenfiguren und Frauendarstellungen in neueren Computerspielen mit historischen Inhalten, in: ALAVI, Bettina (Hrsg.): Historisches Lernen im virtuellen Medium (Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Bd. 54), Heidelberg 2010, S. 35. 14
Vgl. SCHWARZ, Angela: Neue Medien – alte Bilder, S. 37. Siehe auch: SCHWARZ, Angela: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft?, in: dieselbe (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, S. 14. 15
Vgl. SCHOLZ, Kristina: The Greatest Story Ever Remembered. Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg als sinnstiftendes Element in den USA, Frankfurt a.M. 2008, S. 168. Siehe auch GIESELMANN, Hartmut: Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel, Hannover 2002, S. 102. 16
Vgl. SCHÜLER, Benedikt; SCHMITZ, Christopher; LEHMANN, Karsten: Geschichte als Marke, in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, S. 199–215, hier S. 202. 17
SCHOLZ, Kristina: The Greatest Story Ever Remembered, S. 106. 18
Vgl. ATKINS, Barry: More than a game. The computer game as fictional form, Manchester 2003, S. 2.
4
spielgeschichte listet; »Nazis always make good villains.«19 Der Großteil der im Zweiten
Weltkrieg angesiedelten PC-Spiele scheint diese Schranken zu akzeptieren. Dennoch werden
immer wieder Spiele veröffentlicht, die es ihren Spielern freistellen, auch aufseiten der
Deutschen die historischen Schlachten am PC nachzuerleben und – gewissermaßen als
»Endsieg der Enkel«20 – zuweilen auch zu gewinnen.
Die vorliegende Arbeit nimmt diesen Umstand zum Anlass, anhand einer Auswahl von vier
PC-Spielen, die es erlauben, auf deutscher Seite zu kämpfen, nach Repräsentationsformen
des Zweiten Weltkriegs im Computerspiel zu fragen. Dabei nimmt die Untersuchung
zunächst die Präsentationsebene in den Blick: Wie werden Weltkrieg und Wehrmacht in den
Spielen dargestellt; welche Aussagen werden getroffen und welche Geschichtsbilder
vermittelt? Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt die Regelstruktur der Spiele in
die Untersuchung miteinbezogen. Hier soll gezeigt werden, inwiefern sich die in den Spielen
formulierten Ziele und angebotenen Lösungsmöglichkeiten mit den realen Taktiken der
Wehrmacht decken und diese sogar einfordern.
Nach diesen Untersuchungen scheint es berechtigt, zu fragen: So what? – Welche Relevanz
hat es überhaupt, Geschichtsbilder in PC-Spielen zu erforschen? Der abschließende dritte Teil
dieser Arbeit widmet sich daher der Frage, ob die PC-Spiele vermittels der
herausgearbeiteten Weltkriegsrepräsentationen tatsächlich das Geschichtsbewusstsein der
Spieler prägen. Da sich die Forschung über diesen Punkt zwar einig ist, bislang allerdings
wenig Belege erbracht hat und sich lediglich Rückschlüsse von Rezeptionsuntersuchungen
anderer Medien ziehen lassen, begibt sich die Arbeit in diesem Abschnitt im Wesentlichen
auf Spurensuche in Internetforen, in denen über die untersuchten Spiele diskutiert wird, um
so wenigstens in Ansätzen eine begründete Antwort liefern zu können.
Bevor in Kapitel 3 mit der Untersuchung der PC-Spiele auf ihre Weltkriegsrepräsentationen
hin begonnen wird, sollen am Beginn dieser Arbeit zunächst noch einige einleitende
Bemerkungen zum Forschungsstand, zur Untersuchungsmethode sowie zu den verwandten
Computerspielen und sonstigen Quellen stehen.
19
IGN: Nazis is Number 6, online unter: http://www.ign.com/videogame-villains/6.html [12.06.2012]. 20
KUSENBERG, Peter: Endsieg der Enkel, in: Konkret 7 (2004), online unter: http://www.konkret-verlage.de/kvv/txt.php?text=endsiegderenkel&jahr=2004&mon=07 [12.06.2012].
5
2. Der Historiker als Spiel(e)verderber: Anmerkungen zum Vorgehen 2.1. Forschungsstand
Computerspiele als Forschungsbereich innerhalb akademischer Strukturen sind ein
vergleichsweise junger Gegenstand, der sich unter dem Namen Game Studies spätestens seit
2001 zumindest im englischen Sprachraum etablieren konnte.21 In Deutschland blieb die
Untersuchung von PC-Spielen dagegen weitgehend der Psychologie und der Pädagogik
vorbehalten.22
Für Historiker stellten Computerspiele dementsprechend lange Zeit Terra incognita dar. Als
Pionier gilt Peter Wolf, der bereits 1993 nach der Darstellung des Mittelalters im PC-Spiel
›Der Patrizier‹ (Ascon, 1992) fragte,23 wenngleich seine Untersuchung ein Einzelfall blieb.
Erst mit einem Workshop an der Universität Siegen im Jahr 2008 und dem dazu erschienen
Tagungsband24 konnte das fremde Forschungsfeld für die deutsche Geschichtswissenschaft
jüngst in grundlegenderen Ansätzen erschlossen werden.
Dennoch hat sich bereits eine Handvoll Autoren explizit mit dem Zweiten Weltkrieg im PC-
Spiel beschäftigt: Die Texte von Hartmut Gieselmann25, Rainer Pöppinghege26 sowie Peter
Kusenberg27 etwa fragten – ähnlich wie diese Arbeit – nach Repräsentationsmechanismen
und -formen von Nationalsozialismus und Weltkrieg. 1998 setzten sich Markus Pöhlmann
und Dierk Walter unter dem Titel ›Guderian fürs Kinderzimmer?‹28 zudem unter
21
Vgl. AARSETH, Espen: Computer Game Studies, Year One, in: Game Studies 1 (2001), online unter: http://gamestudies.org/0101/editorial.html [12.06.2012]. 22
Vgl. SCHWARZ, Angela: Neue Medien – alte Bilder, S. 33. 23
WOLF, Peter: Freibeuter der Chronologie. Geschichtsbilder des Historismus im Computerspiel ›Der Patrizier‹, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 10 (1993), S. 665–670. 24
SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, Münster 2010. 25
GIESELMANN, Hartmut: Spielplatz Zweiter Weltkrieg. Nazi-Clans und Militär-Fanatiker im virtuellen Stahlgewitter, online unter: http://web.archive.org/web/20050221092821/http://snp.bpb.de/referate/giesel.htm [12.06.2012], sowie ders.: Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel, Hannover 2002. 26
PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer. Der Zweite Weltkrieg im Computerspiel, in: Steinberg, Swen (Hrsg.): Vergessenes Erinnern. Medien von Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis, Berlin 2009, S. 105-120. 27
KUSENBERG, Peter: Endsieg der Enkel, in: Konkret 7 (2004), online unter: http://www.konkret-verlage.de/kvv/txt.php?text=endsiegderenkel&jahr=2004&mon=07 [12.06.2012]. 28
PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer? Historische Konfliktsimulationen im Computerspiel, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 12 (1998), S. 1087–1109.
6
militärhistorischer Perspektive mit der Thematik auseinander. Gunnar Sandkühler29 und
Steffen Bender30 dagegen fokussierten sich in ihre Untersuchungen auf Spuren der
Remediation populärer Kriegsfilme bzw. auf das Nacherleben subjektiver Kriegserfahrungen
in Ego-Shootern.
2.2. Methode
Wenn sich Historiker bisher mit Computerspielen beschäftigt haben, so geschah dies auf
eine recht oberflächliche Art: Zu sehr erwecken die Untersuchungen den Eindruck, sie
beriefen sich auf reine Beobachtungen, nicht auf eine eingehende Spielanalyse; zu sehr
erscheint es oft angebracht, zu fragen: »You Played That?«.31 Dieser Umstand mag in der
fehlenden Übung mit dem neuen Medium liegen, aber auch im fehlenden Instrumentarium:
Die traditionelle Methode des Historikers, die Quellenkritik, kann zwar helfen, den
Spielinhalt grundlegend zu erfassen, zu einer tatsächlichen Analyse der Spiele taugt sie aber
wenig.32 Daher wurde sie in dieser Untersuchung durch Ansätze der Game Studies ergänzt.
Diese Ansätze haben sich seit Entstehung des Fachs in zwei prominente Richtungen
entwickelt; die Narratologie und die Ludologie.33 Erstere versteht das Medium
Computerspiel als Text und damit als Erweiterung etablierter erzählerischer Medien, wie der
Literatur, dem Theater oder dem Film und betont daher vordergründig dessen narrativen
Aspekt.34 In Abgrenzung dazu begreifen die Ludologen das Computerspiel in erster Linie als
ebendies: als Spiel. Folglich betonen sie den Charakter der Spiele als Regelsysteme ohne
primär erzählerische Funktion, die konstitutiv für die Spielwelt sind.35 Entsprechend legen
29
SANDKÜHLER, Gunnar: Der Zweite Weltkrieg im Computerspiel: Ego-Shooter als Geschichtsdarstellung zwischen Remediation und Immersion, in: MEYER, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien, Frankfurt a.M. 2009, S. 55-65. 30
BENDER, Steffen: Durch die Augen einfacher Soldaten und namenloser Helden. Weltkriegsshooter als Simulation historischer Kriegserfahrung?, in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, S. 123-147. 31
THOMAS, David et al.: You Played That? Game Studies Meets Game Criticism, in: DIGRA (Hrsg.): Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory, o.O. 2009, online unter: http://www.digra.org/dl/db/09287.17255.pdf [12.06.2012]. 32
Vgl. SCHWARZ, Angela: Siegen ist erst der Anfang, S. 221. 33
Vgl. KÜCKLICH, Julian: Invaded Spaces. Anmerkungen zur interdisziplinären Entwicklungen der Game Studies, online unter: http://playability.de/pub/drafts/Invaded_Spaces.pdf [12.06.2012]. 34
Vgl. HUBERTS, Christian: Raumtemperatur. Marshall McLuhans Kategorien ›heiss‹ und ›kalt‹ im Computerspiel, Salzhemmendorf 2010, S. 9. 35
Vgl. Ebd.
7
die beiden Richtungen ihren Fokus auf das Narrativ der Spiele einerseits, andererseits auf
deren Gameplay.
Diese Arbeit versteht Narratologie und Ludologie nicht als gegensätzlich, sondern versucht,
beide Ansätze zu verbinden. In diesem Sinne werden als Weltkriegsrepräsentationen sowohl
der Spielinhalt – also die Thematik des Spiels, das Spielgeschehen, Spielraum und -figuren
sowie die Gestaltung der Aufgaben und Missionen – als auch die spielimmanenten
Regelstrukturen verstanden und entsprechend untersucht. So soll im Sinne der Ludologie
etwa gefragt werden, welche Ziele und Siegbedingungen die Spiele setzen und welche Taktik
sie zu deren Erfüllung nahelegen.
Eine detaillierte Spielanalyse kann selbstverständlich nur über den Prozess des Spielens
selbst erfolgen. Die Computerspiele, auf denen diese Untersuchung beruht, wurden daher
alle eingehend vom Autor gespielt, wobei der Fokus auf die in den Spielen angebotene
deutsche Kampagne gelegt wurde. Diese Herangehensweise, so nötig sie ist, bringt allerdings
zwei Einschränkungen mit sich. Erstens stellen die in dieser Arbeit erbrachten Ergebnisse
zwangsläufig das Resultat der vom Autor eingeschlagenen Spielweise dar und können so nur
bedingt Anspruch auf Vollständigkeit erheben,36 da es sich bei dem Medium PC-Spiel um ein
dynamisches Untersuchungsobjekt handelt, das dem Spieler (1) immer nur einen Teil seiner
Regeln und möglichen Lösungen offenbart, dessen Variablen (2) häufig dem Zufall
unterliegen und dessen Spielerfahrung (3) deshalb mit jeder begonnenen Partie stark
variieren kann:37 »I could tell the story again and again and bring the story to a variety of
conclusions.«38 Um dennoch zu gewährleisten, dass, so weit ersichtlich, alle auftretenden
Weltkriegsrepräsentationen erfasst wurden, wurde jedes Spiel über einen langen
Untersuchungszeitraum hinweg eingehend, einzelne Missionen bei Bedarf auch mehrfach,
gespielt.
Das zweite Problem liegt im Zitieren dieser Spiele. Da Computerspiele ein non-lineares
Medium darstellen, erscheint es wenig sinnvoll, diese mit Fußnote zu zitieren, da weder
Seitenzahl noch Minute o.ä. zu belegen sind. Daher wurde auf Belege mittels Fußnote
36
Vgl. MATZENBERGER, Michael: Die Zukunft der Computerspiele, Marburg 2008, S. 149. 37
Ebd. 38
ATKINS, Barry: More than a game, S. 5.
8
verzichtet; aus dem Kontext geht stattdessen hervor, auf welches Spiel sich das jeweilige
Zitat konkret bezieht. Sofern es sich nicht um ein im gesamten Spielverlauf auftretendes
Element handelt, wurde dort, wo es sinnvoll erschien, zudem die jeweilige Mission bzw. die
einschlägige Stelle im Spiel angegeben.
2.3. Quellenauswahl
Die in dieser Arbeit untersuchten Spiele sind alle dem Genre der Strategiespiele zuzuordnen.
In diesen übernimmt der Spieler in der Regel die Funktion eines Kriegsherrn, der die volle
Befehlsgewalt über ein Kontingent an Einheiten hat, welche aus der Vogelperspektive in
einem begrenzten Areal kommandiert werden. Unter den PC-Historienspielen stellen die
Strategiespiele das wichtigste Genre dar: Knapp 45 Prozent der Spiele sind ihm
zuzuordnen.39
Neben dem Genre ist allen hier untersuchten Titeln gemein, dass sie Kampagnen – mehrere
zusammenhängende Missionen im Spiel – aufseiten der Wehrmacht anbieten. Da diese
Arbeit auch nach der Rolle der Computerspiele als Sozialisatoren und ihrem Einfluss auf das
Geschichtsbild der Spieler fragt, wurden schließlich nur solche Spiele untersucht, die auch
tatsächlich ein Massenpublikum erreichen konnten, sprich, die (1) kommerziell erfolgreich
vertrieben wurden40 und (2) durch überdurchschnittlich gute Bewertungen in den
Computerspiele-Magazinen auf sich aufmerksam machen konnten. Diese Auswahl soll in den
folgenden Kapiteln kurz vorgestellt werden. Für diese Untersuchung wurden die Spiele in
ihrer ursprünglichen, im Handel erhältlichen, Version belassen – von Spielern erstellte
Inhalte fanden also keine Berücksichtigung.
Ergänzend wurden die Internetauftritte der Spiele, Beiträge von Spielern in
Diskussionsforen41 sowie die mitgelieferten Handbücher als Quellen herangezogen. Zwar
sind Letztere mit Vorsicht zu genießen, da (1) die dort beschriebenen historischen
Hintergründe nicht unbedingt in einer sichtbaren Beziehung zur tatsächlichen
39
Vgl. SCHWARZ, Angela: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft?, S. 12. 40
Daher finden sich etwa auch neonazistische Spiele wie ›Anti-Türkentest‹ (o.V., 1986) oder ›KZ Manager‹ (o.V., 1989-2000) nicht in dieser Arbeit. Diese wurden nie kommerziell vertrieben, sondern über Mailboxen getauscht. 41
Sofern diese nicht mehr aktuell waren, wurden sie über das Internet-Archiv www.archive.org abgefragt.
9
Spielgestaltung stehen42 und (2) die Spieler dazu neigen, das als Hilfestellung konzipierte
Handbuch zu ignorieren und die Spielwelt durch Learning by doing zu erkunden.43 Sie fanden
dennoch in dieser Arbeit Berücksichtigung, da gerade komplexe Spiele wie das hier
untersuchte ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ (Paradox, 2006) nicht ohne die Hinweise aus dem
Handbuch zu bewältigen sind, welches unter Spielern treffend als »the Bible«44 bezeichnet
wird.
2.3.1. ›Sudden Strike 1 & 2‹
Das Echtzeit-Strategiespiel ›Sudden Strike‹ (Fireglow Games, 2000) gehörte zu den
bestbewerteten und meistverkauften Spielen des Jahres 2000 und wurde von der GameStar
sogar zum »Strategiespiel des Jahres« gekürt.45 Ende 2000 stand das Spiel auf Platz Drei der
deutschen Verkaufscharts,46 bis 2003 wurden über eine Million Exemplare verkauft.47
Aufgrund des großen Erfolgs erschienen 2001 mit ›Sudden Strike Forever‹ sowie ›Total War‹
Spielerweiterungen, so genannte Add-Ons, die das Spiel um neue Szenarien und Einheiten
ergänzen. Hinzu kam 2002 der offizielle Nachfolger, der sich in puncto Spielgestaltung und
Grafik aber kaum vom ersten Teil unterscheidet. Dennoch konnte auch ›Sudden Strike 2‹ in
der Presse gute Wertungen verbuchen, die GameStar bewertete das Spiel etwa mit 83 von
100 möglichen Punkten.48
In ›Sudden Strike‹ hat der Spieler die Option, zwischen drei angebotenen Fraktionen zu
wählen: den Westalliierten, dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Add-On und
42
Vgl. PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer?, S. 1092. 43
ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen, online unter: http://www.f01.fh-koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_gesamtauswertung.pdf [12.06.2012]. 44
Eintrag von »Black Lotus« vom 01.06.2005, online unter: http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?179799-What-do-you-think-of-the-manual&s=ea51ac5f15a942524b30e6a8322e9094 [12.06.2012]. 45
Vgl. N.N.: Report: GameStar Awards 2000, in: GameStar 01.02.2001, online unter: http://www.gamestar.de/specials/reports/1330130/gamestar_awards_2000.html [12.06.2012]. 46
Vgl. N.N.: Sudden Strike erfolgreich, in: PC Games 07.03.2001, online unter: http://www.pcgames.de/Sudden-Strike-PC-16051/News/Sudden-Strike-erfolgreich-5890/ [12.06.2012]. 47
Vgl. N.N.: Über eine Million Exemplare verkauft. CDV mit guten Verkaufszahlen, in: Gameswelt 02.07.2003, online unter: http://www.gameswelt.at/news/72846-Sudden_Strike_-_UEber_eine_Million_Exemplare_verkauft_-_CDV_mit_guten_Verkaufszahlen_....html [12.06.2012]. 48
Vgl. SCHNELLE, Mick: Sudden Strike 2, in: GameStar 7 (2002), S. 98, online unter: http://www.gamestar.de/spiele/sudden-strike-2/test/sudden_strike_2,37403,1338267.html [12.06.2012].
10
Nachfolger ergänzen das Spiel zudem um eine spezifisch britische bzw. eine japanische
Fraktion.
2.3.2. ›Panzer General‹
Wenngleich ›Panzer General‹ (SSI, 1994) heute zu den Klassikern der rundenbasierten
Strategiespiele gehört, wurde seine Veröffentlichung in Deutschland von sehr gemischten
Gefühlen begleitet: So bewertete einerseits etwa die PC Games das Spiel mit 84 Punkten
überdurchschnittlich gut, kritisierte andererseits aber den »geschmacklose[n] Spielinhalt«.49
Dieser alarmierte auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS), die das
Spiel als jugendgefährdend indizierte, da es seine »Spieler in einen Zustand der gespannten
Erwartung des ›Endsieges‹«50 versetze.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die weitgehend offen gestaltete Kampagne von
›Panzer General‹: Ausgestattet mit dem Oberkommando über die Wehrmacht, führt der
Spieler darin seine Streitkräfte in blitzkriegartigen Feldzügen zur Weltherrschaft.
2.3.3. ›Hearts of Iron II: Doomsday‹
›Hearts of Iron II: Doomsday‹ kann als Globalstrategiespiel bezeichnet werden: Gespielt wird
es nicht in einem begrenzten Areal, sondern auf einer Weltkarte, die in über 2.500
individuelle Provinzen eingeteilt ist.51 Zu Beginn des Spiels übernimmt der Spieler die
Kontrolle eines gesamten Staates, wobei er dessen Politik, Wirtschaft und Militär quasi
alleine steuern kann. Ziel ist es, den eigenen Staat erfolgreich durch den Zweiten Weltkrieg
und die Nachkriegszeit zu führen.
Die zahlreichen Funktionen und Faktoren, die den Spielverlauf beeinflussen können, machen
›Hearts of Iron II: Doomsday‹ zu einem hochkomplexen Spiel, das einer langen Einarbeitung
49
Zit. nach: MOBYGAMES: Panzer General. The Press Says, online unter: http://www.mobygames.com/game/dos/panzer-general/mobyrank [12.06.2012]. 50
BUNDESPRÜFSTELLE FÜR JUGENDGEFÄHRDENDE SCHRIFTEN: Indizierungsentscheidung Panzer General (Auszüge), Bonn o.J., online unter: http://web.archive.org/web/20050413074646/http://snp.bpb.de/referate/bpjs_pgindex.htm [12.06.2012]. 51
Vgl. PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, o.O. 2006, S. 24.
11
bedarf und sich deshalb nicht an ein breites Massenpublikum richtet. Dennoch verfügt es
über eine treue Anhängerschaft und wurde auch von der Presse weitgehend positiv
aufgenommen; die PC Games etwa vergab 73 von 100 Punkten.52
3. Narratologische Analyse
In den folgenden Kapiteln sollen anhand verschiedener Kategorien spielübergreifend
Darstellungsweisen und Geschichtsbilder des Zweiten Weltkriegs in den untersuchten
Spielen aufgezeigt werden. Die Untersuchung bezieht sich dabei zunächst auf die
Spieloberfläche, auf das Gezeigte. Im anschließenden vierten Kapitel wird sie dann auf die
Regelstruktur der Spiele ausgeweitet.
3.1. Kontrafaktizität und Kriegsverlauf
Um überhaupt einen Anreiz zu bieten, konsumiert zu werden, müssen Computerspiele ein
entscheidendes Kriterium erfüllen: Sie müssen gewinnbar sein. Warum sollte sich ein Spieler
mehrere Stunden in ein Spiel wie ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ einarbeiten, nur um am Ende
feststellen zu müssen, dass er gar nicht gewinnen kann? – Ein Spiel muss stets ergebnisoffen
sein, der Spieler die Möglichkeit haben, mit seinem Geschick selbst über Sieg oder
Niederlage entscheiden zu können. Denn gerade im Versprechen interaktiver Eingriffs- und
Gestaltungsmöglichkeiten liegt ja das Alleinstellungsmerkmal des Computerspiels gegenüber
anderen Medien.53
Für die hier untersuchten PC-Spiele scheint sich daraus zunächst einmal ein Problem zu
ergeben, sind diese doch eigentlich an die Historie gebunden. Somit muss es für einen
Spieler wenig reizvoll erscheinen, aufseiten der Wehrmacht in den virtuellen Krieg zu ziehen,
da diese schon a priori als Verlierer feststeht. Die Spiele umgehen dieses Dilemma auf zwei
52
Vgl. N.N.: Hearts of Iron 2: Doomsday, in: PC Games 01.05.2006, online unter: http://www.pcgames.de/Hearts-of-Iron-2-Doomsday-PC-121960/Tests/Hearts-of-Iron-2-Doomsday-464470/ [12.06.2012]. 53
Vgl. BUTLER, Mark: Would you like to play a game? Die Kultur des Computerspielens, Berlin 2007, S. 81.
12
unterschiedliche Arten, die entsprechend ihrer Nähe zum realen Geschehen als linear
einerseits, andererseits als offen bezeichnet werden können.54
3.1.1. Lineare Spiele
Die hier untersuchten ›Sudden Strike‹ und ›Sudden Strike 2‹ sind den linearen Spielen
zuzurechnen. Ihnen ist gemein, dass der Verlauf ihrer Kampagnen – sprich die Abfolge der
Missionen – zwar nicht vom Spieler beeinflusst werden kann, sich im Gegenzug aber eng an
der Historie anlehnt, auch wenn die Szenarien teilweise fiktiv sind.
So bestreitet der Spieler in ›Sudden Strike‹ erst einige kleinere Scharmützel gegen die
französische Armee, ehe das Spiel ihn an die Ostfront versetzt. Dort muss er sich zunächst
via Brest den Weg nach Stalingrad bahnen, in den finalen Missionen dann eine namentlich
nicht genannte Stadt einnehmen. Die elf Missionen des Nachfolgers ›Sudden Strike 2‹
drehen sich um die Einnahme der ukrainischen Stadt Charkiw im Herbst 1941.
Die beiden Spiele behandeln nur ausschnitthafte Momentaufnahmen aus dem Zweiten
Weltkrieg, die sie nicht nur den politischen Zusammenhängen, sondern auch dem übrigen
Kriegsverlauf entrücken: Um dem Spieler das Gefühl von Erfolg zu vermitteln, enthalten die
Kampagnen überwiegend Szenarien, in denen sich die Wehrmacht auf dem Vormarsch
befindet,55 also außerhalb deutscher Grenzen in Frankreich bzw. Osteuropa Gebietsgewinne
verzeichnen kann. Diese drücken sich in ›Sudden Strike‹ etwa darin aus, dass der
Ausgangspunkt des Spielers meist im Westen des Areals, das Ziel aber im Osten liegt. Ein
Missionssieg ist dadurch auch immer automatisch mit einem Raumgewinn verbunden, was
im Übrigen mit der zeitgenössischen Frontberichterstattung in der ›Deutschen
Wochenschau‹ korrespondiert, die ebenfalls die West-Ost-Bewegung als visuelles
Stilelement nutzt. Mehrere eigentlich unabhängige Missionen vermitteln so die Illusion eines
sukzessiven Vorankommens gen Osten. Die deutsche Kampagne in ›Sudden Strike 2‹
verstärkt diesen Effekt, indem sie von der ersten Mission an das zentrale Kampagnenziel des
»We must conquer the city at any cost« in den Vordergrund stellt, die einzelnen Missionen
54
Vgl. zu dieser Terminologie auch SCHWARZ, Angela: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft?, S. 15. 55
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer, S. 110.
13
nur als Schritte dorthin betont: So geht es in den Missionen etwa darum, der 6. Armee den
Weg zur Stadt zu bahnen oder mehrere Divisionen für den bevorstehenden Angriff zu
vereinen.
Die Wehrmacht eilt in den linearen Spielen also von Sieg zu Sieg, allerdings nur in
Annäherung an die historischen Vorbilder. Was der Spieler dagegen nicht aktiv nachspielen –
und damit nicht potentiell gewinnen – darf, sind Szenarien, die in der Realität zugunsten der
Alliierten entschieden wurden. Stattdessen werden die realen Niederlagen der Kontrolle und
weitestgehend auch den Blicken des Spielers entzogen und nur am Rande behandelt. So
heißt es in einer Missionsbeschreibung in ›Sudden Strike‹ nachdem der Spieler bereits einige
Siege errungen hat: »Ihre Erfolge an der Ostfront haben Ihnen einen Heimaturlaub
eingebracht. Aber inzwischen sind unsere Truppen im Osten auf dem Rückzug und im Westen
sind die Alliierten erfolgreich gelandet.« Der Spieler ist also selbst nicht anwesend, wenn die
Wehrmacht zurückgeworfen wird. In der anschließenden zehnten Mission der Kampagne
muss er dann wiederum zum Gegenangriff ansetzen, befindet sich also abermals auf dem
Vormarsch – Gebietsverluste muss er selbst nicht miterleben. Die Kampagne in ›Sudden
Strike 2‹ dagegen ist den historischen Zusammenhängen vollkommen entrückt; hier wird mit
keinem Wort auf die (kommenden) Niederlagen und Rückschläge der Wehrmacht verwiesen,
stattdessen wurde bewusst der kleine zeitliche und räumliche Abschnitt um Charkiw
gewählt: Zu diesem Zeitpunkt, 1941, ist die Wehrmacht noch nicht in die Defensive
gezwungen, noch nicht auf deutschen Boden zurückgedrängt; das Spiel kann sie als
überlegenen Eroberer präsentieren.
3.1.2. Offene Spiele
Der Reiz der offenen Spiele, in dieser Untersuchung ›Panzer General‹ und ›Hearts of Iron II:
Doomsday‹, liegt in ihrer Kontrafaktizität56 begründet. Sie brechen mit der Prämisse der
unausweichlichen deutschen Niederlage, stellen stattdessen die Frage: Was wäre geschehen,
wenn...? – etwa die Wehrmacht Moskau 1941 eingenommen hätte – und geben dem Spieler
die Möglichkeit, durch sein Eingreifen die Kette von scheinbar zwangsläufigen
56
Zum Begriff der Kontrafaktizität vgl. grundlegend DEMANDT, Alexander: Ungeschehene Geschichte. Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn...?, Göttingen
42001.
14
Abb. 1: Kontrafaktische Geschichte: Geglückte deutsche Invasion Großbritanniens in ›Panzer General‹ (SSI, 1994).
Geschehnissen zu durchbrechen und so die Geschichte nachträglich neu zu schreiben bzw.
Enden zu produzieren, die weit vom tatsächlichen Geschehen abweichen.57
Der Kriegsverlauf in ›Panzer General‹ ist abhängig vom Erfolg des Spielers: In jedem der rund
vierzig Szenarien ist es sein Ziel, innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von Spielrunden
strategisch wichtige Punkte, in der Regel Städte, einzunehmen. Je nachdem, wie erfolgreich
er dabei ist, folgen unterschiedliche Szenarien, die sich immer mehr von den realen
Geschehnissen entfernen: Ausgehend vom Überfall auf Polen 1939 kann der Spieler etwa
weiter vorrücken nach Osten und nicht nur Stalingrad, sondern auch Moskau mit der
Wehrmacht erobern, was wiederum die Invasion der britischen Inseln und später auch einen
Angriff auf die USA erlaubt (Abb. 1).
57
Vgl. SCHWARZ, Angela: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft?, S. 15 sowie ATKINS, Barry: More than a game, S. 103.
15
Noch weniger an historische Vorgaben gebunden, ist der Kriegsverlauf in ›Hearts of Iron II:
Doomsday‹. Hier entscheidet der Spieler selbst, welchen Staaten er zu welchem Zeitpunkt
den Krieg erklärt. So ist nicht einmal vorgeben – wenn auch sehr wahrscheinlich –, dass es
überhaupt zu einem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kommt.58 An welchen Fronten
allerdings gekämpft wird, liegt allein im taktischen Ermessen des Spielers. Lediglich durch die
weltpolitische Ausgangssituation zu Beginn der Kampagne sowie unregelmäßig eingestreute
Erläuterungstexte zu realen historischen Ereignissen,59 wird die Rückbindung an die
Geschichte deutlich.
Im Gegensatz zu den linearen Spielen kalkulieren beide Titel auch eine etwaige deutsche
Niederlage ein: In ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ bestimmt, wie gezeigt, ohnehin der Spieler
über den Ausgang des Krieges, aber auch die deutlich linearere Kampagne in ›Panzer
General‹ ist nicht automatisch beendet, wenn der Spieler ein Szenario verliert; vielmehr
bewegt sich das Spiel wieder etwas weg von der kontrafaktischen Geschichtsschreibung,
denn der Spieler eröffnet damit eine Reihe von neuen Szenarien, die ihn in die Rolle des
Verteidigers am D-Day, der Operation Market Garden oder vor den Toren Berlins versetzen.
Die Wehrmacht befindet sich in diesem Handlungsstrang auf dem Rückzug, das Ziel des
Endsiegs über die USA ist nicht mehr zu erreichen, lediglich vereinzelte Siege, etwa in den
Ardennen 1944, sind noch möglich. Die Kampagne endet so aber in jedem Fall mit dem
alliierten Einmarsch in Berlin.
Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die linearen Spiele wenig Raum für Kontrafaktizität
lassen; sie erlauben nicht, dass in der Realität verlorene Schlachten im Spiel nachträglich
gewonnen werden, akzeptieren also den historischen Verlauf. Andererseits lösen sie das
eingangs erwähnte Dilemma des feststehenden Verlierers, indem sie den Fokus nur auf
siegreiche Phasen der Wehrmacht legen, im Gegenzug die deutsche Niederlage
weitestgehend ausblenden oder allenfalls beiläufig erwähnen. Der Spieler steht dabei in
keinerlei Verbindung zu den Niederlagen: Die Wehrmacht, die er kommandieren darf, ist im
Felde unbesiegt. Die offenen Spiele dagegen umgehen den historischen Verlauf, indem sie
58
Vgl. PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, S. 61. 59
Vgl. ebd., S. 23.
16
kontrafaktisch argumentieren.60 Sie nehmen zwar die Historie als Ausgangspunkt, legen den
Kriegsverlauf dann aber in die Obhut des Spielers. So können sie es sich auch erlauben, den
Spieler mit der deutschen Niederlage zu konfrontieren, denn diese wird weitestgehend
durch sein Geschick bestimmt.
3.2. Nationalsozialismus im Spiel 3.2.1. Rechtliche Grundlage
Nach § 86 und § 86a StGB ist die Verbreitung von »Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke[n],
Parolen und Grußformen« verfassungswidriger Parteien verboten und wird mit »Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe [...] bestraft«.61 Am 18. März 1998 entschied das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Grundsatzurteil, dass auch das bereits 1994
wegen Hakenkreuz-Abbildungen beschlagnahmte Computerspiel ›Wolfenstein 3D‹ (id
Software, 1992) diesen Tatbestand nach § 86a erfülle: »Wäre eine derartige Verwendung
von verbotenen Kennzeichen in Computerspielen erlaubt, dann wäre es kaum noch möglich,
einer Entwicklung zu ihrer zunehmenden Verwendung in der Öffentlichkeit
entgegenzuwirken«,62 so die Richter. Da ausgehend von diesem Urteil in der Regel schon die
kurze einmalige Visualisierung eines verfassungsfeindlichen Kennzeichens erhebliche Risiken
der Beschlagnahme und Strafverfolgung für die Spieleentwickler mit sich bringt, verzichten
die meisten Computerspiele seitdem darauf, in ihren deutschen Ausgaben national-
sozialistische Symbole abzubilden.63
›Panzer General‹ etwa verwendet anstelle der Hakenkreuzflagge eine rote Flagge mit
Eisernem Kreuz in der Mitte, ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ dagegen die schwarz-weiß-rote
Flagge des Kaiserreichs. ›Sudden Strike‹ verzichtet gar völlig auf die Abbildung jeglicher
Symbolik. Aus demselben Grund wird auch von einer Darstellung als besonders heikel
60
Vgl. auch MACCALLUM-STEWART, Esther/ PARSLER, Justin: Controversies: Historicising the Computer Game, S. 205. 61
§ 86 STGB, online unter: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html [12.06.2012]. 62
OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN: Urteil vom 18.3.1998, Az.: 1 Ss 407/97, online unter: http://www.technolex-anwaelte.de/user_data/OLG_Frankfurt_a.M._1_Ss_407_97.pdf [12.06.2012]. 63
Vgl. LIESCHING, Marc: Hakenkreuze in Film, Fernsehen und Computerspielen. Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen in Unterhaltungsmedien, in: BPJM-Aktuell 3 (2010), S. 11, online unter: http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-hakenkreuze-film-fernsehen-computerspielen-aus-03-10,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf [12.06.12] sowie PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer, S. 109.
17
geltender Persönlichkeiten abgesehen. So benennt ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ Hitler in
»Hiller« um und macht aus Himmler »Heimmler«, aus Heß »Hansen« und aus Göring
»Gorink«.64 Im Geschichtsbild der Entwickler weniger belastete NS-Zeitgenossen, etwa
Außenminister Joachim von Ribbentrop oder General Heinz Guderian, werden in den Spielen
dagegen ohne Bedenken mit ihren Originalnamen und Porträts dargestellt.
3.2.2. Darstellung nationalsozialistischer Ideologie
Symbole und Personen des Nationalsozialismus sind in den Spielen aus Angst vor
Strafverfolgung also tabu – doch auch jenseits dieser visuellen Repräsentation findet eine
Thematisierung des Nationalsozialismus so gut wie nicht statt.
Sowohl ›Panzer General‹ als auch die beiden Teile von ›Sudden Strike‹ konzentrieren sich
rein auf die militärische Ebene des Krieges: Die drei Spiele betrachten nur das jeweils
aktuelle Schlachtfeld und die Kampfhandlungen – die politische Dimension des Zweiten
Weltkriegs wird dagegen vollkommen ausgeblendet oder zu einer vagen historischen Folie
degeneriert.65 Dementsprechend findet sich in den Erläuterungstexten über den konkreten
Missionsrahmen hinaus keine Erklärung für die Handlung.66 Das erste Missionsbriefing von
›Panzer General‹ etwa erwähnt weder Anlass noch Ursache des gerade ausgebrochenen
Krieges: »September 1, 1939 – Your first mission in operation Fall Weiss, the conquest of
Poland, is to capture the key cities of Kutno and Lodz by September 10th. This keeps open the
possibility of conquering Poland before the French and British can launch an attack on
Germany.« Nur das Erreichen der Missionsziele ist entscheidend, warum etwa Frankreich
oder Großbritannien einen möglichen Angriff auf Deutschland vorbereiten, oder warum die
Wehrmacht gar in Polen einmarschiert, wird nicht gesagt.
Dass der Nationalsozialismus in diesem Spiel mit keiner Silbe erwähnt wird, bemängelte auch
die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), der ›Panzer General‹ im November 1994
64
Siehe auch BRENDEL, Heiko: Historischer Determinismus und historische Tiefe – oder Spielspaß? Die Globalechtzeitstrategiespiele von Paradox Interactive, in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Geschichte im Computerspiel, S. 117. 65
Vgl. PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer?, S. 1093. 66
Vgl. MOORSTEDT, Tobias: Der Zweite Weltkrieg in Computerspielen. Wie es wirklich nicht war, in: Süddeutsche Zeitung 19.05.2005, online unter: http://www.sueddeutsche.de/kultur/der-zweite-weltkrieg-in-computerspielen-wie-es-wirklich-nicht-war-1.438989 [12.06.12].
18
zur Prüfung vorgelegt wurde und die es als »nicht geeignet unter 18 Jahren« einstufte. In der
Begründung heißt es, sie beurteile die »Auslassung historischer Zusammenhänge und [die]
Verharmlosung der Rolle der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg [...] als sehr
problematisch und politisch desorientierend«.67 Wenig später wurde das Spiel zudem von der
BPjS indiziert, da es »kriegsverharmlosend und kriegsverherrlichend ist [...] [und] im
weitesten Sinne die Ideologie des Nationalsozialismus verharmlost wird«.68
Genau wie das Spiel, geht auch das Handbuch zu ›Sudden Strike‹ nicht auf politische Fragen
ein, stattdessen beschäftigt es sich nur mit der Steuerung der Einheiten und technischen
Details zum Spielablauf.
In einer Anzeige zu ›Sudden Strike 2‹, die das Spiel glorifizierend mit dem Slogan »Mit Dir
hätten wir jeden Krieg gewonnen ...sagt mein Opa!« bewirbt, heißt es dagegen: »In keinster
Weise sollen [...] die Greueltaten [sic!] des 2. Weltkriegs verharmlost oder verherrlicht
werden. Wir plädieren für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Geschichte und der
notwendigen Beachtung der Tatsache, dass es sich hierbei lediglich um ein taktisches
Strategiespiel handelt.«69 Auf die Dimension des Vernichtungskriegs wird zwar verwiesen,
diese wird aber als nicht relevant für das Spiel verstanden.
Ähnlich verhält es sich in ›Panzer General‹, dessen Handbuch in zwei Versionen existiert: Die
englische Originalfassung verzichtet vollkommen auf eine Erläuterung des historischen
Hintergrunds. Hier werden abermals die Spielziele betont: »Go from triumph to triumph,
invading and seizing the capitals of Great Britain, the Soviet Union, and ultimately the United
States of America on your way to conquering the whole world!«70 Welche politischen
Konsequenzen dieser Kriegsausgang im Sinne NS-Deutschlands gehabt hätte, bleibt durch
die Nichterwähnung belanglos.71 Dagegen wurde dem deutschen Handbuch – wohl aus
Angst vor der Indizierung – ein kurzer historischer Abriss des Kriegsverlaufs vorangestellt,
der immerhin auch die Vernichtung der europäischen Juden erwähnt und den
67
Zit. nach: BUNDESPRÜFSTELLE FÜR JUGENDGEFÄHRDENDE SCHRIFTEN: Indizierungsentscheidung Panzer General (Auszüge). 68
Ebd. 69
Werbeanzeige zu ›Sudden Strike 2‹, abgedruckt in: GameStar 6 (2002), S. 53. 70
STRATEGIC SIMULATIONS, INC.: Panzer General, o.O. 1994, S. 4. 71
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer, S. 110 f.
19
Nationalsozialismus als Terrorregime verurteilt: »Weltweit über 50 Millionen Opfer, darunter
die Hälfte Zivilisten, waren die schreckliche Bilanz eines Krieges, der zugleich eine letzte
Konsequenz aus dem Sieg eines totalitären Systems über den demokratischen Rechtsstaat
war.«72 Mehr als dieses kurze Lippenbekenntnis wird indes nicht über den
Nationalsozialismus verloren,73 zumal sich im Spiel selbst keine vergleichbare kritische
Betrachtung findet.
Ganz anders die Darstellung des Nationalsozialismus in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ (Abb.
2): Hier wird die politische Ausrichtung jedes Landes anhand sieben »innenpolitischer
Grundsätze«74 bestimmt, die sich jeweils zwischen zwei Extremen bewegen.
Deutschland wird demnach als »Nationalsozialist« bezeichnet. Seine (1) Regierungsform ist
autokratisch, die Minister im Kabinett werden nach (2) ihrer Ideologie bestimmt, in diesem
Fall extrem rechts. Die (3) Gesellschaft ist weitestgehend unfrei, was Unruhen in den
eigenen Provinzen verhindert, die (4) Wirtschaft dagegen besteht aus einer Mischung aus
freiem Markt und Planwirtschaft. Das (5) Verteidigungskonzept beruht größtenteils auf
einem stehenden Heer und auf einer (6+7) interventionistischen Angriffspolitik, die es
erlaubt, Kriege zu erklären, ohne Unruhen in der Gesellschaft fürchten zu müssen.
Ebenfalls einzigartig ist die Darstellung Adolf Hitlers – bzw. »Albert Hillers« – als
»rätselhafte[s] Staatsoberhaupt in Berlin« mit einem »teuflischen Charme, der die
frustrierten Massen verzaubert.« Hitler wird hier als »machthungrige[r] Demagoge«
charakterisiert, der »nur ein Ziel [hat], und das ist es, die Welt zu beherrschen und nach
seinen Wünschen zu formen.« Diese Charakterisierung deckt sich mit vor allem bis in die
1970er Jahre populären geschichtswissenschaftlichen Ansätzen des »Hitler-Zentrismus« (Ian
Kershaw), die die Persönlichkeit Hitlers und seine Ideologie zum zentralen Gegenstand ihrer
Interpretation des Nationalsozialismus machen.75 Gleichzeitig scheinen in dieser Darstellung
72
Zit. nach: BUNDESPRÜFSTELLE FÜR JUGENDGEFÄHRDENDE SCHRIFTEN: Indizierungsentscheidung Panzer General (Auszüge). 73
Vgl. PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer?, S. 1092. 74
Vgl. PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, S. 8. 75
Vgl. KERSHAW, Ian: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretation und Kontroversen im Überblick, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 127-130.
20
Abb. 2: Nationalsozialistische »Grundsätze« und Machthaber in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ (Paradox, 2006).
im Spiel auch psychohistorische Ansätze durch, die in Hitler einen »verbitterte[n]
rachedurstige[n] und hasserfüllte[n] Mann« erblicken. Gleichwohl zeigt das Spiel an anderer
Stelle auch Anerkennung der Person Hitler als »schillernde[n] Held« sowie »geborene[n]
Führer und [...] echte[n] Kämpfer.« Wieder wird hier auf seine Programmatik eingegangen,
diese allerdings wird im Vergleich zum obigen Zitat als deutlich flexibler – wenn auch ebenso
konsequent – dargestellt: »Er wird versuchen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, wenn es
nicht anders geht [sic!] kämpft er jedoch bis zum bitteren Ende.«
Von allen untersuchten Spielen ist ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ das einzige, das sich mit
dem Nationalsozialismus auseinandersetzt und versucht, dessen politische und
gesellschaftliche Charakteristika einzufangen. Doch auch hier ist die NS-Ideologie nicht
handlungsleitendes Paradigma, sondern allenfalls Beiwerk, denn die dargestellten
»Grundsätze« sind nur in einem Fenster, dem Diplomatie-Bildschirm, zu sehen. Ohnehin
haben sie wenig Auswirkungen auf das Spiel, denn sie verteilen nur in geringem Ausmaß
21
Boni oder Strafpunkte für bestimmte Handlungsoptionen76 und beeinflussen einzig die
Diplomatie nachhaltig. Die Effekte auf das innenpolitische Klima oder die Kampfkraft der
eigenen Armee sind dagegen marginal und für den Spieler kaum ersichtlich, zumal die sieben
voreingestellten »Grundsätze« vom Spieler auf Reglern verändert werden können und
dadurch zur reinen Makulatur degeneriert werden, genauso wie die Person Hitler, der der
Spieler außerhalb des Diplomatie-Bildschirms ebenfalls nicht begegnet.
3.2.3. Verhältnis der Wehrmacht zum Nationalsozialismus
Die Wehrmacht steht in den Spielen in keiner sichtbaren Verbindung zum
Nationalsozialismus. Weder die Missionstexte noch die von deutschen Soldaten im Spiel
geäußerten Dialogzeilen lassen einen ideologischen Hintergrund vermuten; und auch die
Spielziele werden nicht ideologisch begründet. Daher ist für die Entwickler auch die
heroisierende Darstellung der Wehrmachtsgeneräle, etwa Guderian oder Rommel,
unbedenklich, da diese als unbelastet erscheinen. Als militärische Helden tauchen sie an
einigen Stellen in den Spielen auf. In ›Panzer General‹ ist es etwa die Figur des Heinz
Guderian, dessen Beiname nicht nur namensgebend für das Spiel war, sondern der auch in
Spiel und Handbuch mittels Bildern repräsentiert wird. Der Spieler selbst wird in Guderians
Rolle versetzt: »Imagine that you are the Panzer General. You are the brightest and best of
the new Axis generals in the Second World War. […] Can you achieve a place in history?«77
Guderian, der sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat – nun soll der Spieler
es ihm gleichtun. Auch in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ umgibt die ca. 300 mit Originalnamen
und Portrait abgebildeten Wehrmachtsgeneräle eine gewisse Aura, die über den Erfolg ihrer
Einheiten entscheiden kann: »Es gibt noch einen weiteren Wert, [...] der die Fähigkeit des
Offiziers nach seinen historischen Leistungen bemisst«,78 womit allerdings allein seine
militärischen Erfolge gemeint sind. Zudem kann im Spiel jeder »Offizier [...] einer bestimmten
Doktrin zusprechen oder einen Expertenbereich haben«,79 der weitgehend populären
Vorstellungen über die historischen Vorbilder entspricht, so besitzt etwa Guderian, der im
76
Vgl. PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, S. 8. 77
STRATEGIC SIMULATIONS, INC.: Panzer General, S. 4. 78
PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, S. 86. 79
Ebd.
22
Spiel ab 1942 zur Verfügung steht, die Fähigkeiten »Panzerkommandeur« und »Schlitzohr«,
genauso wie Rommel, der zudem als »Logistik-Genie« eingestuft wird.
Die Person Hitler dagegen wird als Hemmnis der Wehrmacht dargestellt. So wird der
Eindruck vermittelt, er selbst mische sich regelmäßig in die Kriegstaktik ein um diese zu
steuern: »Seine Kreativität sorgt jedoch dafür, dass er manchmal auch schlechte Ideen hat,
die er dann mit aller Macht verteidigt«, was freilich im Spiel nicht zutrifft, hat dort doch der
Spieler den Oberbefehl über sämtliche Kampfverbände. Dennoch bescheinigt ›Hearts of Iron
II: Doomsday‹ Hitler einen negativen Effekt auf seine Generalität, senkt er deren »Fähigkeit
und Effizienz« doch um 10 Prozent.
Einen einzigen kleinen Hinweis auf eine politische Dimension der Wehrmacht geben die
roten Binden in ›Sudden Strike‹, die die Offiziere am Arm tragen. An dieser Stelle sei auch
verwiesen auf das hier nicht weiter untersuchte Spiel ›Company of Heroes‹ (Relic
Entertainment, 2006), in dessen englischer Sprachversion die Angehörigen der Wehrmacht
als »Nazis« bezeichnet werden. Dieser Begriff wurde in der deutschen Version jedoch
weitgehend gestrichen und durch »Die Deutschen«, »Armee der Deutschen« ersetzt.80 Es ist
zu vermuten, dass diese Änderungen keinen Einzelfall darstellen. Sie zeigen, dass –
zumindest für den deutschen Markt – bewusst versucht wird, die Wehrmacht vom
Nationalsozialismus abzugrenzen.
3.3. Darstellung des Kriegsalltags 3.3.1. Kriegsverbrechen und Vernichtungskrieg
Die beiden hier untersuchten linearen Spiele, genauso wie ›Panzer General‹, beschränken
ihre Szenarien auf räumlich abgegrenzte Areale, in denen die Kampfhandlungen stattfinden.
Diese sind zwar eigentlich als Repräsentation der realen Schauplätze angelegt, erwecken
jedoch mehr den Eindruck von Kampfarenen, da in ihnen einzig die beiden verfeindeten
Parteien aufeinandertreffen. Zivilisten dagegen werden in den Spielen nicht dargestellt; die
Straßen Charkiws in ›Sudden Strike 2‹ etwa sind menschenleer, wodurch das Agieren des
Spielers auf dem Schlachtfeld weitgehend konsequenzenlos wird: So kann er mit Artillerie
80
ONLINE GAMES DATENBANK: Company of Heroes, online unter: http://www.onlinegamesdatenbank.de/index.php?section=game&gameid=12891 [12.06.2012].
23
oder Fliegerbomben ganze Städte in Schutt und Asche legen, im Wissen, nur feindliche
Soldaten, jedoch keine Zivilbevölkerung getroffen zu haben.
Die Kriegsführung der Wehrmacht erscheint daher nicht als besonders barbarisch, sondern
entspricht vielmehr den Methoden aller im Spiel vertretenen Parteien. Durch das Fehlen der
Zivilbevölkerung werden zudem die von der Wehrmacht begangenen Kriegsverbrechen
ausgeblendet. Besonders eindrücklich beweist dies die Kampagne von ›Sudden Strike 2‹: Ziel
ist hier das Nachspielen der Eroberung Charkiws durch die Wehrmacht. Deren reales
Pendant wurde in der Ausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–
1944«, (1995-1999) als Beispiel für die deutsche Besatzungspolitik aufgeführt: Kurz nach der
Einnahme Charkiws im Oktober 1941 ließ das als Stadtkommandantur eingesetzte LV.
Armee-Korps Zivilisten verhaften und in den Straßen der Stadt aufhängen, ab Dezember
1941 wurden dann 20.000 jüdische Einwohner erschossen oder mittels Gas ermordet. Die
Beschlagnahmung privater Lebensmittelvorräte zur Versorgung der Wehrmacht löste zudem
eine Hungerkrise in der Bevölkerung aus, so der Befund der Ausstellung.81 Drei Jahre nach
deren Ende zeichnet ›Sudden Strike 2‹ ein ganz anderes Bild der Eroberung: Hier – genau wie
in allen anderen Missionen – endet das Spiel mit der Einnahme des Kampfgebietes; über die
folgende Besatzungspolitik der Wehrmacht, etwa die Säuberungsmaßnahmen oder
Bandenunternehmen, erfährt der Spieler dagegen nichts.82
Gleiches gilt für ›Hearts of Iron II: Doomsday‹, wo der Spieler in den besetzten Gebieten
zwar Wehrmachtseinheiten zur Bekämpfung von Partisanen einsetzen kann, jedoch nicht
gezeigt wird, mit welchen Mitteln dies geschieht. In ›Sudden Strike‹ dagegen erscheinen
diese nur in der Einzelmission »Partisanen«, werden dort allerdings als reguläre
Armeeeinheiten dargestellt und entsprechend bekämpft. Die Wehrmacht erscheint so als
normale und saubere Armee, die von den sowjetischen oder amerikanischen Streitkräften
nur durch ihre Uniformen und Fahrzeuge zu unterscheiden ist.
81
Vgl. BOLL, Bernd / SAFRIAN, Hans: Die 6. Armee. Unterwegs nach Stalingrad. 1941 bis 1942, in: HEER, Hannes (Hrsg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg 1996, S. 96-100. Siehe auch: ANGRICK, Andrej: Das Beispiel Charkow. Massenmord unter deutscher Besatzung, in: HARTMANN, Christian / HÜRTER, Johannes / JUREIT, Ulrike: Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte, München 2005, S. 117-123. 82
Siehe zum Beispiel Charkiw auch KUSENBERG, Peter: Endsieg der Enkel sowie GIESELMANN, Hartmut: Spielplatz Zweiter Weltkrieg.
24
Wie zu erwarten, wird auch der Holocaust in den untersuchten Spielen nicht thematisiert,
wenngleich, wie erwähnt, das deutsche Handbuch von ›Panzer General‹ eine Passage dazu
enthält. Für die ›Sudden Strike‹-Erweiterung ›Total War‹ dagegen war ursprünglich eine
Mission angekündigt, in der der Spieler als Befehlshaber über alliierte Streitkräfte ein
Konzentrationslager befreien kann,83 für die DVD-Veröffentlichung wurde dieses Szenario
letztendlich allerdings doch nicht verwendet, womit auch in diesem Spiel nichts auf die
deutsche Vernichtungspolitik hindeutet.
3.3.2. Die SS im Spiel
In der Regel kämpfen in den untersuchten Spielen auf deutscher Seite reguläre
Truppenverbände der Wehrmacht; Verbände der SS, Einsatzgruppen oder Polizeibataillone
kommen dagegen kaum vor.84 Dort wo die SS gezeigt wird, erscheint sie mehr oder weniger
als normale Truppe: So kann der Spieler in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ etwa die »SS-
Verfügungsdivision« im Krieg wie jede reguläre Einheit der Wehrmacht einsetzen. Im realen
Weltkrieg sollten Angehörige dieser Division im Juni 1944 in der französischen Ortschaft
Tulle 99 Gefangene hängen lassen und wenige Tage später in Oradour-sur-Glane bei einer
»Vergeltungsaktionen« nahezu die gesamte Dorfbevölkerung erschießen.85 Ihr Pendant im
Spiel zeichnet sich weder durch besondere Härte noch durch besondere Stärke gegenüber
den Wehrmachtsverbänden aus, die Verbrechen bleiben unerwähnt.
Die Person Heinrich Himmler wird dagegen trivialisiert, indem er als umso verbrecherischer
beschrieben wird: »Der Fürst des Schreckens lebt nach dem Motto: Besser gefürchtet als
geliebt zu werden. Extreme Gewalt kann jedoch Volkes Unmut auch steigern, eine Tatsache,
die der Fürst des Schreckens nicht sieht.« Was genau aber seine Taten sind, bleibt nebulös.
Wenigstens in einem Text zum Tode Reinhard Heydrichs im simulierten Jahr 1942 wird das
Spiel konkreter, indem es auf dessen »blutige Herrschaft« verweist, sowie darauf, dass
»15.000 Tschechen bei der Vergeltungsaktion [für seinen Tod, d.A.] ums Leben kamen.«
Diese konkrete Nennung von Taten bleibt jedoch ein Einzelfall.
83
Vgl. DONATH, Andreas: Spieletest. Sudden Strike Add-On Total War, in: Golem 19.06.2001, online unter: http://www.golem.de/0106/14420.html [12.06.2012]. 84
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer, S. 117. 85
Vgl. STEIN, George H.: The Waffen SS. Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, Ithaca (New York) 1966, S. 276.
25
Abb. 3: »Deutsche Elitesoldaten« (eigene Hervorhebung): SS und Wehrmacht vereint in ›Sudden Strike‹ (Fireglow Games, 2000).
Auch in ›Sudden Strike 2‹ wird die SS namentlich genannt: So muss der Spieler in einer
Mission seine Truppenteile mit der berüchtigten »SS-Division Totenkopf« zusammenführen,
die ihn beim bevorstehenden Angriff auf Charkiw unterstützen soll. Das Kommando über die
SS-Truppen übernehmen, darf er dort allerdings nicht. Dies geht wiederum in ›Sudden
Strike‹ (Abb. 3), wo die SS abermals als normale Einheit erscheint und Seite an Seite mit den
Wehrmachtssoldaten an vorderster Front kämpft. Die »deutschen Elitesoldaten«, wie die SS-
Angehörigen im Spiel genannt werden, unterscheiden sich von Letzteren lediglich durch ihre
dunkleren Uniformen und besseren Fähigkeiten, nicht aber durch ihre Handlungen.
3.3.3. Zivilgesellschaft und Totaler Krieg
Ebenso wie die politische, findet auch die gesamtgesellschaftliche Dimension nur bedingt
Eingang in die Spiele. Dort, wo der Zweite Weltkrieg auf militärische Operationen reduziert
26
wird, in ›Sudden Strike‹ und ›Sudden Strike 2‹, existiert keine zivilgesellschaftliche Ebene.86
›Panzer General‹ dagegen beruht auf pseudo-innenpolitischen Mechanismen: Wichtigste
Ressource im Spiel ist das »Prestige« des Spielers, das durch erfolgreiche Gefechte vermehrt
werden kann, im Gegenzug aber durch Niederlagen wieder verloren geht.87 Als
Währungsersatz kann er Prestigepunkte nicht nur gegen neue Einheiten eintauschen,
sondern mit ihnen auch beschränkten Einfluss auf zentrale operative Entscheidungsprozesse
nehmen.88 Damit impliziert ›Panzer General‹ ein System gesellschaftlicher Anerkennung, das
militärische Erfolge nicht nur besonders goutiert, sondern geradezu verlangt. So vage das
»Prestige« im Spiel gehalten ist, lässt es damit doch Rückschlüsse auf eine bellizistische, auf
den Totalen Krieg eingestellte, Gesellschaft zu.
Noch deutlicher wird dies in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹, wo der Zweite Weltkrieg vollends
als die Zivilgesellschaft umfassender Totaler Krieg erscheint. So sind im Spiel die gesamte
Ökonomie und Forschung auf den Krieg ausgerichtet: Der Bau von Fabriken genauso wie
internationale Handelsabkommen etwa erfolgen einzig zum Zweck der Rohstoffgenerierung
für die Produktion. Diese wiederum beschränkt sich auf Heeres-, Luftwaffen- und
Marineeinheiten. Auch geforscht werden kann nur im militärischen Bereich, vorzugsweise an
der Weiterentwicklung von Waffensystemen, wobei sich unter den Forschungseinrichtungen
im Spiel auch die stark belastete IG Farben findet.
Die Zivilgesellschaft dagegen spielt zumindest in der virtuellen Diktatur eine untergeordnete
Rolle: Äußert sie sich in Demokratien immerhin noch durch Wahlen, macht sie sich hier nur
durch Unruhen bemerkbar, deren Rolle im Spiel allerdings zu vernachlässigen ist. So droht
das Handbuch zwar, dass »die Möglichkeit [besteht], dass die Unruhe ein Ausmaß annimmt,
an dem die Öffentlichkeit eine offene Rebellion startet«,89 im Spiel ist dieser Faktor aber
marginalisiert und fällt allenfalls in besetzten Gebieten ins Gewicht, wo ziviler Ungehorsam
und Partisanenaktivitäten das Potential haben, die Produktivität – und damit wiederum die
Kriegswirtschaft – zu hemmen.
86
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Wenn Geschichte keine Rolle spielt, S. 136. 87
Vgl. STRATEGIC SIMULATIONS, INC.: Panzer General, S. 7. 88
Vgl. PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer?, S. 1096 f. 89
PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, S. 59.
27
4. Ludologische Analyse
Computerspiele sind regelbasiert:90 Die Regelstruktur umfasst die Möglichkeiten und
Grenzen des Spiels, sie bestimmt die Spielziele und wie diese zu erreichen sind. Diese Regeln
kann der Spieler – im Unterschied zu herkömmlichen Formen des Spiels91 – im PC-Spiel nicht
selbst aushandeln; sie werden vom jeweiligen Spiel vorgegeben.92 Dementsprechend
werden in diesem Kapitel die Ziele und Siegbedingungen, die die Spiele setzen, untersucht.
Gleichzeitig wird aufgezeigt, mit welchen Taktiken diese zu erreichen sind.
4.1. Spielziele
Allen hier untersuchten Spielen ist gemein, dass sie als oberstes Ziel Expansion fordern: Sei
es die Eroberung der sowjetischen Städte in ›Sudden Strike‹ oder die Erringung der
Weltherrschaft in den offenen Spielen, die Siegbedingungen sind immer an die Einnahme
von Gebieten im Besitz des Gegners geknüpft; fallen diese nicht in die eigenen Hände, kann
das Spiel nicht gewonnen werden: »Ziel des Spiels ist es zu expandieren«, heißt es in ›Hearts
of Iron II: Doomsday‹, »Gewinnen kann nur, wer sein Gebiet ausweitet und Krieg führt.« Der
Kern der Spiele liegt damit – dem Genre gerecht werdend – im Führen von Kriegen (Abb. 4).
Der Erfolg dort bestimmt dann den Erfolg im Spiel. In ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ etwa
gewinnt, wer bis ins simulierte Jahr 1953 die meisten Provinzen eingenommen hat. Mit
diplomatischen Mitteln lässt sich das Spiel dagegen nicht gewinnen. Auch in ›Sudden Strike‹
und ›Panzer General‹ werden diese nicht als mögliche Lösungsstrategien angeboten; dort
beschränkt sich die Zielsetzung ebenfalls eindimensional auf den unausweichlich
erscheinenden Krieg.
4.2. Kriegstaktik
Während die anderen Spiele es dem Spieler weitgehend offen lassen, mit welcher Taktik er
die einzelnen Ziele erreichen kann, wird seine Taktik in ›Panzer General‹ im Wesentlichen
90
Vgl. JUUL, Jesper: The Game, the Player, the World. Looking for a Heart of Gameness, in: KAMINSKI, Winfred (Hrsg.): Clash of Realities 2008, S. 30. 91
Vgl. HUIZINGA, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek bei Hamburg 21
2009, S. 20. 92
Vgl. SICART, Miguel: The ethics of computer games, Cambridge 2009, S. 27.
28
durch die zeitkritische Komponente der einzelnen Missionen bestimmt. Da ihm jeweils nur
eine sehr knapp bemessene Anzahl an Spielrunden zur Verfügung steht – in der ersten
Mission, dem Überfall auf Polen, sind es zehn, bei der finalen Einnahme Washingtons 22
Runden –, in dieser Zeit aber große Distanzen zu überbrücken und gleichzeitig mehrere
strategisch wichtige Punkte einzunehmen sind, erweist sich eine blitzkriegartige Taktik als
einziges probates Mittel: So kann der Spieler die vorgeschriebene Rundenzahl nur einhalten,
wenn mit jeder Spielrunde auf breiter Front aggressiv vorgerückt, feindliche Stellungen
gleichzeitig innerhalb kürzester Zeit eingenommen werden. Schafft er es, das Missionsziel
sogar in kürzerer Zeit einzunehmen, kann er sich zusätzliches »Prestige« verdienen; lässt er
sich dagegen auf einen Stellungskrieg ein, bleiben ihm nicht genügend Spielrunden, das
Missionsziel noch zu erreichen. Entsprechend wird der Blitzkrieg als siegbringende Taktik
auch im Handbuch von ›Panzer General‹ propagiert und gleichzeitig Tipps gegeben, wie
dieser zu gewinnen sei: »Blitzkrieg (not sitzkrieg) – breakthrough and bypass strongpoints
rather than getting bogged down«,93 weshalb die BPjS mutmaßte, »dieses Handbuch
[könnte] in Verbindung mit dem Spiel als ein Lehrbuch zur Führung des Zweiten Weltkrieges
angesehen werden« und verstoße sogar gegen Artikel 26 des Grundgesetzes, da es einen
Angriffskrieg befürworte. Auch die USK kritisierte die »›Blitzkrieg‹-Version des
›Karrieremodus‹« als unkritische Übernahme »der Rolle des deutschen Aggressors im
Zweiten Weltkrieg«.94
4.3. Vernichtung des Gegners
Während in ›Panzer General‹ gegnerische Einheiten nicht zwingend bekämpft, sondern auch
umgangen werden können um das Missionsziel zu erreichen, sind die Siegbedingungen in
den beiden ›Sudden Strike‹-Teilen immer an die vollständige Vernichtung des Gegner
geknüpft, was bedeutet, dass stets alle im Spielareal befindlichen gegnerischen Einheiten
getötet bzw. zerstört werden müssen. Dies gilt selbst dann, wenn die anderen Missionsziele
schon erreicht sind. In ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ gehört die Vernichtung des Gegners
zwar nicht zwingend zu den Siegbedingungen, ein vollständiger Sieg über einen gegnerischen
Staat und damit die Akquise seiner Provinzen kann jedoch nur sichergestellt werden, wenn
93
Vgl. STRATEGIC SIMULATIONS, INC.: Panzer General, S. 52. 94
Zit. nach: BUNDESPRÜFSTELLE FÜR JUGENDGEFÄHRDENDE SCHRIFTEN: Indizierungsentscheidung Panzer General (Auszüge).
29
Abb. 4: Spielziel Expansion in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ (Paradox, 2006): Das Deutsche Reich (grau) weitet sein Gebiet aus.
dessen Einheiten vollständig vernichtet wurden, da sie sonst mit der schrittweisen
Rückeroberung der besetzten Gebiete beginnen können. Die Möglichkeit, Gefangene zu
nehmen, besteht dagegen in keinem der Spiele.
5. Rezeption des Geschichtsbildes
Ausgehend von den obigen Ergebnissen soll in diesem Kapitel gefragt werden, ob die
untersuchten Spiele tatsächlich einen Einfluss auf das Geschichtsbild ihrer Spieler haben – ob
sie also fähig sind, dieses mit ihren aufgezeigten Weltkriegsrepräsentationen zu prägen. Wie
in 5.1. zu zeigen ist, haben die bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten diese Frage eher
stiefmütterlich behandelt und sind empirische Belege schuldig geblieben. Natürlich kann
auch die vorliegende Arbeit aufgrund ihres geringen Umfangs diese Leistung nicht erbringen.
Dennoch soll im Folgenden wenigstens in Ansätzen versucht werden, diese Frage anhand
von Beiträgen der Spieler in Internet-Diskussionsforen zu beantworten.
30
5.1. Forschungsstand
Die bisher zu Geschichtsrepräsentationen im Computerspiel veröffentlichten Studien sind
sich größtenteils darin einig, dass PC-Spiele als massenwirksame Produzenten und Vermittler
von Geschichtsbildern zu identifizieren sind,95 da sie zum »heimlichen Lehrplan« einer
Gesellschaft zählen.96 Pöppinghege etwa vermutet, dass »vorhandene Geschichtsbilder durch
das Nachspielen am Bildschirm verstärkt werden und somit eine individuelle
Sinnesproduktion stattfindet«.97 Ungeachtet dieser Erkenntnis kann auch er keinen
empirischen Beleg dafür bringen, wie die transportierten Inhalte rezipiert werden und wie
die Rezeption der narratologischen und ludologischen Spielelemente im Einzelfall aussieht;
er bezieht sich in seiner Untersuchung ebenfalls auf ausgewählte Foreneinträge. Jürgen Fritz
et al. dagegen können wenigstens in Ansätzen eine fundierte Untersuchung vorweisen; sie
befragten 80 Interviewpartner zu deren Spielerfahrungen mit ›Sudden Strike‹ und anderen
Titeln.98
Dass der »heimliche Lehrplan« der PC-Historienspiele wirkungsvoll ist, entspricht auch den
Annahmen anderer Historiker.99 Da methodisch abgesicherte Untersuchungen zu PC-Spielen
bisher allerdings größtenteils ausblieben, lohnt ein Blick auf Studien, die die Rezeption von
im Fernsehen vermittelten Geschichtsbildern untersuchen. Sönke Neitzel etwa kann in einer
Betrachtung der TV-Dokumentation ›Die Wehrmacht – eine Bilanz: Wende des Krieges‹ (ZDF,
2007), die er 113 Schülern und Studierenden vorführte, nachweisen, dass diese »einen
starken Einfluss auf die Kenntnisse von ausgewählten historischen Fakten [hat]. Der
Vermittlungseffekt ließ mit der Zeit nach, war teilweise aber nach drei Monaten noch
nachweisbar.«100 Außerdem geht er davon aus, dass »der Einfluss von Fernsehsendungen auf
95
Vgl. SCHWARZ, Angela: Siegen ist erst der Anfang, S. 218. 96
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Pedanterie im Cyberspace. Zum Geschichtsbewusstsein von Computerspielern, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 7/8 (2011), S. 459. 97
Ebd., S. 467. 98
FRITZ, Jürgen / WITTING, Tanja / KRAAM-AULENBACH, Nadia: Einführung in das Forschungsprojekt, online unter: http://www.f01.fh-koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_einfuehrung.pdf [12.06.2012] sowie ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen. 99
Vgl. SCHWARZ, Angela: »Wollen Sie wirklich nicht weiter versuchen, diese Welt zu dominieren«. Geschichte in Computerspielen, in: KORTE, Barbara/ PALETSCHEK, Sylvia (Hrsg.): History Goes Pop, S. 316. 100
NEITZEL, Sönke: Geschichtsbild und Fernsehen. Ansätze einer Wirkungsforschung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 9 (2010), S. 492.
31
das Geschichtsbild jüngerer Zuschauer größer ist als auf das älterer.«101 In eine ähnliche
Richtung geht Björn Bergold, der anhand des Spielfilms ›Die Flucht‹ (ARD, 2007) zeigt, dass
durch die negative Repräsentation der Roten Armee im Film dieser »eine asymmetrische
Bewertung der Roten Armee und der deutschen Wehrmacht zu begünstigen [schien]«,102 da
im Anschluss von den Zuschauern »Vergewaltigungen deutscher Frauen durch die Rote
Armee [...] doppelt so häufig genannt [wurden] […] wie etwa der [...] Mord an Zivilisten durch
die deutsche Wehrmacht.«103 Welzer et al. weisen zudem darauf hin, dass in ihren mit
Nachkommen der Weltkriegsgeneration geführten Interviews »besonders Spielfilmen oder
Fernsehserien [...] die Rolle zukommt, als Belege für historische Wirklichkeit zu fungieren.«104
5.2. Untersuchung ausgewählter Foreneinträge 5.2.1. Grundlegende Überlegungen
Untersucht man nun die Foreneinträge, sind einige Einschränkungen zu beachten. In der
Regel werden in den Foren vordergründig taktische und technische Fragen zu den Spielen
behandelt, etwa bezüglich der Spielinstallation. Die Anzahl der Foreneinträge, in denen
tatsächlich über Geschichte diskutiert wird ist (1) deutlich geringer und steht (2) meist nicht
in direktem Zusammenhang zum Spiel. Diese Einträge sind daher nur sehr bedingt dienlich,
da nicht ersichtlich ist, ob sich das darin dargebotene Geschichtsbild nun aus dem
Spielerlebnis oder aus dem Vorwissen des Spielers generiert. In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass deren Rezeptionskompetenz stark vom sozialen Kontext und ihrem
Bildungsstand abhängt.105 Mit höherem Bildungsgrad und größerem Vorwissen steigt in der
Regel auch die Fähigkeit, die Inhalte kritisch zu beurteilen.106
Auch ist davon auszugehen, dass die Diskussionsteilnehmer sich intensiv mit den Spielen
auseinandergesetzt haben, in den Foren daher nicht die Durchschnittsspieler repräsentiert
101
NEITZEL, Sönke: Geschichtsbild und Fernsehen, S. 490. 102
BERGOLD, Björn: »Man lernt ja bei solchen Filmen immer noch dazu«. Der Fernsehzweiteiler ›Die Flucht‹ und seine Rezeption in der Schule, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 9 (2010), S. 514. 103
Ebd., S. 508. 104
WELZER, Harald / MOLLER, Sabine / TSCHUGGNALL, Karoline: »Opa war kein Nazi«. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt a.M.
32002, S. 129.
105 Vgl. MATZENBERGER, Michael: Die Zukunft der Computerspiele, S. 141.
106 Vgl. NEITZEL, Sönke: Geschichtsbild und Fernsehen, S. 496.
32
sind, über die sich so keine Aussage treffen lässt.107 Dies gilt ebenso für die Frage, wie
einzelne Elemente konkret frequentiert und rezipiert werden: Werden etwa die
Missionstexte oder das Handbuch tatsächlich mehrheitlich gelesen? Auch darauf kann keine
klare Antwort gegeben werden.
5.2.2. Motivation und Rezeptionskompetenz
Um die Frage nach Effekten auf das Geschichtsbild angehen zu können, ist entscheidend,
welche Motivation und welches Vorwissen die Spieler mitbringen. Hier ist zunächst einmal
festzustellen, dass die Möglichkeit, auf deutscher Seite zu spielen unter einigen Spielern
offensichtlich als Kaufargument verstanden wird: »wenn es keine Deutsche Kampagne gibt,
wird das [Spiel] eben nicht gekauft – ganz einfach.«108 Trotz dieser Aussage scheint der
»Endsieg der Enkel«, also eine geschichtsrevisionistische Motivation, nur für einen geringen
Teil der Spieler Anlass zu sein, auf deutscher Seite zu spielen. Im Gegenteil distanzieren sich
viele Spieler davon, nazistisches Gedankengut mit ihren Spielpräferenzen zu verbinden: »nur
weil man eventuell bei einem Computerspiel die Deutsche Seite spielen kann ist man noch
lange kein Nazi.«109 Zu ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ etwa sagt einer der Spieler aus, er
spiele zwar gerne auf deutscher Seite, »[a]ber ich mag die ganzen Nazi-Bonzen nicht. Also DR
[Deutsches Reich, d.A.] mit Hitler und Co hat für mich keinen Reiz.«110 Auch zu ›Sudden
Strike‹ gab nur einer der Befragten von Fritz et al. an, die historische Entwicklung im Spiel
zugunsten der Deutschen beeinflussen zu wollen: »Wenn man die Deutschen in der Schlacht
zu Stalingrad spielt, [...] dann spielt man die auch, damit die Deutschen am Ende doch
gewinnen. Das ist auf jeden Fall auch ein Reiz für mich und das macht mir auch Spaß.«111
Diese Haltung stellt auch in den Foreneinträgen eine Ausnahme dar, wogegen die
Kontrafaktizität des Szenarios im Allgemeinen als motivierend genannt wird: »Richtig gut
fand ich es [in ›Panzer General‹, d.A.] die Geschichte neu zu schreiben und auch mal Amerika
107
Vgl. PÖPPINGHEGE, Rainer: Pedanterie im Cyberspace, S. 460. 108
Eintrag von »geschichtsmediziner« vom 19.01.2011, online unter: http://forum.golem.de/kommentare/games/il-2-sturmovik-kampf-ueber-den-klippen-von-dover/deutscher-will-deutschen-spielen/48430,2621246,2621246,read.html [12.06.2012]. 109
Eintrag von »Leon« vom 31.08.2004, online unter: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=87153 [12.06.2012]. 110
Eintrag von »Vampy« vom 04.12.2007, online unter: http://www.heartsofiron.de/interaktiv/phpBB2/viewtopic.php?f=98&t=15721&st=0&sk=t&sd=a&start=30 [12.06.2012]. 111
ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen.
33
zu erobern.«112 Ebenfalls scheint eine Sympathie für die deutsche Seite in deren als besser
oder cooler empfundener Ausrüstung zu liegen, wie ein Beitrag von »sinot« zeigt: »bin lieber
nazi als ami in einem Spiel (alleine schon wegen den mega ledermäntel die es heute in dieser
qualität kaum noch gibt außer selbst machen lassen) und der MP , schon der general patton
[...] soll gesagt haben: die SS als ›eine verdammt gut aussehende Bande von sehr
disziplinierten Hurensöhnen‹.«113
Die Motivation der meisten Spieler liegt offenbar ebenfalls nicht darin begründet, vermittels
der PC-Spiele einen Lerneffekt erzielen zu wollen. Vielmehr wählen die Spieler ihre Spiele
nach ihrem Wissen und ihren Präferenzen aus. So ist den in Foren aktiven Spielern
mehrheitlich ein verhältnismäßig großes Wissen über den Zweiten Weltkrieg zu attestieren.
Fast alle von Fritz et al. Befragten geben etwa an, in ihrer Freizeit vornehmlich Bücher oder
Filme zu rezipieren, die sich thematisch mit ›Sudden Strike‹ decken,114 wobei die
Literaturhinweise in den Foren fast ausschließlich Militaria und Schlachtverläufe
thematisieren.115 Pöppinghege geht davon aus, dass es sich bei den Spielern von ›Hearts of
Iron II: Doomsday‹ und ähnlicher Titel um »männliche historische Laien mit einem
vergleichsweise hohen Bildungsniveau«116 handelt, die »ein recht großes Interesse an
geschichtlichen [...] Themen [zeigen].«117 Fragt man nun nach Ursache und Wirkung, so ist
davon auszugehen, dass die Spieler die PC-Spiele nach ihren Interessen – vorzugsweise
militärischer oder technologischer Natur – auswählen, die darin vermittelten
Geschichtsbilder aufgrund des Vorwissens also entweder auf konkurrierende Bilder stoßen
oder diese ohnehin bestätigen. Die Spiele werden daher höchstens als Ausgangsbasis für
eine eingehendere Beschäftigung wahrgenommen.118
112
Eintrag von »Götterwind« vom 07.02.2006, online unter: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?s=f193ca90cff801cb0246770f2de6c614&t=87153&page=2 [12.06.2012]. 113
Eintrag von »sinot« vom 29.12.2005, online unter: http://www.giga.de/forum/politik-wirtschaft/623201-anti-nazi-shooter-vermitteln-hass-auf-die-deutschen-heute-3.html [12.06.2012]. 114
Vgl. ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen. 115
Siehe etwa das Thema Buchbesprechungen des PANZERGENERAL 3D-FORUM, online unter: http://www.panzer-general-3d.de/f12-Buchbesprechungen.html#overview [12.06.2012]. 116
PÖPPINGHEGE, Rainer: Pedanterie im Cyberspace, S. 460. 117
Ebd., S. 463. 118
So beschäftigt sich etwa ein Spieler mit der Panzerschlacht um Prokhorovka 1943, nachdem er diese in ›Panzer General‹ gespielt hat. Vgl. Eintrag von »Clu« vom 28.11.2007, online unter: http://www.panzer-general-3d.de/t70374262f6-Mythos-Prokhorovka.html [12.06.2012].
34
Hierbei ist auch zu bedenken, dass das Ausgangsszenario, der Zweite Weltkrieg, für die
Mehrzahl der Hardcore-Spieler zwar einen Einstiegsreiz darstellt, im Verlauf des
Spielprozesses allerdings zunehmend an Wichtigkeit verliert und ausgeblendet wird.
Stattdessen rücken die Handlungsanforderungen zur Lösung der einzelnen Missionen in den
Mittelpunkt und vermindern so die Bedeutung des Inhaltes.119 Es geht also nach einer
gewissen Einarbeitungszeit mehrheitlich um das Besiegen der Spielmechanik, zuweilen auch
um das Knacken des Programmcodes, weshalb viele Spieler das Spiel auf ludologische
Regelstruktur herunterbrechen und den Spielinhalt – nicht zuletzt durch die Möglichkeit, bei
einer Niederlage einfach einen alten Spielstand zu laden – gleichsam ausblenden.120
5.2.3. Authentizitätsversprechen und Rezeption
Dennoch ist der historische Hintergrund der Spiele nicht zu vernachlässigen, denn das
Potential der Spiele, einen Effekt auf das Geschichtsbewusstsein ihrer Spieler auszuüben,
leitet sich vor allem aus ihrem Authentizitätsversprechen ab. So behauptet etwa ›Sudden
Strike 2‹ von sich, »noch realistischeres Kampfgeschehen«121 zu simulieren und den Krieg in
»noch nie da gewesener Realitätstreue«122 zu zeigen. Dem Vorgänger wird sogar in einer
Kritik bestätigt, dass »[s]ämtliche Einheiten im Spiel den realen Vorbildern nicht nur optisch
nachempfunden [wurden]. In puncto Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Bewaffnung
kommt das Kriegsgerät den historischen Vorbildern sehr nahe.«123
Auch die Spieler scheinen davon auszugehen, dass das Spiel an die reale Historie
heranreicht: »Wenn ich mir vorstelle, wie es im Zweiten Weltkrieg war, kommt das der
Realität schon sehr nahe. [...] Wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, ist ›Sudden
Strike‹ sehr nah an der Realität.«124 Ein anderer Spieler bestätigt, »dass das Spiel sehr
realitätsnah ist. Wo man sagen kann: So war das im Krieg und so kann man das gut
119
Vgl. ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen. 120
Vgl. BRENDEL, Heiko: Historischer Determinismus und historische Tiefe – oder Spielspaß?, S. 109. 121
Werbeanzeige zu ›Sudden Strike 2‹, abgedruckt in: GameStar 6 (2002), S. 53. 122
CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG: Sudden Strike 2, online unter: http://web.archive.org/web/20020320012247/http://www.suddenstrike2.de/deutsch/index1.htm [12.06.2012]. 123
GLISS, Sascha: Hunde wollt Ihr ewig leben?, in: PC Games 11 (2000), S. 129, online unter: http://download.pcgames.de/asset/documents/SuddenStrike.pdf [12.06.2012]. 124
Zit. nach: ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische Konsequenzen.
35
nachvollziehen!«125 Drei der von Fritz et al. zu ›Sudden Strike‹ befragten geben zudem an,
durch das Spiel strategisches Denken gelernt zu haben.126 Ähnlich schreibt ein Schüler, die
Spiele seien besser als der Geschichtsunterricht, da sie die taktische und militärische Seite
des Krieges zeigten, aber »In der schule lernt man nur noch die politischen Folgen,etc..... und
das is Mist!!!!!«127
Es ist also anzunehmen, dass die Spiele tatsächlich auf das Geschichtsbild der Spieler
einwirken – allerdings nur in einer kleinen Nische, nämlich im Bereich der Waffentechnologie
und des Schlachtverlaufs. Die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Repräsentationen dagegen
scheinen das Geschichtsbild der meisten Spieler nicht zu beeinflussen. So sind sich viele
Spieler bewusst darüber, dass die Spiele Entscheidendes ausblenden: »Der Ideologische
Ansatz des WWII bzw. der Deutschen bleibt komplett außen vor [...]. Der Spieler wird nicht
mit Judenmord, Rassenlehre etc. konfroniert. [sic!]«128 Wenngleich etwa der Nutzer »Marva«
es als gefährlich empfindet, »den Eindruck zu vermitteln, dass der zweite Weltkrieg nur von
ehrenhaft kämpfenden Armeen bestritten wurde und ein völlig sauberer Krieg war.« und
daher die Spieleentwickler in die Pflicht nehmen will, »korrekte historische Fakten zu
vermitteln, da die Schule anscheinend oftmals dabei versagt«,129 bleibt doch festzustellen,
dass Computerspiele unter allen Sozialisatoren einen (bislang) geringen Einfluss auf das
Geschichtsbild ihrer Spieler haben und das in Schule und anderen Medien vermittelte
Wissen diese weit überlagert.
6. Fazit
Die vorliegende Arbeit konnte zeigen, wie der Zweite Weltkrieg in Computerspielen
repräsentiert wird. Bezüglich ihres Umgangs mit der Geschichte lassen sich die Spiele
zunächst nach ihrer Kontrafaktizität unterteilen: Während in den offenen Spielen der Spieler
125
Zit. nach: KRAAM-AULENBACH, Nadia / IBRAHIM, Shahied a / ESSER, Heike: Inhaltsanalyse und Auswertung der Befragung des Spiels ›Sudden Strike‹, online unter: http://www.f01.fh-koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_sudden_strike.pdf [12.06.2012]. 126
Vgl. ebd. 127
Eintrag von »Majo« vom 27.01.2003, online unter: http://www.sudden-strike-maps.de/phpBB2/viewtopic.php?f=14&t=759&start=15 [12.06.2012]. 128
Eintrag von »Nossi« vom 31.08.2007, online unter: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=87153 [12.06.2012]. 129
Eintrag von »Marva« vom 08.04.2005, online unter: http://www.gamestar.de/community/gspinboard/showthread.php?t=114387 [12.06.2012].
36
die Möglichkeit hat, den Zweiten Weltkrieg kontrafaktisch auch mit der Wehrmacht zu
gewinnen, behandeln die linearen Spiele diesen nur ausschnitthaft und lösen ihn aus dem
historischen Verlauf – der deutschen Niederlage – heraus.
Ludologisch ist festzustellen, dass sich die in den Spielen dargestellten Konflikte nur
militärisch lösen lassen: Krieg zu führen, ist das einzige angebotene – und damit auch das
legitimste – Mittel, die Spiele erfolgreich abzuschließen; friedliche Lösungsansätze werden
dagegen ausgeblendet. Als siegbringende Taktik erweist sich der Blitzkrieg, wobei in der
Regel alle gegnerischen Einheiten zu vernichten sind, um den Sieg sicherzustellen. Der
Spieler muss sich also der gleichen Taktiken bedienen, die auch die Wehrmacht anwandte,
um erfolgreich zu sein.
Die Spiele können diese taktische Adaption ohne Bedenken einfordern, da sie die politischen
Zusammenhänge des Zweiten Weltkriegs weitgehend ausblenden: Der Nationalsozialismus
findet insbesondere in ›Hearts of Iron II: Doomsday‹ zwar an einigen Stellen Erwähnung, ist
jedoch auch dort kein spielbestimmendes Element; der Spieler wird vielmehr nur am Rande
mit ihm konfrontiert, während die Wehrmacht in keiner Verbindung mit ihm zu stehen
scheint. Auch der Holocaust und die Verbrechen der Wehrmacht finden in den Spielen so gut
wie nicht statt; stattdessen werden alle Spezifika des Vernichtungskrieges ausgeblendet. Die
Wehrmacht erscheint so nicht als »ideologisch motivierte[s] Instrument des verbrecherischen
Regimes«,130 sondern – genau wie die SS – als ganz normale und saubere Armee, wodurch
auch das Eintreten für die deutsche Seite im Spiel unkritisch wird.
Die Spiele reproduzieren damit auf ihrer narratologischen Ebene mehrheitlich
Geschichtsbilder, wie sie vor der Wehrmachtsausstellung und vor allem in der frühen
Nachkriegszeit in den ›Landser‹-Romanen populär waren: Auch diese rissen den Krieg aus
seinen politischen Zusammenhängen; auch diese machten ihn zu einer Momentaufnahme;
130
BORDJUGOV, Gennadij: Terror der Wehrmacht gegenüber der russischen Zivilbevölkerung, in: GORZKA, Gabriele / STANG, Knut (Hrsg.): Der Vernichtungskrieg im Osten. Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion, aus Sicht russischer Historiker, Kassel 1999, S. 56.
37
auch diese wussten nichts von Kriegsverbrechen zu berichten; und schließlich zogen auch
diese scharfe Trennlinien zwischen Nationalsozialisten und Soldaten.131
Wie diese angebotenen Geschichtsbilder von den Spielern nun rezipiert werden, konnte in
Kapitel 5 zwar nur in Ansätzen erörtert werden, die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die
Einflüsse vermutlich geringer sind, als vermutet. Dies liegt darin begründet, dass die
Rezeptionskompetenzen bei den an Forendiskussionen beteiligten Spielern sehr hoch
anzusetzen sind, denn sie beschäftigen sich mehrheitlich nicht nur ausführlich mit den
Spielen, sondern auch mit der Thematik Zweiter Weltkrieg. Da ihr Interesse dabei vor allem
auf militärischen Aspekten liegt, die PC-Spiele aber genau diese betonen, tragen Letztere
höchstens zu einer gewissen Verfestigung der Geschichtsbilder bei. Auch gehen diese Spieler
rasch dazu über, die Spielhandlung auszublenden und sich auf das Bewältigen der
Spielalgorithmen zu konzentrieren. Ob ein größerer Einfluss auf die Geschichtsbilder von
Durchschnittsspielern – dies sind allein im Fall von ›Sudden Strike‹ über eine Million – zu
verzeichnen ist, wird nur in einer repräsentativen Untersuchung zu klären sein.
Es bleibt festzuhalten, dass die Entwickler für ihren virtuellen Zweiten Weltkrieg größtenteils
auf populäre Geschichtsbilder zurückgreifen und gleichzeitig alle Spezifika des Weltkriegs
vernachlässigen, wodurch das Szenario beliebig und austauschbar wird. Die Untersuchung
zeigt, dass der historische Hintergrund, wenngleich er eine tragende Rolle einnimmt, doch
für Spiel und Spieler größtenteils ebendies bleibt: Hintergrund.
131
Vgl. KNOCH, Habbo: Die lange Dauer der Propaganda, S. 209-220. Siehe auch APP, Reiner / LEMKE, Bernd: Der Weltkrieg im Groschenheft-Format. Über den Lektüre-Reiz der Landser-Romane und ihre Verherrlichung des Zweiten Weltkriegs, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 11 (2005), S. 636-641.
38
7. Quellen- und Literaturverzeichnis 7.1. Quellen
VERWANDTE SPIELE
›Hearts of Iron II: Doomsday‹ (Paradox, 2006).
›Panzer General‹ (SSI, 1994).
›Sudden Strike‹ (Fireglow Games, 2000).
›Sudden Strike 2‹ (Fireglow Games, 2002).
SONSTIGE QUELLEN
»BLACK LOTUS«: Eintrag vom 01.06.2005, online unter:
http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?179799-What-do-you-think-of-the-
manual&s=ea51ac5f15a942524b30e6a8322e9094 [12.06.2012].
CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG: Sudden Strike 2, online unter:
http://web.archive.org/web/20020320012247/http://www.suddenstrike2.de/deutsch/index
1.htm [12.06.2012].
CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG: Sudden Strike Forever, o.O. 2001.
CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG: Werbeanzeige zu ›Sudden Strike 2‹, abgedruckt in:
GameStar 6 (2002), S. 53.
»CLU«: Eintrag vom 28.11.2007, online unter: http://www.panzer-general-
3d.de/t70374262f6-Mythos-Prokhorovka.html [12.06.2012].
»GESCHICHTSMEDIZINER«: Eintrag vom 19.01.2011, online unter:
http://forum.golem.de/kommentare/games/il-2-sturmovik-kampf-ueber-den-klippen-von-
dover/deutscher-will-deutschen-spielen/48430,2621246,2621246,read.html [12.06.2012].
»GÖTTERWIND«: Eintrag vom 07.02.2006, online unter:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?s=f193ca90cff801cb0246770f2de6c6
14&t=87153&page=2 [12.06.2012].
»LEON«: Eintrag vom 31.08.2004, online unter:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=87153 [12.06.2012].
»MAJO«: Eintrag vom 27.01.2003, online unter: http://www.sudden-strike-
maps.de/phpBB2/viewtopic.php?f=14&t=759&start=15 [12.06.2012].
39
»MARVA«: Eintrag vom 08.04.2005, online unter:
http://www.gamestar.de/community/gspinboard/showthread.php?t=114387 [12.06.2012].
N.N.: § 86 STGB, online unter: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html
[12.06.2012].
»NOSSI«: Eintrag vom 31.08.2007, online unter:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=87153 [12.06.2012].
OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN: Urteil vom 18.3.1998, Az.: 1 Ss 407/97, online unter:
http://www.technolex-anwaelte.de/user_data/OLG_Frankfurt_a.M._1_Ss_407_97.pdf
[12.06.2012].
PANZERGENERAL 3D-FORUM: Buchbesprechungen, online unter: http://www.panzer-general-
3d.de/f12-Buchbesprechungen.html#overview [12.06.2012].
PARADOX INTERACTIVE: Hearts of Iron II – Doomsday, o.O. 2006.
»SINOT«: Eintrag vom 29.12.2005, online unter: http://www.giga.de/forum/politik-
wirtschaft/623201-anti-nazi-shooter-vermitteln-hass-auf-die-deutschen-heute-3.html
[12.06.2012].
STRATEGIC SIMULATIONS, INC.: Panzer General, o.O. 1994.
»VAMPY«: Eintrag vom 04.12.2007, online unter:
http://www.heartsofiron.de/interaktiv/phpBB2/viewtopic.php?f=98&t=15721&st=0&sk=t&s
d=a&start=30 [12.06.2012].
7.2. Literatur
AARSETH, Espen: Computer Game Studies, Year One, in: Game Studies 1 (2001), online unter:
http://gamestudies.org/0101/editorial.html [12.06.2012].
ANGRICK, Andrej: Das Beispiel Charkow. Massenmord unter deutscher Besatzung, in:
HARTMANN, Christian / HÜRTER, Johannes / JUREIT, Ulrike: Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz
einer Debatte, München 2005, S. 117-123.
APP, Reiner / LEMKE, Bernd: Der Weltkrieg im Groschenheft-Format. Über den Lektüre-Reiz der
Landser-Romane und ihre Verherrlichung des Zweiten Weltkriegs, in: Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht 11 (2005), S. 636-641.
ASSMANN, Aleida: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen
Inszenierung, München 2007.
ATKINS, Barry: More than a game. The computer game as fictional form, Manchester 2003.
40
BENDER, Steffen: Durch die Augen einfacher Soldaten und namenloser Helden.
Weltkriegsshooter als Simulation historischer Kriegserfahrung?, in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.):
»Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?«. Eine
fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel, Münster 2010, S. 123-
147.
BERGOLD, Björn: »Man lernt ja bei solchen Filmen immer noch dazu«. Der Fernsehzweiteiler
›Die Flucht‹ und seine Rezeption in der Schule, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
9 (2010), S. 503-514.
BOLL, Bernd / SAFRIAN, Hans: Die 6. Armee. Unterwegs nach Stalingrad. 1941 bis 1942, in:
HEER, Hannes (Hrsg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg
1996, S. 62-101.
BORDJUGOV, Gennadij: Terror der Wehrmacht gegenüber der russischen Zivilbevölkerung, in:
GORZKA, Gabriele / STANG, Knut (Hrsg.): Der Vernichtungskrieg im Osten. Verbrechen der
Wehrmacht in der Sowjetunion, aus Sicht russischer Historiker, Kassel 1999, S. 53-68.
BRENDEL, Heiko: Historischer Determinismus und historische Tiefe – oder Spielspaß? Die
Globalechtzeitstrategiespiele von Paradox Interactive, in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): »Wollten
Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?«. Eine
fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel, Münster 2010, S. 95-122.
BUNDESPRÜFSTELLE FÜR JUGENDGEFÄHRDENDE SCHRIFTEN: Indizierungsentscheidung Panzer General
(Auszüge), Bonn o.J., online unter:
http://web.archive.org/web/20050413074646/http://snp.bpb.de/referate/bpjs_pgindex.ht
m [12.06.2012].
BUNDESVERBAND INTERAKTIVE UNTERHALTUNGSSOFTWARE (Hrsg.): Gamer-Statistiken, online unter:
http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken.html [12.06.2012].
BUNDESVERBAND INTERAKTIVE UNTERHALTUNGSSOFTWARE (Hrsg.): Marktzahlen, online unter:
http://www.biu-online.de/de/fakten/marktzahlen [12.06.2012].
BUTLER, Mark: Would you like to play a game? Die Kultur des Computerspielens, Berlin 2007.
DEMANDT, Alexander: Ungeschehene Geschichte. Ein Traktat über die Frage: Was wäre
geschehen, wenn...?, Göttingen 42001.
DONATH, Andreas: Spieletest. Sudden Strike Add-On Total War, in: Golem 19.06.2001, online
unter: http://www.golem.de/0106/14420.html [12.06.2012].
ESSER, Heike / IBRAHIM, Shahied a / WITTING, Tanja: Gesamtauswertung und pädagogische
Konsequenzen, online unter: http://www.f01.fh-
koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_gesamtauswertung.pdf
[12.06.2012].
41
FREI, Norbert: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2005.
FRITZ, Jürgen / WITTING, Tanja / KRAAM-AULENBACH, Nadia: Einführung in das Forschungsprojekt,
online unter: http://www.f01.fh-
koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_einfuehrung.pdf
[12.06.2012].
GIESELMANN, Hartmut: Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel,
Hannover 2002.
GIESELMANN, Hartmut: Spielplatz Zweiter Weltkrieg. Nazi-Clans und Militär-Fanatiker im
virtuellen Stahlgewitter, online unter:
http://web.archive.org/web/20050221092821/http://snp.bpb.de/referate/giesel.htm
[12.06.2012].
GLISS, Sascha: Hunde wollt Ihr ewig leben?, in: PC Games 11 (2000), S. 129, online unter:
http://download.pcgames.de/asset/documents/SuddenStrike.pdf [12.06.2012].
HUBERTS, Christian: Raumtemperatur. Marshall McLuhans Kategorien ›heiss‹ und ›kalt‹ im
Computerspiel, Salzhemmendorf 2010.
HUIZINGA, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek bei Hamburg 212009.
IGN: Nazis is Number 6, online unter: http://www.ign.com/videogame-villains/6.html
[12.06.2012].
JUUL, Jesper: The Game, the Player, the World. Looking for a Heart of Gameness, in: KAMINSKI,
Winfred (Hrsg.): Clash of Realities 2008. Spielen in digitalen Welten, München 2008, S. 25-45.
KERSHAW, Ian: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretation und Kontroversen im Überblick, Reinbek
bei Hamburg 1988.
KNOCH, Habbo: Die lange Dauer der Propaganda. Populäre Kriegsdarstellung in der frühen
Bundesrepublik, in: HARDTWIG, Wolfgang/ SCHÜTZ, Erhard: Geschichte für Leser. Populäre
Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2005, S. 205-223.
KRAAM-AULENBACH, Nadia / IBRAHIM, Shahied a / ESSER, Heike: Inhaltsanalyse und Auswertung
der Befragung des Spiels ›Sudden Strike‹, online unter: http://www.f01.fh-
koeln.de/imperia/md/content/wirkungvirtuellerwelten/inhalte_sudden_strike.pdf
[12.06.2012].
KÜCKLICH, Julian: Invaded Spaces. Anmerkungen zur interdisziplinären Entwicklungen der
Game Studies, online unter: http://playability.de/pub/drafts/Invaded_Spaces.pdf
[12.06.2012].
42
KUSENBERG, Peter: Endsieg der Enkel, in: Konkret 7 (2004), online unter: http://www.konkret-
verlage.de/kvv/txt.php?text=endsiegderenkel&jahr=2004&mon=07 [12.06.2012].
LIESCHING, Marc: Hakenkreuze in Film, Fernsehen und Computerspielen. Verwendung
verfassungsfeindlicher Kennzeichen in Unterhaltungsmedien, in: BPJM-Aktuell 3 (2010), S. 11,
online unter: http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-
hakenkreuze-film-fernsehen-computerspielen-aus-03-
10,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf [12.06.12].
MACCALLUM-STEWART, Esther/ PARSLER, Justin: Controversies: Historicising the Computer Game,
in: BABA, Akira (Hrsg.): Situated Play. Proceedings of DiGRA 2007 Conference, o.O. 2007, S.
203-210, online unter: http://www.digra.org/dl/db/07312.51468.pdf [12.06.2012].
MATZENBERGER, Michael: Die Zukunft der Computerspiele, Marburg 2008.
MEDIA CONTROL GFK INTERNATIONAL GMBH: Top 50 PC-Spiele für den Zeitraum KW 01 bis KW 53
2009, abgedruckt in: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): »Wollten Sie auch immer schon einmal
pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?«. Eine fachwissenschaftliche Annährung an
Geschichte im Computerspiel, Münster 2010, S. 200.
MEYER, Erik: Problematische Popularität? Erinnerungskultur, Medienwandel und
Aufmerksamkeitsökonomie, in: KORTE, Barbara/ PALETSCHEK, Sylvia (Hrsg.): History Goes Pop.
Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009, S. 267-
288.
MOBYGAMES: Panzer General. The Press Says, online unter:
http://www.mobygames.com/game/dos/panzer-general/mobyrank [12.06.2012].
MOORSTEDT, Tobias: Der Zweite Weltkrieg in Computerspielen. Wie es wirklich nicht war, in:
Süddeutsche Zeitung 19.05.2005, online unter: http://www.sueddeutsche.de/kultur/der-
zweite-weltkrieg-in-computerspielen-wie-es-wirklich-nicht-war-1.438989 [12.06.12].
NEITZEL, Britta: Das Computerspiel als Leitmedium des 21. Jahrhunderts, in: KAMINSKI, Winfred
(Hrsg.): Clash of Realities 2008. Spielen in digitalen Welten, München 2008, S. 61-75.
NEITZEL, Sönke: Geschichtsbild und Fernsehen. Ansätze einer Wirkungsforschung, in:
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 9 (2010), S. 488-502.
N.N.: Hearts of Iron 2: Doomsday, in PC Games 01.05.2006, online unter:
http://www.pcgames.de/Hearts-of-Iron-2-Doomsday-PC-121960/Tests/Hearts-of-Iron-2-
Doomsday-464470/ [12.06.2012].
N.N.: Report: GameStar Awards 2000, in: GameStar 01.02.2001, online unter:
http://www.gamestar.de/specials/reports/1330130/gamestar_awards_2000.html
[12.06.2012].
43
N.N.: Sudden Strike erfolgreich, in: PC Games 07.03.2001, online unter:
http://www.pcgames.de/Sudden-Strike-PC-16051/News/Sudden-Strike-erfolgreich-5890/
[12.06.2012].
N.N.: Über eine Million Exemplare verkauft. CDV mit guten Verkaufszahlen, in: Gameswelt
02.07.2003, online unter: http://www.gameswelt.at/news/72846-Sudden_Strike_-
_UEber_eine_Million_Exemplare_verkauft_-_CDV_mit_guten_Verkaufszahlen_....html
[12.06.2012].
ONLINE GAMES DATENBANK: Company of Heroes, online unter:
http://www.onlinegamesdatenbank.de/index.php?section=game&gameid=12891
[12.06.2012].
PÖHLMANN, Markus / Walter, Dierk: Guderian fürs Kinderzimmer? Historische
Konfliktsimulationen im Computerspiel, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 12 (1998),
S. 1087–1109.
PÖPPINGHEGE, Rainer: Ballern für den Führer. Der Zweite Weltkrieg im Computerspiel, in:
Steinberg, Swen (Hrsg.): Vergessenes Erinnern. Medien von Erinnerungskultur und
kollektivem Gedächtnis, Berlin 2009, S. 105-120.
PÖPPINGHEGE, Rainer: Pedanterie im Cyberspace. Zum Geschichtsbewusstsein von
Computerspielern, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 7/8 (2011), S. 459-468.
PÖPPINGHEGE, Rainer: Wenn Geschichte keine Rolle spielt, in: HARDTWIG, Wolfgang/ SCHUG,
Alexander (Hrsg.): History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt,
Stuttgart 2009, S. 131-138.
SANDKÜHLER, Gunnar: Der Zweite Weltkrieg im Computerspiel: Ego-Shooter als
Geschichtsdarstellung zwischen Remediation und Immersion, in: MEYER, Erik (Hrsg.):
Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien, Frankfurt a.M.
2009, S. 55-65.
SCHNELLE, Mick: Sudden Strike 2, in: GameStar 7 (2002), S. 98, online unter:
http://www.gamestar.de/spiele/sudden-strike-2/test/sudden_strike_2,37403,1338267.html
[12.06.2012].
SCHOLZ, Kristina: The Greatest Story Ever Remembered. Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg
als sinnstiftendes Element in den USA, Frankfurt a.M. 2008.
SCHÜLER, Benedikt; SCHMITZ, Christopher; LEHMANN, Karsten: Geschichte als Marke, in:
SCHWARZ, Angela (Hrsg.): »Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre
Gegner werfen?«. Eine fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel,
Münster 2010, S. 199-215.
44
SCHWARZ, Angela: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft?, in: dieselbe
(Hrsg.): »Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner
werfen?«. Eine fachwissenschaftliche Annährung an Geschichte im Computerspiel, Münster
2010, S. 7-28.
SCHWARZ, Angela: Neue Medien – alte Bilder. Frauenfiguren und Frauendarstellungen in
neueren Computerspielen mit historischen Inhalten, in: ALAVI, Bettina (Hrsg.): Historisches
Lernen im virtuellen Medium (Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Bd.
54), Heidelberg 2010, S. 31-53.
SCHWARZ, Angela: Siegen ist erst der Anfang. Oder: Was kommt nach der Annäherung an die
Geschichte im Computerspiel?, in: dieselbe (Hrsg.): »Wollten Sie auch immer schon einmal
pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?«. Eine fachwissenschaftliche Annährung an
Geschichte im Computerspiel, Münster 2010, S. 217-227.
SCHWARZ, Angela: »Wollen Sie wirklich nicht weiter versuchen, diese Welt zu dominieren«.
Geschichte in Computerspielen, in: KORTE, Barbara/ PALETSCHEK, Sylvia (Hrsg.): History Goes
Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009, S.
313-340.
SICART, Miguel: The ethics of computer games, Cambridge 2009.
STEIN, George H.: The Waffen SS. Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, Ithaca (New York)
1966.
THOMAS, David et al.: You Played That? Game Studies Meets Game Criticism, in: DIGRA
(Hrsg.): Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory, o.O. 2009,
online unter: http://www.digra.org/dl/db/09287.17255.pdf [12.06.2012].
WELZER, Harald / MOLLER, Sabine / TSCHUGGNALL, Karoline: »Opa war kein Nazi«.
Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt a.M. 32002.
WILKE, Jürgen: Die Fernsehserie ›Holocaust‹ als Medienereignis, in: Historical Social Research
4 (2005), S. 9-17.
WOLF, Peter: Freibeuter der Chronologie. Geschichtsbilder des Historismus im Computerspiel
›Der Patrizier‹, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 10 (1993), S. 665–670.
WOLFRUM, Edgar: Neue Erinnerungskultur? Die Massenmedialisierung des 17. Juni 1953, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40/41 (2003), S. 33-39.