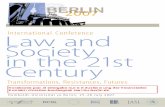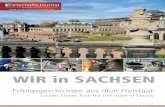"vielleicht tun wir am Ende recht". Über ein rechtsphilosophisches Leitmotiv Heinrich von Kleists
Transcript of "vielleicht tun wir am Ende recht". Über ein rechtsphilosophisches Leitmotiv Heinrich von Kleists
176 ANDREAS GELHARD
In diese Richtung weist letztlich schon Binders These, Kleist wehre sich gegen die Vormacht der idealistischen Kunst- und Tugendvorstellungen „durch Ironie": „Nicht durch die handfeste Ironie der Bloßstellung, die ei-nen eigenen und gesicherten Standort voraussetzte, sondern durch eine sehr versteckte Ironie, die zwar die Positionen ihres Zeitalters bezieht, aber zu-gleich erkennen läßt, daß sie ihre Tragfähigkeit bezweifelt."33 Nimmt man Binders Überlegung ernst, so heißt das: Kleist untergräbt, zersetzt und zer-stört zwar die Versatzstücke des bürgerlich-aufrichtigen Diskurses, zu dem er kein Zutrauen fassen kann, er enthält sich dabei aber weitgehend derjeni-gen Techniken des Bloßstellens, Entlarvens und Strafens, die er als einen wichtigen Bestandteil dieses Diskurses erkennt. Wenn man von so etwas wie Kleists Ethik sprechen kann, dann ist es eine Ethik der Enthaltung, wie sie schon aus einer von Kants Randbemerkungen zu seiner Schrift über das Schöne und Erhabene spricht: „Die Satyre bessert niemals daher wenn ich auch die / Talente dazu hätte so würde ich mich ihrer nicht bedienen."34
33 Binder, „Ironischer Idealismus", S. 311. 34 Immanuel Kant, Bemerkungen in den .Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen', neu herausgegeben und kommentiert von Marie Rischmüller, Hamburg 1991, S. 81. Auch das Pathos dieses abschließenden Zi-tats bleibt nicht ohne ironische Brechung, da Kant nur wenig später eine strafen-de Satyre verfasst hat: die Träume eines Geistersehers.
„vielleicht tun wir am Ende recht" Über ein rechtsphilosophisches Leitmotiv
Heinrich von Kleists
JAN M ü L L ER
Heinrich von Kleists Prosastück „Über das Marionettentheater" beginnt mit einem Verwirrspiel: Wo der Titel tradierten Gattungskonventionen gemäß einen Traktat oder eine Abhandlung „Über das Marionettentheater" ver-spricht, wird ein Gespräch nicht einmal als scheinbar neutraler (letztlich dramatischer) Dialog dargestellt, sondern von einem der Gesprächsteil-nehmer berichtet. Diese Inszenierung als bezeugter Bericht provoziert die Frage nach der Zuverlässigkeit des Zeugen. Wer sich zur Beglaubigung ei-ner berichteten Sachlage auf einen Zeugen beruft, der entledigt sich nicht der Anforderung, die Angemessenheit seines Berichts zu beurteilen; er ver-schiebt nur, indem er den Bericht als Zeugnis versteht, die Last von der Sa-che auf den Zeugen. Die Figur des Zeugen ist ambivalent: Einerseits soll sie die Angemessenheit eines Berichts unmittelbar beglaubigen; und ande-rerseits kann man das von ihr nur erhoffen, wenn man anerkennt, dass ein Zeuge prinzipiell fallibel ist. Relevant ist bei der Beurteilung des Zeugnis-ses nicht, ob der Zeuge ein Zeuge ist (dies festzustellen geht seiner Beurtei-lung als Zeuge voraus), sondern ob er ein guter oder ein schlechter - ein unzuverlässiger, voreingenommener usw. - Zeuge ist.
Das Prosastück „Über das Marionettentheater" inszeniert dieses Prob-lem der Zeugenschaft. Das beginnt mit der ein- und ausleitenden Realitäts-fiktion. Der Text hebt an mit der Mitteilung: „Als ich den Winter 1801 in
178 JAN MüLLER
M... zubrachte, traf ich daselbst [...] den Herrn C. an"; unterzeichnet ist er mit dem Kürzel „H. v. K." (KW II, 338 u. 345)1. Die Kleist-Forschung hat diese Angaben zu überprüfen versucht: Könnte Kleist sich im Winter 1801 in einer Stadt mit Oper aufgehalten haben, deren erster Tänzer ein „Herr C..." gewesen sein könnte (Mainz bietet sich an - aber da war Kleist erst 1803)? Solches Nachdenken verdankt sich der Hoffnung, Erzählerfigur und Autorperson ließen sich einander so annähern, dass die Reden der Erzähler-figur zur Erhellung kleistischer Überzeugungen nützen. Der Text „Über das Marionettentheater" könnte dann direkten Aufschluss über Kleists Verhält-nis zu theoretischen Debatten seiner Zeit geben, etwa der Ästhetik oder Dichtungstheorie; auf seine „Poetologie", also die Weise, in der er selbst höherstufig über sein Dichten Auskunft gibt. Eine solche Eindeutigkeitser-wartung wird indes schon durch die Unmöglichkeit enttäuscht, den Zeugen des Berichts zu identifizieren. Ob die Signatur „H. v. K." „Text" oder „Pa-ratext" ist2, ob sie zum abgedruckten Bericht gehört wie die Unterschrift unter einem Zeugenprotokoll, oder die Signatur des den Abdruck verant-wortenden Redakteurs der „Berliner Abendblätter" ist, lässt sich dem „Text" nicht entnehmen - die Grenzen des Textes sind ja gerade das, was in Frage steht.3
Kaum weniger als die Identität des Zeugen ist seine Qualität problema-tisch: Was ist von einem Zeugen zu halten, der, nach der Mitteilung der verblüffenden Bärengeschichte (abermals treu durch Angabe eines Ge-währsmanns, des „livländischen Edelmanns v. G..." (KW II, 344) beglau-bigt) gefragt: „Glauben Sie diese Geschichte?", nach eigenem Bekunden „mit freudigem Beifall" ausruft: „Vollkommen! [...] jedwedem Fremden
1 Ich zitiere Kleists Schriften und Briefe nach der von Helmut Sembdner besorg-ten zweibändigen Ausgabe (1984), verzichte aber darauf, alle Texte im einzel-nen nachzuweisen - sie werden im Kontext jedenfalls genannt. Auf Kleists Werke wird mit der Sigle „KW" verwiesen; die römische Ziffer gibt den Band, die arabische die Seitenzahl an.
2 Vgl. Genette (1987). 3 Allenfalls könnte man auf Rückschlüsse aus dem Druckkontext hoffen. Man
findet leider in den „Berliner Abendblättern" sowohl Texte von Kleist, die gar nicht unterzeichnet sind, als auch unter Pseudonym veröffentlichte Texte - je-denfalls kein Muster, das letztlich erklären würde, welche Funktion das Autor-kürzel unter dem Marionettentheater-Text erfüllt.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" | 179
[...]: um wie viel mehr Ihnen!" (KW II, 345) Gutgläubigkeit und mangeln-des Urteilsvermögen machen den Erzähler unzuverlässig. Mit dem Zeugen aber wird das Bezeugte fragwürdig. Wenn der Text also eine Abhandlung ist - warum wird die Geltung der verhandelten Sachen überhaupt an die Glaubwürdigkeit von Zeugen geknüpft? Wenn der Text die Erzählung eines Streitgesprächs ist - sind die Gegenstände des Streits dann mehr als das beiläufige Thema? Diese Alternative ist bestimmt vom Bemühen, Kleists Text möglichst eindeutig als Gattungsexemplar - „philosophische" Ab-handlung oder „literarische" Erzählung - zu klassifizieren. Kleist unterläuft dieses Bemühen. Die dafür verantwortliche ironische Haltung verdankt sich allerdings nicht skeptischen, sondern normativen Erwägungen (1): Sie ist ein Modus des praktischen Umgangs mit Dilemmata, die bei Kleist unter dem Titel des Rechts verhandelt werden (2). Unter diesem Titel arbeitet Kleist sich an einer Spannung in der Begründung von Normativität ab: Die Spannung zwischen der Unbedingtheit und Unhintergehbarkeit ihrer fak-tisch wirklichen Geltungsansprüche, und der Notwendigkeit und zugleich dem notwendigen Ungenügen ihrer individuellen und subjektiven Aner-kennung. Kleists Erzählungen und Dramen fuhren diese Spannung aus der Teilnehmerperspektive betroffener Subjekte vor (3). Wenn das ein wieder-kehrendes Organisationsprinzip kleistischer Stoffe ist, dann ist schließlich das Gespräch „Über das Marionettentheater" die ironisch abbrechende In-szenierung des Versuchs, sich der Zumutung des Rechts unangemessen, nämlich bloß theoretisch, zu entledigen (4).
1. KLEISTS IRONIE: SKEPSIS ODER PRAXIS?
Wie sollte man feststellen, ob „Über das Marionettentheater" als Abhand-lung oder als Erzählung zu lesen ist? „Literarische" Texte unterscheiden sich von „philosophischen" scheinbar in ihren „Eigenschaften" (ihren sprachlichen Mitteln). Die Unterscheidung typischer sprachlicher Mittel schafft nun zwar, stabilisiert durch geistes- und gattungsgeschichtliche Konventionen und Rekonstruktionen, eine erste Orientierung. Bei genaue-rer Betrachtung erweist sie sich im Einzelfall aber stets als prekär. Das ist
4 Das ist die Erfahrung, die Jürgen Habermas' vorschnelle Invektive gegen die „Einebnung des Gattungsunterschieds" motivierte; vgl. Habermas (1985, 219ff.)
180 JAN MüLLER
kein Zufall, noch weniger Resultat unscharfer oder unklarer Begriffsbil-dung. Die Ausdrücke „literarisch" und „philosophisch" fungieren nicht at-tributiv, sondern adverbial - sie bezeichnen nicht die individuierenden Ei-genschaften von Sachen disjunkter Gegenstandsklassen, sondern zeigen Perspektiven an, die man (produzierend und rezipierend) auf Mitteilungen und Texte einnehmen kann.
„Philosophisches" Sprechen bemüht sich üblicherweise, seine „literari-schen" Aspekte so gut wie möglich zu kontrollieren und der Leserin trans-parent zu machen. Das ist pragmatisch auch völlig angemessen: Üblicher-weise geht es in philosophischen Diskursen und Texten weniger darum, wie, und mehr darum, was behauptet und begründet wird, und es gilt als ei-ne philosophische Tugend, gleichsam durch die verwendete Sprachform di-rekt auf die behandelte Sache zu blicken. Dieses Ideal völliger Transparenz, restloser Vernachlässigbarkeit, ist jedoch zweischneidig: Was völlig trans-parent ist, ist zwar unsichtbar, darum aber nicht unwirksam. Philosophi-sches Sprechen ist in einer Zwickmühle: Seinem Anspruch nach muss es einerseits seine „literarischen" (figurativen, narrativen, metaphorischen) Aspekte vergessen machen - und darf sie andererseits gerade nicht verges-sen, will es nicht von ihren Konsequenzen heimgesucht werden. „Philoso-phische" Texte fordern von der Philosophierenden, diesem Vergessen re-flexiv nachzuspüren. „Literarische" Texte fordern von der Philosophin da-gegen, weder deren „philosophische" Aspekte historistisch zur Autorideo-logie herabzustufen,5 noch umgekehrt ihre „literarischen" Aspekte als bloß randständige Verzierung einer klaren „philosophischen" These beiseite zu lassen.
und Habermas (1988). Besonnener und im ganzen, denke ich, richtig wird diese logisch-grammatische Vagheit gattungstheoretischer Sortierversuche von Jac-ques Derrida in seinem Essay über das „Gesetz der Gattung" vorgeführt (Derri-da 1979); ihm folge ich in diesem Abschnitt.
5 Weil über die Güte und Angemessenheit der fraglichen Auffassung damit noch nichts gesagt wäre.
6 Beide Verhaltensweisen legen sich deshalb so umstandslos nahe, weil sie sich aus Entwicklungen speisen: Der „denkerischen" Arbeitsteilung, der Entstehung einer (im ideologiehistorischen Sinn verstandenen) „bürgerlichen" Literatur-und Kunstvorstellung, die den als „Literatur" angesprochenen Texten bestimmte (nicht zuletzt politische) Leistungen zusprach, sowie die disziplinare und institu-
„VIELLEICHTTUN WIR AM ENDE RECHT" 181
Kleists „Über das Marionettentheater" provoziert diese Zwickmühle für seine philosophierende Leserin. Liest sie den Text, berechtigt durch seinen Titel, als eine „philosophische" Abhandlung und beurteilt sie dabei die Gel-tung investierter Voraussetzungen und die Abfolge von Argumenten, dann muss sie die Pragmatik des Gesprächs vernachlässigen - die Spitzen und Sticheleien der Streitenden,7 ihre Zerstreuungen und Themenwechsel („Bei dieser Gelegenheit"...).8 Fokussiert die Leserin umgekehrt die „literari-schen" Aspekte des Textes: den Erzähler, die Pragmatik und Dramaturgie der erzählten Diskussion, dann vernachlässigt sie die Orientierung, die der Titel gibt. Deutungen, die in Kleists Text eine im weitesten Sinn „theoreti-sche" Problemlage verhandelt finden, wirken dann überinterpretierend: Dass Philosophinnen und Philosophen im „Marionettentheater" das Ver-hältnis von Unmittelbarkeit und Vermittlung, oder Schillers Ästhetik, oder Thesen der Psychologie und der Moral verhandelt finden, liegt daran, dass sie den Text eben lediglich als Antwort auf solche theoretischen Fragen le-sen.
Angemessen wäre eine Deutung von „Über das Marionettentheater", die beide Perspektiven vermittelt. Die „dekonstruktive" Interpretation bean-
tionelle Herausbildung des Philosophierens als akademischer „Wissenschaft"; und beide Verhaltensweisen finden sich scheinbar dadurch bestätigt, dass die genannten Entwicklungen sich in typischen Textsorten widerspiegeln.
7 Vgl. die malizöse Bemerkung, der Gesprächspartner habe „nicht mit Aufmerk-samkeit gelesen", oder die grobe Abqualifizierung seiner Gesprächskompetenz: „wer diese erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt, mit dem könne man nicht füglich über die folgenden, um wie viel weniger die letzte, sprechen" (KW II, 343).
8 Solche Lesarten sind freilich auch literaturwissenschaftlich verbreitet, weil sie erlauben, wenigstens im Ansatz geistesgeschichtlich verortbare Thesen oder Be-hauptungen zu identifizieren. So nennt etwa der Kleist-Editor Helmut Sembdner den Text in seinem Kommentar einen „Aufsatz", und trifft damit eine nicht un-schuldige Lektüreentscheidung: „Der erste, der den überragenden Wert dieses Aufsatzes erkannte, war anscheinend E. T. A. Hoffmann"; Sembdner orientiert sich dabei an einem Brief Hoffmanns aus dem Jahr 1812, in dem auch dieser von einem „Aufsatz über Marionetten-Theater" spricht, bemerkt dabei aber nicht, dass Hoffmann die Rede von der Textsorte „Aufsatz" sehr viel allgemei-ner gebraucht haben dürfte (KW II, 930).
182 I JAN MüLLER
spracht das. Sie argumentiert, dass der „theoretische" (begriffliche, philo-sophische) Gehalt weniger auf der Ebene des Erzählten zu suchen sei, als in der Inszenierung (im Darstellen und Erzählen) des Behauptens.9 So meint
9 Ich entwickle diese Überlegung im Folgenden im Gespräch mit den Ausführung von Andreas Gelhard (vgl. seinen Beitrag in diesem Band) und konzentriert auf die Pragmatik eines solchen Inszenierens. Mich interessiert, was philosophisch geschieht, wenn man so spricht. Darin unterscheidet sich diese Deutung von der klassischen Interpretation durch Paul de Man. De Man sieht das Verhältnis der beiden kleistischen Gesprächspartner und ihrer Geschichten höherstufig als eine Allegorie des Verhältnisses von Zeichen und Bezeichnetem, oder - aktiv ge-wendet - von Lesen und Schreiben. Der Meistertänzer oder tänzelnde Fechter C... ist für de Man ein Indiz dafür, dass der Text ein „hermeneutischefs] Ballett" als „Schauspiel der Verausgabung" inszeniere, dessen Gehalt die generelle The-se repräsentiert: „entweder wir beherrschen den Text, dann können, aber brau-chen wir nicht zu täuschen; oder wir beherrschen den Text nicht und können dann auch nicht wissen, ob wir täuschen oder nicht" (de Man 1979, 224). Eine solche Deutung ist möglich, sagt aber weniger etwas darüber, wie man den Text „Über das Marionettentheater" deuten sollte, als dass sie ihn für die Illustration einer gewissen generelle Art und Weise, über Lesen und Schreiben nachzuden-ken, nutzt. So erhellend dieses Vorgehen ist, so sehr leidet seine Plausibilität da-runter, dass der philosophische Zweck, zu dem das „Marionettentheater" eine il-lustrierende Funktion erfüllt, dem Text letztlich beiläufig ist. („Letztlich" beiläu-fig ist er ihm deshalb, weil der Text hinreichend plausible und relevante An-knüpfungspunkte bieten muss. De Mans Deutung knüpft an die Verwendung des Ausdrucks „lesen" im Kleist-Text an, und würde ohne diese Verbindung nicht bestehen können. Ob Kleists Verwendungen des Ausdrucks „lesen" für de Mans Frage aber relevant sind, ergibt sich nicht aus Kleists Text.) De Mans Deutung ist nicht dekonstruktiv genug: Beansprucht er, dass die philosophische Überle-gung, zu der ihm die Lektüre von Kleists Text Anlass gibt, sich nicht nur beiläu-fig ergibt, dann liest er das Prosastück nur als - zugegeben: kunstvoll verrätsel-tes - Thesenstück, dessen philosophischer Gehalt sich in der generellen Behaup-tung wiedergeben lässt, die ich zitierte. Beansprucht er das nicht, dann deutet er Kleists Text auch nicht, sondern nutzt ihn lediglich für die Illustration seiner von Kleist ganz unabhängigen Überlegungen, wobei die Angemessenheit der Il-lustration sich an seinen Überlegungen bemisst und nicht am Kleisttext. Im ers-ten Fall fiele auch de Man auf die durch den Titel nahegelegte Privilegierung
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" 183
Wolfgang Binder, es sei letztlich zufällig, dass im Text gerade ein zeitge-nössisch verbreitetes Drei-Stadien-Modell besprochen werde. Ebenso gleichgültig sei deshalb auch, ob Kleist sich während seiner so genannten „Kant-Krise" plötzlich und schmerzlich von solchen Modellen abgewendet habe, oder ob er den Anspruch und die Reichweite solcher Modelle schlicht missverstanden habe.11 Jedenfalls dürfe man das Auftauchen dieser Model-le nicht als Bekenntnis des Autors verstehen; und weil sich dem erzählten Gespräch auch höherstufig keine kohärente sachliche Behauptung entneh-men lasse, schließt Binder:
„Der idealistische Dreischritt: Sein - Entfremdung - Sichfinden beruht auf der Kon-tingenz eines verwirrenden Faktums, das so unbezogen wie entbehrlich ist. Kleist macht, was seinem Zeitalter als Horizont der Daseinsdeutung gilt, zum Instrument der poetischen Durchführung, und diese Umdeutung eines Credo in ein technisches Mittel, das nicht mehr verbindlich, sondern nur brauchbar ist, kann wohl ironisch genannt werden, [...] Kleist verwendet die idealistischen Kategorien und Schemata [...] als Gestaltungsmittel [...], aber er glaubt nicht mehr an die Sinndeutung des Da-
des „philosophischen" Aspekts herein; im zweiten Fall würde dieser Aspekt zu-gunsten herangetragener kunstphilosophischer Annahmen über das Wirken lite-rarischer Texte vernachlässigt. Dass de Man dieses Dilemma nicht berührt, liegt daran, dass ihm das strukturalistische (und damit letztlich empiristische) Modell des Textes als eines irgendwie selbsttätigen, sinngenerierenden Dings unfraglich ist. Er nivelliert die Spannung von literarischem und philosophischem Aspekt, indem er Texte überhaupt als Instanzen von Funktionserfüllungen betrachtet, Funktionen, deren Charakterisierung er kunst- und ästhetiktheoretischen Diskus-sionen entnimmt.
10 Vgl. Binder (1976). 11 Wolfgang Binder beurteilt die Bedeutung der „Kantkrise" insgesamt skeptisch:
Es sei bemerkenswert, dass sie vor allem eine Legitimationsfunktion für Kleists Bemühen erfülle, sich den Ansprüchen seiner Umwelt zu entziehen - das Antre-ten eines festen Amtes, die Heirat mit Wilhelmine von Zenge und die damit ver-bundene Einschränkung seiner Freizügigkeit tauchen wenigstens in den Briefen aus dem Frühjahr 1801 stets in der Nachbarschaft von Schilderungen der durch die Lektüre „kantischer Philosophie" erlittenen Zerrüttungen nebst Angabe des probaten Gegenmittels - reisen! - auf; vgl. Binder 1976, 319.
184 JAN MüLLER
seins, die sie bisher mit sich führten. [...] Dieses Verfugen [...] ist die Ironie des jeder Setzung mitgegebenen Offenlassens." (Binder 1976, 326 u. 328)
Andreas Gelhard hat diese Ironie im Anschluss an Binder sehr treffend mit der pyrrhonischen Isosthenie und der daraus folgenden Urteilsenthaltung in Verbindung gebracht. Kleist nimmt demnach im Text „Über das Marionet-tentheater" eine bestimmte praktische Haltung zu den verwendeten theore-tischen Modellen ein: Er weiß, wie sie funktionieren, lehnt aber ab, sich von ihnen betreffen zu lassen. Statt dessen fuhrt er vor, wie die Wahrheits-effekte der verhandelten Ideologeme im und durch den erzählten Streit ein-treten - wie etwa unbegründete Behauptungen bloß durch ihr Bezeugtsein genauso glaubhaft und plausibel werden, wie die durch den Erzähler in zweiter Ordnung bezeugte Behauptung, es gebe solche Zeugen.12
Man kann diese ironische Haltung auf wenigstens zwei Weisen verste-hen. Die erste, von Wolfgang Binder vorgeschlagene, sieht in den skepti-schen oder relativistischen Konsequenzen, die sie nahelegt, gerade den clou von Kleists Vorgehen. Die zweite, mit Andreas Gelhard anvisierte Deutung sieht Kleists Verdienst umgekehrt darin, eine ironische Haltung vorzufüh-ren, die nicht im Skeptizismus endet. - Binder sieht in Kleists Text unge-fähr folgendes epistemologisches Dilemma:13 ,Es ist kein sicheres Urteil mit Wahrheitsanspruch möglich; also enthalte ich mich des Urteils'. Er-gänzt man das Enthymem um die zweite Prämisse: ,Nur wahre Urteile sind erstrebenswert', dann ist entweder die erste Prämisse wahr, die zweite
12 Vgl. Foucault (1973). Eine analoge Deutung unternimmt Vogl (2004), der sich dabei auf Kleists „Lustspiel" „Der zerbrochene Krug" bezieht. - Vogls Deutung scheint mir deshalb unzureichend, weil er in seiner Lesart Foucaults die juristi-sche Form lediglich als Ausdruck wahrheits- und biopolitischer Praktiken liest. Die Gerichtsverhandlung wird ihm so zu einer Inszenierung der Konstitution des „Falls" aus einer Machtpraktik. Das scheint mir zu kurz zu greifen - denn die wesentliche Differenz des Kleist'schen Anti-Ödipus Adam zum Ödipus des So-phokles ist die Form des Rechts und seiner Anwendung; vgl. Vogl 2004, 116f., und direkt dazu Menke (2010a) und (2011, v.a. Kap. 11,3).
13 Ich supponiere das als Erläuterung von Binders These, Kleists Ironie bestehe eben in der Verwendung idealistischer Theoreme „aus kritischer Distanz" (Bin-der 1976, 328), die von der epistemologischen „Kant-Krise" wenigstens moti-viert sei.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 185
falsch, und die Folgerung beliebig; oder die zweite Prämisse ist wahr -dann gilt die erste nicht unbedingt, und das Dilemma besteht bloß faktisch. Typischerweise folgt aus einer solchen Lage eine quietistische oder volun-taristische Haltung. Präzise dieses Dilemma bespricht Kleists Zeitgenosse Hegel als zwei Gestalten eines „unglücklichen Bewußtseins" - als Versu-che, ein vernünftiges Selbstverhältnis zu konzipieren, die daran scheitern, dass man die skandalöse Inkonsistenz beider Haltungen nicht als Anzeige unzureichender gedanklicher Anstrengung bei der Modellierung, sondern als Merkmal des Modellierten missversteht. Ein so verstandenes Selbstver-hältnis zwingt in der Tat zu einer ,ironischen Haltung' - allerdings einer Ironie, die gegen „das Band [...], in welchem die Menschen und alles ihr Tun und Schicksal sich zusammenhält und Bestehen hat" - gegen die Erfahrung unseres gemeinsamen Lebens - ein „Prinzip" setzt, „welches die subjektive Überzeugung zur Regel macht":
„Ihr nehmt ein Gesetz in der Tat und ehrlicherweise als an und für sich seiend, Ich bin auch,dabei und darin, aber auch noch weiter als Ihr, ich bin auch darüber hinaus und kann es so oder so machen. Nicht die Sache ist das Vortreffliche, sondern Ich bin der Vortreffliche und bin der Meister über das Gesetz und die Sache, der damit, als mit seinem Belieben, nurspieltvnd [darin ...] nur mich genieße" (Hegel 1821, S. 275 u. 279).
Der (so verstandene) Ironiker enthält sich des Urteils, weil er sich von dem, worüber er urteilen könnte, für nicht betreffbar hält. Er übersieht dabei aber erstens, dass er immer schon betroffen ist - dass die Sache einen Anspruch an ihn stellt, ermöglicht ihm ja erst, sich ihm gegenüber indifferent zu ge-ben. Er übersieht zweitens, dass sein scheinbares Nicht-Verhalten eben ge-nau den Ansprach bestätigt, sich (irgendwie) verhalten zu müssen. Binders Kleist ist ein solcher inkonsistenter Ironiker.
Andreas Gelhards Deutung der kleistischen Ironie unterscheidet sich davon durch den Hinweis, dass Kleists Urteilsenthaltung praktisch orien-tiert ist. Ihr geht es nicht um die theoretische Vermutung, dass Erkenntnis, Wissen, sicheres Urteilen prinzipiell unmöglich sein könnten (das wäre ein bloß „akademischer Skeptizismus"14), sondern darum, dass wir erstens im-
14 Diese Formulierung borge ich von Volker Schürmann; vgl. dessen vorzügliche Rekonstruktion in Schürmann 2002, 51 ff.
186 JAN MüLLER
mer schon handeln, wissen und urteilen, zweitens aber die Beurteilung die-ser Tätigkeiten expost und aus reflexiver Perspektive prinzipiell problema-tisch ist. Angesichts des Zeugnisses des kleistischen Erzählers muss die Le-serin urteilen, ob er zuverlässig ist. Darin spricht sich kein epistemologi-sches Dilemma aus, sondern eine normative Frage: Nicht, ob er ein Zeuge ist (sein Zeugnis liegt vor, stellt einen Anspruch an uns), sondern inwiefern er ein mehr oder weniger guter Zeuge ist. Der Bericht ist in der Welt, und wir müssen urteilend mit ihm umgehen, ohne dabei auf generelle Wissens-bestände zurückgreifen zu können, die diesen praktischen Umgang infalli-bel machen könnten.15 Kleist enthält sich nicht einfach eines theoretischen Urteils; er enthält sich des Urteils, ohne dass damit der Anspruch des Urtei-len-Müssens, die unmittelbare Betroffenheit von der Sache, verschwände. Seine Ironie dient dazu, das Verhältnis der theoretischen Unentscheidbar-keit und des praktischen Nicht-Mcfe-Entscheidenkönnens zu artikulieren, ohne einfach höherstufig Unentscheidbarkeit zu proklamieren (= sich dafür zu entscheiden). Gegenstand dieser Ironie sind nicht theoretische Behaup-tungen, sondern der normativ urteilende Umgang mit Handlungen und ih-ren Konsequenzen. In der Tat diskutiert Kleist diese Sphäre des normativen Urteilens über unsere Praxis sowohl in literarischer Form wie in brieflichen Äußerungen in einem solchen Ausmaß, dass man von einem Leitmotiv oder Prinzip seines Dichtens und Denkens sprechen darf. Der Titel für diese Sphäre des normativen Urteilens aber ist das Recht.
2. DIE UNHINTERGEHBARKEIT DES „RECHTS"
Auf den Stellenwert der Behandlung des Rechts im Werk Kleists - als ei-nem der deutschen „Dichterjuristen" am Übergang vom 18. ins 19. Jahr-hundert16 - wurde vielfach hingewiesen. Tatsächlich finden sich in nahezu
15 Wir gehen mit ihm charakteristischerweise nicht so um, dass wir uns des Urteils enthalten: „Darüber kann man nichts sagen" (a) ist eine ebenso unbefriedigende Antwort wie „Das interessiert mich nicht", oder: „das deutet jeder nach seiner Fasson" (b) - denn ad (a): Worüber „kann man nichts sagen"? Und ad (b): Wieso sprechen wir dann miteinander?
16 Vgl. etwa Weitin (2005, 146) und Großmann (2005); als Forschungsüberblick zum Thema generell Hamacher (2003).
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" | 187
allen Erzählungen und Dramen Bezüge zum Recht, zur Rechtspraxis und zur zeitgenössischen Rechtsdiskussion.18 Für dieses Interesse am Recht gibt es einen begrifflichen Grund, der sich biographisch im Zusammenhang mit Kleists mutmaßlicher epistemologischer Desillusionierung herausbildet. Nach einem knappen halben Jahr wird nämlich die „Kant-Krise" von einer veritablen „Rechtskrise"19 überholt. Die „Kant-Krise" bestand in der emp-findlichen Verletzung, die die Vorstellung, theoretische Bildung führe un-mittelbar zur sittlichen Erhöhung, durch die „kantische Philosophie" (vul-go: einen zunächst epistemologischen Skeptizismus) erlitten hatte. Die Ein-sicht, dass unbedingtes' materiales Wissen faktisch nicht zu haben (weil begrifflich sinnlos) ist, nötigte - in der Formulierung Ernst Cassirers - zum „Verzicht auf jene unmittelbare Einheit des Theoretischen und Praktischen, die bisher die naive Voraussetzung all seines Denkens gebildet hatte. [...] [N]un war für ihn die moralische Begreiflichkeit der Welt überhaupt aufge-hoben" (Cassirer 1924, 182f.). So belehrt Kleist die bemerkenswert gedul-dige Wilhelmine von Zenge am 15. August 1801 brieflich mit Verweis auf den ersten rousseau'sehen Diskurs, „der Mensch" sei von einem „morali-sche[n] Bedürfnis [...] zu den Wissenschaften" getrieben (KW II, 682). Nur „Wissenschaft" als Titel vernünftiger Aufklärung ermögliche, sein Handeln an guten Gründen zu messen. Nun, da diese „Wissenschaft" als Titel ver-nünftiger Aufklärung durch die „Kant-Krise" grundsätzlich fraglich gewor-den sei, sei Sittlichkeit nur mehr im Stand der „Unschuld" (ebd.) vorstell-
17 So weist Theodore Ziolkowski (1987, 41 u. 47ff.) auf die Spuren des Allgemei-nen Landrechts als erstem deutschsprachigen modernen Rechtscodex in Kleists „Zerbrochenem Krug" hin.
18 Diese Bezüge werden durchaus kontrovers beurteilt; während Ziolkowski die Kant-Krise als Anlass einer verstärkten Zuwendung zum positiven Recht (ver-mutlich in Form des ALR; Ziolkowski geht so weit zu sagen, Kleist habe - vor allem im „Kohlhaas" - alle vorkommenden Rechtsfragen per analogiam zum ALR erschlossen) unterstreicht, hebt Regina Ogorek (1988) eher die Verwandt-schaft zu den Überlegungen Adam Müllers hervor, die zur Debatte Naturrecht-Rechtspositivismus durchaus quer stehen. Soweit ich sehe, erlauben solche Rückschlüsse zwar die Erläuterung einzelner Motive durch Verweis auf ihre mutmaßlichen Quellen, tragen aber zur Erläuterung ihrer Funktion in Kleists Werken nicht unmittelbar bei.
19 Zum Ausdruck vgl. Ziolkowski (1987).
JAN MüLLER
bar. Die Rede von „Unschuld" artikuliert die Idee einer unmittelbaren tu-gendhaften Sittlichkeit20 - freilich eine paradoxe, selbst durch ein Dilemma motivierte Idee: Wenn unser absichtsvolles Handeln immer auf seine Güte befragbar ist (These 1), das Wissen darum, wie diese Frage beantwortet werden könnte, diese prinzipielle Befragbarkeit jedoch nicht zum Ver-schwinden bringt (These 2), dann sind beide Thesen nur vereinbar im Licht der Idee eines unmittelbar sittlichen Handelns, eines Handelns also, bei dem nicht nach der Güte des Handelns als Handeln gefragt werden muss, weil es unmittelbar sittlich ist.
Kleist operiert hier mit derselben Idee eines unmittelbaren, mithin un-ausgesprochenen und unaussprechlichen Einklangs des individuellen Han-delns mit den Normen der Gemeinschaft, die Hegel unter dem Titel einer „antiken Sittlichkeit" diskutiert. Und wie bei diesem die antike Sittlichkeit sich darin, dass sie thematisiert werden kann, als schon überschritten und prekär erweist - als Ideal gemeinschaftlicher Sittlichkeit, mit dem das indi-viduelle Handeln gerade nicht übereinstimmt21 - , so begreift Kleist den Stand der „Unschuld" als einen, der überhaupt nur deshalb verständlich und thematisierbar ist, weil er verlassen wurde. Das vernünftige Subjekt kann sich als eines begreifen, das unmittelbar unter Normen steht; das gehört zum Begriff eines vernünftigen Selbstverhältnisses. Es kann von seinem Unter-Normen-Stehen aber nur wissen, insofern es sich zu diesen normati-ven Ansprüchen anerkennend oder ablehnend22 verhalten kann, mithin die Unmittelbarkeit des Anspruchs bezweifeln kann. Dieses Zweifelnkönnen an den Normen, unter denen das Subjekt sich wiederfindet und an denen es sich urteilend misst, begründet die grundsätzliche Fraglichkeit der prakti-schen Geltungsansprüche (die theoretischen Wissensansprüche sind dabei nur eine Variante der praktischen Ansprüche). Die Idee unmittelbarer sittli-cher Unschuld macht die praktische Prekarität unseres Urteilens verständ-
20 Vgl. den Beitrag von Christoph Halbig in diesem Band. 21 Kreons Berufung auf die „Gesetze der Väter" ist verständlich erst von Antigones
Zuwiderhandeln her, und umgekehrt ist ihr Zuwiderhandeln als individuelles Handeln nur vom Konflikt mit der (geistlosen) Gemeinschaft her verständlich. Vgl. Hegel 1807, 322 u. v. a. 348f.
22 „Ablehnen" und „anerkennen" sind hier freilich keine Gegensätze: Den An-spruch ablehnen heißt, ihn als Anspruch anerkennen und sich dazu ablehnend verhalten - „Ablehnung" ist ein Modus des Anerkennens.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 1 89
lieh. Umgekehrt kann man von dieser Idee der Unschuld keine Orientierung erhoffen: Ihre definitionsgemäße Unmittelbarkeit sorgt dafür, dass sie hochgradig ambivalent ist. Das sieht Kleist: „Wenn die Unwissenheit unsre Einfalt, unsre Unschuld und alle Genüsse der friedlichen Natur sichert, so öffnet sie dagegen allen Greueln des Aberglaubens die Tore" (KW II, 682) - auf ihr lassen sich keine Normen begründen. „Unschuld" ist attraktiv nur im Lichte unhintergehbarer Schuldverhältnisse, die sich aus der Unsicher-heit unserer theoretischen und praktischen Urteilsmaßstäbe ergeben.
Kleist zieht aus dieser Einsicht eine verblüffend radikale Folgerung. Wenn „niemand den Zweck seines Daseins [...] kennt, wenn die menschli-che Vernunft nicht hinreicht, sich und die Seele [...] zu begreifen, wenn man seit Jahrtausenden noch zweifelt, ob es ein Recht gibt", und der Bezug auf göttliche Offenbarung durch kulturellen Pluralismus fragwürdig wurde, weil etwa „[dieselbe Stimme, die dem Christen zuruft, seinem Feinde zu vergeben, [...] dem Seeländer zu[ruft], ihn zu braten, und mit Andacht ißt er ihn a u f (KW II, 683) - dann scheint reine Aktivität das einzig positiv An-sprechbare zu sein: Es „liegt eine Pflicht auf den Menschen, etwas Gutes zu tun [...], schlechthin zu tun" (KW II, 684). Das klingt wie ein Plädoyer für einen theoretischen Voluntarismus.23 Kleists Satz: „so mögen wir denn vielleicht am Ende tun, was wir wollen, wir tun recht" (KW II, 682), besagt
23 Äußerungen wie diese motivieren Ernst Cassirer zu seiner Engführung Kleists mit Fichtes Subjektphilosophie: „Im Tun allein liegt die Rettung; das Tun aber kann nicht warten, bis das Wissen mit seinen Erwägungen und Bedenken zu Ende gelangt ist. Es muß glauben und wagen; es muß in den Gang der Dinge eingreifen, unbekümmert darum, ob sich die Wirkung und der Erfolg dieses Eingreifens im voraus berechnen läßt" (Cassirer 1924, 194f.). Cassirer meint, Kleist verzweifle daran, dass Normen, nicht anders als Sachverhalte, nicht mehr erkannt werden könnten; und er meint, Kleist folge Fichtes Lösungsvorschlag, dieses erkenntnistheoretische Problem durch einen argumentativen Ebenen-wechsel anzugehen: Wenn auch die Normen des Handelns prinzipiell fraglich seien, so sei doch die reine Aktivität, das reine Tun, unfraglich und tauge zum Grundstein eines epistemologischen, und erst davon abgeleitet auch moralphilo-sophischen, Begründungsprogramms. - In diesem Essay wird eine entgegenge-setzte Deutung vorgeschlagen: Sittliche Normativität ist nichts Fragliches, das erst der begründenden Konstitution bedürfte. Sie ist unfraglich wirklich - nur deshalb ergibt sich das scheinbare Dilemma.
190 I JAN MüLLER
aber gerade nicht, dass es so etwas wie „Recht" deshalb, weil es nicht er-kenn- und begründbar ist, nicht gebe - weshalb es nur darum gehen könne, überhaupt rege zu sein. Der Satz besagt lediglich, dass die Begründung von „Recht" als offenbarte absolute Norm (oder als System solcher Normen) prinzipiell problematisch ist, weshalb jedes Handeln unvermeidlich die Frage ermöglicht, ob und wie es eine Norm erfüllt. Die Frage danach, ob ein Handeln z.B. „gut" ist, lässt sich nur stellen, wenn es im veritablen Sinn gut sein kann; das ist die Idee unmittelbarer Unschuld. Zugleich stellt sich immer schon die Frage, wie das Handeln einer Norm entspricht: Wir tun, nolens volens, wenn wir handeln, mehr oder weniger „recht", und geben darüber Auskunft mit Bezug auf das System explizit Geltung beanspru-chender Normen: das positive Recht. Diese Auskunft freilich bleibt streit-bar, weil fallibel und nicht alternativlos - deshalb ist die „seeländische Kü-che" so irritierend.
3. „SCHICKSAL" UND „RECHTSGEFüHL": FIGUREN DER AUSTRAGUNG NORMATIVER SPANNUNGEN
Kleist arbeitet sich an einer Spannung ab: Der Spannung zwischen der Idee unmittelbarer sittlicher Angemessenheit eines Handelns - seiner unbeding-ten Gerechtigkeit - und der Fallibilität aller abwägenden Beurteilung eines Handelns - seiner relativen Rechtmäßigkeit. Damit bewegt er sich durchaus im Kontext des mit dem Beginn der Neuzeit einsetzenden „Umbaus des Rechtsbewußtseins für die moderne Gesellschaft".24 Zuvor begründete die klassische „ius"-Semantik des Rechts die reziproken Verpflichtungs- und Berechtigungsverhältnisse zwischen Menschen durch eine transzendente Idee der Gerechtigkeit: Zwischen Menschen bestehen natürliche Verpflich-tungen, die das Recht nur noch benennt. Rechte kommen Menschen spezi-ell, d.h. ad personam zu, weil sie logisch in der Idee der Gerechtigkeit gründen. Das souveräne Recht bildet so unmittelbar die Norm sittlich guten Handelns. Eine solche naturrechtliche Begründung wird, so Luhmann, ei-nerseits von seinen Begründungslasten erdrückt, andererseits von der Aus-differenzierung der modernen Gesellschaft überholt. So kommt es auf drei Ebenen zur Herausbildung der Gestalt subjektiver Rechte. Erstens wird die
24 Vgl. zum Folgenden Luhmann 1981.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 191
Funktion des Rechts - mit Luhmann: die Herstellung von „Erwartungssi-cherheit" - von dem Anspruch entkoppelt, zugleich sittlich gerechtfertigte Normen zu vertreten. „Rechtmäßigkeit" und „Gerechtigkeit" werden unter-schieden. Zweitens wird der Anspruch auf Recht - das Recht auf Rechte -von singulären, faktischen und symmetrischen Verpflichtungsverhältnissen zwischen speziellen Personen entkoppelt. Subjektive Rechte etablieren erst asymmetrisch Ansprüche gegen „jeden": „Dass Recht auf (subjektive) Rechte umgestellt wird, heißt, dass Rechte den Verpflichtungen vorher ge-hen und sie daher hervorbringen" (Menke 2008, 88). Drittens werden die subjektiven Rechte (gleich, ob absolut oder relativ) auf die Fähigkeit des Rechtssubjekts gegründet, diese Rechte wahrzunehmen und selbst Adressat von Ansprüchen zu sein. Verpflichtungsverhältnisse bestehen nicht natür-lich und faktiv, sondern sie bestehen vom Recht her, indem sie mit Verweis auf das Recht geltend gemacht werden. Darin liegt - neben dem Wegfall einer unbedingten, natürlichen Rechtsbasis - die zweite rechtsphilosophi-sche Herausforderung: Auch die aufklärerische Rechtsphilosophie, die in einem emphatischen Begriff subjektiver Freiheit ein argumentatives Äqui-valent zur Begründungsstrategie naturrechtlicher Konzepte entwickeln wollte, wird von der Entwicklung des positiven Rechts überholt. Die Ent-kopplung von „Recht" und „Gerechtigkeit" bedeutet,
„dass die Freiheit, die das Recht, als verbindliches Gesetz, zu begründen vermag, al-so die Freiheit der Autonomie, nicht die Freiheit ist, die das Recht, als subjektives Recht, impliziert oder voraussetzt. Denn die Freiheit, die die Träger subjektiver Rechte haben (müssen), ist nicht die Freiheit der Autonomie, sondern individuelle oder private Willkür. Und zwar gilt dies allein aufgrund der Form subjektiver Rech-te. Gleichgültig wozu sie da sind und worin sie begründet sind: subjektive Rechte konzipieren (oder .adressieren') ihre Träger als Individuen mit privater Will-kürfreiheit" (Menke 2008, 89) - nicht als autonome Subjekte.
Dem (positiven) Recht mangelt etwas: Es gewährleistet gerade nicht die Freiheit im Sinn einer sittlich unmittelbar angemessenen Autonomie, für deren Denkbarkeit es doch allein das Modell abgibt. Kleists Dichtungen -seine Erzählungen und Stücke - inszenieren in immer neuem Anlauf Vari-anten, wie mit diesem Dilemma praktisch umgegangen werden kann. Stets geht es dabei um drei Fragen: (a) Wie ist damit umzugehen, dass rechtes Handeln sein Maß an bloß faktisch geltenden, überkommenen Normen fin-
192 JAN MüLLER
den kann - Sittlichkeit mithin wie eine Unterwerfung unter solche Normen erscheint? (b) Wie ist damit umzugehen, dass diese Normen allein dem An-spruch auf „Gerechtigkeit" genügen können - und zugleich „Rechtmäßig-keit" von „Gerechtigkeit" grundsätzlich verschieden scheint? (c) Wie lässt sich im Licht dieser beiden Fragen mit der Idee praktischer Freiheit als Selbstgesetzgebung umgehen - wie lassen sich bloße Unterwerfung unter je schon geltendes Recht einerseits und schiere Souveränität der Selbstlegisla-tur andererseits vermeiden? Ich entwickle diese Fragen exemplarisch an kleistischen Figuren:
(a) Dem Handeln gehen die Normen seiner Beurteilung immer schon voraus. Handeln steht unmittelbar unter Normen; es ist in seiner Form nor-mativ. Das macht die „Setzung" von Normen zu einem paradoxen Akt: Spricht man eine Norm als Gesetz an, dann wird gesetzt, wovon bean-sprucht wird, dass es unmittelbar je schon in Geltung war. Zugleich ge-winnt die Norm ihren bestimmten Gehalt erst in und durch die Setzung. Je-de Setzung ist in gewisser Hinsicht gewalttätig: Sie fordert, man solle aner-kennen, dass das Gesetzte unabhängig von seiner Setzung in bestimmter Gestalt immer schon gegolten habe. Diese Anerkennung reicht aber zur Begründung des bestimmten Gehalts des Gesetzten nicht hin. Anerkennen lässt sich, dass eine Norm unmittelbar gegolten habe; dass es gerade diese bestimmte Norm war, wie sie nach ihrer Vermittlung als Gesetztes sichtbar wird, lässt sich nur behaupten. Die unmittelbare sittliche „Unschuld" taugt nicht zur Begründung von Rechtssetzungen, die mit dem Anspruch auftre-ten, die unmittelbare Normativität „unschuldiger" Sittlichkeit explizit zu machen. Wer so argumentiert, verfehlt das, was er unter dem Titel „Un-schuld" in Anspruch nehmen wollte. Umgekehrt ändert die Kritik am Recht, dass seine Geltung unbegründbar und seine Gehalte kontingent sei-en, nichts an seiner Wirklichkeit. Das ist das Thema der Erzählung „Das Erdbeben von Chili": Nachdem ein Erdbeben den wegen seiner Beziehung zu einer Schutzbefohlenen verurteilten Protagonisten (kurz, bevor er sich erhängen kann) befreit, trifft er seine - ebenfalls knapp der Hinrichtung entgangene - Geliebte Josephe und das gemeinsame Kind, und sie fliehen vor die Stadt, wo sie - bezeugt dadurch, dass Josephe den hungrigen Säug-ling anderer Überlebender stillt - „unter einem Granatapfelbaum" (KW II, 150) Freundschaft mit einer hochstehenden Familie schließen. Die Naturka-tastrophe hat, wenigstens punktuell, die Geltung des Rechts zugunsten einer
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 193
unmittelbaren, paradiesischen Tugend ausgesetzt.25 Tim Mehigan meint, diese „idyllische" Szenerie artikuliere ein rechtsphilosophisches Ideal Kleists: Es ziele auf eine vernünftige Menschengemeinschaft, in der die ge-sellschaftlichen Standesunterschiede verschwunden seien, und Recht und Rechtsprechung sich an „experience, tact and sympathetic impartiality" der Richterpersönlichkeit orientierten (Mehigan 2010, 168). Kleists Erzählung markiert jedoch deutlich, dass die idyllische Anmutung bloß scheinbar und ausnahmsweise besteht: „Auf den Feldern, so weit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen" (KW II, 156) - der Satz behauptet eine Idylle, indem er sie durch explizite Nennung der Stände dementiert. Vollends sichtbar wird der Scheincharakter der Idylle, als die unmittelbare, sich im Figurenverhalten nur ausdrückende Sittlichkeit expli-ziert und begründet werden soll. Die Rückkehr in die Stadt, in der das Aus-nahme-Idyll durch einen Kirchgang beglaubigt werden soll, endet katastro-phal: Die Predigt nimmt das rechtsaussetzende Erdbeben als Gottesurteil wieder ins Recht hinein; es kommt zum Aufruhr, in dem ein religiös fanati-sierter Mob die Protagonisten lyncht.
Ist das unmittelbare Wirken der Sittlichkeit in dieser Geschichte am si-tuativen Konflikt zweier Normen- und Rechtsordnungen dargestellt, so in den „Geschwistern Schroffenstein" durch das unhintergehbare Bestimmt-sein durch ererbtes Recht: Ein Erbvertrag zwischen den beiden Familien-stämmen der Schroffensteins, entworfen, um den Fortbestand des Hauses zu sichern, determiniert das Verhältnis aller Akteure zueinander. Auch hier wird die Geltung des Vertrags und der aus ihm folgenden Rechts- und Ra-chehändel zu Beginn auf eine transzendente Instanz bezogen. Der Rache-schwur Ruperts im ersten Akt findet nicht zufällig in der Schlosskapelle statt, wo der Kirchenvogt erläutert: „Ei, Herr, der Erbvertrag gehört zur Sa-che./ Denn das ist just als sagtest Du, der Apfel/ gehöre nicht zum Sünden-fall" (I, 184ff.).27 In einem Geflecht von archaischen Retributionsgeboten
25 In der Stadt selbst freilich herrscht Ausnahmerecht; es werden „Galgen ausgerichtet], um der Dieberei Einhalt zu tun" (KW II, 151).
26 Vgl. Mehigan 2010, 163. 27 Der Gottesmann wird zusätzlich, und nicht eben positiv, dadurch charakterisiert,
dass er den situativen Anlass für das Auflodern des Konflikts für ganz unprob-lematisch hält: das unter Folter erpresste Geständnis eines Untertans von Sylves-
194 JAN MüLLER
und Erbrecht töten die verfeindeten Vettern schließlich in einer skurrilen Verwechslungsszene jeweils ihr eigenes Kind (die sich shakespeare'sch trotz der Familienfehde verliebt hatten). Die Begründung der Normen und ihrer motivierenden Wirkung geht unterdessen verloren. Unmittelbar, nachdem Rupert seinen Sohn - den er für Sylvesters Tochter Agnes hält -erstochen hat, wendet er sich zerstreut an seinen Vasallen und bittet um ei-ne Erklärung seiner Tat: „Warum denn tat ichs, Santing? Kann ich es/ Doch gar nicht finden im Gedächtnis"; und Santing antwortet, als würde das den Mord begründen: „Ei,/ Es ist Agnes" (V/I, 2515ff.). Die Dramenhandlung entfaltet sich mit schrecklicher Folgerichtigkeit, und doch urteilt die unbe-teiligte Ursula am Ende: „Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen" (V/I, 2706). Das Blutbad unter den Schroffensteins ist kein Zufall: Jeder Schritt resultiert aus der Befolgung geltender Normen und Gesetze - und es ist doch ein Versehen, weil die es regierenden Normen grundlos und kon-tingent sind.28
(b) Dass sich das unmittelbare Gelten der Normen und ihrer Repräsen-tation, des Rechts, nicht im Rückgriff auf externe Autorität oder eine hö-herstufige Idee begründen lässt, berechtigt nicht dazu, die Wirklichkeit und Wirksamkeit ihres Gehens auszublenden. Die Entkopplung von Recht und Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass beide nichts miteinander zu tun hätten. Sie unterstreicht nur, dass eine substantielle Idee von Gerechtigkeit nicht in der Verfahrensform des positiven Rechts aufgeht, wie umgekehrt die Gel-tung positiven Rechts, artikulierter Normen sich nicht hinreichend durch den Verweis auf eine solche substantielle Idee begründen lässt. Gerade die-se Spannung ist es, die das Recht beständig unter Legitimationsdruck setzt: Die Frage danach, ob und wie das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit faktisch realisiert ist und vernünftig gedacht werden kann, ist Ausdruck der Entkopplung von Recht und Gerechtigkeit, und entfaltet direkt eine aufklä-rende Wirkung. Sie impliziert die Unterscheidung zwischen der Unmittel-barkeit geltender sittlicher Normen und der Geltung positiver Rechtssätze, eine Unterscheidung, die gerade nicht mehr auf der Begründung des Rechts durch eine Gerechtigkeitsidee beruht, sondern vom Recht her und mit den begrifflichen Mitteln des Rechts vorgenommen wird. Spricht man über eine
ter, er habe auf dessen Befehl Ruperts Sohn, der tatsächlich ertrunken ist, er-mordet.
28 Vgl. dazu den Beitrag von Sarah Schmidt in diesem Band.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 195
unmittelbare, noch nicht thematisierte Sittlichkeit, dann tut man das mit den Mitteln des Rechts-Sprachspiels. Die Formulierang und Reflexion einer Idee der Gerechtigkeit bedient sich der normativen Grammatik des Rechts; der Bezug auf eine solche sittliche Idee (auf eine unmittelbar wirksame Norm) ist kein Bezug auf etwas außerhalb des Rechts, sondern eine Diffe-renzierung im Recht. Deshalb löst der Bezug das Legitimationsproblem faktisch geltenden Rechts nicht, sondern er artikuliert es. Einerseits ist das Recht die Form, in der normative Anerkennungs- und Verpflichtungsver-hältnisse zwischen Menschen überhaupt angesprochen werden können; „Recht" ist eine Gestalt von Sittlichkeit. Andererseits scheitert es daran, weil die unmittelbaren praktischen Verhältnisse unter Menschen in der rechtsförmigen Explikation begrifflich nicht aufgehen. Einerseits taugt der Bezug auf die sittliche Idee kategorial nicht zur Begründung des Rechts; andererseits ist er unverzichtbar, weil er die indisponible Kontingenz des Rechts und seine praktische Unhintergehbarkeit zu thematisieren ermög-licht. Diese Spannung organisiert die Novelle „Michael Kohlhaas": Kohl-haas, einer der „rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit" (KW II, 9), opponiert gegen das ihm vom selbstherrlichen Jun-ker Tronka zugefügte Unrecht, indem er die Rechtmäßigkeit des Rechts, dem er untersteht, bezweifelt. Insofern ist er „ent-setzlich". Zugleich lässt er als Lösung des Konflikts nur gelten, im Recht und durch das Recht ent-schädigt zu werden. Das Gespräch mit Luther zeichnet den weiteren Fort-gang vor: Kohlhaas habe, sagt Luther (ganz staatskirchenmännisch) „in Verfolg eigenmächtiger Rechtsschlüsse" (KW II, 45) gehandelt und sich damit aus der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen.29 Kohlhaas erwidert da-rauf: Das stimme nur, wenn er Teil der Rechtsgemeinschaft wäre: „Der Krieg, den ich mit der Gemeinheit der Menschen führe, ist eine Missetat, sobald ich aus ihr nicht [...] verstoßen war" (ebd.); insofern ihm aber „der Schutz der Gesetze versagt" sei, könne er sich auch nicht aus der Rechts-gemeinschaft ausschließen. Daraus ergibt sich ein catch 22: Die sächsische Regierung akzeptiert - freilich eher aus Angst vor seiner Rebellentruppe -Kohlhaas' Rechtsanspruch; sie begnadigt ihn unter dem Vorbehalt, dass er „bei dem Tribunal zu Dresden mit seiner Klage, der Rappen wegen", ange-nommen wird (KW II, 53). Kohlhaas aber ist seine Zugehörigkeit zur
29 Vgl. dagegen Ziolkowski 1987, 45: nach ALR II 20, §§159ff., sei Kohlhaas et-wa durchaus berechtigt zu seinem Feldzug gewesen.
196 I JAN MüLLER
Rechtsgemeinschaft ganz prinzipiell fragwürdig geworden. Was, so argu-mentiert er, wenn die Amnestie bloß scheinbar und aus strategischem Kal-kül gewährt worden wäre? Um also der Regierung „den Schein der Gerech-tigkeit [zu verweigern, JM], während sie in der Tat die Amnestie, die sie ihm angelobt hatte, an ihm brach" (KW II, 71), bezichtigt er sich der Rä-delsführerschaft einer aus seinen Truppen hervorgegangenen Räuberbande. Kohlhaas ist nicht (nur) trotzig: Er sah sich vom Recht ausgeschlossen, und erst die Amnestie macht ihn wieder zum Rechtssubjekt. Würde die Amnes-tie nun gebrochen, obwohl sein Prozess fortgeführt wird, dann wäre der Rechtsprozess eine Farce - ein Geschenk der Regierung an ihn, der als In-haftierter eigentlich keinen Prozess führen dürfte. Allein die selbstmörderi-sche Selbstbezichtigung kann sicherstellen, dass Kohlhaas' Prozess „der Rappen wegen" keine Farce ist, sondern ihm als Rechtssubjekt zusteht; und sichergestellt ist das genau dann, wenn Kohlhaas zugleich Rechtssubjekt im kapitalstrafbewehrten Landfriedensbruchprozess ist. Erst das Urteil, das Kohlhaas final aus der Rechtsgemeinschaft ausschließt, gibt die Gewähr für seinen Status als Rechtssubjekt. ,,[H]eut ist der Tag", sagt der Kurfürst am Ende, „an dem dir dein Recht geschieht" (KW II, 101) - Restitution seines Eigentums und Enthauptung.
Die Tragik der Geschichte liegt darin, dass das Recht, das Kohlhaas ge-schieht, nicht mehr als ein menschliches, kontingentes positives Recht ist noch sein kann. Die irrwitzige „Zigeunerinnen"-Episode am Ende der No-velle führt noch einmal, und dramaturgisch ziemlich unbeholfen, die Mög-lichkeit vor, sich auf ein transzendent, nämlich in der Person des absolutis-tischen Souveräns begründetes Recht zu beziehen. Die unbekannte Prophe-zeiung über seine Zukunft drängt dort den Kurfürsten dazu, das Recht (frei-lich zu seinen eigenen Zwecken) rechtskräftig auszusetzen. Würde Kohl-haas ihm das gestatten, dann würde er die Geltung seines Zivilprozesses un-terminieren. Gerechtigkeit ist (nicht nur für Kohlhaas) nur in der Form menschlichen Rechts zu haben, weil sich Gerechtigkeit nur in der Form der Rechtmäßigkeit, oder vom Recht her, verstehen lässt.
(c) Diese Spannung schließlich hat unmittelbar Konsequenzen für die Form subjektiver Selbstverhältnisse - denn sie zwingt zu einer Revision der Kleist zeitgenössischen Versuche, die Geltung des Rechts über den Begriff subjektiver Freiheit zu begründen. „Autonomie" als Fähigkeit zur Selbstge-setzgebung führt zum Dilemma der Selbstunterwerfung. Kant hatte dieses Dilemma, das noch Rousseaus Verständnis von Autonomie charakterisierte,
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 197
umgangen, indem der das „Selbst" in der Rede von „Selbstgesetzgebung" nicht mehr auf den Akt der Legislatur bezieht, sondern als Bestimmung des Gesetzes denkt:30 Das Sittengesetz einsehen ist bereits, es sich zu geben, und diese Verpflichtung durch das Sittengesetz ist der Begriff des „Willens überhaupt" als guter Wille - ist der Begriff der Freiheit. Kleist ringt indes damit, dass die Ausdrücke „Recht", „Pflicht" etc. in diesen Charakterisie-rungen einerseits in engster Verbindung zur Sprache und Praxis des Rechts stehen - das Recht aber andererseits nicht leisten kann, was mit ihm be-gründet werden soll. Das Recht thematisiert das Rechtssubjekt gerade nicht als autonomes Subjekt, sondern als willkürfreies Individuum; gerade dieser Effekt der modernen Rechtsentwicklung macht die Abkopplung des Rechts von der Idee substantieller Gerechtigkeit als Mangel erfahrbar. Auch Kleist bemerkt, dass „das Recht zu einem bestimmten Wollen und Handeln zu ha-ben, nicht [heißt], in diesem Wollen und Handeln recht zu haben" (Menke 2008, 90).
Entweder funktionieren die Ausdrücke „Gesetz", „Pflicht" usf. in der philosophischen Erläuterung der Autonomie ganz anders als ihre Homo-nyme im Rechtsdiskurs. Der Versuch der Aufklärung, die Geltung des Rechts in der Geltung des Sittengesetzes zu gründen, wäre dann eine metäbasis eis alle- genos - schlechte, weil unbemerkte Metaphysik. Oder aber: Die Art, sich zu sich als autonomem Subjekt zu verhalten, greift auf die Redemittel des Rechtsdiskurses und ihre logische Grammatik zurück; die Ausdrücke und ihr Gebrauch sind in beiden Redekontexten (prinzipiell) dieselben. Das verlagert die Spannung von Recht und Gerechtigkeit ins Subjekt - ein Subjekt, dass sich nur als Individuum, als Rechtssubjekt, an-sprechen kann, und dem das Ungenügen dieser Ansprache in jedem Kon-flikt von „eigenem Gesetz" und dem indisponibel schon geltenden positi-ven Recht sichtbar wird. Beide Perspektiven wären ihm praktisch unange-messen, verstünde man sie exklusiv. Versucht man beide zugleich einzu-nehmen, ergibt sich eine Spannung, die bei Kleist den Titel „Rechtsgefühl" trägt. So heißt es über Michael Kohlhaas: „Das Rechtsgefühl [...] machte ihn zum Räuber und zum Mörder" (KW II, 9). Man hat das so gelesen, als berufe Kohlhaas sich für seine Kritik am positiven Recht auf eine irgend-wie unmittelbare, gefühlte Idee der Gerechtigkeit. Das „Rechtsgefühl" kann aber keine so verstandene Begründungsfunktion für ein alternatives adper-
30 Hier folge ich Menke 2010b, 678.
198 I JAN MüLLER
sonam-Recht erfüllen. Es ist kein zweifelsfreies „inwendiges Orakel", weil Kleist es nicht als unfehlbar begreift und darstellt. Kohlhaas' „Rechtsge-fühl" zwingt ihn, gerade weil es prekär und nicht abschließend verifizierbar ist, der kurfürstlichen Amnestie zu misstrauen und so selbst seinen Nieder-gang einzuleiten. In den „Geschwistern Schroffenstein" beharrt Ruperts Frau, als erste Zweifel an der Schuld Sylvesters auftauchen: „über jedwedes Geständnis geht/ Mein innerstes Gefühl doch" (TL/2, 1617f.) - und täuscht sich.31 Die Berufung auf ein „Rechtsgefühl" gibt nicht (im Namen der Ge-rechtigkeit) einen Grund gegen das Recht, sondern zeigt ein Problem im Umgang mit dem Recht an. Das moderne Recht stellt das Recht auf subjek-tive Rechte - auf Ansprüche und Pflichten - sicher. Damit kann es nicht als „Instrument zur Durchsetzung substanzieller Gerechtigkeitsvorstellungen" (Menke 2008, 89) dienen - wohl aber zu ihrer Formulierung.
4. „ÜBE R DAS MARIONETTENTHEATER": VOM SCHEITERN PHILOSOPHISCHER ANTWORTEN AUF PRAKTISCHE FRAGEN
Hegel modelliert die Spannung zwischen „Rechtsgefühl" und unmittelbar geltendem Recht so: Das Recht beansprucht unbedingte Geltung; und ich bin seinem Gesetz unterworfen. Das Gesetz zwingt mich, weil nicht ich es gesetzt habe. Nur ein Gesetz, das ich mir selbst gegeben hätte, würde mich nicht zwingen. Genau das, meint Hegel, ist nicht denkbar: Als Gesetz ist das Gesetz allgemein; es betrifft mich nur als ,einen von allen', als Individuum - nicht als wirkliches Selbstbewusstsein. Das macht die Form des Gesetzes aus. Im unmittelbaren Vollzug des Handelns bleibt das unthematisch; Sitt-lichkeit, der Vollzug des gemeinschaftlichen Lebens, besteht im situativen Zusammenfallen von Norm und Normgefühl. Weil das Handeln aber sub-jektives Handeln ist, muss es immer nach Maßgabe der artikulierten Nor-men - des Rechts - beurteilt werden können; und dabei muss es prinzipiell zum Auseinanderfalten beider Perspektiven kommen können. Was Kleist „Rechtsgefühl" nennt, behandelt Hegel unter dem Titel „Gewissen": „Das Gewissen drückt die absolute Berechtigung des subjektiven Selbstbewußt-
31 Das arbeitet Wolfgang Binder sehr deutlich heraus; vgl. Binder 1976, 323.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 199
seins aus, nämlich in sich und aus sich selbst zu wissen, was Recht und Pflicht ist, und nichts anzuerkennen, als was es so als das Gute weiß, zu-gleich in der Behauptung, daß, was es so weiß und will, in Wahrheit Recht und Pflicht ist" (Hegel 1821, 255). Die Anerkennung dessen, was das Ge-wissen zu wissen meint, bedarf freilich der Formulierung im Recht. Artiku-liert man die Norm in dieser Form, dann betrifft sie mich wieder nur so, dass sie mich als Individuum adressiert, mithin den Einspruch des Gewis-sens gegen solchen Zwang provozieren können muss. Kleist versteht diese Spannung richtig: als praktische, die im wirklichen Tun und Handeln im-mer aufbricht und eine praktische Vermittlung erzwingt. Im „Prinzen von Homburg" klingt das, bei aller patriotischen Schrillheit, durch: Der Prinz, der - schuldlos, aber unbedacht - den Befehl des Kurfürsten verletzt, wird in Abwesenheit zum Tod verurteilt („Wer immer auch die Reuterei geführt/ [...] Damit ist aufgebrochen, eigenmächtig/ [...] Der ist des Todes schuldig, das erklär ich,/ Und vor ein Kriegsgericht bestell ich ihn"; II/9, 715), ob-wohl er sich keiner Schuld bewusst ist.32 Der allzu menschliche Kurfürst begnadigt ihn seiner dem Prinzen zärtlich zugetanen Tochter Natalie zulie-be - aber nur, falls der Prinz unter Eingeständnis seiner Schuld um diese Gnade bitte. Der Prinz steht nun vor einem Dilemma: Dass er unrecht han-delte, wie es das Recht sagt, sieht er nicht ein; andererseits ist sein Leben bedroht. „Daß er [der Kurfürst, JM] mir unrecht tat, wies mir bedingt wird,/ Das kann ich ihm nicht schreiben; zwingst du mich,/ Antwort, in dieser Stimmung, ihm zu geben,/ Bei Gott! so setz ich hin, du tust mir recht" (IV/4, 1356ff). Nach einer patriotischen Ermannung wird aus Todesangst die Einsicht, dass ein Gnadengesuch die Geltung des Kriegsrechts, und da-mit die souveräne Autorität des Kurfürsten gefährden würde. Für Homburg geht es um die Integrität seines, allerdings am Absolutismus Preußens ge-schulten, Gewissens: Das Gnadengesuch relativierte den Rechtsgaranten; die Berufung auf diesen Rechtsgaranten war aber die Grundlage für Hom-burgs Gewissensurteil: „Mir war der Schatten seines Hauptes heilig" (III/l, 915). Beharrte Homburg auf seinem Rechtsgefühl, dann dementierte er sei-ne Geltung, und deshalb entscheidet er sich tragisch: „Ich will das heilige Gesetz des Kriegs,/ Das ich verletzt, im Angesicht des Heers,/ Durch einen
32 Immerhin half er die Schlacht gewinnen, nicht verlieren.
200 I JAN MüLLER
freien Tod verherrlichen!" (V/7, 1750ff.) Tragisch ist das, weil der Kon-flikt zwischen positivem Recht und unmittelbarem Rechtsgefühl seinen Grund in der antidemokratischen Verfassung des im „Prinzen von Hom-burg" geltenden Rechts hat. Der Heroismus des Prinzen ist nicht einfach (wie jeder Heroismus) lächerlich, sondern bitter. Wenn „überhaupt von ei-nem Heldentum hier die Rede sein kann", so Klaus Lüderssen, „dann da-von, daß der Prinz die Demütigung, die man ihm letztlich zuteil werden läßt, akzeptiert" (Lüderssen 1985, 74). Der Prinz von Homburg ist eine mo-derne Figur: Seine Modernität besteht in der Erfahrung, dass geltendes Recht und sittliche Selbstwahrnehmung auseinanderfallen können und mit dieser Erfahrung beide Perspektiven nie unproblematisch gewesen sein werden.
In der zweiten Anekdote des Gesprächs „Über das Marionettentheater" behandelt Kleist diese moderne Problemlage am Versuch, eine unmittelbar graziöse, gelungene Bewegung handelnd zu wiederholen. Entgegen ver-breiteten Deutungen geht es Kleist dabei nicht darum, „Grazie" und „Be-wusstsein" gegeneinander auszuspielen.34 Die Differenz von Bewusstheit und Unbewusstheit ergibt sich nur beiläufig, nämlich als Folge der Diffe-renz zwischen unmittelbarem Vollzug und der absichtsvollen Wiederho-lung, in der „Grazie" als bezweckter Sachverhalt repräsentiert35 und die Verwirklichung des Zwecks schrittweise mit dem vorgesetzten Zweck ver-
33 Die Tragik beruht hier freilich auf der Idee des im doppelten Souveränkörper gegründeten Rechts. Gnade als Rechtsaussetzung kann im modernen Recht auch komisch inszeniert werden; vgl. zum „Zerbrochenen Krug" Menke (2010a, 2011); zur ambivalenten Art, in der die Gnade im „Prinzen von Homburg" ge-währt wird, vgl. dagegen Großmann (2005).
34 „Der Verlust der Grazie geht nicht auf Rechnung der Reflexion als solcher, son-dern des Versuchs, Grazie willentlich hervorzubringen, d.h. etwas Natürliches künstlich zu erzeugen. [...] Auch der Satz, das Bewußtsein zerstöre die Grazie, ist nicht bewiesen worden, es sei denn, Bewußtsein bedeute weder Wissen noch Sichwissen, sondern Sich-zu-etwas-machen-wollen, das freilich nicht ohne Ver-lust des ursprünglichen Seins abgeht. Herr C. nennt es das ,Sich-zieren'" (Bin-der 1976, 313).
35 Die Komik der Sachlage - der Erzähler lacht nicht nur aus Boshaftigkeit - dürf-te in der in dieser Formulierung komprimierten Vermischung grundsätzlich ver-schiedener logischer Grammatiken bestehen.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 201
glichen wird/6 Nicht beiläufig dagegen ist die Charakterisierung der Grazie als einer unmittelbaren Qualität, die sich situativ - durch Übung oder glücklichen Zufall - einstellen mag. Das Maß ihres Gelingens hat auch die unmittelbare Grazie in der Explikation und Reflexion ihres Misslingens. Grazie wird als Modus eines intentionalen Handelns begriffen: als der Mo-dus, der sich nicht sinnvoll bezwecken lässt - der aber auch nicht einfaches Widerfahrnis ist. Darin gleicht die Grazie dem sittlichen Leben und der Un-schuld. „Das Leben selbst", heißt es in der „Paradoxe von der Überlegung", „ist ein Kampf mit dem Schicksal", ein praktischer Umgang mit nichtdis-poniblen Widerfahrnissen, in dem die „Überlegung [...] ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat" finde (KW II, 337).37 Darin steckt ein begrifflicher Hinweis: Es wurde immer schon praktisch, wirklich, situa-tiv etwas getan, wenn über das Handeln (und das Verhältnis von Handeln und Denken) nachgedacht wird, und die Beurteilung des Handelns ist genau deshalb ein unablässiger „Kampf mit dem Schicksal", weil auch das Urtei-len unmittelbar Teil des urteilsbedürftigen Lebens ist. Der Zeuge, der das Gespräch über das Marionettentheater erzählt, versteht das erkenntnistheo-retisch. Er meint, das die Spannung zwischen dem Beurteilten und seiner (selbst urteilsbedürftigen, weil Angemessenheit beanspruchenden) Reprä-sentation im urteilenden Bewusstsein in einen Regress führe. Und er meint, dass dieser Regress erst in einem restlosen Zusammenfallen von Urteilen-dem und Beurteiltem zu vermeiden sei. Die Idee dieses unmittelbaren Zu-sammenfallens ist, natürlich, die Idee der Unschuld. Im Gespräch „Über das Marionettentheater" taucht sie als die Utopie eines „Stands der Un-schuld" auf, in dem durch erneuten Erkenntnisapfelgenuss eine völlige Adäquation von „Bewußtsein" und „Sein" (und also „gar kein" Bewusst-sein, KW II, 345) realisiert wäre: „das ist das letzte Kapitel von der Ge-schichte der Welt" (ebd.), in dem der Vollzug des menschlichen Lebens im
36 Diese Problematik zieht sich durch die erzählten Anekdoten: Noch dem fech-tenden Tanzmeister fallen Vollzug, unmittelbares Agieren, und Reflexion des Vollzugs auseinander („Ich versuchte, ihn durch Finten zu verführen" [Hervorh. JM]; KW II, 345).
37 Eine „Paradoxe" ist das deshalb, weil diese Reflexion als theoretische Unterwei-sung eines Kindes vorgestellt wird - als Lehrsatz der Art: „Sei immer hübsch spontan!".
202 I JAN MüLLER
Ganzen abgeschlossen ist und so Gegenstand unmittelbar gelingender Kon-templation sein kann.
Wolfgang Binder hat allerdings auf eine bemerkenswerte Verschiebung im Gespräch hingewiesen: Die Behandlung der Grazie wandle sich, von den Gesprächspartnern unbemerkt, von der Betrachtung „reinefr] Bewe-gungsanmut, also ein[es] außermoralische[n] Phänomen[s]", hin zur Rede von Unschuld, d. h. ,,ein[es] moralische[n], richtiger ein[es] vormorali-sche[n] [Phänomens]. Aus ihr kann die Schuld und mit ihr der Mensch ent-stehen, aus Grazie entsteht nichts" (Binder 1967, 317). Binder folgert aus dieser Beobachtung nichts, sondern illustriert mit ihr nur die These, Kleist spiele unbeteiligt mit Idealismen. Der Wechsel von einer deskriptiven zu einer normativen Grammatik ist jedoch bedeutsam. Denn er funktioniert nur deshalb so diskret, weil wirkliches Tun (auch das tätige Denken und Wissen!) bereits unter Normen steht, deren Erfüllung und deren Angemes-senheit Gegenstand praktischen Urteilens sind. Kleists Figuren im „Mario-nettentheater"-Gespräch missverstehen das. Sie übersehen, dass ihr episte-mologischer Regress bloß daraus resultiert, dass sie die prinzipielle Prekari-tät praktisch-situativer Urteile der erkenntnistheoretischen Modellierung des Beurteilten zuschlagen. Gerade um diese praktische Prekarität aber geht es Kleist; darum, dass Urteilen, auch wenn es unmittelbar („unschuldig") gelingen können muss, fallibel bleibt. Im Text „Über das Marionettenthea-ter" macht das die Unzuverlässigkeit des Zeugen handgreiflich; am Text wird es handgreiflich im Zwang, dem Text gerecht werden zu müssen. Die philosophische Interpretin würde dazu die fingierte Perspektive vom „letz-ten Kapitel der Geschichte der Welt" her einnehmen. Die Handlungen, Fi-guren und Reden in Kleists Erzählungen und Dramen sind jedoch Teil der „Geschichte der Welt". Kleists Texte erzählen aus der Teilnehmerperspek-tive den Vollzug subjektiven Lebens im Dickicht der sie regierenden Nor-men. So auch das „Gespräch über das Marionettentheater". Es führt aber zudem ironisch vor, wie es aussehen würde, wenn man dieses praktische Dickicht bloß theoretisch beschreiben und seine Anforderungen bloß theo-retisch zu lösen versuchen wollte. Genau das unternehmen die beiden Ge-sprächspartner; und der Text führt konsequent vor, was für das Gelingen eines solchen Unterfangens nötig wäre: „Das ist" - den Text in performati-ver Aufhebung des reflektierenden Dialogs beschließend - „das letzte Ka-pitel der Geschichte der [erzählten, JM] Welt" (KW II, 345). Die Spannung zwischen den normativen Anforderungen, die wir an uns gestellt finden,
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" I 203
und der vernünftigen Anerkennung und Ablehnung aus subjektiver Per-spektive, würde ,behoben' sein genau dann, wenn keine Praxis mehr wäre. Weil das eine unsinnige Vorstellung ist, bleibt nur „schlechthin zu tun", und dabei so zu navigieren, dass wir „vielleicht am Ende tun, was wir wol-len, wir tun recht". Das erzählt Kleist.
LITERATUR
Binder, Wolfgang (1976): Ironischer Idealismus. Kleists unwillige Zeitge-nossenschaft. In: Ders.: Aufschlüsse. Studien zur deutschen Literatur. Zürich/München: Artemis, 311-329.
Cassirer, Ernst (1924): Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie. In: Ders.: Idee und Gestalt. Goethe - Schiller - Hölderlin - Kleist. Darmstadt: WBG 1975, 157-202.
de Man, Paul (1979): Ästhetische Formalisierung: Kleists Über das Mario-nettentheater. In: Ders.: Allegorien des Lesens. Frankfurt/Main: Suhr-kamp 1988, 205-233.
Derrida, Jacques (1979): Das Gesetz der Gattung. In: Ders.: Gestade. Hrsg. von Peter Engelmann. Wien: Passagen 1994, 247-283.
Foucault, Michel (1973): Die Wahrheit und die juristischen Formen. M. e. Nachw. v. Martin Saar. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2003.
Genette, Gerard (1987): Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2001.
Großmann, Andreas (2005): Recht und Gnade - Gnade vor Recht? Philo-sophische Betrachtungen nach Kleist. In: Rechtstheorie 36 (2005), 495-512.
Habermas, Jürgen (1985): Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1988): Philosophie und Wissenschaft als Literatur? In: Ders.: Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frank-furt/Main: Suhrkamp 1992, 242-263.
Hamacher, Bernd (2003): Schrift, Recht und Moral. Kontroversen um Kleists Erzählen anhand der neueren Forschung zu ,Michael Kohlhaas'. In: Knittel, Anton Philipp/Kording, Inka (Hrsg.): Heinrich von Kleist. Darmstadt: WBG, 254-278 (= Neue Wege der Forschung).
204 I JAN MüLLER
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1807): Phänomenologie des Geistes. In: Ders.: Theorie-Werkausgabe. Hrsg. von Eva Moldenhauer u. Karl Mar-kus Michel. Bd. 3. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1973.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1821): Grandlinien der Philosophie des Rechts. In: Ders.: Theorie-Werkausgabe. Hrsg. von Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel. Bd. 7. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1973.
Kleist, Heinrich von (1984): Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. von Hel-mut Sembdner. Zweibd. Ausg. i. einem Bd. München: DTV 2001.
Lüderssen, Klaus (1985): Recht als Verständigung unter Gleichen in Kleists ,Prinz von Homburg' - ein aristokratisches oder ein demokratisches Prinzip? In: Kleistjahrbuch 1985, 56-83.
Luhmann, Niklas (1981): Subjektive Rechte. Zum Umbau des Rechtsbe-wußtseins für die moderne Gesellschaft. In: Ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesell-schaft. Bd. 2. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1993, 45-104.
Mehigan, Tim (2010): Legality as a Fact ofReason: Heinrich von Kleist's Concept of Law, with special reference to Michael Kohlhaas. In: Grei-ner, Berahard/Thums, Barbara/Vitzthum, Wolfgang (Hrsg.): Recht und Literatur. Interdisziplinäre Bezüge. Heidelberg: UV Winter, 153-170.
Menke, Christoph (2008): Subjektive Rechte: Zur Paradoxie der Form. In: Zeitschrift für Rechtssoziologie 29 (2008), 81-108.
Menke, Christoph (2010a): Nach dem Gesetz. Zum Schluß des Zerbroche-nen Krugs. In: Gross, Martina/Primavesi, Patrick (Hrsg.): Lücken se-hen... Beiträge zu Theater, Literatur und Performance. Heidelberg: UV Winter, 97-111.
Menke, Christoph (2010b): Autonomie und Befreiung. In: Deutsche Zeit-schrift für Philosophie 58.5 (2010), 675-694.
Menke, Christoph (2011): Recht und Gewalt. Berlin: August. Ogorek, Regina (1988): Adam Müllers Gegensatzphilosophie und die Aus-
schweifungen des Michael Kohlhaas. In: Kleist-Jahrbuch 1988/89, 96-125.
Schürmann, Volker (2002): Heitere Gelassenheit. Grundriß einer parteili-chen Skepsis. Magdeburg: Scriptum.
Vogl, Joseph (2004): Scherben des Gerichts. Skizze zu einem Theater der Ermittlung. In: Campe, Rüdiger/Niehaus, Michael (Hrsg.): Gesetz. Iro-nie. Festschrift für Manfred Schneider. Heidelberg: Synchron, 109-122.
„VIELLEICHT TUN WIR AM ENDE RECHT" | 205
Weitin, Thomas (2005): Dichter und Richter. Probleme des Urteil ens im 18. Jahrhundert. In: Rechtsgeschichte (Rg) 6 (2005), 143-160.
Ziolkowski, Theodore (1987): Kleists Werk im Lichte der zeitgenössischen Rechtskontroverse. In: Kleistjahrbuch 1987, 28-51.