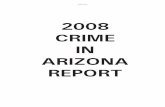Demokratie, Machbarkeit und die politische Kultur der Niederlande in den Siebziger Jahren (2008)
Die Römer in Leoben (2008)
Transcript of Die Römer in Leoben (2008)
THIASOSFestschrift fˇr Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag
herausgegeben von
Christiane Franek ^ Susanne Lamm
Tina Neuhauser ^ Barbara Porod ^ Katja Z˛hrer
Wien 2008
Die R˛mer in Leoben
Manfred Lehner
Einleitung und ForschungsstandUnser beider Heimatstadt, sehr verehrter Jubilar, liegt im steirischen Zwischengel�nde. We-
der topographisch ^ Leoben liegt am steirischen Hauptf luss inmitten der grˇnen Mark ^
noch wirtschaftlich ^ Leoben ist die zweitgr˛�te Stadt der Steiermark und beherbergt immer-
hin die G˛sser Brauerei und die VOEST Alpine ^ auch nicht geschichtlich ^ wir haben das �l-
teste Stift der Steiermark und eine ottonische Grafschaft tr�gt den Namen der heutigen
Stadt, lange bevor das Land den Namen Steiermark tr�gt ^ nein, unsere Heimatstadt liegt im
Zwischengel�nde der arch�ologischen Forschung. Dies ist umso verwunderlicher, als nicht
nur Sie und ich aus der Montanstadt stammen oder zumindest dort das Gymnasium be-
sucht haben, sondern eine ganze Reihe einst und jetzt wissenschaftlich aktiver Kolleginnen
und Kollegen wie Heribert Aigner, Erich Hudeczek, Gerhild Jeschek, Gabriele Koiner, Ute
Lohner-Urban, Peter Mauritsch,Verena Maier-Maidl und Georg Tiefengraber. Alle genann-
ten Personen leb(t)en und forsch(t)en in Graz und ziehen (zogen) ihre wissenschaftlichen
Kreise um Graz herum, vor allem nach Sˇden, Osten und Westen. Nach Norden hin ˇber-
schritt kaum eine/r das Randgebirge, und wenn1, dann nicht, um sich auf die Suche nach
der r˛mischen Vergangenheit unserer und ihrer Heimat- bzw. Schulstadt zu begeben. Dass
man ˇberhaupt etwas lesen kann von der sp�rlichen Hinterlassenschaft der R˛merzeit in
und um Leoben, ist noch immer in erster Linie dem steirischen Landesarch�ologen Walter
Modrijan zu verdanken, der vor mehr als 50 Jahren aus dem Fundus der Landesmuseums-
Ortsakten und �lterer Zusammenstellungen2sch˛pfte und anl�sslich der Er˛ffnung des
Heimatmuseums 1955 der Vorlage des Fundmaterials aus dem hallstattzeitlichen Flachgr�-
berfeld von Leoben-Hinterberg3einen �berblick ˇber die damals bekannten Funde und
Fundstellen des politischen Bezirkes Leoben folgen lie�4. Wenn Leoben als r˛merzeitlicher
Fundpunkt in der Fachliteratur auftaucht, dann meist im Zusammenhang mit dem promi-
nenten, 2005 in die Heimat zurˇckgekehrten Zufallsfund der Donawitzer Grabaedicula5;
auch das im Rahmen einer eingehenden Neuuntersuchung dieses Monuments von (den
Grazern) Daniel Modl und Bernhard Schrettle gezogene neueste Resume¤ e zur Leobner R˛-
merzeit kann mangels neuer feldarch�ologischer Daten in puncto Siedlungsstruktur und
Verkehrssituation kaum ˇber das Modrijans hinausgehen6.
Mit der Einsetzung eines Amtsarch�ologen am Landeskonservatorat fˇr Steiermark
im Jahre 1986 und dem damit verbundenen allgemeinen Aufschwung der steirischen Feldar-
ch�ologie hatten zwar, schˇtter aber doch, denkmalpf legerisch bedingte arch�ologische
Aktivit�ten auch im Raume Leoben begonnen; deren Zahl nimmt sich bis heute, verglichen
mit anderen St�dten und politischen Bezirken, �u�erst bescheiden aus7. Ein einziges Mal
1Der einzige Leobner, der auch den Spaten ange-
setzt hat, ist G. Tiefengraber, der im Auftrag des Bun-
desdenkmalamtes 2007 eine Notgrabung am H�usel-
berg, dem fˇr die Pr�historie wichtigsten und
prominentesten Leobner Fundplatz, durchgefˇhrt hat.2
Vor allem Pichler 1879 und Gutscher 1897.3
Grabung Brunnleiten im Sommer 1952: Modrijan
1956, 18^36; neue Fotos aus dem Museumscenter Leo-
ben bei Leitner-B˛chzelt ^ Mittersteiner 2006, 114^120.4
R˛merzeit bei Modrian 1957, 6^24.5
Noch im Jahr des Fundes bekanntgemacht
durch Haas 1858; ein Foto der neuen Aufstellung bei
Leitner-B˛chzelt ^ Mittersteiner 2006, 112.
6Modl ^ Schrettle 2005a, 117^119.
7Von einigen vereinzelten Fundmeldungen und
Baubeobachtungen (z. B. an der Jakobikirche 1987
oder im Hof des Stadtmuseums 1995, beide B. Hebert)
abgesehen, lassen sich moderne arch�ologische
Grabungsaktivit�ten in Leoben an den Fingern einer
Hand abz�hlen: Krypta Stift G˛� 1989 (Mittelalter, B.
Hebert), Notgrabung Interspar 1992 (Bronzezeit, G.
Fuchs), Ma�enburg 1998 (Mittelalter, H. Heymans), Do-
minikanerkloster 2005 (Mittelalter/Neuzeit, H. Hey-
mans), H�uselberg 2007 (Hallstattzeit, G. Tiefengra-
ber).
591
stand dabei die R˛merzeit am Programm, und auch das nur indirekt in Verbindung mit r˛-
merzeitlichen Spolien in der G˛sser Stiftskrypta8.
Die dem N�hrboden der Heimatkunde und der Montangeschichte ^ genannt seien
hier ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit der Papierh�ndler und Privatgelehrte Wolfgang
Haid9, der Volkskundler, Indologe und langj�hrige Direktor des Leobner Stadtmuseums
Gˇnther Jontes10und der ehemalige Vizebˇrgermeister und Hˇttenmann Gerhard Sperl
11^
entwachsenen arch�ologischen Blˇten unterscheiden sich im Bezug auf die R˛merzeit des
Stadtgebietes nur in wenigen Details12von dem vor 50 Jahren gezeichneten Bild.
Nach dem bisher Gesagten ist es wenig verwunderlich, dass Leoben in der althistori-
schen und arch�ologischen �berblicksliteratur zur R˛merzeit eine vergleichsweise margi-
nale Pr�senz aufweist: Weber verzeichnet fˇr den ganzen Bezirk nur sechs r˛mische
Inschriften, fˇr das Gebiet der Stadtgemeine Leoben nur zwei13, Schachinger kann nicht
mehr als 12 bestimmbare r˛mische Mˇnzen fˇr den ganzen Bezirk namhaft machen14, da-
von allerdings 8 aus Leoben. Im R˛merband der von Herwig Wolfram herausgegebenen �s-
terreichischen Geschichte15
und im Noricumband von Alf˛ldy16
erscheint einzig die
Donawitzer Grabaedicula erw�hnenswert, im Reclam-Arch�ologiefˇhrer �sterreichs nur
die wenigen Einzelfundstˇcke, die sich damals in der Schausammlung des Stadtmuseums
befanden17. In Fischers Bildband zur Provinz Noricum fehlt Leoben wie ˇbrigens das ganze
obere Murtal zwischen Bruck a. d. Mur und Moosham ˇberhaupt18.
Arch�ologische Befunde, Alt- und EinzelfundeAls einzig sicherer ,Befund‘ zur Leobner R˛merzeit kann der jˇngst mit naturwissenschaftli-
chen Methoden erbrachte Nachweis der r˛merzeitlichen Nutzung des Kalksteins (,Halbmar-
mor‘) vom Galgenberg gelten19. Zum selben H˛henzug geh˛ren ja auch die Felsinschriften
der gerne als Steinbrucharbeiter oder Steinmetzen titulierten Herren VERVICIVS und DE-
CIVS (vgl. Abb. 1)20.
Vermeintliche, in der Altliteratur ˇberlieferte arch�ologische Befunde zur R˛merzeit
in Leoben halten hingegen bereits einer oberf l�chlichen �berprˇfung nicht stand: Die 1895
in Donawitz in 6 Meter Tiefe aufgedeckte, durch eine Mˇnze des Hadrian datierte ,,Staub-
schichte einer alten Stra�e‘‘21, ist noch der glaubwˇrdigste Befund, auch wenn Modrijan
die unglaubliche Fundtiefe mit einem Erdrutsch erkl�ren muss22. Weber erw�hnt ,,r˛merzeit-
liches Mauerwerk‘‘, das ,, in Leoben selbst‘‘ zum Vorschein gekommen sein soll und zitiert
Pichler23, dessen Verweis (wenig verwunderlich) nicht zu einem Siedlungsbefund, sondern
8Hebert 1989.
9z. B. Haid 1954; bezeichnenderweise steigt Haid
ˇber den historischen Bergbau in die Arch�ologie ein:
Haid 1967; Nachruf bei Jontes 1980.10
z. B. Jontes 1995.1 1
z. B. Sperl 1994; siehe Festschrift fˇr Gerhard
Sperl zur Vollendung des 70. Lebensjahres, res monta-
narum 38, 2006, Schriftenverzeichnis 9^15.12
Vor allem in Bezug auf die Zugeh˛rigkeit oder
Nichtzugeh˛rigkeit der spiralkanellierten S�ulenspo-
lie in der G˛sser Stiftskrypta zur Donawitzer Grabaedi-
cula, vgl. Modl ^ Schrettle 2005b, 28^31; Wagner 2001,
392^394.13
Weber 1969, 283^289 Nr. 231^236. Nur Nr. 232
und 235 (letztere verschollen) geh˛ren sicher zum Ge-
meindegebiet, Nr. 233 ist unsicher und k˛nnte auch
zur KG Traidersberg (Gem. St. Peter-Freienstein) geh˛-
ren; der Fundort des verschollenen Steins Nr. 234
(Caius Mimisius, zur Lokalisierung Modrijan 1957, 6) in
der Anfang des 20. Jhs. gesprengten Veitsberger Kir-
che liegt entgegen den Angaben Webers in der Ge-
meinde Proleb; auch auf der Fundkarte von Modl ^
Schrettle 2005a, 114 Abb. 6 Nr. 1 ist der Veitsberg
falsch eingezeichnet. Die Kirchenruine liegt unmittel-
bar westlich des Geh˛fts Ganzer nordwestlich von Pro-
leb auf ca. 720 m Seeh˛he.14
Schachinger 2006, 325. Leoben liegt damit unter
den 17 steirischen Bezirken nur vor Bruck und Mˇrzzu-
schlag, aber auch vor dem fl�chenm��ig kleinen Be-
zirk Fˇrstenfeld.15
Gassner u. a. 2003, 217.16
Alf˛ldy 1974, 175 und Taf. 51.17
Lippert 1985, 306 f. (Neugebauer)18
Fischer 2002, 104 f.19
Hebert ^ Hudeczek 2004, 411.20
Weber 1969, Nr. 232 und 233; Modrijan 1957, 23.21
Gutscher 1897, 188.22
Modrijan 1957, 8.23
Weber 1969, 284; Pichler 1874, 169.
592
Manfred Lehner
zur Erstbesprechung der Donawitzer Grabaedicula durch Carl Haas zurˇckfˇhrt. Dessen
Beschreibung der Fundumst�nde, die er selbst nur vom H˛rensagen kennt, l�sst allerdings
weniger an ein am ursprˇnglichen Ort in Sturzlage befindliches Monument, sondern eher
an einen ungeordneten Haufen von Baugliedern, also an ein irgendwann (in der Sp�tantike
oder im Mittelalter ?) vielleicht zum Abtransport, zum Zerkleinern fˇr einen Kalkofen oder
zur Spolienentnahme hergerichtetes Marmorsteindepot denken24. Dass die mitgefundene
Mˇnze der Tetrarchenzeit nicht datierend fˇr den Grabbau sein kann, steht ohnehin au�er
Diskussion25. Haas gibt den Fundort mit ,,in unmittelbarer N�he des bei Leoben gelegenen
gro�artigen Eisen-Werkes, welches im Besitze des Herrn Franz Mayr ist†‘‘ an, und zwar im
neu gegrabenen Bett des damals ins Werksgel�nde der Franzenshˇtte26
umgeleiteten Vor-
dernbergerbaches. Die Fundstelle lag sicher links, also n˛rdlich des Baches, was auch aus
Gutschers Erw�hnung pr�historischer Bronzefunde bei km 2,4 der Stra�e Leoben-Vordern-
berg, ,,jedoch rechts des Baches‘‘, hervorgeht; seine anschlie�enden Ausfˇhrungen zur bei
km 2,6 der Stra�e gefundenen Grabaedicula mˇssen sich demnach auf die linke Bachseite
beziehen27. Bei einer neuerlichen Verlegung des Bachbettes 1895 ,,nun bis an die oberste
Talseite bis knapp unter die Reichsstra�e‘‘, so Gutscher weiter, kam wieder beim Ausheben
des ,,neuesten Bachbettes‘‘ in 6 Meter Tiefe die erw�hnte Staubschicht inkl. Mˇnze des Had-
rian zu Tage, sowie aus dem Aushub weitere kaiserzeitliche Mˇnzen und Fibeln auf einer
Strecke von ca. 300 Metern.
Zur Lokalisierung des Fundorts oder vielmehr dieser Fundstrecke, von der auch etli-
che pr�historische Metallfunde stammen, gibt es verschiedene Angaben28. Sie liegt sicher
nicht, wie die Ortsakten des BDA angeben29, sˇdlich vom Fr˛schlwirt beim Ausgang des Un-
teren Tollinggrabens (vgl. Abb. 1, unterhalb Kote 593), also schon nahe der Gemeinde-
grenze zu St. Peter-Freienstein, und auch nicht ,,in der N�he des heutigen Sozialhauses des
Hˇttenwerkes Donawitz an der Vordernbergerstra�e‘‘, wie Sperl meint30
(vgl. Abb. 1, etwas
links von Kote 556), sondern dazwischen, mitten am Gel�nde des heutigen Schienenwalz-
werks dort, wo sich die Bundesstra�e 115a in einer leichten Kuppe zwischen Werkshalle
und Kˇhltˇrmen wie durch eine Schlucht zw�ngt (Abb. 1, Oval). Wenn man dem Leobner
Gymnasialprofessor und Zeitgenossen Hans Gutscher weiter folgen will, der die Lage der
Fundstelle als gegenˇber dem Eingang des Talgrabens (Abb. 1, ,,Im Tal‘‘) liegend pr�zi-
siert31, zeigt eine �berprˇfung der Topographie anhand der Josefinischen Landesauf-
nahme, dass es sich grob gesagt um das Gebiet gegenˇber der ehemaligen Einmˇndung
des Talbaches in den Vordernbergerbach handelt. Den bereits von Walter Schmid32
nicht
mehr angetroffenen Kilometerstein 2,6 muss man von der Stra�engabelung K�rntnerstra�e-
Vordernbergerstra�e, also dort, wo diese Stra�e beginnt, unmittelbar nach der Leobner
Waasenbrˇcke (die bis heute den Ort des alten Murˇbergangs h�lt, vgl. Abb. 1, n˛rdlich der
Eintragung ,,SATVS‘‘) messen und nicht vom Hauptplatz und auch nicht von der Kurve am
Annaberg oder von sonstwo aus. Nur dann stimmt die Entfernungsangabe des Kilometer-
steins mit den topographischen Angaben Haas’ und Gutschers ˇberein. Die bisherigen Lo-
kalisierungsversuche liegen mit einiger Sicherheit einerseits zu weit westlich/bachaufw�rts
und andererseits zu weit ˛stlich/bachabw�rts.
24Haas 1858, 161; Verf. wei� sich darin einer Mei-
nung mit B. Hebert; vgl. auch Wagner 2001, 350; Fi-
scher 2002, 127.25
Modrijan 1957, 11.26
Zur Lage der Franzenshˇtte vgl. Sperl 1994, 42
Abb. 16.27
Gutscher 1897, 187.28
Modl ^ Schrettle 2005a, 109 unternehmen kei-
nen neuen Lokalisierungsversuch.29
Verf. hat B. Hebert fˇr die Erlaubnis zur Einsicht-
nahme in die Ortsakten des BDA zu danken. Das zum
Gro�teil bergige Gemeindegebiet umfasst 10 Katastral-
gemeinden (Donawitz, G˛�, G˛�graben, Judendorf,
Leitendorf, Leoben, Mˇhltal, Prettach, Schladnitzgra-
ben und Waasen); der Jubilar stammt aus der Stadt
(KG Leoben), Verf. aus der Vorstadt (KG Waasen).30
Sperl 1990; Sperl 1994, 42; E-mail von 2004 in
den Ortsakten des BDA.3 1
Gutscher 1897, 187.32
Schmid 1932, 214.
593
Die R˛mer in Leoben
Wenn man nun ^ wie weiter oben angedacht ^ annimmt, dass der Fundort der Grab-
bauteile nicht ident mit dem ursprˇnglichen Standort des Monuments ist, und auch den
,Stra�enbefund‘ anzweifelt, stellt sich die Frage, ob die in der unmittelbaren Umgebung aus
dem Aushub der neugegrabenen Bachbetten geborgenen Metallfunde notwendigerweise
zu Gr�bern geh˛ren mˇssen33^ doch dazu sp�ter.
Der kargen Befundsituation l�sst sich die Sp�rlichkeit des Fundmaterials zur Seite stel-
len, das noch dazu fast ausschlie�lich aus zum Teil verschollenen Altfunden besteht. Neu-
eren Datums sind nur ein 2003 gemeldetes kleines marmornes Blattkapitell, das bei
Baggerarbeiten am linken Murufer 50 Meter f lussabw�rts der ehemaligen ,Kremplwehr‘ in
der KG Judendorf zutage kam (vgl. Abb 1, oberhalb des Eintrags ,,Stadion‘‘)34, sowie das
1989 gefundene 40Nummi-Stˇck des Iustinian vom Annaberg (Abb. 1, Kreis), ˇbrigens die
einzige heute noch vorhandene byzantinische Fundmˇnze der Steiermark35. Dazu gesellt
sich das vor etwa 20 Jahren am Mˇnzenberg (Nordrand von Parzelle 344/1 der KG Waasen,
vgl. Abb. 1, ,,TS‘‘) aufgesammelte Randfragment eines Rheinzaberner Sigillata-Tellers der
Form Dragendorff 18/31 (Abb. 2), das hier erstmals bekannt gemacht wird36.
Im Verein mit den aus den Ortsakten und der sp�rlichen arch�ologischen und heimat-
kundlich-regionalhistorischen Literatur erschlie�baren Altfunden lassen sich fˇr 5 der 10
Leobner Katastralgemeinden r˛mische Funde anfˇhren, links, also n˛rdlich der Mur fˇr Do-
nawitz,Waasen und Judendorf, rechts der Mur fˇr Leoben und G˛�.
Die Donawitzer Werksfundstrecke ist bereits besprochen worden; ebenfalls zu Dona-
witz geh˛rt der Felskopf Schmutzenwand ,,Im Tal‘‘ mit der Inschrift des VERVICIVS37. Zu Waa-
sen z�hlt der Annaberg, der nicht nur sp�tantike Einzelfunde hervorgebracht hat38,
sondern an seinem felsigen, nach Sˇden vorgeschobenen Sporn eine im Gel�nde deutlich
ausgepr�gte Wehranlage tr�gt. Zwischen Annaberg und Vordernbergerbach hat der Sol-
dat und Scherbensammler Alois Rauter 1991 anl�sslich der Errichtung eines Gro�marktes
(vgl. Abb. 1, im Bereich des Buchstabens E von ,,Waasen‘‘) laut Ortsakten des BDA pr�histo-
risches bis neuzeitliches Fundmaterial aufgesammelt; m˛glicherweise ist eine r˛merzeitli-
che Glasperle darunter.
Der westliche Teil des Mˇnzenberges geh˛rt ebenfalls noch zur KG Waasen. Er sticht
vor allem durch den Flurnamen ,Burgstallfeld‘ hervor. Auf seiner j�h zur Mur (heute zur Ei-
senbahn) hin abfallenden Felsklippe stand die schon im 17. Jh. v˛llig abgekommene Burg
Mˇnzenberg; aus dem n�heren Umkreis sind kaiserzeitliche Mˇnzfunde ˇberliefert39, vom
sanften sonnseitigen Hang unmittelbar n˛rdlich davon stammt die Sigillatascherbe (Abb.
2). Aus der eigentlichen Waasenvorstadt im Zwickel zwischen der Mur und dem Unterlauf
des Vordernbergerbaches schlie�lich sind die verschollene Grabinschrift des SATVS40und,
falls die Lokalisierung zutrifft41, die 1890 ,,im Garten der Dettelbach-Mˇhle‘‘ geborgenen
Grabbeigaben (Glasf l�schchen und Henkelkrug) zu nennen42. Neben dem erw�hnten Voll-
blattkapitell aus der Mur kann die ˛stlich an Waasen anschlie�ende KG Judendorf mit ein-
zelnen Mˇnzfunden ,,bei den Kohlebergwerken Mˇnzenberg und Seegraben‘‘ aufwarten
(vgl. Abb. 1, im Bereich der rechten oberen Ecke des Kartenbildes)43.
33In diesem Sinne Modrijan 1957, 7 und Modl ^
Schrettle 2005a, 109 f. mit Anm. 23.34
Hinker ^ Thaller 2003; Schrettle 2004.35
Schachinger 2006, 239 f.36
Verf. hat Ch. Gugl und U. Lohner fˇr die Begut-
achtung der Scherbe zu danken.37
Freudenthaler 1940, 18 (Karte).38
Der Fundort der byzantinischen Mˇnze hat
Fuchs ^ Obereder 1999, 134, bewogen, hier auch die
Herkunft eines sp�tantik-frˇhmittelalterlichen Hohl-
armreifs (ebd. Taf. 28, 5) aus einer Leobner Privat-
sammlung anzunehmen.39
Gutscher 1897, 191 spricht von den ,,Feldern
oberhalb des Sˇdbahnhofes‘‘; Ebner 1979, 149 f.40
Weber 1969, Nr. 235; Modrijan 1957, 7.4 1
Endgˇltige Klarheit ˇber die Lage dieser Mˇhle
konnte trotz intensiver Bemˇhungen nicht erreicht wer-
den; Verf. hat besonders Frau E. Wei�enb˛ck (Leo-
ben) zu danken.42
29. Jahresbericht des Steierm�rkischen Landes-
museums Joanneumˇber das Jahr 1890 (Graz 1891) 51.43
Gutscher 1897, 191.
594
Manfred Lehner
Die rechte Murseite f�llt deutlich ab: Es gibt es nur zwei Fundnachrichten zu (verschol-
lenen) kaiserzeitlichen Mˇnzen: einmal in G˛�44, wo man sich auch die Spolienfunde aus
der Stiftskrypta in Erinnerung rufen muss, und einmal in Leoben selbst, ,,im Nordteil der
Halbinsel‘‘45, also au�erhalb der mittelalterlichen Stadt. Im Zuge der jˇngsten modernen
Grabungen rechts der Mur haben weder die Ma�enburg noch das Dominikanerkloster an
der Nordostecke der mittelalterlichen Stadt auch nur den geringsten Hinweis auf die R˛mer-
zeit erbracht46.
Interessant w�re die Kenntnis der genauen Fundorte der verschollenen, dem Landes-
museum Joanneum vom Leobner Bˇrgermeister Graf im Jahre 1820 ˇbergebenen 40 R˛-
mermˇnzen47. Donawitz und G˛� geh˛rten damals noch lange nicht zu Leoben
48; es ist
trotzdem nicht davon auszugehen, dass die doch erkleckliche Anzahl von Mˇnzen aus dem
Kernbereich der damaligen Stadt stammt. Josef Graf war, wie die Abfassung der ersten
Leobner Ortsgeschichte 1824 beweist, historisch engagiert und k˛nnte ˇber eine aus ganz
verschiedenen Quellen gespeiste Mˇnzensammlung verfˇgt haben49.
Die R˛mer in Leoben ^ Versuch einer AuswertungDie arch�ologische Aussagekraft von Einzelfundverteilungen ist auch bei Vorliegen besse-
rer Funddaten, als das in Leoben der Fall ist, zweifelhaft und wird widersprˇchlich beur-
teilt50. Realistisch gesehen gibt es fˇr die R˛merzeit in Leoben nicht viel mehr Belege als
tumultuarisch geborgene R˛mersteine und ein paar Metallfunde. Was nicht darunter f�llt,
ist disloziert oder verschollen. Als einzige Ausnahme kann die Felsinschrift des VERVICIVS
gelten; den DECIVS hat schon Weber nicht mehr gesehen51. Noch weniger als eine wegen
der Unbestimmtheit der exakten Fundorte nur sehr ungef�hre Verteilungskartierung der
Mˇnzfunde sind durch die Fundorte der R˛mersteine Aussagen ˇber die Siedlungsdichte
oder die Stra�enverl�ufe innerhalb einer Mikroregion m˛glich. Dennoch soll, auch ange-
sichts der disparaten Fundsituation und im Bewusstsein diverser Unw�gbarkeiten52
das
eher im Sinne eines Denkansto�es zu verstehende Wagnis einer Situationsrekonstruktion
Leobens in der r˛mischen Kaiserzeit eingegangen werden.
R˛mische Siedlung und r˛mische Stra�e bedingen einander53; ohne arch�ologische
Befunde gleicht die Frage, was zuerst da war, der nach der Henne und dem Ei. Funde der
Late' nezeit, die eine direkte Siedlungskontinuit�t anzeigen und nach denen sich r˛merzeitli-
che Stra�enfˇhrungen orientiert haben k˛nnten, sind aus dem Raum Leoben erstaunlicher-
weise bis heute nicht bekannt54. Zudem scheint die Reihe der einigerma�en sicher
44Schmid 1924. Das von W. Haid, F� 9/3, 1968, 144
gemeldete Bronzegef�� vom Ausgang des G˛�gra-
bens (Kaltenbrunn/Windischberg), vgl. hier Abb. 1,
rechte untere Ecke, ist wohl neuzeitlich.45
Gutscher 1897, 188.46
Heymans ^ Lehner 2005; Heymans 2006.47
Joanneum. Neunter Jahresbericht 1820, 10:
,,Vom Herrn Graf, Bˇrgermeister in Leoben, 40 Stˇcke
theils silberne, theils kupferne Mˇnzen aus der R˛mer-
zeit‘‘.48
G˛� wurde 1922 eingemeindet, das viel gr˛�ere
Donawitz erst, als 1939 die Bildung einer dem heutigen
Ausma� entsprechenden Gemeinde ,Gro�-Leoben‘
verfˇgt wurde.49
Vgl. das Vorwort von H. Pirchegger, in: Freuden-
thaler 1940, 5.50
Fˇr die Mˇnzen Schachinger 2006, 15^17; fˇr
R˛mersteine Wagner 2001, 354^356; fˇr Altstra�en
Grabherr 2006, 56.
5 1Weber 1969, 287 Anm. zu Nr. 233.
52z. B. Interpretation der Metallfunde als Grab-
Siedlungs-, Teile von Hort- bzw. (antike oder rezente)
Verlustfunde (vgl. Schachinger 2006, 64 f. 86. 239. 325),
womit noch immer nicht alle M˛glichkeiten aufgez�hlt
sind, wie z. B. die Funde antiker Mˇnzen und Fibeln in
mittelalterlichen Befundzusammenh�ngen zeigen, vgl.
Steinklauber u. a. 2002, 284^286. ^ R˛mische Bauspo-
lien scheinen bereits im Mittelalter nicht immer nur aus
der unmittelbaren Umgebung der Kirche oder Burg, in
die sie eingemauert wurden, zu stammen; nachgewie-
sen ist der weite Transport von Spolien fˇr die Steier-
mark erst in der Neuzeit, vgl. Karl 2006.53
Grabherr 2006, 55.54
Freundliche Mitteilung von Wolfgang Artner, der
jedoch illegale Funde aus dem Liesingtal im Netz auf-
gespˇrt hat. ^ Der Donawitzer Bronzering mit rhomboi-
dem Querschnitt, den Kramer 1994, 55 anfˇhrt (vgl.
Modrijan 1956, 15 f.), ist wohl �lter.
595
Die R˛mer in Leoben
bestimmbaren Mˇnzen erst mit Hadrian zu beginnen55
^ war zuerst die (Murtal-)stra�e da,
die zum siedlungsbildenden Faktor wurde, und war Leoben bis zur hohen Kaiserzeit wirk-
lich eine ,,once backward area‘‘56?Es steht au�er Frage, dass die arch�ologische St�rke der Region Leoben in der sp�-
ten Bronze- und frˇhen Eisenzeit liegt57. Angesichts der hohen Dichte von Hortfunden und
prominenten H˛hensiedlungen l�sst sich annehmen, dass die ˛konomischsten Verkehrs-
wege nicht nur naturr�umlich durch das Gel�nderelief vorgegeben, sondern auch durch
vorgeschichtliche Benutzung vorgepr�gt waren. Eine solche pr�historische Trasse fˇhrte
das Tal des Vordernbergerbaches aufw�rts und zweigte bei St. Peter-Freienstein, die H˛-
hensiedlung am Kulm rechts liegen lassend, in Richtung Liesingtal ab (Abb. 3). Dass diese
wenig H˛henunterschied aufweisende Wegefˇhrung auch in r˛mischer Zeit benutzt wurde,
zumindest, wenn man auf kˇrzestem Wege (ca. 50 km) ˇber den Schoberpass die norische
Hauptstra�e Richtung Ovilava bei Trieben erreichen wollte, legen die Funde von Windisch-
bˇhel (vormals Pichl, Gem. Gai) und Seiz (Gem. Kammern i. L.)58
nahe. Richtung Virunum
hingegen empfahl es sich, den Anschluss an die Hauptstra�e bei Monate oder Ad pontemanzustreben
59, also vorerst auf kˇrzestem Wege St. Michael in der Obersteiermark, wo die
Liesing in die Mur mˇndet, zu erreichen. Dies war entweder ˇber den ebenfalls seit der Vor-
geschichte vorgegebenen, in der Kurve der B 116 gegenˇber der ,Waldschenke‘ noch ein
kurzes Stˇck erhaltenen tiefen Hohlweg ˇber den H�uselbergsattel und dann murtalauf-
w�rts zu bewerkstelligen ^ fˇr diese Wegefˇhrung liegen allerdings keine r˛mischen Fund-
punkte zur Best�tigung vor ^ oder ˇber einen etwas kˇrzeren, aber bei weitem steilerenWeg
von Donawitz den Talbach aufw�rts ˇber die ,Niederung‘60, der, wie die Felsinschriften bele-
gen, in der R˛merzeit sicher begangen war. In jedem Falle bietet sich der breite Platz am Un-
terlauf des Vordernbergerbaches, auf den auch die bereits geschilderte Donawitzer
Fundverdichtung hinweist, als Verkehrsknotenpunkt an, zumal die von Osten ankommende
Murtalstra�e ab Bruck an der Mur/St. Ruprecht61
mit Sicherheit links der Mur verlief, in der
KG Waasen den Sattel zwischen ,Burgstallfeld‘ und dem Fundort der Sigillatascherbe (vgl.
Abb. 1) erklomm und erst im Bereich zwischen Annaberg und der Einmˇndung des Vordern-
bergerbaches in die Mur, etwa im Gel�nde des heutigen Landeskrankenhauses, wieder den
Talboden erreicht haben kann62.
Zur Erschlie�ung der Lage des vicus von Donawitz, dessen Existenz wohl au�er Frage
steht, kann man nur hypothetische Konstruktionen anbieten:
1) Weist man die Objekte der Donawitzer Einzelfundstrecke (Abb. 1, Oval) wie bisher
ˇblich r˛mischen Brand- oder K˛rpergr�bern zu, und nimmt man zus�tzlich den R˛mer-
stein aus der Waasenkirche und die Gef��e aus dem Garten der Dettelbach-Mˇhle als Hin-
weise auf Bestattungen im Bereich des Unterlaufes des Vordernbergerbaches, ergeben sich
zwei Gr�berfelder (oder eher Gr�berstra�en), zwischen denen man das Siedlungsareal in-
terpolieren k˛nnte. Konkret ist das der ˛stliche Teil des heutigen Donawitzer Werksgel�n-
des, etwa zwischen der ehemaligen Einmˇndung des Talbaches in den Vordernbergerbach
und der von Annaberg und Galgenberg gebildeten Talenge (Abb. 4). Ein Blick auf die Karte
(Abb. 1) zeigt, dass dort auch die Kl�ranlage desWerks und das Donawitzer Fu�ballstadion
55Freudenthaler 1940, 20 erw�hnt allerdings eine
sp�trepublikanische Mˇnze.56
Alf˛ldy 1974, 175.57
Modrijan 1956, 7^36; Fuchs ^ Obereder 1999,
108^111.58
Modrijan 1957, 11f. 20 f.59
Hinker 2006.60
Modrian 1957, 23 f. und Abb. 9.61
Die Identifikation mit dem Poedicum des Ptole-
maios ist nach den Ergebnissen von Lugs 2005 m˛gli-
cherweise anzuzweifeln. Poedicum w�re der einzige
Ort, bei dem die Koordinaten Ptolemaios’ mit den tat-
s�chlichen exakt ˇbereinstimmen, w�hrend andere, si-
cher auch aus anderen Quellen identifizierbare Orte
eine gewisse Fehlerstetigkeit aufweisen.62
Ebner 1979, 149 spricht von der ,,in der R˛mer-
zeit und auch sp�ter viel begangenen Stra�e Bruck-
Donawitz‘‘.
596
Manfred Lehner
liegen, arch�ologisch also nichts mehr zu holen sein kann, weshalb diese Hypothese immer
eine solche bleiben wird.
2) Interpretiert man angesichts des eigenartigen ,Stra�enbefundes‘ von 1895 und
der 1858 wohl nicht am ursprˇnglichen Standort angetroffenen Aediculateile die Dona-
witzer Fundstrecke nicht als Gr�berstra�e, sondern als selektiv aufgesammeltes Siedlungs-
material, l�ge der vicus l�ngsgestreckt auf einer heute im Gel�nde kaum mehr
nachvollziehbaren Terrasse links des ursprˇnglichen, das Tal etwa mittig durchziehenden
Bachverlaufes, am Fu�e von Annaberg und B�rnerkogel, am Ort und ˛stlich des heutigen
Schienenwalzwerks.
3) Legt man den Schwerpunkt der Interpretation auf die Tatsache, dass s�mtliche
Funde in gro�er Tiefe lagen und offensichtlich in buntem Durcheinander mit pr�histori-
schen Metallfunden aus dem Aushub der neugegrabenen Bachbetten geborgen wurden,
kommt auch die M˛glichkeit in Betracht, dass s�mtliche Funde von den sonnseitigen Ab-
h�ngen des B�rnerkogels und des Annaberges erosiv an den Fundort verfrachtet worden
sind, der vicus von Donawitz also eine der seltenen kaiserzeitlichen H˛hensiedlungen dar-
stellte63. Im Rahmen dieses Denkmodells ist ohne Belang, ob die Grabaedicula in situ gefun-
den wurde oder nicht.
Aufgrund der eindeutigen Gel�ndemerkmale (Abschnittsgraben,Terrassierungen, Alt-
wegspuren) ist eine kleine Wehranlage am Sporn des Annaberges anzunehmen, die von ih-
rer Zurichtung her durchaus auch hochmittelalterlich sein k˛nnte64. Die eminente
strategische Bedeutung des nur 580^650 m hohen Annaberges, der einen Blick fast ohne
tote Winkel ˇber das Leobner Becken, weit murtalabw�rts nach Osten sowie ˇber das ge-
samte untere Vordernbergerbachtal bietet (Abb. 4), ist augenf�llig65. Der Fund der 538/39
gepr�gten byzantinischen Mˇnze66
legt eine sp�tantike Datierung dieser Anlage nahe, in
der arch�ologischen Literatur wird der Leobner Annaberg auch ausschlie�lich in diesem
Zusammenhang genannt67. Vom H˛rensagen, ohne sich an die Quelle erinnern zu k˛nnen,
wei� Verf. von menschlichen Skelettresten aus der unmittelbar n˛rdlich des Sporns liegen-
den Schrebergartensiedlung; auch dies wˇrde gut zu einer sp�tantiken H˛hensiedlung
passen, auf die sich die Donawitzer vicani ab dem 4. Jh. zurˇckgezogen haben k˛nnten.
Eine zweite, wohl untergeordnete Siedlungsstelle (mansio oder mutatio ?) ist am Sat-
tel des Mˇnzenberges, der die h˛chste Stelle des Stra�enverlaufs darstellt, zu postulieren.
Der Fundpunkt der Sigillata-Scherbe (Abb. 2) ist dabei nicht ˇberzubewerten, zumal die
Parzelle au�er zwei unbestimmbaren pr�historischen Scherben mit v˛llig verriebener Ober-
f l�che keinerlei relevantes Aufsammlungsmaterial hervorbrachte; sie k˛nnte wie die ˇberlie-
ferten Mˇnzaltfunde ebensogut vom ,Burgstallfeld‘ stammen und im Zuge des modernen
Stra�enbaus mit B˛schungsmaterial auf den gegenˇberliegenden Acker gelangt sein. Viel-
leicht stammt das am Murufer unterhalb des Mˇnzenbergs in der KG Judendorf gefundene
Blattkapitell von einem Grabbau, der im Zusammenhang mit dieser Siedlungsstelle zu se-
hen ist.
Ohne einzelne Altfundpunkte ˇberstrapazieren zu wollen, k˛nnten auch die rechts
der Mur gefundenen Mˇnzen als Siedlungsindikatoren gelten, einmal fˇr den Nordteil des
63Zusammenstellung der steirischen H˛hensied-
lungen der Kaiserzeit bei Bauer 1997.64
Vor der Verlegung und Befestigung der mittelal-
terlichen Stadt Leoben in der Murschleife 1262/63 war
das Leobner Becken von einem Kranz kleinerer Wehr-
bauten geschˇtzt (in Nennersdorf, am Mˇnzenberg,
am H�uselberg und vielleicht auch am Annaberg). Die
Ma�enburg ist erst im Zuge der Stadtverlegung errich-
tet worden. Ebner 1979, 60. 69; Heymans ^ Lehner
2005, 369. Verf. dankt Werner Murgg fˇr Informationen.65
Vgl. das Gem�lde von Georg Karrer1840/50, im
Leobner Stadtmuseum, das ˛sterreichische und fran-
z˛sische Offiziere am Annaberg zeigt, die auf das Leo-
ben zur Zeit Napoleons hinunterblicken. Abgebildet
bei Leitner-B˛chzelt ^ Mittersteiner 2006, 75 Kat.Nr. 4.8.66
Schachinger 2006, 240.67
Bauer 1997, 135; Steinklauber ^ Hebert 2001,
277; Modl ^ Schrettle 2005a, 119.
597
Die R˛mer in Leoben
heutigen Stadtgebietes n˛rdlich au�erhalb der mittelalterlichen Befestigung und anderer-
seits fˇr G˛�. Dieser zweite, schattseitig nahe dem Ausgang des G˛�grabens gelegene
Fundpunkt k˛nnte auf die r˛merzeitliche Nutzung einer Abkˇrzung aus dem mittleren Mur-
tal hinweisen: Vom Verlauf des ,Diebswegs‘, der n˛rdlich von Frohnleiten (in Rothleiten) vom
Murtal durch den Gamsgraben abzweigt und nach gut 20 km ˇber den Almwirt auf nur
1170 m Seeh˛he via G˛�graben das Murtal erreicht, sind allerdings bisher keine r˛mischen
Funde bekannt geworden.
Nur nebenbei sei ein weiterer, das Steirische Randgebirge ˇberschreitender Neben-
weg genannt, der zwar nicht unmittelbar mit Leoben selbst zu tun hat, sich aber aus Leob-
ner Indizien ergibt:
Wie den Ortsakten des BDA zu entnehmen ist, k˛nnen Marmorproben der Donawitzer
Aedicula den weststeirischen Kainacher Brˇchen zugeordnet werden. Wie kommt der
Marmor nach Leoben? Immer wieder wird fˇr den Transport der schweren Bauglieder der
Wasserweg postuliert68. Kainachabw�rts bis Wildon und dann muraufw�rts (!) bis zum Do-
nawitz n�chsten Murknie sind, gemessen am heutigen, ˇber weite Strecken begradigten
Murverlauf mindestens 140 km zurˇckzulegen. Wenn man allerdings die Bergstrecke in
Kauf nimmt, die vom oberen Kainachtal in weniger als 20 km ˇber Brendlstall und Gleinalm-
sattel (1586 m), Glein und F˛tschach das Murtal ˛stlich von St. Lorenzen bei Knittelfeld er-
reicht, sind (nun gerne auch) am Wasserweg f lussabw�rts nur mehr 26 bequeme km nach
Leoben zu bew�ltigen69.
Aus den r˛mischen Stra�enanbindungen Leobens streichen muss man die von Modri-
jan als ,,eine der bestgebauten R˛merstra�en Steiermarks‘‘70
bezeichnete gepf lasterte
Strasse von Donawitz nach Vordernberg und zum Erzberg, die sich nach den Forschungen
von Susanne Klemm endgˇltig als Neubau aus der Zeit Maria Theresias erwiesen hat71. Zu-
mindest bis Trofaiach/Laintal, wo eine r˛mische Siedlungsstelle mit Sicherheit nachzuwei-
sen ist72, muss es jedoch eine Wegverbindung gegeben haben; nichts spricht somit
dagegen, den vicus von Donawitz als Verkehrsknotenpunkt, an dem mehrere Nebenwege
ins Murtal mˇndeten, zu bezeichnen.
Eine darˇber hinausgehende ˇberregionale Bedeutung als ,Funktionssiedlung‘, vor
allem im Zusammenhang mit norischem Eisen aus der Erzbergregion, muss dahingestellt
bleiben73. Bisher ist der Nachweis einer r˛merzeitlichen Nutzung des Erzberges ausgeblie-
ben, die von Walter Schmid74
als r˛misch bezeichneten Schmelz˛fen auf der Feistawiese
an der Nordseite des Pr�bichl haben sich als mittelalterlich erwiesen75. Die Frage, ob der
Leobner Raum zur R˛merzeit in irgendeiner Weise in das zentral kontrollierte Berg- und Hˇt-
tenwesen eingebunden war, steht in enger und urs�chlicher Verbindung mit der Frage
nach seiner verwaltungsm��igen Zuordnung. Geh˛rt er zum munizipalen Verwaltungsbe-
reich von Flavia Solva oder ist er Teil der von Ge¤ za Alf˛ldy konstruierten und vor allem in
den 70er-Jahren des 20. Jhs. leidenschaftlich umstrittenen kaiserlichen Ressourcendo-
m�ne (Metall, Stein, Salz, Holz) eines patrimonium regni Norici76? Es f�llt auf, dass es inner-halb Noricums n˛rdlich und sˇdlich des Alpenhauptkammes in einem 100 bis 150 km
breiten Streifen keine r˛mische Stadt gibt, nicht einmal dort, wo genˇgend Platz dafˇr w�re,
68z. B. vehement Fischer 2002, 121f.
69In diesem Sinne auch Hebert ^ Hudeczek 2004,
411.70
Modrijan 1957, 11.7 1
Klemm 2000.72
Modrijan 1957, 11f.; Fuchs ^ Hudeczek 1986;
Gutjahr 2000, 110 und Anm. 17.73
Zum vielf�ltigen Vicusbegriff neuerdings Kor-
tˇm 2008.
74Schmid 1932, 33 f.; in diesem Sinne noch Alf˛ldy
1974, 175.75
Klemm 2003, 14; Sperl 1990 (12./13. Jh.); Sperl
1994, 28 f.; die bei Freudenthaler 1940, Taf. 3 abgebilde-
ten Scherben von der Feistawiese sind ins 14./15. Jh.
zu datieren.76
Zuletzt mit ausfˇhrlicher Diskussion Alf˛ldy
1989.
598
Manfred Lehner
z. B. im Raum Aichfeld-Murboden77, dass also vielleicht kein Bedarf fˇr eine Munizipalverwal-
tung bestand78. Diese Konstruktion ist insofern bequem, als man sich vorzustellen hat, dass
die Kontrolle und Verwaltung dieses riesigen und z. T. sehr unwegsamen Gebietes ambu-
lant erfolgte und Siedlungsstellen nur im Zusammenhang mit der Ausbeutung der Boden-
sch�tze und zur infrastrukturellen Versorgung der Stra�en entstanden, also eine gewisse
raumerfassende Dichte der r˛merzeitlichen Siedlungsstruktur gar nicht vorhanden war.
Aus diesem Zusammenhang erkl�ren sich Aussagen, die von einer ,,ˇberraschenden
Dichte r˛merzeitlicher Funde im Gro�raum Leoben‘‘79
sprechen, obwohl die Fundlage ver-
gleichsweise �u�erst karg ist.
Im Laufe der Zeit ^ die Arch�ologie ist eine langsame Wissenschaft und kein ,Blitz-
krieg‘80
^ verdichten sich die Indizien, dass dieser Raum eben nicht nur im Sinne einer Opti-
mierung von Rohstoffgewinnung und -transport rein funktional und infrastrukturell
erschlossen, sondern entlang der Stra�en ganz ,normal‘ aufgesiedelt war. Es gibt keinen
Grund, weder fˇr das Leobener Stadtgebiet noch fˇr den Landbezirk und noch weniger,
was die ganze Mur-Mˇrzfurche betrifft, eine viel geringere r˛merzeitliche Siedlungsintensi-
t�t als fˇr andere vergleichbare und besser erforschte Talschaften anzunehmen. Was fehlt,
ist ein Munizipium oder ein Milit�rlager als Angelpunkt althergebrachter Heimat- undmoder-
ner Umland-Forschung81.
Einer Zugeh˛rigkeit zum Verwaltungsbereich Flavia Solvas (das dann trotz seiner rela-
tiven Unbedeutendheit nach Iuvavum das zweitgr˛�te Munizipium Noricums w�re82!) soll
hier trotzdem nicht das Wort geredet werden; die Frage ist unentschieden, und Reinhold We-
denig hat sie zu Recht als ,Glaubensfrage‘ bezeichnet83.
Aufgrund der kargen Ausbeute an arch�ologischen Daten sind auch chronologische
Fragen zur R˛merzeit in Leoben nur schwer zu diskutieren. Sicher belegbar ist die Zeit-
spanne vom 2. bis zum 4. Jh. ; ob mehrere Siedlungspl�tze gleichzeitig oder nacheinander
existierten, ist anhand der Mˇnzfunde nicht zu entscheiden. Nur die Donawitzer Funde las-
sen eine Mehrphasigkeit des vicus erahnen84. Erstaunlich ist der sp�te Mˇnzfund vom An-
naberg, sind doch die Funde des 6. und 7. Jhs. in der Steiermark im Gegensatz zu K�rnten
quasi an den Fingern einer Hand abzuz�hlen85. Es dr�ngt sich die Frage auf, ob die inneral-
pinen H˛hensiedlungen der Sp�tantike, die vor allem im Ennstal gut erforscht sind, wirklich
alle sp�testens im 5. Jh. enden86, oder ob wir, wenn die Metallfunde auslassen, nur das kera-
mische Fundmaterial noch nicht richtig datieren k˛nnen87.
Gedanken zum Leobner ForschungsdefizitDie R˛mer/innen waren zwar in Leoben, aber die Leobner Arch�olog/inn/en sind in Graz
und schauen ^ zumindest in Fachpublikationen nachlesbar ^ nicht zurˇck. Woran mag das
liegen? Warum ist die R˛merforschung gerade in der Heimatstadt so vieler Altertumswissen-
schaftler/innen arch�ologisch verwaist88? Woran mag es liegen, dass in den letzten Jahren
77Zur r˛merzeitlichen Siedlungsstruktur in diesem
Raum neuerdings Tiefengraber 2007, 14. 20^22.78
Gassner u. a. 2003, 116 f.79
Modl ^ Schrettle 2005a, 117.80
Ausspruch G. Tiefengrabers, den Verf. damit ei-
nen Geistes mit weiteren Kolleg/inn/en wei�.8 1
Wie es Groh u. a. 2007 mit ihrem aktuellen ufer-
norischen Surveyprojekt vorexerzieren.82
Auch diese Aussage ist relativ: Die Gr˛�e des
Solvenser Stadtterritoriums h�ngt nicht nur von seiner
Nordausdehnung, sondern noch mehr davon ab, wie
weit ˛stlich man die ebenso v˛llig unklare und umstrit-
tene Grenze zwischen Noricum und Pannonien zieht.
83Wedenig 1997, 38.
84Vgl. Tiefengraber 2007, 14.
85Steinklauber ^ Hebert 2001, 275^277.
86Steinklauber u. a. 2005, 164.
87ebd., 151.
88Realistisch betrachtet liegt ja nicht nur Leoben,
sonden die ganze, zumindest heute naturr�umlich
und wirtschaftlich zentrale Mur-Mˇrz-Furche n˛rdlich
des Randgebirges und sˇdlich das Alpenhauptkam-
mes im Zwischengel�nde der steirischen arch�ologi-
schen Forschung. Au�erhalb dieser Grenzen findet
arch�ologische Forschung zur R˛merzeit statt, inner-
halb kaum einmal.
599
Die R˛mer in Leoben
kaum Schˇler/innen von den Leobner Gymnasien den Weg zum Studium am Grazer Institut
fˇr Arch�ologie finden? Geschichtliches Desinteresse einer linksregierten Arbeiterstadt?
Dagegen spricht, dass zwar die Stadtregierung zu mehr als drei Vierteln links der Mitte, aber
trotzdem mitten in der Bˇrgerlichkeit angesiedelt ist. Das kulturelle Sagen hatte in Leoben
immer schon das durch das Vorhandensein der Montanuniversit�t und durch das riesige
Landeskrankenhaus fˇr eine Kleinstadt sehr deutlich ausgepr�gte und auch zahlreich vor-
handene Bildungsbˇrgertum, das ja eigentlich die klassische Klientel der Arch�ologie dar-
stellt.
Bestes Abbild dieser hybriden Situation ist der Ortsvorsitzende der KP� Leoben, Abge-
ordneter zum steirischen Landtag Dr. Werner Murgg, der ein mehr als engagierter Burgen-
forscher ist und eng mit der Bodendenkmalpf lege zusammenarbeitet.
Einen weniger politischen Standpunkt nimmt Gˇnther Jontes ein, der anl�sslich des
10. Todestages des Heimatforschers und unermˇdlichen Geschichtsbewusstseinsbildners
Wolfgang Haid meint, dass man ,,in einer Stadt wie Leoben, in der nˇchterner Sachverstand
dominierte und die Technik in derart hohem Ma�e alle Bereiche das Lebens und der Gesell-
schaft beherrschte †‘‘89, fˇr Kunst, Kultur und sch˛ne alte Dinge eher keinen Sinn habe.
Steht also die Arch�ologie in Leoben auf verlorenem Posten? Man k˛nnte hinzufˇgen,
dass es auch weniger abstrakte als ganz praktische Grˇnde anzufˇhren g�be: Viel Wald
und mehr Wiesen als �cker ergeben ungˇnstige Bedingungen fˇr Oberf l�chenfunde. Im
Ausseerland und im steirischen Ennstal gibt es fast gar keine �cker, aber eine Forschungs-
dichte, die in �sterreich ihresgleichen sucht. Liegt das nur an der submonarchistischen
Salzkammergut-Sehnsucht des ˛sterreichischen Bildungsbˇrgertums, oder eher daran,
dass es eine ,,Arch�ologische Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut‘‘ gibt und einen ,,Verein
ANISA‘‘, also gel�ndeerprobte Metallsuchger�tgeher, die dem steirischen Bodendenkmal-
pf leger eine Unmenge an Funden melden, woraufhin er einen Gutteil seiner ausschlie�lich
in Graz stationierten Truppen weit nach Nordwesten werfen muss?
Dass die steirischen Industrieregionen der Mur-Mˇrz-Furche schon rein forschungs-
geschichtlich stark im Hintertreffen sind, mag sicher auch an der aus Mangel an historisch
interessiertem Bildungsbˇrgertum unterrepr�sentierten Kategorie der Heimatforscher lie-
gen, in deren Windschatten die Armada der Metallsucher und Raubgr�ber lauert. Dieser
historische Rˇckstand konnte trotz des Aufw�rtstrends der letzten Jahre bis heute nicht
wettgemacht werden. In den ,konservativen‘ Gegenden des b�uerlichen Ennstals und des
monarchistisch gepr�gten Salzkammerguts ist der arch�ologische Aktivit�tsgrad bezeich-
nenderweise fast gleich hoch wie rund um Graz als Sitz der Forschungsinstitutionen und in
den f lacheren, naturgem�� eine h˛here Dichte an Fundstellen aller Epochen aufweisen-
den sˇdlichen Landesteilen der Steiermark; Jochen Giesler schreibt diesen Umstand ,,denProblemen einer zentralisierten Bodendenkmalpflege‘‘ zu90 und wird damit so unrecht
nicht haben.
EpilogAm 2. Mai 2000 hat Verf. einen Brief an den Leobner Bˇrgermeister, Hrn. Dr. Matthias Kon-
rad, geschrieben, mit der Absicht, den Schwung im Gefolge der damaligen Steirischen Lan-
desausstellung91
nicht nur in die Selbstabfeierung der Stadt als neue Kulturmetropole ^
gerade hatten auch die publikumswirksamen kulturhistorischen Gro�ausstellungen92
im
89Jontes 1980, 145.
90Giesler 1997, 302.
9 11997: Made in Styria.
921998: China- Verborgene Sch�tze. Grabfunde
der Han-Dynastie; 1999: Tibet ^ G˛tter des Himalaya;
2000: Peru ^ Versunkene Kulturen, die Welt der Inka,
Mochica, Nasca, Lambayeque, Chimu¤ ; 2001: �gypten ^
im Reich der Pharaonen; 2002: Mongolen ^ Die
Sch�tze der Goldenen Horde; 2003: Samurai und Gei-
sha. Liebe und Tod im Japan der Sho“ gune; 2004: Faszi-
nation Vietnam. G˛tter, Helden, Ahnen; 2005: Mensch
und Kosmos. Pr�kolumbische Kunst aus Mexiko; 2006:
600
Manfred Lehner
Stadtmuseum zu greifen begonnen ^ mˇnden zu lassen, sondern diesen Schwung auch
fˇr die arch�ologische Forschung nutzbar zu machen. Eine Antwort auf dieses Koopera-
tionsangebot ^ es war definitiv kein Bettelbrief ! ^ ist nie erfolgt. Siebeneinhalb Jahre sp�ter,
anl�sslich eines zuf�lligen Zusammentreffens in einemWirtshaus in Kammern im Liesingtal,
sprach der Bˇrgermeister, als er erstaunt erfuhr, dass Verf. Arch�ologe ist, prompt von der
n�chstj�hrigen Ausstellung: Die Wikinger ! Chronologisch hervorragend passen wˇrde
eine l�ngst ˇberf�llige arch�ologische Untersuchung der 904 urkundlich bezeugten Wehr-
hofanlage in loco Zlatina dicto in G˛ss/Schladnitz93. Glˇck auf !
Vass. Mag. Dr. Manfred Lehner
Institut fˇr Arch�ologie
Karl-Franzens-Universit�t Graz
Universit�tsplatz 3/II
A-8010 Graz
LiteraturverzeichnisAlf˛ldy 1974 G. Alf˛ldy, Noricum (London1974).
Alf˛ldy 1989 G. Alf˛ldy, Die regionale Gliederung der r˛mischen Provinz Noricum, in: G. Gottlieb (Hrsg.), Raumord-
nung im R˛mischen Reich. Zur regionalen Gliederung in den gallischen Provinzen, in R�tien, Noricum
und Pannonien. Kolloquium an der Universit�t Augsburg anl��lich der 2000-Jahr-Feier der Stadt Augs-
burg vom 28. bis 29. Oktober 1985. Schriften der Philosophischen Fakult�ten der Universit�t Augsburg,
historisch-sozialwissenschaftliche Reihe 38 (Mˇnchen 1989) 37^55.
Bauer 1997 I. Bauer, R˛merzeitliche H˛hensiedlungen in der Steiermark mit besonderer Berˇcksichtigung des ar-
ch�ologischen Fundmaterials, F� 36, 1997, 71^192.
Ebner 1979 H. Ebner, Burgen und Schl˛sser der Steiermark 2. Mˇrztal und Leoben2(Wien 1979)
Fischer 2002 Th. Fischer, Noricum (Mainz 2002)
Freudenthaler 1940 J. Freudenthaler, Eisen auf immerdar ^ Geschichte der Stadt und des Kreises Leoben in Kulturbildern2(Leoben 1940)
Fuchs ^ Hudeczek 1986: G. Fuchs ^ E. Hudeczek, KG Laintal, F� 24/25, 1985/86, 310.
Fuchs ^ Obereder 1999 G. Fuchs ^ J. Obereder, Arch�ologische Untersuchungen amKulm bei Trofaiach 1997, F� 38, 1999, 107^
162.
Gassner u. a. 2003 V. Gassner ^ S. Jilek ^ S. Ladst�tter, Am Rande des Reiches. Die R˛mer in �sterreich. �sterreichische
Geschichte 15 v.^378 n. Chr. (Wien 2003)
Giesler 1997 J. Giesler, Der Ostalpenraum vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Studien zu arch�ologischen und schrift-
lichen Zeugnissen 2: Historische Interpretation. Frˇhgeschichtliche und Provinzialr˛mische Arch�olo-
gie, Materialien und Forschungen 1 (Rahden 1997)
Grabherr 2006 G. Grabherr, Die Via Claudia Augusta in Nordtirol ^ Methode, Verlauf, Funde, in: E. Walde ^ G. Grabherr
(Hrsg.), Via Claudia Augusta und R˛merstra�enforschung im ˛stlichen Alpenraum. Ikarus 1 (Innsbruck
2006) 36^336.
Groh u. a. 2007 St. Groh u. a., Zur l�ndlichen Besiedlung im Hinterland von Mautern/Favianis ^ methodische Grundla-
gen einer Untersuchung gro�r�umiger Siedlungsstrukturen am Donaulimes, A� 18/2, 2007, 56^63.
Gutjahr 2000 Ch. Gutjahr, Vier frˇhmittelalterliche K˛rpergr�ber in Trofaiach, Steiermark, F� 39, 2000, 109^136.
Gutscher 1897 H. Gutscher, Vorgeschichtliche und r˛mische Funde in Leoben und Umgebung, MZK NF 23, 1897, 187^
191.
Haas 1858 C. Haas, Ein neues r˛misches Denkmal, Mittheilungen des Historischen Vereines fˇr Steiermark 8, 1858,
161^164.
Haid 1954 W. Haid, Bodenfunde im Raum Leoben, Obersteirische Volkszeitung vom 13.3. 1954, 7.
Haid 1967 W. Haid, Nammonius Mussa, ein r˛merzeitlicher Goldschmied aus Kalsdorf, SchSt 13, 1966/67, 25^31.
Hebert 1989 B. Hebert, Arch�ologische Untersuchungen in der Krypta von G˛�, Steiermark, �ZKD 43, 1989, 181^184.
Hebert ^ Hudeczek 2004: B. Hebert ^ E. Hudeczek, Arch�ologische Interpretationsans�tze, in: B. Djuric› u. a., Marmore r˛mischer
Brˇche und Steindenkm�ler in der Steiermark und in S� tajerska. Ergebnisse eines Forschungsprojektes,
F� 43, 2004, 365^431.
Heymans 2006 H. Heymans, Das Dominikanerkloster in Leoben, F� 45, 2006, 523^540.
Die Welt des Orients. Kunst und Kultur des Islam; 2007:
Gold und Jade. Sensationsfunde aus chinesischen
Herrschergr�bern.93
Zahn 1875, Nr. 13.
601
Die R˛mer in Leoben
Heymans ^ Lehner 2005: H. Heymans ^ M. Lehner, Arch�ologische Grabungen in der Massenburg, Leoben, Steiermark, F� 44,
2005, 369^381.
Hinker 2006 Ch. Hinker, Der Fall Monate. Entdeckung und Verlust einer r˛mischen Stra�enstation in der Steiermark,
in: E. Walde ^G. Grabherr (Hrsg.),Via Claudia Augusta undR˛merstra�enforschung im˛stlichen Alpen-
raum. Ikarus 1 (Innsbruck 2006) 457^464.
Hinker-Thaller 2003 Ch. Hinker ^ E. Thaller, KG Judendorf, F� 42, 2003, 738.
Jontes 1980 G. Jontes,Wolfgang Haid 1906^1970, SchSt 14, 1979/81, 143^146.
Jontes 1995 G. Jontes, Leoben, die alte Bergstadt2(Spielberg 1995)
Karl 2006 St. Karl, Die r˛merzeitlichen Altarabschlussfragmente von Kalsdorf und Schloss Seggau. Eine zeichne-
rische Wiedervereinigung, in: Ch. Gutjahr u. a. (Hrsg.), Homo effodiens ^ der Grabende. Festgabe fˇr
Helmut Ecker-Eckhofen zum 70. Geburtstag, Hengist-Studien 1 (Wildon 2006) 85^88.
Klemm 2000 S. Klemm, Neue Comercialstra�e und Arzt=fuhr=weeg. Untersuchungen von Altstra�en im Gemeinde-
gebiet von Vordernberg, Bez. Leoben, Steiermark, 1997^1998, F� 39, 2000, 145^170.
Klemm 2003 S. Klemm,Montanarch�ologie in den Eisenerzer Alpen. Arch�ologische und naturwissenschaftlicheUn-
tersuchungen in der Eisenerzer Ramsau, MPK 50 (Wien 2003).
Kortˇm 2008 K. Kortˇm,Vici ^ R˛mische Siedlungen. Vorl�ufer moderner St�dte, AiD 2008/1, 18^21.
Kramer 1994 M. Kramer, Late' nefunde der Steiermark. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar der Phi-
lipps-Universit�t Marburg 43 (Marburg a.d. L. 1994)
Leitner-B˛chzelt 2002 S. Leitner-B˛chzelt, Leoben (Erfurt 2002)
Leitner-B˛chzelt ^ Mittersteiner 2006: S. Leitner-B˛chzelt ^ R. Mittersteiner, Schienen in die Vergangenheit. 2000 Jahre Stadt-,
Regional- und Montangeschichte. Katalog Museumscenter Leoben (Leoben 2006)
Lippert 1985 A. Lippert (Hrsg.), Reclams Arch�ologiefˇhrer. �sterreich und Sˇdtirol (Stuttgart 1985)
Lugs 2005 W. Lugs, Die Geographie des Ptolem�us fˇr den norischen Raum, R� 28, 2005, 7^22.
Modl ^ Schrettle 2005a D. Modl ^ B. Schrettle, Die ,,Wanderkapelle‘‘ ^ DasObergeschoss einer r˛mischenGrabaedicula aus Do-
nawitz, SchSt 18, 2005, 107^133.
Modl ^ Schrettle 2005b D. Modl, B. Schrettle, R˛mische Grabarchitektur aus Leoben, BlHkStmk 79, 2005, 22^31
Modrijan 1956 W. Modrijan,Vor- und frˇhgeschichtliche Funde aus dem Bezirk Leoben (1. Teil), SchSt 6, 1956, 3^40.
Modrijan 1957 W. Modrijan,Vor- und frˇhgeschichtliche Funde aus dem Bezirk Leoben (2. Teil), SchSt 7, 1957, 5^28.
Pichler 1874 F. Pichler, Die r˛mische Villa zu Reznei in Steiermark, MZK 19, 1874, 169^179.
Pichler 1879 F. Pichler,Text zur arch�ologischen Karte von Steiermark (Graz 1879)
Schachinger 2006 U. Schachinger, Der antike Mˇnzumlauf in der Steiermark, VNumKomm 43 (Wien 2006).
Schmid 1924 W. Schmid, R˛mische Forschungen in �sterreich 1912^1924, BerRGK 15, 1923/24, hier 233.
Schmid 1932 W. Schmid, Norisches Eisen, Beitr�ge zurGeschichte des ˛sterreichischenEisenwesens (Wienu. a. 1932)
Schrettle 2004 B. Schrettle, KG Judendorf, F� 43, 2004, 927^929.
Sperl 1990 G. Sperl, R˛misches Eisenwesen um den Erzberg, Obersteirische Zeitung vom 20. 10. 1990, 10.
Sperl 1994 G. Sperl, Donawitz vor der ,,Alpine‘‘. Von den Anf�ngen eines weltbekannten Industrieortes, in: Donawitz
^ mehr als ein Stadtteil von Leoben (Leoben 1994) 23^47.
Steinklauber ^ Hebert 2001: U. Steinklauber ^ B. Hebert. Ad Viruni limina ^ An den Grenzen des Virunenser Territoriums, in: F. W.
Leitner (Hrsg.), Carinthia Romana und die r˛mische Welt. Festschrift fˇr Gernot Piccottini zum 60. Ge-
burtstag. Aus Forschung und Kunst 34 (Klagenfurt 2001) 271^278.
Steinklauber u. a. 2005 U. Steinklauber u. a., Inneralpine sp�tantike H˛hensiedlungen im steirischen Ennstal, SchSt 18, 2005,
135^198
Tiefengraber 2007 G. Tiefengraber, Arch�ologische Funde vom Fu�e des Falkenberges bei Strettweg. Ein Beitrag zur Be-
siedlungsgeschichte des Aichfeldes, Berichte des Museumsvereines Judenburg 40, 2007, 3^39.
Wagner 2001 J. Wagner, Zur ostentativenWiederverwendung r˛merzeitlicher Spolien in mittelalterlichen und frˇhneu-
zeitlichen Kirchenbauten der Steiermark. Bannung, Exorzismus und humanistische Intentionen im Spie-
gel einer interpretatio christiana, F� 40, 2001, 345^479
Weber 1969 E. Weber, Die r˛merzeitlichen Inschriften der Steiermark. Ver˛ffentlichungen der Historischen Landes-
kommission fˇr Steiermark, Arbeiten zur Quellenkunde 35 (Graz 1969)
Wedenig 1997 R. Wedenig, Epigraphische Quellen zur st�dtischen Administration in Noricum. Aus Forschung und
Kunst 31 (Klagenfurt 1997)
Zahn 1875 J. v. Zahn,Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark I (Graz 1875)
602
Manfred Lehner
Abb. 1: Ausschnitt aus der �K 50 132 Trofaich und 133 Leoben. Quelle: BEV Austrian Map 2.0 (2001).Rechteck: Stadt Leoben, mittelalterliche Anlage von 1262/3.Kreis: Sp�tantike (?) H˛hensiedlung am Sporn des AnnabergesOval: Vermutete Position der Fundstellen von 1858 (Grabaedicula) und 1895 (Metallfunde)TS: Fundort der Terra Sigillata-Scherbe Abb. 2Satus: verschollene Grabinschrift von der WaasenkircheVervicius: Felsinschrift auf der Niederung (Schmutzenwand)
Abb. 2: Randfragment eines Tellers der Form Dra-gendorff 18/31 (Rheinzabern) vom Mˇnzenberg,KGWaasen, Nordrand von Parz. 344/1. Foto Verf.
603
Die R˛mer in Leoben
Abb. 3. Ansicht des Altweges in St. Peter Freienstein (Hessenberg) in RichtungWestnordwesten. Rechts derReiting ˛stlich, im Hintergrund die Seckauer Alpen westlich des Liesingtals. Foto Verf. im J�nner 1989.
Abb. 4: Ansicht des unteren Vordernbergerbachtales mit demWerk Donawitz im Jahre 1873 mit vermuteterLage des vicus. Dahinter im Bildmittelgrund der Rˇcken des Annaberges mit seinem nach Sˇden auskra-genden Felssporn. Von rechts (H�user) flie�t der Talbach in den Werksbereich. Nach Freudenthaler 1940,Taf. 26 unten, Bearb. Verf.
604
Manfred Lehner
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort der Herausgeberinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P. Noelke, Erwin Pochmarski. Pater colloquiorum artis lapidariae provinciarum . . . . . . . . . . 11
W. Muchitsch, Versuch eines Geleitwortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tabula Gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
S. Ahrens ^ A. Pomeroy ^ J. Deuling, The Sarcophagus of Albius Graptus in Wellington . . . . 31
H. Aigner, Ein geraubtes ,,Herakles-Relief‘‘ aus dem oberen Nadura-Tempel derOase Charga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A. Ambrogi, Polychrome Lastra mit dextrarum iunctio- Darstellung in der Catacomba diS. Panfilo in Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B. Andreae, ,,Einer neuenWahrheit ist nichts sch�dlicher als ein alter Irrtum.‘‘ Noch einmalzum Praetorium Speluncae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
R. Ardevan, Ein Gryllos aus gebranntem Ton aus Gherla (Dakien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
W. Artner ^ F. Belitti, Die bronzezeitlichen Funde aus dem Bereich der r˛mischen Villa II vonGrafendorf bei Hartberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A. Bammer, Der Baldachin und das ,,Foundation Deposit‘‘ im Artemision von Ephesos . . . . 83
F. Blakolmer, Zum Lentoidsiegel mit Keilerjagd aus dem frˇhmykenischen Tholosgrab vonVapheio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
J. Bouzek, Das Ende der mitteleurop�ischen Kelten: Was ist von ihnen geblieben? . . . . . . . 103
E. Christof, Das sp�tptolem�ische K˛nigsbildnis in Mailand ,,Inv. E 0.9.4075‘‘ . . . . . . . . . . . 109
F. Ciliberto, Die Anf�nge der Sarkophagproduktion Aquileias. Kritische Beobachtungen . 117
O. Czirke, Sekund�rbestattungen in den Hˇgelgr�bern der sp�ten Kaiserzeit und derfrˇhen Arpadenzeit im Komitat Veszpre¤ m (Ungarn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
St. Ditsch, Geh˛hlte Grabdenkmalfragmente aus der Pfalz. �berlegungen zum Zusammen-hang zwischen Grabmonument und Bestattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
B. Djuric¤ , Early Stelae from Poetovio and the Marble Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
E. Dobruna-Salihu, Kaiserzeitliche reliefgeschmˇckte Sarkophage aus Dardanien . . . . . . 167
M. Donderer, Bildliche Darstellungen von Sklaven im G˛tterkostˇm? Die consecratio informam deorum auf Abwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
P. Dyczek, Unde et quando cippi dalmatini dardanique initium ceperint . . . . . . . . . . . . . . . 197
C. Englhofer, Das Priestertum des Poseidon auf Kalaureia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
E. Fabbricotti, New Finds from a Roman Tomb in Cyrenaica. The Portraits . . . . . . . . . . . . . 219
A. Facsa¤ dy, Earrings on Stone Monuments from Pannonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
F. Fazekas ^ A. Szabo¤ , Ausgew�hlte Bronzegef��e aus dem Kastell von Lussonium . . . . . 243
G. Fuchs, Spuren der r˛mischen Landvermessung im La�nitztal (Weststeiermark,�sterreich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
V. Gaggadis-Robin, Ein r˛misches Grabrelief aus Buthrotum (Butrint) . . . . . . . . . . . . . . . . 273
U.-W. Gans, Ein Familienrelief amMausoleum von Saint-Julien-le' s-Martigues . . . . . . . . . . 277
5
V. Gassner, ,,Boische‘‘ Keramik und ,,boische Grabstelen‘‘ ^ zur Problematik ethnischerZuweisungen in der Interpretation der materiellen Kultur in den r˛mischenProvinzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
T. Gesztelyi, Die Gemmenfunde von Aquincum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
F. Glaser ^ G. P˛schl, Das Dionysosmosaik in Virunum. Entdeckung, Besitz undRestaurierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
H. Gra�l, Der Prozess der Provinzialisierung im Ostalpen- und Donauraum im Bild derneueren Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
K. Gschwantler, Die Grotte des Pan und der Nymphen auf dem Parnes . . . . . . . . . . . . . . . . 349
M. Handy, Die Severer und das Aufkommen eines regionalen Bewusstseins amDonaulimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
B. Hebert ^ U. Steinklauber, In Privatbesitz ^ dreimal antike Plastik in steirischen Burgen undSchl˛ssern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
N. Heger, EX UNGUE LEONEM PINGERE ^ Zu einem Freskenrest aus Loig . . . . . . . . . . . . . 385
G. Hoxha, Zwei altchristliche Gebetsschalen mit biblischen Szenen aus derProvinz Praevalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
R. Kastler, Neuer Wein in alte Schl�uche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
T. Kaszab-Olschewski, Das 3. nachchristliche Jahrhundert im Hambacher Forst . . . . . . . . 421
M. J. Klein, Die ,,Alsatia Illustrata‘‘ des Stra�burger Gelehrten Johann Daniel Sch˛pflin(1694^1771) und die Erforschung r˛mischer Steindenkm�ler des Rheinlandesan den H˛fen vonMannheim undMainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
E. Klenina, Some Remarks on the Topography of the Ancient Chersonesus Taurica . . . . . . 445
G. Koch, Ein Jahreszeiten-Sarkophag aus Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
G. Koiner, Die Grabstele des Stasis aus Marion. Eine attischeWebkante in Zypern . . . . . . . 467
A. Kossatz-Deissmann, Orest in Delphi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
P. Kova¤ cs, Christian Epigraphy in Pannonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
J. Kraschitzer, Kliometherthal Euer Urpokal ^ Erato oder Terpsichore? . . . . . . . . . . . . . . . . 503
E. Krenn, Das norisch-pannonische Hˇgelgr�berfeld von Rothleiten, OG und KG St. Johanni. d. Haide, Grabung 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
U. Kurz, Frˇchte und Opferkuchen in der Koroplastik des Demeter- undKore/Persephonekultes von Herakleia/Policoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
R. Kurzmann, Prata, Territorium & Co ^ R˛mischeMilit�rterritorien und ihre Bezeichnungen 537
K. Kuzmova, Torques-Darstellungen auf den r˛mischen Grabsteinen Nordpannoniens . . . 545
S. Lamm, ,,Dieser Teller geh˛rt†‘‘ Ein instrumentum domesticum aus Grˇnau und Tellerin-schriften in der Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
F. Lang ^ D. Knauseder, �berlegungen zum sogenannten Handwerkerviertel vonIuvavum/Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
O. T. La¤ ng, A Newly Discovered Statue of Jupiter from Aquincum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
St. Lehmann, Der Kopf einer hellenistischen Athletenstatue in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . 579
M. Lehner, Die R˛mer in Leoben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
U. Lohner-Urban, Der Tempelbezirk des Juppiter Heliopolitanus in Carnuntum ^ EinVorbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Th. Lorenz, Pseudopolykleitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
6
Inhaltsverzeichnis
T. Mattern, Ein Verm�chtnis Alexanders des Gro�en? Antiochos IV. und drei monumentalehellenistische Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
A. Maver, Funerary Aediculae in Poetovio and Her Ager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
M. Merczi, Sekund�rbestattungen im frˇhr˛mischen Hˇgel Nr. 1 von Kemenes-szentpe¤ ter-Dombi Flur. Eine anthropologische Auswertung der Skelettfunde . 639
H. Meyer, Polyklet ˇber Fingern�gel und Lehm. Zur Rezeptionsgeschichte einesKˇnstlerausspruchs zwischen Horaz, Morelli und Beazley . . . . . . . . . . . . . . . 649
F. Mˇller, Die Statue eines Kybelepriesters aus CaesareaMauretania und die Ausbreitungdes Kybelekultes im r˛mischen Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
U. Muss, Potnia Theron im Artemision von Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
M. Nagy, A Lead Tank from Late Roman Pannonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
E. Nemeth, Taktik und Strategie in der milit�rischen Zusammenarbeit zwischen denr˛mischen Provinzen Dakien und Pannonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
T. Neuhauser, Das r˛mische Theater von Savaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
St. Oehmke, Ein unverhofftes Liebespaar. Zur Berliner Priapos/M�nadengruppe . . . . . . . 707
S. Pala¤ gyi, Einige Angaben zu den Geb�uden von Ke¤ kku¤ t (Pannonia) . . . . . . . . . . . . . . . . 725
T. Panhuysen, Zwei Kaiserportr�ts und ein Sarkophag. R˛mische Au�enseiter inMaastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
A. Pastorino, Der Torso eines Satyrs im ,,Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti‘‘ inGenua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
G. Piccottini, Munusculum EpigraphicumCarinthiacum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
R. Porod ^ B. Porod, Die Geburt eines Mythos. Zu Lukians prolalia Bacchus . . . . . . . . . . . 767
M. Poulkou, M�nade bei der K˛rperpflege. Eine Schale in Gravisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
M. Pretzler, Pausanias in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
D. Ratkovic,Wagon and Harness Bronzes from the Roman Collection of the NationalMuseum in Belgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
E. Ruprechtsberger, Reliefmedaillon mit Kaiserportr�t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
M. Sanader, �ber zwei r˛mische Grabstelen aus der r˛mischen Provinz Dalmatien, aufdenen ein Ball dargestellt ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
U. Schachinger, Der r˛merzeitliche Geldverkehr im norisch-pannonischen Grenzgebiet . . 843
P. Scherrer, Agrippinaminor als Concordia? Bemerkungen zu den imperialen Reliefs amSebasteion von Aphrodisias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
G. Schick, Augustus als PRAESENS DIVUS oder doch der DIVUS Agrippa? Vaterschafts-fragen und ein gaditischer Dupond fˇr Gaius und Lucius Caesar . . . . . . . . . 885
A. Schidlofski, Ein unbekannter Brief vonW. Froehner. Beispiel einer ,,sachlichen‘‘ Gelehrten-diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
G. Schwarz, Eine r�tselhafte Frau. Zur Ikonographie von ,,Hektors L˛sung‘‘ auf attischenSarkophagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
I. Skupin¤ ska-L�vset, Four Sculptures with the Provenience Caesarea Maritima in Oslo . . . 921
A. Starac, Volumen, stilus, codex ansatus. Examples from Istria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
A. Steinegger, M�dchenmit Spiegel sucht Jˇngling mit Schriftrolle. Eine etwas andereVermisstenanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
J. Steiner, Instruction und Anleitung zu Ausgrabungen in Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
7
Inhaltsverzeichnis
K. Strobel, Der Alpenkrieg und die Eingliederung Noricums und Raetiens in dier˛mische Herrschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
V. Strocka, Das verkannte Weihrelief des Neoptolemos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005
K. Tausend, Frˇhe kretische Krieger. Bemerkungen zu den Kriegerdarstellungen aufkretischen Bronzen des 9./8. Jhs. v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
S. Tausend, Der ,,Schwarze Tod‘‘ vor Troia? Apollon Smintheus und Yersinia pestis . . . . . 1033
F. Teichner, <<Theile einer Badeanstalt im r˛mischen Style>> Zu den Anf�ngen derprovinzialr˛mischen Forschung im Sˇden Lusitaniens . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045
H. Thˇr, Zum Stadtpalast des Dionysospriesters C. Flavius Furius Aptus im Hanghaus 2 inEphesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
E. To¤ th, Ein wiederverwendeter r˛mischer Sarkophag aus Sze¤ kesfehe¤ rva¤ r . . . . . . . . . . . . 1073
M. Verza¤ r-Bass, Icarusdarstellungen aus Flavia Solva und das Problem der Vorbilder . . . 1081
M. Vomer Gojkovic› , R˛mischeWandmalerei aus einemHaus in der Gubceva ulica inPtuj/Poetovio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
E. Walde, Sch˛ne M�nner. Die K˛rperkunst der Kouroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
E. Weber, Ein R˛merstein aus der Steiermark in Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129
R. Wedenig, Die norisch-pannonische Tracht im epigraphischen Kontext. Zur Datierungder beschrifteten Grabsteine bei J. Garbsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135
M. Wei�, Das Mithrasbild aus der Villa Altieri, Rom. Vergleich und Deutung . . . . . . . . . . . . 1147
W. Wohlmayr, Zur sog. Sempronier-Stele im ,,Savaria Mu¤ zeum‘‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161
K. Z˛hrer, R˛mische Siedlungsreste im Bereich von Thannhausen, Oststeiermark . . . . . . 1173
Inhaltsverzeichnis
8