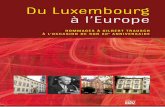Die Darstellung von Realität in Julian Roman Pölslers Film DIE WAND
Transcript of Die Darstellung von Realität in Julian Roman Pölslers Film DIE WAND
Universität zu KölnInstitut für Medienkultur und Theater
Basismodul 4: Formate, Genres, Gattungen
Übung: Kino der Realität
Gereon Blaseio
SS 2013
Die Darstellung von Realität in Julian Roman Pölslers Film DIE WAND.
von
Johanna Xenia Rafalski
BA Medienwissenschaft: Medienkulturwissenschaft, Medienpsychologie
2. Fachsemester
Gereonswall 45
50670 Köln
Tel.: 0221/26028408
Matrikelnummer: 5572991
2
Inhalt
1. Einleitung 3
2. Der Filmausschnitt 3
2.1 Das Visuelle – die Gestaltung eines real anmutenden Bildes durch
Kameraführung, Montage und Licht 4
2.2 Das Auditive 7
2.2.1 Sprache und Stimme 8
2.2.2 Geräusche und Musik 10
2.3 Das Schauspiel 12
3. Die Szenerie 13
4. Die Gesellschaft 13
5. Die realistische Darstellung von Surrealismus im Medium Film 14
6. Quellenangaben 15
Eidesstattliche Erklärung 17
Anhang
3
1. Einleitung
In der folgenden Arbeit wird eine Auseinandersetzung mit der Darstellung von Realität in dem
2012 von Julian Roman Pölsler verfilmten Roman DIE WAND von Marlen Haushofer
stattfinden.
Vielfach interpretiert wurde die Buchvorlage bereits – auf feministischer Grundlage,
psychologischer, politischer, soziologischer. Noch einmal losgelöst davon soll hier jedoch die
Frage aufgeworfen sein, ob und wie das Medium Film das wirkliche Leben darstellt gerade
unter dem Aspekt, dass es keinen reellen Anhaltspunkt für die Existenz einer derartigen Wand
gibt, es sich also um eine fantastische Geschichte handelt.
Aufgrund des begrenzten Größenformats dieser Arbeit wird sich die Analyse nicht auf den
gesamten Film beziehen sondern stattdessen lediglich auf einen Teil des erzählten ersten
Tages der Eingeschlossenheit. Im Laufe der rund 103Minuten Spielzeit kommt die Hauptfigur
insgesamt sechs Mal mit der Wand in Berührung. Da die ersten drei Begegnungen an diesem
ersten Tag stattfinden und unmittelbar nach einander erfolgen, somit quasi ein Erlebnis für die
Figur darstellen, sollen diese Szenen, mit einer weiterhin außerordentlichen Gesamtlänge von
8Minuten 16Sekunden, als eines betrachtet werden. Im Zuge dessen wird die Kapitel 2.1und
2.2 sich auf eine Makroanalyse, welche zuvor von mir vorgenommen wurde und in
tabellarischer Form im Anhang zu finden ist, gründen, genauer jedoch nur auf Besonderheiten
eingehen und dessen Gesamtheit innerhalb dieses Filmausschnittes zu interpretieren
versuchen.
Der Hauptteil der Betrachtung widmet sich somit den technischen, oder handwerklichen,
Aspekten des Filmemachens. Hier findet eine Gliederung in „Das Visuelle“, „Das Auditive“,
„Das Schauspiel“ statt. Darauffolgend sollen die Darstellungen von Natur und Gesellschaft
allgemeinere Aufmerksamkeit finden.
Abschließend wird sich eine Aussage darüber treffen lassen, auf welche Art und Weise
Pölslers „Die Wand“ Realität im Medium Film darstellen kann bzw. welche Wahrnehmung
von Realität der Regisseur selbst scheinbar vermitteln möchte.
2. Der Filmausschnitt
Der Filmausschnitt TC 0:11:51–0:20:07 soll hier Analyse finden. Innerhalb dieses Abschnittes
begleiten wir die Protagonistin durch drei verschiedene Motive sowie durch erzählte und
4
erzählende Zeit. Die Benennung der Szenen/Motive in der zugrundeliegenden Makroanalyse1
erfolgte wohlgemerkt nach eigenem Belieben.
Der Zuschauer sieht in genanntem Abschnitt zuerst die Protagonistin den Weg ins Dorf2
antreten (erzählte Zeit). Mittels einer einzigen Einstellung im Ferienhaus3 wird die erzählte
Zeit dann durch die zwei Jahre spätere erzählende Zeit unterbrochen. Daraufhin folgt der
Zuschauer der Hauptfigur wieder in erzählter Zeit von dem Weg ins Dorf4 zu einer Keusche5,
wo sie auf andere Menschen trifft bevor sie zum Ferienhaus6 (diesmal in ebenfalls erzählter
Zeit) zurückkehrt. Zum Schluss des gewählten Filmausschnittes begibt sie sich noch einmal
an die Stelle, an der sie zuvor zum ersten Mal in Kontakt mit der Wand gekommen ist, auf den
Weg ins Dorf7. Die Zusammengehörigkeit der insgesamt fünf Szenen begründet sich damit,
dass sie gemeinsam den ersten Teil des Realisationsprozesses über das Eingeschlossensein für
die Hauptfigur darstellen, also einen dramaturgischen Bogen bilden.
2.1 Das Visuelle – die Gestaltung eines real anmutenden Bildes durch
Kameraführung, Montage und Licht
Julian Roman Pölslers Film DIE WAND arbeitet statt mit aktionsgeladenen Szenen mit
vorwiegend stillen dominanten Bildern auf fotografische Weise. Doch auch Kameraschwenks
integriert Pölsler, wenn auch reduziert, wirkungsbewusst. Wie Kracauer bemerkt:
Wie bei der Fotografie, so hängt auch hier [im Medium Film] alles vom 'richtigen' Gleichgewicht
zwischen realistischer und formgebender Tendenz ab; die beiden stehen aber nur dann im rechten
Verhältnis zueinander, wenn sich die formgebende Tendenz nicht über die realistische erhebt, sondern
sich schließlich ihr einordnet.8
Die Bewegungen der Kamera reduzieren sich größtenteils auf minimale Schwenks, eher als
leichte Verwackelungen zu betrachten, welche in der Filmsprache als sogenanntes „Atmen“
bezeichnet werden. Dieser filmische Umgang ist eher im dokumentarischen Genre üblich, da
er „unsere Sehweise mit unserer wirklichen Situation ins Einvernehmen bringt“9. Somit folgt
Pölsler hier durchaus einer realistischen Tendenz. Gäbe es dieses „Atmen“ aus Zuschauersicht
1 Siehe Anhang.2 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:11:51–0:13:52.3 Ebd. TC 0:13:53–0:14:10.4 Ebd. TC 0:14:11–0:16:34.5 Ebd. TC 0:16:35–0:18:28.6 Ebd. TC 0:18:29–0:19:12.7 Ebd. TC 0:19:13–0:20:07.8 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964. S. 67.9 Ebd. S. 38.
5
nicht, so nähme sich der Zuschauer wie gewöhnlich beim Medium Film als getrennt davon
wahr. Der Zuschauer gerät hier jedoch beinahe in eine voyeuristische Position. Besonders
deutlich wird dies bei einer Großaufnahme der an der Wand klopfenden und rufenden Frau10:
Die Kamera positioniert sich als Zuschauer hierbei jenseits der Wand, auf der Seite des
eigentlich scheinbar erstarrten Lebens. Dennoch nimmt das Publikum nicht nur an ihren
starken Emotionen - Verzweiflung, Angst, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit - teil, sondern bleibt
durch eben dieses „Atmen“ lebendig und zugleich Hilfe verwehrend.
Holt der Zuschauer die Protagonistin mittels Kameraschwenk zu Beginn auf ihrem Weg
ins Dorf ab, so wird er schnell zu eben diesem überwiegend stillen Beobachter. Die Kamera
folgt ihr nicht per Kamerafahrt, sie ist stattdessen statisch positioniert und nähert sich dank
Montage von Einstellung zu Einstellung jeweils ein Stück mehr bzw. in deckungsgleichen
Einstellungen nähert sich die Protagonistin. Außerdem tritt diese mehrere Male aus dem Off
in das Bild hinein11. Statt ihr zu folgen, wartet der Betrachter somit schon auf sie. Er ist längst
anwesend, ebenso wie die Wand längst real ist.
Als Protagonistin nehmen wir die Frau überhaupt war, da die Kameraperspektive einzig
sie dem Zuschauer in Normalsicht präsentiert. Die Normalsicht wird zur bildlichen Ich-
Perspektive. Jede weitere Auf- und Untersicht, welche sie in Begegnung mit weiteren Figuren,
etwa dem Hund Luchs oder dem älteren Paar an der Keusche, einnimmt, ist die dieser
„handelnden“12 Frau. Die veränderten Perspektiven zeigen das Verhältnis, in welchem sie zu
diesen anderen Lebewesen steht. Darauf soll näher in Kapitel 4 „Die Gesellschaft“
eingegangen werden. Es sei jedoch schon an dieser Stelle betont, dass die dadurch
entstehende Identifikation mit nur einer einzigen Figur die natürlichste und realste überhaupt
ist.
Durch die langsame räumliche Annäherung an die Figur mittels Montage und Zoom wird
ein sensibler Umgang mit ihren Emotionen gewährleistet. Der Zuschauer bekommt die
Möglichkeit, sich mit der Figur “anzufreunden“, wird in die Rolle des Empathie-
Empfindenden versetzt und erlebt die Protagonistin so wie ihr Erlebnis ebenso real wie sich
selbst. 1960 schrieb Kracauer über derartige „Phänomene [wie das der Wand], die das
Bewußtsein überwältigen“, dass sie dem Medium Film gar bedingen:
Jedenfalls rufen sie Erregungszustände und Ängste hervor, die sachlich-abgelöste Beobachtung unendlich
erschweren. Kein Zeuge solcher Ereignisse und erst recht kein aktiv an ihnen Beteiligter wird deshalb
10 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:17:19–0:17:27; vgl. auch ebd. TC 0:16:55–0:17:00.11 Vgl. ebd. TC 0:11:51; TC 0:12:06; TC 0:12:23; TC 0:16:35.12 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 59.
6
zuverlässig über sie berichten können. Da aber diese Manifestationen roher – menschlicher oder
außermenschlicher – Natur in den Bereich physischer Wirklichkeit fallen, gehören sie umso mehr zu den
spezifisch filmischen Gegenständen. Nur die Kamera vermag sie unverzerrt darzustellen. 13
Pölsler arbeitet fortführend kontrastreich mit Nähe und Distanz; während sich die
Protagonistin im ersten Motiv, dem Weg ins Dorf, immer auf dem geraden Weg befindet und
dort nur deckungsgleich oder gleichlaufend von der Kamera erfasst wird, entfernt sich die
Kamera und mit ihr der Zuschauer im Motiv „Berghütte“ durch das Ein- und Austreten der
Figur im jeweils rechten Winkel. Sie zieht am Zuschauer sozusagen vorbei14. Im filmisch
erzeugten Raum tritt sie links ein und rechts wieder aus, was der westlichen Leserichtung
entspricht. Für das westlich geprägte Auge bewegt sie sich also vorwärts. Doch diesmal folgt
der Zuschauer ihr am Ende dieser zweiten Szene nicht und blickt ihr auch nicht hinterher, wie
er es noch am Ende der ersten Szene tat. Obwohl der Zuschauer in der ersten Szene, dem Weg
ins Dorf, perspektivisch aufgefordert wurde, das Erleben der Hauptfigur und ihres Weges
nachvollziehen zu können, muss er sich nach Begegnung mit der Wand eingestehen, niemals
von solch einer Erfahrung real „tangier[t]“15 gewesen zu sein, da es sich nach wie vor um eine
fiktive Geschichte handelt. Hickethier nennt dieses Vorgehen das Erzeugen einer
„filmische[n] Realität“, die „sich zum großen Teil aus diesem ständigen Wechsel von
Annäherung und Entfernung“ ergibt16. Und Pölsler steigert dies im weiteren Verlauf: mittels
Großaufnahmen in der nächsten Szene, dem Ferienhaus, darf der Zuschauer wieder an dem
psychischen Prozess und dem Gefühl der Verlorenheit der Frau teilhaben, bevor sie in der
letzten Szene, dem Weg ins Dorf, optisch wieder in die (noch weitere) Ferne rückt und nun in
der Tat bei Rückkehr an die Wand in der Landschaft verloren wirkt.17 Durch die stille Totale in
dieser letzten Einstellung wirkt die Szene tatsächlich wie ein Gemälde oder eine Fotografie.
Der Wand wird hier im Film eine reale Existenz zugesprochen, denn das stille „Bild steht
stellvertretend für etwas Anderes, das nicht anwesend ist, dessen Existenz aber durch das Bild
behauptet wird.“18
Auch auf der Ebene der Beleuchtung erlebt der Zuschauer innerhalb des gewählten
Filmausschnittes Kontraste. Pölsler arbeitet ausschließlich mit logischer Lichtführung (auch
13 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964. S. 91.14 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 62.15 Vgl. ebd.16 Vgl. ebd. S 58.17 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC: 0:18:29–0:20:07.18 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 38.
7
„naturalistisch“ genannt19) und dabei wiederum mit der natürlichsten aller Lichtquellen, der
Sonne, da es sich im Film schließlich größtenteils um Außenaufnahmen handelt. Auch
während der einzelnen Innenaufnahme der erzählenden Zeit im Ferienhaus weicht er nicht
davon ab, sondern benutzt die natürliche Lichtquelle einer Kerze.20 Das Ungewöhnliche, das
Schock-Erlebnis findet in Pölslers Film bei freundlichstem Sonnenschein statt; der zwei Jahre
spätere Alltag in Finsternis und Tristesse. Eine Widersprüchlichkeit, die nicht realistischer
sein könnte. Zwar durchlebt die Protagonistin bis dahin auch Momente der Erfüllung und
genießt zeitweise den Einklang mit der Natur, doch in dem Filmausschnitt, von dem hier die
Rede ist, muss der Regisseur mit dem größtmöglichen Kontrast arbeiten, um dem Zuschauer
zu Beginn des Filmes glaubhaft zu versichern, dass die Figur und ihr Leben eine Wandlung
vollziehen werden. Laut Hickethier sorgt dies für eine „erhöhte Glaubwürdigkeit“21. Schaut
der Zuschauer DIE WAND bis zu Ende, bis zu dieser erzählenden Zeit zwei Jahre später, so
wird er emotional an die Hauptfigur heranwachsen. Eben dies verspricht die einzelne
Nahaufnahme von der bei Kerzenschein Tagebuch schreibenden Frau der zweiten Szene. Der
Low-Key-Stil, das flackernde Licht der Kerze, steht hier für etwas Geheimnisvolles und für
psychische Anspannung22, während zu Beginn ihres Eingeschlossenseins ein heller Schein
vom Himmel auf sie fällt23. Dem erlöschenden Leben steht somit hier die „Erleuchtung“, (das
Gelb „der christlichen Erlösung“24) zu Beginn ihres Eingeschlossenseins als Neubeginn, als
Chance gegenüber. Über diesen High-Key-Stil schreibt Kandorfer: „Die ideale High-Key-
Beleuchtung rührt von einer transparenten, das Licht völlig diffus streuenden Kugel, die das
Objekt völlig umgibt.“25 In diesem Fall ist diese Kugel die Sonne selbst, deren Licht eine
Kuppel um die Protagonistin bilden und sie fortan völlig darunter einschließen soll.
2.2 Das Auditive
Zweifelsohne hebt sich Pölslers Film nicht nur visuell sondern auch auditiv von der großen
Masse26 ab: 2013 gewann DIE WAND den Deutschen Filmpreis für die beste Tongestaltung.27
Der Regisseur bedient sich hier Stilistik in ungewöhnlichen Dimensionen, indem, bedingt
19 Vgl. Katharina Theml: Licht, Farbe, Sound. Filme sehen lernen 2 (Beibuch). Leipzig 2011. S. 35.20 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:13:53-0:14:10.21 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 78.22 Vgl. ebd. S.76.23 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:19:13-0:20:07.24 Katharina Theml: Licht, Farbe, Sound. Filme sehen lernen 2 (Beibuch). Leipzig 2011. S. 27.25 Pierre Kandaorfer: Lehrbuch der Film-Gestaltung. Köln-Lövenich 1978. S.286.26 Vgl. Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964.. S. 149.27 Deutsche Filmakademie e.V. URL: http://www.deutsche-filmakademie.de/fpsuche.html.
8
durch die Einsamkeit der Frau, der innere Monolog als Off-Text gegenüber dem direkten
Dialog überwiegt. Ähnlich einem Hörbuch wird hier das Auditive in dem sonst Bild-lastigen
Medium Film ein Hauptbestandteil des Narrativen. Hinzu kommt außerdem die Untermalung
mit Musik und einmaligen synthetischen Geräuschen. Im Folgenden geschieht eine
Unterteilung in 2.2.1 „Sprache und Stimme“, da dieser auditive Aspekt in direktem Bezug zur
Figur steht, und 2.2.2 „Geräusche und Musik“, welche ihre Umwelt bilden.
2.2.1 Sprache und Stimme
Pölsler baut mittels dualer Narration ein komplexes Geflecht aus On-/Off-Text,
erzählender/erzählter Zeit sowie innerem Monolog/direkter Rede (aufgrund fehlender
sprachlicher Replik der Nebenfiguren möchte ich an dieser Stelle den literarischen Begriff der
direkten Rede anstelle des Dialogs benutzen).
Mit Hickethiers Worten ist die „Gegenwart der Wahrnehmung durch den Zuschauer [...]
auch Gegenwart der Figuren.“28 Psychologisierung des Zuschauers bzw. -hörers geschieht in
DIE WAND allerdings, indem die Protagonistin ihre Geschichte rückblickend erzählt. Rund
zwei Jahre nach der ersten Begegnung mit der Wand hält die Protagonistin ihre Erlebnisse
schriftlich fest. Diesen Zeitpunkt, die vermeintliche („fiktive“29) Gegenwart, nennen wir die
erzählende Zeit, ihre Erlebnisse in der Vergangenheit hingegen die erzählte Zeit. Der während
des Schreibprozesses vertonte innere Monolog der erzählenden Zeit liegt als Off-Text (also
non-diegetisch30) auch unter den quantitativ überwiegenden Bildern der erzählten Zeit.
Diesem Off-Text steht direkte Rede in der erzählten Zeit als On-Text gegenüber. Somit baut
das Publikum in diesem Fall gleichzeitig ein Verhältnis zur Protagonistin und zu ihrem Alter
Ego auf. Zwei Jahre Zeitgeschehen können dadurch problemlos in 103Minuten nach- bzw.
miterlebt werden.
Sorgt gewöhnlich „Synchronität von Bild und Ton [für die] Schaffung einer in sich
konsistenten und kohärenten audiovisuellen Welt, die der Wirklichkeit [...] entspricht“31,
gewinnen die Hauptfigur und auch ihre Isolation durch den (größtenteils non-diegetischen)
inneren Monolog erst an Glaubwürdigkeit, merkt der Zuschauer dadurch doch, dass wie bei
jeder realen Person die Gedanken und Erinnerungen auch in Ermangelung eines
Dialogpartners niemals still stehen bzw. oftmals gerade aufgrund dessen Reflexion einsetzt.
28 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 129.29 Vgl. ebd. S. 137.30 Vgl. Katharina Theml: Licht, Farbe, Sound. Filme sehen lernen 2 (Beibuch). Leipzig 2011. S. 19f.31 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 91.
9
Unterstützt wird der Eindruck eines echten Resümierens hierbei durch die sachlich-
berichtende Sprechweise.
Pölsler schafft wiederholt innerhalb einer visuellen Szene den Übergang vom Off-Text der
erzählenden hin zur direkten Rede der erzählten Zeit, schließlich zu Geräusch/Musik,
wodurch er den Zuschauer vom allein akustischen in das direkte Erleben hinein führt, denn
Bild- und Hörraum werden dabei gleichlaufend. Durch diese Synchronität entsteht schließlich
Raum für Empathie, die dank der anschließenden musikalischen Untermalung in einem
Gefühlsraum gipfelt.
Eine weitere Besonderheit im Bereich der Stimme bietet DIE WAND ausgerechnet in der
zeitweisen Abstinenz derer.32 Abgeschirmt durch die Wand wird das daran Klopfen und das
Rufen der Protagonistin unhörbar. Der Komponist, Regisseur und Autor Michel Chion spricht
hierbei von dem sogenannten „Screaming Point“ innerhalb eines Films:
I use the expression screaming point to emphasize that it's not so much the sound quality of the scream that's
important, but it's placement. And this place could be occupied by nothing, a blank, an absence. The
screaming point is a point of the unthinkable inside the thought, of the indeterminate inside the spoken, of
unrepresentability inside representation.33
Pölsler verdeutlicht durch die Abwesenheit der Stimme an dieser Stelle sowohl die Absurdität
der Situation als auch die Intensität des emotionalen Schockzustandes, in dem die Frau sich
befindet, denn „[i]m Dramatischen hallt das unausgesprochene Wort oft lauter als das
ausgesprochene.“34 Der Zuschauer kann vielleicht noch eine emotionale Verbindung zu der
Figur, nicht aber zu diesem konkreten Erlebnis aufbauen. Damit vermeidet der Regisseur es
auch, sich selbst anzumaßen, der Figur passende Worte in den Mund zu legen.
Stand das Geschlecht der Hauptfigur in DIE WAND aufgrund der gegebenen Buchvorlage
nie zur Debatte, gibt es dennoch laut Chion einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen
dem wortlosen Aufschrei einer Frau und dem eines Mannes im Medium Film35, der auch hier
Anwendung finden kann: Der „shout“ (maskulin) steht für das animalische Behaupten eines
Territoriums und für Kraft. Der „scream“ (feminin) hingegen wird gemeinhin als humaner
Schrei im Angesicht des Todes angesehen;
32 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:17:07-0:18:07.33 Michel Chion: The Voice in Cinema [La Voix au cinéma. 1982.]. New York 1999. S.77.34 Alan A. Armer: Lehrbuch der Film- und Fernsehregie [Directing Television and Film. USA 1986.]. Frankfurt
am Main 1997. S. 147.35 Vgl. Michel Chion: The Voice in Cinema [La Voix au cinéma. 1982.]. New York 1999. S. 78.
10
„[...] the woman's scream has to do with limitlessness. The scream gobbles up everything into itself – it is
centripetal and fascinating […]. The screaming point is where speech is suddenly extinct, a black hole,
the exit of being.“36
Pölslers Protagonistin verschlingt ihren Laut also scheinbar; ihr innerer hilfloser Schrei und
ihre schier endlose existentielle Angst, welche das Eingeschlossensein auslöst, sind zentraler
als ein dabei etwaig entstehendes Geräusch. Noch deutlicher wird dies tatsächlich in der
Traumsequenz37, welche erst im folgenden Filmverlauf stattfindet.
2.2.2 Geräusche und Musik
Das Geschehen des Filmausschnittes wird größtenteils von natürlichen atmosphärischen
Klängen aus der Natur begleitet und gewinnt dadurch an subtiler Lebendigkeit38, die den
unweigerlichen Gegenpart in der zeitweisen Lautlosigkeit findet.
Jedoch gibt es weitaus auffallendere akustische Besonderheiten innerhalb dieser wenigen
Film-Minuten. So hört das Publikum ebenfalls den vor Angst pulsierenden Herzschlag, das
„Pochen“ im Ohr der Protagonistin, und zwar noch ehe diese es verbal erklärt.39 Obgleich es
sich hierbei nicht um ein Geräusch der Umwelt, sondern um ein körpereigenes, äußerst
intimes (das jeder Zuschauer wieder zu erkennen im Stande ist und sich unweigerlich mit in
Wallung versetzt sieht) handelt, so nimmt die Protagonistin die „Furcht“ doch zuerst mit
Befremden und als von sich getrennt wahr. An dieser Stelle wird auditiv Spannung erzeugt.40
Doch nicht nur die Psyche bekommt eine reelle Daseinsberechtigung. Da die Wand nicht
visuell wahrnehmbar ist, tritt hier der symbolische Charakter des Auditiven in den
Vordergrund: Auch der Wand selbst wird eine Existenz, eine Materie zugesprochen, indem
Pölsler ihr einen eigenen Klang synthetisch erzeugen lässt. „Geräusche [...] gehören der
materiellen Realität an“41, so Kracauer. Das anfänglich anonyme Geräusch, welches von der
Wand selbst auszugehen scheint, beschreibt Pölsler als dem der Erdrotation oder eines
magnetischen Feldes ähnlich, als metaphysisch also.42 Da es sich hierbei nicht um ein
Geräuschstereotyp handelt, unterliegt der Zuschauer der Illusion einer supranaturalen Macht,
welche die Wand über die Menschheit erhebt.
36 Ebd. S. 79.37 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:20:41-0:21:39.38 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S.91.39 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:13:53-0:14:09.40 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S.91f.41 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964. S. 178.42 Vgl. Julian Roman Pölsler. In: Regiekommentar. DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. DVD
(STUDIOCANAL GmbH 2013). TC 0:08:50.
11
Die Partiten Johann Sebastian Bachs, die Pölsler bei letztmaliger, absichtlicher Rückkehr
der Protagonistin an die Wand43 und im weiteren Filmverlauf wiederholt asynchron einsetzt,
bezeichnet er selbst (anders als Kracauer, der Sprache und Geräusche als eines beschreibt und
Musik davongetrennt sieht.44 Hickethier wiederum trennt alle drei voneinander.45) als
„Überhöhung“ des Off-Textes, als eine andere Form von Sprache.46 Tatsächlich ist es
inkorrekt, die Musik rein als Teil der Umwelt der Protagonistin zu bezeichnen (s.o.). Auch
spiegeln Bachs Partiten nicht nur das Innerste der Frau. Vielmehr beschreiben sie den Moment
in Gänze, wie es nicht einmal die Stimme aus dem Off kann. Zu diesen Partiten finden sich
Bezeichnungen als „magisch“47, „sakral“48 und „Nimbus“49;
Tatsächlich befragt Bach in ihnen darüber hinaus das fast 200 Jahre alte Suitenmodell insgesamt, um es
aufzubrechen, mit eigenen Lösungen zu konfrontieren und mit neuem Geist zu defi nieren [sic!]. […] Und
selbst dort, wo Bach die ursprüngliche Bezeichnung eines Tanzsatzes beibehält, erfährt dieser zusehends
eine Veränderung in Form und Gehalt. […] – ein Ort der Reflexion, Sammlung und Kontemplation. Die
Sarabande wird zusehends auch zum spirituell-geistigen Herzstück, in dem sich vielfach der Schlüssel zum
inneren Verständnis der Werke findet. […] zumindest wird mit ihr der Prozess, vom Alten zu etwas Neuem
zu gelangen, erkannt und gewissermaßen benannt.50
Auch die Hauptfigur aus DIE WAND scheint zu diesem musikalischen Tableau zu tanzen,
sehen wir als Zuschauer sie doch nur mit erhobenen Armen sich an einer unsichtbaren
Scheibe entlang bewegen und tasten. Gleichzeitig wirkt sie hochkonzentriert, denn sie
befindet sich auch im geistigen Zustand des Be-Greifens. Das Bild eines religiösen
Zeremoniells entsteht vor allem auch in Zusammenspiel mit der besonderen
Sonnenlichteinstrahlung. In diesem Schlüsselmoment vollzieht ihr Leben die entscheidende
Wandlung und wird zum Fest. Die Zäsur, dass es auf der „Heldenreise [...] kein Zurück mehr
gibt“51, erfolgt hier also auf einer weiteren, nämlich musikalischen Ebene. Den Einsatz dieses
spezifischen Werks J. S. Bachs beschreibt die Zeitschrift Der Spiegel gar als Pölslers größten
43 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:19:23-0:20:07.44 Vgl. Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964. S. 147-213.45 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 91.46 Vgl. Julian Roman Pölsler. In: Regiekommentar. DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. DVD
(STUDIOCANAL GmbH 2013). TC 0:02:12.47 Sal Pichireddu: Filmmusik von „Die Wand“ von Julia Fischer. In: codaex, 18.10.2012.
http://blog.codaex.de/2012/10/filmmusik-von-die-wand-von-julia-fischer/.48 Carola: J.S.Bach – Sonaten und Partiten für Violine Solo, BWV 1001-1006. In: Capriccio Kulturforum,
30.05.2012. URL: http://www.capriccio-kulturforum.de/ensemble-und-kammermusik/4051-j-s-bach-sonaten-
und-partiten-fuer-violine-solo-bwv-1001-1006/.49 Ebd.50 Florian Olters: Johann Sebastian Bach. Sechs Partiten für Klavier BWV 825-830 (Clavierübung Teil 1). Irma
Issakadze, Klavier. In: Oehms Classics. URL: http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=478.51 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 121.
12
eigenen „Input“52, da er weder romangetreu erfolgt noch sich auf ein realistisches Geschehen
gründet, sondern rein künstlerische Interpretation darstellt. Hickethier würde die Wahl der
Violinmusik außerdem als Beleg für die eigentlich glückliche Erfülltheit53 der Protagonistin
behaupten, was wiederum nicht unrealistisch ist, zeigt sie sich doch von Filmbeginn an als
ruhige Einzelgängerin, also als jemand, der freiwillig den Weg der Isolation wählt.
2.3 Das Schauspiel
Schauspieler gelten gemeinhin als austauschbar (besonders die filmische Parzellierung
begünstigt dies). Hier soll jedoch nicht die Besetzungsfrage neu aufgenommen werden,
sondern lediglich eine Auseinandersetzung mit der Darstellung der Figur durch Martina
Gedecks Spiel und ihrer einzigartigen Aura54 stattfinden.
Gedecks Darstellung gründet auf dem Prinzip der 'Lebensechtheit'55, in dem sich die
Schauspielerin möglichst stark mit Figur und Situation identifiziert. Dazu gehört auch die
Eigenschaft des wahrhaftigen Zuhörens. Mit allen Sinnen scheint Gedeck in der Rolle ihre
Innen- wie auch Umwelt wahrzunehmen. Dabei gilt, dass „das Einfache, das Schlichte, die
Untertreibung in diesem Medium das Stärkste“56 ist, sodass ihr Spiel zugunsten der
Glaubwürdigkeit ein minimalistisches bleibt. Die emotional größten Momente lassen sich bei
Gedeck in Großaufnahmen einfangen, da sie fokussiert allein durch ihre Augen spielt.
Bei der Hauptfigur dieses Films handelt es sich nicht um ein gesellschaftliches Idol57,
vielmehr um eine gewöhnliche Frau mittleren Alters, deren Herkunft zweitrangig ist. Zwar
erzählt auch ihre eloquent gewählte Sprache einen vorhandenen Bildungsgrad. Doch erst
Gedecks Habitus in der Rolle, nämlich „das hintergründig im körperlichen Verhalten
Artikulierte“58 bringt dem Zuschauer etwas über Werte und Moral der Figur nahe. So zeigt das
feinfühlige Spiel ihrer (gepflegten) Hände mit Requisiten in der erzählten Zeit vornehme
Korrektheit. Die Protagonistin achtet auf „Form“. Hingegen sich die Handhabung von
(Schreib-) Werkzeugen in der erzählenden Zeit kraftvoller gestaltet. Der äußere Umgang
spiegelt den natürlichen inneren Wandel hin zum Pragmatismus.
52 Vgl. Jenni Zylka: Kinodrama „Die Wand“: Halb lebt sie im Paradies, halb in der Hölle. In: Spiegel Online,
14.10.2012. URL: http://www.spiegel.de/kultur/kino/die-wand-romanverfilmung-mit-martina-gedeck-nach-
marlen-haushofer-a-860463.html.53 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 96.54 Vgl. ebd. S. 161.55 Ebd. S. 169.56 Alan A. Armer: Lehrbuch der Film- und Fernsehregie [Directing Television and Film. USA 1986.]. Frankfurt
am Main 1997. S.154.57 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S.173.58 Ebd. S. 172.
13
3. Die Szenerie
Als Schauplatz für DIE WAND wählt Pölsler nicht den Originalschauplatz des Romans, das
Effertsbachtal, sondern das Dachsteinmassiv in den österreichischen Alpen.59 Die
Abwandlung ist für den Zuschauer wenig bis gar nicht von Bedeutung. Einzig die unberührte
Natur steht im Vordergrund und dass es sich zu keinem Zeitpunkt um Studioaufnahmen
handelt, denn „die echte Aufnahme [besitzt] eine Eigenschaft [...], die der Imitation fehlt.“60
4. Die Gesellschaft
Die einzelne Begegnung mit einem Paar in der dritten Szene des beschriebenen
Filmausschnittes61 kann nur als Synekdoche62 für eine Interpretation über die Gesellschaft im
Ganzen dienen. Die Protagonistin versucht, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Letztere
wird jedoch erstarrt, leb- und teilnahmslos, als nicht zugänglich dargestellt. Somit ist die
Protagonistin mit ihren Problemen ganz auf sich gestellt. Sie kann keine Hilfe erwarten. Hier
ließe sich eine Gesellschaftskritik in Bezug zu Ignoranz und zur tendenziell zunehmenden
Selbstverantwortung des Einzelnen vermuten. Auch, dass psychische Anomalien wie
Sozialphobie in unserer westlichen Gesellschaft keine Aufmerksamkeit fänden, gar mit
Verachtung gestraft würden, könnte Pölslers Film inhaltlich angelastet werden. Woran krankt
unsere Gesellschaft? Ist ein wahrhaftiges Leben nicht in der großen Gesellschaft möglich?
Spielen andere Menschen in Wahrheit viel weniger eine Rolle im Leben eines jeden Einzelnen
als wir denken? Oder im Gegenteil – nimmt sich der Mensch ganz egozentrisch als zu
getrennt von der seiner Umwelt wahr?
Vielmehr scheint Pölsler jedoch die Fiktion der tatsächlichen Wand an dieser Stelle
aufrecht zu erhalten und zu verdeutlichen, dass die scheinbar abwesende Gesellschaft schlicht
nicht so sehr von Bedeutung ist, sondern einzig die einsame, hinter der Wand eingeschlossene
Frau, ihr Schicksal und ihre Realität im Fokus stehen. Die anteilige Präsenz anderer Figuren
im Verhältnis zu der der Frau unterstützt die Aussage, dass es sich in diesem Film thematisch
viel mehr um „die Reise zu sich selbst“63 dreht. Aufgrund dessen erübrigt sich eine
ausführliche Analyse dahingehend, ob die (kameraperspektivische) Aufsicht auf den Hund
59 Andreas Lesti: Wanderung zur „Wand“: Haushofer Hütte. In: Spiegel Online, 21.10.2012. URL:
http://www.spiegel.de/reise/europa/die-wand-spurensuche-in-marlen-haushofers-heimat-in-oesterreich-a-
861596.html.60 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964. S. 63.61 DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. TC 0:16:35-0:18:45.62 Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 103.63 Vgl. Julian Roman Pölsler. In: Regiekommentar. DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. DVD
(STUDIOCANAL GmbH 2013). TC 0:12:50.
14
einen Tiefstatus des Tieres sowie die Untersicht zu anderen Menschen einen Hochstatus der
übrigen Gesellschaft zu bedeuten haben, auch wenn Letzteres durchaus auch ein physisches
Gefühl der Beklommenheit auszulösen im Stande ist.64
5. Die realistische Darstellung von Surrealismus im Medium Film
Abschließend lässt sich über Julian Roman Pölslers DIE WAND zusammenfassen, dass in
diesem Film dem Erzeugen eines Realitätseffekts genügend Folge geleistet wird, sodass der
Zuschauer die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit (suspension of disbelief65) als ein
Leichtes zulassen kann. Der Regisseur bedient sich bewährter Methoden und Stile des
Filmemachens und scheut sich nicht intimste Momente nah darzustellen. In einer
tiefergehenden Analyse sollte unbedingt auch dem Aspekt verschiedener Tempi und des
Rhythmus' Rechnung getragen werden.
Zu Genüge deutlich wird jedoch hier bereits, dass die Potenzierung66 der diversen real
anmutenden Aussageebenen eine glaubhafte Welt konstruiert: „Die Synthese von Bild, Wort,
Geräusch und Musik dient der Steigerung des Realitätseindrucks.“67 Der Verzicht jeglicher
computergenerierter visueller Effekte in der Darstellung der Wand wirkt dabei maßgeblich
unterstützend. Nicht zuletzt Gedecks schauspielerische Leistung ermöglicht es dem Publikum,
dem Phänomen nach gebotener anfänglicher Skepsis schließlich Glauben zu schenken. Ob es
sich nun um den übertragenden Sinn hinter der Wand, nämlich die psychische Isolation, oder
buchstäblich um eine physische Wand, und eine so oder so hervorgerufene Wandlung geht,
darf offen bleiben und liegt im Auge des Betrachters. Für diese Frau ist die Erscheinung der
Wand real. Dank äußerst natürlicher Darstellung von Natur und äußerer Realität selbst gelingt
es dem Regisseur dieses Werks, die surrealistische Begebenheit auch einem breiten Publikum
vorstellbar zu machen. Julian Roman Pölsler erweitert somit den Begriff des Realen, indem er
jegliche Imagination allein aufgrund ihrer Existenz darin einschließt. Eben hierin liegt die
Kraft des Mediums – in dem Spiel der Fantasie.
64 Vgl. Jost Meyer: Nonverbale Kommunikation. Der Status. In: Leadion, 2005. URL:
http://www.leadion.de/artikel.php?artikel=0273.65 Vgl. Wavelength Media. Suspension of Disbelief. In: MediaCollege.com. URL:
http://www.mediacollege.com/glossary/s/suspension-of-disbelief.html.66 Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007. S. 102.67 Ebd. S. 101.
15
6. Quellenangaben
verwendete Quellen
• Armer, Alan A.: Lehrbuch der Film- und Fernsehregie [Directing Television and Film. USA 1986.].
Frankfurt am Main 1997.
• Carola: J.S.Bach – Sonaten und Partiten für Violine Solo, BWV 1001-1006. In: Capriccio Kulturforum,
30.05.2012. URL: http://www.capriccio-kulturforum.de/ensemble-und-kammermusik/4051-j-s-bach-
sonaten-und-partiten-fuer-violine-solo-bwv-1001-1006/ (23.09.2013).
• Chion, Michel: The Voice in Cinema [La Voix au cinéma. 1982.]. New York 1999.
• Deutsche Filmakademie e.V. URL: http://www.deutsche-filmakademie.de/fpsuche.html (23.09.2013).
• DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler.
• Hickethier, Knut: Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Stuttgart 2007.
• Korte, Helmut: Einführung in die Systematische Filmanalyse. 4. Aufl. Berlin 2010.
• Kracauer, Siegfried: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit [Theory of Film. The
Redemption of Physical Reality. New York 1960.]. Frankfurt am Main 1964.
• Lesti, Andreas: Wanderung zur „Wand“: Haushofer Hütte. In: Spiegel Online, 21.10.2012. URL:
http://www.spiegel.de/reise/europa/die-wand-spurensuche-in-marlen-haushofers-heimat-in-oesterreich-
a-861596.html (23.09.2013).
• Meyer, Jost: Nonverbale Kommunikation. Der Status. In: Leadion, 2005. URL:
http://www.leadion.de/artikel.php?artikel=0273. (23.09.2013)
• Olters, Florian: Johann Sebastian Bach. Sechs Partiten für Klavier BWV 825-830 (Clavierübung Teil 1).
Irma Issakadze, Klavier. In: Oehms Classics. URL: http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=478
(23.09.2013).
• Pichireddu, Sal: Filmmusik von „Die Wand“ von Julia Fischer. In: codaex, 18.10.2012. URL:
http://blog.codaex.de/2012/10/filmmusik-von-die-wand-von-julia-fischer/ (23.09.2013).
• Pölsler, Julian Roman. In: Regiekommentar. DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler. DVD
(STUDIOCANAL GmbH 2013).
• Theml, Katharina: Licht, Farbe, Sound. Filme sehen lernen 2 (Beibuch). Leipzig 2011.
• Wavelength Media. Suspension of Disbelief. In: MediaCollege.com. URL:
http://www.mediacollege.com/ glossary/s/suspension-of-disbelief.html (23.09.2013).
• Zylka, Jenni: Kinodrama „Die Wand“: Halb lebt sie im Paradies, halb in der Hölle. In: Spiegel Online,
14.10.2012. URL: http://www.spiegel.de/kultur/kino/die-wand-romanverfilmung-mit-martina-gedeck-
nach-marlen-haushofer-a-860463.html (23.09.2013).
weiterführende Informationen
• Atalante: Die Wand – Innere Emigration oder radikale Selbstbestimmung. Mit Daniela Strigl auf den
Spuren Marlen Haushofers(1920-1970). In: Atalantes Historien, Literatur Geschichte, 20.11.2012. URL:
http://atalantes.de/2012/11/die-wand-innere-emigration-oder-radikale-selbstbestimmung/ (23.09.2013).
• Bach, Lida: DIE WAND – INTERVIEWS MIT JULIAN PÖLSLER UND MARTINA GEDECK. In:
Negativ, 1.10.2012. URL: http://www.negativ-film.de/2012/10/die-wand-interviews-mit-julian-polsler-
und-martina-gedeck (23.09.2013).
• v. Billerbeck, Liane: Gefangen hinter de unsichtbaren Mauer. Regisseur Julian Roman Pölsler über
seinen neuen Film. In: dradio.de, 07.10.2012. URL: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/
kinoundfilm/1885087/ (23.09.2013).
• Bohren, Andreas: Hommage an Marlen Haushofer. URL: http://www.marlenhaushofer.ch/index.php
(23.09.2013).
• CGthorski: Julia Fischer – Bach, Chaconne, BWV 1004 (1/2). In: Youtube, 24.03.2009. URL:
http://www.youtube.com/watch?v=l9x0dE5Rda4 (23.09.2013).
• Kilb, Andreas: Video-Filmkritik: „Die Wand“. Das Ende der Welt ist der Anfang des Waldes. In:
FAZ.NET, Feuilleton 10.10.2012. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-
16
filmkritiken/die-wand-filmkritik-das-ende-der-welt-ist-der-anfang-des-waldes-11919566.html
(23.09.2013).
• Puschmann, Dr. med. Helmut/ Puschmann-Reuter, Dr. med. Gertraud: Marlen Haushofer: Die Wand. In:
Puschmann. URL: http://www.dr-puschmann.de/de/literatur/literatur/marlen_haushofer_die_wand/
txt00258.html (23.09.2013).
• Schiefer, Karin: Julian R. Pölsler: Die Wand – Interview. In: Austrian Film Comission, November 2011.
URL: http://www.afc.at/jart/prj3/afc/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=11642721805
06& tid=1322552864876&artikel _
id=1322552864766 (23.09.2013).
• Schwickert, Martin: Film „Die Wand“. Gefangen in sich selbst. In: Zeit Online, 11.10.2012. URL:
http://www.zeit.de/kultur/film/2012-10/film-die-wand (23.09.2013).
• Strigl, Daniela: „Die Wand“ (1963) – Marlen Haushofers Apokalypse der Wirtschaftswunderwelt. In:
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 22.07.2004. URL: http://www.inst.at/
trans/15Nr/05_16/strigl15.htm (23.09.2013).
• thiagoblanco: J. S. Bach – Partita No. 2 in D minor for solo violin, BWV 1004 (Live). In: Youtube,
12.02.2012. URL: http://www.youtube.com/watch?v=wW5wuNlTZuo (23.09.2013).
• unbekannter Autor: „Wenn Stille Raum bekommt“. Die Schauspielerin Martina Gedeck und der
Regisseur Julian Roman Pölsler über ihren Film „Die Wand“. In: dradio.de, 13.02.2012. URL:
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1676667/ (23.09.2013).
• Wolff, Rochus/u.a.: „Vom Wald und von der Natur gezwungen“ - Julian Pölsler im Interview zu „Die
Wand“. In: kino-zeit.de, 11.10.2012. URL: http://www.kino-zeit.de/news/vom-wald-und-von-der-natur-
gezwungen-julian-polsler-im-interview-zu-die-wand (23.09.2013).
DIE WAND, A/D 2012, R: Julian Roman Pölsler.
Makroanalyse
TC 00:11:51–00:20:07
Timecode Motiv Einstellung Handlungs-/Blickachse Perspektive Kamera-Bewegung Kommentar
0:11:51 Weg ins
Dorf
Totale
Two-Shot
Deckungsgleichheit: Protagonistin läuft
frontal auf die Kamera zu.
Normalsicht Schwenk
0:12:04 Weg ins
Dorf
Halbtotale
Two-Shot
Gleichlaufend: Over-Shoulder;
Protagonistin setzt Gang von der Kamera
entfernend fort; Hund läuft voraus.
Aufsicht >
Normalsicht
Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:12:12 Weg ins
Dorf
Amerikanisc
h
Single-Shot
“Schuss-
Gegenschuss”
Deckungsgleichheit: Protagonistin kommt
der Kamera noch näher als zuvor.
Leichte Untersicht
bergab
Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:12:15 Weg ins
Dorf
Halbnah
Single-Shot
Gleichlaufend; Hund läuft in die Biegung
des Waldweges, aus dem Bild
verschwindend.
Normalsicht Minimaler Schwenk?
Still?
0:12:17 Weg ins
Dorf
Nah > Gross
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin nähert
sich, stoppt bei Vernehmen eines Lautes
vom Hund.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:12:22 Weg ins
Dorf
Totale >
Halbnah
Single >
Two-Shot
Deckungsgleichheit: Protagonistin kommt
über die Biegung des Weges ins Bild zum
Hund.
Leichte Untersicht Schwenk
0:12:47 Weg ins Totale Gleichlaufend: subjektive Blickrichtung Normalsicht > Still
Timecode Motiv Einstellung Handlungs-/Blickachse Perspektive Kamera-Bewegung Kommentar
Dorf der Protagonistin den weiteren Weg
hinunter.
Leichte Untersicht
0:12:50 Weg ins
Dorf
Halbnah
Two-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin
kümmert sich um den Hund; tritt dann an
der Kamera vorbei aus dem Bild heraus.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:12:59 Weg ins
Dorf
Amerikanisc
h
Single-Shot
“Schuss-
Gegenschuss”
Gleichlaufend: Protagonistin setzt Gang
den Weg hinab von der Kamera entfernend
fort.
Untersicht Still
0:13:01 Weg ins
Dorf
Halbnah
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Hund bleibt stehen
und beobachtet das Weitergehen der
Protagonistin.
Normalsicht Still
0:13:03 Weg ins
Dorf
Halbtotale
Single-Shot
Gleichlaufend; Protagonistin wendet sich
vom Hund ab, geht weiter des Weges,
dreht sich dabei zwei Mal um.
Normalsicht Still
0:13:08 Weg ins
Dorf
Halbtotale >
Halbnah
Two-Shot >
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin
kollidiert (zum ersten Mal) mit der Wand.
Normalsicht Still Kamera steht
“jenseits der Wand”.
0:13:38 Weg ins
Dorf
Totale
Single-Shot
Gleichlaufend; Protagonistin steht mit
beiden Händen berührend vor der Wand.
Normalsicht Still
0:13:53 Ferienhaus Ganz Groß >
Groß
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Hand und Gesicht
der Protagonistin während sie Tagebuch
über das Geschehene führt.
Normalsicht Schwenk
0:14:11 Weg ins Halbnah > Deckungsgleichheit; Protagonistin steht Normalsicht Still
Timecode Motiv Einstellung Handlungs-/Blickachse Perspektive Kamera-Bewegung Kommentar
Dorf Totale
Single-Shot
mit beiden Händen berührend vor der
Wand; setzt sich schließlich an den
Wegesrand.
0:14:54 Weg ins
Dorf
Halbnah Gleichlaufend; Blickrichtung vom zuvor
gegangenen Weg auf die Wand.
Normalsicht Still
0:14:58 Weg ins
Dorf
Nah
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin sitzt,
denkt nach.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:15:10 Weg ins
Dorf
Halbnah Gleichlaufend; Blickrichtung vom zuvor
gegangenen Weg auf die Wand.
Normalsicht Still
0:15:15 Weg ins
Dorf
Totale >
Halbnah >
Totale
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin sitzt am
Wegesrand; läuft zur Wand, läuft
schließlich den Weg zurück zum Haus.
Normalsicht Still
0:16:35 Keusche Halbtotale >
Nah/Groß
Two-Shot >
Single-Shot >
Three-Shot
“Schuss-
Gegenschuss”
Schräger Winkel > rechter Winkel >
Gleichlaufend; Hund und Protagonistin
gehen den Weg hinauf auf eine Hütte zu.
Normalsicht 180°-Schwenk “Abholen” mit der
Kamera.
0:16:55 Keusche Nah
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin stößt
erneut an die Wand.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
Kamera steht zwar
“jenseits der Wand”,
aber fokussiert
Emotionalität.
Schwenk =
inkonsequent?
Timecode Motiv Einstellung Handlungs-/Blickachse Perspektive Kamera-Bewegung Kommentar
Geheimnisvoll.
Bewegung mit ihrer
Emotionalität
begründet.
0:17:01 Keusche Totale
Two-Shot
Gleichlaufend; Blick auf das von der
Protagonistin adressierte Paar am Haus.
Normalsicht Still Untermauert die
Leblosigkeit
dahinter.
0:17:06 Keusche Nah
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin stößt
erneut an die Wand.
Kamera steht “jenseits der Wand”.
Normalsicht Still
0:17:11 Keusche Totale
Three-Shot
Gleichlaufend; Protagonistin versucht sich
dem Paar bemerkbar zu machen durch
Klopfen an der Wand.
Normalsicht Still
0:17:19 Keusche Groß
Single-Shot
“Schuss-
Gegenschuss”
Deckungsgleichheit; Gesicht und Hand
der rufenden und klopfenden
Protagonistin.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
Voyeuristisch.
0:17:28 Keusche Amerikanisc
h
Single-Shot
Gleichlaufend; adressierter Mann steht
starr am Brunnen.
Leichte Untersicht Still
0:17:34 Keusche Amerikanisc
h
Single-Shot
Gleichlaufend; adressierte Frau sitzt starr
auf der Veranda.
Leichte Untersicht Still
0:17:39 Keusche Groß
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin
beobachtet das Paar.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
Timecode Motiv Einstellung Handlungs-/Blickachse Perspektive Kamera-Bewegung Kommentar
0:17:48 Keusche Halbtotale
Two-Shot
Gleichlaufend; Paar verharrt weiter in
Starre.
Leichte Untersicht Still
0:17:53 Keusche Gross > Nah
Single-Shot
Deckungsgleichheit; Protagonistin entfernt
sich rückwärts laufend.
Normalsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:18:04 Keusche Totale
Three-Shot
Gleichlaufend > rechter Winkel;
Protaginistin nimmt weiter Abstand von
Haus und Paar; mit dem Hund läuft sie
rechts parallel zur Kamera aus dem Bild.
Normalsicht Still Sie verstummt
innerlich, resigniert.
0:18:29 Ferienhaus Gross > Nah
Single-Shot >
Two-Shot >
Single-Shot
Schräger Winkel; Protagonistin (erst in
Reflexion des Fensters) und Hund sitzen
auf der eigenen Veranda.
Normalsicht >
Aufsicht
Schwenk
0:18:46 Ferienhaus Halbtotale;
Two-Shot
Rechter Winkel; Protagonistin und Hund
sitzen auf der eigenen Veranda
Leichte Untersicht Still
0:18:58 Ferienhaus Gross;
Single-Shot
Schräger Winkel; Protagonistin raucht und
denkt nach, tritt schließlich rechts aus dem
Bild.
Aufsicht Minimaler Schwenk
“Atmen”
0:19:13 –
0:20:07
Weg ins
Dorf
Totale;
Single-Shot
Schräger Winkel; Protaginistin kehrt von
links ins Bild zur Wand zurück, tritt
ebenfalls links wieder aus dem Bild
heraus.
Normalsicht Still