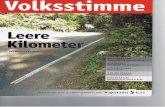Die Darstellung der Trauer König Etzels. Geschlecht und Emotion in der mittelhochdeutschen...
-
Upload
uni-bayreuth -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Darstellung der Trauer König Etzels. Geschlecht und Emotion in der mittelhochdeutschen...
Nadine Hufnagel
Die Darstellung der Trauer König Etzels. Geschlecht und Emotion in der mittelhochdeutschen Nibelungenklage Das Nibelungenlied gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Texten des deut-schen Mittelalters.1 Die Geschichten um Gunther und Brünhild, Kriemhild und Siegfried sowie dessen Ermordung durch Hagen, die Erzählung vom kostbaren Nibelungenschatz und von der Rache Kriemhilds, die zum Untergang der Nibe-lungen am Hof des heidnischen Königs Etzel führt, werden heute auf sehr ver-schiedene Art und Weise rezipiert.2 Weit weniger bekannt ist die Nibelungen-klage3, die in beinah allen Nibelungenlied-Handschriften zusammen mit diesem überliefert ist.4 In dieser Nibelungenklage wird die Handlung am Ende des Epos
1 Dementsprechend umfangreich ist auch die Forschungsliteratur zum Nibelungenlied.
Zur Einführung bieten sich beispielsweise Otfrid Ehrismann: Nibelungenlied. Epoche – Werk – Wirkung, München ²2002 oder Jan-Dirk Müller: Das Nibelungenlied, Berlin ³2009 an. Als richtungsweisend für die Nibelungenlied-Interpretation erachte ich Jan-Dirk Müller: Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes, Tübingen 1998.
2 Vgl. z.�B. das Themenheft Nibelungen-Rezeption. Mitteilungen des Deutschen Germa-nistenverbandes 55 (2008) H. 4, hg. von Ina Karg.
3 Die Textzitate sind folgender Ausgabe entnommen: Die ‚Nibelungenklage‘. Synopti-sche Ausgabe aller vier Fassungen, hg. von Joachim Bumke, Berlin, New York 1999. Die Untersuchung basiert auf der *B-Fassung des Textes (im Folgenden zitiert mit „NK“). Die Übersetzungen stammen von mir.
4 Die Überlieferungslage legt nahe, dass die Nibelungenklage im Mittelalter zur Wahr-nehmung und Perspektivierung des Nibelungenstoffes in irgendeiner Form immer da-zugehörte. Die Forschung hat dazu unterschiedliche Thesen entwickelt: Jan-Dirk Mül-ler beispielsweise spricht von einer „Korrektur des Epengeschehens“ (Müller: Nibe-lungenlied [Anm. 1], S. 169) und davon, dass die Klage das Geschehen des Nibelun-genlieds in vertraute Zusammenhänge einordne (vgl. ebd., S. 171); als Korrektur „an bestimmten Einzelheiten des Nibelungenliedes“ begreift Christoph Fasbender die Kla-ge in seiner Einleitung zu Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der For-schung, hg. von Christoph Fasbender, Darmstadt 2005, hier: S. 11. Dietz-Rüdiger Mo-ser und Marianne Sammer sprechen sogar davon, dass durch die getrennte Ausgabe der beiden Texte Nibelungenlied und Klage in heutiger Zeit historische Befunde ver-schleiert würden, da aufgrund der Überlieferungssituation von einer konzeptionellen Einheit der Texte auszugehen sei (vgl. Dietz-Rüdiger Moser und Marianne Sammer: Vorwort, in: Nibelungenlied und Klage. Ursprung – Funktion – Bedeutung. Symposi-
58 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
aufgegriffen, – zum Teil in den Einzelheiten und in der Schwerpunktsetzung von diesem abweichend – wiedererzählt, gedeutet, kommentiert und fortgesetzt.5 Die Schlacht am Hof des Hunnenkönigs Etzel, in deren Rahmen nicht nur die Nibe-lungen, sondern auch zahllose andere Helden und Krieger untergehen, wird von Figuren und Erzählinstanz betrauert und mehr oder weniger bewältigt. Zunächst werden klage und jâmer auf dem ‚Schlachtfeld‘ in den Blick genommen und die Trauer um die Toten sowie deren Bestattung ausführlich erzählt. Später wird geschildert, wie sich die Nachricht vom Nibelungenuntergang ausbreitet und schließlich durch Boten Etzels auch in die Heimat der gefallenen Helden sowie zu Bischof Pilgrim nach Passau getragen wird. Dort löst die Botschaft ebenfalls große Trauer und Leid aus. Schließlich zeigt die Erzählung jedoch auch, dass man sich durch gegenseitige Hilfe sowie den Entwurf christlich-religiöser Erklä-rungen für die Katastrophe tröstet und beginnt, die Verhältnisse neu zu ordnen.6 So wird beispielsweise der junge Sohn Gunthers und der verwitweten Brünhild in Worms zum neuen König der Burgunden gekrönt. Am Ende kehrt der Fokus
um Kloster Andechs 1995 mit Nachträgen bis 1998, hg. von Dietz-Rüdiger Moser und Marianne Sammer, München 1998, S. 5-7, hier: S. 6).
5 Die Forschung zur Nibelungenklage beschäftigt sich vornehmlich mit Fragen ihres künstlerischen Werts, der Entstehung und Datierung, dem Verhältnis zum Nibelungen-lied und seinen verschiedenen Fassungen, der Stellung des Textes im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie dessen Gattungszugehörigkeit (vgl. Elisa-beth Lienert: Die Nibelungenklage. Mittelhochdeutscher Text nach der Ausgabe von Karl Bartsch. Einführung, neuhochdeutsche Übersetzung und Kommentar von Elisa-beth Lienert, Paderborn, München, Wien u.�a. 2000, hier: S. 9). Forschungsüberblicke finden sich bei Monika Deck: Die Nibelungenklage in der Forschung. Bericht und Kri-tik, Frankfurt a. M., Berlin, Bern u.�a. 1996 und Joachim Bumke: Die vier Fassungen der ‚Nibelungenklage‘. Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte und Textkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert, Berlin, New York 1996. Erwähnenswert unter den jüngeren Arbeiten ist die 2008 erschienene Dissertation Cordula Kropiks, die der Erzählkonzeption in heldenepischen Texten auf den Grund geht (Cordula Kropik: Re-flexionen des Geschichtlichen. Zur literarischen Konstituierung mittelhochdeutscher Heldenepik, Heidelberg 2008).
6 Die aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich ausfallenden Deutungsangebote der Klage sind es, welche die Forschung an diesem, im Vergleich zum Nibelungenlied handlungsarmen Text besonders interessieren. Vgl. neben den bereits genannten Titeln beispielsweise auch Nikolaus Henkel: ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘. Überlegungen zum Nibelungenverständnis um 1200, in: Mittelalterliche Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster. Ergebnisse der Berliner Tagung, 9.-11. Oktober 1997, hg. von Nigel Palmer und Hans-Jochen Schiewer, Tübingen 1999, S. 73-98; Claudia Brinker-von der Heyde: Hagen – valant oder trost der Nibelungen? Zur Uner-träglichkeit ambivalenter Gewalt im ‚Nibelungenlied‘ und ihrer Bewältigung in der ‚Klage‘, in: Der Mord und die Klage. Das Nibelungenlied und die Kulturen der Ge-walt, hg. von Gerold Bönnen und Volker Gallé, Worms 2007, S. 122-144 oder im sel-ben Sammelband Jan-Dirk Müller: Die Klage – Die Irritation durch das Epos, S. 163-182.
NADINE HUFNAGEL 59
der Erzählung schließlich wieder an den Ausgangspunkt der Handlung, den trau-ernden Etzelhof, zurück. Die Nibelungenklage gibt also Zeugnis davon, dass eine Geschichte, wie sie das Nibelungenlied erzählt, von unausweichlich scheinender Eskalation, die sich nicht von höfischen Normen und Werten verhindern lässt und in einem Ausbruch tödlicher Gewalt während eines höfischen Festes gipfelt, bereits bei zeitgenössischen Rezipienten Irritation und vielleicht sogar Trauer hervorgerufen zu haben scheint. So schlägt sich darin offenbar das Bedürfnis nieder, sich mit Möglichkeiten der Darstellung und der Darstellung der Verarbei-tung dieser Phänomene auseinanderzusetzen. Die folgenden Ausführungen wol-len sich jedoch nicht unter die zahlreichen Versuche, das Verhältnis zwischen Nibelungenlied und Klage näher zu bestimmen, einreihen, denn ob der Text der Klage in seiner überlieferten Form beispielsweise auf eine emotionale Bewälti-gung einer Nibelungenlied-Rezeption zurückgeführt werden darf, liegt im Be-reich des Spekulativen, da die genauen Produktions- und Rezeptionsbedingungen beider Texte im Dunkeln liegen. Stattdessen wird allein die Nibelungenklage in den Mittelpunkt gerückt, um darin den Zusammenhang von emotionalem und genderspezifischem Verhalten in den Blick zu nehmen.7
Die Bearbeitung genderthematischer Fragestellungen ist in der germanisti-schen Mediävistik mittlerweile fest etabliert.8 Auch „[d]as ‚Nibelungenlied‘
7 Den Zusammenhang von Emotionsdarstellungen und Geschlecht zu untersuchen wird
von Schnell wie folgt als Forschungsdesiderat der germanistischen Mediävistik umris-sen: „Zwar ist es uns [als Literaturwissenschaftlern] verwehrt, über die tatsächlichen Gefühle Aussagen zu machen, doch bleibt es dennoch interessant zu erforschen, (a) ob die literarischen Inszenierungen der Emotionen von Frauen anderen Gestaltungsprinzi-pien folgen als bei Männern, (b) ob den Männern bestimmte Emotionen häufiger zuge-schrieben werden als Frauen, (c) ob bei Emotionsszenen von Frauen deutlichere Be-wertungen vorgenommen werden als bei Männern, (d) inwiefern die Ausbildung einer weiblichen Identität stärker an bestimmte Emotionen gebunden ist als beim männli-chen Geschlecht bzw. umgekehrt die Ausbildung von Gefühlen/Emotionen an das Ge-schlecht gebunden ist.“ (Rüdiger Schnell: Historische Emotionsforschung. Eine mediävistische Standortbestimmung, in: Frühmittelalterliche Studien 38 (2004), S. 173-276, hier: S. 269). Er weist darüber hinaus darauf hin, dass es sich bei Emotions-forschung nicht um eine eigene Disziplin handle, sondern Emotionsforschung sich zwischen den Disziplinen abspiele und sich dabei auch Erkenntnissen verschiedener Disziplinen bedienen müsse, dass aber gerade deshalb „die Studien, die sich zur Emo-tionsforschung zählen, zumindest den methodischen Anforderungen und dem Kennt-nisstand ihres jeweiligen ‚Heimatfaches‘ genügen [sollten] […]. [E]ine literarhistori-sche Emotionsforschung kann auch in Zukunft nicht auf einläßliche, solide Textlektüre verzichten.“ (Ebd., S. 276) Dieser Forderung kann ich mich nur anschließen.
8 Aus der Fülle der Untersuchungen seien hier zwei Sammelbände genannt: Manlîchiu wîp, wîplîch man. Zur Konstruktion der Kategorien „Körper“ und „Geschlecht“ in der deutschen Literatur des Mittelalters, hg. von Ingrid Bennewitz und Helmut Tervooren, Berlin 1999 (= Beihefte der Zeitschrift für deutsche Philologie 9), und Genderdiskurse und Körperbilder im Mittelalter. Eine Bilanzierung nach Butler und Laqueur, hg. von Ingrid Bennewitz und Ingrid Kasten, Münster 2002 (= Bamberger
60 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
unter einer Gender-Perspektive zu analysieren, ist inzwischen, nach anfänglichen Außenseiterpositionen, fast schon mainstream-Forschung“, wie Elisabeth Lie-nert, die für diese Beobachtung zahlreiche Beispiele ins Feld führt, konstatiert.9 Bisher waren jedoch meist die weiblichen Figuren des Nibelungenliedes Aus-gangspunkt und Zentrum dieser Studien,10 weniger die männlichen oder der Text der Klage, den Lienert nur am Ende in ihre Überlegungen einbezieht. Da die Thematisierung von Geschlecht bzw. ‚Männlichkeit‘ in der Klage keinen Gegen-stand für sich darstellt, empfiehlt es sich, deren Erforschung mit der Unter-suchung anderer Konzeptionen zu verbinden. Die Verknüpfung mit der Emotion Trauer bietet sich dafür an, denn dass Trauer bzw. die mit dieser Emotion in Ver-bindung zu bringenden mittelhochdeutschen Termini klage und jâmer im Zent-rum der Klage stehen, wird zu Anfang des Textes explizit thematisiert:11
Hie hebt sich ein maere,
daz waere vil redebaere
und waere guot ze sagene,
niwan daz ez ze klagene
den liuten allen gezimt
swer ez rehte vernimt,
der muoz ez jâmerlîche klagen
und jâmer in dem herzen tragen.
(NK, 1-8)
Hier beginnt eine Geschichte,
die wäre wohl der Rede wert
und gut zu erzählen,
wenn es sich für alle Leute nicht viel
eher gehören würde, deswegen zu
klagen.
Wer sie richtig aufnimmt,
der muss sie jämmerlich beklagen
und Trauer im Herzen tragen.
Studien zum Mittelalter 1) und exemplarisch für Studien, die besonders das männliche Geschlecht in den Blick nehmen, der Sammelband Aventiuren des Geschlechts. Model-le von Männlichkeit in der Literatur des 13. Jahrhunderts, hg. von Martin Baisch, Hendrikje Haufe, Michael Mecklenburg, Matthias Meyer und Andrea Sieber, Göttin-gen 2003. Der vorliegenden Arbeit liegt ein Verständnis von Geschlecht als hegemo-nialem Diskurs zugrunde (vgl. beispielsweise Andrea Maihofer: Geschlecht als hege-monialer Diskurs. Ansätze zu einer kritischen Theorie des ‚Geschlechts‘, in: Denkach-sen. Zur theoretischen und institutionellen Rede vom Geschlecht, hg. von Theresa Wobbe und Gesa Lindemann, Frankfurt a. M. 1994, S. 236-263).
9 Elisabeth Lienert: Gender Studies, Gewalt und das ‚Nibelungenlied‘, in: Bönnen, Gallé: Der Mord und die Klage [Anm. 6], S. 145-162, hier: S. 145.
10 Vgl. beispielsweise Ingrid Bennewitz: Kriemhild und Kudrun: Heldinnen-Epik statt Helden-Epik, in: 7. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Mittelhochdeutsche Heldendich-tung ausserhalb des Nibelungen- und Dietrichkreises (Kudrun, Ortnit, Waltharius, Wolfdietriche), hg. von Klaus Zatloukal, Wien 2003, S. 9-20 (= Philologica Germanica Bd. 25).
11 Der ‚Titel‘ des Textes weist ebenfalls darauf hin (NK, 4322): diz liet heizet diu Klage Diese Dichtung heißt die Klage.
Ein weiterer Terminus, der in der Klage mit der Semantik von Trauer in Verbindung zu bringen ist, ist riuwe (vgl. z.�B. NK, 154-15 8).
NADINE HUFNAGEL 61
Der Fokus liegt im Folgenden vor allem auf der Trauer Etzels, des zweiten Ehe-manns Kriemhilds, der schon im Nibelungenlied als besonders mächtiger Herr-scher beschrieben wird: Allein sein Respekt einflößender Name reicht bei-spielsweise aus, um seine Boten auf ihrem weiten Weg vom Etzelhof nach Worms vor Angriffen zu schützen, während die Burgunden sich auf demselben Weg durchaus kämpferischen Auseinandersetzungen stellen müssen. Auch die Nibelungenklage beginnt nach dem Prolog mit dem Lob auf Etzel: Er hatte zwölf Könige unter sich, besaß hohes Ansehen sowohl bei Heiden als auch bei Christen und sein Herrschaftsbereich war ungeheuer groß. Darüber hinaus zog sein Hof viele hervorragende Helden, darunter auch Dietrich von Bern, an und war Ort großartiger Turniere sowie zahlreicher prachtvoller Feste. Die Betrachtung dieser Figur verspricht besonderen Erkenntnisgewinn für die Frage des Zusammen-hangs von Emotion und Männlichkeit in der Klage: Nachdem der Prolog zu-nächst betont, dass alle – unabhängig vom Geschlecht – trauern müssen, wird anhand ihres Verhaltens die Genderspezifik von Trauer explizit aufgerufen, wie noch gezeigt werden wird. Dabei bestätigt sich zwar auf den ersten Blick die populäre Vorstellung genderspezifischer Dichotomie, bei der dem weiblichen Geschlecht eine höhere Emotionalität, dem männlichen dagegen größere Ratio-nalität unterstellt wird, doch ist diese Lesart anhand einer genauen, historisch-perspektivierten Textlektüre zu hinterfragen.
‚Emotionsforschung‘ in der mediävistischen Germanistik
Bei der Analyse von literarischer Trauer- in Verbindung mit Gender-Darstellung kann dabei an die jüngere altgermanistische Forschung angeknüpft werden: In ihrer Dissertation zur Darstellung von Trauer in drei epischen Texten des Mittel-alters, Hartmanns von Aue Erec, Wolframs von Eschenbach Willehalm und Gottfrieds von Straßburg Tristan, widmet Elke Koch sich ebenfalls in einem Kapitel speziell der Genderthematik. Sie bemerkt zwar, dass einige neuere Un-tersuchungen die These der Zuschreibung von Trauer an weibliche Figuren be-stätigten12 und die Geschlechtsspezifik von Trauerdarstellungen bereits vielfach konstatiert wurde, wobei Trauer in der Heldenepik männlichen Figuren, im höfi-schen Roman aber vor allem weiblichen Figuren zugeschrieben würde.13 Ihre eigene Analyse zeigt jedoch, dass Trauer – z.�B. in Hartmanns von Aue höfi-schem Roman Erec – zwar funktional für die Konstitution der Geschlechtsidenti-tät von Figuren ist, sich aber die Forschungsthese eines Gegensatzes von weibli-cher Emotionalität einerseits und männlicher Rationalität andererseits nicht er-härten lässt:
12 Elke Koch: Trauer und Identität. Inszenierungen von Emotionen in der deutschen
Literatur des Mittelalters, Berlin, New York 2006, S. 11. 13 Vgl. ebd., S. 159.
62 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
Vielmehr wird leit in seinen vielfältigen Formen und Anlässen geschlechtsspezi-
fisch differenziert, wobei keine exklusiven Oppositionen, sondern unterschiedli-
che Muster emotionaler Performanzen ausgeprägt werden.14
Und so bedarf die
kulturwissenschaftliche These der Weiblichkeit von Trauer […] mit Blick auf nar-
rative Texte um 1200 der Differenzierung. Zwar finden sich vielfach Zuschrei-
bungen von Trauer an weibliche Figuren oder auch Erzählerkommentare, in denen
Trauer weiblich markiert wird. Jedoch hat sich in allen drei Texten erwiesen, dass
Trauer auch für die Konstitution männlicher Identität zentral ist.15
Kochs Arbeit ist dabei nur ein Beispiel für die rege Beteiligung der mediävistischen Germanistik an der interdisziplinären Erforschung von Emo-tionen. Diese literarhistorische Emotionsforschung hat jedoch unter anderem aufgrund methodischer Schwierigkeiten und eines teilweise inkonsistenten oder unklaren Begriffsgebrauchs auch Kritik hervorgerufen.16 Deshalb sollen an die-ser Stelle kurz einige Problemfelder angesprochen und die eigenen Prämissen offengelegt werden. Für die Literaturwissenschaften ergeben sich zusätzlich zu den Problemquellen, denen sich auch andere an der Emotionsforschung betei-ligte Disziplinen gegenübersehen – wie etwa der Bestimmung dessen, was ‚Emo-tion‘ letztlich eigentlich sei17 –, Fragen nach den Bedingungen und Wirkungen literarischer Transformation. Es ist zu reflektieren, ob und inwiefern medial vermittelte Ausdrucksformen von Emotionen überhaupt Rückschlüsse auf diese Emotionen selbst zulassen. Dieses Problem verschärft sich für die Literaturwis-senschaft, die sich mit älteren Texten auseinandersetzt, aufgrund der zahlenmä-ßig begrenzten nicht-literarischen und der noch geringeren Anzahl nicht-schriftlicher Quellen zu Emotionen. So hebt Koch die „Frage nach dem Verhält-nis von ‚literarischen‘ und ‚historischen‘ Emotionen in der aktuellen Debatte als strittige[n] Punkt“ hervor.18 Grundsätzlich treffe man, so Rüdiger Schnell, auf
14 Ebd., S. 168. 15 Ebd., S. 286. 16 Vgl. dazu insbesondere den bereits erwähnten Beitrag von Schnell (Schnell: Histori-
sche Emotionsforschung [Anm. 7]). 17 Ist Emotion lediglich ein inneres, ein psychisches Ereignis? Oder kann man von Emo-
tion erst dann sprechen, wenn Handeln irgendeiner Art sichtbar ist? Worin liegt der Unterschied zwischen Emotion, Gefühl, Empfindung und Affekt? Aufgrund solch grundlegender Fragen fordert Schnell „für jede Epoche, jeden Diskurs, jede Kommu-nikationssituation die Begriffe ‚Emotion‘ und ‚Codierung‘ sowie deren Relationierung je von neuem“ zu bestimmen (Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 185).
18 Elke Koch: Bewegte Gemüter. Zur Erforschung von Emotionen in der deutschen Lite-ratur des Mittelalters, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 49 (2008), S. 33-54, hier: S. 40.
NADINE HUFNAGEL 63
zwei konträre Grundpositionen: Entweder würden alle Emotionen als anthropo-logisch konstant vorausgesetzt und lediglich die Ausdrucksweisen hätten sich im Laufe der Menschheitsgeschichte verändert, oder es werde allgemeine histori-sche Veränderbarkeit von Emotionen angenommen. Nehme man die Erkenntnis ernst, dass von den Ausdrucksformen her keine sicheren Aussagen über etwaige vorgängige emotionale Zustände zu gewinnen sind, müsse man beiden Positio-nen eine Absage erteilen.19 Meine Ausführungen basieren auf einem Verständnis von Emotion, wie es Koch formuliert: Emotionen besitzen keinen ontologischen Status, vielmehr stellen sie
eine kulturell variable Kategorie anthropologischer Selbstbeschreibung [dar], die
durch Wissenstraditionen und Sprachregelungen geprägt ist und den Gegenstand,
den sie bezeichnet und beschreibt, mit hervorbringt und formt.20
Die Vorstellung von überzeitlichen Emotionen wäre damit selbst als ein kultu-relles Produkt identifizierbar.21 Je älter ein literarisches Zeugnis ist, umso mehr ist davon auszugehen, dass sich dessen Vorstellungswelt stärker von der gegen-wärtigen unterscheidet und somit die Gefahr einer ahistorischen Sinnentstellung durch die Rückprojektion jüngerer Konzepte zunimmt. So stellt beispielsweise Jan-Dirk Müller anhand seiner Interpretation des Nibelungenliedes fest, dass populäre moderne psychologische Vorstellungen mit vermeintlich überzeitlicher Geltung bei den Figuren des mittelhochdeutschen Heldenepos nicht greifen, und rekonstruiert aus dem mittelhochdeutschen Text selbst eine ‚nibelungische Anth-ropologie‘. Zwar müsse man bei Affekten, Habitus, psychischen Mechanismen und Ähnlichem mit Strukturen längerer Dauer und größerer Reichweite rechnen als bei anderen kulturellen Phänomenen und es stiegen die Chancen, Vergleich-bares oder Bekanntes zu entdecken, doch die Annahme ihrer anthropologischen Konstanz entspringe einer „vorwissenschaftliche[n] Naivität“.22 Psychische An-
19 Vgl. Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 180. Eine dritte Position
nimmt laut Schnell Charles Stephen Jaeger ein, der zudem zwischen öffentlichen, so-ziokulturell bedingten und damit variablen sensibilities einerseits und privaten, trieb-haften und damit konstanten emotions, deren Ausdrucksformen aber historisch varia-bel seien, andererseits unterscheidet. Damit, kritisiert Schnell zu Recht, gerät Jaeger in das Dilemma, dass die angenommene Konstanz der emotions nicht nachweisbar ist, wenn ihre Ausdrucksformen variieren und die Zuordnung beobachteter Phänomene zu den Kategorien emotions und sensibilities letztlich willkürlich bleibt. Darüber hinaus sei problematisch, dass Jaegers Konzept von sensibilities nicht sauber zwischen Emo-tionen und deren Codierung unterscheide, und dass die Unterscheidung von sensibilities und emotions mit der Differenz privat und öffentlich, die selbst kulturell unterschiedlich bestimmt sei, verknüpft werde.
20 Koch: Bewegte Gemüter [Anm. 18], S. 42. 21 Vgl. Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 182. 22 Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 201f.
64 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
triebe und Reaktionen, die dem heutigen Leser als „affektiv ausladend […]“23 erscheinen, sind nach Müller nicht als Ausdruck eines ‚inneren‘ Charakters zu verstehen, sondern seien Funktionen der Handlungskonstellationen, in denen die Figuren auftreten.24 Aufgrund der enormen Bedeutungs- und auch Bewertungs-breite der lateinischen Begriffe affectus, affectio, passio sowie mittelhochdeut-scher Termini wie muot muss man sich ferner fragen, welche Bezeichnung(en) und Konzepte im Mittelalter für das, was man heute unter Emotion verstehen kann, vorhanden waren, welche semantischen Komponenten die entsprechenden mittelalterlichen Begriffe tatsächlich enthalten und wie sich diese wiederum zur modernen Semantik verhalten.25 Schnell weist außerdem darauf hin, dass
die (historische) Emotionsforschung in einer dialektischen Spannung ‚gefangen‘
zu sein [scheint]: Sie begreift äußere Zeichen (Gestik, Gebärde, Körperhaltung,
verbale Äußerungen) als Bedeutungsträger für etwas Vorgängiges (emotionale Zu-
stände). Gleichzeitig muß sie damit rechnen, daß diese Zeichen (vor allem im Fal-
le sprachlicher Aussagen) dasjenige allererst produzieren, worauf sie verweisen.26
Zu diskutieren ist im Zusammenhang mit der Kritik der literarhistorischen Emo-tionsforschung auch der häufig gebrauchte Begriff der ‚Codierung‘. Durch die-sen Terminus ist zunächst die Tatsache in Erinnerung gerufen, dass Emotionen sich grundsätzlich in bestimmten Verhaltensweisen äußern, sich in Körper ein-schreiben oder sprachlich artikuliert werden, also immer medial vermittelt sind. Dabei stehen Emotionen der (mediävistischen) Literaturwissenschaft grund-sätzlich nur doppelt medial vermittelt zur Verfügung, nämlich durch die literari-sche Beschreibung dieser Verhaltensweisen, Körper oder Worte in Texten. Es ist also notwendig, verschiedene Ebenen zu unterscheiden: Emotionen, deren Co-dierung in Form von Körpersprache, Handlungen oder Worten und die literari-sche Codierung dieser Codierung erster Ebene. Die literarische Codierung, von mir im Folgenden meist als Darstellung bezeichnet, umfasst dabei ein Set ver-schiedener Möglichkeiten: die Schilderung eines Verhaltens durch die Erzähl-instanz, Figurenrede in Dialog oder Monolog, der Blick in den Innenraum der
23 Ebd., S. 203. 24 Ebd., S. 201-204. Zur Ablehnung einer ahistorischen Anwendung der Psychoanalyse
vgl. auch Katharina Philipowski: Wer hat Herzeloydes Drachentraum geträumt? Trûren, zorn, haz, scham und nît zwischen Emotionspsychologie und Narratologie, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 128 (2006), S. 251-274. Koch weist ebenfalls eindringlich darauf hin, dass sich in der mittelalterlichen Epik um 1200 keine Charaktere oder Individuen, deren Seelenleben dargestellt wird, finden, sondern das Handeln der Figuren eher von ihren sozialen Rollen, ihren narrativen Funktionen und den Handlungskonstellationen her bestimmt wird (vgl. Koch: Bewegte Gemüter [Anm. 18], S. 51).
25 Vgl. Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 207-210. 26 Ebd., S. 186f.
NADINE HUFNAGEL 65
Figuren, die Kommentierung durch eine Erzählerfigur etc. Diese Möglichkeiten können wiederum von bestimmten literarischen Konventionen, etwa Gattungs-konventionen, beeinflusst sein.27 Aufgrund dieser doppelten Codierung ist in literaturwissenschaftlichen Arbeiten stets darauf zu achten, dass sich Aussagen über die Darstellung von Emotionen nicht ununterscheidbar mit Aussagen über diese Emotionen vermischen.28
Exemplarisch für die Untersuchungen, die sich methodologisch strikt an der genuinen Eigenständigkeit von Literatur orientieren, wird des Öfteren ein Auf-satz Katharina Philipowskis genannt.29 Sie setzt bei der Differenzierung zwi-schen faktischen und narrativ konstruierten Emotionen an und kritisiert zurecht einige Forschungsansätze, die davon ausgehen, dass, weil „Emotionen immer schon Repräsentationen und nie ‚unmittelbar‘ seien, […] sie auch auf einer heu-ristischen Ebene (als Repräsentationen) miteinander vergleichbar [seien]“.30 Stattdessen habe man ernst zu nehmen, dass „‚Repräsentation‘ durchaus nicht gleich ‚Repräsentation‘“31 sei. Ihr ist zuzustimmen, dass literaturanthropologi-sche Ansätze häufig kritisch anzusehen sind, da die Literarizität der Texte darin oft nicht mehr den zentralen Erkenntnisgegenstand darstellt, sondern diese viel-mehr als historische Quelle, als Zeugnis einer Geschichte der Emotionen fungie-ren. Philipowski legt eingängig dar, warum es geboten ist, zwischen Personen und Figuren, zwischen Anthropologie und Narration zu unterscheiden, führt dann jedoch letztlich alles Fiktionale allein auf die Aussageintention des historischen Autors zurück: Die Existenz literarischer Figuren hänge allein davon ab, wie ihr Schöpfer sie definiere. Ficta bestünden allein aus den Eigenschaften, die ihnen von einem Autor zugeordnet würden, und somit seien auch die Emotionen einer fiktiven literarischen Figur ontologisch unvollständig.32 Natürlich stimmt es, dass es nichts über die Figuren zu wissen gibt, was jenseits dessen liegt, was im Text greifbar ist. Allerdings zeichnet sich Sprache dadurch aus, dass sie mehr beinhal-
27 Laut Koch gehört die Untersuchung von Gattungskonventionen in der mediävistischen
Literaturwissenschaft momentan zu den vorrangigen Fragestellungen. Dabei wurden starke Unterschiede, vor allem zwischen Heldenepos und höfischem Roman, festge-stellt (vgl. Koch: Bewegte Gemüter [Anm. 18], S. 52).
28 Vgl. Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 176-179. Darüber hinaus gilt, was Schnell später zugespitzt folgendermaßen formuliert hat: „Wie sich Ge-schichtswissenschaftler, Ethnologen oder Psychohistoriker für die historischen und kulturellen Bedingtheiten von Emotionen interessieren, so interessieren sich – bzw. ha-ben sich zu interessieren – Literaturwissenschaftler für die historischen, kulturellen und auch gattungsgeschichtlichen Bedingtheiten von Emotionsdarstellungen.“ (Rüdi-ger Schnell: Erzähler – Protagonist – Rezipient im Mittelalter, oder: Was ist der Ge-genstand der literaturwissenschaftlichen Emotionsforschung?, in: IASL 33 (2008), H. 2, S. 1-51, hier: S. 8).
29 Philipowski: Herzeloydes Drachentraum [Anm. 24]. 30 Ebd., S. 254. 31 Ebd., S. 255. 32 Vgl. ebd., S. 256.
66 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
tet als nur eine Aussageebene bzw. die von einem Autorsubjekt intendierten Aus-sagen. So plädiert bereits Schnell, der Philipowski in weiten Teilen zustimmt, für einen stärkeren Einbezug der Rezipientenebene und warnt vor einer völligen Loslösung von Literatur aus ihrem kulturellen Kontext.33 Denn Philipowski zieht aus ihren dargelegten Kritikpunkten den Schluss, dass literarischen Texten tat-sächlich jeglicher Wert für emotionsgeschichtliche Fragestellungen fehle. Fra-gen, wie etwa die nach einer literarischen Reflexion von kulturellen Emotions-Konzepten oder solche nach der Semantik von Emotionswörtern über den narra-tiven Kontext hinaus, seien fehlgeleitet und müssten letztlich an der Differenz von Phänomen und fiktionaler Konstruktion scheitern.34 Diese Differenz sollte reflektiert werden, in der Radikalität, in der Philipowski diese Differenz formu-liert, führt sie jedoch zu Aporien:
indem sie [Philipowski] aber erzählte Emotion und Weltwissen vollständig von-
einander abgekoppelt wissen will, ist nicht mehr erklärbar, wie das Erzählen von
Emotionen in der Produktion und in der Rezeption überhaupt als Sinn erzeugend
angesetzt werden kann.35
Die Darstellung der Trauer Etzels
Unter Beachtung dieser Prämissen soll im Folgenden untersucht werden, wie die Trauer Etzels und auch der anderen Figuren in der Nibelungenklage dargestellt ist und welche Funktionen diese Darstellung im jeweiligen narrativen Kontext hat, ob sich die dargestellten Trauer-Verhaltensweisen bei männlichen und weib-lichen Figuren unterscheiden und ob daran etwa geschlechtsspezifische Wertun-gen geknüpft sind. Angesetzt wird bei den bereits erwähnten mittelhoch-deutschen Termini klage(n), jâmer(n) und riuwe. Diese besitzen einen semanti-schen Gehalt, den man mit demjenigen des modernen Begriffs Trauer in Verbin-dung bringen kann, obwohl davon auszugehen ist, dass diese keinesfalls de-ckungsgleich sind.36 Zuerst wird durch den Tod Kriemhilds, der recht früh in der Klage thematisiert und gedeutet wird, unter allen Leuten ungemach und jâmer
33 Vgl. Schnell: Erzähler – Protagonist – Rezipient im Mittelalter [Anm. 28], S. 24-26. 34 Vgl. die Kritik an Philipowski bei Koch: Bewegte Gemüter [Anm. 18], S. 48. 35 Ebd. 36 Koch widmet der Darstellung der mittelalterlichen Diskurse über Trauer, in den meis-
ten Texten mit tristitia bezeichnet, ein eigenes Unterkapitel (vgl. Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 32-37): Die vor allem theologischen, aber auch medizinischen Ausführungen ergeben laut Koch kein einheitliches Bild in der Wahrnehmung und Bewertung von Trauer. So lässt sich mit den nicht-literarischen Texten zwar der kultu-relle Kontext der mittelhochdeutschen Literatur weiter rekonstruieren, aber Koch warnt ausdrücklich davor, irgendeine theologische oder medizinische Position einfach auf einen literarischen Text zu übertragen.
NADINE HUFNAGEL 67
ausgelöst (vgl. NK, 519-527).37 Tag und Nacht ist man nur noch mit Weinen und Klagen beschäftigt (vgl. NK, 543-545). Etzel verbringt seine ganze Zeit „mit leide und ouch mit sêre“, mit Leid und Schmerzen (NK, 591). Müller legt dar, dass im Nibelungenlied emotionale und rechtliche Aspekte im Begriff leit unun-terscheidbar sind und leit allgemein einen beschädigten Status bezeichnet, wobei semantisch keine scharfe Grenze zwischen ‚äußerer‘ Verletzung und ‚innerer‘ Beleidigung bestünde. Dies ist auch in der Klage der Fall: Es wird nicht benannt, ob der Schmerz Etzels seelischer oder körperlicher Art ist, vermutlich weil ohne-hin beides vom mittelalterlichen Rezipienten zusammengedacht worden ist.38 Die Verwendung von sêre weist jedenfalls deutlich auf die Heftigkeit der Schmerzen hin.39 Etzel stößt Klagelaute aus, die sehr laut tönen und die Türme und Hauptgebäude der Burg zittern lassen (vgl. NK, 624-631). Die Klage ge-braucht in diesem Kontext auch das Verb wüefen. Der wuof ist ein Geschrei, insbesondere ein Klage- und Jammergeschrei,40 das akustische Signalwirkung besitzt. Es erregt Aufmerksamkeit und kann somit zur Herstellung einer (Ge-richts-)Öffentlichkeit oder Klagegemeinschaft führen.41 Dass an dieser Stelle nicht (nur) die Artikulation eines im Inneren zu verortenden Schmerzes, sondern
37 ungemach ist ein weiterer mittelhochdeutscher Begriff, der mit Trauer in Verbindung
gebracht werden kann, da er auch Klage und Trauergebärden bezeichnet. Häufig ist er allgemeiner verwendet im Sinne eines Ausdrucks von Unmut, Unannehmlichkeit, Verdruss oder Unruhe (vgl. auch Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwör-terbuch, 2. Nachdruck der 3. Auflage von 1885, Stuttgart 1992, S. 296).
38 Dass es an dieser Stelle tatsächlich um Etzels Status geht, legen die Folgeverse nahe (vgl. NK, 592f.). Zur Frage, inwiefern für die mittelalterliche Vorstellungswelt über-haupt eine Innen-Außen-Dichotomie zwangsläufig angenommen werden muss, vgl. Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 188-190 und Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 212-216.
39 Vgl. Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch [Anm. 37], S. 226, wo die Be-deutung des Substantivs sêr mit körperlichem und geistigem Schmerz, Qual, Leid und Not angegeben wird sowie das Adjektiv sêre mit gewaltig und heftig und sêre – wunde mit tödlicher Verwundung übersetzt sind. Die Verletzung des ‚Status‘ Etzels kann so-mit durchaus als existenzbedrohend begriffen werden.
40 Vgl. Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch [Anm. 37], S. 395. 41 In der Klage wird wuof bzw. wuofen an mehreren Stellen und nicht nur im Zusammen-
hang mit Etzels Verhalten gebraucht. Zur Semantik dieser Begrifflichkeit vgl. auch H. Holzhauer: Gerüfte, in: Lexikon des Mittelalters 4 [CD-ROM-Ausgabe 2000], Sp. 1357f. Auch das Klagegeschrei, welches Kriemhild im Nibelungenlied angesichts der Entdeckung der Leiche ihres ersten Mannes Siegfried ausstößt, wird als wuof bezeich-net. Auf dieses akustische Signal hin kommen zunächst ihr Gefolge und Siegfrieds Va-ter, Sigmund, mit seinen Männern herbei, die ebenfalls in die Klage einstimmen, was wiederum andere Personen herbei ruft. Somit erweitert sich der Kreis der Klagenden immer mehr, solange bis auch Kriemhilds Brüder und Hagen ihn nicht mehr ignorieren können und sich dazu verhalten müssen. Eine öffentliche Thematisierung der Todesur-sache wird unvermeidbar (vgl. Nibelungenlied. Text und Übertragung in zwei Bänden, hg. von Helmut Brackert, Frankfurt a. M.292004 und 272005, Aventiure 17).
68 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
vor allem die soziale Signalwirkung wichtig ist, unterstreicht der Vergleich mit dem Horn, einem Instrument, das, beispielsweise bei der Jagd, der Fernkommu-nikation dient. Zusätzlich zu den akustisch und taktil wahrnehmbaren Klagelau-ten umfasst die Darstellung des Trauer-Verhaltens Etzels auch vor allem visuell wahrnehmbare Ausdrucksmöglichkeiten: Er ringt mit den Händen, weint und sinkt schließlich neben der Leiche seiner Frau nieder, „als ob er waere entslâfen“ (NK, 851).42 Bei dieser Gelegenheit wird er durch Dietrich von Bern ermahnt:43
[…] ir tuot dem ungelîch daz ir sît ein wîse man. daz iuch niht vervâhen kan daz lât: daz ist mîn lêre. (NK, 854-857)
Ihr verhaltet Euch nicht, als ob Ihr ein kluger Mann wärt. Womit44 Ihr nichts ausrichten könnt, das lasst bleiben: Das ist mein Rat.
Später wird Etzel, wiederum von Dietrich, kritisiert, er verhalte sich unmännlich und stünde händeringend da, ganz wie eine hilfebedürftige Frau. Dies sei man von ihm nicht gewöhnt und es sollte besser auch nicht allgemein bekannt wer-den.45 Damit scheint die These bestätigt, dass, da Frauen als schwach und emoti-onal gelten, sich weibliche Figuren ganz der Trauer hingeben dürften, Etzel als
42 entslâfen hat im Mittelhochdeutschen sowohl die Bedeutung einschlafen als auch
sterben (vgl. Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch [Anm. 37], S. 46), sodass man sowohl lesen kann, dass Etzel vor Erschöpfung durch den Schock oder das an-strengende Trauer-Verhalten einschläft, was das Ausmaß dieses Verhaltens – und da-mit das des erlittenen Schadens – unterstreichen würde, als auch, dass er wie tot ohn-mächtig niedersinkt, was die Verbundenheit des hunnischen Herrschaftskörpers über den Tod hinaus symbolisieren würde und vielleicht schon als früher Hinweis auf die Ausweglosigkeit von Etzels Trauer verstanden werden könnte.
43 Dietrichs Position ist nicht einfach zu bestimmen. Im Nibelungenlied erfährt man, dass der Herr der Amelungen als Landfremder am Hof König Etzels aufgenommen worden, diesem aber nicht zur bedingungslosen Treue verpflichtet ist. So kann er sich zunächst aus den Kämpfen zwischen den Hunnen und den Burgunden heraushalten. Erst als sei-ne Gefolgsleute, die gegen seinen Befehl in die Schlacht eingegriffen haben, bis auf Hildebrand alle getötet worden sind, muss er seine ‚neutrale‘ Position aufgeben. Er be-siegt sowohl Gunther als auch Hagen im Zweikampf und liefert sie als Gefangene an Kriemhild aus, die Gunther töten lässt und schließlich auch Hagen umbringt, worauf-hin sie von Hildebrand getötet wird. Christina Kiehl, die sich in ihrer Dissertation vor-nehmlich einem Vergleich der Klage-Fassungen *J und *B widmet, zeigt in ihrem Forschungsüberblick mit Bezug auf Michael Curschmann und Nikolaus Henkel, wie man es auch als eine wichtige Funktion der Klage verstanden hat, dass sie das Helden-leben Dietrichs von Bern, einem im Mittelalter überaus beliebten Erzählkomplex, zu Ende führe (vgl. Christina Kiehl: Zur inhaltlichen Gestaltung einer Kurzfassung. Eine verkürzte ‚Nibelungen-Klage‘ als Fortsetzung des ‚Nibelungen-Liedes‘, Frankfurt a. M. u.�a. 2008, S. 55f.).
44 Oder auch: wogegen. 45 Vgl. NK, 1018-1025.
NADINE HUFNAGEL 69
Mann hingegen Trauer nicht derart ausgeprägt performieren sollte, sondern seine Emotionen unter Kontrolle zu halten und rational zu handeln hätte. Diese Lesart wird allerdings irritiert, wenn Dietrich in den folgenden Versen Etzel darum bittet, nicht sich selbst, sondern ihn, den „armen Dieterîche“, zu trösten und fortan mit Etzel gemeinsam trauert, weint46 und seufzt.47 Des Weiteren zeigt Dietrich selbst stark ausgeprägtes Trauer-Verhalten angesichts des toten Giselher und seiner gefallenen Gefolgsleute:
mit leide in unsinne
gie dô der Bernaere
und schouwete sîne swaere
(NK, 1410-1412)
Wahnsinnig vor Schmerz
ging der Berner dorthin
und betrachtete sein Leid.
Dieses Verhalten legt Dietrich an den Tag, ohne dafür getadelt zu werden. Der Berner Fürst funktioniert also keineswegs als ein emotional beherrschtes, ratio-nal handelndes, positives männliches Gegenbild zum übertrieben emotionalen, weibisch handelnden Etzel. Angesichts dessen ist es an diesem Punkt sinnvoll, den Blick zu erweitern und danach zu fragen, wie im Zusammenhang mit ande-ren Figuren Trauer in der Klage dargestellt wird und ob es dabei zu ähnlich ex-pliziten genderspezifischen Differenzierungen kommt.
Die Zeichenhaftigkeit von Trauer
Auffällig ist zunächst, dass Textbelege für einen eindeutigen Blick in das Seelen-leben bzw. die Psyche der Figuren auch bei anderen Figuren schwerlich zu er-bringen sind. Selbst Bilder, die diesen Einblick vermeintlich erlauben, wie es zum Beispiel der häufige Rückgriff auf die Schilderung des Zustandes eines Her-zens signalisiert, können offenbar weniger metaphorisch als in neuzeitlicher Literatur verwendet sein. So ist in der Reaktion der Jungfrau Isalde das so häufig als Metapher erscheinende blutende Herz tatsächlich eine körperliche Reaktion:
si wart jâmeric zehant
und sô trûrec gemuot,
daz ir von herzen daz bluot
draete ûz ir munde
(NK, 2762-2765)
Sie wurde sogleich klagend
und so traurig gesinnt,
dass ihr das Blut des Herzens
aus dem Mund strömte.
In weiten Teilen ist der Rezipient des Textes ohnehin auf die direkte Figurenrede und die Beschreibung des Figurenverhaltens durch andere Figuren und die Er-zählinstanz angewiesen. In diesen Beschreibungen wie auch im überwiegenden
46 Vgl. z.�B. NK, 1468-1470. 47 Vgl. z.�B. NK, 1568-1571.
70 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
Teil der Rede der Figuren wiederholen sich ständig dieselben Verhaltensweisen und Redeformeln. So bestätigt die Lektüre der Klage den Befund Kochs, dass ein etwaiger nichtmitteilbarer Kern subjektiver, individueller Emotionalität keine Rolle in den epischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts spielt. Vielmehr zielt die Darstellung darauf, Trauer als Kommunikation zu entwerfen, wobei die kommunikative Dimension durch die Formalisierung des Ausdrucks gestützt wird. Trauer funktioniert dadurch auch als Performanz von Zugehörigkeit.48
Die Bedeutung von emotionalem Verhalten als symbolische Kommunikation im Mittelalter hat bereits der Historiker Althoff herausgearbeitet,49 sie wird seit-dem auch immer wieder betont.50 Diese kommunikative Dimension des Trauer-Verhaltens, die schon in der ersten Betrachtung der Darstellung des Trauer-Ver-haltens Etzels beobachtet werden konnte, bedingt auch die – aus gegenwärtiger Perspektive – oftmals extreme Ausprägung der geschilderten Verhaltensweisen: Hände werden gerungen, bis sie brechen, man schreit bis zur Bewusstlosigkeit etc. Dadurch wird das Ausmaß des entstandenen Schadens performiert und schreibt sich – sichtbar – in die Körper ein. Deshalb ist die Intensität des Trauer-Verhaltens auch weitgehend unabhängig von der persönlichen Nähe des Trauern-den zum Betrauerten: So kann man aus der persönlichen Betroffenheit erklären, dass Etzel angesichts der Leichen von Frau und Kind das Herzblut aus Mund und Ohren rinnt, aber nicht, dass einem namenlos bleibenden Knappen aus dem Ge-folge der Boten König Etzels in Bechelaren, also bereits entfernt vom Ort des Geschehens, wegen des Todes des Markgrafen das Blut aus dem Mund bricht. Auch in diesem Beispiel ist die kommunikative Funktion ausschlaggebend für die Intensität des Trauer-Verhaltens, so löst erst der Blutfluss des Knappen das Gespräch über die wahren Ereignisse am Etzelhof, die man zunächst verschwei-gen wollte, überhaupt aus und hebt gleichzeitig den hohen sozialen Status des Verstorbenen hervor, dessen Verlust für den Hof von Bechelaren eine Katastro-phe ähnlichen Ausmaßes darstellt wie für Etzel der Tod von Kriemhild und Ort-lieb. Bei alldem ist nicht entscheidbar, inwiefern die kommunikative Wirkung dieses Verhaltens von den Figuren intendiert und ob es Gefühlsausdruck ist; solche Fragen sind in der Nibelungenklage, wie in der überwiegenden Zahl mit-
48 So Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 287, vgl. auch den Hinweis auf die Do-
minanz körperbezogener Darstellungsmuster und den stereotypen Charakter der Emo-tionsdarstellungen in literarischen Texten um 1200 in der Einleitung.
49 Vgl. z.�B. Gerd Althoff: Empörung, Tränen, Zerknirschung. ‚Emotionen‘ in der öffent-lichen Kommunikation des Mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 30 (1996), S. 60-79. In Abgrenzung von Elias betont Althoff den zweckrationalen Charakter öffent-licher Gefühlsdemonstrationen, die, in einer Gesellschaft ohne staatliches Gewaltmo-nopol funktional und musterhaft bzw. ritualisiert angewendet, Sicherheit generieren und die Ernsthaftigkeit eines Vorgangs unterstreichen.
50 Beispielsweise von Schnell: Historische Emotionsforschung [Anm. 7], S. 225f.
NADINE HUFNAGEL 71
telhochdeutscher epischer Texte, weder gestellt noch beantwortet.51 Nichts-destotrotz erfüllt das Trauern in den meisten Fällen seine kommunikative Funk-tion auf Figurenebene und für den textexternen Beobachter wird die spezifische soziale Zeichenhaftigkeit des Trauer-Verhaltens erkennbar, wie Koch mit Bezug auf das von ihr untersuchte Textkorpus schreibt:
Durch Trauer werden Weltverhältnisse ausgedrückt, die sich auf soziale Bindun-
gen und Normen beziehen. In diesem Sinne ist Trauer als Performanz von Identi-
tät zu verstehen.52
Da das Trauer-Verhalten untrennbar mit der Identität der Figuren verknüpft ist, schreibt es sich regelrecht in ihre Körper ein. So kann die Trauer nicht ver-heimlicht werden, denn sie ist für andere Figuren dort ablesbar, selbst wenn deren Ursache nicht klar ist, wie die Reaktion der Tochter und der Ehefrau Rüdi-gers in Bechelaren bei der Ankunft der Boten vom Etzelhof unter Beweis stellt.53 Der Fokus muss sich folglich von der Frage nach der Intentionalität eines darge-stellten Verhaltens auf die nach dessen Performanz in und aus sozialen Kontex-ten und Handlungskonstellationen heraus verschieben. Die Untersuchung litera-rischer Emotionsdarstellungen kann sich somit von der Frage nach ‚Persön-lichkeit‘ oder ‚Charakter‘ der Figuren lösen und die Konstitution der Figuren-identität – und somit auch deren Geschlechtsidentität – in den Blick nehmen, ohne moderne Konzepte von Individualität und Intentionalität auf mittelalter-liche Texte zu projizieren.54
51 Es scheint nicht notwendig, den demonstrativen Charakter von emotionalem Verhalten
immer in Gegensatz zu Spontaneität oder gar Authentizität zu bringen, da Zeichen-haftigkeit nicht notwendig kalkulierenden Zeichengebrauch voraussetzt (vgl. Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 209). Dabei beschäftigen sich Texte häufiger mit der Frage nach der Verlässlichkeit von Zeichen, in der Nibelungenklage jedoch stellen sich die sichtbaren Zeichen des Trauer-Verhaltens als unhintergehbar heraus.
52 Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 68. Auch Müller stellt mit Bezug auf das Ni-belungenlied fest: „trûren ist Reaktion auf einen beschädigten Weltzustand. So wenig wie zorn ist es subjektive Befindlichkeit, sondern bezeichnet Haltungen, die sich aus einer konfliktträchtigen Situation ergeben, und bestimmte ihnen zugeordnete Gebär-den, vorgetäuschte oder echte.“ (Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 208.)
53 Damit gibt es in der Welt der Klage keine ‚Trübung der Sichtbarkeit‘ wie im Nibelun-genlied (vgl. Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 249-295).
54 Vgl. Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 60. In epischen Texten des Mittelalters wird Identität maßgeblich über soziale Zuschreibungen bestimmt, etwa der Zugehörig-keit zu einem Stand oder einer Verwandtengruppe. Identität in diesem Sinne muss immer wieder neu gestiftet und realisiert werden. Sie stellt keine Entität dar, die sich verfestigt, sondern konstituiert sich prozesshaft immer aufs Neue durch Sprechakte der Selbst- und Fremdzuschreibung, des Körpereinsatzes etc. (vgl. ebd., S. 71, mit Rück-griff auf Alois Hahns Terminus der partizipativen Identität).
72 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
Richtet man das Augenmerk auf das von den Figuren performierte Verhalten, ergibt sich folgendes Bild: Die männlichen Figuren verhalten sich allesamt ähn-lich wie Dietrich und Etzel, sie seufzen, weinen, klagen, schreien laut und ringen mit den Händen.55 Das Verhaltensrepertoire der weiblichen Figuren besteht eben-falls aus Seufzen, Weinen, Klagen, lauten Schreien und Händeringen. Das bereits erwähnte Hervorbrechen von Blut kommt außer im Fall des Knappen und dem Etzels nur bei weiblichen Figuren vor. Von anderen Figuren negativ bewertet wird es aber nur im Falle Etzels, nicht in dem der Frauen und des – ebenfalls männlichen – Knappen.
Als spezifisch weiblich stellt sich allerdings das Ausreißen von Haaren und Zerreißen kostbarer Gewänder dar. Schönheit, gepflegtes Äußeres und prächtige Kleidung gelten in der höfischen Kultur des Mittelalters als repräsentative Ele-mente für adeligen Stand und Freude der höfischen Gemeinschaft.56 Die Zerstö-rung von Schönheit und Ausstattung macht folglich die Vernichtung derselben sichtbar. Dass es hier vor allem die weiblichen Figuren sind, die ihr höfisches Äußeres demonstrativ zerstören, liegt sicher darin begründet, dass etliche der männlichen Figuren noch vom Kampf gerüstet und gezeichnet sind und somit ohnehin keine Festkleidung mehr tragen, aber vor allem auch daran, dass gerade die schöne und prächtige höfische Dame für Friedfertigkeit und höfische Freude steht. Das in der Literatur weit verbreitete Muster der Äußerung von Todessehn-sucht im Rahmen von Trauer-Verhalten57 ist ebenfalls bei Vertretern beiderlei Geschlechts zu finden, wird aber nur bei Etzel und Dietrich kritisiert. Aus Trauer sterben zu wollen, ist offenbar für Figuren, die keine spezifische soziale Funk-tion mehr zu erfüllen haben, eine denkbare Reaktion, aber nicht für diejenigen, die als Herrscher Verantwortung tragen. So kann Ute, die Mutter der toten Burgundenkönige, tatsächlich in allen Ehren an ihrer Trauer versterben, schließ-lich wird die Funktionsstelle der Königinmutter jetzt von Brünhild, der Mutter des neu gekrönten Wormser Königs besetzt. Außerdem verhalten einige Frauen sich wie von Sinnen oder fallen in Ohnmacht. Unsinniges Verhalten und Be-wusstlosigkeit waren auch Anlass für die ersten Vorhaltungen Dietrichs an Etzel
55 Damit entspricht ihr Verhalten den charakteristischen Trauergebärden auch in anderen
mittelhochdeutschen Texten (vgl. Miriam Riekenberg: Literale Gefühle. Studien zur Emotionalität in erzählender Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 2006, S. 124).
56 Vgl. beispielsweise Joachim Bumke: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 122008, S. 172-210. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich einfügen, dass ich ‚höfisch‘ als Bezeichnung für eine an den mittelalterli-chen Höfen des Adels, aber auch des weltlichen Klerus, situierte kulturelle Ausprä-gung verstehe. Diese Höfe begreife ich als Ort der Rezeption und vermutlich auch der Produktion eines Großteils der volkssprachlichen Literatur. Deshalb möchte ich ‚hö-fisch‘ gewissermaßen ‚neutral‘ verstanden wissen, da damit zunächst keine (ästheti-sche oder moralische) Wertungskategorie verbunden ist.
57 Vgl. Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 103.
NADINE HUFNAGEL 73
gewesen, jedoch wird der Terminus unsinne auch im Zusammenhang mit Diet-richs eigenem Verhalten gebraucht. Dazu kommt, dass, obwohl Dietrich das unsinnige Ohnmächtigwerden als für einen klugen Mann unpassend kritisiert, es auch bei Frauen kritisiert wird. Bei der Markgräfin von Bechelaren nämlich wird dieses Verhalten von anderen Figuren als Zeichen für abwesende zuht gewertet, also für fehlendes angemessen höfisches Handeln. Denn durch die Ohnmacht und Sinnenlosigkeit bietet man den Gästen des Hofes, welche die ankommenden Boten sind, nichts zu trinken an, wofür die Markgräfin als Gastgeberin hätte sorgen müssen (vgl. NK, 3237-3245).58 Dies lässt darauf schließen, dass die soziale Funktion der Figuren bzw. deren Nichterfüllung relevant für die Negativ-wertung des Verhaltens ist und weniger die Geschlechtszughörigkeit. Etzel und die Markgräfin sind beide Gastgeber und Herrscher am jeweiligen Handlungsort; dementsprechend beurteilt man die Markgräfin anders als andere Frauen und den Hunnenkönig anders als andere Männer. Die Kritik an der Markgräfin wird in diesem Kontext auch nicht geschlechtsspezifisch formuliert.
Richtet man das Augenmerk verstärkt auf die situativen sozialen Funktionen der Figuren, fällt auf: Obwohl Etzels Trauer zu Beginn der Handlung der Klage im Zusammenhang mit dem Tod Kriemhilds einen ersten Höhepunkt erreicht, wird er nicht als Ehemann eingeführt,59 sondern als Etzel der künec (NK, 523). Nicht Etzel, den Gatten oder Vater, sondern Etzel den künec rîchen (vgl. NK, 532f.) sieht man voller Jammer. Im weiteren Handlungsverlauf fehlt sogar häufig der Name Etzels und der Text verwendet stattdessen nur die Funktionsbezeich-nungen künec, wirt oder fürst. Auf diese Beobachtung wird später noch zurück-zukommen sein. An dieser Stelle ist bedeutsam, dass der Schaden, der in der Klage betrauert wird, Etzel folglich in erster Linie als Repräsentant des Etzelhofs betrifft, wobei es eine Unterscheidung in ‚Privatperson‘ und ‚öffentliche Person‘ dabei nicht gibt.60 Der Text verknüpft die Gemeinschaft des Hofes, ihren Hand-lungsort und ihren König aufs Engste miteinander. So ist der Etzelhof, der vor-mals Schauplatz herrschaftlicher Prachtentfaltung, höfischer Kultur und adliger Festesfreuden war, nach den Kampfhandlungen schwer beschädigt, wobei erzäh-
58 Für die Ohnmacht der Markgräfin gilt ferner Ähnliches wie für die Ohnmacht Etzels
[vgl. Anm. 42]: Das Wie-tot-Niedersinken setzt die Einheit des Herrschaftskörpers von Bechelaren über den Tod des Markgrafen hinaus ins Bild. Anders als man dies von Et-zel sicher sagen kann, stirbt die Markgräfin Rüdiger später auch tatsächlich nach.
59 Genauso wenig wird übrigens Kriemhild an dieser Stelle als Ehefrau dargestellt; sie wird weder mit ihrem Namen genannt noch als Etzels wîp bezeichnet, sondern als vrouwen wol geborn (NK, 522), was zwar auch ihr Geschlecht, vor allem aber ihren adligen Stand und ihre Rolle als Herrin betont.
60 Damit bestätigt sich Müllers anhand des Nibelungenliedes getroffene Feststellung, dass Schmerz über den Tod eines nahestehenden Menschen und Herzensleid durchaus in der mittelhochdeutschen Trauersemantik eingeschlossen, aber nicht die alleinigen oder dominierenden Bedeutungsnuancen sind, auch für die Nibelungenklage – obwohl er selbst diese Aussage in Bezug auf die Klage relativiert (vgl. Müller: Spielregeln [Anm. 1], S. 208f. und dort insbesondere auch Fußnote 15).
74 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
lerisch der Verlust des Ansehens Etzels mit der Zerstörung der Örtlichkeiten parallelisiert wird:
Daz hûs daz lac gevallen
ob den recken allen,
die durch strîten kômen drin.
dem wirte gie diu zît hin
mit leide und ouch mit sêre.
sîn hôhez lop und êre
wâren beide nider komen.
(NK, 587-593)
Das Gebäude lag zusammengefallen
auf den ganzen Helden,
die durch die Kämpfe dort hinein ge-
kommen waren.
Dem Gastgeber verging die Zeit
mit Leid und mit großem Schmerz.
Sein hohes Ansehen und sein guter Ruf
waren beide herunter gekommen.
Der zerstörte Ort verdeutlicht das Ausmaß der Katastrophe und wird gleichzeitig zum Zeichen für Etzels zerstörte Königswürde, ebenso wie umgekehrt Etzels Trauer-Verhalten Zeichen für die Schädigung des Hofes ist. Dieser Schaden ist derart groß, dass Etzel beginnt seinen Kopf und seine Hände so heftig zu winden, wie es noch nie ein König vor oder nach ihm getan hat (vgl. NK, 614-617). Den mittelalterlichen Hof muss man allerdings nicht allein als Ort, sondern vor allem als Herrschaftsverband und Hofgemeinschaft verstehen.61 König Etzels Schaden ist also nicht nur sein Verlust, sondern betrifft gleichzeitig alle, deren König er ist. Vor diesem Hintergrund wird die Tatsache, dass Etzel so laut klagt, dass die Türme und Hauptgebäude der Burg zittern (vgl. NK, 624-631), auch erkennbar als Zeichen für die Schwere des Schadens, den der Etzelhof als soziale Gemein-schaft erlitten hat. Sichtbar wird das Schadensausmaß zunächst an seinem wich-tigsten Repräsentanten und dem Ort seiner Repräsentation und dann erst im Trauer-Verhalten der Hofgemeinschaft. Denn Etzels lautes Klagen, das nicht nur akustisch weithin wahrnehmbar ist, führt erst dazu, dass diese Gemeinschaft als solche überhaupt wiederhergestellt wird: Erst auf sein weithin hör- und sichtba-res Trauer-Verhalten hin kommen immer mehr Menschen herbei und bilden durch die Performanz von, aus moderner Sicht teilweise extremem, gemeinsam, gleichförmig ausgeübtem Trauer-Verhalten eine Trauer-Gemeinschaft. Trauer um die Toten scheint das einzige verbleibende Bindeglied aller Anwesenden zu sein. Es wird auf die beschriebene Weise kollektiv getrauert und man kümmert sich um die Leichen sowie weitere Überreste des Kampfes. Des Weiteren zeigt das Entsenden von Boten, welche die Geschichte der Schlacht in die Heimat der Gefallenen bringen und verbreiten sowie mit den Empfängern der Nachricht zusammen trauern, dass der Etzelhof auch nach außen hin als Gemeinschaft handeln kann. Die sozial-kommunikative Bedeutung von Trauer macht dabei nicht nur aus den Überlebenden wieder einen gemeinsam agierenden Gruppen-
61 Vgl. Bumke: Höfische Kultur [Anm. 56], S. 71-82.
NADINE HUFNAGEL 75
verband, sondern schließt durchaus auch die Toten mit ein.62 Um einer Gruppe zurechenbar zu sein, muss eine Figur entsprechend handeln. Die Klage treibt diese Zugehörigkeit durch gemeinsames, öffentlich sicht- und hörbares Agieren auf die Spitze, wenn sie nicht nur die Zugehörigkeit zur Hofgemeinschaft, son-dern sogar die Geschlechtsidentität davon abhängig macht, denn es heißt:
swelh wîp daz versaz,
daz si den ungesunden
beweinten niht ir wunden,
daz was unwîplîcher muot
(NK, 718-721)
Welche Frau dies unterließ,
dass sie die Verletzten
wegen ihrer Wunden beweinte,
die war unweiblich gesinnt.
Dass in dieser Situation alle Frauen trauern, entfaltet wiederum kommunikative Wirkung: Hildebrand hört das laute Rufen und kommt sofort herbei. Genau an-ders herum liegt der Fall anlässlich des Fundes des Dänen Iring. Etzel, Dietrich und Hildebrand beginnen damit, Iring laut zu beklagen „alsô daz man ez wol ervant“ (NK, 1100), also so laut, dass man es gut hören konnte, und sogleich eilen Frauen herbei, um ihnen dabei zu helfen. Es erweist sich als notwendig, dass um alle getrauert wird, und dennoch wird gleichzeitig differenziert: Das Ausmaß der Trauer, das namentliche Hervorheben Einzelner aus der Masse der Gefallenen, die Benennung ihrer Herkunft, die Wiederholung der genauen Todes-umstände sowie die Aufzählung ihrer Taten, nicht zuletzt in der Schlacht am Etzelhof selbst, messen Einzelnen einen besonderen Wert bei. Da Iring ein groß-artiger Held war, steht es ihm zu, besonders betrauert zu werden, was durch lautstarke Trauer, namentliche Nennung, Herkunftsbezeichnung und Tatenschil-derung auch gewährleistet wird. Allen voran sprechen Dietrich, Etzel und Hil-debrand den toten Helden noch einmal êre zu und sichern ihnen damit auch einen besonderen Platz im Gedächtnis der Überlebenden. Die soziale Zuordnung ge-mäß der êre der Toten wird nicht nur durch das Ausmaß des Trauer-Verhaltens vorgenommen, sondern die Leichenteile werden auch nach Rang und Gruppen-zugehörigkeit sortiert und die Bestattung erfolgt je nach Status in angemessen prachtvollen Einzel- oder anonymen Massengräbern. Auf diese Weise ist das weitere Gedenken dem ursprünglichen Ausmaß des Trauer-Verhaltens entspre-chend gesichert. Soll das Trauer-Verhalten als Wertzumessungsinstrument funk-tionieren, darf es nicht bei allen gleich sein. Je nach Kontext der Figuren fallen Lob und Trauer folglich unterschiedlich aus.63 So loben beispielsweise Dietrich
62 Zum Verhältnis der Lebenden zu den Toten im Mittelalter vgl. etwa Philippe Ariès:
Geschichte des Todes, München u.�a. 71995. Um die triuwe zu den Toten zu beweisen und ihren Wert zu unterstreichen, werden die Leichen auch geküsst und liebkost, ob-wohl dies den Leuten zu Recht unangenehm ist, wie es heißt (vgl. NK, 2274-2277).
63 Dietrich beteiligt sich an der allgemeinen Trauer der Hofgemeinschaft, deren Gast er ja ist, klagt aber besonders über seinen Verbündeten und Verwandten, Rüdiger von Bechelaren und seine eigenen Gefolgsleute – ferner über ihre Gegner, unter denen er
76 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
und Etzel Gunther, Hagen und Volker als hervorragende Kämpfer und tapfere Helden, während Hildebrand Dietrich auffordert, diese und vor allem Hagen nicht zu sehr zu beklagen, da gerade sie unter den Amelungen für die größten Verluste verantwortlich gewesen seien. Dietrich weist Hildebrands Kritik jedoch mit dem Hinweis auf die Qualitäten der Toten zurück (vgl. NK, 1211-1236). Aus mehreren Gründen müssen die Feinde des Etzelhofes ebenfalls beklagt werden: Zum einen ist es auch für die eigenen Toten ehrenvoller durch besonders hervor-ragende Helden besiegt worden zu sein und zum anderen sind die feindlichen Burgunden auch durch Verwandtschaft und Freundschaft mit Etzel und Dietrich verbunden gewesen, nicht aber mit Hildebrand, der im Kampf sogar durch Ha-gen verwundet worden war.64
Die Restitution von Ordnung
Die Darstellung des Trauer-Verhaltens des wiederhergestellten Gruppenverban-des steht in der Klage deutlich im Zusammenhang mit der Restitution von Ord-nung: Dies betrifft zunächst die räumliche Ordnung, so werden die ursprünglich zusammengehörenden Körperteile einander zugeordnet, und dem Landvolk wird befohlen, nicht zwischen den Leichen herumzulungern, sondern Platz zu schaf-fen. Im selben Ausmaß stellt sich eine gewisse soziale Ordnung her, denn, wie bereits erwähnt, werden die Toten in Freund und Feind unterschieden. Bei den Aufräumarbeiten ist die klagende Gesellschaft auch wieder gemäß dem höfi-schen Rang hierarchisch organisiert: Es sind stets Etzel oder Dietrich, die Anwei-sungen geben, der ihnen untergeordnete Hildebrand oder die anwesenden adligen Jungfrauen haben andere je eigene Aufgaben, während die Aushebung des Mas-sengrabes ausdrücklich durch einfache „lantliute“ erledigt wird (NK, 2399). Ein wichtiges Element höfischer Ordnung ist auch geschlechtsspezifisches Verhalten. Dazu gehört, dass Frauen normalerweise keine Waffen tragen. Vor diesem Hin-tergrund lässt sich auch eine für die Genderperspektive interessante Textstelle erklären: Es wird beschrieben, dass Jungfrauen und verheiratete Damen sich, da es nicht genügend Männer gibt, die dies tun, um die Entwaffnung und Entklei-dung der toten Kämpfer zu kümmern beginnen. Dies scheint so außergewöhn-lich, dass explizit durch den Erzähler bekräftigt werden muss, es handle sich dabei um die Wahrheit. Die Reaktion der dieses Geschehen beobachtenden Figu-ren besteht aus noch größerer Trauer, insbesondere König Etzel beginnt so sehr zu weinen, dass alle seine vorherigen Tränen dagegen gering scheinen. Er tadelt
besonders Giselher hervorhebt, den Bräutigam der mit ihm verwandten Tochter Rüdi-gers.
64 Vgl. auch Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 103 in Bezug auf den Willehalm: „Durch die Abstufung der Intensität der Klage werden die sozialen Bindungen hierar-chisiert. Diese Rangfolge ist jedoch nicht konsistent.“ Sie hängt vielmehr davon ab, wer in welchem Kontext handelt.
NADINE HUFNAGEL 77
die jungen Männer, es schade ihrem Ansehen sehr, dass Frauen sich mit den Leichen abmühen müssten, während gesunde Männer herumstünden, die dies besser tun sollten. Als diese die Aufgabe, die Toten aus ihren Rüstungen zu be-freien, jedoch auch kaum bewältigen können, gerät er in großen Zorn und wen-det sich von der Szene ab (vgl. NK, 1591-1631). Gender ist also durchaus eine wichtige Wahrnehmungs- und Beurteilungskategorie, jedoch bezieht sie sich an dieser Stelle nicht auf Unterschiede in Bezug auf Emotionalität, sondern ist Gradmesser für soziale Ordnung. Deren Wiederherstellung bereitet, so kann man aus dieser Episode schließen, dem Etzelhof durchaus einige Schwierigkeiten.
An einer weiteren Stelle werden Trauer-Verhalten und Weiblichkeit in Ver-bindung miteinander gebracht: Als man die besten und vornehmsten unter den Verstorbenen aufgebahrt hat, kommt eine Reihe von mindestens sechsundachtzig Jungfrauen, deren eigene vornehme Abstammung von Königen und Fürsten und hervorragende höfische Erziehung stark betont werden, um die Toten zu betrau-ern (vgl. NK, 2175-2239). Dieses Verhalten hat mehrere Effekte: Zunächst kommen weitere Jungfrauen, ungefähr achtzig Grafentöchter herbei, die die Klage akustisch verstärken, mit der Wirkung, dass weitere Leute sich an der Klage beteiligen und die Toten sortieren helfen, denn jeder sucht auf dem Schlachtfeld seine Verwandten und Freunde heraus. Schließlich ist das Hauptge-bäude, das zuvor voller Leichen gewesen war, leergeräumt. Auch in dieser Szene wird also durch das Trauer-Verhalten die Ordnung räumlich, geschlechtsspezi-fisch und im Bezug auf die höfische Hierarchie hergestellt: Um die Besten trau-ern zuerst die besten Töchter und dann die meisten Leute. Der Aufräumprozess, der die Zugehörigkeit der Gefallenen berücksichtigt, wird weiter vorangetrieben.
Die Restitution der Ordnung hat eine eng mit der höfischen verwobene religi-öse Komponente. Das Totengedenken und die Gebetshilfe für die Seelen der Verstorbenen spielen in der mittelalterlichen Gesellschaft eine wichtige Rolle65, was spätestens am Verhalten des Bischofs von Passau deutlich wird, der für die Seelen der Toten die Glocken läuten, Opfer darbringen und Messen lesen lässt (vgl. NK, 3378-3391). Aber auch schon am Etzelhof werden die – zumindest hochadeligen – Toten gemäß ihrer religiösen Sitten von Geistlichen ihres jeweili-gen Glaubens bestattet, es wird gebetet und die Messe gesungen (vgl. NK, 2327-2360). Ein angemessenes Gedenken im Hinblick auf êre und christliche memoria wird auch durch das Entsenden der Boten, welche die Geschichte verbreiten, langfristig gesichert.66 Darüber hinaus markiert dieses Entsenden der Boten den
65 Vgl. Arnold Angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 42009,
S. 712-716. 66 Nicht zuletzt ist dieses Gedenken im Text als der ursprüngliche Anlass für die Abfas-
sung der Klage dargestellt: Bischof Pilgrim von Passau, heißt es, trägt Sorge dafür, dass die Geschichte schriftlich aufgezeichnet wird und somit einerseits der Nachwelt mahnend im Gedächtnis bleiben kann und andererseits für die memoria der Gefallenen gesorgt ist, bei denen es sich zum großen Teil um seine Verwandten und deren Gefol-ge handelt, denn schließlich ist er der Onkel Kriemhilds und ihrer Brüder. Explizit
78 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
Beginn der Wiederherstellung von Kommunikation und geordneten Verhältnis-sen in Bezug auf andere Höfe.67
Aus der herausgearbeiteten sozialen Zeichenfunktion des Trauer-Verhaltens, insbesondere als Gradmesser des empfangenen sozialen Schadens und damit auch des sozialen Werts der Verstorbenen sowie seiner Rolle bei der Restitution von Ordnung, wird das extreme Trauer-Verhalten Etzels verständlich: Es ist nicht Symptom (unmännlich) überbordender Emotionalität aufgrund persönlicher schwerer Verluste, sondern textintern und textextern lesbar als soziales Zeichen, als Markierung des exzeptionellen Schadens des Etzelhofes. Der Etzelhof als Ort, als Symbol für die Macht seiner Gemeinschaft und die gewaltreglementierte adelige Gemeinschaftlichkeit ist zerstört worden. Der Etzelhof als Hofgemein-schaft wurde einer Hälfte seines Herrscherpaares und des Thronfolgers beraubt und mit dem Versterben Kriemhilds sowie Blödelins, des Bruders des Königs, gleichzeitig auch der Möglichkeit in absehbarer Zeit für einen neuen Erben zu sorgen. Darüber hinaus ist die Königin einen äußerst unrühmlichen Tod gestor-ben, der schlechte Nachrede zur Folge hat (vgl. NK 556-563).68 Damit und mit dem Verlust an Gefolge und materiellen Gütern sind Etzel die Ressourcen, eine
wird darauf hingewiesen, dass er die Aufzeichnung durch liebe der neven sîn veranlas-se (vgl. NK, 4296).
67 Die ordnungsrestituierende und –stabilisierende Funktion der Trauer sowie der memoria-Gedanke könnten auch der Grund dafür sein, dass der Text auf neuzeitliche Leser stark redundant wirkt. Da der Text der Klage selbst gleichsam eine Art Trauer-Verhalten ist – auf die Anweisung bezüglich der Rezeptionshaltung im Prolog sowie die Selbstinszenierung als memoria im Rahmen der Entstehungsfiktion wurde bereits hingewiesen –, erklären sich die ritualhaft wiederholenden Schilderungen der meist ähnlichen Begebenheiten und Verhaltensweisen sowie die formelhaften Formulierun-gen. Der Wert eines Toten wird nicht nur durch das Ausmaß des Trauer-Verhaltens der Figuren bestimmt, sondern auch dadurch, wie viel Raum die Erzählung ihm einräumt, wie oft und wie ausführlich von der Trauer um ihn und seine vergangenen Taten er-zählt wird.
68 Während die Klage allerdings den Tod Kriemhilds schon gemäßigter wiedergibt – es wird ‚nur‘ von einem abgeschlagenen Kopf erzählt –, ist das Nibelungenlied drasti-scher (vgl. Nibelungenlied [Anm. 41], Str. 2376f.):
Hildebrant mit zorne zuo Kriemhilde spranc er sluoc der küneginne einen swæren swertes swanc. jâ tet ir diu sorge von Hildebrande wê waz mohte si gehelfen daz sie sô grœzlîchen schrê? […] ze stücken was gehouwen dô daz edele wîp.
Hildebrand sprang mit Kampfeszorn zu Kriemhild, er versetzte der Königin einen schweren Schlag mit dem Schwert. Ja, diese Fürsorge Hildebrands bereitete ihr Schmerzen. Was konnte es ihr helfen, dass sie so gellend schrie? […] Da war die edle Frau in Stücke gehauen.
NADINE HUFNAGEL 79
neue Königin für seinen Hof zu gewinnen, weitgehend genommen. Des Weiteren ist Rüdiger, einer seiner treuesten und mächtigsten Vasallen, in seinem Dienst umgekommen, ebenso wie viele andere Helden, die am Hof weilten. Nicht zu-letzt bedeutet auch der Tod der Festgäste einen weiteren Schaden für den Etzelhof und sein soziales Ansehen. Dieser überaus große Schaden zeigt sich am Ort, am Verhalten der gesamten Hofgemeinschaft, besonders auch an dem Etzels. Warum aber kommt es dann zur eingangs dargestellten Kritik Dietrichs an Etzel?
Die Problematik von Etzels Trauer-Verhalten
Der Kontext der Textstelle zeigt deutlich, dass Etzel von Dietrich vor allem in seiner Funktion als König kritisiert wird. An den König richtet sich nämlich der Tadel Dietrichs bezüglich des Niedersinkens Etzels, als ob er selbst auch tot wäre, nachdem er die Leiche Kriemhilds betrauert hat:
Er und meister Hildebrant
gie, dâ er den künec vant. […]
‚Ach, wê dirre maere,
gevreischet man diu in daz lant,
daz ir mit wintender hant
stêt als ein bloede wîp,
diu ir zuht und ir lîp
nâch vriunden sêre hât gesent!
des sîn wir von iu ungewent,
daz ir unmanlîche tuot.‘
(NK, 1013-1025)
[Hervorhebung von NH]
Er und Meister Hildebrand
gingen dorthin, wo er den König fand.
‚Ach, weh wegen dieser Geschichte,
wenn man im Land vernimmt,
dass Ihr mit ringenden Händen dasteht
wie eine schwache Frau,
die durch ihr Benehmen und ihr Aussehen
heftig um Beistand bittet!
Das sind wir von Euch nicht gewohnt,
dass Ihr Euch so unmännlich verhaltet.‘
Etzel wird also ausdrücklich als König kritisiert. Als solcher solle er unterlassen, was nicht nützlich sei, lautet Dietrichs Rat (vgl. NK, 850-857), denn der Tod bzw. schon die Inaktivität des Königs schadeten dem Hof weiter.69 Ein Verharren des Oberhauptes in dieser Handlungsunfähigkeit bedeutet im Grunde sogar das Ende von dessen sozialer Existenz: Ist der König dauerhaft inaktiv, verharrt auch der Hof im Zustand der Katastrophe und die Gemeinschaft würde sich vermut-lich nach und nach auflösen. Bezeichnenderweise löst der Rat Dietrichs dann auch Etzels erste Handlung in der Klage aus: Er weist an, den toten Ortlieb ne-ben die Leiche seiner Mutter zu legen, also mit der Restitution der Ordnung zu beginnen. Die Bemerkung, Etzel verhalte sich nicht wie ein kluger Mann, kann sich folglich nicht an dessen vermeintlich unmännlich starker Emotionalität orientieren, sondern markiert den Verlust von Herrscherqualitäten. Ideal wird
69 Vgl. die Kritik an der Markgräfin von Bechelaren.
80 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
höfische Herrschaft in Gestalt des Herrscherpaares mit je genderspezifischer Aufgabenverteilung ausgeübt, jedoch fehlt nach dem Tod Kriemhilds dem Etzelhof der weibliche Part, welcher auch – im Gegensatz zum männlichen – nicht mehr reaktivierbar ist. Übergangsweise gibt es jedoch auch Höfe mit nur einem Herrscher, wobei ein Hof unter rein weiblicher Führung relativ instabil scheint, wie die Sorge der jungen Markgräfin und ihre Hoffnung auf baldige Heirat sowie die rasche Krönung des männlichen Erben in Worms nahelegen. Herrschaftshandeln ist in der Klage primär männlich konnotiert, dabei aber durchaus nicht ausschließlich auf Männer beschränkt, wie z.�B. das Handeln Brünhilds in Worms belegt. Die Bezeichnung ‚unmännlich‘ unterstreicht die Kritik an Etzels Herrscherqualitäten: Dietrich nutzt an dieser Stelle das Ge-schlecht, um zu betonen, dass es um den sozialen Status, den Grad der Abhän-gigkeit geht, denn während Frauen als rechtlich Abhängige zur Bewältigung einer großen Katastrophe auf jeden Fall auf die Hilfe von Verbündeten angewie-sen sind, wäre es Etzels Aufgabe als König, diese Hilfe zu liefern. Ein Bekannt-werden des Verhaltens Etzels, vor dem Dietrich explizit warnt, würde sich nicht nur weiter negativ auf den Ruf, das soziale Ansehen Etzels und der Hofgemein-schaft auswirken, sondern auch deren Hilfsbedürftigkeit und Angreifbarkeit nach außen hin lesbar machen, was in der erzählten agonalen Welt des Textes verhee-rende Folgen hätte. Eine Deutung, dergemäß Etzel als Mann stark und rational zu sein hätte, während Frauen nun einmal stärker emotional sind, greift also zu kurz. Dies erkennt man auch daran, dass Dietrich, der ja keine Frau ist, Trost von Etzel einfordert, während er in der Interaktion mit sozial Schwächeren, wie den höfischen Jungfrauen am Etzelhof oder der Tochter Rüdigers von Bechelaren, selbst zum Trostspender in seiner Funktion als Fürst, Verwandter oder Freund wird, denn zu den von Etzel geforderten Herrscherqualitäten gehört auch das Spenden von Trost. So folgt Dietrichs Forderung direkt auf seine kritische Äuße-rung und wiederum an den König gerichtet,70 wobei die Formulierung bereits weniger auf den Ist-Zustand Etzels, sondern auf das Ideal der Funktionsrolle verweist:
nû solt ir, edel künec guot,
troesten vriuntlîche
Nun sollt Ihr, edler, guter König,
mich armen Dietrich
70 Und dies tut er nicht zum letzten Mal, vgl. z.�B. NK, 1041-1045 [Hervorhebung von
NH]:
Dô sprach der Bernaere ‚her künec‘, lât iuwer swaere, und tuot dem gelîche, ob ir Dieterîche welt helfen von der nôt […].
Da sprach der von Bern: Herr König, lasst ab von eurem schmerzlichen Verlust und verhaltet euch wie jemand, der Dietrich in seiner Notsituation helfen wollte [...].
NADINE HUFNAGEL 81
mich armen Dieterîche
(NK, 1026-1028)
wie einen Verbündeten trösten.
Trost besteht in der Klage auch weniger in persönlichem emotionalen Beistand, sondern umfasst z.�B. das förmliche Versprechen von Solidarität oder des Arran-gements einer Heirat. Trotz seiner kommunikativen Funktion muss Trauer-Verhalten schließlich auch endlich sein, ein Umstand, auf den in der Klage von verschiedenen Seiten explizit hingewiesen wird (vgl. NK, 3439-3447).71 Es wür-de wohl zu weit gehen zu sagen, dass sich durch das Spenden von Trost durch Dietrich für Etzel die soziale Hierarchie umzukehren beginnt, doch markiert es eindeutig den Anfang vom Ende der Attraktivität des Etzelhofes für einen land-fremden Helden wie Dietrich. Zum einen kann Etzel aufgrund des enormen Aus-maßes des Schadens des Etzelhofes keinen wirklichen Trost mehr finden, zum anderen fehlt ihm als Heiden der Zugang zur Quelle, aus der letztendlich alle anderen Figuren des Textes Trost ziehen können: der christliche Gott.72 Etzel beschuldigt sich selbst des Verrats an Gott und deutet die Katastrophe als Gottes Strafe für seine Rückkehr zum Heidentum (vgl. NK, 948-1008). Eine Möglich-keit, die Gnade Gottes zu erlangen, scheint er für sich auszuschließen (vgl. NK, 976-981).73 Sein Heidentum und die daraus abgeleitete Deutung des Geschehens verknüpft Etzel auch explizit mit seiner Unfähigkeit, Trost zu spenden und
71 Oder auch NK, 1577f.:
Dô si genuoc geklagten die, die sie vunden heten hie […].
Als sie diejenigen genug beklagt hatten, die sie hier gefunden hatten […].
72 Gott wird mehrfach als Letztbegründung für Trost angeführt, beispielsweise in NK,
3212f.:
die müezet ir alle verklagen, wand got der weisen vater ist.
Die sollt Ihr nicht länger beklagen, denn Gott ist der Vater der Waisen.
Ein weiteres Beispiel findet sich an der Stelle, an der Bischof Pilgrim von Passau rät, von Klagen, die den Ablauf der Messe stören, abzulassen und stattdessen „nâch kristenlîchem orden“ zu trauern (V. 3381).
73 Der Erzähler lässt die Deutung der Figur Etzel unkommentiert, sie wird weder bestä-tigt noch kritisiert; vgl. hierzu auch Marianne Sammer: Nibelungenlied und Klage zwi-schen Moraltheologie und Liturgie, in: Moser, Sammer: Nibelungenlied und Klage [Anm. 4], S. 169-200, hier: S. 178f. Sammer deutet das Nibelungenlied ausschließlich vor der Folie dogmatischer Kirchentheologie; ein Ansatz, der nicht unproblematisch ist, aber gerade im Hinblick auf die zitierte Textstelle interessante Anregungen zu ge-ben vermag. Vgl. zur Thematik des christlichen Deutungshorizonts in der Klage auch meinen Beitrag im Tagungsband zum Symposium Gottes Werk und Adams Beitrag des Mediävistenverbandes 2011 in Jena [im Erscheinen].
82 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
gleichzeitig mit der Ablehnung seine Funktion als König in Zukunft noch auszu-üben:
Er sprach:‚wie sold ich geben trôst?
jâ bin ich alles des belôst,
daz ich zer werlde ie gewan, […]
mich hât mit unminne
der gotes haz bestanden.
ich was in mînen landen
gewaltec und rîche.
nû stên ich jâmerlîche,
reht als ein arman,
der nie huobe gewan.‘
(NK, 1029-1040)
Er sprach: ‚Wie sollte ich
Trost spenden?
Ja, habe ich doch alles verloren,
was ich auf der Welt hatte […]
Mich hat ohne Erbarmen
der Hass Gottes getroffen.
Ich war in meinen Ländern
einflussreich und mächtig,
nun stehe ich trauernd da,
wie ein armer Mann,
der nie ein Stück Land besessen hat.‘
Alle Handlungsmöglichkeiten, die Etzel für sich selbst noch sieht, sind die eines armen Mannes ohne Landbesitz. Dass er nach seiner Ohnmacht von seinem Gefolge ausdrücklich gebeten wird, sich zu trösten und das Leben nicht zu ver-lieren, verdeutlicht zum einen wiederum, wie wichtig der Zustand des obersten Repräsentanten für den gesamten Hof ist, zum anderen, wie dysfunktional Etzel in seiner Funktion als König mittlerweile ist.74 Denn solange Etzel König ist, repräsentiert er den Zustand der ganzen Hofgemeinschaft: Kann er sich nicht trösten, kann es keiner, der sich dieser Gemeinschaft weiterhin zurechnet.75 Denn Trauer ist, was bereits Koch anhand des von ihr untersuchten Textkorpus heraus-
74 Vgl. Horst Wenzel in der Einleitung zu seiner Aufsatzsammlung Höfische Repräsenta-
tion. Symbolische Kommunikation und Literatur im Mittelalter, Darmstadt 2005, S. 9-20, hier: S. 11: „In einer Gesellschaft, in der es noch keinen Ausweis gibt, muß der Mensch sich durch die Darstellung dessen ausweisen, was er ist oder zu sein bean-sprucht. Repräsentatives Herrschaftshandeln verlangt die sinnlich erfahrbare, sichtbare, hörbare, fühlbare und greifbare Darstellung von sozialem Rang, von tatsächlichen oder auch angemaßten Statuspositionen.“
75 Vgl. auch Riekenberg: Literale Gefühle [Anm. 55], S. 62: „Wie sich in der Textanaly-se gezeigt hat, hat Freude innerhalb einer Hofgesellschaft zudem insofern große Rele-vanz, als sie ausdrückt, dass die Gemeinschaft, angeleitet von einem Herrscher, vor-bildlich funktioniert. […] Freude [stellt] demnach keine Emotion auf zwischenmensch-licher Basis dar, sondern wird in erster Linie als das einem Kollektiv, einer Gefolg-schaft zugrunde liegende Phänomen dargestellt. […] Freude ist augenfällig eng an die Herrschaftsrepräsentation gekoppelt und soll Stärke und Macht bzw. die unangreifbare Einigkeit und Einheit zwischen König und Gefolgsleuten demonstrieren.“
NADINE HUFNAGEL 83
arbeitet, extrem affizierend.76 Dabei schadet die extreme Klage den Überle-benden enorm, denn es heißt, dass die Gesunden von der Klage krank werden (vgl. NK, 1644f., 2200f.). Dabei hätte auch gegenseitiges Trostspenden gemein-schaftskonstituierende Funktion und würde weitere gemeinsame Anschluss-handlungen möglich machen, wie das Beispiel des Burgundenhofes in Worms zeigt: Die Witwe Gunthers zeigt ebenfalls dem Schaden ihres Hofes entspre-chendes extremes Trauer-Verhalten, wird jedoch dann von den Gefolgsleuten des Wormser Hofes getröstet. In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass Trauern Pflicht ist und gemeinsame Trauer tröstet (vgl. NK, 3726-3737). Hier entfaltet das gemeinsame Trauern und Trösten dann ebenfalls eine neue Hand-lungsfähigkeit des Hofes. Zwar werden auch am Etzelhof im Anschluss an Etzels Ohnmacht Begräbnisse durchgeführt und Messen gelesen, die Veranlassung hierzu geht allerdings wieder direkt oder indirekt von Dietrich aus. Das wegen des großen Schadens notwendige Trauer-Verhalten des Etzelhofes wirkt dagegen in seinem extremen Ausmaß immer wieder isolierend, verfehlt demnach gerade seine sozial kommunikative Funktion und ist aufgrund von Etzels heidnischer Verzweiflung ausweglos:
Sît in vreude niht gezam,
niemen des andern war nam
der, die noch lebende wâren.
Etzeln man gebâren
vil ungüetlîche vant.
dô er ze ietweder sîner hant
der guoten recken niht ensach,
Da ihnen jegliche Freude nicht zustand,
nahmen sich die, die noch am Leben
waren, einander nicht wahr.
Man fand, dass Etzel sich sehr
unfreundlich gebärdete,
weil er sich nicht um die guten Helden
kümmerte, die ihn umgaben.
76 Vgl. Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], z.�B. S. 287. Dieser affizierende Effekt der
Herrschertrauer zeigt sich beispielsweise in NK, 652-659:
swie lût ie der künec schrê, die vrouwen schrîten allez mite. ez ist ouch noch der liute site: swâ einem leit ze herzen gât, daz der ander vreude bî im lât. alsô wart dâ vreude lâzen. daz volc âne mâzen die klage ie groezer machten.
Wie laut auch der König schrie, die Damen schrien immer ebenso. So ist es auch noch Brauch bei den Leuten: Wo einem das Leid ans Herz geht, da lässt ein anderer höfische Freude bleiben. Also gab es dort keine höfische Freude mehr. Das maßlose Gefolge machte die Klage also größer.
Die Maßlosigkeit des Trauer-Verhaltens der Etzelhofgemeinschaft wird auch in den Folgeversen dadurch unterstrichen, dass die Glieder der Frauen vor Händewinden laut krachen. Darüber hinaus werden bei den Aufräumarbeiten die Lebenden und die Toten immer ähnlicher: Etzel z.�B. sitzt im Blut, wie die Gefallenen darin liegen (NK, 1781f.), und beim Versuch, den toten Körper Rüdigers aus dessen Blut zu heben, bricht Hildebrands eigene Wunde wieder auf und der Held sinkt kraftlos und leichen-blass neben der Leiche zu Boden (NK, 2195-2107).
84 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
[…]
Dietrîch sprach: ‚jâ sult ir lân
iuwer grôze ungehaben.
sine sint niht alle noch begraben,
die iu ze dienste sint gewant.
[…]
got mac iuch ergetzen
genaedeclîch der leide.
ir habt doch noch uns beide,
mich und Hildebrande,
bî iu in dem lande.‘
‚Waz hilfet daz‘ sprach er dô. ‚
‚ine kunde nimmer werden vrô,
und sold ich tûsent jâr leben.‘
(NK, 2431-2457)
[…]
Dietrich sprach: ‚Ja, Ihr sollt Eure
große Trauer sein lassen.
Sie sind noch nicht alle begraben,
die Euch zu Diensten sind:
[…]
Gott kann Euch von dem Leid
gnädig erlösen.
Ihr habt außerdem noch uns beide,
mich und Hildebrand,
hier in Eurem Land.‘
‚Was hilft das?‘ sprach er darauf.
‚Ich könnte niemals mehr froh werden,
selbst wenn ich tausend Jahre leben würde.‘
Etzel kann aufgrund seines (heidnischen) Trauer-Verhaltens die Lage nicht mehr richtig einschätzen und sagt sich auf Dauer von höfischer vreude los.77 Nach dieser Rede zählt Etzel dann erneut auf, welchen Schaden der Hof erlitten hat, und beginnt wieder zu weinen und zwar, wie der Text betont, als ob er gerade erst damit angefangen hätte. Die Klage beginnt also immer wieder wie von vorn. Das Trauer-Verhalten entspricht zwar ausdrücklich dem Maß des Verlustes, wird für den Etzelhof allerdings gewissermaßen zur Sackgasse. Durch die im Nibe-lungenlied geschilderte Katastrophe ist ihm ein zu großer Schaden entstanden.78 Es verwundert kaum noch, dass Dietrich und Hildebrand nicht mehr länger am Etzelhof verweilen möchten. Ein letztes Mal gelingt es Dietrich zwar im An-schluss, Etzel zu einer wichtigen kommunikativen Handlung zu bewegen, näm-lich zum Entsenden der Boten, aber nach der Rückkehr derselben scheinen die über immerwährende Trauer hinausgehenden Handlungsmöglichkeiten des Etzelhofes endgültig erschöpft. Nachdem Etzel noch einmal ausspricht, dass dort keine höfische Gemeinschaft mehr möglich ist, brechen trotz seiner wiederholten Bitten, zu bleiben, Dietrich, die Dame Herrat und Hildebrand auf. Dieser Auf-bruch bedeutet erneut einen Schaden für den Etzelhof, da nicht nur für alle offen-bar wird, dass er jegliche höfische Anziehungskraft verloren hat, sondern auch, weil dem Hof noch mehr Ressourcen höfischer Repräsentation entzogen werden: Es wird beschrieben, dass Herrat viele adelige Jungfrauen, Prachtsättel, Stoffe und Ähnliches mit sich nimmt. Für Etzel als König und seinen Hof ist dies gleichbedeutend mit dem sozialen Tod:
77 Zur Bedeutung höfischer vreude vgl. auch Anm. 75. 78 Vgl. auch Koch: Trauer und Identität [Anm. 12], S. 136: „Explizite Normkonflikte
sind in Trauerdarstellungen in der Literatur um 1200 immer wieder festzustellen, so auch zwischen Trauer um Verwandte und der Herrscherpflicht.“
NADINE HUFNAGEL 85
Dô si zem wirte urloup genâmen,
und ê si ûz dem hove quâmen,
der künec viel nider vür tôt.
im gap der jâmer sölhe nôt,
daz er die sinne niht behielt
und sô kranker witze wielt,
daz er unversunnen lac.
lebt er sît deheinen tac,
des het er doch vil kleinen vrumen,
wande im was an sîn herze kumen
diu riuwe alsô manecvalt,
daz in daz leit mit gewalt
lie selten sît gesprechen wort.
(NK, 4183-4195)
Weil sie von ihrem Gastgeber Abschied
nahmen, bevor sie aus dem Hof heraus
waren, brach der König wie tot zusam-
men.
Ihm verursachte die Klage solche Not,
dass er seine Sinne verlor
und so schwachen Verstandes war,
dass er besinnungslos da lag.
Lebte er seitdem noch einen Tag,
hätte er davon doch nur sehr wenig,
denn ihm war so viel Schaden
bis ins Zentrum gedrungen,
dass ihn die gewaltige Trauer
seither kein Wort mehr sprechen ließ.
Infolgedessen wird Etzel einfach zurückgelassen und von niemandem mehr be-achtet, sein Trauer-Verhalten verliert endgültig seine kommunikative Funktion, verkehrt sich sogar ins Gegenteil, bleibt aber für den Rezipienten der Klage als Zeichen für die existenzauslöschende Schädigung des Etzelhofes lesbar. Über dessen weiteres Schicksal weiß der Erzähler konsequenterweise nichts mehr zu berichten. Diese Tatsache, dass man von Etzel nicht einmal sagen kann, wie und wann er gestorben ist, wird allerdings am Ende der Klage noch einmal recht ausführlich dargelegt, was einerseits den Kontrast zum Fall Utes und der Mark-gräfin unterstreicht und andererseits verdeutlicht, dass Etzel nicht aufgrund man-gelnder Männlichkeit infolge exzeptioneller Emotionalität, sondern aufgrund des Verlustes seiner Funktion als oberster Repräsentant des Etzelhofes vollkommen aus der Geschichte verschwindet.
Die Untersuchung der Darstellung von Trauer-Verhalten in der mittelhoch-deutschen Nibelungenklage hat zunächst gezeigt, dass die Zuordnung weiblich-emotional, männlich-rational für diesen mittelalterlichen Text in dieser Form nicht zutrifft. Für die Bewertung des Trauer-Verhaltens der Figuren, das ver-schiedene Funktionen wie Herstellung und Darstellung von Identität, gesell-schaftlichem Rang und sozialen Beziehungen erfüllt, haben sich vielmehr ihr sozialer Status und das Ausfüllen ihrer Funktionsrolle innerhalb der höfischen Gemeinschaft als entscheidend erwiesen. In diesem Rahmen spielt dann auch genderspezifisches Verhalten durchaus eine Rolle. Eine generelle genderspezifi-sche Differenzierung von Trauer-Verhaltensweisen oder deren Intensität konnte jedoch nicht festgestellt werden.
Die Zeichenhaftigkeit des dargestellten Trauer-Verhaltens ist textintern für die anderen Figuren lesbar, aber auch für die textexternen Rezipienten, da der literarische Text bei der Darstellung des Trauer-Verhaltens der Figuren letzten Endes – trotz besonderer ästhetischer Voraussetzungen und Funktionen – an die
86 DIE DARSTELLUNG DER TRAUER KÖNIG ETZELS
Vorstellungswelt eines Publikums gebunden bleibt, um Sinn erzeugen zu kön-nen.79 Die Anbindung der Figurendarstellung an die Vorstellungswelt der Rezipi-enten bedeutet aber nicht, dass sich die historischen Rezipienten derselben Dar-stellungsmodi, wie sie von den Figuren des Textes angewandt werden, bedient haben oder die Darstellung der Trauer-Darstellung auf sie ähnlich affizierend gewirkt haben muss wie das Trauer-Verhalten der Figuren auf die anderen Figu-ren. Auch Textstellen, wo die Erzählinstanz auf die emotionalen Reaktionen eines impliziten Rezipienten Bezug nimmt oder Publikumsreaktionen vorweg-nimmt, wie dies beispielsweise im Klage-Prolog der Fall gewesen war, lassen nur sehr vorsichtige Rückschlüsse auf tatsächliches Rezeptionsverhalten zu.80 Bekannterweise bilden literarische Texte Weltwissen nicht nur ab oder speichern dieses, sondern ermöglichen auch reflexive Distanzierung von gesellschaftlichen Verhaltens- und Wertungsmustern sowie einen experimentellen Umgang damit. Es ist anzunehmen, dass sie dadurch auch eine Wirkung auf die Verhaltens- und Denkweisen ihrer Rezipienten entfalten können.81 Dass zumindest moderne Rezipienten wenig Verständnis für die Darstellung des Trauer-Verhaltens in der Klage aufbringen und ein Mitvollzug desselben wohl eher nicht in Frage kommt, belegt ein offenbar ironischer „Schreibervermerk“ zur Klage in der Jenaer Nibe-lungenhandschrift von 1882:
o verdammt� langweilig� blœdsinn! wær es niht d’vollstændigkeit wegen, ich
schriebe dieses ia⊥�gewæsch nimm� zv ende!82
79 Vgl. auch Schnell: Erzähler – Protagonist – Rezipient [Anm. 28], S. 16. Die jüngere
Rezeptionsforschung betont dabei, dass Rezipienten auf Figuren nicht wie auf ihre Mitmenschen emotional reagieren, sondern auf die textuelle Figurendarstellung und ihre auf dieser Basis entwickelten Figurenvorstellungen (vgl. z.�B. den Beitrag des Medien- und Kommunikationswissenschaftlers Jens Eder: Drei Thesen zur emotiona-len Anteilnahme an Figuren, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 54 (2007), H. 3, S. 362-378).
80 Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass literarische Darstellungskonventionen und ihre Evolution nicht notwendigerweise mit außerliterarischen Entwicklungen korrelieren. Um diese Entwicklungen im 12. und 13. Jahrhundert geht es Riekenberg: Literale Ge-fühle [Anm. 55]. Die Arbeit liefert einige interessante Textbeobachtungen und ist eine Fundgrube für literarisch-sprachliche Mittel, mit denen in acht mittelhochdeutschen epischen Texten Zorn, Freude, Trauer und Angst dargestellt werden. Die Schlüsse, die Riekenberg zieht, sind m. E. allerdings kritisch zu hinterfragen.
81 Vgl. Koch: Bewegte Gemüter [Anm. 18], S. 45f. 82 Jenaer Nibelungenhandschrift von Heinrich Wansleben, Kiel 1882 (Ms. Prov. f. 255,
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek). Es handelt sich bei der bisher nicht edierten Papierhandschrift, welche den Text des Nibelungenliedes und der Nibelun-genklage enthält, um die gelungene Imitation einer mittelalterlichen Handschrift mit Stilelementen des 13. und 15. Jahrhunderts. Die einzige mir bekannte Veröffentlichung stellt Jens Haustein, Susanne Zimmermann: ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘ in einer Je-
NADINE HUFNAGEL 87
naer Handschrift des 19. Jahrhunderts aus dem Besitz des Medizinhistorikers Theodor Meyer-Steineg, in: Septuaginta quinque. Festschrift für Heinz Mettke, hg. von Jens Haustein, Eckhard Meineke und Norbert Richard Wolf, Heidelberg 2000, S. 191-200 dar. Für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Informationen zu diesem weit-gehend unbekannten Schriftstück bedanke ich mich herzlich bei Dr. Joachim Ott von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek.
Julia Bohnengel
„Lieben und nicht wieder geliebt werden – Ha! Das ist eine Hölle.“ Zur Wandlung von Männlichkeitsbildern im europäischen Herzmaere-Stoff1
Unter den Sturm-und-Drang-Autoren ist der in Kreuznach geborene Friedrich Müller, gen. Maler Müller, bekanntlich von der Literaturgeschichtsschreibung weitgehend vernachlässigt worden, obwohl er ein erstaunliches Doppeltalent als Schriftsteller und Maler besaß. Dass sein literarisches Werk vor allem in lokal-historischen Zusammenhängen untersucht wurde und ihm darüber hinaus ver-gleichsweise wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, mag auch mit seiner frühen Abreise aus Deutschland zusammenhängen. Bereits 29-jährig verließ Müller seine Heimat und lebte fortan in Rom, wo er vom deutschen Literaturbe-trieb abgeschnitten war, so dass viele seiner literarischen Projekte unabgeschlos-sen blieben. Aus seiner Mannheimer Zeit, die in die Jahre unmittelbar vor der Abreise nach Rom zwischen 1769 und 1778 fällt, stammt auch ein Dramenfrag-ment, das im Zusammenhang mit Männlichkeitsentwürfen am Ende des 18. Jahrhunderts nähere Beachtung verdient.2 Es besteht im Wesentlichen aus dem hier folgenden Monolog einer männlichen Figur mit Namen Fayel:
Fayels Schloß.
Der Garten.
Fayel allein.
Lieben und nicht wieder geliebt werden – Ha! Das ist eine Hölle. Um Barmher-
zigkeit flehen, und sich verstoßen sehen, ist hart. Seine Ehre verliehren und mit
dem Gefühl dieses Verlusts schwerer als mit Welten beladen sich schleppen, bis
irgend ein scheußliches Grab, in einer der Sonne unbekannten Gegend, uns und
unsere Last einnimmt, dieser Gedancke hat Raserey, und doch könnte ich mich in
allem diesem Unglück trösten oder wenn ich mich nicht trösten könnte, so habe
ich ja Hände, und ein Stück Eisen meine Seele aus Ihrem Käffig zu lassen. Aber
aus der ganzen Natur sich ein Geschöpf erwehlen, nichts sehen nichts fühlen
1 Der Aufsatz ist aus einem größeren Projekt zur Erforschung des europäischen Herz-
maere-Stoffes hervorgegangen. 2 Friedrich Meyer: Maler Müller-Bibliographie, Leipzig 1912, S. 137 (dort wird das
Fragment seiner „frühen Mannheimer Zeit“ zugeordnet); zur neueren Forschungslitera-tur siehe auch Rolf Paulus und Eckhard Faul: Maler-Müller-Bibliographie, Heidelberg 2000.
90 MÄNNLICHKEITSBILDER IM EUROPÄISCHEN HERZMAERE-STOFF
nichts wissen, als dasselbe, ganz mit ihm erfüllt so voll davon seyn daß man um
nicht zu ersticken, dem Mund kein anderes Geschäffte als Athemholen, (welches
der unwissende Pöbel bey verliebten seufzen heißt) geben kann und von dem Ge-
schöpf sich verachtet sehn kan. O die gefallene Engel haben keine solche Qual.
Und doch giebt es noch eine ärgere. Wann diejenige die ich liebe gar nichts liebet,
so ist sie nicht besser als ein kalter Marmor, durch das Genie des Künstlers, zum
Menschen geschaffen und als eine solche kan ich doch wenigstens, wie ein Mar-
mor Bild, durch Geld, oder durch den Altar mein eigen machen, und auf meiner
Seite doch meine Liebe an ihr auslassen. Aber wenn in dem Herzen, daß ich mir
erwehle, ein anderes Bild eingegraben ist, und hoffnungslose Liebe mit Eifersucht
vereinigt wird, o die verdammten dencken sich dieses, und zittern für gröserer
Qual. Und doch – Heilige Mutter Gottes, womit hab ich es verschuldet, – und
doch ist diß beynah mein Fall. Mein Fall! Gütiger Gott! Mein Fall! Wie mich die-
ser Gedancke niederschlägt. Mein Kopf schmerzt mich, meine Augen brennen wie
Feuer und sehen alles so oft, daß die Natur wieder zum Chaos geworden ist, mei-
ne Zähne fahren für Schrecken aufeinander, und ihr Geklapper sagt mir, daß wenn
dieser Gedancke wahr wäre, meine Seele und mein Körper mit dem Sinn der gan-
zen Welt zugleich ins Nicht seyn sincken würden. O Gabrielle, ich bin ein Ritter
und die weite Welt spricht von meinen ritterlichen Tugenden, und sezt mich jun-
gen Leuten zum Muster. und du allein liebst mich nicht. Ich bin edel, aber ich kan
auch unedel seyn. Es ist gewis, daß mich meine Frau nicht liebt und daß sie einen
andern liebt, schließ ich aus ihren Thränen, und aus ihrer Melancolie, die mich in
Verzweiflung bringt3.
Deutlich geht aus dieser Textpassage hervor, dass Fayel als Ritter und zugleich als ‚großer Kerl‘ gezeichnet ist, der gerade deshalb verletzlich erscheint, weil er so stark empfindet.
In seiner Rede erforscht Fayel im Garten vor seinem Schloss das Unglück von Menschen, die lieben, ohne auf Gegenliebe hoffen zu dürfen. Obwohl seine Überlegungen in zeittypischer ‚Kraftsprache‘ gefasst sind und Züge eines spon-tanen Gefühlsausbruchs tragen, ist der Monolog klar strukturiert. In einer drei-stufigen Klimax analysiert Fayel die Spielarten unerwiderter Liebe: „Lieben und nicht wieder geliebt werden“, so beginnt er, sei „eine Hölle [Hervorhebung von JB]“, bedeute aber nur einen ersten Grad von Leiden, obwohl diese schon auf
3 Der Text ist konstituiert nach der diplomatischen Transkription des Fragments in
Reiner Wild: Fayels Schloß. Eine bisher unveröffentlichte Dramenszene von Friedrich Müller, gen. Maler Müller, in: Verstehen durch Vernunft. Festschrift für Werner Hoff-mann, hg. von Burkhard Krause, Wien 1997, S. 409-418. Da Maler Müller im Herbst 1776 einen Großteil seiner Manuskripte verbrannte, geht Wild von einer Entstehungs-zeit zwischen 1776 und 1778 aus; zwingend ist dieser Zusammenhang allerdings nicht, zumal in dem in Frage stehenden Konvolut mit überlieferten Manuskripten auch ein späteres, in Rom entstandenes Blatt enthalten ist (vgl. Bernhard Seuffert: Maler Mül-ler, Berlin 1877, S. 60).
JULIA BOHNENGEL 91
dieser ersten Stufe extrem und kaum überbietbar erscheinen. Müller reiht dabei Hyperbel an Hyperbel und benennt in dichter Verwendung rhetorischer Tropen und Figuren auch Paradoxien: So sei es gerade der damit verbundene Verlust der Ehre, der eine Last bedeute und schwerer zu tragen sei, als – hier spielt er auf den mythischen Weltenträger Atlas an – „mit Welten beladen sich [zu] schlep-pen“.
Doch schlimmer noch, als nicht wiedergeliebt zu werden, sei (auf einer zwei-ten Stufe) die Verachtung des geliebten Geschöpfs. Denn Liebe, wie sie hier verstanden wird, ist absolut und ausschließlich, was den Liebenden betrifft wie das geliebte Gegenüber: „aus der ganzen Natur sich ein Geschöpf erwehlen“ heißt es, und: „nichts sehen nichts fühlen nichts wissen, als dasselbe, ganz mit ihm erfüllt so voll davon seyn daß man um nicht zu ersticken dem Mund kein anderes Geschäfte als Athemholen […] geben kan“. Liebe bedeutet in dieser Perspektive eine vollkommene Verschmelzung zweier Individuen, die notwendi-gerweise die Existenz des Liebenden bedroht, sobald der Andere mit Gering-schätzung reagiert. Denn die Vergewisserung der eigenen Identität ist ausschließ-lich an die Sicht des Anderen, weil Einzigen gebunden.
Doch auch mit dieser zweiten Stufe – mit der Verachtung durch den geliebten Menschen – ist für Fayel noch nicht die höchste Form des Leidens erreicht. Eine nochmalige Steigerung ist dann gegeben, wenn zur Liebe Eifersucht kommt und das liebende Ich nicht nur fürchten muss, dem geliebten Gegenüber gleichgültig zu sein, sondern „wenn in dem Herzen, daß ich mir erwehle, ein anderes Bild eingegraben ist“. Dann droht in zeittypischer Definition der Eifersucht als einer körperlich erfahrbaren Krankheit das Ich und mit ihm die ganze Welt endgültig ins „Nicht seyn“ zu sinken.4
Die Klimax von Gleichgültigkeit über Verachtung hin zur Abwendung des geliebten Wesens, das einer anderen Person zugehören will, ist nicht ganz linear durchgeführt. Wenn dies zum einen auf den Entwurfscharakter des Monologs deutet5, so mag es zum anderen auch mit eher zeichnerischen Vorstellungen zu tun haben; anstelle von Abstufungen kann man daher auch von Schattierungen des Unglücks eines vergeblich und einseitig Liebenden sprechen. Die in diesem Sinne dunkelste Stelle – die Gewissheit, dass die erhoffte Gegenliebe einem anderen gehört – vergleicht Fayel am Ende seiner Klimax mit dem eigenen
4 Stellvertretend für die ausführliche zeitgenössische Diskussion sei auf den Artikel
Jalousie von Louis de Jaucourt aus dem achten, 1765 erschienenen Band der Ency-clopédie von Diderot und D’Alembert sowie für den deutschsprachigen Raum auf fol-genden Artikel verwiesen: [Karl Friedrich Pockels:] Zur Seelennaturkunde. Materia-lien zu einem analytischen Versuche über die Leidenschaften […]. Eifersucht, in: Ma-gazin zur Erfahrungsseelenkunde, 6. Bd., 3. St., 1788, S. 52-75.
5 Die Handschrift zeigt, dass Müller zunächst wohl eine zweistufige Klimax geplant hat: Auf einer ersten Stufe hat er Liebe ohne Gegenliebe angesiedelt, auf einer zweiten be-reits Liebe mit Eifersucht gepaart. Erst später fügt er noch die mittlere Stufe mit der Verachtung des geliebten Wesens ein.