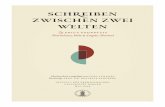Die ägyptische Revolution: Klassische Revolution oder Aufstand neuer Art?
Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität: Dynamiken der biopolitischen...
-
Upload
uni-augsburg -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität: Dynamiken der biopolitischen...
547
Peter Wehling/Willy Viehöver/Reiner Keller/Christoph Lau
Zwischen Biologisierung des Sozialenund neuer Biosozialität: Dynamiken derbiopolitischen GrenzüberschreitungDer Beitrag beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen im Feld der Biopolitik, die das Verhältnis vonMedizin, Gesellschaft und Individuum grundlegend verändern könnten. In der sozialwissenschaftlichenDebatte werden diese Entwicklungen äußerst kontrovers beurteilt, unausgesprochen wird dabei aber einemehr oder weniger homogene Entwicklungstendenz des biopolitischen Feldes zugrunde gelegt, die ent-weder als Biologisierung und Naturalisierung des Sozialen oder als Herausbildung neuer Biosozialitätenund Gewinn an individueller Selbstbestimmung gedeutet wird. Aus dem Blick gerät dabei die Tatsache,dass man es dabei mit teilweise sehr unterschiedlichen Dynamiken zu tun hat. Um diese Differenziertheitund Vielschichtigkeit sichtbar zu machen, möchte unser Beitrag anhand von vier biopolitischen Dynami-ken der Ausweitung medizinischer Diagnostik, der Entgrenzung medizinischer Therapie, der Entzeitli-chung von Krankheit sowie der Perfektionierung der menschlichen Natur nachzeichnen, wie sowohl eta-blierte Vorstellungen von der menschlichen Natur als auch eingespielte Grenzziehungen zwischenKrankheit und Gesundheit, Heilung und Optimierung infrage gestellt werden oder sich sogar aufzulösendrohen. Abschließend werden einige Schlussfolgerungen, insbesondere hinsichtlich der Frage nach dermöglichen Biologisierung des Sozialen sowie nach den Grenzen biopolitischer Entgrenzungen, gezogen.
1. Einleitung
Unter dem Etikett „Biopolitik“1 wird gegen-wärtig ein breites Spektrum von Entwick-lungen diskutiert, die in folgenreicher Weisedie etablierten gesellschaftlichen Erfahrungs-und Vorstellungshorizonte von Gesundheitund Krankheit sowie von der Natürlichkeitdes menschlichen Körpers zu sprengen dro-hen. Beispiele hierfür bieten Visionen derpharmakologischen Beeinflussung zentralerGehirnleistungen wie Erinnern und Verges-sen, radikalisierte Vorstellungen von derchirurgischen Umgestaltung und „Optimie-rung“ des menschlichen Körpers, die mögli-che Verpflanzung genetisch „maßgeschnei-derter“ tierischer Organe in menschlicheKörper (Xenotransplantation), Versuche, diemenschliche Lebensspanne erheblich zu er-weitern sowie nicht zuletzt Utopien der ge-netischen Optimierung oder des „reprodukti-ven Klonens“ von Menschen (vgl. als Über-blick die Beiträge in Parens 1998; Geyer2001; van den Daele 2005a; Ach/Pollmann2006). Vieles hiervon ist bisher bloße Spe-
kulation und Vision – und wird es aller Vor-aussicht nach auch bleiben. Doch nicht we-nige der erwähnten Entwicklungen könntenschon in absehbarer Zeit realisiert werden. Injedem Fall werden durch derartige gleicher-maßen wissenschaftlich-technische wie dis-kursive Dynamiken nicht nur Fragen nachdem Wert des „natürlichen“ menschlichenKörpers aufgeworfen (Karafyllis 2003; Bay-ertz 2004; Birnbacher 2006); darüber hinausgeraten bislang handlungsleitende Unter-scheidungen zwischen Krankheit und Ge-sundheit oder zwischen Therapie (Heilung)und Optimierung („Enhancement“) unterDruck, werden unscharf und gesellschaftlichneu ausgehandelt.
In der öffentlichen wie der sozialwissen-schaftlichen Debatte werden die skizziertenEntwicklungen äußerst kontrovers beurteilt:Einige Beobachter befürchten bereits das„Ende des Menschen“ und sehen eine be-drohliche, posthumane Zukunft heraufzie-hen (Fukuyama 2002; vgl. auch Habermas2001). Andere hingegen vermögen kaum et-was Neues zu erkennen und verweisen dar-auf, dass es weder begründbar noch Erfolg
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
548
versprechend sei, wollte man versuchen, diemenschliche „Natur“ gegen Eingriffe abzu-schotten, die im Namen besserer Gesundheitoder individueller Selbstbestimmung vorge-nommen werden (van den Daele 2005b).Ähnlich umstritten ist in der sozialwissen-schaftlichen Diskussion, ob die Verbreitungund Nutzung neuer biomedizinischer Optio-nen in eine fragwürdige „Biologisierung desSozialen“ münden werde (vgl. Bertilsson2003) oder umgekehrt Chancen für eine neu-artige „Biosozialität“ (Rabinow 2004) eröff-nen könnte, das heißt für Formen der Solida-rität und Vergemeinschaftung auf der Grund-lage einer kulturell gestalteten (menschlichen)Natur.
Bisher werden solche Fragen zumeist starkgeneralisierend diskutiert; unausgesprochenwird dabei eine mehr oder wenig homogeneund lineare Entwicklungstendenz und -rich-tung des biopolitischen Feldes zugrunde ge-legt, die entweder als Biologisierung und Na-turalisierung des Sozialen oder als Heraus-bildung neuer Biosozialitäten und Gewinnan individueller Selbstbestimmung gedeutetwird. Aus dem Blick zu geraten drohen aufdiese Weise nicht nur die Ambivalenzen undWidersprüchlichkeiten biopolitischer Ent-wicklungen, sondern auch die Tatsache, dassman es dabei mit teilweise sehr unterschied-lichen Dynamiken, Verlaufsformen, Ak-teurskonstellationen, Rhetoriken, Legitima-tionsstrategien, möglichen Gegentendenzenwie auch gesellschaftlichen Widerständen zutun hat. Um diese Differenziertheit und Viel-schichtigkeit sichtbar zu machen, möchtenwir in unserem Beitrag idealtypisch vier Dy-namiken der Biopolitik im Spannungsfeldder (unscharf werdenden) Abgrenzungenzwischen Krankheit und Gesundheit sowieTherapie und Enhancement unterscheiden.2Wir vermuten, dass sich damit die Fragennach den Hintergründen, Motiven, Antriebs-kräften und möglichen Konsequenzen bio-medizinischer und biopolitischer Grenzüber-schreitungen differenzierter stellen (und mög-licherweise beantworten) lassen, als wennvon nur einer homogenen Entwicklungsdy-namik ausgegangen würde.
Im Folgenden möchten wir zunächst sehrknapp verdeutlichen, inwiefern und weshalbdie aktuellen und zukünftig erwartbaren Ent-
wicklungen im Feld der Biopolitik sowohletablierte Vorstellungen von der menschli-chen Natur als auch eingespielte Grenzzie-hungen zwischen Krankheit und Gesundheit,Heilung und Optimierung infrage stellen undsogar aufzulösen drohen (Abschnitt 2). Dar-an anschließend möchten wir die vier biopo-litischen Dynamiken der Ausweitung medizi-nischer Diagnostik, der Entgrenzung medizi-nischer Therapie, der Entzeitlichung vonKrankheit sowie der Perfektionierung dermenschlichen Natur in ihrer jeweiligen Spe-zifik darstellen (Abschnitt 3). Abschließendmöchten wir einige vorläufige Schlussfolge-rungen insbesondere hinsichtlich der Fragenach der möglichen Biologisierung des So-zialen sowie nach den Grenzen biopoliti-scher Entgrenzungen ziehen (Abschnitt 4).
2. Jenseits von Gesundheit undKrankheit?
Die neuen biomedizinischen Möglichkeitenmachen uns, so vermutet der Wissenschafts-historiker und Biologe Hans-Jörg Rheinber-ger (1996: 289), gegenwärtig zu „Zeugen ei-ner globalen, irreversiblen Transformationlebender Wesen, einschließlich des Men-schen, in gezielt konstruierte Wesen“. Aufdiese Weise würde letztlich, so Rheinberger(ebd.: 288f.), „der Gegensatz zwischen Naturund Kultur selbst zur Disposition stehen“.3Die Vorstellung der „Natürlichkeit“ und ins-besondere der Naturgegebenheit des mensch-lichen Körpers scheint ihre Bedeutung alsnormativer Wert und als kulturelle Hand-lungsorientierung mehr und mehr einzubü-ßen. Infolgedessen beginnt sich auch diealltagsweltliche Wahrnehmung von „Krank-heit“ als Abweichung von einem natürlichen,normalen Zustand des menschlichen Körpersaufzulösen.4 Damit geraten bislang als „na-türlich“ wahrgenommene körperliche Gege-benheiten, wie Alterung, Aussehen, Körper-größe und (Über-)Gewicht, oder auch alltäg-liche Verhaltensformen, wie Schüchternheit,mit der Erweiterung des medizinischen Zu-griffs in die Nähe therapiebedürftiger undtherapierbarer „Defizite“ und „Störungen“(Lau/Keller 2001: 85; Wehling 2007). Auf-
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
549
grund dessen wird „Krankheit“ unter derHand zunehmend als die „suboptimale“ Ent-faltung und Ausnutzung eines prinzipiellsteigerbaren Potenzials verstanden, über dasder menschliche Körper verfügt – oder dasman ihm „einpflanzen“ kann. Folglichschwinden (tatsächliche oder vermeintliche)lebensweltliche Handlungsgewissheiten und-voraussetzungen in dem Maße, wie diebiologische Natur des menschlichen Körpersimmer mehr zum Objekt wissenschaftlich-technischer Intervention und damit – selbstbeim Interventionsverzicht – entscheidungs-abhängig wird.
Die Hintergründe und Ursachen für sol-che Entgrenzungstendenzen sind vielschich-tig: An erster Stelle lassen sich sicherlich diezuvor ungekannten Möglichkeiten der Mani-pulation, Optimierung oder Transformationdes menschlichen Körpers (und „Geistes“)nennen, die durch Gentechnik, Reprodukti-ons- und Transplantationsmedizin, Hirnfor-schung, Psycho- und Neuropharmakologie,kosmetische Chirurgie etc. eröffnet werden.Es wäre jedoch eine verfehlte, letztlich tech-nikdeterministische Sichtweise, würde mandie gleichermaßen technisch-materiale wiediskursive Erosion der Abgrenzungen vonNatur versus Kultur/Gesellschaft, Krankheitversus Gesundheit etc. allein als Folge neuerwissenschaftlicher Erkenntnisse und medizi-nischer Handlungsmöglichkeiten begreifen.Hinzu kommen vielmehr eine Reihe sozialer,kultureller und wirtschaftlicher Faktoren undKontexte, welche die Nutzung und (Weiter-)Entwicklung dieser technischen Möglich-keiten beeinflussen und in bestimmte Rich-tungen lenken. So trägt beispielsweise erstdie weite Verbreitung und Veralltäglichungbiomedizinischer Optionen aufgrund sinken-der Kosten und medialer Inszenierungen(etwa bei Schönheitschirurgie oder Psycho-pharmaka) entscheidend zur Erosion bisherkulturell etablierter Natürlichkeitsvorstellun-gen und Grenzziehungen bei. Eine entschei-dende Rolle spielen hierbei die Marke-tingstrategien von Pharmaunternehmen undanderen Anbietern von Gesundheitsdienstleis-tungen. Diese gehen immer stärker dazuüber, nicht mehr lediglich ihre Produkte zubewerben, sondern zunächst die „Krankhei-ten“ und „Störungen“, auf die ihre Therapien
zugeschnitten sind, ins Bewusstsein derZielgruppen zu heben. „Marketing diseases,and then selling drugs to treat those disea-ses“ – so hat der amerikanische Medizinso-ziologe Peter Conrad (2005: 6) diese Strate-gie zusammengefasst. „Selling sickness“(Moynihan/Cassels 2005) lautet dementspre-chend die nur auf den ersten Blick paradoxanmutende Devise der „Gesundheitsindus-trie“. Dies zeigt sich besonders deutlich inden USA, seitdem dort im Jahr 1997 auch fürverschreibungspflichtige Arzneimittel Wer-bung direkt bei den Endverbraucherinnenund -verbrauchern zugelassen worden ist. Inder Folge beginnt die Grenze zwischen zwarunangenehmen, aber „normalen“ Verhaltens-und Befindlichkeitsproblemen (z.B. Kon-zentrationsschwierigkeiten, Stimmungstiefs,Schüchternheit) und therapiebedürftigen Er-krankungen (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-peraktivitäts-Syndrom ADHS, Depression,Angststörungen) immer undeutlicher unduneindeutiger zu werden.5 Verstärkt werdensolche Entgrenzungstendenzen dadurch, dasses offensichtlich für eine wachsende Zahl vonMenschen normal und alltäglich gewordenist, das eigene Aussehen und Wohlbefindensowie ihre körperliche oder geistige Lei-stungsfähigkeit mit medizinischen Mitteln zuverbessern – auch dann, wenn hierfür keinemedizinisch-diagnostische Grundlage be-steht. Der Boom, den die sogenannte Schön-heitschirurgie, „Glückspillen“ wie Prozacoder das „Potenzmittel“ Viagra in den letz-ten Jahren erlebt haben, sind prägnante Bei-spiele hierfür. Mit Blick auf solche Tenden-zen wird verschiedentlich von einem Über-gang zur „Lifestyle-Medizin“ oder „wun-scherfüllenden Medizin“ (Kettner 2006) ge-sprochen.
Damit verschwimmt eine weitere grund-legende Unterscheidung, die in modernenGesellschaften lange Zeit handlungsorientie-rend für Bereiche wie Medizin, Psychothe-rapie, Pädagogik etc. war: die Differenz zwi-schen „Heilung“ (therapy) und „Verbesse-rung“ (enhancement) (vgl. Juengst 1998;Lenk 2002; Council on Bioethics 2003). So-lange die Medizin sich im kulturellen und in-stitutionellen Erwartungshorizont der „Hei-lung“ bewegte, blieb sie als idealtypischeWiederherstellung eines durch Krankheit
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
550
veränderten und gefährdeten „natürlichen“oder „normalen“ Zustands an die Vorstel-lung einer vorgegebenen Körpernatur desMenschen gebunden (vgl. Rheinberger 1996:289). Ein solcher Diskurs der Normalisie-rung und Wiederherstellung erschien langeZeit als sozial und kulturell plausibel, wenn-gleich er verdeckte, dass diese Körpernaturschon immer gesellschaftlich (mit)geprägtwar und die „Wiederherstellung der norma-len Gestalt und Funktion des Menschen“(Schlich 2001: 141) häufig (etwa in Formvon Prothesen, Herzschrittmachern u. ä.) ei-ne schrittweise Veränderung und gelegent-lich auch eine „Verbesserung“ des Körpersmit einschloss. Insofern geht es bei demSpannungsverhältnis zwischen Therapie undEnhancement nicht um die „ontologische“und „essentialistische“ Gegenüberstellungzwischen dem völlig unveränderten, natur-gegebenen Körper auf der einen Seite unddem technisch manipulierten, „künstlichen“auf der anderen, sondern in erster Linie umeine Differenz zwischen kulturellen Erwar-tungshorizonten und Handlungsorientierun-gen (vgl. Gill 2003: 157f.). Entscheidend isthierbei, dass infolge der teils bereits verfüg-baren, teils anvisierten Möglichkeiten derBiomedizin der Handlungshorizont der Hei-lung und Wiederherstellung sukzessive durchdenjenigen der Verbesserung und Optimie-rung der menschlichen Natur überlagertwird. Dadurch wird die Unterscheidung ins-gesamt uneindeutig und problematisch: Las-sen sich die Behandlung von Menschen mitgeringer Körpergröße mit Hilfe von Wachs-tumshormonen, die Verlangsamung des Al-terns oder die pharmakologische Beeinflus-sung von Erinnern und Vergessen weiterhinim kulturellen Horizont der „Wiederherstel-lung“ eines durch Krankheit gestörten Na-turzustands begreifen? Oder stellen sie be-reits Visionen einer medizinisch-technischenPerfektionierung und Transformation desmenschlichen Körpers und seiner Funktio-nen dar? Dies wirft die Frage auf, an wel-chen Maßstäben und Zielen sich (reflexiv)moderne Gesellschaften angesichts der sichabzeichnenden medizinischen Möglichkeitenorientieren können und sollen, wenn der Re-ferenzrahmen der „menschlichen Natur“ da-für ausfällt (vgl. schon van den Daele 1987
sowie Habermas 2001; Fukuyama 2002).Und offen ist auch: „Wer wird die Verant-wortung tragen, die mit diesen Optionenverbunden ist?“ (Rheinberger 1996: 297).
In der sozialwissenschaftlichen Diskussi-on der letzten Jahre besteht ein weitgehenderKonsens darüber, dass die Verantwortungfür solche Optionen und die Festlegung vonZielen für ihren Einsatz in den gegenwärti-gen modernen Gesellschaften immer weni-ger von zentralen staatlichen Instanzen über-nommen wird, wie es bis Mitte des 20. Jahr-hunderts der Fall war. Auch Foucault (1999:294ff.) hatte in der nationalsozialistischenPolitik der Eugenik und „Rassenhygiene“ ei-ne mögliche, wenn auch nicht unbedingtnotwendige Konsequenz kollektivistischer,staatlich organisierter Biopolitik gesehen.Nach der Diskreditierung einer solchen Poli-tik ist der Umgang mit Fragen der Gesund-heit, der Körperverbesserung, der Optimie-rung des menschlichen Lebens mehr undmehr individualisiert, privatisiert und kom-merzialisiert worden (vgl. Bauman 1992;Nye 2003; Conrad/Leiter 2004; Conrad2005). Jürgen Habermas (2001) spricht vordiesem Hintergrund von der Möglichkeit ei-ner „liberalen Eugenik“. Deren Antriebskraftist nicht primär das staatliche Interesse ander Verbesserung des Gesundheitszustandesvon Bevölkerungen, sondern die individuali-sierte Sorge um die Gesundheit, sei es dieeigene oder die von Kindern und nahen An-gehörigen. Dies schließt allerdings keines-wegs aus, dass die Vielzahl individuellerEinzelentscheidungen für (oder gegen) denEinsatz neuer biomedizinischer Technikensich zu einer unter Umständen irreversiblenTransformation der „menschlichen Natur“und der gesellschaftlichen Zukunft summie-ren könnte (ebd.), gerade weil bislang hand-lungsorientierende Unterscheidungen wieKrankheit/Gesundheit und Heilung/Verbes-serung unscharf werden, sich pluralisierenoder ganz auflösen (Rose 2007). Zudemkann auch eine „liberale“, individualisierteNutzung biotechnischer Optionen durchausmit der Entstehung neuer Formen von so-zialer Herrschaft und Ungleichheit verbun-den sein – sei es, dass bei den Betroffenenkaum auflösbare (Entscheidungs-)Dilemma-ta erzeugt werden, die selbst ein Ausdruck
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
551
von Herrschaft (etwa diskursiver Definiti-onsmacht) sind, sei es, dass ein übermächti-ger sozialer Konformitätsdruck entsteht odersich neuartige Formen einer „naturalisier-ten“, beispielsweise genetisch basierten Dis-kriminierung herausbilden (vgl. Wehling2005; Lemke 2006).
Für die soziologische Untersuchung undReflexion der skizzierten Entwicklungen ste-hen Fragen wie die folgenden auf der Tages-ordnung: Welche Formen und Dynamiken so-zialer Praktiken und „Körpertechniken“(Mauss 1989) resultieren aus der diskursivenwie technisch-materialen Erosion von Unter-scheidungen wie krank/gesund, natürlich/künstlich, normal/abweichend? Bilden sich imHorizont einer möglichen „Biologisierung desSozialen“ spezifische Formen von Herrschaftund sozialer Ungleichheit heraus, etwa indemsich Normen des „perfekten“ Körpers, der un-begrenzten Leistungsfähigkeit und des „un-auffälligen“ Verhaltens oder Mechanismender genetischen Diskriminierung („geneticunderclass“) durchsetzen? Inwieweit eröffnensich gegenläufig dazu Chancen für eine neue„Biosozialität“, also für die Bildung von so-zialen Gemeinschaften und für die kollektiveArtikulation von Interessen bzw. „Anerken-nungskämpfen“ (Axel Honneth) auf derGrundlage einer kulturell reflektierten und ge-stalteten menschlichen Natur? Wo könnten inmodernen, liberalen Gesellschaften normativeoder kulturelle Grenzen der Optimierung dermenschlichen Körpernatur liegen? Die so-ziologische Behandlung solcher Fragen leidetbislang nicht zuletzt darunter, dass die sehrverschiedenen und heterogenen Entwicklun-gen innerhalb des biopolitischen Feldes oftnicht hinreichend differenziert werden. Diesoziologische Analyse kann daher von einemheuristischen Modell biopolitischer Entgren-zungsdynamiken profitieren, das es erlaubt,die unterschiedlichen Prozesse und Phänome-ne idealtypisch zu ordnen und auf ihre jewei-ligen Implikationen zu befragen. Im folgen-den Abschnitt möchten wir vier solcher Ent-grenzungsdynamiken vorstellen.
3. Vier Dynamiken derbiopolitischen Entgrenzung
Unsere Hypothese lautet, dass sich die er-wähnten Fragestellungen differenzierter be-arbeiten lassen, wenn der Unterschiedlich-keit von biopolitischen Entwicklungsdyna-miken analytisch Rechnung getragen wird.Bringt man die beiden Unterscheidungen„Krankheit versus Gesundheit“ und „Hei-lung versus Verbesserung“ in heuristischerAbsicht in eine Kreuztabelle, so könnenidealtypisch vier Formen und Dynamikender Grenzverwischung und -überschreitungidentifiziert werden. Dabei werden die Gren-zen nicht lediglich verschoben und neu ge-zogen, sondern zugleich vervielfältigt unddadurch mehrdeutig und unscharf. Insofernbedeutet Grenzüberschreitung gleichzeitigauch „Entgrenzung“, das heißt Erosion undtendenziell sogar Auflösung der Grenzzie-hung. Die vier Formen der Entgrenzung be-zeichnen wir als Ausweitung medizinischerDiagnostik, Entgrenzung medizinischer The-rapie, Entzeitlichung von Krankheit sowiePerfektionierung der menschlichen Natur.
Wir möchten diese biopolitischen Dyna-miken zunächst jeweils kurz charakterisie-ren, um anschließend auf einige wichtigeGemeinsamkeiten und Unterschiede hinzu-weisen.
3.1 Ausweitung medizinischerDiagnostik
Unter der „Ausweitung medizinischer Dia-gnostik“ verstehen wir eine gesellschaftlicheDynamik, in deren Verlauf körperliche, psy-chische und/oder mentale Phänomene (Kör-perzustände, Verhaltensformen u.ä.), die zu-vor nicht in medizinischen Termini wahrge-nommen wurden, in Begriffen wie „Krank-heit“, „Störung“, „Pathologie“ definiert (undbehandelt) werden. Ein bekanntes, noch im-mer aktuelles und umstrittenes Beispiel hier-für bildet die Definition kindlicher Verhal-tensprobleme und Konzentrationsschwierig-keiten als „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-aktivitäts-Syndrom“ ADHS in den 1970erJahren (Conrad 1976) sowie dessen Aus-
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
552
weitung auf Erwachsene in den 1990er Jah-ren (Conrad/Potter 2000). Weitere einschlä-gige Fälle sind etwa die Wahrnehmung vonSchüchternheit oder der weiblichen Meno-pause und ihrer Symptome als behandlungs-bedürftige Probleme und „Störungen“. Un-abhängig davon, ob man derartige Redefini-tionen als wissenschaftlich begründet be-trachtet oder als fragwürdig kritisiert, lassensie sich zunächst analytisch-neutral als Aus-weitung des Geltungsbereichs medizinischerTerminologie und Diagnostik begreifen. DieFolge dieser Ausweitung ist nicht allein, dasseine wachsende Zahl sozialer Phänomene inmedizinischer Begrifflichkeit definiert wird.Vielmehr werden die implizit zugrunde lie-genden Unterscheidungen von „gesund“ und„krank“, „normal“ und „abweichend“ selbstuneindeutig und unscharf, und zwar um somehr, je stärker umstritten solche medizini-schen Deutungsangebote sind.
Gut beobachten lässt sich dies an den an-haltenden wissenschaftlichen und gesell-schaftlichen Kontroversen um die Diagnoseund Behandlung von ADHS (vgl. Leuzinger-Bohleber/Brandl/Hüther 2006). Besondersstrittig ist hierbei der seit den 1990er Jahrenexpandierende, wenn nicht „explodierende“Einsatz der Neurostimulanz Methylphenidat(bekannt geworden unter dem Handelsna-men Ritalin) zur Behandlung von ADHS beiKindern und Jugendlichen (und seit etwaMitte der 1990er Jahre auch bei Erwachse-nen). In Deutschland wurde Ritalin laut Ba-lance online (http//www.balance-online.de/texte/104.htm, Zugriff 22.03.2004) im Jahr1989 rund 58.000 Mal verschrieben, 1996seien es bereits 445.000 Verschreibungengewesen; nach Angaben des Bundesgesund-heitsministeriums ist der Verbrauch von Ri-talin bei Kindern in der Bundesrepublik al-lein zwischen 1997 und 2000 um rund 270Prozent angestiegen (zit. nach Leuzinger-Bohleber 2006: 16). Nach anderen Schät-zungen haben die Verordnungen von Me-thylphenidat (nach Tagesdosen) zwischen1990 und 2001 um das 61-fache zugenom-men mit vermutlich weiter steigender Ten-denz (Mattner 2006: 77f.). Für die USAwerden noch deutlich höhere Behandlungs-zahlen und Steigerungsraten berichtet; demArzneitelegramm (Nr. 8/2000) zufolge be-
kommen dort 4 Mio. Kinder unter 17 Jahren(nach anderen Quellen sogar 8 Mio.) sowieinzwischen 1 Mio. Erwachsene das Medika-ment.6 Bedeuten die enormen Steigerungs-raten der ADHS-Diagnose und der entspre-chenden medikamentösen Behandlung „nur“,dass erst seit kurzem das volle Ausmaß derErkrankung erkannt wird, als deren Ursachezumeist eine Störung des Hirnstoffwechselsangesehen wird? Oder hat man es mit einemFall der „Biologisierung abweichenden Ver-haltens“ (Mattner 2006) zu tun?
Die Tendenz zur Ausweitung medizini-scher Diagnostik weist deutliche Parallelenzu dem Begriff der „Medikalisierung“ (me-dicalization) auf, das heißt der Wahrneh-mung sozialer Probleme in medizinischenTermini, der seit den 1970er Jahren Verbrei-tung vor allem in der englischsprachigen So-ziologie gefunden hat (vgl. Conrad 1992).7Dessen theoretische Wurzeln sind viel-schichtig: Sie liegen zum einen in den Ana-lysen Michel Foucaults über die Entstehungmoderner Praktiken und Techniken der Dis-ziplinierung des menschlichen Körpers (Fou-cault 2002; vgl. zusammenfassend Nye 2003)sowie in den medizinkritischen Arbeiten der1960er und 70er Jahre, etwa von TomasSzasz und Ivan Illich. Zum anderen stammenwesentliche Impulse aus der interaktionisti-schen oder konstruktivistischen Soziologiesozialer Probleme, die sich für Prozesse des„Labeling“ bestimmter, (tatsächlich odervermeintlich) abweichender Verhaltensfor-men in medizinischen Termini interessierte:„from badness to sickness“ (vgl. vor allemConrad 1976, 1992, 2005; Conrad/Schneider1980). Medizinische Diagnosen und Defini-tionen erscheinen unter dem kritischen Blickauf Medikalisierungsprozesse nicht als einvon vorneherein privilegierter Zugang zuWahrheit und Objektivität, sondern nurmehrals eine unter mehreren konkurrierendenRealitätsdeutungen, die zudem häufig ver-bunden ist mit neuartigen Formen sozialerKontrolle.8
Ganz allgemein ist unter Medikalisierungnach einer neueren Definition „a way ofthinking and conceiving human phenomenain medical terms, which then guides ways ofacting and organizing social institutions“(Council on Bioethics 2003: 303) zu verste-
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
553
hen. Genauer beinhaltet dies die Tendenz,„to conceive an activity, phenomenon, con-dition, behavior, etc. as a disease or disorderor as an affliction that should be regarded asa disease or disorder“ (ebd.). Explizite oderimplizite Konsequenz daraus ist, dass dieGründe für solche Phänomene vorrangigoder ausschließlich als „physisch“ oder „so-matisch“ und nicht als „mental“, „psychisch“oder „sozial“ angesehen werden. Auf den er-sten Blick könnte Medikalisierung insofernals „normale“ Dimension gesellschaftlicherRationalisierung und Modernisierung er-scheinen, als dadurch (pathologische) Ver-haltensformen oder Körperzustände, die zu-vor als unbegreiflich und unbehandelbar er-schienen oder aufgrund mangelhaften Wis-sens nicht als Krankheitssymptome wahrge-nommen werden konnten, nunmehr in denBereich wissenschaftlicher Erklärung undmedizinischer Handlungskompetenz einbe-zogen werden (vgl. von Ferber 1989). Einesolche Sichtweise verkennt jedoch, dass diezugrunde liegenden Begriffe und Unterschei-dungen (gesund/krank; normal/abweichend)nicht objektiv und eindeutig vorgegeben sind,sondern unterschiedlichen sozialen, insbeson-dere medizinisch-wissenschaftlichen Defini-tions- und Grenzziehungsaktivitäten unterlie-gen.9 Im Gefolge der Ausweitung von medi-zinischen Behandlungsmöglichkeiten (oderBehandlungsansprüchen) können dabei zuvorals „gesund“ und „normal“ angesehene Ver-haltensweisen als „krank“ und „auffällig“ eti-kettiert werden. Das Ergebnis solcher Prozes-se ist somit nicht einfach – im Sinne der „Ent-zauberung der Welt“ – eine Ausweitung desobjektiven Wissens in den Bereich zuvor fürunerklärbar und/oder nicht therapierbar ge-haltener Phänomene hinein. Vielmehr wirdaufgrund kontingenter wissenschaftlicherund professioneller Wissensansprüche vie-les, was bis dahin als medizinisch unauffälligangesehen wurde, nunmehr als behandlungs-bedürftig definiert. Dabei entfaltet sich,wenn etwa der Zustand des Unglücklichseins„medikalisiert“ wird, eine weitreichendeDynamik, „that blurs the line between sick-ness and health“ (Dworkin 2001: 87). Esgeht hierbei dann nicht nur um die seit lan-gem strittige Frage, ob und inwieweit psy-chische Erkrankungen körperliche („natürli-
che“) oder soziale, z.B. familiäre Ursachenhaben, sondern darüber hinaus um die vor-gängige und weiter reichende Frage, wasüberhaupt als eine behandlungsbedürftige(psychische) Erkrankung anzusehen ist.
Ungeachtet der engen Parallelen zwischen„Ausweitung medizinischer Diagnostik“ und„Medikalisierung“ verstehen wir den letzte-ren Begriff in einem umfassenderen Sinne,nämlich als Verbreitung sowohl von medizi-nischen Terminologien und Definitionen alsauch von medizinischen Techniken und(materialen) Praktiken, sodass sich auch inden übrigen drei noch darzustellenden Ent-grenzungsdynamiken Elemente einer Medi-kalisierung sozialer Phänomene beobachtenlassen. Dieses weitere Begriffsverständniswird dadurch unterstützt, dass in jüngsterZeit auch führende Vertreter der Medikali-sierungssoziologie die frühere Konzentrationauf die Deutungsmacht der medizinischenProfession als entscheidende Triebkraft desGeschehens relativiert haben (vgl. vor allemConrad/Leiter 2004; Conrad 2005). In denBlick geraten stattdessen sowohl andere(Schlüssel-)Akteure (vor allem Pharmaun-ternehmen, Medien und zunehmend auch diebetroffenen Individuen selbst) als auch andereFormen und Dynamiken der Medikalisie-rung.10 Conrad (2005) spricht daher von „shif-ting engines of medicalization“ und hebt ne-ben dem Einfluss von Pharmaunternehmendie zunehmende Rolle der „Selbst-Medikali-sierung“ Betroffener hervor: „Individuals’self-medicalization is becoming increasinglycommon, with patients taking their troublesto physicians and often asking directly for aspecific medical solution“ (ebd.: 9). Mögli-cherweise hat man es also zunehmend mitdem paradoxen Phänomen einer fortschrei-tenden Medikalisierung bei schwindendemEinfluss – oder teilweise sogar gegen denWiderstand – von Ärzten zu tun. Gleichwohlbesitzen die Ärzte bei dieser Form biopoliti-scher Entgrenzung nach wie vor die Rollevon „gatekeepers“ (ebd.: 10), weil in der Re-gel nur sie die medizinische Diagnose insti-tutionell beglaubigen und den (legalen) Zu-gang zu entsprechenden Therapien sichernkönnen. Dennoch gibt die wachsende Be-deutung anderer Akteure einen wichtigenHinweis darauf, dass die Ausweitung medi-
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
554
zinischer Definitionen und Terminologienunter den gegenwärtigen Bedingungen nichtso sehr zu neuen, stabilen Krankheitsdefini-tionen als vielmehr zum Verschwimmen derUnterscheidung von „gesund“ und „krank“führt. Daraus resultieren Grauzonen der Un-eindeutigkeit, in denen die Individuen ihreeigenen Befindlichkeiten (oder die ihrerKinder) „selbst“ interpretieren und definie-ren müssen, aber angeregt und angeleitetdurch Außeneinflüsse wie Medien, Wer-bung, Selbst-Tests im Internet, Ratgeber-Literatur u.ä.
3.2 Entgrenzung von Therapie
Unter der „Entgrenzung von Therapie“ ver-stehen wir allgemein den sich sukzessiveausweitenden Einsatz medizinischer Behand-lungstechniken über professionell definierteund begrenzte Krankheitsdiagnosen hinaus.Im Unterschied zum vorigen Fall löst sichdie Nutzung medizinischer Technologiehierbei also mehr und mehr von Krankheits-definitionen ab, ohne allerdings ganz denBezug dazu zu verlieren.11 An die Stelle der„Heilung“ oder „Wiederherstellung“ trittdamit de facto die Verbesserung des „gesun-den“ menschlichen Körpers bzw. bestimmterphysischer oder mentaler Funktionen. Infra-ge gestellt wird durch diese Dynamik alsosowohl die Unterscheidung zwischen „ge-sund“ (im Sinne von „nicht therapiebedürf-tig“) und „krank“ („therapiebedürftig“) alsauch diejenige zwischen Therapie und En-hancement.
Die Geschichte der Medizin und der Kör-perpraktiken weist eine Vielzahl von Bei-spielen für diese Tendenz zur Entgrenzungvon Therapien auf. Eines der gerade in jüng-ster Zeit auffälligsten Beispiele hierfür istdie sogenannte „Schönheitschirurgie“: Ur-sprünglich als plastische Chirurgie entwi-ckelt zur („wiederherstellenden“) Behand-lung von Kriegs- oder Unfallverletzungen,hat sich der Anwendungsbereich der dabeientwickelten chirurgischen Techniken in denletzten Jahren mehr und mehr ausgeweitetauf die „Korrektur“ von altersbedingten Kör-perveränderungen und/oder eines als „häss-lich“ (bzw. nicht „schön“) empfundenen
körperlichen Aussehens (vgl. Schlich 2001:133f.; Leven 2006).12 Wenn es darum geht,inwieweit schönheitschirurgische Leistungenvon den Krankenversicherungen finanziertwerden, wird zwar nach wie vor auf medizi-nische (Krankheits-)Diagnosen zurückge-griffen, die aber – wie beispielsweise Hin-weise auf „psychosoziale Probleme“ – sehrunscharf und teilweise fragwürdig sind (vgl.Wiesing 2006: 146ff.). Bei dem expandie-renden Markt für kosmetische Eingriffe, dievon den Betroffenen selbst bezahlt werden,entfällt dieser Bezug auf medizinische Dia-gnostik jedoch (fast) vollständig.
Schönheitschirurgische Eingriffe sind ineinigen Ländern und sozialen Milieus zurfast schon alltäglichen Normalität, zu einem„Massenphänomen“ (Davis 1995: 16) ge-worden und zeigen ein neues Verhältnis zum„eigenen“, „naturgegebenen“ Körper in wei-ten Teilen der modernen Gesellschaft an (vgl.Gilman 1999). Wenngleich bisher (noch)überwiegend Frauen die Kundinnen einer sichrapide entwickelnden „Schönheitsindustrie“bilden, werden die Dienste kosmetischer Chi-rurgen zunehmend auch von Männern in An-spruch genommen. Schätzungen zufolgewerden in Deutschland jährlich etwa500.000 bis 1 Million Schönheitsoperationendurchgeführt, und es wird angenommen,dass die Zahl der Eingriffe sich in den ver-gangenen zehn Jahren verdreifacht hat(Kahlweit 2004). Für andere Länder, wie dieUSA, Brasilien oder China, werden nochdramatischere Steigerungsraten angenom-men, in den USA beispielsweise von 2 Mil-lionen Eingriffen 1997 auf 8,5 Millionen imJahr 2001 (Degele 2004: 19).
Von besonderem Interesse sind bei die-sem Beispiel der Entgrenzung medizinischerTherapie vier Aspekte: erstens die gleicher-maßen massive wie umstrittene massenme-diale Inszenierung und Popularisierung sol-cher Praktiken (auch in der BundesrepublikDeutschland); zweitens bemerkenswerte„kulturelle“ Unterschiede in der Nutzung derkosmetischen Chirurgie im Ländervergleich;drittens eine sich andeutende Tendenz, wo-nach die „Korrektur“ des körperlichen Aus-sehens nicht mehr „nur“ der individuellenSelbstwahrnehmung und der Anerkennungim sozialen Umfeld dient, sondern zuneh-
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
555
mend auch von Bedeutung auf dem Ar-beitsmarkt werden könnte (vgl. Wehling2006). Viertens schließlich löst die Tatsache,dass bei offenkundig gesunden Personenteilweise schmerzhafte und riskante chirurgi-sche Eingriffe vorgenommen werden, bei ei-nem Teil der Ärzteschaft deutliches Unbeha-gen aus. Hinweise hierauf sind ärztliche For-derungen nach Qualitätskontrollen sowie diein der Bundesrepublik Deutschland von derBundesärztekammer mitinitiierte „Allianzgegen Schönheitswahn“, die sich unter ande-rem für Altersbegrenzungen bei kosmeti-schen Operationen einsetzt. Andere Teile dermedizinischen Profession (aber auch nicht-ärztliche Berufe) haben die Schönheitschir-urgie hingegen als einen expandierenden undlukrativen Markt entdeckt. Anders als imAbschnitt 3.1 geschilderten Fall ADHS gehtes in diesem Kontext weniger um eine me-dizinisch-wissenschaftliche Auseinanderset-zung um die Art der Diagnose, als vielmehrum die (professions)ethische Frage, ob chir-urgische Eingriffe auch ohne Krankheitsdia-gnose ärztlich vertretbar sind, sowie ummögliche Grenzen für individuelle Verschö-nerungswünsche.
Auch die Nutzung von pharmazeutischenMitteln zur Beeinflussung von wichtigenGedächtnisleistungen (Erinnern und Verges-sen), an denen gegenwärtig gearbeitet wird(Klein 2004; Breuer 2004; Kandel 2006),könnte zukünftig einer Dynamik der Ent-grenzung von Therapie folgen: Zwar werdendie Ziele bisher vorwiegend medizinisch de-finiert, beispielsweise das Leiden von Pati-enten mit quälenden, traumatischen Erinne-rungen zu verringern. Dennoch verknüpfensich mit der Möglichkeit, bestimmte Gehirn-funktionen zu beeinflussen oder Gedächt-nisinhalte neutralisieren zu können, inzwi-schen weitreichende Erwartungen hinsicht-lich einer gezielten Manipulation und „Steue-rung“ von Vergessen oder Erinnerung. DerUS-amerikanische Film Eternal Sunshine ofthe Spotless Mind aus dem Jahr 2003 hatsolche, bisher (noch) nicht realisierbarenErwartungen, etwa den Wunsch, die Erinne-rung an vergangene Liebesbeziehungen zu„löschen“, in ironischer Form aufgegriffen.Wie häufig, ist auch in diesem Fall die mas-senmedial-künstlerische Verarbeitung ein Hin-
weis darauf, dass entsprechende Phantasienund Visionen, angeregt durch neue medizi-nisch-technische Optionen, in der Gesell-schaft virulent sind.
3.3 Entzeitlichung von Krankheit
Als „Entzeitlichung von Krankheit“ begrei-fen wir die zunehmende Ablösung desKrankheitsbegriffs von zeitlich manifesten(akuten oder chronischen) Symptomen undBeschwerden sowie seine „Vorverlagerung“auf bestimmte Indizien und „Risikofakto-ren“.13 Im Zusammenhang damit etablierensich immer mehr Strategien eines „präventi-ven Risikomanagements“, das den betroffe-nen Personen einerseits bestimmte Verant-wortungen in ihrer individuellen Lebensfüh-rung zuschreibt und/oder sie andererseits inden Wirkungsbereich von (im weitesten Sin-ne) medizinischen Therapien einbezieht, oh-ne dass die Betreffenden jedoch (im bisheri-gen Verständnis) tatsächlich „krank“ wären.So werden beispielsweise in den USA imZusammenhang mit – durchaus umstrittenen– Medikamenten zur Brustkrebspräventionseitens der medizinischen Forschung undPharmaindustrie „Hoch-Risiko-Frauen“ alsZielgruppe für die Vermarktung solcherMittel identifiziert (Fosket 2004). Risikowird in solchen Kontexten mehr und mehr zueiner „illness category in and of itself“ (ebd.:294).
Ihre markanteste und vermutlich gesell-schaftlich folgenreichste Ausprägung erfährtdie Dynamik der Entzeitlichung von Krank-heit gegenwärtig im Zusammenhang mit denneuen Möglichkeiten der prädiktiven Gen-diagnostik. Diese ist darauf ausgerichtet, ge-netische Besonderheiten einer Person oderGruppe zu identifizieren, die in späteren Le-bensstadien mit statistisch erhöhter oder ineinzelnen Fällen, wie der Huntington-Krankheit, sogar mit an Sicherheit grenzen-der Wahrscheinlichkeit zu bestimmten Er-krankungen führen werden (Feuerstein et al.2002: 39). Die zu erwartende Verbreitungdieser Form medizinischer Diagnostik wirdvermutlich weitreichende Folgen im Sinneder Entgrenzung von Krankheit und Ge-sundheit haben. Zum einen entsteht aufgrund
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
556
des Wissens um genetische Dispositionen fürbestimmte Krankheiten, die erst in einerspäteren Lebensphase auftreten – und unterUmständen überhaupt nicht –, eine neuePersonen-Kategorie von „Noch-Nicht-Kranken“, „Kranken ohne Symptom“ oder„gesunden Kranken“. Diesen wird nicht nurein schwer zu bewältigendes Risikomanage-ment auferlegt, wobei häufig, etwa bei erb-lich (mit-)bedingtem Brustkrebs, sinnvollePräventions- und Therapiemöglichkeiten fürdie prognostizierten Erkrankungen fehlen.Darüber hinaus sind sie möglicherweise auchder Gefahr neuartiger sozialer Diskriminie-rungen aufgrund ihrer genetischen „Auffäl-ligkeiten“ oder „Abweichungen“ ausgesetzt.Zum anderen sind in diesem ZusammenhangAnzeichen für eine unter Umständen sehrweitreichende Neudefinition des Krankheits-begriffs im Sinne einer Verschiebung derUnterscheidungskriterien von „Krankheit“oder „Gesundheit“ auf die genetische Ebenezu beobachten (vgl. Wolf 2002; Lemke2002, 2003). Die medizinische und gesell-schaftliche Wahrnehmung von Krankheitkönnte hierbei von der Manifestation derSymptome zunehmend auf das Vorliegengenetischer Besonderheiten verlagert wer-den.
In Reaktion auf diese Entgrenzungsten-denz und ihre möglichen Folgen sind neuesoziale und institutionelle Praktiken zu be-obachten. Hierzu gehören neben der Entste-hung „bio-sozialer“ Selbsthilfegruppen vonMenschen mit gleichen genetischen Beson-derheiten vor allem die Diskussion um eininzwischen zwar prinzipiell anerkanntes, inseiner faktischen Reichweite aber stark um-strittenes „Recht auf Nichtwissen“ (Wehling2003) ebenso wie Fragen des Datenschutzesgegenüber Arbeitgebern oder Versicherungs-gesellschaften (vgl. als Überblick Damm2004).14 Verhindert werden soll durch die in-stitutionelle Absicherung eines Rechts aufNichtwissen die Herausbildung neuartigerFormen sozialer Benachteiligung und Aus-grenzung („genetische Diskriminierung“),etwa am Arbeitsmarkt, im Gesundheits-,Versicherungs- und Bildungswesen oder auchauf dem Heiratsmarkt (vgl. Lemke/Lohkamp2005; Lemke 2006). Besonders ausgeprägtsind zugleich die individuellen und familiä-
ren Entscheidungsdilemmata: Soll man einenGentest auf bestimmte Krankheitsdispositio-nen oder -risiken vornehmen lassen, wiewerden nahe Verwandte (Eltern, Geschwi-ster, Kinder) durch das Ergebnis beeinflusstoder beeinträchtigt, wie kann ein positivesTestergebnis, das eine erhöhte Wahrschein-lichkeit bestimmter (zukünftiger) Erkran-kungen diagnostiziert, individuell und sozialverarbeitet werden? Offen ist gegenwärtig,inwieweit sich gesellschaftlich eine expliziteoder implizite Verhaltenserwartung durch-setzen wird, wonach insbesondere soge-nannte „Risikopersonen“ eine Art von mora-lischer Verpflichtung haben, ihre geneti-schen Dispositionen überprüfen zu lassen?Da in absehbarer Zeit mit einer Ausweitungund verstärkten Nutzung DNA-basierter prä-diktiver Diagnosen (und unter Umständensogar mit umfassenden „Screenings“ auf ei-ne Reihe vererbbarer Krankheiten) zu rech-nen ist (vgl. Hennen/Petermann/Sauter 2001),werden solche Fragen aller Voraussicht nacherheblich an sozialer, politischer und rechtli-cher Brisanz gewinnen. Dabei wird nicht nurdie Grenze zwischen Krankheit und Gesund-heit neu definiert, pluralisiert, verschobenund damit unscharf und uneindeutig, sondernweitergehende Möglichkeiten der Biomedi-zin, etwa die somatische Gentherapie oderdie Keimbahntherapie, könnten das präven-tive Risikomanagement eines Tages sogar inBemühungen um eine krankheitsvermeiden-de Optimierung des Körpers übergehen las-sen.
3.4 Perfektionierung und Transformationder menschlichen Natur
Versuche zur „Perfektionierung der mensch-lichen Natur“ beinhalten idealtypisch die di-rekte Verbesserung des menschlichen Kör-pers, seiner Funktionen und Leistungen überdas „natürliche Maß“ hinaus. Solche Strate-gien gehen insofern über die schrittweiseAusweitung der medizinischen Diagnostikund/oder des Anwendungsspektrums medi-zinischer Technik hinaus, als sie unmittelbardas Ziel der Körperoptimierung, des „En-hancement“ ansteuern. Beispiele hierfür sindVisionen von der Verlangsamung oder gar
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
557
„Abschaffung“ des Alterns, unter anderemmit gentechnischen Mitteln (vgl. de Grey2004; Gesang 2007: 140ff.), Utopien derVerknüpfung menschlicher Gehirne mit in-formationstechnischen Systemen („brain-machine-interaction“) sowie der technischenVerbesserung sensorischer Fähigkeiten (Ro-co/Bainbridge 2002; vgl. Fleischer/Decker2005) oder die Zielsetzungen der 1998 ge-gründeten „World Transhumanist Associati-on“ (www.transhumanism.org). In derenprogrammatischer „Deklaration“ heißt es:„We seek personal growth beyond our cur-rent biological limits.“ Die Praktiken desDopings im Leistungssport, aber zunehmendauch im Breitensport, in der Freizeit und imberuflichen Alltag folgen einer ähnlichenOptimierungsdynamik. Zwar sind die meis-ten Dopingmittel und -methoden ursprüng-lich für medizinisch-therapeutische Zweckeentwickelt worden, ihr (illegaler) Einsatz imSport basiert allerdings nicht auf einer suk-zessiven Ausweitung und Entgrenzung desKrankheitsbegriffs, sondern verfolgt unmit-telbar den Zweck einer Leistungssteigerungüber „natürliche“ Grenzen und Maßstäbehinaus.
Die Dynamik der „Perfektionierung dermenschlichen Natur“ weist zwei Besonder-heiten auf: Erstens sind entsprechende medi-zinische Techniken und Praktiken bisherzumeist nur ansatzweise verfügbar. Daherlässt sich diese Dynamik gegenwärtig über-wiegend auf der Ebene von Strategien undForschungsprogrammen sowie in Diskursenbeobachten, wird dabei aber häufig rheto-risch überdeckt oder bleibt unausgesprochen.Denn explizite („transhumanistische“) En-hancement-Strategien scheinen, zweitens,unter einem höheren Legitimationsdruck alsdie drei übrigen Dynamiken zu stehen, inso-fern sie den Handlungshorizont der Heilungund Wiederherstellung bewusst überschrei-ten. Sie treten daher selten in „Reinform“auf, sind aber häufig ein Bestandteil über-greifender Forschungsprogramme oder -fel-der und verwischen dadurch die Differenzzwischen Therapie und Enhancement. Rechtgut beobachten lässt sich dies am Feld dersogenannten „Anti-Aging-Medizin“, worinsich drei Zielsetzungen überlagern (vgl.Maio 2006: 342f.; Viehöver 2007): erstens
die Prävention von altersbedingten Erkran-kungen, zweitens die Prävention und Be-handlung von altersbedingten körperlichenund mentalen Einschränkungen mit stritti-gem Krankheitswert sowie drittens die Ver-langsamung oder Überwindung des Alternsmit dem utopischen Fernziel der „Unsterb-lichkeit“. Nur diese dritte Zielsetzung, dieVerlängerung des menschlichen Lebens weitüber bislang bekannte Zeitspannen hinaus,lässt sich als „reine“ Perfektionierung be-greifen. Offen formuliert würde eine solcheVision wegen ihrer unabsehbaren gesell-schaftlichen Konsequenzen möglicherweiseauf Zweifel und Ablehnung stoßen. Als Teildes gesellschaftlich akzeptanzfähigen Feldes„Anti-Aging-Medizin“ findet sie hingegengrößere Zustimmung und kann entsprechen-de Forschungsprogramme (wie die Suchenach genetischen Ursachen des Alterns) an-regen.15 Unabhängig davon mehren sich al-lerdings im biopolitischen und -ethischenDiskurs Stimmen, welche die Praktiken desEnhancement prinzipiell für durchaus ver-tretbar halten oder ihnen positive Aspekteabgewinnen (vgl. z.B. Hughes 2004; Schö-ne-Seifert 2006; Gesang 2007). Längerfristigkönnte dies die Legitimationsschwierigkei-ten von Enhancement-Programmen erheblichverringern.
3.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Die Unterscheidung der vier Dynamiken, diein einer Abbildung noch einmal zusammen-gefasst werden, ermöglicht einen differen-zierten Blick auf die aktuellen und zukünftigerwartbaren biopolitischen Entwicklungen.Erkennbar wird, worin die einzelnen Dyna-miken sich voneinander abheben, wo sie sichüberschneiden und inwieweit sie sich wech-selseitig verstärken. Alle vier Dynamikenweisen – wenngleich in jeweils spezifischerForm – in Richtung der Erosion und Entgren-zung der Unterscheidungen von Krankheitund Gesundheit und/oder Therapie und En-hancement.16 Sie eröffnen dabei neue Hand-lungsspielräume für Individuen oder profes-sionelle Akteure, erzeugen aber gleichzeitiggravierende Uneindeutigkeiten im alltägli-chen und institutionellen Handeln, mit den
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
558
möglichen Folgen, die oben angedeutet wor-den sind.
Die wichtigsten Unterschiede zwischenden vier biopolitischen Dynamiken betreffendie jeweilige gesellschaftliche Rolle, Legiti-mation und Konstellation der verschiedenenAkteure (professionelle und wirtschaftlicheAkteure, Medien, Wissenschaft, Politik so-wie nicht zuletzt die individuellen Patientin-nen und „Kunden“). Die „Entgrenzung me-dizinischer Therapie“ beispielsweise wird,besonders prägnant im Fall der kosmetischenChirurgie, stark von den Medien und denKundinnen und Kunden vorangetrieben, beieiner gewissen Distanz eines Teils der Ärz-teschaft. Deutlich anders verläuft hingegendie Entgrenzung von Krankheit und Gesund-heit durch die prädiktive Gendiagnostik: Hierstellt eher die biowissenschaftliche Grund-lagenforschung die treibende Kraft dar, in-dem sie immer mehr Erkrankungen mit ge-netischen Besonderheiten und (Risiko-)Fak-toren in Verbindung bringt, während betrof-fene Patienten und Patientinnen (besonderssolche aus sogenannten „Risikogruppen“)mit erheblicher Zurückhaltung reagieren. DieDebatte um das „Recht auf Nichtwissen“
und die Warnungen vor genetischer Diskri-minierung verdeutlichen die gesellschaftlichambivalente Wahrnehmung der „Entzeitli-chung von Krankheit“. Wieder andere Ak-teurskonstellationen kennzeichnen die Aus-weitung medizinischer Diagnostik: Das Bei-spiel ADHS verdeutlicht zum einen, dasssolche Tendenzen (auch) innerhalb der Me-dizin bzw. zwischen verschiedenen Fach-richtungen umstritten sind, zum anderen ge-winnen hierbei die Marketingstrategien vonPharmaunternehmen einen immer größerenEinfluss auf das Geschehen. Im Zusammen-spiel mit Tendenzen zur „Selbstmedikalisie-rung“ der Patienten kann dies zu einem rela-tiven Bedeutungsrückgang der ärztlichenProfession führen (vgl. Conrad/Leiter 2004;Conrad 2005).
Wie diese Hinweise unterstreichen, wärees wenig weiterführend, von einer homoge-nen und kohärenten Tendenz zur „Medikali-sierung“ oder biopolitischen Entgrenzungauszugehen. Den Differenzierungen inner-halb des Feldes Rechnung zu tragen, ist ins-besondere dann von entscheidender Bedeu-tung, wenn man den Blick auf gegenwärtigeoder zu erwartende Konflikte, auf mögliche
Abbildung: Entgrenzungsdynamiken im Feld der Biopolitik
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
559
Gegentendenzen und soziale Widerständesowie auf Potenziale und Ressourcen einer(Selbst-)Begrenzung der biopolitischen Dy-namiken richtet. Solche Potenziale könnensich fall- und kontextspezifisch in Professi-onsethiken finden (z.B. kosmetische Chirur-gie, Enhancement-Strategien), in innerwissen-schaftlichem Dissens (Expansion von Diag-nostik), in sozialem Protest (etwa gegen ge-netische Diskriminierung), in rechtlichenRegelungen (Recht auf Nichtwissen, Regu-lierung der Arzneimittelwerbung u.ä.) oderauch in ethisch-normativ begründeten Wi-derständen, sei es in individuellen Ethikender „Authentizität“ oder generellen Beden-ken gegen die technische Umgestaltung undTransformation der menschlichen Natur. In-wieweit solche Gegentendenzen gesell-schaftlich wirksam werden und welchen Er-folg sie haben, ist eine letztlich empirisch zubeantwortende Frage.
4. „Biologisierung des Sozialen“oder neue „Biosozialität“?
Die idealtypisch beschriebenen Entgren-zungsprozesse haben wesentliche Implika-tionen sowohl für das, was man die „gesell-schaftliche Herstellung der Zukunft“ nennenkönnte, als auch für neue Erscheinungsfor-men von Herrschaft und sozialen Ungleich-heiten. Unter dem Aspekt der Herstellungund Festlegung von Zukunft könnten sie zueiner möglicherweise irreversiblen Verände-rung und Überschreitung der „menschlichenNatur“ führen. Unsere erste These lautet indiesem Zusammenhang, dass die Vorstellungeiner „naturgegebenen“ Körperlichkeit desMenschen allmählich ihre Bedeutung alsOrientierungs- und Legitimationshorizont fürwissenschaftliches und medizinisches Han-deln sowie für soziale Alltagspraktiken ein-büßen könnte. Der Leib, der man ist, wirddann (fast) durchgehend zum Körper, denman hat (vgl. Plessner 1981), das heißt mehrund mehr zu einem Objekt technischer Um-gestaltung und Perfektionierung.
Unter den Gesichtspunkten des Wandelsund der Neudefinition von Herrschaftsfor-men und sozialen Ungleichheiten ist eine
Dimension der beschriebenen Entwicklun-gen von besonderem Interesse, die sich mitden bereits erwähnten individuellen Hand-lungsunsicherheiten und Entscheidungszwän-gen verschränkt und diese verstärkt: Vonnicht wenigen sozialwissenschaftlichen Be-obachtern wird befürchtet, es könnten sichneue Wahrnehmungs- und Bewertungskrite-rien für Individuen und individuelle Verhal-tensformen etablieren und verfestigen, diesich in erster Linie an scheinbar „naturalisti-schen“, tatsächlich aber technisch herge-stellten Standards wie „maximale körperli-che oder geistige Leistungsfähigkeit“, „Un-auffälligkeit des Verhaltens“, „Schönheit“,„Jugendlichkeit“ orientieren. Die Emanzipa-tion vom „naturgegebenen“ Körper scheint,so unsere zweite These, in paradoxer Weisein eine neue „Körperabhängigkeit“ zu mün-den. Das bedeutet, dass körperliche Attribute(Gesundheit, Jugendlichkeit, Schönheit etc.)auf neue Art an Bedeutung für soziale Hier-archiebildung, Distinktion und Diskriminie-rung gewinnen. Die weiterlaufende (wissen-schaftlich-technische) „Vergesellschaftungder Natur“ wird auf diese Weise durch einefragwürdige „Naturalisierung und Biologi-sierung des Sozialen“ ergänzt und teilweisekonterkariert (vgl. Bertilsson 2003). Dabeiist zu vermuten, dass nicht so sehr „substan-zielle“ Normen und Körperbilder als viel-mehr das beständige und letztlich unab-schließbare Bemühen um „Verbesserung“oder um eine nie einlösbare „Perfektionie-rung“ des Geist-Körper-Komplexes zur do-minierenden Verhaltenserwartung wird. UndErkrankungen, berufliche Misserfolge u.ä.könnten dann als Folge mangelnder Gesund-heitsverantwortung und eines unzureichen-den Körper-Monitorings den Individuen zu-gerechnet werden, wie es gegenwärtig in denRegulierungen des Rauchens, des Alkohol-konsums, der Gewichtskontrolle entlang des„Body Mass Index“ teilweise bereits an-klingt (vgl. Feuerstein/Kollek 2001). Ent-sprechend können sich „post-politische“ For-men von „Biomacht“, sozialer Ungleichheitund Konformismus herausbilden, die sichauch und gerade in den sozialen Praktikenund Motivlagen der individuellen Akteureausprägen und gewissermaßen festsetzen,indem beispielsweise bestimmte Konsumen-
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
560
tenbedürfnisse verstärkt oder überhaupt erstgeweckt werden: „Suitably stimulated, thedemand of consumers for easier means tobetter-behaved children, more youthful orbeautiful or potent bodies, keener or morefocused minds, and steadier or more cheerfulmoods is potentially enormous“ (Council onBioethics 2003: 302). Francis Fukuyama undandere Autoren befürchten in diesem Zu-sammenhang die Herausbildung einer „kos-metischen Psychopharmakologie“ zur „Ver-besserung oder Vervollkommnung ansonstennormaler Verhaltensformen oder zur Um-wandlung eines normalen Verhaltens in einanderes, von dem irgendwer meint, es seigesellschaftlich vorzuziehen“ (Fukuyama2002: 83). Unter diesem Blickwinkel rückendie Entwicklung und Verbreitung von Psy-cho- und Neuropharmaka, die Gentechnikund -diagnostik, Reproduktions-, Transplan-tations- und „Anti-Aging“-Medizin, kosme-tische Chirurgie, „Functional Food“, „Well-ness“ u.ä. in den Vordergrund der soziologi-schen Betrachtung. Gemeinsam ist diesenFeldern, dass darin alltagsrelevante Formender Krankheit/Gesundheit-Unterscheidunguneindeutig werden und die betroffenen In-dividuen, Familien oder Gruppen ohne nen-nenswerten institutionellen Rückhalt ent-scheiden müssen, an welchem der beiden„Pole“ der Unterscheidung (krank/gesundetc.) sie ihr Handeln ausrichten wollen. Diein diesen Bereichen beobachtbaren Ent-wicklungen bieten einerseits eine Vielzahlneuer medizinischer und technischer Optio-nen zur Verbesserung des Gesundheitszu-stands, des individuellen Wohlbefindens undder Leistungsfähigkeit. Sie erzeugen ande-rerseits in der „Grauzone“ zwischen Ge-sundheit und Krankheit fundamentale Hand-lungsunsicherheiten, erlegen den Betroffe-nen (illusionäre) Verantwortlichkeiten fürletztlich kaum beeinflussbare Gesundheitsri-siken auf und können als eine Art „diskreterCharme der Biokratie“ (Viehöver et al.2004) zu neuen Formen von Herrschaft, Ab-hängigkeit, Konformität und sozialer Un-gleichheit beitragen.
Gleichwohl ist vor dem Hintergrund derin Abschnitt 3 beschriebenen Differenzie-rungen und Ambivalenzen des biopolitischenFeldes keine lineare und eindeutige Tendenz
zur „Biologisierung des Sozialen“ zu erwar-ten. Denn die Auflösung (oder Re-Stabili-sierung) der Unterscheidungen von Gesund-heit und Krankheit sowie von Therapie undVerbesserung geschieht nicht zuletzt imRahmen alltäglicher Handlungspraktiken so-zialer (Mikro-)Akteure wie Individuen, Haus-halte, Familien; wenngleich gesellschaftlicherzeugt, werden die Ambivalenzen und ihreBearbeitung gleichsam „privatisiert“ (Bau-man 1992). Daher darf keinesfalls von einereinseitigen Determination der alltäglichenPraktiken durch Makro-Prozesse und -dis-kurse ausgegangen werden; vielmehr mussein wechselseitiges Interaktions- und Beein-flussungsverhältnis angenommen werden.Neue wissenschaftlich-technische Optionenkönnen durch die Alltagsakteure transfor-miert und in einer unerwarteten Weise ge-nutzt werden, und Selbsthilfegruppen oderPatientenorganisationen haben häufig einennicht zu unterschätzenden Einfluss auf dieHandlungsweisen und Entscheidungen vonwirtschaftlichen oder professionellen Akteu-ren. Umgekehrt werden jedoch die Entschei-dungen zur Nutzung von neuen „Technolo-gien des Selbst“ (Michel Foucault) sowohldurch professionelle, diskursive und medialeVermittlungsprozesse als auch durch diepraktische Verfügbarkeit und Zugänglichkeitneuer Produkte und Techniken strukturiert.Insofern sind die Mikro-Akteure bei ihrenHandlungen und Entscheidungen mit einemvielschichtigen, heterogenen und teilweise wi-dersprüchlichen Geflecht von (Makro-)Stra-tegien, Diskursen und Interessenlagen unter-schiedlicher wirtschaftlicher und professio-neller Akteure konfrontiert (Rose 2007).
Wie eingangs bereits angedeutet, werdendie skizzierten Phänomene und Tendenzengegenwärtig nicht nur in Politik und gesell-schaftlicher Öffentlichkeit, sondern auch inden Sozialwissenschaften kontrovers disku-tiert. Idealtypisch lässt sich dabei eine Rich-tung unterscheiden, die hier in erster Linieneue Freiheitsspielräume und die Entstehungerweiterter Formen der Selbstbestimmung(van den Daele 2005b) oder die Herausbil-dung neuartiger „bio-sozialer“ Gemein-schaften sehen will (vgl. z.B. Rabinow 2004;vgl. auch Rose 2001). Unter „Biosozialität“versteht der amerikanische Anthropologe
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
561
Paul Rabinow die Bildung von Selbsthilfe-und Betroffenengruppen, „deren Mitgliedersich treffen, um Erfahrungen auszutauschen,um auf ihre Krankheit hinzuweisen, um ihreKinder der Krankheit entsprechend zu erzie-hen und um ihre Umwelt ihrem Lebensum-stand anzupassen“ (Rabinow 2004: 143).Darin sieht Rabinow (ebd.: 139) gerade kei-ne Form von Gesellschaft, die „auf derGrundlage einer biologischen Metapher kon-struiert“ werde; vielmehr werde die Natur„in der Biosozialität auf der Grundlage vonKultur modelliert“.17 Eine andere Richtungder Diskussion erkennt in den angedeutetenProzessen jedoch eher eine problematische„Biologisierung des Sozialen“ sowie frag-würdige Tendenzen einer potenziell schran-kenlosen (Selbst-)Objektivierung, Instrumen-talisierung und Transformation des Menschen(vgl. u.a. Habermas 2001; Fukuyama 2002;Council on Bioethics 2003; Feuerstein/Kollek2001). Dabei drohe letztlich genau jenes au-tonome „Selbst“ verloren zu gehen, das dochsowohl die Voraussetzung als auch das Zielsolcher Optimierungsstrategien darstelle. Be-sonders dramatisch könnte dies der Fall seinbei zukünftig möglichen chirurgischen oderpharmakologischen Eingriffen in das Gehirnvon Personen, die deren individuelle Identitätmassiv verändern können (vgl. dazu Galert2005).
Nicht minder kontrovers wird daher dieFrage nach dem „naturgegebenen“, „gewach-senen“ Körper sowohl als Orientierungsrah-men wie auch als (personale, identitätsver-bürgende) Grundlage und Voraussetzung fürdie Nutzung biomedizinischer Optionen dis-kutiert (vgl. hierzu Bayertz 2004; Ach/Poll-mann 2006; Birnbacher 2006). Zumindest indem skeptischen Teil des öffentlichen undwissenschaftlichen Diskurses wird in diesemKontext die Forderung nach „Grenzen“ fürOptimierungsstrategien erhoben (vgl. z.B.Habermas 2001; Fukuyama 2002; Bertilsson2003; Council on Bioethics 2003: 298f.).Dabei ginge es nicht allein um „harte“ recht-lich-institutionell verankerte Grenzziehun-gen in Form von gesetzlichen Verboten undSanktionen, sondern gleichermaßen um„weiche“ kulturelle, ethische, lebensweltlichfundierte Schranken für wissenschaftlich-technische Visionen und Praktiken einer an-
scheinend schrankenlosen (Selbst-)Verbesse-rung des Menschen. Es zeigt sich jedoch,dass auch und gerade bei Versuchen, demMachbaren Grenzen zu setzen, nicht mehrumstandslos auf vermeintlich natürliche unddaher evidente Unterscheidungen zurückge-griffen werden kann (van den Daele 1987).Dies gilt für den „laienhaften“ Versuch derMoralisierung der menschlichen Natur eben-so wie für die Maschinerie der Ethikräte. Sogeht beispielsweise die Beratungskommissi-on für bioethische Fragen des US-amerika-nischen Präsidenten George W. Bush in ih-rem Bericht Beyond Therapy? zunächst zwarvon der Unterscheidung zwischen therapyund enhancement aus, räumt aber gleichzei-tig ein, dass diese Abgrenzung inzwischenselbst unscharf geworden ist und daher kei-nen eindeutigen Anhaltspunkt bietet, um dasethisch Vertretbare vom nicht Vertretbarenabzugrenzen (Council on Bioethics 2003:13ff.). Wie Eric Juengst (1998) hervorgeho-ben hat, muss diese Unschärfe aber nichtnotwendigerweise bedeuten, gänzlich auf dieUnterscheidung im Sinne einer kontextspezi-fisch handlungsleitenden Orientierung zuverzichten.
Angesichts der Vielschichtigkeit des bio-politischen Geschehens erweisen sich ver-gleichsweise klar geschnittene Alternativsze-narien (Biologisierung oder neue Biosozia-lität?) offenbar als zu schematisch. Statt-dessen dürften moderne Gesellschaften eszukünftig mit Formen der Gleichzeitigkeit,des „Sowohl-als-auch“ zu tun haben: sowohlmit neuartigen Dynamiken einer (vermeint-lich) „naturbasierten“ sozialen Diskriminie-rung und neuen Formen von körperbasierterMacht und Distinktion als auch mit neuensozialen Zusammenschlüssen und kollekti-ven Praktiken, die wiederum erweiterte Hand-lungsmöglichkeiten auch gegenüber einfluss-reichen (Makro-)Akteuren aus Wirtschaft,Wissenschaft und Politik eröffnen können.Eine soziologisch aufschlussreichere Frage-stellung und Forschungsprogrammatik ließesich daher wie folgt formulieren: Inwieweitbilden sich in unübersichtlichen Gemengela-gen gleichsam „zwischen“ den polarisiertenAlternativen Formen eines „reflexiv moder-nen“ Umgangs mit den sich auflösendenGrenzen zwischen dem „Natürlichen“ und
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
562
dem „Gesellschaftlichen“ oder „Künstlichen“heraus? „Reflexiv modern“ würde in diesemKontext bedeuten, die menschliche Körper-Natur nicht als gegebenes Faktum und unab-änderliches Schicksal zu verstehen, sondernsie als etwas kulturell und gesellschaftlichGestaltetes und Gestaltbares zu begreifen,ohne jedoch dem „modernistischen“ Phan-tasma einer grenzenlosen Formbarkeit undPerfektionierung der (menschlichen) Naturaufzusitzen. Lassen sich hier verbindliche,allgemein anerkannte Grenzen errichten –und soll man dies überhaupt versuchen?Oder müssen die Grenzziehungen zwischenNatürlichem und Künstlichem, Krankheitund Gesundheit, Heilung und Optimierungmittels einer „pragmatistischen Experimen-talität“ im Sinne John Deweys immer wiederneu ausgehandelt und in einem widersprüch-lichen Geflecht von wissenschaftlich-tech-nischen Möglichkeiten, kontrastierenden In-teressenlagen, Machtungleichgewichten, viel-schichtigen sozialen Praktiken und normati-ven Reflexionen ausbalanciert werden? Undwenn ja, in welchen institutionellen und so-zialen Kontexten könnte dies geschehen undgelingen?
Ein reflexiv werdender Umgang mit bio-politischen Entgrenzungstendenzen würdesomit einerseits die Notwendigkeit von ge-sellschaftlich zu ziehenden Grenzen des wis-senschaftlich-technischen Zugriffs auf die„Natur des Menschen“ anerkennen, ohne an-dererseits natürliche Gegebenheiten als prin-zipiell „unverfügbar“ zu tabuisieren, zu on-tologisieren oder zu sakralisieren. Unter ge-sellschafts- und demokratietheoretischen As-pekten bleibt bislang jedoch völlig offen undklärungsbedürftig, inwieweit individualisier-te und globalisierte moderne Gesellschaftensich überhaupt auf derartige Grenzziehungenverständigen könnten und auf welchen nor-mativen und rechtlichen Grundlagen sowiemit Hilfe welcher Institutionen und Verfah-ren dies aussichtsreich erschiene (vgl. hierzuWehling/Viehöver/Keller 2005).
Anmerkungen
1 Der Begriff „Biopolitik“ ist von Michel Fou-cault in den 1970er Jahren in die neuere sozi-alwissenschaftliche Diskussion eingeführt wor-den; er bezeichnete damit den „Eintritt derPhänomene, die dem Leben der menschlichenGattung eigen sind, in die Ordnung des Wis-sens und der Macht, in das Feld der politischenTechniken“ (Foucault 1977: 169). Dieser seitdem 18. Jahrhundert sich herausbildenden„Biomacht“ ging es nicht (wie dem vormoder-nen Souverän) um die Unterdrückung oderVernichtung des menschlichen Lebens, son-dern um seine Erhaltung und Optimierung.Biopolitik trat zunächst in Gestalt von Hygie-ne- und Bevölkerungspolitik an die Seite derDisziplinierung des individuellen Körpersdurch Militär, Erziehungs- und Schulwesenetc. In unserem Beitrag knüpfen wir an dasdurch Foucault geprägte Verständnis von Bio-politik an; in der aktuellen Debatte wird derBegriff häufig allerdings recht unspezifisch imSinne der (nachträglichen) politischen Reakti-on auf neue medizinisch-technische Optionenverwendet (vgl. z.B. van den Daele 2005b).
2 Diese Überlegungen sind entstanden im Rah-men des Forschungsvorhabens „Biologisie-rung des Sozialen oder neue Biosozialität?“ ander Universität Augsburg, einem Teilprojektdes Sonderforschungsbereichs „Reflexive Mo-dernisierung“ (München/Augsburg). Für hilf-reiche Anregungen und wertvolle Unterstüt-zung danken wir Brigitte Ploner, DeboraFrommeld und Fabian Karsch.
3 In seiner „Rahmen-Analyse“ hatte ErvingGoffman (1980) davon gesprochen, dass inmodernen Gesellschaften die Unterscheidungvon „Natur“ und „Gesellschaft“ einen „primä-ren Rahmen“ darstelle. Er bezeichnete damiteine basale Unterscheidung oder Leitdifferenz,die im Sinne einer sozialen „Definition derSituation“ genutzt wird, um einen menschlichbzw. gesellschaftlich nicht zu verantwortendenPhänomenbereich von der Sphäre menschli-cher Verursachung zu unterscheiden. Gegen-wärtig ist in zahlreichen gesellschaftlichenHandlungsbereichen eine tiefgreifende Erosiondieser modernen Basisunterscheidung von„Natur“ und „Gesellschaft“ sowie damit zu-sammenhängender spezifischer Unterschei-dungsmuster (z.B. natürlich/künstlich, krank/gesund) zu beobachten. Vgl. zur Bedeutungsowie zur Entgrenzung der modernen Natur-Gesellschaft-Unterscheidung aus unterschied-lichen Perspektiven: Luckmann 1980, Haber-
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
563
mas 1981, Latour 1995, Lau/Keller 2001, Lin-demann 2002, Viehöver et al. 2004.
4 Zweifellos ließ sich die Unterscheidung zwi-schen Gesundheit und Krankheit noch nie ver-bindlich und trennscharf vornehmen, nichtzuletzt, weil die Begriffe höchst unterschied-lich definiert wurden und werden (vgl. Lenk2006). Jedoch wird alltagsweltlich, und zwarauch im Alltag der Medizin, unter Krankheitzumeist die Unterbrechung des „normalen“Funktionierens (in Relation zu Alter, Ge-schlecht u.ä.) des menschlichen Körpers ver-standen.
5 Vgl. zu diesen Beispielen Conrad 1976, Con-rad/Potter 2000, Dworkin 2001, Moynihan/Cassels 2005, Scott 2006.
6 Vgl. zur Situation in den USA auch DeGrand-pre 2002 und Fukuyama 2002. Darüber hinausfindet Ritalin ähnlich wie Kokain auch Ver-wendung zur Verbesserung der geistigen Lei-stungsfähigkeit bei „nicht-hyperaktiven“ Er-wachsenen (Fukuyama 2002: 75f.).
7 Diese Parallelen werden besonders deutlich,wenn Conrad (2005: 3) als Kern des Medikali-sierungsgeschehens das „definitional issue“bezeichnet: „defining a problem in medicalterms, usually as an illness or disorder“.
8 Eine entscheidende theoretische wie kulturelleVoraussetzung für diesen Perspektivenwechselwar die seit den 1960er Jahren sich vollzie-hende Abkehr von einem objektivistischen(Selbst-)Bild der Wissenschaft und der Medi-zin sowie von einer naturalistischen Auffas-sung von Krankheiten „als natürliche Gege-benheiten (...), die als solche völlig unabhän-gig von ihrer Isolierung und Benennung durchdie Ärzte existieren“ (Schlich 1998: 114).
9 Aus diesem Grund wird Medikalisierung so-ziologisch nicht als ein eindimensionales undunaufhaltsames Geschehen begriffen, sondernausdrücklich auch die Möglichkeit von „De-medikalisierung“ (demedicalization) hervor-gehoben. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist dieallmähliche Demedikalisierung von Homose-xualität, die unter der Dominanz der Genetikaber wiederum abgelöst und konterkariertwerden könnte durch eine neuerliche Re-Medikalisierung.
10 Die enge Bindung von Medikalisierung an denEinfluss und die Definitionsmacht der ärztli-chen Profession war so gesehen eher Ausdruckeiner bestimmten historischen Phase und Ver-laufsform des Geschehens als eine inhärenteQualität von Medikalisierungsprozessen.
11 Hieran lässt sich ablesen, dass die Unterschei-dung der Entgrenzungsdynamiken nur idealty-pisch zu treffen ist. Denn in „Grauzonen“ un-
eindeutiger und umstrittener Krankheitsdefini-tionen mag es im Einzelfall schwer zu ent-scheiden sein, ob man es mit der Ausweitungvon Diagnostik oder der Entgrenzung vonTherapie zu tun hat.
12 Ein zweiter Entstehungskontext der ästheti-schen Chirurgie ist direkter mit sozialenMacht- und Herrschaftsverhältnissen verbun-den. Wie Gilman (1999, 2001) am Beispielvon Nasenoperationen bei Juden, Afro-Ameri-kanern oder Asiaten zeigt, geht es hierbei pri-mär um das „Unsichtbarmachen“ eines zurStigmatisierung genutzten vermeintlichen kör-perlichen „Makels“ und somit um die Anpas-sung an den (idealisierten) Körper einer domi-nanten sozialen Gruppe, weniger um die ten-denziell unabschließbare Optimierung des ei-genen Körpers nach den Kriterien von „Schön-heit“ oder „Jugendlichkeit“. Beide Aspektekönnen sich allerdings auch vermischen (vgl.Wehling 2005).
13 Dies ist durchaus auch eine Konsequenz ausder Etablierung des modernen industriegesell-schaftlichen Gesundheitsbegriffs seit dem aus-gehenden 18. Jahrhundert, der auf die Stabili-sierung und „Steigerung“ von Gesundheit aus-gerichtet ist (vgl. Labisch 1985, 1992).
14 Umstritten ist besonders, inwieweit Versiche-rungsunternehmen oder Arbeitgeber berechtigtsind, genetische Informationen über (potenzi-elle) Kunden oder Beschäftigte einzusehenoder dies sogar zur Bedingung für den Ab-schluss von Versicherungs- oder Arbeitsver-trägen zu machen.
15 Auch Bernhard Gill (2003: 161) vermutet,dass Perfektionierungsprogramme in breitenKreisen der Gesellschaft „Manipulationsängs-te“ auslösen könnten; „zu ‚therapeutischenHäppchen‘ kleingearbeitet und in die individu-elle Verfügung gestellt“, würden solche Pro-gramme aber sehr wohl akzeptiert.
16 Dies wird in der Abbildung durch Pfeile sym-bolisiert, die – jeweils in einem Quadrantenbeginnend – die eingespielten Unterscheidun-gen und Grenzziehungen in eine bestimmteRichtung überschreiten und damit zugleich in-frage stellen.
17 Hartmut Böhme (2004) spricht in diesem Zu-sammenhang von „Fortschritten der Biologieals Kultur“, durch die der Mensch zum Subjektder Evolution sowie seiner körperlichen undgenetischen Ausstattung werde. Kultur begin-ne nun schon auf subzellularer Ebene; es wür-den Prozesse gestaltbar, „die ehemals gleich-sam unter Naturschutz standen – wie Zeugung,Geburt, Tod, Gefühl, Wahrnehmung etc.“; dieshabe zu einer „eigentümlichen Drehung
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
564
zwischen Bio- und Geisteswissenschaften ge-führt“ (ebd.: 76). Biologie als Kulturtechnik un-terstehe den Aushandlungsregeln, die in unsererKultur gelten, somit sei sie historische Praxis.
Literatur
Ach, Johann/Arnd Pollmann (Hrsg.) (2006): nobody is perfect. Baumaßnahmen am menschli-chen Körper – Bioethische und ästhetischeAufrisse. Bielefeld: transcipt.
Bauman, Zygmunt (1992): Moderne und Ambi-valenz. Frankfurt a.M.: Fischer.
Bayertz, Kurt (Hrsg.) (2004): Die menschlicheNatur. Welchen und wieviel Wert hat sie?Paderborn: Mentis.
Bertilsson, Thora M. (2003): The Social as Trans-Genic. On Bio-Power and its Implications forthe Social. In: Acta Sociologica 46, S. 118-131.
Birnbacher, Dieter (2006): Natürlichkeit. Berlin:de Gruyter.
Böhme, Hartmut (2004): Die Fortschritte derBiologie als Kultur. In: Gegenworte, Nr. 13,Frühjahr, S. 75-78.
Breuer, Hubertus (2004): Vergessen auf Rezept.Was Unfallopfer von ihrem Trauma befreit,könnte auch ein Leben ohne Scham und Reueermöglichen. In: Süddeutsche Zeitung v.6.7.2004, S. 9.
Conrad, Peter (1976): Identifying HyperactiveChildren. The Medicalization of Deviant Be-havior. Lexington: D.C. Heath.
Conrad, Peter (1992): Medicalization and SocialControl. In: Annual Review of Sociology 18,S. 209-232.
Conrad, Peter (2005): The Shifting Engines ofMedicalization. In: Journal of Health and So-cial Behavior 46, S. 3-14.
Conrad, Peter/Valerie Leiter (2004): Medicaliza-tion, Markets and Consumers. In: Journal ofHealth and Social Behavior 45 (Extra Issue),S. 158-176.
Conrad, Peter/Deborah Potter (2000): From Hy-peractive Children to ADHD Adults: Obser-vations on the Expansion of Medical Catego-ries. In: Social Problems 47, S. 559-582.
Conrad, Peter/Joseph Schneider (1980): Devianceand Medicalization. From Badness to Sick-ness. St. Louis/Toronto/London: C.V. Mosby.
Council on Bioethics (2003): Beyond Therapy.Biotechnology and the Pursuit of Happiness. AReport of the President’s Council on Bio-ethics. Washington D.C., www.bioethics. gov(15. April 2004).
Daele, Wolfgang van den (1987): Die Moralisie-rung der menschlichen Natur und Naturbezügein gesellschaftlichen Institutionen. In: Kriti-sche Vierteljahresschrift für Gesetzgebung undRechtswissenschaft 2, S. 351-366.
Daele, Wolfgang van den (Hrsg.) (2005a): Bio-politik. Leviathan, Sonderheft 23, Wiesbaden:VS Verlag.
Daele, Wolfgang van den (2005b): „Einleitung:Soziologische Aufklärung zur Biopolitik“. In:Wolfgang van den Daele (Hrsg.), Biopolitik.Leviathan, Sonderheft 23, Wiesbaden: VSVerlag, S. 7-41.
Damm, Reinhard (2004): GesetzgebungsprojektGentestgesetz – Regelungsprinzipien und Re-gelungsmaterien. In: Medizinrecht 22, S. 1-19.
Davis, Kathy (1995): Reshaping the FemaleBody. The Dilemma of Aesthetic Surgery.New York: Routledge.
Degele, Nina (2004): Sich schön machen. Zur So-ziologie von Geschlecht und Schönheitshan-deln. Wiesbaden: VS Verlag.
DeGrandpre, Richard J. (2002): Die Ritalin-Gesellschaft: ADS, eine Generation wirdkrankgeschrieben. Weinheim: Beltz.
De Grey, Aubrey (Hrsg.) (2004): Strategies forEngineered Negligible Senescence. New York:Annals of the New York Academy of Sci-ences, Bd. 1019.
Dworkin, Ronald (2001): The Medicalization ofUnhappiness. In: The Public Interest, Nr. 144,S. 85-99.
Ferber, Christian von (1989): Medikalisierung –ein zivilisatorischer Prozeß oder eine sozial-politische Fehlleistung? In: Zeitschrift für So-zialreform 35, S. 632-642.
Feuerstein, Günter/Regine Kollek (2001): Vom ge-netischen Wissen zum sozialen Risiko: Gendia-gnostik als Instrument der Biopolitik. In: AusPolitik und Zeitgeschichte, B 27, S. 26-33.
Feuerstein, Günter/Regine Kollek/Thomas Uhle-mann (2002): Gentechnik und Krankenversi-cherung. Baden-Baden: Nomos.
Fleischer, Torsten/Michael Decker (2005): Con-verging Technologies. Verbesserung menschli-cher Fähigkeiten durch emergente Techniken?In: Alfons Bora/Michael Decker/Armin Grun-wald/Ortwin Renn (Hrsg.), Technik in einerfragilen Welt. Berlin: edition sigma, S. 121-132.
Fosket, Jennifer (2004): Constructing „High-RiskWomen“: The Development and Standardiza-tion of a Breast Cancer Risk Assessment Tool.In: Science, Technology and Human Values29, S. 291-313.
Foucault, Michel (1977): Sexualität und Wahr-heit, Bd. 1: Der Wille zum Wissen. Frankfurta.M.: Suhrkamp
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
565
Foucault, Michel (1999): In Verteidigung der Ge-sellschaft. Vorlesungen am Collège de France1975-1976. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Foucault, Michel (2002): Die Geburt der Klinik.Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frank-furt a.M.: Fischer.
Fukuyama, Francis (2002): Das Ende des Men-schen. Stuttgart/München: Deutsche Verlags-Anstalt.
Galert, Thorsten (2005): Inwiefern können Ein-griffe in das Gehirn die personale Identität be-drohen? In: Alfons Bora/Michael Dek-ker/Armin Grunwald/Ortwin Renn (Hrsg.),Technik in einer fragilen Welt. Berlin: editionsigma, S. 91-99.
Gesang, Bernward (2007): Perfektionierung desMenschen. Berlin: de Gruyter.
Geyer, Christian (Hrsg.) (2001): Biopolitik. DiePositionen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Gill, Bernhard (2003): Streitfall Natur. Weltbilderin Technik- und Umweltkonflikten. Wies-baden: Westdeutscher Verlag.
Gilman, Sander (1999): Making the Body Beauti-ful. A Cultural History of Aesthetic Surgery.Princeton: Princeton University Press.
Gilman, Sander (2001): Die Operation, die un-sichtbar machte. In: Gero von Randow (Hrsg.),Wieviel Körper braucht der Mensch? Ham-burg: edition Körber-Stiftung, S. 17-21.
Goffman, Erving (1980): Rahmen-Analyse. EinVersuch über die Organisation von Alltagser-fahrungen. Franfurt a.M.: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommuni-kativen Handels. Band I. Frankfurt a.M.: Suhr-kamp.
Habermas, Jürgen (2001): Die Zukunft dermenschlichen Natur. Frankfurt a.M.: Suhr-kamp.
Hennen, Leonhard/Thomas Petermann/ArnoldSauter (2001): Das genetische Orakel. Progno-sen und Diagnosen durch Gentests – eine ak-tuelle Bilanz. Berlin: edition sigma.
Hughes, James (2004): Citizen Cyborg. WhyDemocratic Societies Must Respond to theRedesigned Human of the Future. Boulder,CL: Westview.
Juengst, Eric (1998): What Does EnhancementMean? In: Erik Parens (Hrsg.), EnhancingHuman Traits. Ethical and Social Implications.Washington, D.C.: Georgetown Univ. Press, S.29-47.
Kahlweit, Cathrin (2004): Ich will nicht aussehenwie meine Mutter. In: Süddeutsche Zeitung v.21.9.2004, S. 15.
Kandel, Eric (2006): In Search of Memory. TheEmergence of a New Science of Mind. NewYork/London: W.W. Norton & Co.
Karafyllis, Nicole (Hrsg.) (2003): Biofakte. Ver-such über den Menschen zwischen Artefaktund Lebewesen. Paderborn: Mentis.
Kettner, Matthias (2006): „Wunscherfüllende Me-dizin“ zwischen Kommerz und Patientendien-lichkeit. In: Ethik in der Medizin 18, S. 81-91.
Klein, Stefan (2004): Niemand hat die Pflicht,sich zu erinnern. Die Frage der Zukunft: EricKandel entwickelt eine Pille gegen das Ver-gessen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.24.6.2004, S. 35.
Labisch, Alfons (1985): Die soziale Konstruktionder „Gesundheit“ und des „homo hygienicus“:Zur Soziogenese eines sozialen Gutes. In:Österreichische Zeitschrift für Soziologie 10,S. 60-81.
Labisch, Alfons (1992): Homo Hygienicus. Ge-sundheit und Medizin in der Neuzeit. Frank-furt a.M./New York: Campus.
Latour, Bruno (1995): Wir sind nie modern gewe-sen. Versuch einer symmetrischen Anthropo-logie. Berlin: Akademie-Verlag.
Lau, Christoph/Reiner Keller (2001): Natur undGesellschaft – Zur Politisierung gesellschaftli-cher Naturabgrenzungen. In: UlrichBeck/Wolfgang Bonß (Hrsg.), Die Moderni-sierung der Moderne. Frankfurt a.M.: Suhr-kamp, S. 82-95.
Lemke, Thomas (2002): Mutationen des Gendis-kurses: Der genetische Determinismus nachdem Humangenomprojekt. In: Leviathan 30, S.400-425.
Lemke, Thomas (2003): Molekulare Medizin?Anmerkungen zur Ausweitung und Redefiniti-on des Konzepts der genetischen Krankheit.In: Prokla 33, S. 471-492.
Lemke, Thomas (2006): Die Polizei der Gene.Formen und Felder genetischer Diskriminie-rung. Frankfurt a.M./New York: Campus.
Lemke, Thomas/Christine Lohkamp (2005): For-men und Felder genetischer Diskriminierung.Ein Überblick über empirische Studien undaktuelle Fälle. In: Wolfgang van den Daele(Hrsg.), Biopolitik. Leviathan, Sonderheft 23,S. 45-70.
Lenk, Christian (2002): Therapie und Enhance-ment. Ziele und Grenzen der modernen Medi-zin. Münster: LIT.
Lenk, Christian (2006): Verbesserung als Selbst-zweck? Psyche und Körper zwischen Abwei-chung, Norm und Optimum. In: JohannAch/Arnd Pollmann (Hrsg.), no body is per-fect. Baumaßnahmen am menschlichen Körper– Bioethische und ästhetische Aufrisse. Biele-feld: transcript, S. 63-78.
Leuzinger-Bohleber, Marianne (2006): Einfüh-rung. In: Marianne Leuzinger-Bohleber/
P. Wehling u.a.: Zwischen Biologisierung des Sozialen und neuer Biosozialität
566
Yvonne Brandl/Gerald Hüther (Hrsg.), ADHS– Frühprävention statt Medikalisierung. Theo-rie, Forschung, Kontroversen. Göttingen:Vandenhoeck & Rupprecht, S. 9-49.
Leuzinger-Bohleber, Marianne/Yvonne Brandl/Gerald Hüther (Hrsg.) (2006): ADHS – Früh-prävention statt Medikalisierung. Theorie, For-schung, Kontroversen. Göttingen: Vanden-hoeck & Rupprecht.
Leven, Karl-Heinz (2006): „Eine höchst wohlthä-tige Bereicherung unserer Kunst“ – PlastischeChirurgie in medizinhistorischer Perspektive.In: Zeitschrift für medizinische Ethik 52,S.127-137.
Lindemann, Gesa (2002): Die Grenzen des So-zialen. Zur sozio-technischen Konstruktionvon Leben und Tod in der Intensivmedizin.München: Fink.
Luckmann, Thomas (1980): Die Grenzen der So-zialwelt. In: Thomas Luckmann, Lebensweltund Gesellschaft. Grundstrukturen und ge-schichtliche Wandlungen. Paderborn/Mün-chen/Wien/Zürich: Schöningh, S. 56-92.
Maio, Giovanni (2006): Die Präferenzorientie-rung der modernen Medizin als ethisches Pro-blem. Ein Aufriss am Beispiel der Anti-Aging-Medizin. In: Zeitschrift für medizinische Ethik52, S. 339-354.
Mattner, Dieter (2006): ADS – die Biologisierungabweichenden Verhaltens. In: Mariannne Leu-zinger-Bohleber/Yvonne Brandl/Gerald Hüther(Hrsg.), ADHS – Frühprävention statt Medikali-sierung. Theorie, Forschung, Kontroversen. Göt-tingen: Vandenhoeck & Rupprecht, S. 51-69.
Mauss, Marcel (1989): Körpertechniken. In: ders.,Soziologie und Anthropologie. Frankfurt a.M.:Fischer, S. 199-220.
Moynihan, Ray/Alan Cassels (2005): SellingSickness. How the World’s Biggest Pharma-ceutical Companies Are Turning Us All intoPatients. New York: Nation Books.
Nye, Robert A. (2003): The Evolution of theConcept of Medicalization in the Late Twenti-eth Century. In: Journal of History of the Be-havioural Sciences 39, S. 115-129.
Parens, Erik (Hrsg.) (1998): Enhancing HumanTraits. Ethical and Social Implications. Wa-shington, D.C.: Georgetown University Press.
Plessner, Helmuth (1981): Die Stufen des Organi-schen und der Mensch. Gesammelte Schriften,Bd. IV. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Rabinow, Paul (2004): Artifizialität und Aufklä-rung. Von der Soziobiologie zur Biosozialität.In: Paul Rabinow, Anthropologie der Ver-nunft. Studien zu Wissenschaft und Lebens-führung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 129-152.
Rheinberger, Hans-Jörg (1996): Jenseits von Na-tur und Kultur. Anmerkungen zur Medizin imZeitalter der Molekularbiologie. In: CorneliusBorck (Hrsg.), Anatomien medizinischen Wis-sens. Medizin, Macht, Moleküle. Frankfurta.M.: Fischer, S. 287-306.
Roco, Mihail/William Sims Bainbridge (2002):Converging Technologies for Improving Hu-man Performance. Washington, D.C.: NationalScience Foundation.
Rose, Nikolas (2001): The Politics of Life Itself.In: Theory, Culture and Society 18, S. 1-30.
Rose, Nikolas (2007): The Politics of Life Itself.Biomedicine, Power, and Subjectivity in theTwenty-First Century. Princeton/Oxford: Prin-ceton University Press.
Schlich, Thomas (1998): Wissenschaft: Die Her-stellung wissenschaftlicher Fakten als Themader Geschichtsforschung. In: NorbertPaul/Thomas Schlich (Hrsg.), Medizinge-schichte: Aufgaben, Probleme, Perspektiven.Frankfurt a.M./New York: Campus, S. 107-129.
Schlich, Thomas (2001): Eine kurze Geschichteder Körperverbesserung. In: Gero von Randow(Hrsg.), Wieviel Körper braucht der Mensch?Hamburg: edition Körber-Stiftung, S. 131-144.
Schöne-Seifert, Bettina (2006): Pillen-Glück stattPsycho-Arbeit. Was wäre dagegen einzuwen-den? In: Johann Ach/Arnd Pollmann (Hrsg.),no body is perfect. Baumaßnahmen ammenschlichen Körper – Bioethische und äs-thetische Aufrisse. Bielefeld: transcript, S.279-291.
Scott, Susie (2006): The Medicalisation of Shy-ness: From Social Misfits to Social Fitness. In:Sociology of Health & Illness 28, S. 133-153.
Viehöver, Willy (2007): Auf dem Wege zu einerprotestantischen Ethik des Alterns? Anti-Aging als eine Form der methodischen Selbst-disziplinierung des Leibes. In: Karl-SiegbertRehberg (Hrsg.), Die Natur der Gesellschaft.Verhandlungen des 33. Kongresses der Deut-schen Gesellschaft für Soziologie in Kassel2006. Frankfurt a.M./New York: Campus(i.E.).
Viehöver, Willy/Robert Gugutzer/Reiner Kel-ler/Christoph Lau (2004): Vergesellschaftungder Natur – Naturalisierung der Gesellschaft.In: Ulrich Beck/Christoph Lau (Hrsg.), Ent-grenzung und Entscheidung: Was ist neu ander Theorie reflexiver Modernisierung? Frank-furt a.M.: Suhrkamp, S. 65-94.
Wehling, Peter (2003): Das Recht auf Nichtwis-sen in der Humangenetik – ein „Irrläufer“ inder Wissensgesellschaft? In: Jutta Allmendin-ger (Hrsg.), Entstaatlichung und soziale Si-
Berl.J.Soziol., Heft 4 2007, S. 547-567
567
cherheit. Verhandlungen des 31. Kongressesder Deutschen Gesellschaft für Soziologie inLeipzig 2002. 2 Bde. und CD-ROM. Opladen:Leske + Budrich (CD-ROM).
Wehling, Peter (2005): Social Inequalities Be-yond the Modern Nature-Society-Divide? TheCases of Cosmetic Surgery and Predictive Ge-netic Testing. In: Science, Technology & In-novation Studies 1, S. 3-15 (www.sti-studies.de).
Wehling, Peter (2006): Renaturalisierung sozialerUngleichheit – eine (Neben-)Folge gesell-schaftlicher Modernisierung? In: Karl-SiegbertRehberg (Hrsg.), Soziale Ungleichheit, kultu-relle Unterschiede. Verhandlungen des 32.Kongresses der Deutschen Gesellschaft fürSoziologie in München 2004. Frankfurta.M./New York: Campus, S. 526-539.
Wehling, Peter (2007): Biomedizinische Optimie-rung des Körpers – individuelle Chance odersuggestive soziale Norm? In: Karl-Siegbert
Rehberg (Hrsg.), Die Natur der Gesellschaft.Verhandlungen des 33. Kongresses der Deut-schen Gesellschaft für Soziologie in Kassel2006. Frankfurt a.M./New York: Campus(i.E.).
Wehling, Peter/Willy Viehöver/Reiner Keller(2005): Wo endet die Natur, wo beginnt dieGesellschaft? Doping Genfood, Klimawandelund Lebensbeginn: die Entstehung kosmopoli-tischer Hybride. In: Soziale Welt 56, S. 137-158.
Wiesing, Urban (2006): Die ästhetische Chirur-gie. Eine Skizze der ethischen Probleme. In:Zeitschrift für medizinische Ethik 52, S. 139-154.
Wolf, Nicola (2002): Krankheitsursachen Gene.Neue Genetik und Public Health. Wissen-schaftszentrum Berlin für Sozialforschung.Veröffentlichungsreihe der Arbeitsgruppe Pu-blic Health, P02-2002.