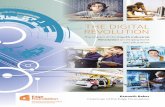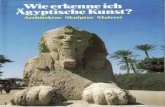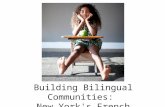Die ägyptische Revolution: Klassische Revolution oder Aufstand neuer Art?
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Die ägyptische Revolution: Klassische Revolution oder Aufstand neuer Art?
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT
SEMINAR: DIE ARABISCHE REVOLUTION UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF POLITIK UND GESELLSCHAFT
DOZENTIN: DR. RENATE STRASSNERWINTERSEMESTER 12/13
Die Ägyptische Revolution – eine traditionelle Revolution oder eine moderne Art von Aufstand?
Samira Cheurfi (5. Semester) HF: Kommunikationswissenschaft
NF: Politikwissenschaft
Inhaltsverzeichnis
Einleitung...............................................................................................................................................1
Die Ursachen.......................................................................................................................................2-9
Klassenbewusstsein............................................................................................................................2
Identitätsverlust...............................................................................................................................2-4
Ökonomischer Aufschwung bei ungleichem Ressourcenzugang…………………………………………………..5-6
Fehlende Synchronisation von sozialen Ansprüchen und politisch reformerischer Tätigkeit…………6-7
Privilegierung und Klientelismus…………………………………………………………………………………………………....8
Das Führerprinzip……………………………………………………………………………………………………………………………8
Der Verlauf……………………………………………………………………………………………………………………………………9-11
Initiierung…………………………………………………………………………………..…………………………………………………..9
Zyklischer Revolutionsverlauf………………………………………………………………………………………………………….9
Evolution der Führerrolle………………………………………………………………………………………………………...10-11
Fazit………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Bibliographie……………………………………………………………………………………………………………………………….13-17
Anhang……………………………………………………………………………………………………………………………………….18-24
Einleitung
Im Rahmen der Analyse der französischen Revolution wurde ein selbiges Ereignis im klassischen Sinne
definiert als
„[e]inmaliges Ereignis mit Umsturzcharakter im politischen Bereich oder als systematisch geplanter,
bewusst vorangetriebener Prozess der Gesellschaftsveränderung oder als Kombination beider
Elemente“ (Wassmund, 1978: 25-26).
Bereits damals existierte demnach die Einsicht, dass neben der reinen Einteilung in willkürlich oder
systematisch auftretene Formen von Revolutionen eine Mischform beider Arten möglich ist.
2007 erst stellte Nassem Nicholas Taleb in seinem Buch „The Black Swan“ dann die black-swan-
Theorie auf, welche Ereignisse beschreibt, die außerhalb der konventionellen Erwartungen auftreten,
weitreichende Effekte haben und deren Auftreten retrospektiv betrachtet durchaus logisch erscheint
(Taleb 2007 xvii ff.).
Inwieweit lässt sich der Fall Ägypten in eine von klassischen Revolutionstheoretikern ausdifferenzierte
Form einer Umsturzbewegung einordnen und was machte sie dennoch zu einem „black swan“ und
damit unvorhersehbar?
Um diese Frage zu erörtern, wird zunächst ein Vergleich aufgestellt zwischen den von klassischen
Revolutionstheorien postulierten Ursachen für Aufstände und den multiplen Ursachen, die zur
Massenerhebung in Ägypten führten. Aus der Masse dieser Revolutionstheorien werden hierbei
unter anderem marxistische Theorien, philosophische sowie funktionalistische Theorien aufgeführt.
Zur Ermittlung von vorhandenen oder fehlenden Parallelen zum Fallbeispiel werden größtenteils
journalistische Online-Publikationen verwendet, da es sich um eine wissenschaftlich noch nicht
vollkommen evaluierte Thematik handelt. Allerdings gibt es bereits einzelne wissenschaftliche
Studien und Forschungspublikationen offizieller Stellen, die vor allem bei der Analyse der Ursachen
aus ägyptischer Perspektive hilfreich sein werden.
Durch den Vergleich des Revolutionsverlauf des nordafrikanischen Landes mit jenen der
europäischen, amerikanischen und russischen Revolutionen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts folgt
schließlich ein Abgleich der Chronologie der Ereignisse, der ebenso entscheidend zur Ermittlung von
existierenden Parallelen oder Nova beitragen wird.
Die Ursachen
Die Frage nach den Ursachen einer Revolution ist ein zentraler Aspekt der traditionellen Theorien. Die
Lösung wird bei den verschiedensten Theorien vorwiegend auf der ökonomischen sowie der sozio-
kulturellen Ebene erforscht.
Klassenbewusstsein
Marxistische Revolutionstheorien verbinden hierbei diese Ebenen und machen das wachsende
Klassenbewusstsein der Arbeiterschicht und die Wahrnehmung der Ausbeutung der Arbeitskraft
verantwortlich für das stetige Wachsen und den schließlichen Ausbruch des Revolutionsgedankens
(Lenin 1895: 85, 1916: 58-59). Es lässt sich in diesem Punkt einen Analogie zu der Bewegung in
Ägypten finden: So rekurriert Paul Mason von der BBC bei seiner Analyse der Ursachen der
Revolution auf das Aufkommen eines neuen soziologischen Typs der ägyptischen Jugend: „the
graduate with no future“ (Mason 2011). Das explosive Potential, welches er dieser Klasse in
Verbindung mit dem Zugang zu neuen Medien zuschreibt, korreliert außerdem mit der Analyse John
Dunns. Nach der Analyse dieses klassischen Theoretikers treten Revolutionen vor allem in Ländern
auf, in denen das Wissen um materielle Gesellschaften existiert bei gleichzeitigem Misstrauen, dass
die eigene Regierung diese gesellschaftliche Evolution reformerisch unterstützt (Dunn 1989 :23). Mit
Dunns Ansatz korreliert ebenso, dass die negative Wahrnehmung der politischen
Beteiligungsmöglichkeiten nicht ihrem Wunsch nach einer solchen Partizipation entspricht. Der
Verwaltungsapparat war zu Mubarak-Zeiten so weit zentralisiert, dass in den Augen der Bürger die
Abstimmung mit lokalen Bedürnissen nicht realisiert werden konnte (Institute of National Planning,
Egypt 2004: 3).
Identitätsverlust
Der Fall Ägypten zeigt darüber hinaus Analogien zu klassischen Theorien auf, die die Ursachen für die
Revolution auf der sozio-kulturellen Ebene ansiedeln. So indiziert Hannah Arendt, dass fehlende
traditionelle Bindungen zum Identitätsverlust des Individuums und somit zu einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs von Massenbewegungen führen (Arendt 1955: 496, 504-508). Das
Individuum reiht sich bei der Suche nach einer identitätsspendenden Gemeinschaft in eine Masse
ein, sobald ein bindender Faktor geboten wird. Ein zentraler Aspekt bei dem Konstrukt der Masse ist
die Mobilisierung, die Erfolg oder Zerfall ihrer Bewegung bestimmt. Le Bon als weiterer
Massentheoretiker definiert die Ideologie als Erfolgsdeterminator in der Mobilisierung (Le Bon 1912 :
86-91, 105-110) Ein dem Mobilisierungseffekt zusprechender Faktor im ägyptischen Fall ist die
Bedeutung der sozialen Medien als Informations- und Organisationsplattformen. Nach einer Studie
der Universität Michigan korreliert die Informierung über TV, Zeitungen und neuen Medien (Internet,
Mobiltelefon) hochsignifikant positiv mit der Partizipation der repräsentativen Stichprobe von circa
3000 Ägyptern (vgl. Grafik 1, Moaddel 2012: 24-25). Das bedeutet, dass die Mobilisierung, die von
Oppositionsparteien wie „Kefaya“ 2008 online initiiert wurde (Storck 2011: 21) und große Fortschritte
durch Social Media-Seiten wie „We are all Khaled Said“ (Giglio 2011) verzeichnete, ausschlaggebend
war für das Aufkommen der Massenbewegung zu dem präzisen Zeitpunkt. Was ebenso für diese
Korrelation spricht, ist das stetige Ansteigen der Facebook-User in den Monaten vor und während der
Revolution. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Revolution belief sich die Zahl auf circa 150.000 Nutzer
(vgl. Grafik 2, Dubai School of Government 2012).
Die Mobilisierung war somit erfolgreich, lässt sich allerdings ebenso eine Parallele ziehen zu der von
Arendt konstatierten Voraussetzung der Identitätskrise? Inwieweit kann man überhaupt von einer
Identitätskrise der Bürger Ägyptens sprechen und war die Massenbewegung ein
identitätsspendendes Moment? Zunächst muss hierbei auf die Geschichte des Landes eingegangen
werden:
Bis in den Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde Ägypten fremdregiert, zunächst von
den Persern, dann begann mit der Herrschaft der Umayyaden die Arabisierung des Landes bis es im
19. Jahrhundert schließlich von den Briten kolonialisiert wurde (Ploetz 1998: 1117-1120). Die
britische Herrschaft dauerte über ein Jahrhundert an, die Architektur, Sprache und Bildung wurde
dem Vorbild Englands angepasst. Ägypter der alten Generation identifizierten sich somit
möglicherweise über diese „säkulare“, retrospektiv eventuell als „freier“ wahrgenommene,
wenngleich europäisierte Form der Regierung und des Lebensstils (Ibrahim 2011). Was folgte, war die
Ägyptische Revolution von 1952, aus der Naguib als erster Präsident Ägyptens hervorging, welcher
mit Gamal Nasser die Ägyptische Unabhängigkeit verkündete. Letzterer verschaffte dem Land unter
der Mission des Pan-Arabismus eine führende Rolle innerhalb der arabischen Staaten und spielte
auch im Ost-West-Konflikt eine dominante Rolle, Nasser stellte sich auf Seiten des sozialistischen
Lagers (Heikal 1978: 124-147). Sein Sukzessor Sadat wiederum löste Ägypten aus der Bindung zur
Sowjetunion und trieb vor allem den Friedensprozess mit Israel voran. Als Konsequenz folgte der
Ausschluss aus der Arabischen Liga (1979), somit das Ende Ägyptens Führung unter den arabischen
Ländern und die Abwendung vom Pan-Arabismus. Nach dem Tod Sadats rückte schließlich Mubarak
nach, der das Land in der Folge 30 Jahre regierte (Ploetz 1998: 1629-1933). Mit der Regierung der
Muslimsbrüder zeichnet sich nun eine mögliche Islamisierung ab. Aus diesem Ablauf der
Fremdherrschaft, Kolonialisierung, Pan-Arabismus und dem Wegfallen des Gleichen ließe sich
durchaus auf eine fortdauernde Identitätskrise der ägyptischen Bürger schließen. Zu der Annahme
würde ebenso passen, dass es Bürger aller Bevölkerungsschichten auf die Straße getrieben und
vereint hat (The Monitor Editorial Board 2011). Es scheint mit Hinblick auf diese Episoden schwer,
einen klaren nationalen Charakter zu definieren, der über Vaterlandsstolz eine mögliche
Identitätsquelle bieten könnte. Die aktuellen Entwicklungen in Ägypten lassen außerdem die Frage
offen, ob Religion eine solche Rolle realisieren könnte. Bei 90% Muslimen innerhalb der Bevölkerung
(index mundi 2012) ließe sich vermuten, dass ein bindender Faktor auf dem spirituellen Niveau
gefunden werden könnte. Jedoch ist zu berücksichtigen, in wieviele Subgruppierungen sich der Islam
aufteilt und auch in Ägypten eine Union verhindert. Als Beispiel sei hier nur der Konflikt zwischen
Sufis und Salafisten zu nennen, die eine grundlegend unterschiedliche Interpretation des Korans
trennt (Brown 2011: 1) und die bis heute gewaltsam aneinander geraten, zuletzt im Zuge der
Revolution, als Salafisten 16 Moscheen von Sufismus-Anhängern überfielen (al-Alawi 2011). Religion
mag ergo für Gruppierungen als Identitätsbasis dienen, sie kann jedoch nicht universell bindender
Faktor in Ägypten sein. Dieser Punkt spricht einerseits für das massentheoretische Postulat Arendts
des Identitäsverlustes, widerspricht andererseits der Bon’schen Bedeutung von Ideologie. Denn wenn
weder Religion ideologischen Charakter aufweist und somit den Erfolg der Bewegung determiniert,
noch andere zentrale Führungspositionen zu identifizieren sind, fällt es schwer, den Fall Ägypten ohne
weiterführende Analyse in die Tradition klassischer Revolutionen einzureihen.
Ökonomischer Aufschwung bei ungleichem Ressourcenzugang
Neben der sozio-kulturellen ist die wirtschaftliche Analyseebene weiterhin zu betrachten, um
mögliche Analogien zu klassischen Revolutionstheorien zu ermitteln. Crane Brinton, der durch die
Evaluation der englischen, französischen, amerikanischen und russischen Revolution eine universelle
Typologisierung von Revolutionen vornimmt, stellt fest, dass diese vor allem in Gesellschaften
ökonomischen Aufschwungs auftreten (Brinton 1965: 29-32). Ägypten hat dieses Charakteristikum
durchaus aufgewiesen: Es wurde bereits zu den Ländern der „Next 11“ (2005) oder der „Civets“
(2008) gezählt, Länder also, die sich in starkem wirtschaftlichen Wachstum befinden und ökonomisch
auf die BRIC-Staaten folgen (Moore 2012). Nach einer Untersuchung des Internationalen
Währungsfonds näherte sich das BIP Ägyptens seit 2004 stetig dem der Schwellenländer an (vgl.
Grafik 3, IMF 2007). Als gleichsam auftretenden Faktor identifizierte Brinton außerdem
unverhältnismäßigen Ressourcenzugang verschiedener Gesellschaftsschichten. Als zutreffendes
Beispiel lässt sich hier das Gesundheitssystem Ägypents nennen: Die Health Insurance Organization,
die ein universelles Versicherungsnetz für alle Bürger anstrebt, ist einer der Hauptversicherer des
Landes. Allerdings beschränkt sich ihr Dienst noch auf urbane Gebiete (Rannan-Eliya 1999: 5),
wodurch Bewohner des ländlichen Raumes ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen können. Darüber
hinaus ist dieser Versicherer nicht profitabel, die Ausgaben liegen über den Einnahmen, was die
Organisation in finanzielle Abhängigkeit der Regierung bringt (Rannan-Eliya 1999: 5). Darüber hinaus
ist auch eine qualitativ hochwertige ambulante Behandlung nicht kostenlos: Die vom
Gesundheitsministerium betriebenen Universitätskrankenhäuser, die eine höhere Qualität aufweisen,
verlangen Behandlungsgebühren. Eine Untersuchung der Universität Harvard zur ägyptischen
Gesundheitsversorgung zeigt hierzu, dass der Zugang privater Behandlung nach Einkommen
signifikant steigt (Rannan-Eliya 1999: 6). Die Schicht mit dem geringsten Einkommen nutzt diese
Versorgungsart nur zu ca. 10%, während die reichste Bevölkerungsschicht fast zur Hälfte private
Einrichtungen nutzt. Auch der Gesamtaufwand favorisiert mit einem Unterschied von circa 20
Prozentpunkten die höheren Einkommensschichten (vgl. Grafik 4, Rannan-Eliya 1999: 22).
Das Problem des ungleichen Ressourcenzugangs ist ebenso auf die Behausungssituation anzuwenden
und ist, wie das Problem der fehlenden lokalen politischen Beteiligungsmöglichkeiten, auf die
politische Zentralisierung zurückzuführen (Institute of National Planning, Egypt 2004: 15). Diese hat in
den vergangenen Jahren zu einem Missverhältnis zwischen Bevölkerungswachstum und
Wohnungsbau geführt, so zählten noch Mitte 2012 zur weiteren Umgebung Ägyptens 40% inoffizielle
Behausungen, in denen bis zu 15 Mio. Ägypter lebten (Sabry 2012). Durch diese Ressourcenknappheit
lässt sich auch erklären, warum sich unter den größten Wünschen der urbanen Jugend eine
angemessene Behausung befindet (vgl. Grafik 5, Institute of National Planning, Egypt 2010: 201).
Fehlende Synchronisation von sozialen Ansprüchen und politisch reformerischer Tätigkeit
Aus dem funktionalistischen Lager und rekurrierend auf die politische Analyseebene kommt die
Theorie, dass sich die Revolution auf die fehlende Anpassungsfähigkeit der Regierung an komplexere
Staatsaufgaben zurückführen lässt (Johnson 1971: 73-78, 111, 132). So treten mit ökonomischen
Aufschwung veränderte Werte innerhalb der Gesellschaft und ihrer Umwelt auf. In so einem Fall habe
eine Regierung zwei Möglichkeiten: Entweder sie versucht reformerisch die neuen Erwartungen der
Bevölkerung zu erfüllen, um die steigende Spannung zu lösen oder sie ignoriert die Anforderungen.
Letzteres provoziert nach Johnson eine konfliktreiche Situation und die existierende
Dissynchronisation verlangt eine verstärkte Verwendung von Sicherheitskraft innerhalb des Staates.
Ist eine Synchronisation der sozialen Ansprüche und politischen Aktivität auch in Ägypten
ausgeblieben?
Die Anzahl der Proteste in Ägypten vor dem Ausbruch der Revolution und die ausbleibende
reformerische Aktivität der Mubarak-Regierung lassen darauf schließen: Das Mubarak-Regime tat im
Jahr 2005 Anstalten, das Wahlgesetz zu reformieren und ließ mehrere Kandidaten zur Wahl zu (Taha,
Kortam, El-Behairy 2013). Als Antwort auf die Kritik an Mubaraks autoritärem Regierungsstil sollte
politischer Dialog erfolgen. Die Wiederwahlergebnisse von fast 90% implizierten allerdings
Wahlmanipulation (Tristam 2005) und hatten innerhalb der Bevölkerung einen ernüchternden Effekt,
ihre Erwartungshaltung wurde enttäuscht. Die Anzahl der Sitze, die die Muslimbrüder als freie
Kandidaten im Parlament erhielten, circa 1/5 aller Sitze, sowie die Unterstützung, die Ayman Nour als
größter Herausforderer Mubaraks bei den Präsidentschaftswahlen erlangte (Gregg Carlstrom 2011),
lieferten dem Regime bereits Indizien, dass sich Opposition in der Bevölkerung auftat. Auf diesen
Reformwunsch der Bürger ließen zusätzlich zunehmende Proteste im Land schließen: Zwischen 2004
und 2009 wurden fast 2000 kleinere bis Millionen-Proteste verzeichnet (Aarts, van Dijke, Kolman,
Statema, Dahhan 2012: 34). Dissonanz entstand unter anderem auch dadurch, dass das nunmehr in
starkem Wirtschaftswachstum befindliche Land immer noch politisch zentralisiert war und die
veränderten ökonomischen Forderungen der Bürger keinen Ausdruck in Interessenverbänden finden
konnten, diese wurden größtenteils durch Gesetze und finanzielle Mittel in staatliche Abhängigkeit
(Aarts, van Dijke, Kolman, Statema, Dahhan 2012: 39) und somit unter Regierungskontrolle gebracht
(Institute of National Planning 2004: 162). Als fehlende Anpassungsfähigkeit der Regierung an
wandelnde soziale Situationen lässt sich außerdem wieder die verpasste Ausweitung des
Wohnungsbaus bei gleichzeitig starkem Urbanisierungstrend der Bevölkerung (Institute of National
Planning, Egypt 2010: 112) anführen. Das Land wurde weiterhin durch die Notfall-Gesetzgebung
regiert (BBC 2013). Geht man von der Zwei-Strategien-Theorie Johnsons aus, repräsentiert das
gewaltvolle Vorgehen der Polizei und Sicherheitskräfte gegen Demonstranten die genannte zweite
Möglichkeit, die Regierungen ergreifen können bei Aufkommen gesellschaftlichen Wandels: Den
Einsatz verstärkter exekutiver Gewalt. Johnson nennt „Machtdeflation“ die Konsequenz dieses
Phänomens, also den Autoritätsverlust der Regierung beim Volk (Johnson 1971: 39, 94-96, 138). Im
Laufe der Revolution wurden mehr als 800 Demonstranten getötet (The Arab Network for Human
Rights Information 2012) sowie laut Al-Jazeera mehr als 10.000 verwundet (Carlstrom, Hill 2012). Aus
diesem gewaltvollen Vorgehen evoluierte ein durchaus als Machtdeflation des Mubarak-Regimes zu
bezeichnendes Phänomen. Beobachtbar ist dieses bereits durch die Intentionsevolution der
Demonstranten: Was als Aufstand gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption begann, mündete
über die Kritik an Polizeigewalt schließlich in dem Ruf nach dem Niedergang Mubaraks (Al-Jazeera
2011). Originär verfolgten die Demonstranten demnach gar nicht die Abdankung des Regimes,
sondern forderten politische Reformen. Der Einsatz und das gewaltvolle Vorgehen der
Sicherheitskräfte führte schließlich zum folgenreichen Autoritätsverlust der Regierung.
Als Massentheoretiker ergänzt Eric Hoffer diesen Ansatz um einen katalysierenden Faktor: So führe
der ökonomische, technische und wirtschaftliche Wandel einerseits und die fehlende
Beteiligungsfähigkeit bei steigenden Forderungen der Bürger andererseits zum Verlust des
Selbstwertgefühls innerhalb der Bevölkerung und schließlich zum Auftreten eines Aufstandes (Hoffer
1952: 15-19, 23, 52-54). Dieser Annahme stimmt die Missstandhierarchie der ägyptischen Jugend
nach der Analsyse des Egypt Human Development Report 2010 zu. Der Zugang zu Jobs, eine
angemessene Behausung sowie der Besitz eines Handys sind dort als erste Forderungen junger
Ägypter verzeichnet, Anzeichen, dass diese an dem wirtschaftlichen und technischen Fortschritt
teilhaben wollen (vgl. Grafik 6, Institute of National Planning, Egypt 2010: 107). Auch die Gender-
Problematik in Ägypten folgt analog der Annahme dieses Gegensatzes, so genießt die Mehrheit der
Frauen eine höhere Bildung, hat dennoch mangelhafte Jobchancen (vgl. Grafik 7, Institute of National
Planning, Egypt 2010: 99).
Privilegierung und Klientelismus
Diese Fakten stimmen ebenso der Theorie de Tocquevilles zu, der auf der psychologischen Ebene
Ursachen für Revolutionen evaluierte. Demnach führte eingeschränkter Zugang zu politischen Ämtern
und Arbeitsplätzen durch die Privilegierung des Adels einerseits zu sozialer Aufstandsbereitschaft und
andererseits zur Einschränkung der eigenen Macht (de Tocqueville 1969: 129). Tauscht man den Adel
mit Großunternehmern und regierungsnahen Personen aus, so lassen sich diese Faktoren durchaus
auf Ägypten anwenden: Das Mubarak-Regime wurde gekennzeichnet durch Vetternwirtschaft und
Klientelismus (Baram 2011), ergo durch enge Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft. Dafür
spricht die Monopolstellung einiger Unternehmen, die im Gegenzug für finanzielle Unterstützung des
Regierungsapparats die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Führungsposition erhielten (Bassiouni, Cherif
2012: 16). Transparency International UK bewertete Ägypten noch dieses Jahr mit der schlechtesten
Note bei der Messung von Korruptionsrisiko (vgl. Grafik 8, Transparency International 2013).
Das Führerprinzip
Die Typologisierung des Ursprungs von Revolutionen durch Carl Leiden und Karl Schmitt verweist
schließlich auf das große Novum der ägyptischen Revolution, welches diese so schwer vorhersehen
ließ: Das Führerprinzip. Die beiden Autoren postulieren, dass für eine erfolgreiche Umsturzbewegung
eine explizite Führung notwendig ist, welche die verschiedenen Revolutionsparteien vereint (Leiden,
Schmitt 1968: 75-94). Inwiefern weist der Fall Ägypten fehlende Konformität mit diesem Postulat auf?
Während der ersten Proteste gab es keine führende Oppositionsorganisation, die alle
Bevölkerungsschichten vereinte, es gab einzeln agierende größere Parteien, die eine wichtige Rolle
spielten. Das April 6 Movement (Carr 2012), Kefaya (El-Wardani 2011) und die Facebook-Seite „We
are all Khaled Said“ (Rashwan 2012) waren ausschlaggebend für die Informierung und Mobilisierung
der Demonstranten, sie übernahmen während der Revolution allerdings keine dominante Rolle. Die
Muslimbrüder, die sich später beteiligten und schließlich von der bereits losgetretenen Bewegung
profitieren konnten (Fisk 2012) und auch die Ultras, die von Beginn an teilhatten und bei den
aktuellen Protesten eine ausschlaggebende Rolle spielen (El-Wardani 2011), vermochten diese
Position nicht zu vertreten. Ein zentrales Moment der klassischen Revolutionstheorien, das eines
expliziten Führers der Massen, ist demnach also fällig und somit fragwürdig, ob Ägyptens Revolution
ohne weiteres in die Tradition der klassischen Revolutionstheorien einzureihen ist.
Der Verlauf
Neben dem Ursprung der Revolution ist die Analyse des Verlaufs wichtig bei der Frage, ob die
Revolution in dem nordafrikanischen Land als eine weitere klassische Revolution betrachtet werden
kann.
Initiierung
Lenin argumentiert, für einen Revolutionserfolg müsse die Bewegung von der Arbeiterklasse initiiert
werden und schließlich von Landarbeitern unterstützt werden (Lenin 1905: 140-145). In Ägypten
verzeichnete sich eine solche Entwicklung nicht. Im Vorlauf der Revolution tauchten durchaus, so
zum Beispiel im Jahr 2008 mit den April-6-Protesten (Dreyfuss 2011) kleinere Proteste auf. Diesen
Aufständen fehlte allerdings ein universeller Charakter, der die Massen verband. Eine solche
Massenbewegung fand erst drei Jahre später statt (AP/The Huffington Post 2011).
Zyklischer Revolutionsverlauf
In Hobbe’scher und machiavellistischer Manier postulieren unter anderem Hegel und Hopper bei
ihrer Revolutionsanalyse einen Kreislauf der Revolution: Die Vorherrschaft von Gewalt gibt Ausschlag
für eine Revolution, nach erfolgreichem Sturz des Despoten wird eine neue Regierung installiert, die
jedoch erneut unterdrückende Maßnahmen zur Kontrolle der Macht anwendet (Hegel 1988: 127-134,
244-250, Hopper 1966: 23). Analogien lassen sich hier ziehen zwischen der von Hegel zentral
betrachteten Schreckensherrschaft der Jakobiner im Zuge der französischen Revolution und der
Machterlangung der Muslimbrüder. Es sind seit der Machtübernahme der Partei unter Mursi erneut
Massenproteste aufgetreten und erneut kommen gewaltsame Konfrontationen zwischen den
Demonstranten und den Sicherheitskräften auf, in den letzten Monaten soll es aufgrund solcher
Auseinandersetzungen zu 60 Todesfällen gekommen sein (Fadel 2013). Es werden bereits Parallelen
gezogen zwischen Mursi und seinem Vorgänger Mubarak: Der vorherige Slogan „Down with
Mubarak“ wird durch den Austausch des Namens als Drohung an den neuen Präsidenten modifiziert
(Fayed, Mohamed 2013) und auch die Plakate, die das geteilte Antlitz beider Präsidenten zeigt (dapd
2012) sprechen für Hoppers und Hegels Revolutionskreislauf.
Evolution der Führerrolle
Eine weitere Chronologie der Revolutionsereignisse wird durch Rex Hopper vorgenommen, der den
Prozess in verschiedene Stadien einteilt: Zunächst sind kleinere dezentrale Aufstände in der
Bevölkerung zu verzeichnen. Spezifische Bewegungen transformieren sich zu einer kollektiven
Bewegung. Im Laufe dieser Entwicklung treten Führungsparteien auf. Dieses Stadium mündet
schließlich in der Extroversion der Revolution, ein Führer ist in dieser Phase bereits etabliert (Hopper
1950: 272). Auch hier muss eine fehlende Analogie zur ägyptischen Revolution aufgeführt werden.
Die Muslimbrüder etablierten sich erst in einem späten Stadium als Vertreter der Demonstranten. In
der Phase des Ausbruchs der Revolution war diese Führungsrolle noch nicht installiert (Fisk 2012).
Auch Hoffer nimmt in der Betrachtung des Revolutionsverlaufs eine Einteilung vor: Er ermittelt
verschiedene Typen von Führern, die in unterschiedlichen Phasen der Revolution eine zentrale Rolle
spielen. Zunächst tritt der Agitator hervor, der Missstände aufdeckt und propagandistisch nutzt. Auf
diesen folgt der Prophet und Reformer, der die Massen mobilisiert und somit zu einer Bewegung
vereint. Der organisatorische Planer tritt auf, um die verschiedenen Forderungen komplexer
Bevölkerungsschichten zu verallgemeinern und somit eine universelle Agenda zu bieten. Schließlich
tragen die Administratoren die Institutionalisierung der Revolutionspartei voran, sodass diese die
agitatorisch verbreiteten Forderungen politisch effizient umsetzen kann (Hoffer 1966: 151-175). Im
Falle der Revolution Ägyptens, die sich als führerlos herausstellte und dennoch das Phänomen der
Massenbewegung präsentierte, ist es schwierig dieser Typologisierung zu folgen. Die Kefaya- und
April-6-Bewegung hatten wie bereits hervorgehoben eine zentrale Rolle bezüglich der Mobilisierung
der Bevölkerung. Mitglieder des April 6 Movement erhielten unter anderem in Serbien Training in
friedlichen Mobilisierungsstrategien. Dieses Training konnten sie mithilfe des CANVAS (Center for
Applied NonViolent Action and Strategies) realisieren. Zurück in Ägypten trainierten die Teilnehmer
wiederum die anderen Mitglieder der Organisation (Rosenberg 2011). Die Mobilisierung trat
demnach nicht willkürlich sondern strategisch in der Frühphase der Revolution auf. Allerdings
agierten die Oppositionsparteien größtenteils parallel zueinander. Kefaya verfolgte politische
Interessen und Reformen (Oweidat, Benard, Stahl, Kildani, O'Connell, Grant 2008), während das April
6 Movement zunächst vor allem Arbeiterinteressen vertrat (Jacob 2011). Auch Wael Ghonim, der
Gründer der Facebook Seite „We are all Khaled Said“, wurde mitunter als Anführer der jungen
Massen bezeichnet (Shah 2011). Nach dem Ausbruch der Revolution spielte er allerdings für die
Erstellung und Verfolgung einer politischen Agenda keine zentrale Rolle mehr. Es ist demnach strittig,
ob in der ägyptischen Revolution überhaupt von einem prophetischen Führer gesprochen werden
kann. Ob die Muslimbrüder schließlich als Organisatoren und Installateure einer für alle
Demonstranten politisch zufriedenstellenden Agenda einzuordnen sind, ist ebenfalls vor dem
Hintergrund der aktuellen Lage fragwürdig. Zunächst ist aufzuführen, dass kein konsensueller
Übergang von den verschiedenen dominanten Revolutionsparteien auf die Muslimbrüder stattfand.
Diese erhielten keinen universellen Zuspruch durch Bewegungen wie dem April 6 Movement, welches
maßgeblich zur Mobilisierung beitrug (Ahram Online 2012). Jüngste Zusammenstöße mit Mitgliedern
dieser Organisation oder jenen der Kefaya-Bewegung unterstreichen die fehlende Unterstützung der
jetzigen Regierung durch die ursprünglichen Revolutionsparteien (Salah 2013) und lassen die Frage
nach einem tatsächlichen und legitimen Organisatoren und Administratoren offen.
Fazit
Betrachtet man die Mehrheit an Ursachen, die laut traditionellen Theorien zum Ausbruch einer
Revolution führen, so ist Ägypten einzureihen in die Tradition klassischer Umstürze: Der ökonomische
Aufstieg des Landes bei ungleichem Ressourcenzugang, die fehlende nationale Identität, das
Bewusstsein eines Großteils der Bevölkerung, einer unterprivilegierten Klasse anzugehören sowie die
fehlende reformerische Tätigkeit der Regierung bei wachsenden materiellen Ansprüchen der Bürger
sind Aspekte, die den Ursachenanalysen der Revolutionen des 18. bis 20. Jahrhunderts entsprechen.
Allerdings ist nicht zu bestreiten, dass bei dem Fall Ägypten neuartige Faktoren auftreten, die diese
Revolution zu einem „black swan“ und somit unvorhersehbar machten. Der Aufstand verlief
führerlos, einen alle Bevölkerungsschichten- und ansprüche verbindenen Anführer hat es zu keinem
Punkt der Revolution gegeben. Aktuelle Ereignisse lassen die Annahme zu, dass auch die Religion
nicht zur Bindung der komplexen Bevölkerung fähig ist, beziehungsweise war. Das Moment der
Verbindung trat auf unter dem gemeinsamen Ziel, das Mubarak-Regime zu stürzen ("Anything has got
to be better than the Mubarak regime.", Cook 2011). Im Sinne Arendts kann man davon ausgehen,
dass mit dem Erreichen des Ziels eine erneute Identitätskrise ausgebrochen ist.
Steven Cook schreibt hierzu:
“Unless the antecedent questions about Egypt's identity are answered in a way that makes sense
to the vast majority of Egyptians, the quality of the upcoming poll matters less than many
believe.”
Ob die mangelhafte Erfüllung der Führerrolle durch die Muslimbrüder aus dem Scheitern der Lösung
der Identitätsfrage resuliert, wie es Cook impliziert, oder welche Ursachen aktuell zu den erneuten
Aufständen beitragen, ist in zukünftigen Arbeiten zu klären.
Ob die Revolution deswegen so erfolgreich war, da sie führerlos verlief, wie Hais und Winograd der
Huffington Post konstatieren (2011), ist ebenso ein interessanter Ansatz. Diese These ist vor allem
relevant vor dem Hintergrund der erneuten Ausschreitungen in Ägypten, welche andeuten, dass das
Fehlen eines Führers zunächst Erfolg, dann die Mündung in Anarchie bedeutet.
Schließlich wäre es noch interessant, in weiteren Studien zu ermitteln, inwiefern der Frame „Aufstieg
der Islamisten“, der offensichtlich ein mediales Konstrukt war, Auswirkungen auf die internationale
Wahrnehmung der Revolution in Ägypten hatte.
Literaturverzeichnis
Printmedien
Arendt, Hannah (1955): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt.
Brinton, Crane (1965): The Anatomy of Revolution. New York: Random House.
de Tocqueville, Alexis (1969): Der alte Staat und die Revolution. Reinbek: Rowohlt.
Dunn, John (1989): Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1988): Phenomenologie des Geistes. Hamburg: Meiner.
Heikal, Mohamed Hassanein (1978): The Sphinx and the Commissar. The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East. London: Collins.
Hoffer, Eric (1952): The true Believer. Thoughts on the Nature of Mass Movements. London: Secker & Warburg.
Hopper, Rex D. (1950): The revolutionary process: A Frame of Reference for the Study of Revolutionary Movements. Austin: University of Texas.
Hopper, Rex D. (1966): Counter-Revolution: How Revolutions Die. New York: Atherton Press.
Johnson, Chalmers A. (1982): Revolutionary Change. Stanford: Stanford University Press
Le Bon, Gustave (1932): Schriftliche Psychologie der Massen. Leipzig: Alfred Kröner Verlag.
Leiden, Carl/ Schmitt, Karl Martin (1968): The politics of violence. Revolution in the modern world.
Englewood Cliffs: N.J., Prentice-Hall.
Ploetz, Carl (1998): Der Grosse Ploetz. Freiburg: Verlag Herder.
Taleb, Nassim Nicholas (2007): The black swan. The impact of the highly improbable. New York: Random House.
Wassmund, Hans (1978): Revolutionstheorien. München: beck.
Weber, Herrmann (1967): Lenin. Aus den Schriften. München: dtv.
Online-Medien
Aarts, Paul/ van Dijke, Pieter/ Kolman, Iris/ Statema, Jort/ Dahhan, Ghassan (2012): From Resilience to Revolt. Making Sense of the Arab Spring. Online im Internet: URL: http://de.scribd.com/doc/100610734/From-Resilience-to-Revolt-Making-Sense-of-the-Arab-Spring (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Ahram Online (2012): April 6 Youth Movement likens Muslim Brotherhood to Mubarak’s NDP. Online im Internet: URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/61261/Egypt/Politics-/April--Youth-Movement-likens-Muslim-Brotherhood-to.aspx (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Al-Alawi, Irfan (2011): Egyptian extremism sees Salafis attacking Sufi mosques. Online im Internet: URL: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/apr/11/salafis-attack-sufi-mosques (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Al-Jazeera (2011): Timeline: Egypt's revolution. Online im Internet: URL: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
AP/ The Huffington Post (2011): Egypt Military Supports Mubarak; Protesters Mass. Online im Internet: URL: http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/egypt-military-supports-mubarak_n_821765.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Baram, Marcus (2011): How The Mubarak Family Made Its Billions. Online im Internet: URL: http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/how-the-mubarak-family-made-its-billions_n_821757.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
BBC (2013): Profile: Hosni Mubarak. Online im Internet: URL: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12301713 (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Brown, Jonathan (2011): Salafis and Sufis in Egypt. Online im Internet: URL: http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Carlstrom, Gregg (2011): Explainer: Inside Egypt's recent elections. Online im Internet: URL: http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2011/11/201111138837156949.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Carlstrom, Gregg/ Hill, Evan (2012): Scorecard: Egypt since the revolution. Online im Internet: URL: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/01/20121227117613598.html#sc_protesters (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Carr, Sarah (2012): April 6: Genealogy of a Youth Movement. Online im Internet: URL: http://www.jadaliyya.com/pages/index/4950/april-6_genealogy-of-a-youth-movement (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Cook, Steven A. (2011): Egypt’s Identity Crisis. Online im Internet: URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/19/egypts_identity_crisis (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
dadp (2012): „Mohammed Mursi Mubarak“? Online im Internet: URL: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/mohammed-mursi-mubarak-ein-aktivist-haelt-ein-transparent-hoch-das-praesident-mursi-und-seinen/7432474.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Dreyfuss, Robert (2011): Who is behind the Egyptian protests? Online im Internet: URL: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/02/who-is-behind-egyptian-protests (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Dubai School of Government - Governance and Innovation Program (2012): Facebook in the Arab Region. Online im Internet: URL: http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=24&mnu=Cat (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
El-Behairy, Nouran/ Kortam, Hend/ Taha, Rana Muhammad (2013): The rise and fall of Mubarak. Online im Internet: URL: http://www.dailynewsegypt.com/2013/02/11/the-rise-and-fall-of-mubarak/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
El-Wardani, Mahmoud (2011): Egyptian revolution book review series: Kefaya - laying the foundations for the 25 January revolution. Online im Internet: URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/18/8773/Books/Egyptian-revolution-book-review-series-Kefaya--lay.aspx (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Fadel, Leila (2013): In Post-Revolution Egypt, Fears Of Police Abuse Deepening. Online im Internet: URL: http://www.npr.org/2013/03/07/173645079/in-post-revolution-egypt-fears-of-police-abuse-deepening (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Fayed, Shaimaa/ Mohammed, Yusri (2013): Egyptian protesters defy curfew, attack police stations. Online im Internet: URL: http://www.reuters.com/article/2013/01/28/us-egypt-anniversary-idUSBRE90N1E620130128 (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Fisk, Robert (2012): Late for the revolution, Muslim Brotherhood take over Tahrir Square. Online im Internet: URL: http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-late-for-the-revolution-muslim-brotherhood-take-over-tahrir-square-7876805.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Giglio, Mike (2011): "We Are All Khaled Said": Will the Revolution Come to Egypt? Online im Internet: URL: http://www.thedailybeast.com/articles/2011/01/22/we-are-all-khaled-said-will-the-revolution-come-to-egypt.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Hais, Michael/ Winograd, Morley (2011): Victory for Egypt's Leaderless Revolution. Online im Internet: URL: http://www.huffingtonpost.com/michael-hais-and-morley-winograd/victory-for-egypts-leader_b_822228.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Ibrahim, Raymond (2011): Egypt’s Identity Crisis. Online im Internet: URL: http://www.meforum.org/2832/egypt-identity-crisis (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Index mundi (2012): Egypt Demographics Profile 2012. Online im Internet: URL: http://www.indexmundi.com/egypt/demographics_profile.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Institute of National Planning, Egypt (2004): Egypt Human Development Report 2004. Online im Internet: URL: http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/arabstates/egypt/egypt_2004_en.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Institute of National Planning, Egypt (2010): Egypt Human Development Report 2010. Online im Internet: http://www.undp.org.eg/Portals/0/NHDR%202010%20english.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Jacob, Jijo (2011): What is Egypt’s April 6 movement? Online im Internet: URL: http://www.ibtimes.com/what-egypts-april-6-movement-261839 (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Mason, Paul (2011): Twenty reasons why it's kicking off everywhere. Online im Internet: URL: http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2011/02/twenty_reasons_why_its_kicking.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Monitor’s Editorial Board (2011): After Mubarak: Egypt's revolution was one of identity. Online im Internet: URL: http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2011/0211/After-Mubarak-Egypt-s-revolution-was-one-of-identity (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Moore, Elaine (2012): Civets, Brics and the Next 11. Online im Internet: URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c14730ae-aff3-11e1-ad0b-00144feabdc0.html#axzz2N36BjDhV (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Oweidat Nadia/ Benard, Cheryl/ Stahl, Dahl/ Kildani, Walid/ O'Connell, Edward/ Grant, Audra K. (2008): The Kefaya Movement. A Case Study of a Grassroots Reform Initiative [Abstract]. Online im Internet: URL: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG778.html. (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Rashwan, Nada Hussein (2012): Revolutionary website 'We Are All Khaled Said' launches constitution initiative. Online im Internet: URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/53520/Egypt/Politics-/Revolutionary-website-We-Are-All-Khaled-Said-launc.aspx (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Rannan-Eliya, Ravi P. (1999): The Distribution of Health Care Resources in Egypt: Implications for Equity. An Analysis Using a National Health Accounts Framework. Online im Internet: URL: http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-81.PDF (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Rosenberg, Tina (2011): Revolution U. Online im Internet: URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/revolution_u (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Sabry, Bassem (2012): A Guide to Egypt's Challenges: Slums & Random Housing. Online im Internet: URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/50599/Egypt/Slums--Random-Housing.aspx (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Salah, Fady (2013): Officials finally react to Mansoura clashes. Online im Internet: URL: http://www.dailynewsegypt.com/2013/03/04/officials-finally-react-to-mansoura-clashes/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Shah, Angela (2011): Egypt's New Hero: Can Geek-Activist Wael Ghonim Overthrow Mubarak? Online im Internet: URL: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2047006,00.html (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Storck, Madeline (2011): The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising. Online im Internet: URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-02-bifef/The_Role_of_Social_Media_in_Political_Mobilisation_-_Madeline_Storck.pdf
(zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Transparency International UK (2013): Government Defence Anti-Corruption Index. Online im Internet: URL: http://government.defenceindex.org/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)
Tristam, Pierre (2005): September 7, 2005: Egyptians Vote for President for First Time. Democratic Challenger Ayman Nour Watches From Prison. Online im Internet: URL: http://middleeast.about.com/od/thisdayinmideasthistory/ig/September-4-September-10-in-Mi/Egypt-Elections-.htm (zuletzt aufgerufen am 10.03.2013)





























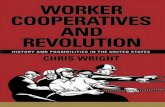



!["Die Revolution ist [...] die Revolution." Georg Forster über Sprache, Politik und Aufklärung.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631beb4a5a0be56b6e0df1f3/die-revolution-ist-die-revolution-georg-forster-ueber-sprache-politik.jpg)