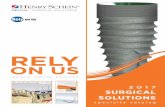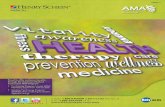Transzendentaler Schein und phänomenologische Ursprünglichkeit – Welterfahrung bei Husserl und...
-
Upload
rits-dmuch -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Transzendentaler Schein und phänomenologische Ursprünglichkeit – Welterfahrung bei Husserl und...
ISSN 2311-6986 (Online)
ISSN 2226-5260 (Print)
C A H K T - H E T E P E V P F C K H f l r o c y , l = l A P C T B E H H b I R y H H B E P C H T E T
H H C T H T Y T ( D H J I O C O O H H
HORIZON
@ E H O M E H O J I O F H Y E C K H E H C C J I E , l J O B A H H S I
S T U D I E N Z U R P H j L N O M E I < i O L O G I E
S T U D I E S I N P H E N O M E N O L O G Y
L T U D E S P H { l N O M j ; N O L O G I Q U E S
T o M 3 ( 1 ) 2 0 L j .
HORIZON
( D E H O M E H O J I O F H Y E C K H E H C C J I E J I O B A H H S I
S T U D I E N Z U R P H A N O M E N O L O G I E
S T U D I E S I N P H E N O M E N O L O G Y
E T U D E S P H [ Z N O M t N O L O G I Q U E S
T o M j ( 1 > 2 0 1 4
C O j { E P ) K A H H E
OT pep;aI(ll;HH
49
49
29
7
9
23
69
2690
2
2
2
242
1 . H C C J I E * Z { O B A H H H
) K y / > H A J I B J C / / f O [ I l : H B M / i ) W y H A / > ( Z / J H ; y J O / ; ] A 3 ; y / I A H H b I X T H f i P H / L 0 S O / >H / i R ' S / N D E X
) K y p H A J I 3 A P E F H C T P H P O B A H B K A 4 E C T B E C M H . C B H j [ E T E I I b C T B O H H N g @ C 7 7 - 5 4 8 7 8
PeKOMCHc}oeauo x: /{y6JJZ/Katjuu
y 4 8 H b / M C O 6 C M O M H u c m u m y m a q b w z o c o q ! ) u u
Cau Km-JJemep6ypacK020 20<;yc]apcmaeuuozo yuueepcumema
[ I y B J 1 H K V E M 6 l E M A T E P H A J 1 6 I H P O W J I H H P O L i E * [ I y p y P E I _ I E I - l 3 H P O B A H F U I H ] K C F I E P T H O F O O T B O P A
F . / I A B H b I A P E j ] A K T O P
[ 1 . A p T ( ! M C H K O
P W A K t / H O H H A H K O H J I E F H H
r. YepnaBHH, A. HaTKyJIb, ,l=!;. Pa3eeB,
C I > . C T a H ) K C B C K H R s A . X a x a s l o B a = ,
A. Ko3blpeBa, ,l=I;. Kououeu,
X. P. 3enn (Fepmauuja:), I<. HoBoTHbl (llexnH),
A. Wnennt, (cI)panuuR)
E D J T O R - I N - C H J E F
Natalia A rtemenko
E D I T O R J A L B O A R D
G. Chemavin> A. Patkul!, i=). Razeev>
F. Stanzhevskiy, A. Khakhalova,
A. Kozyreva, D. Kononetc, H. R. Sepp
(Germany), K. Novotn9 (Czech republic),
A. Schnell (France)
y q E H b l l / C E K P E T A P b
K. MaiinaHef-IKO
E D I T O R L 4 L A S S I S T A N T
K. Maidachenko
H A y q H b l l } C O B E T
H. 3. Bpocom (Poccnsi), M. Fa6enb (FepMaHHA),
X.-X. Fau):tep (Fepmannsi), p. A. FpoMoB 1~
(CI_1.1A), B. H. Monqanos (Poccns!)>
H. B. Marpowmom (Poccnsl:), 10. 0. Opnom -!-
(Poccm), A. :). CaB團(poccng)> .$I. A. C.nnnun
(Poccusi), .J'I. Tenre.nu (F'epMaunx),
A. Xaap.l=(T (FepMai-IH5l), M. JI. Xopbl(OB (Poccm)
A D V J S O R Y B O A R D
N. Brosova (Russia), M. Gabel (Germmy),
H.- H. Gander (Germany), R. Gromov 1-
(Russia), J. Grondin (Canada), S. Lufl
(USA), V. Molchanov (Russia),
N. Motroshilova (Russia), J. Orlova i-
(Russia), A. Savin (Russia), J. Slinin
(Russia), L. Tengelyi (Germany),
A. Haardt (Germany), M. Khorkov (Russia)
A j l P E C P E j [ K O J I J I E F H H :
Mapu.n Ko:!/106a
M e T a ( 1 ) p l 3 H K a M C T a ( I ) o p b l H 3 a r a . I J K a n o : ) T H 4 6 C K O F O C j l O B a
(Konuenunn no:)THYCCKOFO 513bIKa B (I)HJIOCO(1)HH Mafrrnua Xaii,Lterrepa)..
Tambxua Tamapuuzjeea
B s a t t i H T y r a , z J a M e p o B c K o r o n p e . l = ( C T a B j l C H H R H O H H M a H H H B K O H T C K C T C
KpHTHKH H 只 C 0 月 0 「 H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anne Coignard
Lecteurs,enfantsd'Echo:livre,sens, horizon ...................................
H/suke .Ikeda
Transzendentaler Schein und ph!inomenologische Urspriinglichkeit.
welterfahrung bei 目usserl und F i n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalius Jonkus
Stages of Husserl's Philosophy and Intention of Phenom6nology ............
7
9
I L A P X H B
Ocx:ap Be1(Kep
O xpymcoc-rn npefcpacnoro n asanT10pH3MC Xy]JO}KHHKa
(I~lepego.z:t .A. Ham/(yJIR, .E. J[a3apeu/(060jj, no.l=( peri. A. IJamxymz) ......................
K/l((yc Kajzep
Cosnanne u ero (I)eHOMCHbl: Jleii6unu, KanT u Fyccep.nb
Hm:-un JJu
H p a l ( T H Y C C K a 5 I H H T C H I J H O H a J l b H O C T b H T p a n c u e n ; : ( e H T a j - I b H M ( 1 ) e n o M e n o n o r n a
KaK npal(TH4CCKaR (I)HJIOCO(I)HR (FIepeBoj=t K. Maiidavemco, nail pert. H Apm2.zueum)
)KnBa51 MCTa(I)opa. BocbMOij oyepx:. MeTa(I)opa u (I)HJ1OCO(l)cKHii ,z=(HCKypc
(Hpo):(OJl)KCHHe) (LIepego.l=t @. Cmaua/ceacmao, nail pe.l=l. ]': Baoaunoii) ...............
H n < I > O P M A L I H S I O W V P H A J I E P A 3 M E l i I E H A H A C A i ] [ T E
http://horizon.spb.ru
0 L l e u T p ( 1 ) e n o M e n o J I O F H H H F C p M C H C B T V K H V i - I C T W f y T a ( 1 ) H J I O C O ( I > H H CI 1 6 F y , 2 0 1 4
O A B T O p b l B b l f l y C K a , 2 0 1 4
I I I . * Z { H C K y C C H H
H n T e p B b K ) C 5 1 . A . C n m - i H H b i M ( C a m c T - H e T e p 6 y p r c f c n i i r o c y . q a p c T B C H H b l i i
yHHBepcnTeT, 12 cenTji6pR 2013 r.) (HnTepBbtO HO.!lroTOBHJIH /[amwlbji [email protected]
O cTaTbe ,[IMHTpHH (I)ej14yKa (<CxonacTH4CCKOe pas.rIHYHC B Cyl1JeM
H O H T O J 1 0 「 H 4 6 C K a 5 I j ; 1 目 4 > ( I ) e p e n u Ⅱ 5 1 > 〉 ( A 〃 δ a p e i i J I a m K y 〃 U l b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]KCKypcul, nocmu.lennasi npe6b!BaHHK) :).z=(HT I_l_ITaiiu B FE-rrunrene (1913-1916 rr.)
(A Jje]cceii252
From the editors.
C O N T E N T S
Welsh Talia. The Child as "Natural Phenomenologist: Primal and Primary Experience
in M。「I。囮一Pon疼'・P・y。hology(ル〃調』ァθ式θん雇〃) .....................…・・・…・・……・258
M a . i l b l W K H H E . B . ) = I B e M e T a ( I > O p b I H a M j I T H ( I [ H E 6 . l l d I j n u e e ) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ゛゛゛°゛ 2 6 0
v, coBbJTHH
Auouc .J-IeTHeii wmnbl 110 (I)enoMenonornu n (l)HJIOCO(I)HH CO3HaHHR
(18一22aBrycTa2014,Konenrareu,,LI;anul) .................………・・・・…
A u o u c M e ) K } J y H a p o , l = I H O j ; j K O H ( I > e p e n l ( H H < < E . L I H H C T B O C O 3 H B H H5 I :
(1)enoMeHOJ-iornqecrcnii n mrunTHBHblii[ acnel(Tbl)> (28-30 aBrycTa 2014,
C a H K T - F I e T e p 6 y p r )
Auonc Me)KJlynapoj:(HOR KOH(1)epenunn <<I'IepBaR MHpOBaH BOiina
H (l)enomeno.J-iornH>> (The Great\Var and Phenomenology)
( 4 - 6 即 隠 6 p " 2 0 1 4 , 月 。 閾 H , B 凹 柾 一 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … ・ … ・ ・
H。叩 O r i o n V 腿 p o ・ M . C . ( 1 9 5 5 - 2 0 1 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …・…・・
268
L K E S E A R C H
Maria Kozlova
Metaphysics of Metaphor and Enigma of Poetic Word: Concept of Poetic Language
in Martm Heidegger's Philosophy . ... .
Ilzt]ana 72ztarintseva
In Defence of Gadamer's Notion of Understanding in the Context
of Ideological Critique. .
Anne Coignard
Readers, Sons of Echo: Sharing Literary Experience.
Hjsuke Ikeda
Transcendental illusion and Phenomenological Originality
in Husserl and Fink.
Dalius Jonkus
Stages of Husserl's Philosophy and Intention of Phenomenology..
The World-Experience
273I L A R C H I V E
4
L
7
9
49
69
0. pecker
The Vacuity of Art and the Daring of the Artist (Translated by A. Patkul,
K. Kaehler
Consciousness and its Phenomena: Leibniz, Kant, Husserl
(Translated by 0.
N; Lee
Practical Intentionality and Transcendental Phenomenology
as a Practical Philosophy (Translated by K. Maidachenko, ed. by N. Artemenko)
P Rica!ur
The Rule of Metaphor. Study 8. Metaphor and Philosophical Discourse.
Continuation. (Translated by F Stanzevskjy, ed. by G. Vdovina) ..................
.122
9
7
690
2
I I I , D I S C U S S I O N S
An Interview with Prof. Jaroslav Anatol'evich Slinin
(Saint-Petersburg State University, 12th September 2013)
(Prepared by A乙.」rre〃ie〃たοand」. f》α戊〃。.................. 229
5
ReBections on the Dmitry Fedchuk>s Article Titled
<<Scholastic Distinction in Finite Being and Ontological Difference>>
(Andrey
The Excursion on Edith Stein's Visit to G6ttingen (1913-1916)
(Alexei
O T P E , l ( A K L / H H
242
I V , B O O K R E V I E W S
welsh Talia. The Child as Natural Phenomenologist: Primal and Primary Experience
in Merleau-Ponty's Psychology (Iul:an Apostolescu) ...
Malyshkin E. V. The two Metaphors of Memory (1; 1; .Evlampzev).
臀
V . E V E N T
267
Announcement of the Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind held
by Dan Zahavi at the Center for Subjectivity Research at the Copenhagen
Announcement of the international Conference <<Unity of Consciousness:
Phenomenological and Cognitive Aspects>> (28-30 August 2014,
S a i n t P e t e r s b u r g , R u s s i a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ '
Announcement of the International Conference <<The Great War and Phenomenology>>
(4-6D。。。mb。『2014, L。uv圀,Bdgium)………・・・・・・・…・……・・・…・・・・・・・・・・
Obit臆庁.Uva「ovM.S.(1955-2013)………・・・……・…・・・…・…・…………・・゛゛゛°°°°°
268
270
271
Injbrmation jbr authors278
Pe.!JICOJ-ij-iernH )Kypna.na <<Horizon. @euo.7I4eHO/l02ttye-
CKue uccnedoaauux)) c npucmp6nem coo6u.tae-r, YTO
H a 4 5 - M r o , z = t y > I ( H 3 H H C K O p O F I O C T H } K H O C K O H Y a j - I C H
Haiti KOJIJlera n ,l=lpyr;, q.J-ieH I-layqnoro CoBeTa >Kypna-
Jla <<Horizon. @eno.Meuonoaut/ecKue ucc_/jedoeauujl)),
3 a M e q a T e j - i b H b l i j q e j - I O B C K H H a C T O 5 I t l J H i i y - i e H b l j i , 3 a -
se,z:lytou.inii xa(I>ej=tpoii ncTopnn (I)HIIOCO(1)HH (1)aKyJlb-
TCTa (I>HJIOCO(I)HH H KyIlhTypoj-IOFHH K)(I>y; Kai-j.l=lHj=(aT
4 ) H J I O C O ( 1 ) c I ( H X H a y K P o M a H A n a T o . r i h e B H Y r p o m o s
( 0 3 . 0 1 . 1 9 7 0 - 0 4 . 0 5 . 2 0 1 4 r r . ) .
P o M a n y A u a T O j l b C B H 4 y 6 b i J l 0 4 4 r o . z = i a , B b l H y C K -
H H K ( } ] H J I O C O ( 1 ) c l ( O F O ( 1 ) a l ( y J l b T C T a P F V 1 9 9 3 r o , ! = t a , o u
y4HJICH B acnupan-rype ua (1)HJIOCO(I)cKOM (I)atcyJ-ibTC-
Te P o c T O B C K O F O r o c y , 1 : l a p c T B C H H O F O y H H B C p C H T C T a
B 1 9 9 3 - 1 9 9 6 r r . n B 1 9 9 9 r . 3 a l . i l H T H J I K a H , L I H J J a T C K y 1 0
,l=(HCCepTaunro <<IlonslTHC OHbiTa cosnanusi B (I)HJIOCO-
q ) H H ( I ) p a n u a B p e n T a H O ) ) B P o c c n i i c l ( O M F O C y } : t a p c T B C H H O M F y M a H H T a p n o M y H H B e p c n T e T e
(Moc!(Ba); c 1996 r. pa6o-ra.n accncTef-ITOM Ka(1)e]lphl HCTOpHH (1}][IjlOCO(1)HH, c 2000 r. -.Z=10-
ueuT, c 2008 r. - 3aMecTHTCJlb 3age):ty10lltero Ka(1)ejlpoii no naym-Ioii pa6oTe, c 20IO r. -
3aMecTHTCJ-Ib 3aBe,rtyl{)lltero xa@e,!:tpoii no yqe6noii pa6oTe, c 2012 r. - 3aBe.!lyK)H-IHii
K a ( 1 > e . z : t p o i i n c T o p u u @ n n o c o @ u n f O O Y P o M a u A n a T O J l b C B H Y C 2 0 0 9 r . p y K O B O j l H J J H a y q -
HO-HCCJle,l];OBaTej-lbCKOii <<Jla6opaTopneii ncTopnu coBpeMeHHOii 3ana.z=tHOi;i @nnoco(1)HH)>,
6 b l I I O p r a n n s a T o p o M H W O X H O B H T C j l e M M H O F O J 1 C T H e r o n n . J I O , l = ( O T B O p H O f O M C ) K j l y n a p o ) : 1 H O r o
C O T p y , z = ( H H Y C C T B a c y u u B e p c u T e T a M H F e p M a l - I H H H A B C T p H H , a l ( T H B H b [ M y 4 a c T H H K O M M H O ー
r n x M e ) i q : ( y n a p o . L l f l b I X K O H ( I ) e p e n u u i i , p y K O B O j = l H T C J 1 6 M p 5 1 . I J a H a y q H b I X H p O e f { T O B , T a K H X K a K :
<<BpenTaf-IOBCKa5I WKOJia: pa3BHTHC I-lpo6.nem cosnann51 H HHTCHI-IHOHa.nb HOCTH B (1)enoMeHO-
norun n ana.nwruqecKoii @n.uoco(I)HH XX B.>> (PFH@), <<BpenTaHOBCKa5I WKOJ-ta u Mocl(OB-
C K H i i n n H r B H C T H q C C K H R K p y } K O K ) > ( D A A D ) , < < K o n ' r p o s e p 3 b l 1 1 0 I l p 0 6 j l 6 M C H C H X O J 1 O F H 3 M a
B 6 p C H T a H O B C K 0 員 Ⅲ K 0 月 e 〉 > ( 6 A D ) ラ 〈 〈 C T a H o B 月 e H Ⅱ e Ⅱ μ e Ⅱ H a y H H 0 員 巾 H 』 0 C 0 巾 Ⅱ H B A B C T p 0 -
B e n r p n n : n p e , ! I b I C T O p H H ( 1 ) e n o M e H O J I O F H 4 6 C K O F O H a H a j l H T H 4 6 C K O F O J J B H } K C H H i i > > ( P F H @ ) ,
〈〈ΦⅡJIO C O ( 1 > H H K a K H a y K a B H O C T r e r e j - I e B C K O R H C M C L I K O j j ( 1 ) H J - I O C O ( l ) H H . P e a j - I H 3 3 L I H H H p O C K T「oB
nayqnoii @n.noco(1>HH B 6penTaHOBCKOij wKOj-Ie n panneii cl)eHOMCHOjlOFHH>> (PFH@), <<Hn-
C T H T y I - I H O H H J I b H M H C T O p H 5 l ( 1 ) H J - I O C O ( I ) H H : ( I ) o p M H p O B a H H e n p o ( I > e c c n o n a . ] - I b H O i i ( 1 > H J I O C O ( I ) H H
B H C M C L J K O j ; j l H H C T H T y l - J H O H [ U l b H O i i [ c p e n e X V I I I - X X B B . > > ( P F H @ ) n M H O F H X j l p y r u x .
P o M a n A n a T O j l b C B H 4 6 b t J I Y C J I O B C K O M W H p O K H X H a y 4 H b I X H H T C p e c o s , I f < : K O T O p b l M
n p e > W e B c e r o c . l - i e , l = ( y e T O T H C C T H H C T O p H I O H C M C L I K O i i n a B C T p H i i c K o i i @ n j - I O C O ( 1 ) H H X I X -
Ocnosnb(e ny6IIHKaunn: I) :). ryccepm,. HnTenunouaslbHbIC Hpe.!IMCTLI (nepesoa c nemeumro nΠpH-
M C 4 2 1 H H H > / / J l o m c . ) K y p n a . n n o ( j ) H J 1 0 C O ( l ) H H H H p a r M a T H K C K y J I b T y p b l . M . : J : l o M H H T C J I J 1 C K T y a n b n o i i t c n n r n ,
167
\
HORIZON 3 (1:) 2014. ;1. RESEARCH : Y. lkeda : p. 64-98
@ E H O M E H O J I O F H Y E C K H E H C C J I E j l O B A H l / 1 5 1 STUDIEN ZU R P H A N O M E N O L O G E STUDIES IN P H E N O M E N O L O G Y ETUDES P X E N O M E N O L O G I Q U E S
T P A H C I _ j ; E H j l ; E H T A J I b H A H H J I J I I O 3 H R H O E H O M E H O J I O F H Y E C K A 5 1H 3 H A Y A J I b H O C T b - O H b I T M H P A y F y C C E P J 1 5 I H O H H K A
T R A N S Z E N D E N T A L E R S C H E I N U N D P H A N O M E N O L O G I S C H E
U R S P R I ] N G L I C H K E I T - W E L T E R F A H R U N G B E I H U S S E R I _ . U N D F I N K '
T R A N S C E N D E N T A L I L L U S I O N A N D P H E N O M E N O L O G I C A L
O R I G I N A L I T Y - T H E W O R L D - E X P E R I E N C E I N H U S S E R L A N ' D F I N K
Y U S U K E I KE D A "
Ritsumeikan University Kyoto, Kyoto, Japan
e-mail: [email protected]
This paper holds that the philosophical relation between Husserl's and Fink's phenomeno-
logical philosophies can be characterized in terms of proximity and distance. We proceed by
focusing on the philosophical foundation of their projects and, in particular, on the Kantian
notion of <<transcendental illusion>>> which they use> though in different manners) as a way
of determining purely philosophical illusions - a preliminary task to found transcendental
phenomenology proper. We select this Kantian notion as a central theme inasmuch as it con-
cerns the metaphysical problematic of the world. Our analysis shows that Fink defends the
Husserlian thesis that the world is not merely an <<idea of pure reason>> (Kant), but an experi-
ence. In effect, the world is necessarily pregiven to us, though anonymously, in an intentional
experience; in other words, intentional experience without the Pregiven world is) according
to the late Husserl, unthinkable. Fink's characterization of world-experience is radically dif-
ferent from Husserl's. This difference or distance comes from Fink>s conception of <<enworld-
ing>> (Verweltlichung), i. e., the self-actualization of constituting subjectivity in the world-
actualization. Fink's very idea of this type of correlation has two specific enabling functions:
(1) the world's originally enframing function (die urspriinglich einrahmende Funktion) of
the entity into the world itself and (2) the event-like character of the <<intruding>> (Eindrin-
gen) of the subject into the world. Therefore, we conclude that Fink's phenomenological con-
tribution to philosophy consists not only in his genuine reflection on, and analysis of, the
phenomenological conception of correlation at the deep level of world-experience, but also
in his metaphysical reformulation of the traditional concept of the world.
Keywords: transcendental illusion, transcendental idealism, intentional correlation, world-
experience, ongm of the world, access to time-horizons j event.
Es ist mir eine Freude, an dieser Stelle einige W6rter des Dankes an meine Freunde aussprechen zu dtlrfen.
Zu besonderem Dank bin ich Fabien Muller verpflichtet, der mir bei der Gestaltung des deutschen Textes mit
vieien Verbesserungsvorschl5gen geholfen hat: ohne seine Hilfe halite die Arbeit nicht erscheinen k6nnen.
Mein Dank gilt femer Nicolhs Garrera-Tolbert fOr seine freundliche Hilfe bei der sprachlichen Formulierung
des engiischen Abstracts. Danken m6chte ich Georgy Chernavin und Herrn Andrei Patkul ftir die Ermuti-
gung dieser Arbeit.
Graduated student of the Ritsumeikan University Kyoto, PhD student of the Ritsumeikan University Kyoto.
Y U S U K E I K E D A '
Ritsumeikan University Kyoto:, Kyoto> Japane-mail: [email protected]
B j ( a H H o i i c T a T b e o T H O W e H H H M e ) K A y ( 1 ) e H O M e H O J I O F H q e c K H M H 4 ) H J I O C O ( I ) H 5 I M H F y c c e p m l H@ H H K a x a p a K T e p n s y I O T C H B T e p M H H B X G J I H 3 0 C T H H j l ; H C T B H I J H H . M b l ( I ) O K y c n p y e M B H H M a -H H C H a ( l > H J I O C O ( I > C K H X O C H O B a H W I X H X H p 0 e K T O B H > B Y a c T H O C T H J H d K d H T O B C K O M H O H H T H H< < T p a n c u e n p ; e H T a J I b H O i i m ] I I 0 3 H H > > > K O T O p O e n c n o ] l b 3 y I O T O 6 a a B T O p a : . x o T H H H O - p a s n o m y jH a n y T H K O H p e j { e J I C H H I O Y H C T O ( I > H J I O C O 4 > C K H X H J I J I I 0 3 H i i - B ; 3 T O M C O C T O H T f l p e A B a p H T e ] I b -H a 5 1 3 a j { a q a > e c ] I H M b l X O T H M O G O C H O B B T b T p a H c q e H j ( e H T a J I b H y I O ( I ) e H O M C H O J I O F H I O H a j x -J I C ) K B H J H M O 6 p a s o m . M b l B b I 6 p a . 1 1 H 3 T O K a H T O B C K O C H O H H T H C K a K t t e H T p a ] I b H y I O T C M y H O -C T O J I b K y ) f l O C K O J I b K y O H O 3 a T p a r n B a e T M e T a ( I ) H 3 H Y e c K y I O f l p 0 6 J l e M a T H K y M H p a . H a m a n a . 1 I H 3H O K a 3 b I B a e T : . Y T O @ H H K H p H A e p ) K H B a e T c s l r y c c e p J I C B C K O F O T C 3 H C a , c o m a c H O K O T O p O M y M H p3 T O H C T O J I b K O < < H * L I ; e s i q H C T O F O p a s y M a > > ( K a H T ) > H O H O H b I T . H a * z ( e ] I e > M H p C H e o 6 x o j ( H M O -C T B K ) H B M H p e p ; - * Z I ; a H > X O T b H a H O H H M H h I M 0 6 p a s o M > B H H T C H I J H O H d ] I b H O M O H b I T e ; * a ; p y r n m lC J I O B a M H > H H T C H I J H O H E L 1 I b H b l j j o n b I T : , c o m a c H O H O 3 j I ; H e M y F y c c e p J I I O > H e M h I C J I H M 6 e s n p e q -
A a H H O F O M H p a . @ H H K X a p a K T e p n s y e T O H b I T M H p a p a j ( H K a ] I b H O H H a q e j Y C M 3 T O p ; e ] I a ] I F y c -c e p ] I b . O T - 1 I H Y H e H J I H j I ; H C T a H U ; H H 6 e p e T H a q a J I O B 4 ) H H K O B C K O j i [ K O H t l e n q n : n < < o 6 M n p u l e n m > >[Verweltlichung); T. e. c a M o - p e a J I H 3 8 [ J H H K O H C T H T y T H p y t o u l e i i c y 6 1 > e I { T H B H O C T H B H p 0 U e c -c e p e a ] I H 3 B I J H H M H p a . K o p p e m l i l W I T B K O F O T H H B j C O m a c H O H j ( e e g j n H K a : ) f 1 0 3 B O J U I e T B b I H O J I -H H T b C H C U H ( 1 ) H q e c K y I O j { B O R K y I O ( I ) y H K I I H K ) : ( 1 ) ( l ) y H K I J H K ) H 3 H a q a J I b H O F O O 6 p a w l e H W I ( d i eursprunglich einrahmende Funktion) mnpoM> BCTpanBaHHH 3JICMeHTOB B CBM MHp H (2) co-6bITH]iinoro <<BTOp)KeHH51>> (Eindringen) cy6'I>eKTa B MHp. TamM o6pasom, ;)TO HO3BOJIHeTH a M c j ( e J I a T b B b I B O j ( O T O M j Y T O B K J I a j t @ H H K B B 4 > W I O C O ( I ) H I O C O C T O H T H e T O J I b K O B 3 T O i i p e @ -J I C K C H H O ( 1 ) e H O M C H O J I O F H q e c K o i i x o n q e n l t H H K O p p e . m q n n n a H a ] I H 3 6 ( I ) y H . z z a M e H T a ] I b H O F Oy p o B H R O H b I T a M H p a ) H O T B K ) K C H B C F O M e T a @ n s n q e c I ( O M p e ( I > O p M y J I H p O B a H H H T p W H U H O H -H O T O H O H H T W I M H p a .
K J I 1 0 4 6 8 b l 6 ( 1 1 I O B a ; T p a H c u ; e n j ( e H T a J I b H G H H J I J I K ) 3 H H j T p a n c u ; e H j l ; e H T a ] I b H b l i i n p ; e a . 1 I H 3 M ) H H T C H -
U H O H a J I b H 8 _ H K O p p e m i l l H H j O H b I T M H p a : > H C T O K M H p a : ) * Z l ; O C T y I I K B p e M e H H b I M F O p H 3 0 H T a M > c o -6bITHe.
N A f - I E U N D D I S T A N Z - F I N K U N D H U S S E R L
Die vorliegende Abhandlung zielt darauf ab> einen Horizont zu er6ffnen> vor dem dasDenken des jungen Eugen Finks (1905-1975) mit demjenigen Husserls <<systematischhinsichtlich ihrer verschiedenen philosophischen Grundlegungsdimensionen>> verglichenwerden kann. Finks Philosophie hat= kdnnte man sagen) zwei Gesichter. Einerseits habenauf sein Denken zwei LehrerS d. h. Edmund Husserl und Martin Heidegger, einen ent-scheidenden Einfluss ausgeiibt= sowje er selbst auch die Gedanken dieser beiden Leitcha-
C K)cy!<e HKe.zla, 2014 AcnnpauT PHTCyMeiixan ynusepcnTeTa KnoTo. KnoTo, $lnonnsl
64 65
raktere der (<phiinomenologischen Bewegung>> we]terentwickelt hat. Andererseits ist aber
duck leicht einzusehenj, (lass Fink die Impulse Husserls und I-Ieideggers weder nur schlicht
hingenommen, noon bloB unkritisch propagiert hat, sondem class er sich in seinen Schrif-
ten kritisch mit Husserls und Heideggers Denken auseinandergesetzt hat. Vielleicht diir-
fen wir diese Charakteristik des Denken F inks mit dem Titel cines Sammelbandes seiner
Aufsiitze symbolisch als <<Niihe und Distanz>>l zu Husserl und Heidegger benennen. Aber
wir kbnnen uns offensichtlich nicht begniigen, diese Niihe und Distanz bloB biographisch
(darunter sei auch verstanden: entstehungsgeschichtlich) oder historisch (im weitesten Sin-
ne wirkungsgeschichtlich) nachzuvollziehen. Wir miissen unsere Thematik also streng be-
grenzen. Zu dieser Begrenzung soil der Begriff des transzendentalen Scheins dienen, der
bekanntlich von Immanuel Kant stammt:, und uns einen Leitfaden zur Lektiire Husserls
und Finks zur Hand gibt. Wie Fink selber schreibt, ist die <<Vernichtung der dogmatischen
Metaphysik>> - d. h. das Erkennen des <<transzendentalen Scheins)) - <<das erste Geschiiflt
einer Grundlegung der Philosophie>>.2 @'ir stellen demgem@jist, class nicht nur Kant, son-
dern ouch Husserl und Fink diese A*-abe a@ ihreje eigene Wise vollbracht haben, um
ihr eigenes philosophisches Untecnehmen zu ermbglichen. Wenn unsere l-Iypothese bewie-
sen werden kann, milssen dadurch die grundlegenden Dimensionen dieser Philosophien zu
Tage kommen, d. h. wenn derphilosophische Schein aufgehoben ist, muss die Ausweisung
seiner Erkenntnis mbglich, und darin der grundlegende Charakter der Philosophic, ihr
logos didonai selbst erwiesen werden. Unser Ziel liegt nun darin, <<Niihe und Distanz)) auf
dem Hintergrund jener Dimensionen darzustellen.
Deswegen muss unsere Abhandlung drei Hauptteile zdhlen. (1)\Vir untersuchen kurz
den Begriff des transzendentalen Scheins bei Kant und Husserl, sofern dies fiir unser
Vorhaben nbtig ist. Hier soll es um die in sich verschiedenen Ansiitze des transzendenta-
len Idealismus und besonders um den ihm zugrundeliegenden E@hrungsbegr@' gehen.
(2) Dann muss Finks Bestimmung dieses Begriffs an sich und hinsichtlich seiner systema-
tischen Rolle m semer Philosophie er6rtert werden. Hier untersuchen wir nicht nur die VI
Cartesianische Meditation3,4 sondern auch Finks Kantstudien-A@atz, weil wir besonders
in diesem zweiten Text leicht erkennen kbnnene wie sich Fink sowohl von Kant (genau-
er gesagt, vom <<Kritizismus>>, unter dem Fink Rickerts Schule versteht),5 als auch von
Husserl distanziert. Denn der Kantstudien-Ay/satz zielt nachweislich darauf ab, I-lusserls
Phinomenologie:, die den <<gegenwiirtigen Kritiken>> durch den <<Kritizismus>> ausgesetzt
waren, zu verteidigen, auch wenn uns scheint, class Fink einige wesentliche Gegenkritiken
mit semen etgenen philosophischen Ansiitzen, die sich nicht immer mit denen Husserls
Fink E. Nahe und Distanz: Phdnomenologische Lbrtrdge und A @dtze. Milnchen; Freiburg; Veriag Karl
A l b e r , 1 9 7 6 .
Fink E. Die Studien zur Phanomenologie ]930-1939. Den Haag) Martinus Nijhoff, 1966. S. 101. Von nun
an als Kantstudien-Aufsatz abgek0rzt.
Von nun an als VI.CM abgektlrzt.
Fink E. VL Cartesianische Meditation. Die /dee emer transzendentalen Methodenlehre. Dordrecht: Klu-
wer, 1988.
Vgl. Fink E. Kantstudien-A t@atz. S. 79.
decken, formuliert hat. (3) Am Ende werden wir versuchen, das Grundkonzept der friihenPhilosophie Eugen F inks unter dem Titel der Phdnomenologie des << Ursprungs der %lt))6
zusammenzufassen und ihre Fragestellung und Aufgabe formal zu skizzieren.
1 . E I N C B E R B L I C K U B E R D E N B E G R I F F
D E S T R A N S Z E N D E N T A L E N S C H E I N S B E I K A N T U N D H U S S E R L
Wie oben angedeutet, ist der Gegenstand unserer Untersuchung der ((transzendentaleSchein>>. Bekanntlich stammt aber der Begriff des <<transzendentalen Scheins>> urspriing-
lich von Immanuel Kant. Husserl verwendet diesen Begriff, dessen Gebrauch wir jedochnicht mit Kants identifizieren k6nnen, iim Zusammenhang einer systematischen ReflexionHber seines eigenen philosophischen Standpunkt als solchen. Im folgenden Abschnitt mussdaher der philosophische Sinn und die Rolle des transzendentalen Scheinbegriffs bei Kantund Husserl kurz umrissen werden.
1 - 1 . T R A N S Z E N D E N T 4 L E R S C H E I N B E I K 4 N T
Der Ausdruck des Scheins besagt m gewlssen philosophischen Zusammenhdngen dienicht erkannte Illusion, genauer gesagt, den Irrtum der Erkenntnis bzw. des Urteils, et-
was, das in sich nicht wahrhaft ist, das aber dennoch Rir wahrhaR oder wirklich gehaltenwirdl ohne dass man sich dessen aber bewusst ist.7 parum k6nnte man sagen= sind dieSiitze <<man ist in einem Schein befangen>) und <<man setit das[ Sein eines Gegenstandes,welcher an sich nicht als wahrhafl angenommen werden kann!> ohne sich dessen bewusstzu sein>> philosophisch gleichwertig. <<Transzendentaler Schein>> im Kantischen Sinne ist
jedoch eine spezifische und rein philosophische lllusion, die notwendig die Vernunfl selbstmit sich bringt. Der Grund dieses spezifischen Scheins besteht, Kant zufolge, weder inunserer Unachtsamkeit beim Urteilen ripen in Mangel an Erkenntnis, sondern er ergibtsich als <<natHrliche und unvermeidliche Illusion>> der Vemunft:.S Anders als im Fall des<(empirischen Scheins (z. B. des optischen)>>, den wir als Schein irgendwann durch Gewin-
nung emer neuen Erkenntnis oder durch Verbesserung der erkenntnisbildenden Prozesseim Prinzip erkennen,9 und im Fall des <<logischen Scheins>>, der, wenn man die Regeln derLogik beachtet, prinzipiell vermeidbar ist,
IO betrachtet Kant die Rq/lexion tiber den <<tran-
szendentalen Schein>> bzw. das Erkennen desselben als eine notwendig geforderte und rein
philosophische Aufgabe.11 Mit einem Wort: Diese Aufgabe muss Kant> der eben auf eine
I b i d . S . 1 0 2 .
Beispielsweise besagt der Schein im dsthetischen Zusammenhang ohne Zweifel etwas ganz anderes. Dennwir sollen in einer dsthetischen Einstellung prinzipiell inner dessen inne sein, class das, was der Scheindarstellt, nicht notwendig wahrhafl oder wirkiich sein muss, well er reine Fantasie sein kann. D.h. derSchein ist in einem Gemalde oder Roman in manchen Fallen als Schem erkannt. Die Leute, die die Schein-
barkeit des k(lnstlichen Scheins nicht zu erkennen verm6gen, halt man normalerweise ftlr verr0ckt.Kant L Krjtlk der Yemen k2rnu/!/i. A298/B397. Von nun an als KrV abgektirzt.Vgl. Kr V. A295/B351 f.
10 V g l . I b i d . A 2 9 6 f . / B 3 5 3 .
目 V g l . I b i d . A 2 9 5 f . / B 3 5 2 f .
66 Y. Ikeda Horizon ;3 (1) :2014 67
<<Kritik der reinen Vemunfl:>> abzielt, notwendig durchflihren, well der Grund dieses spell
fischen Scheins in der VernunH: selbst liegt. Kant ergriindet das Problem des transzenden-
talen Scheins in der Kr V, indem er drei Grundthematiken der tiberlieferten Metaphysik in
Anschem njmmt - rationale Psychologie, Kosmologie und Theologie, die sich unter dem
Sammelbegriff metaphysica specialis zusammenfassen lassen -, unter dem Blickwinkelder Dialektik der F@rnunj1, die sich <<Logik des Scheins>> nennt, 12 und deren Aufgabe aus-
driicklich als <<Kritik des dialektischen Scheins>> bestimmt ist.13 I=)amit wir die Wirkung des
Erkennens des transzendentalen Scheins ermessen kbnnen, lichen wir nun unsererse!ts
Kants @bltbegrj/?; den Gegenstand der sog. rationalen Kosmologie, kurz in Betracht.
Kant bestimmt das Wort <<Welt>> in erster Linie als die <<absolute Total itiit der existie-
renden Dinge>> (ontologische Bestimmung der Welt als Totalitit),14 die aber notwendig als
<<Gegenstand, der nirgend anders als in unseren Gedanken gegeben werden kann>> (her-
vorhebung von Vfs.),lS anzusehen sei. Kant stellt aber gleichzeitig auch rest: <<Ohne Sinn-
Iichkeit wiirde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden>>.16
Der Gegenstand, den wir als etwas je sinnvoll bezeichnen und als Korrelat des wahrhqf-
tigen Erkennens annehmen kbnnen, kann nur im Zusammenspiel von Sinnlichkeit und
V?rstand gegeben werden. Deswegen scheint uns Kants Grundansatz darin zu liegen, die
Welt als Ibtum in <<die schlechthin unbedingte 7btalitdt der Synthesis der Erscheinungen>>17
aufzul6sen (erkenntnistheoretische Gegebenheitsweise der Welt). Well die reine VemunR
dem Gesetz unterworfen ist, dem zufolge, wenn ein Bedingtes schon gegeben ist, <<die gau-
ze Reihe alley Bedingungen desselben>>, notwendig gegeben sem muss,18' mmmt sie ohne
weiteres an, class die << FF2?lt>> als die ganze Reihe alley Bedingungen notwendig entweder
unendlich oder endlich sein muss.19 Aber ohne Zweifel kann uns <<clie empirische Synthese
und die Reihe der Bedingungen in der Erscheinung <...> notwendig sukzessiv und nur
in der Zeit nach einander gegeben>>20 werden. Well die emptrische Synthesis <<notwendigsukzessiv und nur in der left nach einander gegeben>> wird, kann die Wit in ihrer 7btalitat
niemals in unserer m6glichen Erfahrung gegeben, sondem nur <<in unseren Gedanken>>
rein logisch gedacht werden. Dabei kommt zwar der erkenntnistheoretische Unterschied
zwischen dem empirisch gegebenen (bzw. zu gebenden) Gegenstand und der %lt als absθー
luter Ibtalitdt der Synthesis der Erscheinungen zum Vorschein, mit der gleichzeitig auch
die ontologische D*renz, d. h. die D*renz der Seinsweise von beiden offenbar wird.
Diese Sachlage kann so ausgedriickt werden, class dem Weltbegriff kein Erkenntnisgegen-
stand zukommt, d. h. class sein Gegenstand <<an sich>) nichts fst.21 pie %lt an sich existiert
12 I b i d . A 1 3 l / B 1 7 0 , A 2 9 3 / B 3 4 9 .
13 I b i d . A 6 2 / B 8 6 ,
14 I b i d . A 4 1 9 / B 4 4 7 .
15 I b i d . A 4 8 1 / B 5 0 9 .
16 lbid. A51 /B75.
I7 lbid. A481 /B509.
18 I b i d . A 4 9 7 / B 5 2 5 .
19 V g l . I b i d . A 5 0 3 f f . / B 5 3 1 I T .
20 I b i d . A 5 0 0 / B 5 2 8 .
21 Diese Ansicht teilen wir mit Eugen Fink und Lbzl6 Tengelyi. Vgl. Fink E. f K?lt und Endlichkeit. W(lrzburg,1990. S. 139 und Tengelyi L. E/=/2zhrung und A usdruck. Springer, 2007. S.70 f. Auch vgl. einen aufschluss-
daher weder unendlich noch endiich, weil nur der Gegenstand der mdglichen E@hrungaberhaupt dem oben genannten Gesetz der reinen Vernunfl unterworfen sein kann.22 Dies
besagt: <<Nichts (die Welt!)>> - kann keineswegs einem solchen Gesetz unterworfen sein.
So unterscheidet Kant in Kr V die Welt streng von dem Ding an sich (Gegenstand), um den
<<transzendentalen Schein)) hervorzuheben.
Hier wollen wir auf eine nennenswerte Konsequenz aufmerksam machen, die Kants An-
satz notwendig mit sich bringt: Der transzendentale Schein hat gar keinen Gegenstand in
der Ec/izhrung, wdhrend der oben genannte empirische oder logische Schein einen Gegen-
stand, den -wir gem@ unserer Erkenntnisart sollen erkennen kdnnen, haben muss. Und die-
sen scheinbaren Gegenstand des transzendentalen Scheins, der in sich ein Unding ist, setzt
Kant mit den transzendentalen Ideen gleich,23 die nicht als <<konstitutives Prinzq))), sondern
nur als <<ein regulatives)) gelten.24 Der Gegenstand des empirischen oder logischen Scheins
und der des transzendentalen sind ihrem Wbsen nach, ja, ontologisch grundverschieden.Daher kbnnen wir annehmen, class der <<Schliissel>> der Auf]6sung dieses Scheins nicht
nur in einer Art .Lehrbegr@'des transzendentalen Jdealismus besteht - grob gesagt wlire
dies etwa eine <<erkenntnistheoretische>> Interpretation -,25 sondern auch in der Einsicht
in den ontologischen Unterschied zwischen einem Gegenstand hberhaupt und Nichts, d.h.
der Idee ohne Gegenstand. Diese Interpretationslinie kbnnte man etwa als <<ontologisch>>
bezeichnen. Wenn man diesen Unterschied im Hinblick auf die Differenz von .Phaenomena
und Noumena in Betracht trifII, kann die betreffende Interpretationslinie kosmologisch her
Ben. 26 D jese [lberlegungen nun laufen auf die Erkenntnis hinaus,t class ein transzendentaler
reichen Kommentar zu Kant: Ishikawa H. Kants Denken von einem Dritten- Das Gerichtshq/=-Modelle unddas unendliche Urteil m der Antinomienlehre. Frankfurt, Bem, Paris, New York, l 990.
22 VgL Kr V., A504 f./B532 f. CIbrigens bestdtigt Fink spiitestens im Jahre 193 l ausdr0cklich mit der klaren
Sicht diese Sachlage bei Kant. Darin sieht er schon Kants epochemachende Beitriige zum Weltbegriff. <<Die
positive Bedeutung der kantischen -'ldeenlehre'~ besteht darin. negativ gezeigt zu haben, daB die Verhdltnis-
se des Innerweltlichen nicht au F die Weltganzheit anwendbar sind; daB zun5chst die menschliche VernunRdas Schicksal hat, die Weltganzheit nach dem Schema einer innerweltlichen Ganzheit sich vorstellen, daB
sie sich aber damit notwendig in einen Widerstreit verwickelt>>. Eugen Fink Gesamtausgabe 3/2 (von nun abals EFGA 3/2 abgekiirzt), S. 95, (Z-IX, 14a. Datiert am 31.8.1931). Vgl. auch: EFGA 3/1, S.4l6 Ff. (M-II,
Text-Nr. 2), und Cairns D. Con-versattons with Husserl and Fink Ed:ted bv the Husserl-Archi-ves m Louvain.The Hague, Netherlands. Martinus NijhofI; 1976. S. 98.
23 Vgl. Kr V., A32 l ff;/B377 ff.
24 Ibid. A508f./B536f.: <<Da durch den kosmologischen Grundsatz der T'otalitlit kein Maximum der Reihevon Bedingungen in einer Sinnenwelt, als einem Dinge an sich seibst, gegeben wird, sondern bloB imRegressus derselben aufgegeben werden kann, so beh5lt der gedachte Grundsatz der reinen VernunfI, in
seiner dergestalt berichtigten Bedeutung, annoch seine gute Gtiltigkeit, zwar nicht als Axiom, die Totalitat
im Ob jekt als wirklich zu denken, sondern als ein Problem fHr den Verstand, also fllr das Sub jekt, um, der
Vollstdndigkeit in der Idee gemlil3, den Regressus in der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Be-
dingten anzustellen und fortzusetzen>>. Kant kann ohne Schwierigkeit die Welt (als Nichts verstanden) mit
der Idee gleichsetzen, weil der WeltbegriIT bei ihm prinzipiell als <<ens rat:onrs>>, d. h. <<leerer Begr@~ohne
Gegenstand>> verstanden wird. <<Ens rationis>> selbst wird hier als aNichts).> Verstanden. Vgl. Ibid. A290 ff./
B346 ff. (Siehe besonders die Tafel des Begriffs von Nichts: Ibid. A292/B348).
25 I b i d . A 4 9 0 f f . / B 5 1 8 f f .
26 In allege Richtung ging Fink ausdr0cklich weiter, als er sich spEiter mit Kant thematisch auseinandergesetzt
hat. Vg!. Fink E. %lt und Endl:chkeit. l 990. Jedoch schreibt Fink schon im Jahre 1935: <<Ist es nicht Kants
metaphysiche Entdeckung, daB "Sein'' liberhaupt Erschemung d. i. binnenweltlich ist? Kant ist also der
68 Y . I k e d a 日orizon 3 <1) ;ZOIzj. 69
Schein exalt dann vorliegt, wenn dem Gegenstand der <<Idee>>, clef an sich nichts ist, die
Bestimmungen, die von der Natur der Gegenstdnde unserer m6glichen Erfahrung herstam-
men, zugesprochen werden. Dabei wird die\Velt an sich bei Kant als das Bild ohne Urbild,d.h. als der von der reinen H?rnunjl hervorgebrachte Schein ausgelegt.\1Vir verfallen die-
sem Irrtum aufsozusagen <<transzendentale>> Weise, well er, wie oben hingewiesen, cine Rjr
die Vernunfl <<nattirliche und unvermeidliche lllusion>>27 clarstellt., d. h. die Vernunfl nimmt
den Weltbegriff als das Abbild des Urbilds (oder als <<Urbilder der Dinge>>,;28 wje es, nach
Kant, bei Plato der Fall sei) an. Diese Art <<metaphysische>> Erkenntnis, deren Gegenstand
es nur in unseren Gedanken geben kann, ist <<cloch als gegeben anzusehen, und Metaphysik
ist, wenn auch gleich nicht als Wissenschafl:, doch als Naturanlage (metaphysica natura-
Iis) wirk Hch>〉.29 Mit anderen Worten: der Grund des Kantischen transzendentalen Scheins
liegt in derjiir die krnunji <(natdrlichen und unvermeidlichen)) Schwierigkeit, den oben
genannten erkenntnistheoretisch, ontologisch und nicht zuletzt kosmologisch artikulierba-
ren Unterschiedphilosophisch zu erkennen, zu begrhnden und einer Philosophic zugrunde
zu legen. l-Iieraus wird ersichtlich, warum Kant uns, um den transzendentalen Schein zu
erkennen, vorschliigt, die oben dargeiegte Differenz als das oberste Prinzip des Philoso-
phierens iiberhaupt anzusehen. Dieses <<Prinzip des Philosophierens>> wird im Kantschen
Lehrbegriff des transzendentalen Idealismus aufgenommen, dem zufolge die <<Bedingun-
gen der ]\Jdglichkeit der EJ=kzhrung <...> zugleich die Bedingungen der Mbglichkeit der
Gegenstdnde der E@hrung>> sind;30 und damit vom transzendentalen Idealismus iris-
gesamt, dem die strengen Dualismen von <<Verstand>> und <<Vernunfl[>>, <<Gegenstand der
Erfahrung>>, und <<Idee>>, <<Etwas>> und <<Nichts>>, und nicht zuletzt auch <<Phaenomena>> und
<<Noumena>> zugrunde liegen. Kauts transzendentaler Idealismus besteht in einer rechtm5-
Bigen und durch den Erweis der (<Korrelation)) unserer Erkenntnisart und des Etwas bzw.
Gegenstands der Erkenntnis erbffneten Anerkennung dieser Dualismen, und er verfolgt das
Ziel, den oben genannten (<transzendentalen Schein>> kenntlich zu machen.
1 - 2 . T R A N S Z E N D E N D i L E R S C H E / N B E I . H ' u s s E R L
nicht im Kantischen Sinne verstanden zu sein scheint. U. E. Iassen sich in Husserls Ge-
brauch dieses Begriffes Kantscher Provenienz prinzipiell zwet m sich verschiedene Defi-
nitionen erkennen.32
E R S T E D E F I N I T I O N H U S S E R L S
Den ersten Gebrauch des Begrffs des <<transzendentalen Scheins>> bei Husserl findenwir in seinen Vorlesungen <<Erste Philosophic II>> 1923/1924 (Hua VIII). Husserl zufol-
ge ist der Sail <<lch bin>> mit apodiktischer Zweifellosigkeit einsehbar, wiihrend der Sail<< Welt ist>> nur faktisch und kontingent gilt.33 Denn, solange man sinnvoll - jedoch hypo-
thetisch - von der <<Nichtexistenz der Welt>>, die wir empirisch wahrnehmend zweifelloserfahren (erfahren haben und wahrscheinlich erfahren werden), sprechen kann> handelt essich dabei um einen <<evident mdglichen, d.h. als widersinnsfrei einsehbaren Ansatz>>.34
Daher schliel3t der Satz <<Welt ist>> nicht die Mdglichkeit aus, class er selbst Schein seinkbnnte. Husserl versucht nun., den auf diese Weise konstituierten, spezifischen <<Schein>>zu charakterisieren, mit Riicksicht darauf, class es um die <<\Velt>> oder das <<\Veltall>> geht.Genauer gesprochen unterscheidet sich dieser spezifische Schein von <<jedem empirischenSchein, dem Schein im gemeinen Sinne>> (bspw. eine scheinbare Wahmehmung einer schd-
nen Frau, die ich spiiter als eine Puppe wahrnehme). Husserl nennt den ersten Schein den35 Zwar ist nicht v6ilig klar, weswegen Husserl gerade diesen Kantisch
gepr5gten Begriff verwendet* wenn man bedenktl class sich Husserl mit Sicherheit selbstder VerwandtschaR und Differenz zu Kant bewusst war; doch kbnnen wir leicht einsehen,worauf Husserl damit abzielt, da diese Diskussion in <<Erste Philosophie II>> an HusserlsArgument in <<Die phiinomenologische Fundamentalbetrachtung aus Ideen I>>36 erinnert.
Im genannten Text stellt Husserl die fhr seine Philosophie konstitutiven Ansjitze dar,nach welchen erstens (<Existenz einer Welt <.. > das Korrelat gewisser, durch gewisse We-
sensgestaltungen ausgetzeichneter Erfahrunsmannigfaltigkeiten>>37 jst, oder genauer, class<<die %lt der transzendenten 'Cres'' durchaus atf[.Bew@tsein, und zwar nicht auf logisch
38 zweitens, class <<kein reales Sein, kein sol-
ches, das sich bewuBtseinsmiiBig durch Erscheinungen darstellt und ausweist, <.. > jiir das
\Vie uns bekannt, bezeichnet Husserl seine spiite Philosophie als transzendental-idea-
listisch.31 I-lusserl sprichtjedoch von einem <<transzendentalen Schein>>, cler uns eigentlich
Metaphysiker, der den kosmologischen Hor:zont des Seins freilegte < ..> Entr0ckung der Ontolog:e zum
Problem der Kosmologie>> (OH-III 2-4). Zitiert nach: Bruzina R. Hinter der ausgeschriebenen Finkschen
Meditation: Meontik-Padagogik. Eugen Fink Sozialphilosophie Anthropologie Kosmologie Padagog:k Me-
thodik. W(lrzburg, B6hmer, 2006. S. 205 (hervorhebung von E. Fink).
27 l b i d , A 2 9 8 / B 3 9 7 ,
28 l b i d . A 3 1 3 / B 3 7 0 ,
29 Ibid. B21 Diese <(metaphysica naturalis>> ist schlechthin als etwa antolopologisches Faktum anzusehen,dessen philosophische Rechtfertigung nicht m6glich ist (Vermutlich ware dies ein der wichtigsten Griln-
de, weswegen Kant die Frage << FVie ist Metaphysik als Naturanlage mogl:ch?>> in Kr V ausschlieBt). Kant
schldgt zur L6sung des Problems die <<Kritik der VernunfI>> vor, die uns <<notwendig zur Wissenschaft>>
fuhrt. Dabei lasst sich die Frage so formulieren: << FHe rst Metaph-vs:k als Wssenschaji moglich?:>> (Ibid.
30 I b i d . A l 5 8 / B 1 9 7 .
31 Siehe bspw. Hua 1, S. 118 f.
32 Wir k6nnen fiir den Begriff des <<transzendentalen Scheins>> bei Husseri drei verschiedene Arten des Ge-
brauchs aufweisen. Wir werden in der vorliegenden Abhandlung nicht thematisch auf den dritten Ge-
brauch des transzendentalen Scheinbegriffs - <<Schein des transzendentalen Solipzismus>> (flua XVII,S. 248) - eingehen, weil er in systematiscber Hinsicht bzw. in der systematischen Reflexion der Natur dertranszendentaI-ideaiistischen Phiinomenologie als solcher keine selbststiindige Rolle spielt; dem Problemdes <<Scheins des Solipsismus>> liegen systematisch betrachtet vielmehr die zwei anderen <<Paradoxien>>
zugrunde. Selbstversttindlich besagt dies keineswegs, class die A ufl6sung des << Scheins des transzendenta-
len Solipsismus>> - Aul]6sung durch die phsinomenologische, intentionaie Analyse der Intersubjektivittit
und intersubjektiven Konstitution - irrelevant f0r Husserls Pro jekt der transzendentalen Phanomenolgieist. Vgl. Schuhmann K. D:e Fundamentalbetrachtung der Phdnomenolog:e. Den Haag, Martinus Nijhoff,1 9 7 1 . S . X X X V I I I f .
33 Vgl. Hua Vlll, S. 50.
34 Ibid. S. 55, hervorhebung von E. Husseri.
35 lbid. S. 53, hervorhebung von E. Husserl.
36 Hua III/1, S. 56 IT.
37 l b i d , S . 1 0 3 .
38 Ibid. S. 104, hervorhebung von E. I-Iusserl.
70 Y . I k e d a H o r i z o n 3 ( : l . ) 2 0 1 4 71
Sein des Bewy/1tseins selbst (im weitesten Sinne des Erlebnisstromes) notwendig [ist]>>.:39
Dies lRsst sich nun damit begriinden, class die Gegenbenheitsweise des reinen Bewy/Jt-
seins (d. h. <<schlichtes Erschauen von etwas, das in der Wahrnehmung als "Absolutes"
gegeben (bzw. zu geben) ist ...>>)40 phiinomenologisch betrachtet einen ausgezeichneten
Vorrang vor der Gegebenhe]tsweise des realen Seins (d. h. <<Abschattung>>)4l hat. Das ((rei-
ne>> Bewu Btsein, das keineswegs mit dem ((psychologischen>> verwechselt werden darf,
kennzeichnet Husserl zugleich als <<Immanenz>>, und ihren Gegensatz terminologisch als
<<Transzendenz>> - als Realitdt iiberhaupt.42 Aus diesem Grund charakterisiert Husserl das
reine BewuBtsein als <<Residuum der Weltvernichtung>>.43 Auf die gleiche Art vollzieht er
in <<Erste Philosophie II>> eine (<sozusagen erkenntniskritische Vemichtung meines Leibes
wie des Weltalls>>44 und spricht vom reinen BewuBtsein als <<apodiktische[m] Residuum der
apodiktischen Kritik der Welt>>.45 I-lief ist die << Welt (bzw. Weltall)>>, die zu <<vernichten>> ist,
als Inbegr@'der Realitdt zu verstehen. Es gsilte aber ohne Zweifel Rir verr0ckt, wenn man
sich so verhielte, als wEire einem die Existenz der Welt blol3er <<Schein>>. Aber man darf hier
nicht vergessen, class Husserls Argument der <<Weltvemichtung>> ein Denkexperiment ist,
das dazu dienen soll, seinen sog. <'<transzendentalen Idealismus)) zu begriinden.46 Husserl
behauptet ausdrUcklich, class sein phiinomenologischer, transzendentaler Idealismus inso-
fem kein etwa <<Berkeleyscher)> ist, cla er nachdriicklich unterstreicht, class erstens <<Realitat
und Welt <...> hier eben Titel fiir gewisse giiltige Sinneseinheiten, niihmlich Einheiten des
"Sinnes" sind und zweitens diese Einheiten selbst von dem "sinngebenden Bew@tsein"
konstituiert werden sollen>>.47 Kann diese transzendental-idealistische These nachgewiesen
werden, ist <<eine absolute Realit!it>>, sagt Husseri, <<genau so viel wie ein rundes Viereck>>.48
So ist unter dem ersten Gebrauch des (<transzendentalen Scheins>> hierum eine (<philoso-
phische f@rabsolutierungder @2lt>>49 :zu verstehen, weil, wenn der Satz des <<Nichtseins der
Welt>> ohne Widersinn einsehbar ist, jene <<philosophische Verabsolutierung der Welt>> sich
notwendig als philosophischer Schein herausstellen muss. Dieser philosophische Schein
39 lbid., hervorhebung von E. Husserl.
40 I b i d . S . 9 2 .
41 Vgl. Ibid. S. 86 ff., 49 l ff.
42 V g l . I b i d . S . 9 1 I T .
43 I b i d . S . 1 0 3 f f ,
44 Hua. VIII. S. 73.
45 Ibid. S. 75 f ,
46 Daher gerdt Husseris << Vernichtung der Welt>> weder in die Gefahr eines Skeptizismus, noch, wie Fink
treffend sagt, in einem <<ilberspitzten Methodismus>>, dessen Ideal nicbts anderes als <<GewiBheit>> der Er-
kenntnis ist ( Fink E. Vl.CM. S. 49 tT.). Vielmehr ziehlt Husserls Phlinomenologie darauf ab: <<Es gilt nicht,
Objektivitsit zu sichern, sondern sie zu verstehen>> (Hua VI. S. 193). Diesen Ansatz kbnnen wir fur eines der
ursprtlnglichsten Motive der Ph5nomenologie Husseris halten, nach der sog. << Wende zur transzendentalen
Phiinomenologie>>. Siehe hierzu besonders: Hua XXIV. S. 404 f., I-lua IL S. 6, Hua 1. S. 118 f. und Hua V.
S. 152 f. und auch Husserl and Heidegger on Being in the World. Netherlands, Kluwer Academic Publ.,
2 0 0 4 . S . 3 4 f f ,
47 Hua 111/ l . S. 120, hervorhebung von E. Husserl.
48 Ibid.
49 Ibid., hervorhebung von E. Husserl.
wird erkannt, wenn die Korrelation der %lt (Ganzheit der Realitd/) und des Bewusstseinsin ihrer .Relativitdt (Relativitdt der @bltjlr das erkennende Bewusstsein) eingesehen wird.Dies liisst bereits erahnen, class zwar Husserl, wie Kant, den Schliissel fiir die Auf]6sungdieses transzendentalen Scheins im sogenannten <<transzendentalen Idealismus>> sieht, demzufolge, wie beschrieben, <<die Bedingung der Mbglichkeit der Eqizhrung < ..> zugleichdie Bedingungen der Mdglichkeit der Gegenstdnde der EC/izhrung>> sind. Aber Husserls<<Idealismus>> scheint dennoch nicht mit Kants identisch zu sein. Diese Sachlage werdenwtr spiiter prdzlsieren.
Z w E I T E D E F I N I T I O N H U S S E R L S
Husserls zweiten Gebrauch des Ausdrucks des transzendentalen Scheins finden wir ineinem auf Septembar 193 l datierten Manuskript, das zu den sogenannten B-Manuskripten
(zur ph!inomenologischen Reduktion) geh6rt.50 port geht es um ein anderes Problem destranszendentalen Idealismus, mit dem sich der sphte Husserl (besonders in den dreiBigerJahren) ausdriicklich besch!iftigte; dieses nennt er - vermutlich unter dem Einlluss seinesAssistenten Fink - << H?rmenschlichung>> bzw. << H?rweltlichung>>.51 j=)as Problem der (<Ver-
weltlichung>> taucht auf gleichsam absehbare Weise beim sp5ten Husserl auf: denn <<nunsteht gleich am Anfang die Schwierigkeit, class ich [als transzendentale Subjektivit!itj dochselbst mit zur Welt gehdre>>.52 I-Iusserl hatte schon zuvor festgestellt: <<Das transzendentaleIch ist rejn in sich; es vollzieht aber in sich eine Selbstobjektivatibn, gibt sich selbst die Sin-
nesgestalt "menschliche Seele" und "objektive Realitiit">>.53 Diese <<Selbstobjektivation>>wird als <<Selbstverhiillung>> von <(rnein[em] transzendentalen Ich>> ausgelegt, ihr Resultatist nichts anderes als der <<Mensch>>.54 I3eide <<Iche>> sind daher inntg verbunden. Hier ergibt
sich eine Paradoxie: <<SchlieBe ich das Sein der Welt als Frageboden aus>>,- weil hier die
phiinomenologische Reduktion zu vollziehen ist - <<so schlieBe ich damit auch mein ei-
genes Sein ebenso aus>>.55 Es geht hier um die Identitdt und D*renz der transzendentalen
Suly;ektivitdt und des Menschen, der in sich als die <<Selbstapperzeption Mensch)> clerselbenverstanden werden soll.56 j=)ieser Fragestellung liegt die Intuition zugrunde, class nicht nurdie Welt oder das All der Realit5t Rir die transzendentale Subjektivititit relativ, sondern
50 H u a X X X I V . N o . 1 8 . S . 2 7 9 f T .
51 I b i d . S . 2 8 9 .
52 Ibid. S. 283. So ist helm spaten Husserl schon vorausgesetzt, class, wie bei Fink (vgl. Fink E. Studien zurPhanomenolog:e ]930-1939. Den Haag, Martinus NijhofF, 1966. S. 14 f.), die transzendentale Sub jektivitatselbst notwendig verkorpert sein mu6. Diese Notwendigkeit m6chten wir fHr die Philosophic Husserls biernicht systematisch verfolgen, well diese Problematik welt liber unsere Frage hinausRlhrt. Vgl. Bemet R.Consc:ence et Existence - Perspectwes phinominologiques. PUF, 2004. S. 143 1T.; Schuhmann K. DieFundamentalbetrachtung der Phanomenologie. S. 108 IT. und auch Uemura G. A Preliminaly Sketch onEmbodied Transcendental Sub jectivity in Husserl. CARLS Series q[Advanced Study qf Loge and Sens:bt/-
itv. Japan, Keio University Publ., 2009. p. 339.
53 Hua VllI. S. 77.
54 Ibid,
55 H u a X X X I V ; S . 2 8 3 .
56 I b i d . S . 2 9 0 .
72 Y . I k e d a Horizon 3 (1.) 201zj. 73
auch die Subjektitiv!it tiberhaupt fiir die transzendentale relattv, ja <(selbst-relativ)) seinmuss, weil, wie <<Seiendes tiberhaupt nur denkbar ist als bezogen auf eine transzendentaleSubjektivit!it, diese These Husserls haben wir oben studiert,_ <<eme transzendentaleSubjektivitdt somit auf sich selbst zuriickbezogen tst>>.57 Es liil3t sich zusammenfassendsagen, class es bei der vorliegenden Frage nicht nur um die transzendenta!-idealistischeThese der <<Korrelation in der .Relativitdt der %ltjiir das Bewusstsein))= sondem vielmehrauch um die <<Selbst-Relativitdt der transzendentalen Sul!jektivitdt jiir sich selbst>>. Wenndie oben genannte <<Identitiit und Differenz>> der transzendentalen Subjektivit!it und desMenschen ph!inomenologisch - d. i. durch den Vollzug der (<phiinomenologischen Epo-
chc3>> und <<Reduktion)> - nicht erkenntiich werden, <<macht>>, schreibt Husserl, dies (<dentranszendentalen Schein, dessen Durchschauen die einzige m6gliche Enthiillung und Auf-
[6sung des transzendentalen Psychologismus ist und zugleich das Verstiindnis seiner in derNatiirlichkeit uniiberwindlichen Notwendigkeit>>.58
Unter dem zweiten Gebrauch des Ausdrucks des transzendentalen Scheins meint Hus-
serl daher nichts anderes als den Schein des <<transzendentalen .Psychologismus>>. ObgleichHusserl diese Paradoxie der Selbst-Relativitdt der transzendentalen Sul!jektivitdtfzir sichselbst, ja den (<transzendentalen 'Psychologismus>> vom Grund her aufzulbsen, d. h. <<dasIch, dieser Mensch>> vom <<Ich, dem alles gilt, was ihm gilt, das in sich das Universumseiner Geltung triigt [d. h. dem Ich als der transzendentalen Subjektivit5t]>> an der Wurzelabzutrennen versuchtl da sich z. B. das letzte <<Ich>> als das <<A4ir> in dessen Sein eben allegesGelten seine St5tte hat>> verwechseln lEisst>59 gelingt es ihm nicht:, das letzte Wort Uber dieAuBbsung zu sprechen. Den Grund hiervon sieht I-Iusserl in der <<Unm6glichkeit, die Epo-
ch6 im unbedingten i]berhaupt, also als eine unbedingt allgemeine zu vollziehen>>,60 ohne
jedoch den Grund dieser <<LJnmbglichkeit>> selbst auszuwelsen.61
VVie wir uns im folgenden Teil unserer Untersuchung ansehen werden, nimmt sich Finkdennoch die ausdriickliche Ausweisung dieser <<Unm6glichkeit>> in ihrer Notwendigkeit alsdie konstitutive Aufgabe fiir sein eigenes ph5nomenologisches Projekt vor. Denn wir erken-
nen laut Fink:, und dies k6nnen wir vorwegnehmen, erst die Spezifit!it der Seinsweise dertranszendentalen Sul!jektivitdt= wenn jene <<Unm6glichkeit>> erwiesen ist. Denn hierdurchwird es erst erm6glicht, die oben genannte Idee der <<Korrelation in ihrer Relativitiit>>, iiberdie die Beziehung des erkennenden Subjekts zum zu erkennenden Objekt hinausgehend, inder Dimension der f2rwirklichung (<< H?rweltlichung>>), von der her Fink die ursprtinglicheSeinsweise der transzendentalen Su4jektivitdt versteht) auszudeuten.
D E R G R U N D U N T E R S C H I E D Z W I S C H E N K A N T U N D H U S S E R L
Wie wir gesehen haben, Iassen sich l-Iusserls Argumente des <<transzendentalen Scheins>>
insofern mit denen Kants in {]bereinstimmung bringen, als der Schliissel der Aufl6sung
des Scheins bei beiden Denkern in der ihnen jeweils eigenen Form des (<transzendentalen
Idealismus>> liegt, d. h. in der These der <<.Korrelation in der Relativitdt der %ltjiir das er-
kennende Bewusstsein>> (und Rir Husserl derentsprechend in der These <<Selbst-Relativitdt
der transzendentalen Sul!jektividt zu sich selbst>>). Doch miissen wir unsererseits den Un-
terschied (bzw. die <<Distanz>>) zwischen beiden Typen des transzendentalen Idealismus
herausarbeiten. Dazu ist u. E. (zwar vielleicht nicht zureichend aber) notwendig, class wir
den Begr@'der E@hrung, der sich bei beiden ganz unterschiedlich bestimmen liiBt, kurz
in Betracht ziehen. Husserl ist uicht gezwungen, diesem Begriff den Kantischen strengen
<<Dualismus)) von Gegenstand (oder Phaenomena) und Jdeen bzw. Wlt (Noumena) zugrun-
de zu legen, weil, wenn wir uns dies im Voraus anzudeuten erlauben diirfen, Husserl der
mlt, im Unterschiedzu Kant, eine eigene E@hrbarkeit zuspricht.
Wiihrend Kant, wie gesehen, die @i?lt in der absoluten Ibtalitdt der Synthese der Erschei-
nungen auf16st, wird sie bei Husserl nicht schlicht als die Totalitdt dieser Synthese, sondem
vielmehr als Horizont62 verstanden. Denn nach Husserl ist ein Sul!jekt (oder das Ich) sich
nur einer Wlt bewusst, d. h. es kann nur von einer << l;H?lt))je sinnvoll sprechen undsie phd-
nomenologisch beschreiben, (1) wenn sein <'<aktuelles Whrnehmung@ld>> den aBereich))
der <<anschaulich klar oder dunkel, deutlich oder undeutli2:h Mitgegenwdrtigen als seines
"bestiitigen Umrings" einschlieBt (@blt bzw. Um-welt als Horizont der lUitgegenwartigun-
gen des aktuellen Gegenwdrtigten)>>,63 und (2) wenn dieses (<aktuelles Wahmehmungsfeld>>
und seine <<Mitgegenwiirtigen>> selber <<umgeben von einem dunkel bewussten f{orizont un-
bestimmter Wirklichkeit>> sind.64 <;3.) Dieser Horizont ist die fH?lt, <<endlos ausgebreitet im
Raum, endlos werdend und geworden in der Zeit>>;65 sje ist die @2!lt als raum-zeitlicher Uni-
versalhorizont. Solche deskr<ptiv gewonnenen Charakteristiken der Gegebenheitsweise der
mlt setzen korrelativ den Wr-Begr@der %lt schon voraus. Wie Karl Schuhmann treffend
bemerkt, ist die << Welt>> bei Husserl prinzipiell <<von kontinuierlich zusammenhiingender,
von "quantltativer" Natur>>.66 <<Ein leerer Nebel der dunkeln Unbestimmtheit>>, schreibt
Husserl, <<bev6lkert sich mit anschaulichen M6glichkeiten paler Vermutlichkeiten, und
die "Form" der Welt, eben als "Welt'', ist vorgezeichnet>>.67 j=)eswegen ist diese <<Form der
57 I b i d . S . 2 4 .
58 l b i d . S . 2 9 1 .
59 Ibid. S. 284. Husserls weitere Versuche der Aufl6sung dieser Paradoxie finden wir in der Krtsts-A bhand-/ung wieder. Vgl. I-lua Vl. S. l 85 ff.
60 l b i d . S . 2 9 3 ,
61 0brigens erwahnt Husserl diese <<Unm6glichkeit>> auch in der Kris:s-A bhandlung: <<Die Unauf16sbarkeitder vorhin entfalteten Paradoxie wtlrde besagen, daB eine wirklich universale und radikale Epoch6 0ber-haupt nicht durchflihrbar ist. niihmlich in A bsicht auf eine streng an sie gebundene Wissenschaft>> (Hua Vl.S. 184). Er versucht aber nicht ausdriick[ich den Grund dieser Notwendigkeit aufzudecken.
62 Vgl. Claesges U. Zwezdeut:gkeit :n ffusserls Lebenswelt-Begr@~ Perspektiven transzendentalphdnnomeno-
/og:scher Forschung Phaenomenologica. Bd 49. Haag, Martinus Nijhotf. 1972, S. 85 ff.; Strasser St. Der
Begriff der Welt in der phEinomenologischen Philosophie. Phanomenologie und Prax:s [Phanomenolog:-
sche Forschungen Bd. 3]. Freiburg; Miinchen, 1976. S. 151 ff.; Sepp H. R. Totaihorizont - Zeitspielraum
0berglinge in Husserls und Finks Bestimmung von Welt. Eugen Fink SozialjJh:losoph:e Anthropolog:e
Kosmologie Padagogik Methodlk. W llrzburg, BOhmer A., 2006. S. 155 ff.
63 Hua III/l. S. 57.
64 Ibid.
65 I b i d . S . 5 6 .
66 Vgl. Schuhmann K. Die Fundamentalbetrachtung der Phdnomenologie. S. 19 f.
67 Ibid. S. 57, hervorhebung von Vfs.
74 Y . I k e d a Horizon 3 (l) :zolzj. 75
welt>> nicht als die rein logische, sondern als die der Wirklichkeit anzusehen. Hier kann
die These aufgestellt werden: Die vorgezeichnete <<Form der %lt>> erm6glicht korrelativ
die Dingerfahrung selbst.68 I=)iese These bedarf der niihren Erliiuterung.\Veil Husseri diese
These von dem @2sen der E@hrung ausgehend aufstellt, mbchten wir (A.) vorbereitend
den Erfahrungsbegriff bei Husserl kurz studieren und anschlieBend (B.) das Phiinomen der
welt und seine phiinomenologische Auslegung ausflihren.
(A. Jeder Erfahrung liegt Form der Welt zugrunde.) Indem das transzendente Ding
(z. B. ein Haus) uns erscheint, verweist seine anschauliche Erscheinung (z. B. die der Tiir
des Hauses) auf die andere (z. B. die des Fensters, das mir momentan nicht erscheint). An-
clefs gewendet, besteht, im Fall des transzendenten Dinges, die anschauliche Erscheinungnicht ganz selbststiindig an sich, sondem bezieht sich auf die eine andere nicht anschauli-
che. Weil, wie Fink treffend zusammenfasst, diese sozusagen <<inaddquate>> Erscheinungs-
weise nicht ais Mangel, sondem vielmehr als die origindre und ursprhngliche Gegeben-
heitsweise des Dinges, in der das Ding iiberhaupt nur begegnen, e@hren werden kann, zu
begreifen tst,69 legt Husserls Phsinomenologie diesephdnomenale Ilztsache der K?rweisung
einer aktuell gegebenen Erscheinung auf eine andere zumeist nicht-aktuelle, die jedoch
irgendwann anschaulich gegeben'werden kbnnte, als die Grundstruktur der intentionalen
EJ=/2zhrung aus. Oder anders: die intentionale E@hrung ist die intentional motivierte Be-
wegung zur Anschaulichkeit. (1.) Diese intentional motivierte H?rweisung liisst sich nicht
allseitig bzw. vollstdndig er hllen, sondem ist immer einer m6glichen Tduschung ausge-
setzt. Wenn die Dingerfahrung (Erfahrung des dem Bewusstsein Transzendenten) notwen-
dig die M6glichkeit der Tduschung mit einschlieBt, gilt der folgende Satz Husserls mit der
gleichen Notwendigkeit: (2.) <<Ist eine Erfahrung unvollkommen, die den an sich seienden
Gegenstand nur einseitig, nur in einer Femperspektive und dgl. zur Erscheinung bringt,so ist es die Erfahrung selbst als allege jeweilige BewuBtseinsweise, die auf die Befragungmir das sagt, die mir also sagt, hier ist etwas als es selbst bewuBt, aber es ist mehr; als was
wirklich selbst eC/@/1t ist, es ist noch von demselben anderes zu ec/Zlhren)>70 - Dies ist
die Mehr-Struktur der intentionalen F2rweisung. (3.) Weil jeder intentionalen Verweisungdiese Mehr-Struktur zugrunde liegt, zieht jeder intentional verweisende Akt die anderen
notwendig mit sich: der einzelne intentionale Akt ist ohne den anderen nur ein abstraktes
Moment. Die intentionale Verweisung macht daher die wechselseitige Durchdringung der
Akte notwendig, die aber selber kein Aggregat, sondern der in sich intentional motivierte
Zusammenhang ist: dies kbnnen wir Husserl folgend als Horizontstruktur der intentional
motivierten F2rweisung bezeichnen. (4.) Weil dabei der Horizont der intentionalen Ver-
weisung von ihrer Mehr-Struktur her verstanden wird, muss eine Ganzheit als Grenz-Idee
des Mehr angenommen werden. Die Tatsache der einzelnen mtentionalen Verweisung
68 H ier m6chten wir an einen von Dorion Cairns kurz und pragnant wiedergegebenen Ansatz Husserls er-
innern, dem zufolge: <<Being is always and only given as correlate of a horizon; it is never self-given in
ongmality>> (Cairns D. Conversations w:th Husserl and Frnk. S. 97). VgL auch: Bernet R. La vie du styet:
Recherches sur l 'interprdtation de Husserl dons la phcinominologie. Paris: PUF, 1994. S. 98 ff.
69 Fink E. Einleitung rn die Philosophic, Schwarz F-A (Hg.). worzburg, 1985. S. 24.
70 H u a X V I I . S . 2 4 0 , h e r v o r h e b u n g v o n V f s .
setzt ideell das vollstdndige, aber notwendig *ne System in seiner Ganzheit voraus. (5.)目ierbei dHrfen wir nicht vergessen, class mit dem mtentlonalen F2rweisungssystem nicht
cine bloB logisch-hypothetische Konstruktion gemeint ist, sondern class dieses System der
intentional motivierten K?rweisungen selbst immer schon arf/~ die Wirklichkeit verweisen
muss, wiihrend in den Traditionen des Kantianismus und Emptrjsmus die Sinnlichkeit (oder
der Sinneseindruck) gegeniiber dem System des (<Verstands>> oder des (<understanding>>
in manchem Fall die Rolle einer Instanz bzw. cines I}'ibunals der Empiric einnimmt. '71
Die Irwiesenheit a@die Wirklichkeit geht notwendigjeder mbglichen E*!hrung voraus,wenn sie sich als wirklich herausstellen kann.72 (6-) Dabei lest Husserl diese Verwiesenheit
auf die Wirklichkeit als Wbltglaube der transzendentalen Sul!jektivitdt oder <<Generalthe-
sis der nathrlichen Einstellung>>7;3 aus, well, wie ausgefhhrt> das, was iiberhaut sein kann,nur in seiner intentionalen Korrelation und Relativitdt Rir die transzendentale Subjektivi-
tEit ph!inomenologisch erklLirbar ist und dieser Korrelation die oben genannte <<Form der
welt>> notwendig zugrunde liegt. Das intentionale Verweisungssystem kennzeichnet Hus-
serl darum - sofem es auf die\Virklichkeit verweist - als << Urphdnomen des intentio-
nalen Lebens>>, das seinerseits als <<Evidenz>> bezeichnet wird.74 Und <<Evidenz iiberhaupt,kbnnen w!r sagen, ist Er/izhrung in einem weitesten, und doch wesensmEil3ig einheitlichen
75 Wenn sich eine Antizipation= welche flir das die Wirklichkeit bewiihrende inten-
tionale Erfahrungsleben - das Leben der Welterfahrung - eine konstitutive Rolle spielte,in seinem Verlauf plbtzlich faisch, unrecht oder nichtig zqigt, soll ein Ausweg gefunden
werden k6nnen, damit das die Wirklichkeit bewiihrende Verweisungsystem als solches, die
Einstimmigkeit der .Ej=/2zhrung, nicht zusammenbricht.76 Die intentional erfahrende Subjek-
tivitiit strebt nach der anschaulichen Wirklichkeit und liegt dieser sozusagen teleologischen
Bewegung die <<Form der Welt>> zugrunde. Denn derjbrmale und dennoch nicht rein logi-
sche Spielraum der Erfahrung muss vorgezeichnet sein, wenn der Prozess der Konstitution,ideell gesprochen, unendlich jbrtgesetzt werden, und wenn, um Finks Worte zu benutzen,eine potentiell-;unendliche <<.Jteration>>77 stattfinden kdnnen soll; so zeigt sich die <<Form
der @2lt)> als potentiell-mdglicher Spielraum der E@hrung. Daher scheint uns das, was
Husserl << Form der Welt>> nennt, die Form der Wirklichkeit zu sein. "Nun gilt es aufzuzeigen,wie Husserl die Wlt als Form der Wirklichkeit in ihrer E@hrbarkeit beschreibt.
7l Siehe hierzu: Mc Dowel! J. H. Mind and V'brld. Wth a new introduction bv the aulhor. Cambridge: HarvardUniversity Press, 1996.
72 So l5Bt sich Husserls Gedanke der << intentionalen Verweisung>> deutiich von Kants stark aprioristischemAnsatz unterscheiden. der ganzen << Dialektik der reinen Vernunfi:>> zugrunde liegt: << Wenn das Bedingte
gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben>> (KrV., A 497/B525).73 Hua 111/1. S. 61.
74 Hua 1. S. 92.
75 lbid. S. 93, hervorhebung von Vfs.
76 Hier mbchten wir uns an Husserls Analyse des Ph5nomens der <<Enttauschung>> erinnern. Vgl. Hua XIX/2.S. 574 ff., Hua XI. S. 28 ff. und Husserl E. E/=/2zhrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie derLogik. Hamburg: Claasen Verl., 1964. S. 99 f.
77 << Die phdnomenologische Auffassung der Weltganzheit ist bei l-lusserl abgedrdngt auf das Phdnomen derIteration, "der Grenzenlosigkeit im Fortgang der Anschauung", der potentlellen Unendlichkeit>> (EFGA
3/2, S.l6, Z-Vll, X/la).
76 Y . I k e d a Horizon 3 (:1) :zo:t4 77
(B. Erfahrbarkeit der Welt) (1.) Wir miissen zuv6rderst unsere Methode der Beschrei-
bung rechtfertigen. In der phiinomenologisch spezifischen Analyse der Welt bei Husserl
muB die Idee des .Etwas hberhaut (bzw. die des Objekts iiberhaupt) notwendig den <<tran-
szendentalen Lei(/izden>> bilden. Diese These liisst sich leicht verstiindlich machen, wenn
wir uns an Husserls Analyse der <<Sonderwelten>> erinnem. Denn cine spezifische <<Son-
derwelt>> liisst sich bei Husserl phiinomenologisch beschreiben, indem ein <<Erfahrungsty-
pus>> clef Gegenst5ndlichkeit (z. B. cines Kulturdings), die wesensm!il3ig einer bestimm-
ten Sonderwelt (z. B. zu einer bestimmten Kulturwelt) zugesprochen werden muss, zum(<transzendentalen Lei(/hden>> wird78 und der Phiinomenologe dann die spezifische <<Gege-
benheitsweise>> (oder Erscheinungsweise) dieses <<Leitfadens>> intentional analysiert. Die
Gegebenheitsweise der Welt gilt Jdeen J als Generalthesis; die der geistigen @2lt wird in
<<Ideen II>> hinsichtlich der personalistischen Einstellung, und die der ol!jektiven @2lt in
derjiiq/len Cartesianischen Meditation im Hinblick auf die Jntersul!jektivitdt intentional
zergliedert, wobei das fiirjede Thematik typische Seiende zum transzendentalen Leitfaden
wird: dabei wird die @Wt in ihrer <'<Form)> (<<Ideen I>>), unter dem Blickwinkel der Person
(<<ldeen II>>), und nicht zuletzt unter dem des Anderen (VCA/) zum transzendentalen Leit-
faden. Dadurch zeichnet sich within auch ab, class Husserls Phiinomenologie, wenn sie sy-
stematisch ausgelegt wird, -weder von weltloser; nock soljpsistischer Natur ist. (2.) Femer
miissen wir das Sein des zu beschreibenden Gegenstands, d.h. der Welt bestimmen. Dem
Sein der @blt k6nnen wir mit Rudolf Bemet gewissermaBen einen transzendentalen @2rt'79
zusprechen, well die Welt als Ibtum flir die logisch-:/brmale Fbrzeichnung des Etwas (d. h.
als Kon!positum der Welt) insofem biirgt,80 als man das nicht zur Welt geh6rige Seiende
notwendig als sinnlos ansehen muss. Der transzendentale @i?rt der W?lt besteht demnach
in ihrer logisch-:/brmal vorzeichnenden Funktion, in der Wiise des Gehbrens von allem
mbglichen Seienden zur f@lt (Die Welt als Fbrzeichnen-K6nnen des Etwas).81 S<) k6nnen
wir das Sein der Welt als das regulative Fbrzeichnen des Etwas charakterisieren. In diesem
Sinne ist die Welt vom Wisen des Etwas her auszulegen, sodass aus diesem in Husserls
phEinomenologischer Analyse der Welterfahrung zum <<transzendentalen Leitfaden>> wird.82
Bekanntlich hat schon Kant diese regulative Funktion der\Velt in voller KIarheit einsichtig
gemacht, doch sucht Husserl sie phiinomenologisch auf ihre EC/izhrbarkeit zurtickfiihren,
78 H u a X X X I X . S . 7 1 .
79 <<.. . c'est l 'exp6rience du su jet qui constitue le monde. La r6alit6 possible de ce monde constitu6 ne doitcependant pas 8tre confondue avec l'2tre dune "res", c'est-A-dire dune chose singuli6re, l'2tre du mondeest PBtre de toute chose possible. Si l'8tre du monde possible transcende ainsi la possibilitE des choses
particuli6re, cela veut dire en toute logique que l'8tre du monde a valeur transcendantale. Ainsi, Ie monde
prdpare et accueille ia venue clans l'2tre et la manifestation des choses, mais ce don et cette mission dumonde lui ont 6td confiir6s par l'ego transcendantale>> (Bernet R. La vie du styet. S. 100).
80 Wenn von einer << Sonderwelt>> die Rede ist, wird ihr die transzendentale Funktion der speziIischen Vorzei-
chung des betreITenden Typus des Seienden zugesprochen.
81 <<Jeder ist KOrper in einem einheitlichen Zusammenhang, der der Welt ist>> (I-Iusserl E. E/=/2zhrung undUrteil. S. 156). Daher schreibt HusserI: <<Sie [die Welt] ist das All-Seiende, nicht "in etwas", sondem All-
etwas>> (lbid. S. 157). Vgl. auch. Hua Vl. S. 146 f.
82 Bspw. kennzeichnet Husserl die Welt als <<absolutes Substrat>> (l-lusserl E. E/=/2zhrung und Urteil. S. 156 f.).
wiihrend die Welt bei Kant nicht erfahrbar ist, well sie nur <<in unseren Gedanken>> gegeben
werden kann. Husserls Ansatz lautet: die Wit ist e/=/2zhrbar als der regulativ vorzeich-
nende Universalhorizont des Etwas. (3.) Die phiinomenologische Gegebenheitsweise des
oben genannten <<Vorzeichnen-K6nnens>> ist laut Husserl sowohl <<Vorgegebenheit>> bzw.
<<Anonymitat>> als auch <<Potentialitiit>>. Das Kdnnen der Welt ist <(vorgegeben>>, well alle
mbgliche Erfahrung dies Kbnnen, das die intentional-vorzeichnende Boden/i/nktion der
Erfahrung konstituiert,83 voraussetzt, well also dieses inner auf anonyme Weise notwen-
dig vorgegeben ist,84 wenn Er/izhrung statthat. Daher jimgiert, wie oben angerissen, das
Phdnomen der @2lt= deren Essenz wir mit Husserf in ihrem Horizont-Charakter beschlos-
sen sehen, als das in sich transzendentale Phdnomen, dasjede E@hrung ermbglicht. Auf
dieser Grundlage liisst sich die Gegebenheitsweise der\Velt als potentiell kennzeichnen,
well die Welt uns niemals in infer vollen Aktualitdt gegeben werden kann, auch wenn sie,
ideell gesprochen, immerfort aktualisiert werden soil.85 I=)as Ph!inomen der Welt liisst sich
also mit dem W2chselspiel der Aktualitdt und.Potentialitdt, dessen Wesen als das unendli-
che Streben der transzendentalen Sul!jektivitdt nach der Anschaulichkeit bestimmt werden
kann, gleichsetzen. Im Zentrum alleges Wechselspiels steht alarum notwendig die Subjekti-
vitEit, well das Zentrum der Aktualitiit, d. h. der Anschaulichkeit nichts anderes als eben sie
sein kann. (4.) Hierbei l!isst sich dieses\Vechselspiei, phiinomenologisch gesehen, gdnzlich
im dementsprechenden intentionalen H?rweisungssystem aufl6sen. Es orientjert sich nicht
nur jeder thematisch-intentionaler Akt anhand der Anschaulichkeit, sondem das intentio-
nale Verweisungsystem im Ganzen. Dieser Tendenz obliegen @leichermaBen die <<aktive
Synthesis>>, wie auch die <<passive>>: ihr Gesetz nennt Husserl Assoziation, die selberjenes
<<Bewusstsein.!jild>> ist, ohne welches <<keine ~'@H!lt'' da sein [kbnnte]>>.86 (5-) Femerhin
gilt es nun, die anonyme Gegebenheitsweise des intentionalen Verweisungsystems n5her
zu charakterisieren. Im Allgemeinen sucht Husserls Phiinomenologie die anonyme oder
potentielle Vorgegebenheit auf ihre notwendige Relativitiit Rir das habituell gewordene
F2rmdgen der transzendentalen Subjektivitht zuriickzuRihren, deren St@ung intentional-
analytisch aufgewiesen werden muss.87 penn der Habitus weist zuriick auf seine zumeistverborgen bleibende Genese, durch die er entstanden ist, sodass das (<habituelle Verm6-
gen>> nichts anderes als das Kbnnen besagt, das von der Subjektivit5t erworben wurde:
Habitualitdt birgt notwendigerweise ihre Entstehungsgeschichte in sich, und ebenso die
vorgegebene Welt. Dementsprechend miissen wir sagen, class jede Erfahrung nicht von
<<direktem>> anschaulichen Charakter ist, sondern vielmehr immer von ihrem habituell
83 Fink nennt diese Bodenfunktion der Welt treffend <</\lternationshorizont von Sein und Schein>> (FIua Dok
II/2. S. 9 l ). Vgl. auch. Landgrebe L. Der fH?g der Phdnomenolog:e. Glltersloh, 1963. S. 54.
84 Vgl. Bernet R. La vie du su jet. S. 103.
85 Unter diesem <<Soll>> verstehen wir nichts anderes als <<das Soll der V@ltkonst/tutzon>>. Vgl. Schuhmann K.
Die Fundamentalbetrachtung der Phanomenologie. S. l 82 tT.
86 Hua X. S. 406: <<Die Einheit des BewuBtseinsfeldes ist immer hergestellt durch sinnliche Zusammenh5nge,
sinnliche Ahnlichkeitsverbindung und sinnlichen Konstrast. Ohne das k6nnte keine -'Welt" da sein>>.
87 VgL Hua [. S. 62,109 f. Hua Vlll. S. 150 f., Hua XVIII. S. 215 f. usf.
78 Y . I k e d a Horizon 3 (:t) :zo14- 79
rgewordenen Horizont vermittelt und nur dadurch ermbglicht wird.8S Daher soil die pha-
nomenologische Analyse der Gegebenheitsweise der %lt deren genetischer A y/iveisung,
A@veisung der Entstehung der @2ltapperzeption dienen.89 Im Zentrum dieser phdnome-
nologischen Aufgabe steht dabei die Frage, aus welchenphdnomenologisch zuldssigen %-
sensgesetzen die f@ltapperzeption ableitbar ist. Denn die Riickfrage nach der Entstehungder Weltapperzeption fordert bei Husserl nicht, class man ihre empirische Genese aufweise,
sondern die <<unter @2sensgesetzen stehende Genesis>>.90 Zusammengefasst: das oben ge-
nannte habituelle KOnnen ist uns zwar - als Menschen - vorgegeben, doch betrachtet der
Phdnomenologe dieses als Wiltapperzeption, die von der transzendentalen Sul!jektivitdt
konstituiert wird (oder erworben wurde), da, wenn, wie gesehen, die Welt als <<Einheiten
des Sinnes>> (bzw. Sinngebilde) analysiert wird, diese Einheiten von sich aus notwendig auf
die sie apperzeptiv-konstituierenden Subjektivitdt verweisen, die, wie wir oben kurz ange-
deutet haben, keineswegs von soiipsistischer, sondern intersubjektiver Natur ist. So ist uns
nun verstindlich, class das, was Husserl im folgenden Zitat ausdriicken will, nichts anderes
als die fundamentale Einsicht seiner genetischen Phdnomenologie ist:
<<Alle mtentionale Einheiten sind aus einer intentionalen Genesis, sind "konstituierte"
Einheiten, und iiberall kann man di6 '~fertigen" Einheiten nach infer Konstitution, nach infer
gesamten Genesis befragen und zwar nach deren eidetisch zu fassender Wesensform. Diese
fundamentale Tatsache, in ihrer Universalit!it das gesamte intentionale Leben umspannend,ist es, die den eigentlichen Sinn der intentionalen Analyse bestimmt als Enthiillung der
mtentionalen Implikationen, mit denen, gegeniiber dem oIfen fertigen Sinn der Einheiten,ihre verborgenen Sinnesmomente und "kausalen" Sinnesbeziehungen hervortreten>>.9]
Die\Veltapperzeption, die die mannigfaltigen <<intentionalen Implikationen>> mit sich
fbhrt, ist nichts anderes als das uns vorgegebene Grundph5nomen der nathrlichen Einstel-
lung, in der wir vom Seienden 0berhaupt erst sinnvoll sprechen k6nnen.
Das hier dargelegte Konzept Husserls halten wir fiir einen hervorragenden Beleg dafiir,
class die transzendentale Phiinomenologie den ihr zugrundliegenden Erfahrungsbegriff;, im
88 Antonio Aguirre formuliert den Sachverhalt wie folgt: <<Im.]eweiligen Vollzug der Erfahrung (iberspringe ich
das Selbstgegebene auf seinen fforizont hin, und das heiBtjetzt: auf den Horizont des Erworbenen hin. Das
Erworbene aber ist das, was sich im Verlaufe aller meiner Erfahrungen als fester Besitz niedergeschlagen
hat, es ist Widerspiegelung meines gesamten intentionalen Lebens als eines Geschehens der Erthhrung, es ist
Widerspiegelung meiner eigenen Geschrchte. Das Erworbene ist Geschichte, ist J}-adition>> (Aguirre A. Ge-
netische Phanomenologie und Reduktion. Zur Letztbegrundung der Wissenschaji aus der Radikalen Skepszs
im Denken E. Husserls. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1970. S. 156, hervorhebung von A. Aguirre).
89 Dabei steht die folgende Frage im Vordergrund: << Wie -~entspringt", "erwlichst" Erfahrung, wie voilkomme-
ne Erfahrung von einem Ding, von einem Selbst, von einem anderen Selbst (ti-emdes Sub jekt)?>> (I-lua XIIL
S. 351). Jedoch k6nnen wir den Keim alleges Ansatzes schon in einer fr0heren Epoche des Denken Husserls
ausfindig machen: << Den Ursprung der Dingvorstellung aufweisen, das heiBt nicht, zeigen, durch welche
psychologischen oder psychichen '~Konstruktionen" dergleichen entsteht (wir stehen in keiner Psycholo-
gie), sondern die '-Geschichte'~ der Dingvorstellung aufweisen. d. h. die Stufenreihe teleologisch aufeinan-
der gebauter Akte nachweisen ...>> (I-lua XXXVI. S. 13 (1908))-
90 Diese << Wesensgesetze>> Verstehen sich bei Husserl, formal gesagt. erstens als <<die Zeit als Universalform
aller egologischen Genesis>> (I-lua 1. S. 109), zweitens als <<Assoziation als Prinzip der passiven Genesis>>
(lbid. S. 113).
91 H u a X V I I . S . 2 1 6 .
Gegensatz zu etwa dem Kantianismus, grundlegend reformuliert hat. WLihrend nEimlich im
Kantianismus von keiner Er/2zhrung der f@lt die Rede sein kann, zeichnet sich Husserls
Phiinomenologie gerade als Analyse der Welterfahrung aus, obgleich die Seinsweise der
mlt, wenn man dies mlt emem Wort zusammenfassen kann, bei beiden in ihrer regulativen
Funktion zu liegen scheint. Somit liegt, kbnnen wir zusammenfassen, der philosophische
Beitrag flusserls im Zusammenhang unserer Frage - im Vergleich mit Kant oder dem
Kantianismus - prinzipiell in einem neuen erkenntnistheoretischen, ausschlieBlich phii-
nomenologisch erschlieBbarem Ansatz einer thematischen .Erneuerung des E@hrungsbe-
gr@i, welche ihrerseits auf Umschliige in der ontologisch-kosmologischen H?J=/2zssung zu-
riickverweist (deren Musterbeispiel wir in Husserls Bestimmung der @2lt als derphdnome-
nologisch ec/2zhrbaren Fbrgegebenheit und ihres Horizon's identifizieren kbnnen), die aber
mithin noch ausdriickiich ausgefhhrt werden miissen - wodurch sich die Phiinomenolo-
gie als ein unendliches ,Programm der Arbeitsphilosophie interpretieren liisst. Vordeutend
kbnnen wir sagen, class derjunge Fink die angeRihrten phiinomenoiogischen Ansetzungen
Husserls entwickelt und vertieR, um mit ihnen aber einen neuen Weg zu beschreiten.
2 . F I N K S B E S T I M M U N G D E S T R A N S Z E N D E N T A L E N S C H E I N S U N D S E I N E R O L L E
Die Texte, in denen Fink ausdriicklich den Begriff des (<transzendentalen Scheins>> be-
nutzt, sind, wie schon angedeutet, die VJ; CM und der Schlussteil des Kantstudien-Au/iat-
zes. Hier client uns besonders der letzte Text als Leitfaden,: weil jF ink dort versucht, Hus-
serls transzendentale Phiinomenologie von der transzendentalen Philosophie Kantischer
Pr!igung ausdrhcklich zu unterscheiden, wobei er jedoch bestrebt ist, wje m V]; CM; sein
eigenes transzendental-phiinomenologisches Konzept implizit von demjemgen Husserl ab-
zuheben.
Der Kantstudien-Az@atz zielt darauf ab, auf die <<Einwendungen des durch Rickert und
seine Schule vertretenen Kritizismus>> an I-lusserls Phdnomenologie in der (< Formulierun-
gen von Zocher und Kraus>>92 zu antworten und sie vom Standpunkt der transzendentalen
PhEinomenologie aus zu widerlegen.93 Anders gesagt, bekiimpR Fink in Kantstudien-Atf/l
satz ausdrticklich die Kritiken, die Zocher und Klaus an Husserl adressieren, und gedenkt
gegen diese ein allgemeines Schema vorzuschlagen, durch welches sich der philosophische
Standpunkt der transzendentalen Ph5nomenologie Husserls klar und griindlich demjen!gen
der (<kritizistischen>> transzendentalen Philosophie entgegenstellen liisst.
Fink gliedert die Kritiken des <<Kritizismus>> in drei Hauptmomente: (1.) Es geht in der
ersten kritizistischen Kritik alarum, class die Phiinomenologie Husserls die kritizistische
<<Geltungsform>>, die selbst als <<Bedingung der M6glichkeit der Geltung>> der <(ontischen
Erkenntnis>> vorausgehen miisse, philosophisch nicht thematisiert. Deswegen geriit Hus-
serls Philosophie dem <<Kritizismus>> zufolge m emen naiven <<Ontologismus>>. (2.) Ferner
92 Fink E. Kantstudien-Az@atz. S. 79.
93 Vgl. Zocher R. Husserls P/zdnomenologie und Schuppes Logik. Ein Be:trag zur Kritik des intuitionistischen
Ontologismus m der /mmanenzidee. MOnchen, 1932; und Kreis F. Phdnomenologie und Kritizismus. Tii-
b i n g e n : M o h r , 1 9 3 0 .
80 Y . I k e d a Horizon 3 (1) :zo14 81
fji'
stellt der <<Kritizismus>> die kritische These auf, der zufolge Husserls <<Ontologjsmus>> etneArt <<clogmatisch>> angenommenen (<Intuitionismus>> (der <<Kritizismus>> kritisiert HusserlsAnsatz von (<Wesensschau>> usf.) voraussetzt. (3.) Die letzte Kritik besagt, class die soge-
nannte (<transzendentale Wendung>> Husserls in Jdeen 1, die zwar in den Augen der Kritikerselbst nichts anderes als AnnEihrung an Kant]amsmus zu sem scheint, den tiefen Sinn bzw.den entscheidenden Beitrag des <<transzendentalen Ideaiismus>> Kants verkennt. Daher seiHusserls Konzept des sogenannten <<transzendentalen Idealismus>> mit dem kritizistischenVerstiindnis desselben nicht v6llig vertrdglich; er sei, kurz gesagt, flir den Kritizismus nochnaiv, dogmatisch und nicht zukissig.94
Fink beschriinkt sich bei seiner Widerlegung dieser Kritik nicht darauf, auf Einzelpun-
ke einzugehen um die Vorteile des phdnomenologischen Ansatzes gegentiber dem <<Kriti-
zismus>> hervorzuheben, sondern er versucht anhand einer positiven Reformulierung des
philosophischen Konzepts Husserls zu demonstrieren, class die kritizistischen Kritiken dietranszendentale Phiinomenologie Husserlscher Priigung prinzipiell und vom Anfang an
missverstehen. Kurz gesagt, ist nach Fink das kritizistische Verst!indnis der Phiinomenolo-
gie einem <<Schein>> zum Opfer gefallen.95 Well Fink den Grund dieses <<Scheins>> nicht in
der bloBen Unachtsamkeit Zochejs oder Klaus% verortet, sondern, wte wir sehen werden,in den philosophisch notwendigen Umstiinden (wenn dies vorwegzunehmen erlaubt ist:im <<Dogmatismus der nathrlichen Einstellung>>)97, kann es sich dabei um keinen <<emplri-
schen>>) sondern es muss sich um einen (<transzendentalen>> Schein handeln. Fink Rihrt dartdrei Typen des <<transzendentalen Scheins>> an, die uns weder mit Kants, noch mit Husserls
Gebrauch des Terminus deckungsgleich zu sein scheinen. Fink versteht unter dem (<tran-
szeudentalen Schein>> (i.) das Problem des Ausdruckes und der Mitteilung, (ii.) dasjentgedes phiinomenologischen Satzes als des Ergebnisses der phiinomenologischen Forschungund (ill.) die schwierige Problematik der <<logischen Paradoxie der transzendentalen
DcAnition>〉.98 Fink fasst diese drei Probleme in VI CMiibergreifend unter dem allgemeinenTitel der <<transzendentalen Sprache>) zusammen.99.Jedenfalls sehen wir an dieser Stelleschon deutlich, class Fink mit dem transzendentalen Scheinbegriff primdr, ganz anders alsHusserl, weder eine (<phiiosophische Verabsolutierung der Welt>) noch den ((transzenden-
talen Psychologismus>> widerlegen will. Denn es geht Fink vielmehr darum, sich mit dem
Kritizismus auseinanderzusetzen, der selbst zumindest nicht als typischer Vertreter der dasAll der Realit5.t verabsolutierenden Philosophie (wie es etwa ein philosophisch naiver Na-
turaiismus oder Positivismus t!ite) oder des transzendentalen Psychologismus gelten kann.Um unsererseits allege <<Distanz)) zwischen F ink und Husserl niiher zu bestimmen, m6chtenwir zuvbrderst den Grund auszeigen:, warum Fink die <<kritizistischen>> Kritik an der Ph5-
nomenologie als bloBen (jedoch transzendentalen) <<Schein)> beurteilt.
94 V g l . l b i d . S . 8 2 f f .
95 V g i . I b i d . S . 9 4 , 9 9 .
96 V g L I b i d . S . 9 4 .
97 Fink E. VI. CM. S. 3,102 usf.
98 Vgl. Fink E. Kantstudien-A@atz. S. 153 ff.
99 V g l . F i n k E . V / . C M . S . 8 6 I f .
Nach Fink besteht der wichtigste Grund hiervon darin., class der Kritizismus den phiino-
menologischen Unterschied zwischen der <<transzendentalen (bzw. ph5nomenologischen)>>
und der ((nattirlichen Einstellung>> v61Iig 0bersieht und damit seinen philosophischen Sinn
verkennt. Damit macht F ink uns daraufaufmerksam, class der Unterschied zwischen diesen
zwei Einstellungen die notwendige Bedingung der Mbglichkeit einer phdnomenologischen,
transzendentalen Philosophic ausmacht. Diese DiIferenz nicht zu erkennen heiBt, noch in
der natijrlichen Einstellung b@mgen zu sein, und demgemiiB sieht Fink den Grund der
<<scheinbaren>> kritizistischen Kritiken an Husserl in dieser B@ngenheit. Mit einem Wort,
ist in Finks Augen der Kritizismus in der nattirlichen Einstellung b@mgen. Dieses vag und
gewaltsam anmutendes Argument konkretisiert Fink mit einer Kontrastierung der beiden
Philosophien auf einer anderen Ebene: so bildet Rir den <<Kritizismus>> <(empirisch>> den
Gegenbegriff zu <<transzendental>>, Wiihrend er Rir die Ph5nomenologie <<mundan>> hei13t.
Im A llgemeinen besagt das\Vort <<empirisch>> eine spezifische @i?ise der Gegebenheit
der Gegenstdnde - oder Kantisch gesprochen, eine <<.Erkenntnisart>>, die sich mit einem
<<Erkenntnis, das durch Mhrnehmungen ein Ol!jekt bestimmt>>,100 gleichsetzen liiBt: das
Resultat dieser Wahmemung kbnnen wir, wenn es statthaft ist, Empirie benennen und es
wissenschafllich aufnehmen. Solange der <<Kritizismus>> miit dem Gegenbegriff zu <<tran-
szendental>> ciiese spezifische Erkenntnisart (d. h. die der Empirie) meint, kbnnten wir vor-
kiufig rein formal das, was unter <<transzendental>> verstanden werden soll, als das von
der Empirie unabhiingig Erkannte verstehen. Dann k6nnte.man, mit einem Rekurs auf die
Geschichte der philosophischen Terminologie, etwas, das von dbr Empfrie unabhiingig zu
erkennen ist, mit dem Essenziellen oder Formalen (im Sinne der <<forma>> oder des <<Ei-
dos>>), deren Rechtfertigung auf gar keine empirische Erkenntnis oder Empirie zuriickge-
mhrt werden darf, gleichsetzen. [lbrigens ist es als einer der einflussreichsten Kantischen
Beitriige zur Philosophie zu werten, den traditionellen Begriff <<forma (bzw. Eidos)>> in ei-
nem neuen Sinn - sozusagen <<kopernikanisch>> - bestimmt zu haben. Hiemach versteht
der <<Kritizismus>> unter dem FormbegriIf das, was man zu den sogenannten (<Bedingungen
der Mdglichkeit der E@hrung (damit zugleich diejenigen der Mbglichkeit der Gegenstdn-
de der E@hrung)>> rechnen muss, und daher zu <<unserer Erkenntnisart>>, sofern sie apriori
mbglich sein und zugleich notwendig gelten soll, wiihrend mit dem traditionellen Begriff
<<forma>> das @2sen, das selbst dem betreffenden, von der Erfahrunhg unabhiingig beste-
henden Gegenstand schlechtlich zugeschrieben wird, gemeint ist. So versteht der (<Krit-
zismus>>, bemerkt Fink, unter dem Titel <<transzendental>> etwas ((Formales>>, das zwar von
den faktischen (empirischen) Inhalte oder Materien abstrahiert gedanklich rekonstruierbar
ist, das aber unsere Erfahrung und daher die Gegenstiinde der Erfahrung selbstjbrmal erst
mdglich machen soll.101 I=)ieser sogenannte <$/brmalistische>> Standpunkt spricht offensicht-
Iich gegen den phiinomenologischen, da sowohl Husserl als auch Fink eine wesentliche
<<Ausweitung des Begriffs der Anschauung>>102 beRirworten.
ioo KrV. B218, hervorhebung von 1. Kant.
101 Vgl. Fink E. Kantstudien-Az(/iatz. S. IOO
1 0 2 l b i d . S . 8 2 .
82 Y . I k e d a Horizon :3 (1) ;201zj. 83
In unscrew Zusammenhang gilt es nun die triviale wirkende Tatsache zu beachten,class dieser sogenannte << Formal ismus>> Kantischer Prligung nicht von einer M6glichkeit
der Erkenntnis der Gegenst5nde ausgeht, die niemals in der E@hrung gegeben werden
kann. Well der <<K.ritizismus>> unter dem Begriff der EC/2zhrung (ontische Erkenntnis, in
Zochers Terminologie) tats5chlich Empiric versteht, schlieBt er die sog. <<metaphysischen>>
Probleme der <<\Velt>> (als Gegenstand der metaphysica specialis verstanden), insbesondere
dasjenige ihres <<Grundes>> oder infer <<Ursache>> (z. B. <<Gott>>), aus dem rein philosophi-
schen Bereich aus.103 Insofern der <<Kritizismus>> die <<Welt>> als philosophisches Thema
abweist und sich nur damit beschiifligt, die <<ontischen (oder empirischen) Erkenntnisse>>,die selber, phdnomenal gesagt, nur in der W2lt gegeben sein k6nnen, durch die sog. <<Gel-
tungform>> erkenntnistheoretisch zu rechtfertigen, charakterisiert Fink den philosophischen
Standpunkt des <<Kritizismus>> ais <<weltimmanent>>.104 per <<Kritizismus>>:, sagt Fink:, <<kann
aber auch so welt gehen, die M6glichkeit einer Welterkenntnis im Hinblick aufeinen "tran-
szendenten" Weltgrund iiberhaupt zu bestreiten und das Problem der Philosophic auf cine
weltimmanente Erkenntnis des Seienden abzustellen: sei es in der naiv positivistischen
Form der Fixiertheit auf Seiendes oder in der\1Veise cines Riickgangs in die apriorischen
Voraussetzungen des Seienden>>.1"O5 \)Veiterhin bestimmt Fink den Gegenbegriff zu <<tran-
szendentai>> in der Phiinomenologie terminologisch als <<mundan>>, welcher Begriff sich
hier mit dem oben genannten Ausdruck <(weltimmanent>> gleichsetzen Idl3t. So versteht
Fink unter dem Titel des <<K.ritizismus>> Jenen philosophischen Standpunkt, der, indem er
die Frage nach der <<welttranszendenten>> Erkenntnis (hinsichtlich des Bezugs der Welt
als solcher zu ihrem Grund) vom Bereich der Philosophie methodisch ausschlieBt, seine
eigene Aufgabe streng darauf beschriinkt, die <<weltimmanenten>> Gegenstdnde durch ihre
<<Geltungsformen>> als <<Bedingungen der M6glichkeit der (empirischen) Erfahrung>> bzw.
(<ontischen Erkenntnis>> zu rechtfertigen. Dies miilndet in ein Verstiindnis der transzenden-
talen Philosophie als einerjbrmalistischen Erkenntnistheorie, die nicht nur die metaphy-
sica naturalis, sondern auch, anders als Kant, jeden metaphysischen f2rsuch als in sich
widersprHchlich abiehnt.106
Im krassen Gegenteil zum <<Kritizismus>> nennt Fink das die Ph!inomenoiogie bestim-
mende Grundproblem der <<Frage nach dem Ursprung der %lt>>,107 dje der <<Kritizismus>:>
deswegen kategorisch zuriickweisen will, weil ihm diese Frage wesentlich auf eine vor-
kantische oder dogmatische Weise gestellt zu sein scheint. Diese provokative FormulierungFinks muss den (<Kritizismus>> an das besondere Problem der (<kosmologischen Ideen>>
erinnern, und femer an die <<transzendentale Weltwissenschafll: (cosmologia rationalis)>>,i<)8
deren Durchfiihrung die <<reine VernunH:>> notwendig zu einem in vier Typen gegliederten
widerspruch mit sich selbst fiihrt, w!e Im beriihmten Antmomtenteil der Kr V gezeigt wird,well, genauer gesagt, die konstitutive Anwendung solcher Ideen ganz und gar die <<Schran-
ken der m6glichen Erfahrung (paler "Grenze aller Erfahrung'') iiberfliegen>> muss.109 fink
sagt dennoch: <<Die Welt im Rtickgang auf cine "I}'anszendenz '' erkennen, die sie gerade
wieder einbehdlt, bedeutet cine transzendentale Welterkenntnis realisieren>>.日o Hierbei will
Fink mit der (< Frage nach dem Ursprung der Welt>> keineswegs behaupten, class die Phii-
nomenologie cine neve auf dem sogenannten <<vor-kantischen Dogmatismus>> beruhende
Metaphysik sei. Im Gegenteil will Fink nachweisen, class die Phdnomenologie nicht nur
die Gegenstiinde der Erfahrung im Sinne der (wissenschaftlichen) Empiric, die in nur in
der ffi?lt gegeben werden kann, sondem auch die @Wt von ihrem << Ursprung)) her, der ihr
notwendig <<immanent>> sem muss, erklZiren muss k6nnen. Diese Aufgabe vollzieht sich
durch den <<(}bergang von der Welt zur transzendentalen Subjektivita>>.[11 Anders gesagt>soil <<das konstitutive Werden der Welt>>, sagt Fink, <<von dem Ursprung der transzendenta-
len Subjektivitlit her>> aufjedeckt werden, wobei Fink alleges <<konstitutive Werden>> selber
fiir das <<Absolute>> im phiinomenologischen Sinne hiilt.
Wir kbnnen nur dann behaupten, class die <<transzendentale Subjektivitiit>> flir die Welt
<<konstitutiv>> und <<transzendental>> fungiert= wenn wir Rir die transzendentale Phdnomeno-
logie cine Perspektive annehmen, in welcherjeder m6glichp Sinn und jedes mbgliche Sein
(inklusive Sinn und Sein der\Velt ! ) durch die Analyse des (<konstjtutiven Werdens der tran-
szendentalen Subjektivitiit>> aufgewiesen werden, und in der die <<Welt>> unter der Bedin-
gung, class man ihr ein <<konstitutives Werden>> zuspricht, phdnomenologisch thematisiert
werden kann. Dies nennt Fink <<das W?rden der Wit in der Konstitution der transzenden-
talen Sul!jektivitdt>>ll3 und erkliirt auf gedriingte Weise: <<Die\Velt bleibt dem "Absoluten"
immanent, vielmehr wird sie als im Absoluten liegende entdeckt>>.目4 U. E. liiBt es sich aber
wie folgt noch treffender ausdriicken:
<<Das konstitutive Werden ist aber nicht ein bloBes "attributives>' Geschehen der tran-
szendentalen Subjektivitit, als ob sie einmal zuerst wiire (gleichsam als Substanz) <.. >
Nicht cc(=ilieder== cler Korrelation> sondem die Korrelation ist das Frtihe. Nicht ist die tran-
szendentale Subjektivitiit hier und die Welt dort, und zwischen beiden spielt die konsti-
tutive Beziehung, sondern das %rden der Konstitution ist die Selbstverwirklichung der
konstituierenden Sui2jektivitdt in der /H?ltverwirklichung>>.115
1 0 3 V g l . I b i d . S . 1 0 1 .
1 0 4 l b i d . S . 1 0 0 f .
1 0 5 l b i d . S . 1 0 1 .
106 []ieses Urteil Finks betriffl nur den <<Kritizismus (Zochers und Klaus')>>, nicht Kant selbst. Denn, wieoben kurz angedeutet, halt Fink Kant nicht einfach filr einen erkenntnistheoretischer Formalist, sondem fHrden <<Metaphysiker, der den kosmologischen Horizont des Seins freilegte>> (siehe FuBnote 22). Vermutlichschien ftir Fink der <<K.ritizismus>> primiir eine degenericrte Form der Philosophie Kants zu sein.
1 0 7 I b i d . S . 1 0 2 .
1 0 8 K r V . A 3 3 4 / B 3 9 2 .
109 Vgl. lbid.A295 f./B351 ff., A327/B383 f., A42l/B448 f., A462/B490 usw
IIO Fink E. Kantstudien-Azc/iatz. S. 106, hervorhebung von Fink.
1 1 ! I b i d .
1 1 2 j b i d .
1 1 3 l b i d . S . 1 3 9 .
I !4 Ibid. S. 105, hervorhebung von Fink E.
I 15 Fink E. V/. CM. S. 49, hervorhebung von Vfs.
84 Y . I k e d a Horizon 3 (l) :zo]-4 85
Wie man sieht, teilt Fink zwarmit Husserl den Ansatz der transzendentalen Sul!jektivitat
uls des <(wahrhq/iigen Seinszugangs)),116 cloch scheint uns, class sich der Akzent verschiebt,
well Fink nicht nur Husserls These der notwendigen <<Korrelation in der Relativitdt der
mltjiir das erkennende Bewt(ptsein, das Rir sich selbst relativ ist>> anerkennt, sondern von
dem << FJ@rden>> einer solchen <<Korrelation>> (d. h. der (<Selbstverwirklichung der konstitu-
ierenden Sul!jektivitdt in der %ltverwirklichung>>) spricht. Wir werden welter unten auf die
delikate Frage der Ndhe und Distanz zwischen Fink und Husserl niiher eingehen.
Wir mtissen zuv6rderst unsere ursprtingliche Frage er6rtern, welche Rolle F inks Begriff
des <(transzendentalen Scheins>> zukommt, oder konkreter gesagt, weshalb man ohne Vo[I-
zug der <<transzendentalen Reduktion>> dem <<Schein>> zum Opfer faflen muss. Es ist uns
gleichsam liar geworden, class man die philosophische Erkennentnis der Phiinomenolo-
gie verfehlt, wenn man die transzendentale Subjektivitht als transzendentale Sul!jektivitdt,d. b. als wahrh@iger Seinszugang philosophisch nicht erkennt, wenn man also noch in der
natHrlichen Einstellung b@ngen ist. Hieraus resultlert, wie Im Falle des Kritizismus, der
<<transzendentale Schein>>, der die A usdrhcke und Mitteilungen der phjinomenologischen
Analyse ohne den fbllzug der phdnomenologischen Reduktion zu verstehen sucht. Wie wirwelter unten sehen werden, besteht der Grund hiervon letzten Endes in der eigentiimlichen
Seinsweise der transzendentalen Su4jektivitdt als solcher.
Wir kbnnen Finks Argumentationen wie foist zusammenfassen: (1.) <<Die phanomeno-
logische Reduktion setzt sich selbst voraus>>.117 I=)enn wenn man die <<ph5nomenologische
Reduktion>> nicht volizieht, kann man nicht vom Gegenstand der phdnomenologischen Re-
duktion (d. h. der transzendentalen Subjektivitiit) sprechen, well dieser in diesem Fall keine
dementsprechende, in sichphdnomenologische Anschauung, die die Wahrheit cines phdno-
menologischen Satzes erfiillt und rechtfertigt, generieren kann.118 Diese zugespitzte For-
mulierung bedarf selbstverstiindlich noch einer weiteren Erkllirung, da Finks These sonst
auf die Behauptung hinausliefe, class nur der Phiinomenologe die philosophische Wahrheit
zu erlangen vermag. (2.) Die Notwendigkeit des Satzes der <<Selbst-Voraussetzung der phii-
nomenologischen Reduktion>> setzt seinerseits die <<Andersartigkeit>> der Seinsweise der
transzendentalen Sul!jektivitdt im Hfrgleich mit dem <<mundanen)> Sein voraus. Das Sein
der transzendentalen Subjektivitiit liil3t sich weder mit dem des Menschen noch mit dem<(mundanen)) bz-w. <,<weltimmanenten)> Sein> von welchem man in der nathrlichen Einstel-
lung allezeit spricht, gleichsetzen. Wenn man dies ann5hme, briiuchte man allem Anschein
nach cine andersartige Ausdrucksweise, um die tranzendentale Subjektivit5t und ihre Er-
fahrung zu beschreiben.日9 Aber diese <<Andersartigkeit>> flihrt uns nicht etwa einer Ausbil-
dung der rein <<phiinomenologischen>> oder <<transzendentalen Sprache>>, die in sich von der
Sprache der ((natiirlichen Einstellung>> unterschieden ist - weil es natiirlich keine solche
16 Fink E. Das Problem der Phdnomenologie Edmund Husserls. Studien zur Phdnomenolog:e ]930-1939Den Haag, Martinus Nijhoff; 1966. S. 200 f.
17 Fink E. V/. CM; S. 39. Vgl. auch, Kantstudien-A@atz. S. 105, 108 ff.
Is Vgl. lbid. S. 101 usw.
19 Ibid. S. 81 IT.. 94fY.
Sprache, ja <<keine transzendentale Sprache>> geben kann.120 Wenn man nicht die Andersar-
tigkeit der Seinsweise der transzendentalen Subjektivitiit erkennt, ist man Rir den transzen-
dentalen Schein - die Gleichsetzung der Seinsweise der transzendentalen Sul!jektivitdt
mit dem mundanen Sein, dem Sein des Menschen - anfiillig. Wir k6nnen Finks Einsicht
auf dieser Grundlage so zusammenfassen, class die transzendentale Subjektivit!it in der
Phiinomenologie notwendig ein transzendental-mundaner Zwitterbegr@ist. Denn sofern
Fink davon ausgeht, class sich das andersartige Sein der transzendentalen Subjektivit!it nur
<<im fremden Medium der natdrlichen Sprache>>12l ausdriicken l!iBt, scheint es notwendig zu
werden, die <<mundane)> oder <<nattirliche Sprache)) darhber hinausgehend als transzen-
dentale zu erkennen. Diese notwendig verwirrte Mediatisierung halten wir deswegen flir
z-witterhq/1.l22 Wenn diese tranzendental-mundane Zwittematur nicht erkannt ist, Ist uns
kein kennzeichnender Gegenstand der Ph5nomenologie gegeben (zumindest wird man die-
sen Gegenstand mit etwas anderem, z. B. mit dem Psychischen, verwechseln). Aus Finks
Sicht stellt l-Iusserls Begriff des <<transzendentalen Scheins>> cles <<transzendentalen Psycho-
Iogismus>> nur ein Beispiel seines eigenen Begriffs dar, weil Fink die <<Unmbglichkeit, die
Epoch6 im unbedingten l]berhaupt, also als eine unbedingt allgemeine zu vollziehen>>,123
auf deren notwendigen Grund Husserl nicht hinweist, ausdrticklich hervorhebt. Daher soll
nach Fink der phdnomenologischen Reduktion eine eigenstiindige philosophische Rolle
zugesprochen werden, niimlich diese, die Zwitterhq/1igkeit als solche herausstellen, um den
transzendentalen Schein durch eine Reflexion auf die <<Andgrsartigkeit>> cler Seinsweise der
transzendentalen Subjektivitht als solchen zu erkennen. Dabei wird nach Fink ebenso <<clie
ausdrtickliche Reduktion der Seinsidee notwendig>>.124 <:3.) Hier muss nun gezeigt werden)
warum diese <<Andersartigkeit>> der Seinsweise der transzendentalen Subjektivit!it so stark
betont wird. Der Grund scheint uns prinzipiell in den zwei folgenden Punkten zu liegen:
(A.) Die <<Produktivit5t>> der transzendentalen Konstitution: Der erste Grund der <<Anders-
artigkeit>> der Semswejse der transzendentalen Subjektivitdt besteht darin, class, wie be-
schrieben, <<ihr Sem>>, wte Husseri sagt, <<Sich-Selbst-Konstituieren>> ist, 125 w!ihrend alle
anderen Typen des Seienden <<nur denkbar>> sind <<als synthetische Deckungspol, Einheits-
pol, Pol fhr darauf sich hinrichtende oder mbglicherweise hinrichtende SubjektivitEit>>.126
20 lbid. S. 95. Vgl. auch. S. 104 usf.
2 1 I b i d . S . 1 0 4
22 Uns scheint, class dieser Ansatz prinzipiell von Steven Galt Crowell angenommen wird, der Finks Entwurf
in VI CM als <<gnostisch>> verwirfl:. Denn statt Finks Begriflb anzunehmen, stellt er seinerseits die These
auf, der zufolge (<phsinomenologische SEitze>> manchmals als << Metonymie>> verstanden werden mi)l3en. Ob-
gleich Fink die Natur der <<phanomenoiogischen Satze>> nicht als <<Metonymie>> sondern als <<Analogie>>
kennzeichnet, scheint uns der Herzst0ck von beiden Einsichten jedoch darin zu liegen, class der Ausdruck
der ph5nomenoiogischen Analysen von der oben genannten transzendental-mundanen zw:tterhq/Ien Natur
ist. Vgl. Crowell S. G. Husserl, Heidegger; and the Space q/~ Meaning. Evanston, lllinois: Northwestern
University Press. 2001. S. 261 f.
23 I-lua XXXIV. S. 293.
2 4 F i n k E . V / . C M . S . 8 2 .
25 I-Iua XXXIV. S. 24.
2 6 I b i d .
86 Y . I k e d a Horizon :3 (l) :zo14 87
Die transzendentale Subjektivitht ist, wie schon erliiutert wurde, lily sich selbst relativ,
wiihrend alle anderen Art des Seienden jiir sie relativ sind. Diese <<Relativitdt)) !St als <<Kon-
stituieren >> verstehen.127 Fink entwickelt diesen Gedanken dahingehend, classdie<<Selbstrelativit5t der transzendentalen Subjektivitiit>> (bzw. <<Sich-Selbst-Konstituieren>>
derselben) insofern als die <<konstituierende Produktivitdt>> gelten kann, als der <<Erfah-
rungsbegriff der natiirlichen Einstellung>> prinzipiell durch <<Rezeptivitdt>> bestimmt sein
muss.128 (=)bgleich wir diese Formulierung Finks bier nicht niiher studieren werden, kbnnenwir in diesem Punkt Husserls und Finks Positionen prinzipiell miteinander identifizieren,well uns Finks Bestimmung der <<Rezeptivitit>> mit Husserls These der <<Relativit5t der
welt fllr das BewuBtsein>>, und ebenso die <<konstltutlve Produktivitiit>> (Fink) mit de]qenl-
gen der <<Selbst-Relativitiit der transzendentalen Subjektivitjit>> (Husserl) vereinbar zu sein
scheinen. (B.) Die Andersartigkeit des Seins des konstitutiven <<Werdens>> als Ursprring-
lichkeit: Dennoch scheint uns, class Husserl und Fink die Seinsart dieses <<Sich-Selbst-
Konstituierens>> nicht v6llig aufdieselbe Weise verstehen. Denn Finks Ausdruck des <<Wer-
dens>> bzw. der <<Verweltlichung>> ist wesentlich zweideutig. D. h. wir miissen unter Finks
Wort << Werden>> nicht nur dies verstehen, class zwar die Welt uns vorgegeben ist und die
Gegebenheitsweise des Fungierens der transzendental konstitutiven Subjektivit5t zumeist
anonym bleibt, class es aber diese Vorgegebenheit und Anonymit5t ph!inomenologisch
nachtrdglich - durch den Vollzug der Epoch6 und der phdnomenlogischen Reduktion -
freizulegen und die verborgene Genesis der vorgegebenen @2lt hinsichtlich der sie anonym
konstituierenden Subjektivit!it zu analysieren gilt (Husserls These). Sondem es handelt sich
bei Fink besonders um die Frage, wie dieses anonyme Fungieren ermbglicht werden kann:
das << @2rden)) tut sich kund als << H?rweltlichung)>, als die Bedingung der Mdglichkeit des
universalen <<Korrelationsapriori)) der transzendentalen Sul!jektivitdt und der vorgegebeー/29.f)ieses << 14>i?rden)) ist daher als das in sich rein transzendentale Phdnomen zu
verstehen. Denn wenn die Phiinomene der <<transzendentalen Subjektivit!it>> und der <<Vor-
gegebenheit der VVelt>>, die ji~~urjede phdnomenale Ibtsache konstitutiv sind, nicht als sol-
ches erkannt werden, kbnnen wir nicht ohne Zweifel vom <<universalen Korrelationsaprio-
ri>> von beiden jeweils sinnvoll sprechen, da dieses Sprechen unter diesen Umstiinden
keinen Gegenstand h5tte. Mit anderen Worten: die Erkentnis des Finkschen <<Korrelati-
onsaprioris>> setzt selbst notwendig die phiinomenologische Reduktion voraus (Finks Di-
stanz zu l-lusserl).130 I=)ieses transzendentale Ph!inomen des <<Korrelationsapriori>> lZisst sich
127 ]I)aher hat Fink seinerseits die folgende These aufgestellt: <<Husseris eigentliche These Hber das "Sein'' ist
die ~'phdnomenologische Reduktion'~, d. h. die These von der Konstituiertheit des Seienden>> (EFGA3/2.
S. 140, Z-XI, 7a. hervorhebung von E. Fink).
128 Fink E. VI. CM. S. 56 f., hervorhebung von E. Fink.
129 Bekanntlich <<ersch(ltterte>> Husserl das universale <<Korrelationsapriori>> so tief, <<dass seitdem meine ge-
samte Lebensarbeit von dieser Aufgabe einer systematischen Ausarbeitung dieses Korrelationsapriori beh-
herscht war>> (Hua VI. S. 169). Es ist also fbstzustellen, class Husserls <<universales Korrelationsaprlor1>>
nicht wie bei Fink, zwischen <<der transzendentalen Sul!jektivitat und der vorgegebenen Wi?lt>> besteht,sondern zwischen <<ErIhhrungsgegenstand und Gegebenheitsweisen>> (lbid.).
130 [lbrigens scheint uns, class Schuhmans <<fundamentale These>> zwischen Husseris und Finks Ansdtze os-
zilliert: << Unsere fundamentale These wird sein: Die Seinsweise der transzendentalen Sulyekti-vztcit tst ur-
sprungliche Nachtrdglwhkert. Sie ist ein Secundum oder Posterius, dem kein Primum oder Prius voraus-
insofern nicht im Rahmen der genetischen Phdnomenologie Husserls analysieren, als laut
Fink das <<Werden>> nicht mehr auf seine StiHung (Entstehung) zuriickweist, sondern ein
<<tietbres Phdnomen>> ist, das (<den genetischen Zusammenhang ermbglicht>>.13] I=)ieser Ge-
danke liisst sich tblgendermaBen verstehen: die <<Selbstverwirklichung der konstituieren-
den Sul!jektivitdt in der Wltverwirklichung>> weist auf kein anderes Phdnomen mehr zu-
riick (anders gewendet, weist es nur ay[sich selbst zurrick), weil, wenn dem nichts so wdre,kein Phdnomen, von dem wlrje sinnvoll sprechen k6nnen, sich ereignen kbnnte, dajajedes
Phiinomen, aus Finkscher Sicht, auf dem <<uni-versalen Korrelationsapriori>> der vorgege-
benen Wlt und der transzendentalen Sulyektivitdt beruht, und daher auf sein << Werden>>
notwendig zuriickverweisen muss. Nur in diesem Sinne kbnnen wir dieses (< Werden>> als
ein <<tieferes Phiinomen>> verstehen. Wenn dieses sich ereignet, dann und nur dann -
kann das gegebene PhEinomen notwendigerweise auf das andere verweisen (<<das tiefere
Phiinomen>> zeigt sich als Bedingung der M6glichkeit der ph5nomenalen Tatsache der in-
tentionalen Verweisung). 'Nun ist dieses (<Werden>> als Genesis zu verstehen, jedoch nicht
im Sinne einer Entstehung, sondem als Ursprungl :32 jm strengen Sinne des Wortes, ja << Ur-
sprung der Wlt)). Denn der Ursprung eines Ph!inomens ist im Allgemeinen, wie Giinter
F igal zurecht sagt, <<so etwas wie ein unvorhersehbares und unableitbares Zentrum, von
dem her und in dem sich alles andere mit einem Mal neu erschliel3t>>,133 wiihrend man unter
Entstehung eines Ph!inomens seine Ableitung aus den Zusammenhiingen meint= in denen es
geschieht oder geschehen kann.134 I=)ie Andersartigkeit der Seinsweise der transzendentalen
Subjektivitiit besteht daher in ihrer Ursprhnglichkeit und dE:m urFpriinglichen Geschehen-
liegt; sie ist Abbild, dem kein Urbild als ein (an sich und unabhangig von ihr) Seiendes vorhergeht. Die
Paradoxie der Subjektivitdt l6st sich in die Paradoxie eines absoluten Posterius oder Bild auf>> (Schuh-
mann K. D:e Fundamentalbetrachtung der Phdnomenologie. S. XXXVIII, hervorhebung von K. Schuh-
mann).
131 (<Bekanntheitsborizont eines Gegenstandes (generelle Apperzeption) weist zur0ck auf Urstiflung. Aber es
ist tlraglich, ob alle Bekanntheitshorizonte (Seinsverfassungen) genetisch aufkllirbar sind. Wahrscheinlich
weist die Stiftung der generellen Apperzeption aufein tieferes Ph5nomen, das den genetischen Zusammen-
hang erm0glicht>> (EFGA 3/1. S. 401, U-IV 44).
132 <<Idee des letzten Verstandnisses ist nicht das auf den Grund bezogene, sondern auf den Ursprung>>
(EFGA3/l. S. 259, Z-IV 94a). Er schreibt sogar: <<Reduktion unterscheidet sich von .jeder ontologischen
Reflexion auf das Zusammen von Sub jekt-Objekt durch den grundsdtzlichen Charakter des Zurilckfragens
hinter das Sein des Subjekts. Sofem die Sub jektivitiit sezend ist, ist sie immer schon Mensch (sei es in der
alltaglichen oder eigentlichen Weise der Existenz). Wie ist aber ein Zuriickfragen hinter das Sein m6g-
lich? Fragen hinter das Sein sind keine Substruktionen eines Meta-ontischen. sondem sind Fragen an den
Ursprung des Seins. Phzlosophieren tst das Denken des Ursprungs>> (EFGA3/2. S. l 18, Z-X, 9a und b,hervorhebung von E. Fink).
133 G. Figal schreibt weiter: << Das Urspr0ngliche ist wie der Strude! im Flu B. Es erkllirt sich aus keinem Zusam-
menhang. sondern stifIet einen Zusammenhang erst; es gehbrt in keine Entwicklung, sondern was zu ihm
ais Sichentwickides gehdrt, wird erst vom UrsprOnglichen her als solches erkannt>> ( Figal G. Gegenstand-
lichkett. Tlibingen, 2006. S. 31).
134 Es erscheint uns hierbei sehr hilfreich. Finks Unterschied von der <<phdnomenologischen Ursprungsti-age>>
und der <<ontischen>> zu studieren. Letztere Weise des Fragens k6nnen wir mit derjenigen identifizieren, die
wir die Frage nach Entstehung nennen wollen. << Wenn ein Seiendes gegehen ist, so ist sein "Ursprung In
hairier Weise mehr, auch nicht FHr Gott mehr ongmiir gebbar < . > Ontische Ursprungstl-age ist Frage nach
V)rhin. nach dem Woher. Gefragt ist ein innerzeitlich Vergangenes. Phiinomenoiogische Ursprungsh-age ist
Frage nach der Zeztl:chkeit dieses Seienden>> (EFGA 3/1. S. 219, Z-IV, 19b, hervorhebung von E. Fink).
88 Y . I k e d a Horizon 3 (:1) :201zl- 89
scharakter. <<'N icht c@Glieder== der Korrelation, sondem die Korrelation ist das Friihe>>,135
d. h. diese <<Korrelation>>, genauer gesagt, das <<Korrelationsapriori der transzendentalen
Sul!jektivitdt und der vorgegebenen Wlt>> ist das Ursprhngliche. Daher kann in VVahrheit
kein Gegenstand, der in der Wlt erscheint, zum transzendentalen Leitfaden Hir die <<Frage
nach dem Ursprung der Welt>> werden, sondem das weltimmanente Phdnomen muss viel-
mehr von der Ursprtinglichkeit der Korrelation het; von der <'< Fi?rweltlichung)> her verstan-
den werden: denn erst von dieser Urspriinglichkeit aus kann der weltimmanente Gegen-
stand als der weltimmanente urspriinglich erkannt werden.136 I)ementsprechend versteht
Fink den Weltbegriff nicht nur als Begr@'der Ibtalitdt des Seienden, sondem vielmehr als
Ursprung desselben. Wenn dies nicht erkannt ist, zeigt man sich noch fiir den transzenden-
talen Schein im Sinne Finks anfiillig. Die Urspriinglichkeit der Verweltlichung fungiert, um
mit Husserl zu reden, zumeist anonym und l5Bt sich nach Fink nur ausdrticken, wenn man
die oben genannte transzendental-mundane Zwitterhq/iigkeit des ph5nomenologischen Be-
griffs erkennt. Oder anders: die Urspriinglichkeit der transzendentalen Sul!jektivitdt und
H!rweltlichung im Sinne des Finkschen Korrelationsappriori entzieht sich uns.137 Der
Grund dieses Entzugs scheint uns in der .M'acht der Selbstverstdndlichkeit zu liegen, da es
selbstverstiindlich ist, class, wenn 'von einem Phinomen oder einem Ereignis die Rede ist,wir nicht notwendig tiber dessen Ursprung sprechen milssen - nichtsdestowemger mussder Ursprung eines Phhnomens irgendwie gegeben sein, wenn dasjeweilige Phiinomen als
solches der Erkeuntnis offenstehen soll. Das Wesen des <<Dogmatismus der natiirlichen
Einstellung)> besteht, wie wir anhand von Finks Befund festgestellt haben, im Entzug des
Ursprhnglichen. Der .Entzug ist die eigentliche Gegebenheitsweise des Ursprringlichen.
Hier liiBt es sich zusammenfassend sagen, class Finks transzendental-ph5nomenologi-
scher Beitrag darin besteht, (1.) den (<transzendentalen Schein>> des <<Dogmatismus der
natiirlichen Einstellung>> (weder der <<philosophischen H?rabsolutierung der Wlt>> noch
des <<transzendentalen Psychologismus>> bei Husserl) ausdriicklich formuliert zu haben,und (2.) dessen Grund - die transzendental-mundane Zwitterhq/ligkeit der phiinomeno-
logischen BegriIfe und die Andersartigkeit der Seinsweise der transzendentalen Sulyek-
tivitdt als das Ursprhngliche - erwiesen zu haben. Also sieht Fink an die ausdrzickliche
R@exion hber die Seinsweise der transzendentalen Sul!jektivitat als notwendige A*-abe
der transzendentalen Phdnomenologie tiberhaupt an. (3.) Damit kdnnen wir den Grund
aufzeigen, warum laut Fink die transzendentale Ph5.nomenologie durch die <<Frage nach
dem Ursprung der %lt>> bestimmt ist: wenn niimlich der <<Dogmatismus der natHrlichen
Einstellung>> notwendig gegeben ist, muss der Ursprung derselben ph5nomenologisch ana-
! 3 5 F i n k E . V / . C M . S . 4 9 .
136 In diesem Kontext kritisiert Fink die <<traditionelle Philosophie>>, genauer gesagt: << 1.) die EntgegensetzungVOn Sub jekt und Objekt, Ich und Gegenstand und dann 2) Subsumption des Subjekts unter die "Gegenstdn-
de", sofem das Ich auf sich selbst reBektieren kann; sich selbst '~Gegenstand" wird>> (EFGA 3/2. S. 292,
Z-XV, 67a). Vgl. auch: Bruzina R. Gegensdtzlicher Ei@4/! - /ntegr:erter Einjlz(/?: Dte Stellung He:deg-
gers in der Entwicklung der Phanomenologie. Zur p/ulosophischen Aktualitat Heideggers, Bd 2. Frankhlrtam Main; Klostermann, 1990. S. 153 f. Es sei angemerkt, class meine Aufmerksamkeit durch eine Diskus-
sion mit Georgy Chemavin aufdiesen Texte gelenkt wurde. Daflir danke ich ihm herzlich.
137 Siehe FuBnot 87.
lysiert werden, um den transzendentalen Schein nicht nur zu erkennen, sondern auch von
Grund her aufzulbsen. Darum besteht der Herzstiick des transzendental-phiinomenologi-
schen Konzepts beim jungen Fink eben darin, das << Werden>> oder die <<Verweltlichung>>
als <<Korrelationsapriori der vorgegebenen Welt und der transzendentalen Subjektivit5t>> in
ihrer Ursprdnglichkeit ph5nomenologisch zu analysieren und diese Aufgabe konsequent
und systematisch durchzuRihren.
Doch befremdet es den heutigen Leser der VI. CMund des Kantstudien-A@atzes, class
Fink die oben genannte dritte Aufgabe (die Analytik, durch welche die <<Andersartigkeit>>
der Semswejse der transzendentalen Subjektivitiit als Ursprtinglichkeit nicht rein begr*.
lich, sondern phdnomenologisch-deskr<ptiv analysiert wird) nicht thematisch durchgefiihrt
hat.138 Zwar ist diese abstrakte Herangehensweise in den oben genannten Texten F inks
gewissermaBen unvermeidbar gewesen, weil Fink, statt phdnomenologisch <<nach dem Ur-
sprung der Welt>> zu fragen, das Wesen des <<Dogmatismus der natiirlichen Einstellung>>
begrel/i?n musste, um die Aufgabe von VICM und Kantstudien-A@atz - das formale
Aufzeigen des ph!inomenologischen Systems unter dem Titel der <<transzendentalen Me-
thodenlehre)) und die Widerlegung der <<kritizistischen Kritik>> an der Phiinomenologie
Husserls - durchzufiihren. Doch soll nun unsererseits gezeigt werden, wie sich Finks
Konzept der transzendentzalen Phiinomenologie als Durchflihrung der <<Frage nach dem
Ursprung der Welt>> charakterisieren, und hiervon ausgehend die <<Ndhe und Distanz>> zwi-
schen Husserl und Fink dartun Idsst.
3 . E I N E S K I Z Z E V O N F I N K S K O N Z E P T D E R P H A N O M E N O L O G I E D E S U R S P R U N G S D E R W E L T
Wie wir gesehen haben, (1.) sucht Fink die (kosmologische) Aufgabe der <<Frage
nach dem Ursprung der %lt>> durch eine ph5nomenologische Analyse des <<konstitutiven
werdens der Welt vom Ursprung der transzendentalen Subjektivit5t her>> durchzuRihren,
(2.) wobei Fink unter dem priignanten Ausdruck des (<Werdens der Konstitution>>bzw. der
<< Verweltlichung>> <<die Selbstverwirklichung der konstituierenden Sul!fektivitdt in der fH?lt-
verwirklichung>> versteht. (3.) Die Seinsweise dieser (<Selbstverwirklichung>> scheint uns
nicht nur als <<vorgegeben>> oder <<anonym>>, sondern vielmehr, positiv gesagt, <<ursprdng-
lich>> verstanden werden zu miissen: in der Perspektive des Ursprungs der nathrlichen Ein-
stellung. Hier ist die grundsiitzliche Frage zu stellen, wie uns diese Ursprtinglichkeit, cleren
Gegebenheitsweise wir gerade <<Entzug>> genannt haben, phdnomenologisch gegeben wird,d.h. wie das notwendig entzogene Ph5nomen zum phiinomenologischen Phiinomen wird
und wie es zu beschreiben ist, um F inks << Frage nach dem Ursprung der Welt>> konkreter
nachzuvollziehen. Dabei client uns Finks eigentiimlicher Horizontbegr@zum Leitfaden. Es
erscheint uns evident, class manche Phiinomenologen dem Husserlschen Ansatz der << Welt
als Horizont>> treu folgen, wobei dieser (<I-Iorizont>> selber als <<Zug5nglichkeit der Welt fiirs
38 Vgl. Bernet R. DiIf6rence ontologique et conscience transcendantale. La reponse de la <'<Sixi6me /Y/dditation
Cartdsienne)) de Fink. E. Escoubas et M. Richir (edit.). Husserl. Grenoble: Jc!rome Millon, 1989. S. 98 f.
90 Y . I k e d a Horizon :3 (1) 201zj. 91
rBewuBtsein>>139 verstanden wird. Aber wir sehen es vielmehr als unsere Aufgabe an, das
Spezifische des Horizontbegriffs und der <<Zug!inglichkeit>> bei Fink hervorzuheben. Diese
A ufgabe k6nnen wir anhand von F inks Erstlingsarbeit <<Vergegenwiirtigung und Bild>> (von
nun ab wie VB abgekiirzt) 140 und einigen Pr]vatnot)zen durchRihren, well Fink sich dart
eben mit diesem Problem intensiv beschiifligt hat.
Das Eigenttimliche des Finkschen Ansatzes besteht darin, class die <<I-Iorizontintentio-
nalitiit>> bzw. das <<Horizontbewusstsein>> sich nicht im intentionalen K?rweisungssystem
im Ganzen (Gewebe der intentionalen Verweisung des Etwas auf etwas anderes) aufl6sen
15sst. Grund hiervon ist dies: Erstens kbnnen wir Finks Begriff des <<f-Iorizonts>> - wie bei
Husserl - als den Spielraum der mbglichen EJ=/2zhrung interpretieren, in welchem allererst
ein Phiinomen mtentjonal aufein anderes verweisen kann; aber die Ermbglichungsfunktion
dieses Horizonts besteht nicht primiir in ihrer regulativen Fbrzeichnung des mundanen Sei-
enden, sondem vielmehr im Charakter des @brin, in das die Subjektivitdt <<hineinlebt>>.141
Zweitens liisst sich daher seine dementsprechende Gegebenheitsweise nicht nur als <<an-
onym>〉 und sondern dartiber hinausgehend als <<Bineinleben>> 142 und
<<Eindringen>>143 kennzeichnen. Der Vollzugsmodus des <<Eindringens>> wird bei Fink, k6n-
nen wir vorwegnehmen, als das phiinomenologische Ursprhngliche ausgelegt. Wenn das
erfahrende Subjekt in die Welt eindringt, ist dabei der Horizont dieses <<In-die-%lt-Hin-
einlebens>> im Ganzen selber immer schon <<ausgehalten>> und <<gezeitigt>>.144 l=)as Horizont-
ph5nomen, das in Finks Analyse zum transzendentalen Leitfaden wird, kbnnen wir also
nicht mit jener phiinomenalen Tatsache gleichsetzen, class ein einzelnes Phiinomen nicht
ganz isoliert erscheiuen kann, sondern notwendig auf die anderen Phiinomene verwe]st.
Mutatis Mutandis: Es steht nicht das <<Zugangsbewusstsein>> zu den einzelnen Gegenst5n-
den in Frage, sondern eben zum <<I-Iorizont>>, in dem diese Gegenst5.nde erst erscheinen.
Das Ziel von VB liegt nun darin, diese zwei verschiedenen Typen des <<Zugangsbewusst-
seins>> ausschliel3lich hinsichtlich des Zeitbewusstseins zu ergriinden. Dem Leser von VB
fiillt auf, class Fink dabei kauri von dem <<Zeitobjekt>> bzw. <<immanenten Objekt2 spricht
(z. B. die Melodie), clessen Konstitution Husserl von den Zeitvorlesungen 1905 (Hua X) an
aufzukliiren versuchte und das ihm sp5ter (etwa in den Jahren l908/09)145 :zum transzen-
dentalen Leitfaden client, um die spezifische Zeitlichkeit der Subjektivit!it (d. h. <<Fluss>>)mit del]enigen des (<Zeitobjekts>> zu kontrast)eren.]46 Finks Ausgangspunkt liisst sich unse-
rer Ansicht nach in der folgenden Formel zusammenfassen: <<Die Grundarten der Imagi-
139 Fink E. M?lt und Endl:chkeit. WDrzburg, K6nigshausen & Neumann, 1990. S. 24.
140 Fink E. Vergegenw5rtigung und Bild. Beitriige zur Phlinomenologie der Unwirklichkeit. Studien zur Phd-
nomenologie 1930-] 939. S. l ff.
1 4 1 F i n k E . V B . S . 1 1 f .
1 4 2 l b i d .
143 lbid. S. 26 IT., 44 f.
1 4 4 I b i d . S . 2 l f . , 2 4 , 3 7 f .
145 Vgl. Hua X. S. 324 ff. (Text no. 50) auch: Bemet R., Kem L, Marbach E. Edmund Husserl. Darstellungseries Denkens. Hamburg: Meiner, 1996. S. 102.
146 Denn: <<Der FluB der BewuBtseinsmodi ist kein Vorgang, das Jetzt-BewuBtsein ist nicht selbstjetzt>> (I-Iua
X. S. 333), wdhrend beispielsweise eine <<Melodie>> otTenkundig ein zeitlicher Vorgang des Tons isL Vgl.
auch lbid. S. 371.
nalion gliedern sick nicht nach den Grundarten der e@:hrenden Akte, sondern < . > nach
der Manig/izltigkeit der Zeithorizonte, in denen gegenwdrtigendes Aktleben apriori steht.
So ist wesensm5Big die Erinnerung auf die Vergangenheit bezogen, die Vorerinnerung auf
die Zukunfl ..,>>l47
Diese These kbnnen wir so auslegen, class in Finks Analyse das Phiinomen der <<Man-
nig/2/ltigkeit der Zeithorizonte>> den <<transzendentalen Leitfaden>> bildet. Die <<Zeithorizon-
te>> sloid, rein formal gesagt, die <(umspannenden Horizonte des Vorher und Nachher>>.148
(1.)\)Vir erblicken die <<Mannigfaltigkeit>> deutlich in der phdnomenalen Tatsache, class
beispielsweise der <<Zeithorizont>> der Wahmehmung, in dem etwas wahrgenommen wird,apriori mit demjenigen der Phantasie nicht identisch ist. Denn, wenn sich die beiden Hori-
zonte adGquat decken, kbnnen wir die wirkliche @2?lt (als Korrelat der Wahrnehmung) nicht
von derphantasierten f@lt (Korrelat des Phantasierens) unterscheiden. (2.) Dabeiiibersieht
Fink nicht, class die Modi des <<Eindringens>> in die Zeithorizonte bzw. die der V)llzugsweise
des erfahrenden Subjekts ebenso mannigfaltig sind. Wenn man z. B. m ewer <<pathetischen
Phantasie>> bq/izngen ist, ist man in den in sich unwirklichen Zeithorizont <(versunken>>: <<Je
gr6Ber die Versunkenheit ist, um so mehr entsteht der Anschein des Gegenwiirtigens>>.149
Den Vollzugsmodus der tiefen <<Versunkenheit>> k6nnen wir doch als cine gewissermaBen
normale Bewusstseinsweise ansehen, wenn wir in der Wirklichkeit befangen sind.150 :Schon
bier wird deutlich, class das intentionale <<Korrelat>> des <<Eindringens>> oder <<Hineinle-
bens>> nicht die einzelnen Gegenst5nde, sondern eben die mlt in ihren Modalitdten betrifR.
0brigens verstehen wir dabei unter <<Modalitiit>> nicht nrfr die /einsmodalitdt (wirklich,mbglich, usw.), sondern auch die Zeitmodalitdt (gegenwiirtig, vergangen, usw.). Um die-
se Sachlage zu veranschaulichen, lichen wir das Beispiel der (<Erinnerungswelt>> als der
Welt hinzu, insofern sie vergangen istl51 - Die Erinnerungswelt (oder der Horizont der
Vergangenheit) ist uns, wenn wir uns daran erinnern, nicht nur <<vorgegeben>>, clenn man
kann durch ein Trauma within v6llig darin versinken, so als hbrte - in den Augen der An-
deren - die left ay/; Wenn wir a4[irgendeine wise in die %lt (paler in den Zeithorizont)hineinleben, dann und nur dann kann die Welt uns in ihren Modalitiiten gegeben sein. Nun
ist es zwar wahr, class wir die Weise des Hineinlebens, d. h. die Gegebenheitsweise der %lt
mr anonym halten kbnnen, da wir sie m manchen Fiillen nicht ausdriicklich zu erkennen
brauchen (in dieser Hinsicht behiilt Husserl Recht). Dies aber iiegt bloB darin begr0ndet,class das mannigfaltige Eindringen oder t-Iineinleben zumeist fiir uns ein zu selbstverstdnd-
liches Ph5nomen ist.152 D jese spezifische Selbstverstiindlichkeit als Selbstverst5.ndlichkeit
zu erkennen heiBt nichts anderes, als die phiinomenologische Reduktion zu vollziehen, deー
ren Ursprung Fink zufolge als die <<Verwunderung>> oder das <<Staunen>> bezeichnet werden
147 Fink E. VB. S. 21 f., hervorhebung von E. Fink.
1 4 8 I b i d . S . 2 3 .
1 4 9 I b i d . S . 5 5 .
j SO Fink schreibt jedoch welter: <<Die Weltbefangenheit ist keine Befangenheit des Menschen, sondern ist das
Menschsein selbst>> (EFGA 3/2. S. 175. XCIII/2a).
! 5 J V g l . l b i d . S . 2 7 f f .
152 Vgl. Fink E. Was will die Phanomenologie Edmund Husserls? Stud:en zur Phanomenologie ]930--]939.
S . 1 6 9 f .
92 Y . I k e d a H o r i z o n 3 ( l ) 2 0 1 4 93
kann, das den Menschen in der Art cines << Widerfahmisses>>, wie seit Platon die Erfahrungdes Anfangs der Philosophic gedeutet wird, <<iiberfjiilt>>.153\)\[enn wir Fink folgen und die-
ses selbstverstiindliche Phdnomen des <<Eindrmgens>) von sewer transzendentalen Funk-
tion her phiinomenologisch betrachten, so k6nnen und solien wir die Gegebenheitswe!se
dieses Ph!inomens nicht nur als <<anonym>>, sondern auch positiv als <(ursprtinglich>> cha-
rakterisieren. Wenn man dieses Ph5.nomen von seinem phdnomenal-deskrjptiven Sinn her
versteht, scheinen uns die zwei extremen Pole seiner Fbllzugsmodi einerseits << @2zchheit>>
und andererseits <<Schlq/$> zu sein: <<Das Subjekt ist -welt*n. Nur solange ein subjektives
Leben im W:zchen sich befindet, ist es welt*n.\Vachheit und Weltoffenheit identisch.
Schlaf_ Weltverschlossenhelt>>.154 Weil uns die <<Wachheit>> als Grundmodus der (< Weltofl-
fenheit>> erst den Spielraum zugdnglich macht, in dem uns die E@hrung, sofem sie als
wirklich ausweisbar ist, und korrelativ der Gegenstand der Erfahrung zrt/2zllen kbnnen, d.h.
weil sich uns die Welt im Modus der <<Wachheit>> er@jzet,155 begreiR der WeltbegrifT nicht
bloB die Totalitiit der existierenden Dinge und der korrelativen (intentionalen) Erfahrun-
gen, sondern vielmehr die Ursprhnglichkeit dieses Geschehens als eines solchen. Darin
liegt der Grund:, weshalb Fink das <<ln-die-VVelt-Hineinleben>> als Wesen der <<nattirlichen
Einstellung>>, d. h. als das <<natilrliche Sein des Menschen>> annimmt.156 I=)ie Ursprting~
lichkeit der %lt besteht daher nicht prim jir in der regulativ-vorzeichnenden Funktion der
Seienden, sondem vielmehr in der .Erm6glichung@nktion der ausweisbaren Modalitdten.
Die Welt ist von transzendentalem Wert, nicht nur weil sie als Jbtum zu verstehen ist,sondern weil sie die Ausweisbarkeit der Modalit!it erm6glichend be-schrdnkt. Diese er-
mbglichende Schranke der Welt ist selber der notwendige Rahmen, aus welchem heraus
wir die Wirklichkeit als wirklich, und die M6glichkeit als m6glich zu erkennen verm6gen.
Darin besteht die ursprringliche Macht der %lt. Das Ding muss auf diese Weise notwen-
dig in der Wt eingerahmt sein, wenn es als solches erkennbar sein soll. Somit verstehen
wir <<Sein der Wi?lt>> bei Fink (zumindest prtmiir) weder als regulative <<Idee>> (Kant) noch
als vorgegebene <<Form der Welt>> (I-Iusserl)= sondern als der Rahmen des einzurahmden
Seienden und als sein Geschehen. Es kann kein Seiendes geben, wenn es nicht in der W?lt
eingerahmt ist. In einem Privatnotiz schreibt Fink: <<Die Wirklichkeit ist vor den wirklichen
Dingen. Nicht weil es wirkliche Dinge gibt, gibt es Wirklichkeit (also nicht wie Farbigkeit),sondern weil Wirklichkeit ist, kann es wirkliche Dinge geben>>.157 I-Iierbei diirfen wir nicht
Vergessen: wenn sich die H@lt als wirklich bestimmt, ist dabeidas Subjekt notwendig wach,d.h. in die %lt im Modus der Wchheit eingedrungen. Darum k6nnen wir diese Tatsache
153 Fink E. Das Problem der Phanomenologie Edmund Husserls. Studien zur Phdnomenologie ]930--] 939.S. 182,
1 5 4 E F G A 3 / 2 , S . 2 7 3 , ( Z - X V 1 3 a ) .
155 Jedoch sollen wir Modus des << Schlafs>> nicht so auslegen, class dabei keine Welt bestehL und class wir vonder Welt nur im Modus des << Wachens>> .]e sinnvoll zu sprechen verm6gen. Denn: << Weltlosigkeit ist selbstein bestimmter Modus der Welthabe, ist die Welthabe im Modus der extremen Versunkenheit>> ( Fink E. VB.
S. 64).
1 5 6 l b i d . S . 1 1 f .
1 5 7 E F G A 3 / 2 . S . 6 5 , ( Z - V H , X V I I / 2 4 b ) .
als das oben genannte universale und notwendige Korrelationsapriori der vorgegeben %lt
(in ihren Modalit!iten) und der Sul!jektivitdt (in seinen Modi des Eindringens) im Sinne
F inks, und in diesem Sinne als << F2rweltlichung>> identifizieren, und dieses selbst als das
Konstitutive Rir die A usweisbarkeit der Seienden hberhaupt. Denn, wenn wir von dem
Seienden je sinnvoll sprechen kbnnen, muss uns, wie unserer Darstellung welter oben zu
entnehmen ist, die Modalitdt der Wit vorlLiufig zug5nglich sein. Diese Korrelation ist of-
fensichtlich in sich von einem anderen Typus als die intentionale Korrelation zwischen den
weltimmanenten Gegenstiinden und der sie konstituierenden Subjektivitit. Die spezifische
Bewusstsemswelse dieser urspriinglichen Korrelation (d. h. in den Modi des Eindringens)
definiert Fink als <<Entgegenwiirtigung>>, welche wirjedoch in unserer Untersuchung nicht
mehr behandeln k6nnen. Es ist aber zu bemerken, class Fink die <<Seinsweise der transzen-
dentalen Subjektivitdt>> ausdriicklich mit dieser (<Entgegenwiirtigung>> gleichsetzt.158 Schon
bier wird uns deutlich, class Fink unter dem Ausdruck <<Selbstverwirklichung der konstitu-
ierenden Sul!jektivitdt in der Wltverwirklichung>> (d. h. << H?rweltlichung>>) das ursprhngliー
che Geschehen dieser eigenartigen Korrelation versteht, die selber als << Ursprung der Wlt>>
angesehen werden soll. Deswegen ist die phiinomenologische Analyse dieser spezifischen
Korrelation (<<Verweltlichung>>) nichts anderes als die DurchRihrung der <<Frage nach dem
Ursprung der @Wt)), in welcher, wie wir gesehen haben, laut Fink die transzendentale Phii-
nomenologie begrHndet ist.
Es l!isst sich zusammenfassend sagen, (1.) class, Finks phiinomenaler Beschreibung zu-
folge, die Bewusstseinsweise des <<Hineinlebens>> oder <<Eindrinj;ens>> sich als ein spezj/i-
sches Phiinomen artikuliert, und (2.) class Fink das Zugangsbewusstsein aus diesem Grund
in zwel m sich verschiedene Gattungen gliedert, d.h. einerseits das Zugangsbewusstsein
zu Gegenstdnden, die in der @2lt erscheinen (dessen Essenz jedoch in der intentionalen
Verweisung liegt), und andererseits dasjenige zur <<Mannig/2zltigkeit der Zeithorizone>>, oder
besser zur M?lt in ihren Modalitdten. W?nn dies letzte gegeben ist, dann und nur dann kann
sich uns die @Plt *nbaren. Wir kbnnen die Spezifitiit der Gegebenheltswe!se der Welt
mit Husserl als <<vorgegeben>>, und die dabei fungierende Bewusstseinsweise als <<anonym>>
kennzeichnen, doch kbnnen wir mit Fink dariiber hinaus auf positive Weise konstatieren,
class sich diese <<Vorgegebenheit>> und <<Anonymit5t>> auf die eigentiimliche <<Korrelation>>
der Welt in ihren Modalitiiten und den mannigfaltigen Vollzugsmodi des <<I-lineinlebens>> zu-
riickRihren lassen. (3.) Fink legt diesen Befund so aus, class das Zugangsbewusstsein zu den
Gegenstiinden (thematische Intentionalitit) in demjenigen zur Welt grhndet. In diesem spe-
zifischen Fundierungsverhdltnis stellt sich die Ursprhnglichkeit der transzendentalen Sub-
jektivitdt dar. (4.) Diesem Ansatz liegt die neue (dennoch implizit gebliebene) Bestimmung
des Weltbegriffs zugrunde, dem zufolge der Welt nicht nur die regulative Funktion, sondem
vielmehr die Erm6glichungsfunktion ihrer ausweisbaren Modalit5ten zugesprochen wird.
158 <<Die transzendentale Subjektivitat ist in ihrer Seinsart ganz und gar bestimmt durch die Entgegenwdrtigun-
gen. Diese sloid die konstitutiven Intentionalitdten, durch die allererst so etwas wie eine FH?lt m6glich ist,
sind aber auch die konstitutiven Bedingungen der innerweltlichen Subjektivitlit>> (EFGA 3/1. S. 214, Z-IV
I l a, hervorhebung von E. Fink).
94 Y . I k e d a H o r i z o n 3 ( l ) 2 0 1 4 95