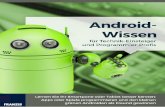Biographische Erfahrungen und politische Einstellungen zwischen Jugend und Lebensmitte
Stehr, Nico und Ulrich Ufer, Wissen als Ware. Invited Lecture, DFG-Graduiertenkolleg „Geistiges...
-
Upload
zeppelin-university -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Stehr, Nico und Ulrich Ufer, Wissen als Ware. Invited Lecture, DFG-Graduiertenkolleg „Geistiges...
Wissen als Ware
Nico Stehr Karl Mannheim Professor for Cultural Studies
Zeppelin University D-88045 Friedrichshafen| Lake Constance
Germany
und
Ulrich Ufer Karl Mannheim Professor for Cultural Studies
Zeppelin University D-88045 Friedrichshafen| Lake Constance
Germany
1. Fassung
Invited Lecture, DFG-Graduiertenkolleg
„Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“, Universitaet Bayreuth, 22./23. Mai 2009, Tagung: "Wissen - Markte -Geistiges Eigentum."
© Nico Stehr, 2009
2
Einführung und Überblick
Ich möchte die Frage nach dem „Wissen als Ware“ aus soziologischer Sicht
untersuchen; damit ist gemeint, dass ich die üblichen Versuche der Umwandlung
und Einfriedung des Wissens in ein Wirtschaftsgut (Kommodifizierung) aus
ökonomischer, philosophischer und rechtlicher Sicht in Frage stellen will. Eine
soziologische Aufarbeitung des Themas vermag die praktische Macht
ökonomischer (North, 1990:34-35), rechtlicher, moralischer oder
philosophischer (John Locke, Hegel) Argumente für Eigentumsrechte an Wissen
allerdings kaum ernsthaft zu beschädigen. 1
Und zwar geht es in der Regel um Argumente, die den ängstlichen Eigentümer
favorisieren, der sich um seine Einkünfte Sorgen macht, und die die Sicht des
frustrierten Kopierers ausblenden, der sich durch Eigentumsrechte Anderer
beengt und als Dieb vorkommt (Cf. Waldron, 1993b). Dazu kommt, dass die
angeblich systemischen Erfordernisse von ökonomischer Effizienz und
gesellschaftlicher Koordination die Wirksamkeit der Kritik an der
Kommodifizierung des Wissens negieren.2 Eine Befreiung des Wissens aus diesen
Zwängen und der damit verbundenen Umfriedung der Erkenntnisse ist deshalb
nur sehr schwer vorstellbar.
1 Die beschränkte gesellschaftliche Macht erstreckt sich eo ipso auch auf ökonomische, philosophische oder moralische Argumentationsketten, die sich gegen eine Kommodifizierung von Wissen in modernen Gesellschaften ausprechen (cf. Vaver, 1990; Waldron, 1993a; Stiglitz, ; Lessig, 2004). 2 Der Verweis in Analogie zur These vom Dilemma bzw von der Tragödie der Allmende (Hardin, 1968), wonach die Freiheit auf der Allmende notwendigerweise zur Überbeanspruchung eines öffentlichen Gutes führt, gehört ebenfalls in die Reihe der Argumente für eine Restriktion des Zugangs zu Wissen
3
Dennoch möchte ich aus soziologischer Warte ganz elementar fragen: muss
Wissen überhaupt geschützt werden? Wir Autoren sind nicht so sehr mit der
Problematik beschäftigt, dass man unser Wissen stehlen könnte, als vielmehr
damit, überhaupt Jemanden zu finden, der die von uns verfassten Texte liest und
verwendet. Natürlich trifft es zu, dass es in modernen kapitalistisch organisierten
Gesellschaften grosse und oft multinationale Konzerne gibt, die ein Interesse an
einem Schutz des Wissens haben (cf. Braithwaite und Drahos, 2000).
Im Vordergrund meiner kritischen Überlegungen stehen aber die
gesellschaftlichen Voraussetzungen und Folgen, Wissen durch Einzäunung zu
schützen. Insbesondere werde ich der Frage nachgehen, ob es bestimmte
Eigenschaften des Wissens gibt, die eine staatlich sanktionierte Regulierung des
Wissens überflüssig machen.
Ich werde meine Fragen an die herkömmliche Sichtweise des Wissens als Ware in
einer Reihe von Gedankenschritten voranbringen:
Wissensgesellschaften und Wissen als Ware
Auf jeden Fall liegt es auf der Hand zu fragen, ob in einer zunehmend durch
Wissen geprägten Gesellschaft Wissen oder auch nur bestimmte Wissensformen
zur Ware werden müssen bzw. sich als ein Phänomen begreifen lassen, das in
enger Analogie zur Ware Eigentumseigenschaften haben muss und sich nur so
aneignen und denaturieren läßt. In der Wissensgesellschaft, in der Wissen neben
den klassischen Faktoren Kapital, Arbeit und Grund und Boden anscheinend zu
einem herausragenden Porduktionsfaktor wird, wächst der ökonomische Druck,
Wissen national wie auch international als Ware zu behandeln. In von neo-
4
liberaler Wirtschaftspolitik geprägten Wirtschaftssystemen verstärkt sich zudem
der Druck, Wissen als privates Gut zu definieren und zu schützen. 3
Der Wert des Wissens hängt wohl kaum ausschließlich von seinem Nutzen für ein
Unternehmen oder ein Individuum ab, sondern auch von der Möglichkeit
anderer Akteure, etwa der Konkurrenten, dieses Wissen zu ihren eigenen
Gunsten und denen Anderer, etwa der Allgemeinheit, zu verwenden.
Im Kontext herkömmlichen ökonomischen Diskurses wird Wissen auf Grund der
gesellschaftlichen Innovationen von Eigentumsrechten (Patente, copyright) zu
einem knappen, d.h. wirtschaftlichen Gut 4 oder es wird in anderen modellhaften
Zusammenhängen reduktionistisch als ein Bestandteil fixer oder variabler Kosten
definiert. 5
3 Als konkrete Verweise mögen das während der Uruguay Round zustande gekommene Übereinkommen „Trade related aspects of intellectual property rights“ (TRIPSs) aus dem Jahre 1994 (siehe http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm) (siehe auch Sell und May, 2001; Meier, 2005; Tyfield, 2008; Carolan, 2008) sowie die strittigen Diskussionen über die Patente von Forschungsergebnissen aus der Genetik oder der Biotechnologie (siehe Kevles, 2002; Zeller, 2008) genügen. 4 So unterstreicht Kenneth Arrow (1996:125), sofern „information is not property, the incentives to create it will be lacking. Patents and copyrights are social innovations designed to create artificial scarcities where none exist naturally … These scarcities are intended to create the needed incentives for acquiring information.” 5 In dem Bemühen, den Wert der Information als wirtschaftliches Gut zu bestimmen, argumentiert Bates (1988:80) zum Beispiel, daß ein Ungleichgewicht besteht zwischen den fixen und variablen Kosten der Produktion (und Reproduktion) von Information. Und zwar sind die fixen Kosten außergewöhnlich hoch, die variablen Kosten (die mit dem Kopieren der Information zutun haben) sehr niedrig oder sogar gar nicht vorhanden, weil Information ad infinitum reproduzierbar ist und alle anderen Quellen absorbiert. Das trifft aber nur solange zu, wie man davon überzeugt ist, daß die Reproduktion praktisch problemlos (z.B. die ursprünglichen Produktionsbedingungen einschließlich der Kosten transzendierend) vonstatten geht und so oft wiederholt werden kann, wie man will, weil die Produktion etwas Definitives ist und weder der Vermittlung noch der Interpretation bedarf.
5
Hält man sich an die konventionelle ökonomische Definition von Ware, so
handelt es sich dabei um knappe Produkte, die tauschfähig sind, demnach
Tauschwert besitzen und für diesen abstrakten Zweck produziert werden. Der
konkrete Nutzen des Objektes Wissen tritt in diesem Kontext in den
Hintergrund. In erster Linie zählt, daß die Ware Wissen absetzbar ist. Allerdings
geht man in der modernen Ökonomie in der Regel nicht davon aus, daß die
Bedürfnisse, die eine Ware befriedigen soll, vom Produzenten (bzw. vom
Verteilungsapparat) vorab erst konstruiert werden müssen, obwohl kritische
Analysen der modernen Wirtschaft und des Kaufverhaltens weiter der
Überzeugung sind, der Stellenwert des Angebots werde überbetont. 6
Die wachsende Zirkulation von gesellschaftlichem Wissen
Der Dienstleistungssektor einer modernen Gesellschaft lebt zu einem großen Teil
vom Handel mit Wissen; das Erziehungswesen beschäftigt Tausende, die ihren
Lebensunterhalt durch die Vermittlung von gesellschaftlich notwendigem Wissen
verdienen; permanent ablaufende Sozialisationsprozesse geben nicht nur
alltägliches Wissen und Informationen weiter; informelle soziale Kontakte sind
ein Transportmittel von Wissen und Informationen; die Diffusion von Wissen
durch soziale Mobilität und Migration ist umfangreich und wird immer 6 In einer Antwort auf vier kritische Besprechungen seines bahnbrechenden und die Makroökonomie wie auch die Wirtschaftspolitik nachhaltig beeinflussenden Werkes The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) macht John Maynard Keynes (1937) in der Zeitschrift The Quarterly Journal of Economics darauf aufmerksam, dass sich kaum einer unter den zeitgenössischen Ökonomen noch explizit zum Sayschen Gesetzes (aus dem Jahr 1800) -- nach dem das Angebot seine eigene Nachfrage generiert -- bekennt. Allerdings fügt Keynes hinzu, dass die Ökonomen seiner Generation das Saysche Theorem dennoch stillschweigend weiter akzeptieren. An diesem Sachverhalt hat sich in den darauf folgenden Jahrzehnten kaum etwas verändert. Auch heute noch beobachten wir eine systematische Überschätzung der Macht des Angebots sowie der Summe der Maßnahmen, die dazu dienen sollen, dem Sayschen Gesetz Nachdruck zu verleihen. Dazu gehört beispielsweise das Gewerbe des Marketing und der Werbung, aber auch die These von der essentiellen Hilf- und Ahnungslosigkeit der Konsumenten (siehe Stehr, 2007).
6
umfangreicher; Waren und Dienstleistungen kommunizieren in ihr eingelassene
Informationen und Wissen; moderne Informationsmedien verstärken die
Zirkulation von Wissen. Kurz, in modernen Gesellschaften wird die künstliche
Knappheit von Wissen mehr und mehr in einem sich selbstverstärkenden Prozess
unterlaufen. Das in modernen Gesellschaften hohe Mass der öffentlichen
Verfügbarkeit von Wissen, sowohl auf Grund traditioneller gesellschaftlicher
Prozesse als auch als Ergebnis gesamtgesellschaftlichen Wandels und technischer
Innovationen, ist historisch gesehen einmalig.
Dem steht entgegen, dass gewisse Wissensansprüche schon immer ihren Preis
hatten; sie standen auch nie im Überfluß zur Verfügung, sind also, wie andere
Waren, knapp; um Wissen verwenden zu wollen, mußten diese
Wissensansprüche unter Umständen gekauft werden. 7 Man konnte und kann die
freie Zirkulation und den ungehinderten Zugang zu Wissen nicht nur dadurch
beschränken, daß man die entsprechenden Voraussetzungen kontrolliert („it is
difficult to make information into property“ [Arrow, 1996:125]), sondern vor
allem auch dadurch, daß man Wissen im juristischen Sinn als Eigentum
deklariert. Man denke insbesondere an das Patent- und Urheberrecht, das sich
in vielen Ländern schon lange nicht mehr nur auf technische Artefakte oder
Prozesse beschränkt und das sich in Zukunft zunehmend mit der Frage des
geistigen Eigentums von wissenschaftlichem Wissen, bisher eher auf den Bereich
der Literatur, Musik und der Künste beschränkt, beschäftigen muss.
7 Diese These von der quasi warenhaften Qualität des Wissens widerspricht natürlich der gängigeren Auffassung, daß man am Wissen, zum Beispiel wegen seiner prinzipiell unendlichen Potenzierbarkeit, keine Eigentumsrechte erwerben kann (z.B. Simmel, [1907] 1989:603).
7
Daß Wissen als Ware behandelt und gehandelt wird, ist historisch gesehen nicht
unbedingt ein neues Phänomen. Dennoch fehlt bisher eine Ökonomie des
Wissens, ähnlich der ökonomischen Theorie des Standortes oder des
Produktionsfaktors Arbeit. Es sind keine Methoden vorhanden, das Wissen in
"Einheiten" einzuteilen, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, daß sich unter
den Ökonomen die Begeisterung, es wie eine Ware unter anderen Waren zu
behandeln, in Grenzen hielt (vgl. Boulding, 1996).
Der Ökonom behandelte Wissen, wie viele seiner sozialwissenschaftlichen
Kollegen, als Selbstverständlichkeit, als externen Faktor oder schlicht als "black
box". Die Entwicklung einer ökonomischen Theorie des Wissens ist keineswegs
einfach, zumal Wissen eher die Eigenschaften eines kollektiven als die eines
privaten Gutes hat. Wissen ist weitgehend in soziale Beziehungen eingebunden.8
Anstatt Wissen als etwas zu definieren, das der Mensch zu seinen Besitztümern
zählt oder relativ leicht als Objekt erwerben kann, sollte der Wissensvorgang
vielmehr als Handlung angesehen werden, als etwas, das der Mensch tut. Wissen
kann einer Idee von John Dewey (1948) folgend als Transaktion bezeichnet
werden, als ein Phänomen, das nicht unabhängig von sozialen Interaktionen
existiert.
8 Daniel Bell ([1979] 1991:237-238) macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass Wissen in der Form einer "codified theory“ eine kollektive Ware ist: „No single person, no single set of work groups, no corporation can monopolize or patent theoretical knowledge, or draw unique product advantage from it. It is a common property of the intellectual world." Die von Bell formulierte Begründung der These warum (kodifiziertes) Wissen eine kollektive und keine private "Ware" ist, erlaubt den Schluß, dass Wissen diese besonderen Qualitäten einerseits auf Grund bestimmter methodologischer Eigenschaften annimmt und andererseits, weil das Ethos der Wissenschaftsgemeinschaft, insbesondere das Verbot der Geheimhaltung, verhindert, daß es zu einer privaten Appropriation kommen kann. Im Gegensatz zu den Vorstellungen Bells werde ich versuchen zu zeigen, daß es die soziale Kompenente des Wissens selbst, seiner Produktion und Reproduktion ist, die verhindert, daß Wissen zum exklusiven Besitz eines Individuums werden kann.
8
Es ist zudem, wie auch Holzner und Marx (1979:239) betonen, zwar
unterschiedlich verteilt and wie im Fall anderer Waren und Güter knapp, aber
nicht "diminished, decreased in value, or consumed in the process of exchange."
Technischer formuliert, und verwendet man die bekannten Eigenschaften der
Konkurrenzhaftigkeit und der Ausschließbarkeit ökonomischer Güter, dann
besteht der allgemeine Vorrat oder insbesondere das alltägliche gesellschaftliche
Wissenskapital vor allem aus Wissen, das nicht wie ökonomische Waren durch
die Attribute Konkurrenzhaftigkeit (rivalry) und Ausschließlichkeit
(excludability) gekennzeichnet ist. Wissen dieser Art ist relativ leicht zugänglich,
läßt sich nicht monopolisieren, ist weiter verbreitet, kann ohne große Kosten
erworben werden und rückt demnach ganz in die Nähe von Waren und
Dienstleistungen, die man als Gemeingut kennzeichnen muß.
Eigentum und Wissen
In der Regel ist die tatsächliche Aneignung und die rechtliche Definition von
Eigentum dem Einzelnen oder einem Kollektiv vorbehalten und damit dem
allgemeineren Gebrauch entzogen, das heißt "eine Sache, an der ich
Eigentumsrecht habe, ist eine Sache, die nur ich benutzen darf" (Durkheim,
[1950] 1991:199).
Eine derartige Eigentumsbeschränkung ist im Fall von Wissen nur schwer zu
realisieren. Allerdings enthält das Rechtssystem bereits einige Normen, die
bestimmten Wissensformen exklusiven Status verleihen, und diese werden in
Zukunft sicherlich noch mehr werden. Was allerdings noch wichtiger ist: die
Fähigkeit, das Wissen um gewisse Wissensansprüche zu erweitern, die sich
darüber hinaus aller Wahrscheinlichkeit nach als praktisch vorteilhaft erweisen,
ist kein kollektives Eigentum. Mit anderen Worten, Wissen ist nicht gleich
9
Eigentum, hat aber unter bestimmtn Voraussetzungen Eigenschaften, die es in
die Nähe von Eigentum und Ware rücken lassen. Für eine rein wirtschaftliche
Betrachtung fehlen dem Wissen demnach die eindeutigen Attribute einer Ware
und dazu zählt in erster Linie die Tatsache, daß der "Verkauf" des Wissens keine
Änderung der Verfügungsgewalt herbeiführt, sie auch nicht einfach verdoppelt,
denn es ist keineswegs sichergestellt, daß der Kauf einen Weiterverkauf
ermöglicht.
Das Angebot von Wissen als Ware
Zu einem ganz anderen Ergebnis kommen anscheinend Charles Derber und seine
Kollegen in ihrer Analyse der gesellschaftlichen Macht der professionellen Berufe
in den U.S.A.. Wenn wir von der großen historischen Variabilität dessen, was als
Wissen gilt, ausgehen und damit vermuten, daß sich fast alles als gültiges Wissen
"verkaufen" läßt, solange Klienten und Kunden erfolgreich davon überzeugt
werden können, dass sie ein Bedürfnis nach einem bestimmten, von einer
Berufsgruppe kontrollierten Wissen haben und dieses Wissen dem alltäglichen
Wissen überlegen ist, nimmt "professionelles" Wissen die typischen
Eigenschaften des Konstruktes "Eigentum" an. Wissen wird zur Ware, da sowohl
die Ausprägung der Nachfrage (also des speziellen Bedürfnisses) als auch die
Strategien der Befriedigung der Nachfrage von den Anbietern kontrolliert
werden. Zu diesen Strategien gehört vor allem die Geheimhaltung oder
Privatisierung von Wissen. Das Verbot der (Berufs-)Ausübung ohne kollektive
Legitimation ist die wichtigste Strategie. In einer Art selbstgeschlossenem und
selbstüberwachtem Zirkulationsprozeß nimmt Wissen die Eigenschaft von Ware
an (vgl. Derber, Schwartz und Magrass, 1990:16-18).
10
Selbst wenn man unterstellt, daß es praktisch relativ leicht ist, Wissen zu
legitimieren und zu monopolisieren, so überschätzen Derber und seine Kollegen
die Passivität der Klienten und die Geschlossenheit der jeweiligen
Wissensfraternität. Noch schwerwiegender scheint mir die Tatsache, daß es die
Autoren in ihrer Untersuchung zum wiederholten Mal unterlassen, die
Wissensgrundlagen und die spezifischen Wissensansprüche der professionellen
Berufe konkret zu analysieren, und man sich mit relativ inhaltslosen, formalen
Attributen des Wissens dieser Berufsgruppe begnügt. Derber und seine Kollegen
tendieren dazu, Wissen als black box zu behandeln und konzentrieren sich damit
auf Attribute, die nicht so sehr mit den sozialen Attributen des Wissensangebots
selbst in Verbindung stehen, sondern vielmehr mit den Besonderheiten der
professionellen sozialen Beziehungen, wie zum Beispiel zwischen Arzt und
Patient, Rechtsbeistand und Klient. Derber, Schwartz und Magrass verleihen
diesen formalen Attributen einen Tauschwert, der letztlich auf jeden wie auch
immer gearteten Wissensanspruch zuzutreffen scheint; das Ganze läuft dann
schließlich auf eine Frage der Macht hinaus, mit der diese Berufe kognitive und
materielle Interessen durchsetzen können. Zum Beispiel ist nicht klar, warum
wissenschaftliche Erkenntnisse die Magie als Quelle der Macht abgelöst haben,
zumal beide im System Derbers funktionale Äquivalente sind. Wissen ist aber
nicht gleich Wissen.
Die sozialen Grenzen der Kommodifizierung von Wissen
Jede Analyse des sozialen Phänomens „Wissen als Ware“ muss von einem Satz
elementarer Prämissen ausgehen: Die Möglichkeit der Überwachung des Wissens
basiert auf der Annahme, daß zusätzliches Wissen sich nicht automatisch
realisiert, selbstschützend ist oder naturwüchsig nur den Mächtigen der
Gesellschaft zukommt.
11
Ist man dagegen davon überzeugt, die Realisierung des Wissens sei im Prinzip
garantiert, vielleicht sogar unvermeidlich, da eine Emanzipation der Erkenntnis
Teil der „Natur“ des emergenten Wissens sei, dann ist die Idee von
Eigentumsrechten an Wissen kaum sinnvoll. Die einzig sinnvolle Haltung Wissen
gegenüber, das keine Grenzen der Realisierung kennt, ist Anpassung an die
gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Folgen, die seine Anwendung
notwendigerweise produziert. Die zweite zu diskutierende Perspektive geht von
einer anderen, aber ähnlich weitreichenden Eigenschaft des Wissens aus,
nämlich der These, daß Erkenntnisse im Prinzip selbstschützend sind.
Wissen realisiert sich selbst
Soweit ich sehen kann, gibt es zwei parallele Argumentationsstränge, eine
statische und eine dynamische, die darauf hinauslaufen, daß sich Wissen – in
einem Fall weitgehend kontextunabhängig – eigen-sinnig realisiert, und dass
deshalb jede Form von Eigentumsrechten an Wissen, die auf eine Governance
des Wissens abzielt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Erstens lässt sich argumentieren, die Art der Verwertung des Wissens sei von
vornherein in die Wissensstruktur selbst eingebettet. Die Fabrikation der
Erkenntnis impliziere ihre Realisierung und verhindere somit jede Kontrolle der
Anwendung des Wissens. 9 Im Fall von technischen Artefakten wird unterstellt,
technische Entwicklungen kennzeichne a priori ein in ihnen fest verankertes
9 Ein weniger unmittelbarer Weg zur Selbstrealisierung von Erkenntnissen verweist, wie Brave (2001:3) dies am Beispiel der modernen Genetik tut, auf die Möglichkeit, daß „no matter what roadblocks might be placed in the way, the human genome is now and forever in our midst, and its manipulation will be difficult to simply prohibit. Neither the relatively small-scale technology required nor the individual or societal belief in biological benefits will be easily reined in by a regulatory body.”
12
Schicksal, das ambivalente, ja alternative Entwicklungsformen und somit
“interpretative Flexibilität” (Pinch und Bijker, 1984: 419-424) ausschließt.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die einst viel diskutierte
begriffliche Bestimmung unterschiedlicher (inhärenter) Erkenntnisinteressen der
Wissenschaften (Habermas, 1964); die oft unsichtbare Kategorie des technischen
Erkenntnisinteresses verweist darauf, dass solcherart fabrizierte Erkenntnisse
(oder Objekte) einen Drang zur Realisierung mit sich bringen, genauer, von
vornherein mit einem spezifischen Nutzen verbunden sind. Auf jeden Fall legt
dies die folgende Bestimmung des technischen Erkenntnisinteresses durch
Habermas ([1965] 1968: 157) nahe: „Erfahrungswissenschaftliche Theorien der
Wirklichkeit [erschließen] die Wirklichkeit unter dem leitenden Interesse an der
möglichen informativen Sicherung und Erweiterung erfolgskontrollierten
Handelns… Dies ist das Erkenntnisinteresse an der technischen Verfügbarkeit
über vergegenständlichte Prozesse.“ Eine andere Technologie und eine andere
(Natur-)Wissenschaft ist nicht denkbar. Die Grenzen von Theorie und Praxis
verblassen; in der wissenschaftlichen und der gesellschaftlichen Praxis kommt es
bzw. muss es zu einer Kopplung von Theorie und Praxis kommen. Und damit
wird die Gesellschaft tatsächlich zum Labor. 10
Zweitens bezieht sich ein weiterer Argumentationsstrang, der auf eine
weitgehend unvermeidliche Selbstrealisierung des Wissens verweist, nicht auf
10 Die Vorstellung, dass Theorie oder Wissen zur Anwendung drängt, ist älter. Man findet sie zum Beispiel in Studien, die sich der Legitimation wissenschaftlichen Arbeitens widmen; so schreibt zum Beispiel Karl Dunkmann (1929:7) über die Begründung der angewandten Soziologie: „Es existiert keine theoretische Forschung, die nur um ihrer selbst willen getrieben wird, die nicht zugleich auch ihre Anwendung in ihrem Schoß trägt. Ja, man kann ruhig einen Schritt weiter gehen und sagen, daß alle Theorie dem Motiv praktischer Wirkung überhaupt entspringt“ (siehe auch Lynd, 1939:ix).
13
bestimmte Eigenschaften des Wissens, sondern auf gesellschaftliche, kulturelle
oder ökonomische Handlungsumstände, die gewährleisten, daß Wissen trotz
möglicher Widerstände oder gesetzlicher Schranken immer auch genutzt wird.
Eine dynamischere Begriffsbestimmung der eigen-sinnigen Realisierung von
Wissen verweist auf Veränderungen in der Produktionsform von Erkenntnissen
in modernen Gesellschaften. Der vormoderne einschneidende Unterschied
zwischen Theorie und Praxis wird nicht nur immer fließender, sondern, so wird
argumentiert, verschmilzt zur Einheit.
Theoretisches und praktisches Wissen lassen sich kaum noch unterscheiden und
beide Formen sind gegenwärtig “fused in the very heart of science itself, so that
the ancient alibi of pure theory and with it the moral immunity it provided no
longer hold” (Jonas, [1976] 1979: 35). Hans Jonas rechtfertigt seine These von
der Konvergenz von Theorie und Praxis in der modernen Wissenschaft an Hand
von vier Überlegungen: (1) ein Grossteil wissenschaftlicher Erkenntnisse „lebt“
heute von der Rückkoppelung, die sie durch ihre technische Anwendung
erfahren; (2) Forschungsanreize und Fragestellungen der Forschung kommen
zunehmend aus der Praxis und werden von praktisch zu lösenden Problemen
angeregt; (3) die Wissenschaften verwenden als Instrument des
Erkenntnisgewinns moderne Technologien. Die Verbindung und gegenseitige
Beeinflussung von Technik und Wissenschaft sind symmetrisch; (4) Die Kosten
der wissenschaftlichen Infrastruktur können oft nur durch externe Finanzquellen
gedeckt werden, die wiederum eine Verzinsung ihrer Investitionen erwarten.
Zusammenfassend betont Jonas ([1976] 1979: 36), “it has come to be that the
14
tasks of science are increasingly defined by extraneous interests rather than its
own internal logic or the free curiosity of the investigator.” 11
All diese Beobachtungen von Hans Jonas and Anderen über die Konvergenz von
theoretischem und praktischen Erkenntnissen in der modernen Wissenschaft
bedeuten aber auch, daß eine Kontrolle und eine Regulierung des Wissens
undenkbar und praktisch unmöglich wird, sobald eine bestimmte Entdeckung
gemacht worden ist. Diese Entdeckung ist oder hat zugleich ein praktisches
Pendant. Dabei spielt es keine Rolle, ob wissenschaftliche Erkenntnisse aus
irgendeinem Grund in den Markt drängen oder sich dem Interesse bestimmter
korporativer Akteure nicht entziehen können, weil der im Wissen bereits
enthaltene praktische Nutzen sicherstellt, dass das, was man denken kann, auch
gemacht wird. 12
11 In Hans Jonas’ Konzept klingt an, was Michael Gibbons (1984) und seine Kollegen “ a mode 2 knowledge co-production” nennen. Sie argumentieren, dass sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine neue Form der Wissensproduktion herausschält, die vom Kontext bestimmt, auf das Problem ausgerichtet und interdisziplinär ist. 12 Zu den vielfältigen Beobachtungen, die eine mehr oder weniger automatische Realisierung von Erkenntnissen unterstellen und die ich an dieser Stelle nicht ausführlicher behandeln will, müssen auch Spekulationen gezählt werden, die von einem signifikanten Schrumpfungsprozeß des Zeitablaufs zwischen der Entdeckung und der praktischen Verwertung neuer Erkenntnisse ausgehen. Genauer formuliert, die Interpretation und die Transformation der Realität nähern sich zeitlich immer mehr an, sodaß die berühmte Metapher von Karl Marx, es komme jetzt darauf an, die Welt zu verändern, nicht sie zu interpretieren, hinfällig wird. Francis Fukuyamas Folgerungen über das Ende der Geschichte lassen einen vergleichbaren Schluß zu. Wenn sich die Geschichte nicht wiederholt und wenn es deshalb so etwas wie eine gradlinige, singuläre Entwicklungsrichtung der sozialen Evolution gibt, dann muß es zwangsläufig einen universell oder global gültigen Mechanismus geben, der dieses Ziel und den Weg zu diesem Ziel sicherstellt. Für Fukuyama (1992:72) kann es sich bei diesem Mechanismus unter der Vielzahl möglicher Ursachen nur um das Wachstum der Naturwissenschaften als Motor des säkularen Fortgangs der Geschichte handeln: „Scientific knowledge has been accumulating for a very long period, and has had a consistent if frequently unperceived effect in shaping the fundamental character of human societies.“ Unter diesen Umständen, so kann man folgern, ist die praktische Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse so etwas wie ein automatisch ablaufender und sich eindeutig durchsetzender Prozeß.
15
Wissen schützt sich selbst
In Rahmen meiner Diskussion, dass Wissen selbstschützend sei, möchte ich
zwischen zusätzlichem und alltäglichem oder allgemein vorrätigem Wissen
unterscheiden.
Die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, zusätzliches Wissen zu produzieren, ist
natürlich ein stratifizierter Prozeß ebenso wie die Möglichkeit, neues Wissen zu
realisieren und aus ihm wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. In Analogie zu dem
von Robert Merton ([1968] 1985:147-171) für das Wissenschaftssystem
formulierten Matthäus-Prinzip der stratifizierten Akkumulation von
Anerkennung gehen die Vorteile zusätzlichen Wissens mit großer
Wahrscheinlichkeit an diejenigen ökonomischen Akteure, die schon auf Grund
vorangegangener Erfindungen und Entdeckungen Vorteile genießen.
Zusätzliches Wissen findet sich eher in den Köpfen derjenigen, die von
disproportional inkorporierten kognitiven Fähigkeiten und “Wissensbeständen”
profitieren. Darüber hinaus sind die durch den Zugang zu zusätzlichem Wissen
gegebenen Wettbewerbsvorteile zeitlich begrenzt. Mit anderen Worten, man muß
sich der temporären Erfolge immer wieder dadurch versichern, dass man
zusätzliches Wissen fabriziert. 13
13 In der Definition wissensintensiver Unternehmen durch Starbuck (1992:716) klingen diese Beobachtungen über die Rolle von zusätzlichem Wissen an; er betont, dass es das außergewöhnliche und wertvolle Expertenwissen und nicht der Besitz von Wissen an sich sei, das eine wissensintensive Firma charakterisiert, denn “if one defines knowledge broadly to encompass what everybody knows, every firm can appear knowledge-intensive.” Allerdings werden durch diese relativ ambivalenten Umschreibungen die praktisch notwendigen Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Anwendung zusätzlichen Wissens notwendig sind, nicht genauer erfaßt.
16
Unter dem Gesichtspunkt der Eigenschaften der Konkurrenzhaftigkeit (rivalry)
und der Ausschließbarkeit (excludability) ökonomischer Güter betrachtet,
besteht der allgemeine Vorrat an Wissen oder insbesondere das alltägliche
gesellschaftliche Wissenskapital vor allem aus Wissen, dem genau diese Attribute
fehlen. Wissen dieser Art ist relativ leicht zugänglich, läßt sich nicht
monopolisieren, ist weit verbreitet, kann ohne große Kosten erworben werden
und rückt demnach ganz in die Nähe von Waren und Dienstleistungen, die man
als Gemeingut kennzeichnen muß. 14 Sein Gebrauch durch einen Akteur schließt
nicht die Verwendung durch einen anderen Akteur aus; und es ist
unwahrscheinlich, daß mehrere Akteure um den Gebrauch konkurrieren.
Darüber hinaus gilt sicher, dass der gesellschaftliche Fundus an Wissen selbst auf
Grund bestimmter rechtlicher Normen, anderer Regeln oder der Tatsache, dass
Wissen in bestimmten Apparaturen verankert ist, seine Verwendung (seinen
Gebrauch) durch Andere niemals ganz ausschließen kann. Andererseits gibt es
kein prinzipielles Hindernis, etwa in Form einer der wissenschaftlichen
Erkenntnis inhärenten Eigenschaft, daß wissenschaftliches Wissen zu einer Ware
wird. Die Schwierigkeiten, im Tausch am Markt Erlöse oder angemessene
Renditen aus dem Verwenden von Wissen zu realisieren, sind anscheinend ein
Grund für das Zögern des Privatsektors, in die Fabrikation von neuen
Erkenntnissen zu investieren oder sich in der Bereitstellung von Wissen zu
engagieren.
14 Diese Eigenschaft von bestimmten Wissensformen hat zur Folge, daß sich die ursprünglichen “Kosten” der Fabrikation des Wissens von den Vorteilen seiner Verwendung abkoppeln lassen. Damit gehen die ökonomischen Anreize, in die Produktion von Wissen zu investieren, natürlich zurück (siehe Dosi, 1996:83). Geroski (1995:94-100) legt verschiedene Strategien dar, die bei der Überwindung des Problems, ob zusätzliches Wissen angebracht ist oder nicht, eine Rolle spielen könnten.
17
Die Weltbank (1999:17) stellt deshalb in einem ihre Berichte fest, dass, sofern
diese Eigenschaften des Wissens zutreffend beschrieben sind, es notwendig sei,
sich auf Interventionen der öffentlichen Hand zu verlassen, „to provide the right
incentive for its creation and dissemination by the private sector, as well as to
directly create and disseminate knowledge when the market fails to provide
enough.” Die Idee von der Notwendigkeit einer fördernden, intervenierenden
Rolle der Politik, Anreize und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist jedoch
nicht nur auf den Kontext der Produktion und der Verbreitung des Wissens als
öffentliches Gut beschränkt, sondern läßt sich auch auf den Fall der restriktiven
Regulierung von Erkenntnissen, die relativ leicht zirkulieren und zugänglich sind,
ausweiten. Allerdings ist die Durchführung politischer Maßnahmen, die auf
Wissen als “reines” öffentliches Gut zielen, schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
Zusätzliches Wissen dagegen ist sehr viel wahrscheinlicher konkurrierendes und
sich gegenseitig ausschließendes Handlungsvermögen.15 Wäre dem nicht so,
15 Michel Callon (1994: 406-407) ist der Überzeugung, wissenschaftliche Erkenntnisse seien insgesamt kein öffentliches Gut, zumindest nicht im Sinn der ökonomischen Begriffsbestimmung der Eigenschaften eines Gemeingutes. Vor allem fällt ihm die besondere Leichtigkeit auf, mit der wissenschaftliches Wissen im Vergleich zu anderen Waren (unfreiwillig) “monopolisiert” werden kann, und wie schwer es ist, zumindest im Wissenschaftsbetrieb, die Bedingungen dafür zu schaffen, daß andere Personen überhaupt Interesse an „neuen Erkenntnissen“ zeigen. Er fügt hinzu, wie ich schon betont habe, “scientists worldwide know through their experience that the difficulty lies not so much in preventing their colleagues from reading what they write, but in convincing them that they should read it.” Inwieweit wissenschaftliches Wissen appropriierfähig und konkurrenzhaftig ist, hängt, wie Callon betont, ab von „strategic configurations of the relevant actors, of the investment that they have already made or are thinking of making. Insofar as they both can be seen as commodities, there is no difference between a Ford Taurus and the general theory of relativity.” Bell (1976:176) schlägt eine, wie er es kategorisiert, “utilitaristische” Begriffsbestimmung von Wissen vor, die diese Überlegungen über die grundsätzliche Ausschließlichkeit von Wissensansprüchen widerspiegelt, obschon er sich auf „objektives“ Wissen zu beziehen scheint: “Knowledge is that which is objectively known, an intellectual property, attached to a name or group of names and certified by copyright or some other for of social recognition (e.g. publication).”
18
wird häufig argumentiert, ließe sich nur schwer erklären, warum sich große und
kleine Industrieunternehmen dazu entschließen, Mittel in die Forschung und
Entwicklung zu investieren oder Wissen bzw. Organisationen, in denen Wissen
produziert wird, zu privatisieren. In vielen Fällen ist die Produktion von
zusätzlichem Wissen kaum ein billiges Unterfangen, berücksichtigt man zum
Beispiel mittelbare Ausgaben, die für das erforderliche symbolische, menschliche
und physische Kapital gemacht werden müssen ebenso wie für die kommerzielle
und öffentliche Infrastruktur, die die Organisation nicht selbst kontrolliert
(schulische Einrichtungen, Büchereien, Verlage, Medien etc.). Zusätzliches
Wissen wird in Verbindung mit und eingebunden in Human- und Sachkapital
produziert. Die Produktion, Transferierung, Anwendung und Rekonfiguration
von Wissen verursacht also nicht selten erhebliche Kosten und erfordert eine
unter Umständen sehr teure Infrastruktur. 16
Insofern konventionelle ökonomische Güter konkurrenzhaftig und ausschließend
sind, ähnelt zusätzliches Wissen herkömmlichen zirkulierenden Waren, die einen
Gebrauchswert haben. Da dieses Wissen aber häufig in sozialen Kontexten
generiert wird, die explizit der Idee bzw. dem Ethos des kollektiven Eigentums
verpflichtet sind, kann man kaum mit Sicherheit davon ausgehen, daß
insbesondere die im Wissenschaftssystem fabrizierten Wissenszuwächse in der
Regel wie eine konventionelle Ware mit Eigentumsvorbehalt behandelt
16 Es lohnt sich zum Beispiel, wirtschaftlich argumentiert, wohl kaum, den durch Copyright-Gesetze geschützten redaktionellen Inhalt von traditionellen Zeitungen zu stehlen. Ein Diebstahl dieser Art würde sofort als solcher erkannt werden und der technische und finanzielle Aufwand und die umfassende Verbreitung eines daraus entstehenden Produktes würde sich vor allem nicht rechnen. Selbst nach der Erfindung der Kopiermaschine kostete die Kopie eines einzelnen Zeitungsartikels oft mehr als das gesamte Zeitungsexemplar. Die Tatsache des Copyright-Schutzes hat in diesem Kontext zwar eine gewisse Bedeutung, allerdings macht der technisch-wirtschaftlich begründete Aufwand des Kopierens den eigentlichen Selbstschutz der Information aus (siehe DeLong, 2009).
19
werden.17 Im Gegensatz zu den neoklassischen Prämissen ökonomischen
Diskurses gilt darüber hinaus, dass der Preis einer zusätzlichen, derivativen
Einheit wissensintensiver Waren und Dienstleistungen mit steigendem
Produktionsausstoß fällt und somit "progress[es] down the learning curve" bzw.
das Ergebnis erfolgreicher Lernprozesse ist. 18
Die These vom sich selbst schützenden Wissen hat eine Nachfrage- und
eine Angebotsseite (siehe Kitch 1980:711-715):19 Wissen ist äußerst schwer zu
stehlen bzw. kaum jemand hat ein Interesse am Diebstahl von Wissen, da es
mühsam ist, von Wissen zu profitieren. 20 Die Schwierigkeit, Wissen mitgehen
zu lassen und von gestohlenem Wissen zu profitieren, um die es hier geht, soll
nicht auf den relativ einfachen Fall der mit Wissen verbundenen
Eigentumsrechte wie Patente oder das Copyright verweisen,21 die einer
17 Vergleiche in diesem Zusammenhang auch die lesenswerte Auseinandersetzung Romers (1990a und 1990b) mit den Begriffen der Konkurrenzlosigkeit von Waren bzw. der konkurrierender Güter. 18 Beide Theorien, die sogenannte Evolutionstheorie des Wirtschaftswachstums (z.B. Romer, 1990a) und die neue Theorie des internationalen Handels (z.B. Krugman, 1990, 1991), gehen davon aus, daß als Folge von Investitionen in Wissen die Profite eher steigen als zurückgehen, wenn das Produktionsvolumen zunimmt. Mit anderen Worten, Wissen ist nicht einem sinkenden Grenzertrag ausgesetzt. 19 Die These von den möglicherweise selbstschützenden Eigenschaften des modernen Wissens fragt nicht in erster Linie nach bestimmten inhärenten Charakteristiken der Erkenntnis, die es etwa zu einem privaten Gut machen (dies mag besonders in früheren Jahrhunderten der Fall gewesen sein, als wissenschaftliche Erkenntnisse gegenüber Laien schon dadurch sozusagen automatisch geschützt waren, daß Wissen in einer den Wenigsten zugänglichen Sprache formuliert war), sondern verweist auf kontextabhängige, institutionelle Attribute, die einer einfachen Verbreitung des Wissens entgegenstehen. Dazu gehört in der modernen Gesellschaft auch der Zugang zum Bildungssystem und seinem intellektuellen Kapital. 20 Die Betonung essentieller, impliziter Attribute von Wissen etwa im Sinn des von Michael Polanyi (1967, 1958) geprägten Begriffs des tacit knowledge macht allerdings auch darauf aufmerksam, daß eine Zirkulation von “Wissensarbeitern” (von Firma zu Firma) den firmeneigenen Schutz gegen eine “mißbräuchliche” Verwendung von Wissen erheblich erschweren mag (siehe Cowan, David und Forey, 1999:7). 21 Sich mit Urheberrechten befassende Gesetzesvorschriften sind ein Abkömmling der Industriegesellschaft (siehe Ryan, 1998). Ihre Entstehung verdanken sie der Druckpresse, deren Erzeugnisse sie schützen sollten. Sie basieren auf der Annahme, daß neues Wissen nur in Kontexten generiert wird, in denen der Schöpfer zusätzlicher
20
unkomplizierten Verbreitung von Wissen und der Möglichkeit, damit Gewinn zu
erzielen, entgegenstehen mögen.22
Auf der Angebotsseite verweist das sich selbst schützende Wissen auf die
Erfordernis, daß die Nutzung des Wissens eng mit der Fähigkeit verbunden ist,
knappe, aber auch schwer artikulierbare kognitive Fähigkeiten zu mobilisieren.
Die Schwierigkeit, Wissen (sekundär) zu nutzen bzw. es zu transportieren (von
Hippel, 1994), wächst mit der Art und Weise seiner Organisation.23 Gleichzeitig
signalisiert der Selbstschutz, daß dieses Wissen in spezifischen Kontexten,
beispielsweise einer bestimmten Wissens-Infrastruktur wie etwa der Fähigkeit,
das Lernen zu lernen (siehe Stiglitz, 1986), verankert ist und weder frei
zirkulierbar noch einfach rekonstituierbar ist bzw. daß man den Zugang zu
Wissen relativ effizient kontrollieren kann. 24 intellektueller Leistungen sicher sein kann, daß seine Produkte einen ökonomischen Vorteil bringen (siehe Machlup, 1968; Hirshleifer, 1971; Steevens, 2000:230-231). In Wissensgesellschaften dagegen gibt es in zunehmendem Maße Situationen und Bedingungen, in denen Innovationen nur deshalb gedeihen, weil neues Wissen großzügig geteilt und nicht monopolisiert wird. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, daß die Gesamtheit der formellen und informellen Regeln der Patentierung und des Urheberrechts von intellektuellem „Eigentum“ in wissensbasierten Ökonomien zunehmend auf dem Prüfstand stehen wird (siehe auch Miles, Andersen, Boden und Howells, 1999, David, 2000a). 22 Cohen, Nelson und Walsh (2000) haben die spezifischen, im amerikanischen Herstellungssektor üblichen Abwehr- oder Schutzmaßnahmen gegen einen vorzeitigen Verlust des durch Erfindungen entstandenen wirtschaftlichen Nutzens untersucht. Sie kommen zu dem Schluß, daß sich Firmen vorrangig nicht auf die Gewährung von Patenten verlassen, sondern auf Geheimhaltung und den gewonnenen zeitlichen Vorsprung. 23 Organisationsformen des Wissens helfen, Wissen zu schützen: Wie Kitch (1980: 712) zum Beispiel unterstreicht, “managers can avoid increasing the ease with which information can be transmitted by resisting the temptation to assemble the information in organized written form.” 24 Der von Eric von Hippel (1991, 1994) geprägte Begriff der “sticky information” verweist auf den gleichen Tatbestand. Implizite, nur schwer transferierbare Wissensbestände (tacit knowledge), kognitive Fähigkeiten und Erfahrungen reduzieren die Mobilität von Wissen, erleichtern seine Kontrolle und reduzieren die Notwendigkeit für umfassende Rechtsnormen zum Schutz dieser Wissensformen (vgl. auch Polanyi, 1958, 1967; Cowan, David und Forey, 1999:6-7). Antonelli (1999:244) wiederum verweist auf strukturelle oder kulturelle Prozesse und argumentiert, es sei insbesondere das technische Wissen, das kontextabhängig sei; denn technisches Wissen „tends to be
21
Die selbstschützenden Charakteristika der Erkenntnis auf der
Nachfrageseite mögen Prozesse sein, die mit Eigenschaften bzw. mit der
Verwendung von Wissen zutun haben wie zum Beispiel die hohe Wertminderung
des Wissens. Letzteres bedeutet, daß erworbenes Wissen in Relation zu den
Kosten des Erwerbs und zukünftiger Erträge schnell an Wert einbüßt. Darüber
hinaus kann im Zusammenhang mit bestimmten Wissensformen gelten, daß die
mit dem Wissen verbundenen Eigentumsrechte ähnlich wie im Fall eines
berühmten Gemäldes oder eines sehr seltenen Buches wie der Gutenberg Bibel
von Anderen unschwer zurechenbar sind und deshalb in erster Linie für den
Eigentümer von Wert sind. Man kann möglicherweise den Grad der „Abnutzung“
von Wissen und Informationen beschleunigen, indem man sich entsprechend der
Information verhält. Folgt man beispielsweise dem Ratschlag, ein bestimmtes
Wertpapier zu kaufen, so mag dieses im Anschluß daran nicht unbedingt mehr
preiswert sein. Ein hoher Abnutzungsgrad des Wertes von Informationen
impliziert, daß “by the time someone steals the information it is worthless which
in turn means there is no incentive to steal it” (Kitch, 1980: 714).
Die mit dem Diebstahl von Wissen verbundenen Schwierigkeiten können
auch dafür verantwortlich sein, daß es dem Dieb kaum gelingen mag,
entsprechende kognitive Kompetenzen manifest zu machen, die es ihm erlauben,
glaubwürdig zu versichern, daß das von ihm zum Kauf angebotene Wissen auch
„echt“ und effizient ist. Schließlich läßt sich anführen, daß insbesondere
zusätzliches Wissen knapp ist. Jede Verbreitung oder „Bekanntmachung“ des
Wissens oder auch nur die Ankündigung einer Reduktion der Zugangschancen
vermindert mit hoher Wahrscheinlichkeit den Wert des Wissens bzw. den
localized in well-defined technical, institutional, regional and industrial situations. It is specific to each industry, region and firm and consequently costly to use elsewhere. The localised character of technical knowledge increases its appropriability but reduces its spontaneous circulation in the economic system.“
22
Anreiz, dieses Wissen zu erwerben. Der Wert der Information oder des Wissens
löst sich sozusagen selbst auf. Die potentielle Wertminderung des Wissens, von
der hier die Rede ist, läßt sich mit größerer Wahrscheinlichkeit vor allem unter
den Bedingungen eines Marktes oder im sozialen Kontext konkurrierender
Akteure beobachten.
Daß diese Schwierigkeiten dem Wissen selbstschützende Eigenschaften
verleihen, macht zugleich deutlich, daß Wissen in ein kulturelles und
strukturelles „Netzwerk“ eingebunden ist. Die Koppelung des Wissens an
bestimmte soziale Gegebenheiten beeinflusst seine Mobilitätschancen und
Migrationsmöglichkeiten.
Aus der Beobachtung, daß Wissen selbstschützend ist, daß es effizient
geschützt werden kann oder daß es Eigenschaften hat, die relativ
mobilitätshemmend sind, kann man bestimmte Folgerungen für den Versuch
ableiten, Wissen politisch zu regulieren. Denn wenn es zutrifft, daß Wissen sich
weitgehend selbst schützt, müßte die Wissenspolitik nur auf denjenigen
Personenkreis zielen, der das fragliche Wissen kontrolliert und allenfalls
marginale zusätzliche Anreize schaffen, die zum Beispiel eine Verbreitung bzw.
Anwendung des Wissens behindern (ein Beispiel wäre die
Präimplantationsdiagnose).
Erkenntnisse werden überflüssig
Es gibt eine weitere erwähnenswerte Überlegung, die andeutet, daß
wissenspolitische Maßnahmen unnötig bzw. überflüssig werden. Ich beziehe
mich damit auf die Möglichkeit, daß Wissen durch neues Wissen redundant wird.
Es erschöpft sich zwar nicht (man kann zum Beispiel die Ideen von Max Weber
unendlich oft verwenden, ohne daß sie sich dadurch wie eine knappe Ressource
verbrauchen) und es unterliegt damit auch nicht der von Garrett Hardin
23
beschworenen „Tragödie der Allmende“. Neu entdeckte Handlungsmöglichkeiten
können aber bisher geltende Handlungsmöglichkeiten ablösen. Eine Kontrolle
der obsoleten Handlungsmöglichkeiten wird damit hinfällig.25 Das objektiv
vorhandene gesellschaftliche Wissen besteht in der Tat zu einem nicht
unerheblichen Teil aus überflüssig gewordenem Wissen, zum Beispiel in den
Handwerksberufen, im Transportwesen oder der Medizin.26 Sozial obsoletes
Wissen bedarf keiner Regulierung und Kontrolle. Es ist in der Tat
bemerkenswert, wie rapide sich das öffentliche Interesse an intensiv und äußerst
strittig geführten Diskussionen über konkrete Aspekte der Wissenspolitik
verringert und Öffentlichkeit und Medien sich auf andere Themen konzentrieren.
Das Karriereende bestimmter Themen hat viele Ursachen einschließlich einer
erfolgreichen Regulierungspolitik oder der von Verfechtern der Anwendung von
25 Dies würde auch dann gelten, wenn man unterstellt, daß in einem bestimmten sozialen Kollektiv Wissen insgesamt ein essentiell öffentliches Gut ist; denn dies würde heißen, daß Mitglieder dieses Kollektivs nicht von der Nutzung des Wissens ausgegrenzt werden dürfen (vorausgesetzt, daß es legitime Wege gibt, Außenseiter vom Nutzen des Wissens auszuschließen). In einem solchen, sehr idealtypischen Fall wäre Wissenspolitik ebenfalls unnötig oder redundant (siehe Cerny, 1999:95-102). Es sind in der Regel ökonomische Gesichtspunkte oder Interessen, die bestimmen, was ein öffentliches Gut ist. Aus normativer oder politischer Sicht dagegen, sind es Güter, die in der Annahme der Bevölkerung öffentlich sein sollten.
26 Ich habe schon auf eines der aktuellen Beispiele der Redundanz von Wissenspolitik als Ergebnis der Wissensentwicklung verwiesen: Die Entdeckung vielseitiger (noch vielseitiger als bisher angenommen) adulter Stammzellen, die die Verwendung von embryonalen Stammzellen in der Forschung und in der Therapie überflüssig machen könnte (siehe „Scientists herald a versatile adult cell,“ New York Times, 25. Januar 2000). In einem im Herbst 1999 für den amerikanischen Präsident verfaßten Bericht fällt die U.S. National Bioethics Advisory Commission (1999:ii) ein sehr viel zurückhaltenderes Urteil über das Potential von adulten Stammzellen. Sie unterstützt zwar eine Weiterführung der Forschung an adulten Stammzellen, da Forschungsvorhaben dieser Art keine ethischen und rechtlichen Probleme oder Restriktionen mit sich bringen, betont aber gleichzeitig, da „important biological differences exist between embryonic and adult stem cells they should not be considered an alternative to ES [embryonic stem cells] or EH [embryonic germ cells] cell research.“
24
Erkenntnissen geleisteten Überzeugungsarbeit, dass gegnerische Bedenken
unangemessen seien.27
Allerdings ist eine „passive“ Wissenspolitik, die auf die Eigendynamik der
Entwicklung des Wissens vertraut, daß nämlich viele Wissensformen über kurz
oder lang überflüssig werden und deshalb eine zurückhaltende regulative
Wissenspolitik angebracht sei, sicher nicht besonders effektiv. Darüber hinaus ist
ein aktives, geplantes Überflüssigwerden von Wissen vorstellbar, etwa in Form
von globalen Vereinbarungen, auf den Gebrauch von bestimmten
Handlungsmöglichkeiten, z.B. Waffen, zu verzichten. Allerdings ist eine geplante
Ächtung spezifischer Handlungsmöglichkeiten nichts anderes als Wissenspolitik.
27 Susan Wright (1986b) beschreibt und analysiert den in den siebziger Jahren entstehenden Konsensus unter Molekularbiologen über die von ihnen potentiell als „gering“ eingestuften Sicherheitsrisiken der rekombinanten DNA-Forschung. Die organisierte Verteidigung der DNA-Forschung durch die Molekularbiologen leistete einen wesentlichen Beitrag zur Beruhigung der Öffentlichkeit und der Politik und war entscheidend für die Vermeidung externer und restriktiver Regulierungsmaßnahmen. Heinz Theisen (1991:112-116) hat die deutsche Diskussion über den wissenschaftlichen, politischen und kommerziellen Umgang mit der Bio- und Gentechnologie bis Anfang der neunziger Jahre zusammengefaßt (siehe auch Jasanoff, 1985),
25
Literatur
Arrow, Kenneth J. (1996), “The economics of information: an exposition,” Empirica 23:119-128. Bates, Benjamin J. (1988), "Information as an economic good: Sources of individual and social value." S. 76-94 in Vincent Mosco und Janet Wasko (Hrsg.), The Political Economy of Information. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press. Bell, Daniel ([1979] 1991), "Liberalism in the postindustrial society." S. 228-244 in Daniel Bell, The Winding Passage. Sociological Essays and Journeys. Neu eingeleitet von Irving Louis Horowitz. New Brunswick, NJ: Transaction Books. Boulding, Kenneth (1966), "The economics of knowledge and the knowledge of economics." American Economic Review 56: 1-13. *Boyle, James (2002), “Fencing off ideas: enclosure & the disappearance of the public domain,” Daedalus 131 (2): 13-25. Braithwaite, John (2007), “Can regulation and governance make a difference?,” Regulation & Governance 1:1-7. Braithwaite, John und Peter Drahos (2000), Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge University Press. Brave, Ralph (2001), “Governing the genome,” The Nation, December 10, 2001. Callon, Michel (1994), “Is science a public good?,” Science , Technology, & Human Values 19: 395-424. Carolan, Michael S. (2008), “Making patents and intellectual property work. The asymmetrical ‘harmonization’ of TRIPS,” Organization & Environment 21:295-310. DeLong, James V. (2009), “Preparing the obituary,” The American. A Magazine of Ideas –Online at American.com. March 3, 2009. Derber, Charles, William A. Schwartz und Yale Magrass (1990), Power in the Highest Degree. Professionals and the Rise of a New Mandarin Order. New York: Oxford University Press. Dewey, John (1948), “Common sense and science: their respective frames of reference,” Journal of Philosophy 45:197-208. Dunkmann, Karl (1929), Angewandte Soziologie. Probleme und Aufgaben. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. Durkheim, Emile ([1950] 1991), Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
26
*Eisenberg, Rebecca S. und Richard R. Nelson (2002), “Public vs. proprietary science: a fruitful tension?,” Daedalus 131 (2): 89-101. *Etkowitz, Henry (1994), Knowledge as property: the Massachusetts Institute of Technology and the debate over academic patent policy,” Minerva 32:383-421. Fukuyama, Francis (1992), The End of History and the Last Man. New York: Free Press. *Garmon, Cecile W. (2002), “Intellectual property rights,” American Behavioral Scientist 45:1145-1158. Gibbons, Michael; Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, & Martin Trow (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage. Habermas, Jürgen ([1965] 1968), “Erkenntnis und Interesse,“ in Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 146-168. Habermas, Jürgen (1964), “Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung – Zur Theorie und Praxis in der wissenschaftlichen Zivilisation,“ in: Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Neuwied: Luchterhand, S. 231-257. Hardin, Garrett (1968), “The tragedy of the commons,” Science 162:1243-1248. *Hesse, Carla (2002), “The rise of intellectual property, 700 B.C. – A.D. 2000: an idea in the balance,” Daedalus 131 (2): 26-45. Holzner, Burkart und John H. Marx (1979), Knowledge Application: The Knowledge System in Society. Boston: Allyn and Bacon. Jonas, Hans ([1976] 1979), “Freedom of scientific inquiry and the public interest,” in: Keith M. Wulff, (Hg.), Regulation of Scientific Inquiry. Societal Concerns with Research, Boulder: Westview Press, S. 33-39. *Judge, Elizabeth F. (2007), “Intellectual property law as an internal limit on intellectual proerty rights and automomous osurvce of liability for intellectual property powners,” Bulletin of Science, Technology & Society 27:301-313. Kevles, Daniel J. (2002), “Of mice & money: the story of the world’s first animal patent, Daedalus 131 (2): 78-88. Lessig, Lawrence (2004), Free Culture. The Nature and Future of Creativity. New York: Penguin. Lynd, Robert S. (1939), Knowledge for What? Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Meier, Henk Erik (2005), “Wissen als geistiges Privateigentum,” Leviathan 33:492-521.
27
May, Christopher (2002a), “Unacceptable costs: The consequences of making knowledge property in a global society,” Global Society 16:123-144. May, Christopher (2002b), “Trouble in e-topia: knowledge as intellectual property,” Urban Studies 39:1037-1049. Merton, Robert K. ([1968] 1985), “Der Matthäus-Effekt in der Wissenschaft,” in: Robert K. Merton, Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Mit einer Einleitung von Nico Stehr. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.147-171. North, Douglas (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. Pinch, Trevor und Wiebe Bijker (1984), “The social construction of facts and artifacts: or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other,” Social Studies of Science 14: 399-441. Posner, Richard A. (2002b), “The law & economics of intellectual property,” Daedalus 131 (2): 5-11. *Rosell, Carlos und Ajay Agrawal (2009), “Have university knowledge flows narrowed? Evidence fronm patent data,” Resaearch Policy 38:1-13. Sell, Susan und Christopher May (2001), “Moments in law: contestation and settlement in the history of intellectual property,” Review of International Political Economy 8:467-500. Simmel, Georg ([1907] 1989), Philosophie des Geldes. Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Stehr, Nico (2007), Die Moralisierung der Märkte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Stiglitz, Tyfield, David (2008), „Enabling TRIPs: the pharma-biotech-university patent coalition,“ Review of International Political Economy 15:535-566. *Vaver, David (1990), “Intelelctual property today: of myths and paradoxes,” The Canadian Bar Review 69:98-128. Waldron, Jeremy (1993a), “Property, justification and need,” Canadian Journal of Law and Jurisprudence 6:185-215. Waldron, Jeremy (1993b), “From authors to copiers: individual rights and social values in intellectual property,” Chicago-Kent Law Review 68:841-887. World Bank (1999), World Development Report. Knowledge for Development, New York: Oxford University Press.