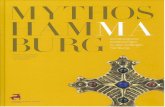Spätpaläolithische Widerhakenspitzen aus dem Heimatmuseum in Friesack, Lkr. Havelland....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Spätpaläolithische Widerhakenspitzen aus dem Heimatmuseum in Friesack, Lkr. Havelland....
VeröffentlichungendesBrandenburgischenLandesmuseumsfür Ur- und Frühgeschichte· Band 33 ·Seite 51-63
Erwin Cziesla, Stahnsdorf
Spätpaläolithische Widerhakenspitzen aus dem
Heimatmuseum in Friesack, Lkr. Havelland
Vorgestellt werden Funde von Pritzerbe, Stadt Brandenburg, die aus der Sammlung Stimming in das Heimatmuseum Friesack gelangten und dort nach Kriegsende verloren gingen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen drei einreihige und drei zweireihige Widerhakenspitzen des Spätpaläolithikums. Sie können nach einer schematischen Publikation der 1930er Jahre und unter Zuhilfenahme einer Fotografie zeichnerisch rekonstruiert werden. Dar an schließt sich eine Diskussion des derzeitigen Forschungsstandes zu Verbreitung, Datierung und kultureller Zuordnung dieser Geräte an.
This paper treats a number of finds from the Stimming collection, which originate from the Pritzerbe district of Brandenburgcity and had come to the Heimatmuseum Friesack before they went lost after the end ofWorld War I!. Highlighted are three uniserially barbed and three biserially barbed harpoons from the Late Palaeolithic. They were reconstructed in a drawing after a sketchy publication and a photograph from the nineteen thirties. A discussion follows on the actual state of research relating to the spread, dating and cultural affiliation of the artefacts.
Einleitung
Beschäftigt man sich mit dem Spätpaläolithikum des H avellandes und dort speziell mit den ein- und zweireihigen Widerhakenspitzen, so stößt man zwangsläufig einerseits auf Vater und Sohn Stimming, andererseits auf den Fundort Pritzerbe, nördlich der Stadt Brandenburg gelegen. Vater und Sohn Stimming hatten zwischen ca. 1880 und 1920 eine sehr umfangreiche Sammlung spätpaläolithischer und mesolithischer Funde aus Geweih und Knochen aus diversen Tongruben des Havellandes zusammengetragen (vgl. hierzu Cziesla 2000 a) und verschiedenen Museen übergeben. Dabei war Material an das Museum für Vor- und Früh-0eschichte, Schloss Charlottenburg in Berlin verkauft worden, der Rest gelangte in das heutige Kreismuseum Jerichower Land nach Genthin. Aber auch weitere .\luseen wurden beschenkt, sodass sich die gesamte
ammlung weiträumig verteilte (Engel 1928). Jenen Funden, die so zu Beginn des letzten Jahrhunderts in das Heimatmuseum nach Friesack gelangten, sei dieser _\rtikel gewidmet.
Fundbericht
Z nächst sei der Fundbericht, der aus der Feder von Jfax Schneider stammt, referiert, wobei darauf hinge-;1,·iiesen sei, dass eine objektive Berichterstattung nicht ·..:.nbedingt das Kennzeichnen der Schneidersehen Be:-i hte ist (vgl. hierzu kritisch Gramsch 1959/60, Anm. : -). Der Lehrer und Heimatforscher Schneider
schreibt ausführlich zum Fundplatz Pritzerbe: "Besonders interessant sind die Verhältnisse vom Pritzerber See, weil hier die meisten Funde gemacht wurden. Meine Auskunft stammt von dem 72-jährigen Baggermeister Sehröder in Pritzerbe, der viele Jahre von 1886- 1905 die Baggerarbeiten dort geleitet hat. Fast sämtliche Funde sind in seiner Anwesenheit gemacht und von ihm an Dr. Stimming, Dr. Lau, Stein und den Oberförster SchuBe in Seelensdorf weitergegeben worden. Nach ihm ist der Pritzerber See Eigentum von 10 Fischern in Pritzerbe, die für seine Ausbeutung zu Ziegeleizwecken für je 1000 Steine 1 Mark erhielten. Die Firma Rudolph Schwarz & Co. ließ die Baggerarbeiten ausführen. Sie wurden in der Ausbuchtung des Sees vorgenommen, die 3 Vz cm südlich unter der Zahl 28 auf der geologischen Karte Blatt Plaue 44/31 zwischen Ferchesar und Fohrde liegt. In dieser Fohrder Lanke stand das Seewasser im allgemeinen 1 Vz m hoch. Darunter folgte 1-1 Vz m mergeliger Faulschlamm, und unter ihm lag ein blaugrauer, ganz weicher Havelton, von etwa 2 Vz m Mächtigkeit in der Mitte, der in Kesseln von 10- 15 m Dm. nach den Seiten bis zu 1 Fuß Stärke auskeilte. Fast sämtliche Funde sind in dieser Fohrder Bucht oder Lanke, da wo die Binsen stehen, gemacht worden. Sie befanden sich am Grunde der Havelschlammschicht, dicht auf oder im Ton. Es wurden gefunden: mehr als 100 Harpunen von Magdal. Typus, Knochen-Speerspitzen, Menschenschädel, Pferdeschädel, angeblich auch Mammutknochen. Die Menschenschädel hat neuerdings 0. Reche in seiner sehr eingehenden Studie
J
I )
("- .. / ·----.
500
'-" ··-·· .-""<\
I
/ /
.... .. \..
// 11111 ) .·Hohen-
\ , ~~~rr~ITIJiiTr \..... 28"
--- .. .. /
1000m
Abb. 1: Die nach N bzw. NW abfließende Havel mit dem Pritzerber See und den Gemeinden Pritzerbe, Fohrde und Hohenferchesar, alle durch spätpaläolithische und mesolithische Funde bekannt. Die hier vorgestellten Funde stammen aus dem Bereich der Seeausbuchrung
zwischen Fohrde und Hohenferchesar (Kreuzschraffur)
untersucht (1928); sie sind nach ihm die ältesten Menschenfunde N-Europas. An derselben Stelle im See fand sich auch das Stirnbein eines anscheinend dolichokephalen Kinderschädels, das Dr. Lau in Brandenburg besitzt. Seine Sammlung enthält noch andere Fundstücke, die in der Nähe dieses Schädelrestes zum Vorschein gekommen waren,
' z.B. 2 schwarze und 2 hellbraune Speerspitzen vom Ren oder Elch, 2 einreihige Harpunen mit Rille und ein Fischschuppenmesser. Außerdem eine Schaufel vom Cervus elaphus. Die übrigen Funde von hier sind
nach allen Richtungen hin zerstreut worden. Die meisten Stücke erhielten D r. Stimming und Stein. In der Sammlung von Stimming liegen allein von dieser Seebucht 60 Stücke solcher Altertümer jeglicher Art, wovon etwa 1 Stück sicher vom Ren sein sollen. 25 H arpunen und 1-t andere Knochengeräte von hier besitzt die Vorge eh. Abt. der Staatsmus. zu Berlin und 6 besonders schöne ein- und ZKeireihige Magdal. Harpunen, 5 feinaezähm e. einen großen Angelhaken und 2 Speerspitzen aus Iillo -h n das Yluseum in Friesack" (Schneider 193_. _: 9 i . .
1 l r .E 1' a z
SJ Si V <
SC
Fl sp nt C;
fe1 au scl (C W; Fu un
ma wu ren He \\LI
).1u
järu em< H ei ).1u.
krie Kau ~]
haw don aud -I .A1 Gm nod en.
nur ·.·on _ gern ~-i h
Hier sei ergänzend erwähnt, dass die von Reche (1928) untersuchten und als jungpaläolithisch klassifizierten chädel aufgrund einer vor wenigen Jahren durchge
:Uhnen 14C-Datierung bronzezeitlicher Zeitstellung s in sollen.1 Im "Katalog der fossilen Menschenfunde" werden die Schädel zwar genannt, aber auch dort nicht c.ls spätpaläolithisch/mesolithisch akzeptiert (Newell · . a. 1979, 178).2 Die rekonstruierte Lage des Fundge~ietes zwischen Fohrde und Hohenferchesar (Lkr. ?msdam-Mittelmark), nur wenige Kilometer nordöst:.i -h der Stadt Brandenburg gelegen, zeigt Abb. 1 (s. iierzu auch das Luftbild in Plate 2000, 131; oberer 3ildrand). _ - ben zahlreichen anderen interessanten Funden, .;.u h aus der näheren Umgebung von Pritzerbe (vgl. z.B . Stimming 1910), sind es vor allem die wichtigen s_ ärpaläolithischen und mesolithischen Objekte, die 5::-mming (1928) auf Fototafeln vorlegte. Das Fundgut --on Pritzerbe wurde durch Schwantes (1928) überrejonal bekannt und in seiner Bedeutung bestätigt. C~1rk (1936) benannte sogar einen seiner mesolithi: -hen Widerhaken-Typen ("chief-types") nach dem -:=-· ndplatz Pritzerbe (s. auch Cziesla 1999 c), und die S?ätpaläolithischen Harpunen erhielten die Bezeich:::.:ng "Havel-Typ" (zur Forschungsgeschichte vgl. Cz:.esla 2000 a). Jüngst konnte Verf. weitere unveröf~-:C~tlichte spätpaläolithische Exemplare von Pritzerbe .;.:.: · den Beständen des Museums für Vor- und Frühge: -hi hte, Berlin Schloss Charlottenburg vorlegen Cz:esl.a 2 01 a).3
C" arum die hier diskutierten spätpaläolithischen -:=-:.:nde. die Schneider (1932) stark verkleinert lediglich :..-:: C mriss abbildet (Abb. 2), ausgerechnet dem Hei-:-= :museum in Friesack (Lkr. Havelland) übergeben --..:r en, lässt sich heutzutage schwerlich rekonstruie-::--::-:. Es ist zu vermuten, dass sie ihren Weg über den ~o: lbe itzer Stein fanden oder von ihm angekauft --..:..:- en. Tatsache ist jedoch, dass diese Funde dort im _ ~:.:..:e m - auf einer Tafel mit Schnüren fixiert -lang~--ig zu sehen waren, und dass etwa um 1910 sogar =-:.~ ? o karte (Abb. 3) mit diesen Fundstücken im ::-:::::..--:-..a:museum zu erwerben war.4 Nach Angaben des _ ~ ...:..:eu Ieiters Kirchert wurden während des 2. Welt-'--~~:: ·e aesamten Museumsbestände des 1902 vom ~=-=-· ·" . h1.L."l Georg H inze (im 2. Weltkrieg gefallen) ge=-·-.=e: n H eimatmuseums vom Rathaus in das Guts::·...:..: :..:: ~ r 1\.lessener Straße ausgelagert, da man sie im .::. :-:::~ ;;j K.eller sicherer glaubte. Dort verblieben sie L::-: :..-: ... en ,·erpackt bis lange nach Kriegsende. Am - _-_ ·.::.~~= 194 jedoch brannte das Gutshaus bis auf die
-:-..::.::.--:-.c. · m nieder. Das Museumsgut muss sich - : - :... ..::e in den Yerschütteten Kellerräumen befin-
Heimatmuseum mit interessanten und _- -~e:: ::=:_ onaren bestücken. - -
Aufbereitung der Funde
Da die Fundeaufgrund ihrer Seltenheit eine Veröffentlichung rechtfertigen, wurde die alte Postkarte aus dem Jahre vor 1913 computertechnisch5 bearbeitet (Abb. 3) und die Abbildungen aufgrund der Angaben aus Schneider (Abb. 2) mit einem Maßstab versehen. Anschließend wurden Zeichnungen von Verf. erstellt (Abb. 4), wobei der Schneidersehe Umriss die Grundlage bildete, die Schraffur erfolgte auf Basis der Fotographien. Sicherlich kann man das erzielte Ergebnis kritisch sehen, jedoch konnte auf dieser Grundlage der folgende Katalog erstellt werden. Nicht mit in diese Betrachtung einbezogen werden die anderen Objekte der Fototafel, denn neben den je drei ein- und zweireihigen spätpaläolithischen Widerhakenspitzen zeigt die Tafel (Abb. 3) auch mehrere mesolithische Artefakte, u. a. eine einfache Spitze, zwei feingekerbte Spitzen vom Duvensee-Typ-2, zwei Spitzen mit kleinen Widerhaken vom Pritzerbe-Typ-8 (vgl. hierzu Cziesla 1999c), sowie eine Geweihhacke. Hinzu kommen spätneolithische flächenretuschierte Dolche sowie ein kleines Beil. Das Ensemble wird von Zahn- und Geweihresten abgerundet. Schließlich ist ein sehr großer, mehr als 15 cm langer Angelhaken -vielleicht auch aus Pritzerbe - erwähnenswert, der für das Havelland typisch ist. Dieser Gerätetyp hat in Bezug auf seine Größe kaum seinesgleichen (s. Chollet u. a. 1980) und findet selbst in der französischsprachigen Fachliteratur - was für deutsche Funde keine Selbstverständlichkeit ist - Niederschlag (s. u. a. Cleyet-Merle 1990, 99).
Frdl. mündliche Mitt. Dr. B. Gramsch, Potsdam, Juli 1998. 2 Herrn Prof. Dr. W Henke, Mainz, sei für diesen Literaturhin
weis herzlich gedankt. 3 Dagegen stammt eine zweireihige Harpune, die jüngst von
Eickhoff!Gramsch (2000, Abb. 7,2) mit der Fundortangabe Pritzerbe publiziert wurde, nicht aus dieser Fundregion, sondern aus dem rund 10 km östlich gelegenen Gortz. Diese berühmte, bereits 1882 gefundene Widerhakenspitze wurde erstmals von Voss!Stimming (1887) abgebildet, anschließend von Krause (1904, 42), Kossinna (1909, Taf. IV,5) und Stimming (1928, Abb. 88) veröffentlicht und ist z. Zt. in der Dauerausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte, Berlin Schloss Charlottenburg, auch neben Funden aus Pritzerbe, zu besichtigen.
4 Sowohl die Postkarte mit einem Blick ins Museum als auch jene, die die Fundmaterialien zeigt, wurden mir dankenswerter Weise von Herrn Günter Kirchert zur Verfügung gestellt. Herr Kirchert ist Leiter des Heimathauses Friesack, Marktstraße 19, und Mitglied des "Heimatverein Friesack e. V.". Er machte schriftlich wie fernmündlich folgende Angaben, für die ich ihm ganz herzlich an dieser Stelle danken möchte.
5 Für diese Arbeiten danke ich Herrn U. Wö/fer, Firma Wurzel Archäologie GmbH, Stahnsdorf.
8
h 14
5
-C)
0
2
6
- 0
9
3
o--
7
-0
-= 10 11
10 cm
Abb. 2: Spätpaläolithische und mesolithisehe Widerhakenspitzen aus dem Friesacker Heimatmuseum (n. Schneider 1932,
Abb. 78- 80).
Beschreibung der sechs spätpaläolithischen Widerhakenspitzen aus dem Friesacker Heimatmuseum (Abb. 4)
Nr. 1
Beschreibung: Vollständig erhaltene einreihige Widerhakenspitze mit vier in annähernd gleichen Abständen zueinander angebrachten Haken. Gesamtlänge 20,6 cm, Abstände zwischen den Haken 28, 29 und 25 mm. Halb-wappenförmiges Basisteil mit einer Länge von 27 mm und einer größten Breite von 16mm. Literatur: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3 (nur im Umriss) von Schneider (1932, Abb. 78). Dort als Fundortsangabe: "Pritzerber See". Erneut wurde die Spitze, ebenfalls stark verkleinert und nur im Umriss, zusätzlich seitenverkehrt, von Kozlowski (1977, Taf. 3) veröffentlicht und dort als "Pritzerbe B" bezeichnet. Sie wird von diesem Autor seiner Variante "12:A4" zugerechnet, die sich durch eine stark asymmetrische Basis ("halbes Wappenschild") auszeichnet. Parallelen: Auf die Ähnlichkeit mit einer nur medial erhaltenen Spitze aus der Maninshöhle bei Letmathe (Kreis Iserlohn) sei hingewiesen, wobei diese Spitze zunächst der Federmesser-Kultur (Schwabedissen 1954, Taf. 87) zugewiesen wurde; Taute (1968, 58) sah jedoch durchaus auch eine Zuweisung zur Ahrensburger-Kultur, wobei dies nur durch eine AMS-14CDatierung zu klären wäre. Grundsätzlich vergleichbar ist auch eine Spitze (mit fehlender Basis) aus Gammelby in Schleswig-Holstein (Röschmann 1963, Taf. 1,5), und - hier selbstverständlich unter Vorbehaltaus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen (Stampfuß! Schütrumpf 1970). Letztere Spitzen sind bezüglich ihres Alters umstritten (s. z. B: Veil u. a. 1991) und möglicherweise in der Tradition mesolithisch, jedoch sind die drei in Dinslaken geborgenen Spitzen sehr heterogen. Schließlich kann darauf hingewiesen werden, dass ein Fund aus Österreich - und zwar aus der Gratkorn-Zigeunerhöhle in der Steiermark (Pittioni 1955, Abb. 4)- ebenfalls vergleichbar herausgeschnittene Widerhaken an einer einreihigen Spitze besitzt. Überraschend ist in diesem Zusammenhang dort auch der Fund eines mehr als 10 cm langen knöchernen Angelhakens, der ebenfalls seine besten Parallelen im Havelland findet (s. z. B. Cziesla 1999 b ). Die räumliche Distanz (Luftlinie) von mehr als 600 km ist bemerkenswert.
Nr.2
Beschreibung: Vollständig erhaltene, schlanke einreihige Widerhakenspitze mit sieben Haken, die vom Spitzenteil bis zur Basis geringfügig kleiner werden, wobei sich die Abstände zwischen den Haken am Schaft deutlich vergrößern; d. h., die Haken im Spit-
(, L (r F
.. Cl
.::J
-- r
3e:
=;:1:eil deutlich dichter stehen. Gesamtlänge 23,7 cm, _.:.._:-:,- ände zwischen den Haken 13, 16, 16, 17 und 26 =....-::. .\bstand vom letzten Haken zum Basisende _::-...Jbes Wappenschild") recht groß mit mehr als 6 cm.
::... :craru r: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3 ~~ · Umriss) bei Schneider(1932, Abb. 79). Dort als
:=:-..:.::-..orrsangabe: "Pritzerber See". Erneut wurde die ~ ? :-::z. , seitenverkehrt, im Umriss und ebenfalls stark - :-:-:,;_:einen , \'On Kozlowski (1977, Taf. 3) veröffentlicht .....:::.0:: 'on als "Pritzerbe C" bezeichnet. Sie wird von :...:~c::: _\uror seiner Variante "12:A4" zugerechnet, .::...:- ::.:-h urch eine stark asymmetrische Basis ("halbes
J..??e" --hild ") auszeichnet. =- ::i...;:e" : Zu dieser einreihigen Widerhakenspitze mit - - ;:.-::::. h. zen Zähnen finden sich Parallelen in We-
=:-.L..-:: S:-:n:ming 1928, Abb. 2) und aus dem Pritzer-__ -:= -- ~ i Hohenferchesar (Stimming 1928, Abb. 3 ), - _ ;:.= · -:::. Ea.Yelland gelegen, sowie - wenngleich mit .:::::-_:_.:-:. ~ ~ill erer Ähnlichkeit- vom Dümmer (Ol
::: . Diese Widerhakenspitze besitzt bislang ~-= _ :.:-i..:.ele im polnischen FundmateriaL
·alls ändig erhaltene (23,3 cm lange), 29 mm) einreihige Widerhaken-
:__ -= - -- ~--~-0
e\\-öhnlich großen, kräftigen • :::::. ;:..:- ··.=.... ~-.:s em Span heraus gearbeitet wur-
Abb. 3: Postkarte von vor 1913 aus dem Heimatmuseum Friesack. M. 1:4
den. Die vier Haken stehen in regelmäßigen Abständen von 25, 27 und 29 mm zueinander, das stark asymmetrische Basisteil selbst bildet einen ergänzenden, spitz ausgezogenen, konternden Haken. Die Tiefe der Haken übersteigt teilweise die Breite des Schaftes, sodass das Objekt trotz der großen Zähne ("Großzahn-Typ") vergleichsweise grazil und zerbrechlich wirkt. Literatur: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3 (nur im Umriss) bei Schneider(1932, Abb. 79). Dort als Fundortangabe: "Pritzerber See". Es erfolgte keine erneute Veröffentlichung, obwohl der Fund Kozlowski (1977) bekannt gewesen sein muss. Bei ihm finden sich weitere Parallelen, und man könnte die Spitze seiner Variante "12:A6" zuordnen, falls man an dieser Klassifizierung festhalten möchte. Parallelen: Parallelen zu dieser großzahnigen Spitze finden sich in Götz (Stimming 1928, Abb. 4) und jüngst im Fundmaterial aus dem Bützsee bei Neuruppin ( Cziesla 1999 b; 2000 b ). Ähnlichkeiten bestehen außerdem zu den Spitzen aus Törning (Mestorf 1885, Abb. 123), Harrislee (Röschmann 1963, Taf. 1,3) und Poggenwisch, also aus Schleswig-Holstein bzw. Dänemark. Blicken wir über die östlichen Landesgrenzen hinaus, so finden wir eine Spitze vom polnischen Fundplatz Wqgliny im Wadra-Flussgebiet (Domanski!Burdukiewicz 1994), nahe der deutschen Grenze. Im polnischen Fundmaterial finden sich weitere Paral-
2 c:::::J 3 4 6 C>
0 10 cm
Abb. 4: Spätpaläolithische Widerhakenspitzen aus Pritzerbe. Rekonstruierte Zeichnung n. Abb. 2 und .3 durch Verf.
lelen. So sieht die Spitze aus Lisi Ogon unserer Spitze fast zum Verwechseln ähnlich, weitere Parallelen (s. Abb. 5) stammen aus Piecki und aus Wojnowo (Galinski 1990, Abb. 1.11,4.5).6
Nr. 4
Beschreibung: Zweireihige Widerhakenspitze mit sechs bzw. fünf kleinen, alternierend angebrachten Widerhaken deutlich unterschiedlicher Größe. Die meist runden Widerhaken sind unterschiedlich klein, die Abstände zwischen den Haken variieren stark. Die Gesamtlänge des im Basisbereich kräftigen, im Spitzenteil dagegen ungewöhnlich dünnen Objektes beträgt 20,9cm. Die Basis ist "klassisch" wappenschildförmig gestaltet, wobei - ebenfalls typisch - die unterschiedliche Höhe des oberen Wappenabschlussrandes zu erwähnen ist, sodass dieser "Schild" leicht asymmetrisch/verkantet wirkt.
Literatur: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3 (nur im Umriss) bei Schneider(1932, Abb. 78). Dort als Fundortsangabe: "Pritzerber See". Keine weitere Veröffentlichung. Parallelen: Die beste Parallele findet sich in einer Spitze von Gortz, die bereits mehrfach publiziert wurde/ jedoch ist das Stück aus Pritzerbe deutlich graziler. Für einen weiteren Vergleich bietet sich das Exemplar aus Netzen an (Voss/Stimming 1887), und schließlich sei auf eine Widerhakenspitze hingewiesen, die H ohmann (1926, Abb. 2) veröffentlichte, zu der er jedoch als Herkunftsbezeichnung nur das "Havelland" preisgibt. Ein weiteres Vergleichsstück stammt aus dem Bützsee, wobei der Fuß jedoch sehr rudimentär ausgefallen ist.
6 Den polnischen Kollegen T Galüiski (Szczecin) und M. Kobusiewicz (Pozna6) sei für Literaturhinweise herzlich gedankt.
7 Voss/Stimming 1887; Krause 1904; Clark 1936; Taute 1968, Taf. 161,1.
(
J
:::>
z
c
ö.c ?a , 02.
Auch aus dem Nachbarland Polen lassen sich zwei Parallelen anführen, und zwar die berühmte Spitze aus Lachmirowice (Taute 1968, Taf. 162,2; vom Oberlauf der Netze, westlich von Warschau) sowie eine ungewöhnlich lange - mit fehlender Basis- von Dziwnowa Balryku aus der Region Stertin (Kaube 1985). Beide werden von Galinski ( 1990, 17) als "Typ Lachmirowice" zusammengefasst.
~r. S
Beschreibung: Kompakte, etwas klobig wirkende zweireihige Widerhakenspitze mit einer erhaltenen Länge von 19,6 cm. Wie jedoch dem Foto zu entnehmen ist, war das Fundstück bei der Bergung vollstän-
ig und endete vergleichsweise spitz. Die großen, abgerundeten Zähne sind alternierend angebracht beidseitig je drei Stück), die Abstände zwischen den
Zähnen sind annähernd gleich groß. Der Schaft ist mit in er Breite von rund 10 mm stabil und wird durch die
großen Zähne randparallel unterstützt. Die Form der Zähne ist (am Schaft) typisch konkav-hakenförmig,
ie Zähne selbst sind sehr hoch und dadurch besonders kräftig. Die Basis ist wappenschildförmig, wieder mit der bereits hervorgehobenen Asymmetrie. Der letzte Haken steht ungewöhnlich dicht bei der Basis, sodass
ie vermutliche Klemm-Schäftung kaum über das Ba-isteil hinaus greifen konnte. Li teratur: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3 nur im Umriss) bei Schneider(1932, Abb. 78). Dort als
.:=-undortsangabe: "Pritzerber See" . Keine weitere Veröffentlichung. ?arallelen: Zweireihige Widerhakenspitzen mitvergleich~ar eng am Schaft sitzenden großen Haken und einem :eicht asymmetrischen wappenschildförmigen Fuß :1nden sich aus Pritzerbe selbst ( Cziesla 2001 a) sowie "::> i Schuchhardt (1934, Abb. 23,1), wobei der genaue ~;Jndort der zuletzt genannten Spitze nicht bekannt ist ..:.n lediglich mit "Havelland" angegeben wurde.
3es.:hreibung: Kompakte, rund 17,2 cm lange zweirei::-..:.;e Widerhakenspitze, die bei Schneider (1932, Abb. 78) -..:..:-.·:ollständig gezeichnet ist, auf dem Museumsfoto je--=- ~ -~ Yollsrändig ist und dort erkennbar spitz endete. Die = =~en folgen dicht aufeinander und lassen kaum eine _-__ ;:-enzung zum Schaft zu. Zudem ist die Außenkante :_··.::illend gerade und wirkt wie zugesägt. Die Haken :::...-:0:: alternierend angebracht, auf jeder Seite drei, wobei .::_e Haken selbst unterschiedlich groß sind. Die Basis ist =-.._ ?.: nförmig, es fehlen die deutlichen Absätze des - :_: r- nschildrandes. =_::e:-a r: Veröffentlichung im Maßstab von ca. 1:3
::-:-=-:- i..-n Gmriss) bei Schneider(1932, Abb. 78). Dort als ~ _;- .:orrangabe: "Pritzerber See". Keine weitere Ver: ;::":::1-:li -hung.
Parallelen: Bei diesem Exemplar drängt sich aufgrund der sägeartigen, parallel zum Schaft verlaufenden Herausarbeitung der Haken der Vergleich zu Stellmoor (Rust 1943, Taf. 89,1) geradezu auf, wenn auch die Basis nicht typisch wappenschildförmig ist. Ebenfalls findet man dieses Haken-Kennzeichen bei einer Geschossspitze aus Pritzerbe ( Cziesla 2001 a), bei einer Spitze vom Bützsee ( Cziesla 1999 b ), bei einer Spitze aus Wachow (unveröffentlicht, Inv.-Nr. If 8841 Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin Schloss Charlottenburg, Objekt nicht mehr nachweisbar) sowie bei einer ungewöhnlich langen Spitze von Gortz (Stimming 1928, Abb. 84). Schließlich sei auf die große Widerhakenspitze von Skaftelev auf Seeland (Dänemark) verwiesen (Mathiassen 1941, Abb. 1; Andersen 1988), die im Nationalmuseum in Kopenhagen ausgestellt ist. Diese dänische Spitze wie auch jene aus dem Bützsee unterscheiden sich jedoch von diesem Fund aus Pritzerbe durch einen kleinen, zusätzlichen Dorn oberhalb des Harpunenfußes. Ansonsten machte bereits Mathiassen (1941, 126) auf die große Ähnlichkeit "mit jedem Detail" zu Funden aus der StimmingSammlung aufmerksam. Aufgrund der typischen Heraustrennung der Zähne schlägt Galinski (1990, Abb. 1,2b) die Bezeichnung "Typ Stellmoor" vor.
Auswertung
Es ist allgemein bekannt, dass Alfred Rust im Jahre 1933 bei seinen Untersuchungen des verlandeten Toreisloches bei Meiendorf nicht nur umfangreiche Jagdbeutereste der so genannten Hamburger Kultur bergen konnte, sondern es gelang als eines der interessantesten Fundobjekte eine einreihige "Rengeweih-Harpune" zu bergen (Rust 1937). Diese Widerhakenspitze spielte in den Folgejahren bei der Datierung der Hamburger Kultur eine nicht unerhebliche Rolle, galt sie doch aufgrund ihrer Morphologie als Beleg für die enge zeitliche, aber auch typologische Verwandtschaft des "Hamburgien" mit dem "Magdalenien des Mittelgebirgsraumes". Zuvor war bereits auf die Ähnlichkeit der Havelharpunen mit dem Magdalenien hingewiesen worden (Schwantes 1928, 217; Menghin 1931, 232), was sich durch den Meiendorfer Fund offensichtlich bestätigte. Auffällig bei diesem Exemplar ist die - bisher einmalige - ungewöhnliche Ausgestaltung der unteren Zacke, die - wie Tromnau (1992, 80) sie beschreibt - zur "Doppelzacke geworden ist und (sie) gleicht in der Form der Vorrichtung zum Aufwickeln der Schnur an einem Fahnenmast". Diese Widerhakenspitze galt neben Kerbspitzen und Zinken als kennzeichnendes Element der Hamburger Kultur,8 und Eosinski (1987, 130) brachte die damalige
8 Vgl. u. a. Kozlowski!Kozlowski 1979, Abb. 34;Jai diewski1984, Abb. 37; Burdukiewicz 1986, 253 .
Forschungsmeinung - als Unterstützung zu seiner Poggenwisch-Stab-Theorie -wie folgt auf den Punkt: "Die Herkunft aus dem Magdalenien wird auch durch die Harpune von Meiendorf belegt". Zunächst gab es bei dieser Einschätzung keine Bedenken, obwohl Mitte der 1980er Jahre von rund 100 Fundstellen der Hamburger Kultur nur diese eine Widerhakenspitze aus dem Toteisloch von Meiendorf vorlag. Die vier aus Stellmoor stammenden Harpunen datieren - bereits nach Aussage des Ausgräbers - in die jüngere "Ahrensburger Stufe" (Rust 1943, Taf. 89). Besondere Verdienste um die Neudatierung der Hamburger Kultur hat sich A. Fischer erworben, der sich gemeinsam mit H. Tauber Anfang der 1980er Jahre in einem an der Universität Kopenhagen angesiedelten Forschungsprojekt um eine präzisere Neudatierung von Altfunden aus Stellmoor, Meiendorf und Poggenwisch bemühte. Dabei stellte sich heraus (Fischer/Tauber 1986 ), dass, wie in Stellmoor, auch in Meiendorf neben der Hamburger Kultur die deutlich jüngere Ahrensburger Kultur ihre Siedlungsfunde hinterlassen hat. Dass es sich bei der Ausgrabung in Meiendorf z. T. um eine "Schlammschlacht" gehandelt hat - ohne an der Arbeit von Rust Kritik üben zu wollen - ist allgemein bekannt, und eine Vermischung nicht zeitgleicher Fundkomplexe liegt nahe. Eine Datierung der Meiendorfer Harpune in den Zeithorizont um etwa 10.110±85 14C-BP (K-4330) wurde somit wahrscheinlich. Auf die stratigraphischen Unsicherheiten wies Tromnau in seinem Vortrag während der 30. Tagung der Hugo-Obermaier-Gesellschaft in Schleswig (1988) hin, und Veil griff diese Kritik bei der Vorstellung seiner Dümmer-Spitze auf (Veil u. a. 1991, 15; vgl. auch Lübke 1993, 75). Tromnau diskutierte die Fundumstände der Meiendorfer Harpune ausführlich und kam abschließend zu folgendem Ergebnis. "Ob die Harpune von Meiendorf deshalb weiterhin als ein Bestandteil der Hamburger Kultur angesehen werden darf, ist somit fraglich" (Tromnau 1992, 83). Schon 1989 war von der Meiendorfer Harpune im Zusammenhang mit der Herkunft der Hainburger Kultur keine Rede mehr (s. Desbrosse/Kozlowski 1989). Erwähnenswert ist auch, dass bereits Gamble (1986, 210) die Harpunen den Stielspitzeu-Gruppen zuordnet, und dabei auf Taute verweist. Warum Taute (1968) in seiner Dissertation einreihige Harpunen überhaupt nicht erwähnt, könnte darin begründet sein, dass auch er bereits Zweifel an der Datierung des Meiendorfer Exemplars hatte, diese damals jedoch nicht begründen konnte, und er zudem die Rustsche Datierung nicht anzweifeln wollte. Eine AMS-14C-Datierung dieses Fundstückes ist somit nicht nur wünschenswert, sondern längst überfällig, um endgültige Sicherheit zu schaffen. Von den bislang bekannt gewordenen rund 150 Fundstellen der Hamburger Kultur liegt kein wei-
··. terer Hinweis auf eine Widerhakenspitze vor, nicht einmal Bruchstücke oder Werkabfälle.9
Als aktuelle Forschungsmeinung bleibt somit festzuhalten, dass nicht nur die zweireihigen, sondern auch die einreihigen Widerhakenspitzen ein Element des Spätpaläolithikums Nordeuropas sind. Dabei scheint man die zweireihigen Widerhakenspitzen ausnahmslos der Ahrensburger Kultur, Bromme-Kultur (?)und dem osteuropäischen Swiderien zuweisen zu können (Kozlowski 1981, 85; 1999, Abb. 1). Schlanke, einreihige Harpunen können dagegen bereits bei den Federmesser-Gruppen des Alleröd auftreten (Fundstellen Kettig und Wustermark; vgl. Cziesla 2001 a, 390), die zweireihigen Harpunen kommen vermutlich erst in der zweiten Hälfte der Jüngeren Dryaszeit in Gebrauch, und es ist zu vermuten, dass sie bis weit ins Präboreal (vgl. Cziesla 2000 b) hineinreichen. 10 Diesen Altersansatz - zweite Hälfte Jüngere Dryaszeit/Beginn Präboreal ( vgl. auch Kozlowski 1981, 83) - möchte Verf. für die hier vorgestellten sechs Spitzen aus Pritzerbe vorschlagen. Sind die sechs beschriebenen Widerhakenspitzen aus Pritzerbe mit einiger Sicherheit dem Zeitraum von ca. 9.750 bis 10.500 14C-BP (uncal.) zuzuweisen (ausführlich Cziesla 2001 c), so stellt sich die Frage nach einem großräumigen interkulturellen Vergleich. Vergleichsfunde wurden im obigen Katalog bereits den einzelnen Exemplaren zugewiesen. Betrachten wir zunächst die beiden beigefügten Verbreitungskarten (Abb. 5; 6). Dazu sei nachdrücklich auf die Bedeutung dieser Artefaktgattung hingewiesen und der Satz von Kozlowski (1981, 82) zitiert: Die Analyse der einreihigen Harpunen "indicate the existence of local differentiations ... , which ... is not obliged to be reflected in the stone inventories produced by the people using this type". Da die Widerhakenspitzen individuellen Ausformungen mehr Raum lassen als Steinartefakte, ist diese Artefaktgattung bei der Differenzierung-lokaler Gruppen von besonderem Interesse, wie jüngst für das Früh-Mesolithikum postuliert ( Cziesla 1999 c). Die einreihigen Harpunen - wie von Kozlowski (1981) bereits belegt- sind ein Element des gesamten nordeuropäischen Flachlandraumes ("tundra-zone"). Auf Kozlowskis Typen-Differenzierung (Typ 12:A1-6) soll an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden, da
9 Es sei darauf verwiesen, dass jüngst ein Führer erschien, der einen aktuellen Überblick zum Spätpaläolithikum im Havelland gibt. Dort heißt es, dass "Rentierjäger der so genannten Hamburger Kultur ins Havelland gekommen sein" ... könnten, und ... "sich unter den entlang der Havel ausgebaggerten Rengeweih-Harpunen Stücke" ... befinden ... , "die der Harpunenform der Hamburger Kultur nahe stehen" (Eickhoff/Gramsch 2000, 31 ). Bedauerlicherweise führen die Autoren ihre Betrachtungen nicht weiter aus.
10 Ins Präboreal zu datierende Rentierfunde sind zwar äußerst selten (was auch an der fehlenden Datierung liegen dürfte), aber vorhanden. Zu nennen sind u. a. Funde aus Niedersachsen (Brandt 1965; Tromnau 1981; Grate 1990), Schleswig-Holstein (Tromnau 1981),Jütland und Bornholm (Aaris-Serensen 1988; 1992).
Memel r
/ ·t~~ I 24-34
100
' • 1
200km
'-
<%~
I
J
• 35
....
( '
\ )
r
l~\ ( \
r o% .... /.
() \ \
./ j''
.36
~
:\bb. 5: Verbreitungskarte einreihiger, mutmaßlich spätpaläolithischer Widerhakenspitzen aus West-, Nord- und Osteuropa. : ::...:nne (B); 2 Dinslaken (D); 3 Bottrop (D); 4 Kettig (D); 5 Maninshöhle (D); 6 Dümmer 1 (D); 7 Dümmer 2 (Lemförde) (D); 8 Brillen-
::öhle (D ); 9 Meiendorf (D); 10 Stellmoor (D); 11 Brodersby (D); 12 Gammelby (D); 13 Harrislee (D); 14 Törning (DK); 15 Ejby ~~se D I\.); 16 Frobjaerg Mose (DK); 17 Tj0rnelunde Raamose (DK); 18 L0j esm0lle (DK); 19 Vallensgard Mose (DK); 20 Venz/Rügen (D); : : ::_=gen Trechow (D); 22 Plauerhagen (D); 23 Bützsee/ Altfriesack (D); 24 Pritzerbe (D); 25 Fohrde (D); 26 Brandenburg-Plauerhof (D); : - G-o= (D); 28 Wachow (D); 29 Wustermark (D); 30 Weseram (D); 31 Ketzin (D); 32 Alt-Töplitz (D); 33 Groß Kreutz (D); 34 Götz (D);
~gliny (PL); 36 Gratkorn-Zigeunerhöhle (A); 37 Zlot6w (PL); 38 Biskupin (PL); 39 Lisi Ogon (PL); 40 Bamowo (PL); 41 Dui.y !....~z 'PL); 42 Kr~pkowice (PL); 43 Orle (PL); 44 Barniewice (PL); 45 R~kawczyn (PL); 46 Lukomie-Kolonia (PL); 47 Mi~dzych6d (PL);
- · :..:...-:.JainY (PL); 49 L~gno (PL); 50 Palmnicken (RUS); 51 Penken (RUS); 52 Pogrimmen (RUS); 53 Piecki (PL); 54 Wojnowo (PL); 55 Jeg_:_·· 'PL); 56 Koi.uchy (PL); 57 Wqi. (PL); 58 NoweJuchy (PL); 59 Orzysz (PL); 60 Staswiny (PL); 61 Kanal Kruklinski (PL); 62 Sol-
.: . .;.:1,. (PL); 63 Balsupiai (LIT); 64 Hohen Viecheln (D). (n. Cziesla 1999 a; 2000 a; 2001 a und Galinski 1990, mit Ergänzungen)
-=~ ..: · Datenbasis für eine derartige Betrachtung für - _ :.-: Z'J gering hält. _;- · ::::·::. s ~i (1977) nannte insgesamt 40 Fundstellen.
= :-·;:- Yorgelegte Verbreitungskarte kann den Fund-=-=-:~ - and auf 64 erhöhen, von denen rund 100
~=-:_.. 0-e ,·orhanden sind (Abb. 5), wenngleich über · ng des einen oder anderen Fundstückes -
- __ :-• .:.;::-s au dem süd- und westeuropäischen Raum ren bleibt. Von Interesse ist, dass die meier letzten Jahre keine Neufunde darstelaus der Bearbeitung von Altsammlungen
"' im·emaren resultieren. Dies zeigt den - __ - '-' -. "berraschend schlechten Bearbeitungs-- - ~ ~e anders in Berlin-Brandenburg.
.:. __ - -- :.:::: -:t.-ir die drei vorgestellten einreihigen Wider• -~~-..L.;:: "'errennt voneinander, so fällt auf, dass
Parallelen zum Fundstück Nr. 1, außer im Havelland, nur in Westdeutschland vorliegen, darüber hinaus verblüfft die Ähnlichkeit zu einem Fund aus Österreich. Das Fundstück Nr. 2 ist dagegen nur im unmittelbaren regionalen Bereich für einen Vergleich zu verwenden. Anders die besonders auffällige Harpune Nr. 3 mit den sehr großen Zähnen. Neben Norddeutschland ist es vor allem das polnische Gebiet, welches Vergleichsfunde geliefert hat. Auf eine Parallele aus Mecklenburg-Vorpommern, die im Katalog noch nicht genannt wurde, möchte Verf. etwas ausführlicher eingehen, da diese große Bedeutung für die älteste Geschichte unseres Nachbar-Bundeslandes haben könnte. Gemeint ist eine Widerhakenspitze aus Hohen Viecheln, von wo - abgesehen von einer neolithischen Fundschicht -Schuldt (1961) nur mesolithisches Material vorlegt. Be-
"' ,.
~ " ~)~ 4.
<. ----- ..... ·······-·· l[ --- ----·------~ ---
",;j
~ .3
'9
/ J
9 • ···~:. ·•-•v " •. 10- 21
/
')"""'--~) .23 \ ~ warthe ~ ...___~~/\
~~ -~~ '
t~ \
·-..... \
'----\ \
0 100 200 km (/ )
l._........_~O"~,.... ''-·
"'-\ (
Abb. 6: Verbreitungskarte zweireihiger, spätpaläolithischer Widerhakenspitzen aus West-, Nord- und Osteuropa. 1 Europoort (NL); 2 Brillenhöhle (D); 3 Stellmoor (D); 4 Bistoft (D); 5 Skaftelev, Seeland (DK); 6 Skellingsted Bro, Seeland (DK); 7 Buerup Sogn, Seeland
(DK); 8 Vallensgard Mose (DK); 9 Bützsee/ Altfriesack (D); 10 Lutze (D); 11 Bredow (D); 12 Wustermark(D); 13 Döberitz (D); 14 Deetz (D); 15 Ferch (D); 16 Netzen (D); 17 Gortz (D); 18 Hohenferchesar (D); 19 Fohrde (D); 20 Pritzerbe (D); 21 Möthlitz (D); 22 Baltyku
Dziwnowa (PL); 23 Lachmirowice (PL); 24 Tolmicko (PL). (n. Cziesla 2000a; b und Galinski 1990, mit Ergänzungen).
trachten wir jedoch die rund 9,3 cm lange "Spitze mit einseitigen großen Widerhaken", von der Schuldt (1961, 109 Taf. 48,c) schreibt: "Das Stück ist technisch sehr gut gearbeitet, es unterscheidet sich stark von allen anderen Typen in Hohen Viecheln"; die Ähnlichkeit mit dem Fundstück aus Stellmoor ist verblüffend. Suchen wir nach weiteren spätpaläolithischen Komponenten in diesem Mecklenburger Material, so zeigt ein Steinartefakt entfernte Ähnlichkeit mit einer Stielspitze (Schuldt 1961, Taf. 38,1). Die Beschreibung der naturwissenschaftlichen Ergebnisse zeigt zudem, dass in den Profilen auch die Jüngere Dryaszeit aufgeschlossen ist (Schmitz 1961, 19 ff.), und dort sogar Holzkohlen vorkommen (kritische Anmerkungen zur Stratigraphie bereits bei Gramsch 1964). Somit möchte Verf. nicht nur einen weiteren Vergleichsfundplatz für Pritzerbe erwähnen, sondern gleichzei-
1 tig das überaus spärliche spätpaläolithische Fundmaterial Mecklenburg-Vorpommerns (vgl. hierzu Terberger 1996) um einen bekannten Fundplatz ergänzen.
Festzuhalten bleibt, dass einerseits ein sehr großes Territorium - immerhin vom Rhein bis an die Memel -durch die Vergleiche aufgespannt wird, dass andererseits bestimmte Widerhakenformen nur in bestimmte Regionen weisen, sodass der Havelregion (vgl. Hänsel 1991) eine vermittelnde Rolle zusteht. Eine Gesamtanalyse lässt spannende Ergebnisse erwarten. Die zweireihigen Harpunen haben bislang noch keine Einzeldarstellung erfahren. In einer ersten Verbreitungskarte wurden durch Clark (1936, Abb. 47) noch beide Harpunentypen aufgenommen und nur vier Fundregionen genannt. Einzeln kartiert wurden die zweireihigen Widerhakenspitzen durch Taute (1968, 309 f.; Karte 8), der insgesamt 13 Exemplare zu nennen wusste. Die Kartierung bei Verhart (1988, Abb. 31) zeigt bereits 17 Exemplare im nordeuropäischen Raum, weitere regionale Kartierungen folgten. 11 Die
11 z. B. Gramsch 1987; Abb. 4; Bokelmann 1988, Abb. 2; Galiliski 1990; Cziesla 2000a.
r
2
s s s a. n
V
G !SI
bc _-\
ur eJ
_\1 lUJ be 701
A!:
_.._..;:]
G:J _,fa
1 ' _._a
hier vorgelegte Abb. 6 zeigt vermutlich auch nicht alle bereits bekannten Objekte, jedoch hat sich die Anzahl der Fundstellen auf insgesamt 24 erhöht, und es ist mit weit über 50 Exemplaren zu rechnen (über die Zeitstellung des einen oder anderen Fundobjektes herrscht sicherlich Uneinigkeit). Eine Gesamtvorlage ist geplant. Die Pritzerber SpitzeN r. 4 besitzt Parallelen in der unmittelbaren Nähe, wie die Fundstellen Gortz, Netzen oder Bützsee belegen. Außerdem weist sie nach Polen, sodass "Typ Lachmirowice" durchaus eine treffende Bezeichnung sein könnte. Die Spitze Nr. 5 besitzt dagegen nur Vergleichsstücke im Havelland. Schließlich erstrecken sich Parallelen zu Fund Nr. 6 nach Nordwesten und Norden, Vergleichsfunde stammen aus Schleswig-Holstein und von der dänischen Insel Seeland. Der polnische Raum bleibttrotzder Harpunenhäufung unberücksichtigt. Somit bleibt für die zweireihigen wie auch für die einreihigen Widerhakenspitzen festzuhalten, dass dem Havelland aufgrund seiner Lage eine besondere Bedeutung in der Rekonstruktion des Geschehens während der Jüngeren Dryaszeit zukommen wird. Eine weitere Beschäftigung mit diesem Datierungsansatz, auch unter Einschluss von Geländearbeiten, ist mehr als überfällig.
Schlussbetrachtung
Verf. konnte ein- und zweireihige spätpaläolithische Geschossspitzen aus dem Havelland vorlegen. Damit ist dieser Raum jedoch noch nicht abschließend bearbeitet, weitere Altfunde harren der Veröffentlichung. Außerdem wurde die Datierung der Stücke diskutiert und auf Vergleichsfunde hingewiesen. Letztere konnten großräumig kartiert werden. Dieser Aufsatz sei als Anregung zur weiteren Erforschung der ältesten Siedlungsgeschichte Berlin-Brandenburgs verstanden. Insbesondere scheinen in dieser Region auch neue Feldforschungen dringend erforderlich.
Abbildungen: G. Matthes, BLMUF, n. Vorlage des Autors (1; 5; 6); Autor (2; 6) und V. Wölfer, Wurzel Archäologie GmbH, Stahnsdorf (3)
Anschrift: Dr. Erwin Cziesla, Wurzel Archäologie GmbH, Fasanenstr. 25b, D-14532 Stahnsdorf Mail: Wurzel-Archaeologie@t -online.de
Manuskriptschluss: Juli 2000
Literatur
Aaris-Sorensen 1988 K Aaris-Sorensen, Danmarks forhistoriske Dyreverden (Kopenhagen 1988).
Aaris-Sorensen 1992 K Aaris-Sorensen, Deglaciation and re-immigration of !arge mammals. A south Scandinavian example from Late Weichselian. In: W. von Koenigswald I L. Werde/in (Hrsg.), Mammalian migration and dispersal evems in the European Quaternary. Courier Forschungsinst. Senckenberg 153 (Frankfurt 1992) 143-149.
Andersen 1988 S. H. Andersen, A survey of the Late Palaeolithic of Denmark and Southern Sweden. In: M. Otte (Hrsg.), De Ia Loire a !'Oder. Les civilisations du Paleolithique final dans le nord-ouest europeen. Kolloq. Liege 1985. Erudes et Rech. Arch. Univ. Liege 25. BAR Internat. Ser. 444 (Oxford 1988) 523- 566.
Eosinski 1987 G. Bosinski, Die große Zeit der Eiszeitjäger. Europa zwischen 40.000 und 10.000 v. Chr.Jahrb. RGZM 34, 1987,3-139.
Brandt 1965 K H . Brandt, Von Reckum nach Stöttinghausen. In: Bremen, V erden, Hoya. Führer vor- u. frühgesch. Denkmäler 2 (Mainz 1965) 88- 91.
Burdukiewicz 1986 ]. M. Burdukiewicz, The Late Pleistocene shouldered point assemblages in Western Europe (Leiden 1986 ).
Chollet u. a. 1980 A. Chollet/P Boutin/G. Ce/bier, Crochets en bois de cerf de l'Azilien du Sud-Ouest de Ia France. Bull. Soc. Prehist. Fran'<aise 77, 1980, 11- 16.
Clark 1936 ]. G. D. Clark, The Mesolithic settlement of Northern Europe (Cambridge 1936).
Cleyet-Merle 1990 ]. -]. Cleyet-Merle, La prehistoire de Ia peche (Paris 1990).
Cziesla 1999 a E. Cziesla, Erster Neufund nach 70 Jahren. Eine einreihige Widerhakenspitze aus dem Bützsee bei Altfriesack, Lkr. Ostprignitz-Ruppin. Arch. Berlin u. Brandenburg 1998, 1999, 38- 39.
Cziesla 1999 b E. Cziesla, The site Bützsee-Altfriesack, northwest of Berlin. A dating program. Pn~hist. Europeenne 14, 1999, 135-142.
Cziesla 1999 c • E. Cziesla, Zur Territorialität mesolithischer Gruppen in Nordostdeutschland. Ethnogr.-Arch. Zeitschr. 40,1999,485- 512.
Cziesla 2000 a E. Cziesla, Spätpaläolithische Widerhakenspitzen aus Brandenburg. Eine Forschungsgeschichte. Arch. Korrbl. 30, 2000, 173-186.
Cziesla 2000 b E. Cziesla, Die 13. aus Brandenburg. Arch. Deutschland 2000, H.4,41.
Cziesla 2001 a E. Cziesla, Zur Besiedlungsgeschichte von Berlin-Brandenburg: Die Anfänge. In: B. Gehlen/ M. Heinen/A. Tillmann (Hrsg.), Zeit-Räume. Gedenkschrift für Wolfgang Taute. Arch. Ber. 14 (Bonn 2001 ).
Cziesla 2001 b E. Cziesla, Eine Verbreirungskarte zu den Stielspitzeu-Gruppen in Berlin/Brandenburg. In: L. Krzyianiak (Hrsg.), Festschrift für Michal Kobusiewicz. Fantes Arch. Posnanienses 39, 2001, 47- 53 .
Cziesla 2001 c E. Cziesla, Weitere Bemerkungen zu organischen Geschossspitzen aus Brandenburg. Die KundeN. F. 52,2001,133- 144.
Desbrosse/Kozlowski 1989 R. Desbrosse/j. K Kozlowski, Les origines du "Creswello-Hambourgien". L'Anthr. 93,1989,183-188.
D ommiskil Burdukiewicz 1994 G. Dommiskil]. M. Burdukiewicz, Harpun jednorzqdowy z W fglin, gm. Gubin, woj. Zielonog6rsk.ie. Slqsk.ie Sprawozdania Arch. 35, 1994, 529-532.
Eickhoff/Gramsch 2000 S. Eickhoff/B. Gramsch, Paläolithikum und Mesolithikum. In: Potsdam, Brandenburg und das Havelland. Führer Arch. Denkmäler Deutschland 37 (Stuttgart 2000) 31-39.
Engel1928 C. Engel, Uebersicht der mittelsteinzeitlichen Fundplätze im Mittelelbgebiet. In: A. Mertens (Hrsg.), Festschrift zur 10. Tagung der Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte am 1.-7. September 1928. Abhandl. u. Ber. Mus. Natur- u. Heimatkde. 5 (Magdeburg 1928) 216--242.
Fischer/Tauber 1986 A. Fischer/H. Tauber, New C-14 datings of Late Palaeolithic Cultures from Northwestern Europe. Journal Danish Arch. 5, 1986,7-13.
Galinski 1990 T. Galinski, P6znoplejstocensk.ie i wczesnoholocenskie harpuny i ostrza ko5ciane i rogowe na poludniowych wybrzei:ach Baltyku mi<rdzy ujsciem Niemna i Odry. Mat. Zachodniopomorsk.ie 32, 1986, 7--69.
Gamble 1986 C. Gamble, The Palaeolithic Settlement of Europe (Cambridge 1986).
Gramsch 1959/60 B. Gramsch, Der Stand der Mittelsteinzeitforschung in der Mark Brandenburg. Wiss. Zeitschr. Humboldt-Univ. Berlin, Gesellschafts- u. Sprachwiss. R.,Jg. 9, H. 3, 1959/60,221-293.
Gramsch 1964 B. Gramsch, Rezension zu: E. Schuldt, Hohen Viecheln. Ein mittelsteinzeitlicher Wohnplatz in Mecklenburg. Ethnogr.Arch. Zeitschr. 5, 1964, 185- 190.
Grate 1990 K Grate, Das Buntsandsteinabri Bettemoder Berg IX im Reinhäuser Wald bei Göttingen. Arch. Korrbl. 20,1990,137-147.
Hänsel1991 B. Hänsel, Berlin und die prähistorische Archäologie. Mitt. Berliner Ges. Anthr., Ethn. u. Vorgesch. 12, 1991,9-17.
Hohmann 1926 K Hohmann, Die Steinzeitfunde von Schmöckwitz. Teltower Heimatkalender 23, 1926, 57--65.
Jaidiewski 1984 Kjaidiewski, Urgeschichte Mitteleuropas (Wrodaw 1984).
Kaube 1985 A. Kaube, Harpun z poroi:a wylowiony z Baltyku. Mat. Zachodniopomorskie 31, 1985, 409-412.
Kossinna 1909 G. Kossinna, Der Ursprung der Urfinnen und der Urindogermanen und ihre Ausbreitung nach dem Osten. Mannus 1, 1909, 1-52.
Kozlowski/Kozlowski 1979 J K Kozlowski!St. K Kozlowski, Upper Palaeolithic and Meso!ithic in Europe. Taxonomy and Palaeohistory. Prace Komisji Arch. 18 (Wrodaw 1979).
Kozlowski 1977 St. K Kozlowski, Jednorzrrdowe Harpuny Typu Hawelansk.iego w Basenie Morza Baltyck.iego. Arch. Polski 22, 1977, 73-95.
Kozlowski 1981 St. K Kozlowski, Single barbed harpoons of Havel Type in the Baltic Sea Basin. In: Pn~histoire de Ia Grande Plaine de l'Europe. Arch. Interregionalis 1 (Warszawa 1981) 77-88.
Kozlowski 1999 St. K Kozlowski, The tanged points complex. In: St. K Kozlowski I ]. GurbaI L. L. Zaliznyak (Hrsg.), Tanged Points Cultures in Europe. Lubelsk.ie Mat. Arch. 13 (Lublin 1999) 28-35.
i Krause 1904 E. Krause, Vorgeschichtliche Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke. Eine vergleichende Studie als Beitrag zur Geschichte des Fischereiwesens (Berlin 1904 ).
Lübke 1993 H. Lübke, Eine jungpaläolithische Geschoßspitze und mesolithische Geweihgeräte aus dem Elbtal bei Hamburg-Billwerder. Hammaburg N. F. 10, 1993,71-81.
Mathiassen 1941 Th. Mathiassen, Two new Danish implements of Reindeer Antler. Acta Arch. (K0benhavn) 12, 1941, 125-134.
Menghin 1931 0. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit (Wien 1931 ).
Mestor/1885 ]. Mestorf, Vorgeschichtliche Altertümer aus Schleswig-Holstein (Hamburg 1885).
Newell u. a. 1979 R. R. Newell/S. Constandse-Westermann/C. Meiklejohn, The skeletal remains of Mesolithic Man in Western Europe: an evaluative catalogue. Journal Human Evolution 8, 1979.
Oldenburg 1980 H. Oldenburg, Eine jungpaläolithische Harpune aus dem Dümmer-See, Ldkr. Diepholz. Ar eh. Korrbl. 10, 1980, 207- 210.
Pittioni 1955 R. Pittioni, Die Funde aus der Zigeunerhöhle im Hausberg bei Gratkorn, Steiermark. Schild von Steier 5, 1955, 12-24.
Plate2000 Ch. Plate, Hohes und spätes Mittelalter. In: Potsdam, Brandenburg und das Havelland. Führer Ar eh. Denkmäler Deutschland 37 (Stuttgart 2000) 122-135.
Reche 1928 0. Reche, Die Schädel aus der Ancyluszeit vom Pritzerber See und ihre Beziehungen zu den steinzeitliehen Rassen Europas. Archiv Anthr. N. F. 21, 1928, 122-190.
Röschmann 1963 ]. Röschmann, Vorgeschichte des Kreises Flensburg. Vor- u. Frühgesch. Denkmäler u. Funde Schleswig-Holstein 6 (Neumünster 1963 ).
Rust 1937 A. Rust, Das altsteinzeitliche Rentierjägerlager Meiendorf (N eumünster 193 7).
Rust 1943 A. Rust, Die alt- und mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor (Neumünster 1943).
Schmitz 1961 H. Schmitz, Pollenanalytische Untersuchungen in Hohen Viecheln am Schweriner See. In: E. Schuldt, Hohen Viecheln. Ein mittelsteinzeitlicher Wohnplatz in Mecklenburg. Dt. Akad. d. Wiss. Berlin, Sehr. Sektion Vor- u. Fruhgesch. 10 (Berlin 1961) 14-38.
Schneider 1932 M. Schneider, Die Urkeramiker. Entstehung eines mesolithischen Volkes und seiner Kultur (Leipzig 1932).
Schuchhardt 1934 C. Schuchhardt, Vorgeschichte von Deutschland. (München, Berlin 1934 ).
Schuldt 1961 E. Schuldt, Hohen Viecheln. Ein mittelsteinzeitlicher Wohnplatz in Mecklenburg. Dt. Akad. d. Wiss. Berlin, Sehr. Sektion Vor- u. Frühgesch. 10 (Berlin 1961).
Schwabedissen 1954 H . Schwabedissen, Die Federmessergruppen des nordwesteuropäischen Flachlandes. Zur Ausbildung des Spätmagdalenien. Offa-Bücher 9 (Neumünster 1954).
Schwantes 1928 G. Schwantes, Nordisches Paläolithikum und Mesolithikum. In: Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Harnburgischen Museums für Völkerkunde. Mitt. Mus. Völkerkde. Harnburg 13 (Hamburg 1928) 159-252.
Stampfuß/Schütrump/1970 R. Stampfuß/R. Schütrumpf, Harpunen der Allerödzeit aus Dinslaken, N iederrhein. Bonner Jahrb. 170, 1970, 19- 35.
Stimming 1910 R. Stimming, Gräberfeld der Völkerwanderungszeit vom Mosesberg bei Butzow (Kr. Westhavelland). Prähist. Zeitschr. 2, 1910, 406-411.
7
\(:
Stimming 1928 R. Stimming, Die Ancyluszeit in der märkischen Havelgegend. Archiv Anthr. N. F. 21,1928,109-121.
Taute 1968 W. Taute, Die Stielspitzeu-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Kenntnis der späten Altsteinzeit. Fundamenta A 5 (Köln 1968).
Terberger 1996 Th. Terberger, The early Settlement of Nonheast Germany (Mecklenburg-Vorpommern). In: L. Larsson (Hrsg.), The Earliest Settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Arch. Lundensia Ser. So 24 (Stockholm 1996) 111- 122.
Tromnau 1981 G. Tromnau, Präborealzeitliche Fundplätze im norddeutschen Flachland. In: B. Gramsch (Hrsg.), Mesolithikum in Europa. Symp. Potsdam 1978. Veröff. Mus. Ur- u. Frühgesch. Potsdam 14/15 (Berlin 1981) 67- 71.
Tromnau 1992 G. Tromnau, Anmerkungen zur Rengeweih-Harpune von Meiendorf. In: E.-B. Krause I B. Mecke (Hrsg.), Ur-Geschichte im Ruhrgebiet. Festschr. Arno Heinrich. Beitr. Bottroper Gesch. 17 ( Gelsenkirchen 1992) 79- 83.
Veil u. a. 1991 S. Veil!M. A. Geyhl]. Merkt/U. Müller/U. Staesche, Eine Widerhakenspitze aus Lernförde am Dümmer, Landkreis Diepholz. NeueAusgr. u. Forsch. Niedersachsen 19,1991,1- 19.
Verhart 1988 L. B. M. Verhart, Mesolithic barbed points and other implements from Europoort, the Netherlands. Oudheidkde. Mededel. 68,1988,145- 194.
Voss/Stimming 1887 A. Voss/G. Stimming, Vorgeschichtliche Altertümer aus der Mark Brandenburg (Berlin 1887).