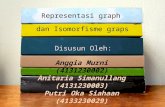Review: Martin H. Graf, Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runeninschriften. Studien zur...
Transcript of Review: Martin H. Graf, Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runeninschriften. Studien zur...
Rezensionen 367
Materialsammlung ein schönes Angebot an weiterführenden Lektürevorschlägen dar.
Wenn auch das Werk schwer lesbar ist und manche Frage offen lässt, wird FnonrB Vadians
Scholienkommerrtar zu Pomponius Mela sicher zu neuer Aufmerksamkeit verhelfen.
Liz. Phil. Katharina Suter-Meyer, Alte Distelbergstraße 4, CH-5035 UnterentfeldenE-Mail : katharina. [email protected]
M.c.Rrnr HanNes Gnan, Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runen-inschriften. Studien zur Schriftkultur des kontinentalgermanischen Runenho-rizonts (Medienwandel - Medienwechsel - Medienwissen 12), Znrich 2010.Chronos Verlag, 190 S. mit Abb., ISBN 978-3-0340-1012-2, EUR 24,50
Manrw He.xups Grar widmet sich in seinem Buch einem durchaus bekannten Phäno-
men, das in der bisherigen Runenforschung zwar häufig konstatiert und vereinzelt
bereits mit weiterführenden Überlegungen sowie einzelnen Deutungsansätzen bedacht
wurde, jedoch nie Gegenstand einer umfangreicheren Untersuchung und eingehenderen
Interpretation war. Die südgermanischen Runeninschriften sind bisweilen mit annähernd
runen- oder auch kapitalisähnlichen, den bekannten Grapheminventaren jedoch nichtzuzuordnenden oder gänzlich abweichenden, symbolartig anmutenden Zeichen verge-
se11schaftet. Derartige Zeichensind je nachArt als "Schriftimitationen", "außerrunische
Zeichen", "Fremdzeichen", "Beizeichen" oder wie in der vorliegenden Studie als
"paraschriftliche Zeichen" angesprochen worden. Eine Zusammenstellung paraschrift-
licher Zeichen wird bereits im Werk von Hntuur AnNrz und HeNs Zrrss geliefert.lAuchWorrceNc Kneusr schenkte jenenZeichen wiederholt seine Aufmerksamkeit, wobei er
sie mitunter als "vomrnisch" ansprach und als einheimisch-germanischen Beitrag an
der Entstehung des Futhark auffasste.2 Aus jüngerer Zeit sind insbesondere die Ansätze
von Kreus Düwsr- zu nennen, der auch eine Deutung als Herstellermarken in Erwägung
zog.3 Erwähnenswert sind ferner dieAusführungen zu "Beizeichen" und runenähnlichen
1 Hnr-uurAnNrz/HaNs Zerss, Die einheimischen Runendenkmäler des Festiandes, Leipzig 1939,
s. 480.2 Z.B. WorpceNc Kn.tusE, Sinnbilder und Runen, in: Altpreußen 1 (1936), S. 15-24; Worr-
ceNc Kuusr, Wesen und Werden der Runen, in: Zeitschrift für Deutschkunde 5l (1937),
S. 281-356; Worpc.qNc Knluse/HnnsBnr JlNrunN, Die Runeninschriften im älteren Futhark
I-II (Abhandlungen derAkademie der Wissenschaften in Göttingen, phil.-hist. Klasse III,65),Göttingen 1966, S. 6.
3 Z.B. Kr-.a,us Düwnr, Runeninschrillen auf Waffen, in: Wörter und Sachen im Lichte der
Bezeichnungsforschung, hg. von RurH ScHrramr-WrscrNo (Arbeiten zur Frühmittelalterfor-schung 1), Berlin,4.{ew York 1981, S. 128-167, hier S. 139f., l5l f.; Kuus Düwer-, Kontinentale
Runeninschriften, in: Old English Runes and their Continental Background, hg. von Ar-rnrnBel4vpseBncBn (Anglistische Forschungen 217), Heidelberg 1991, 5.271-286, hier S.280-282;vgl. den Überblick in: Kr-aus Düwrr-, Runenkunde, Stuttgart/Weimar 42008, S. 66f.
Zeitschrift fit deutsches Altertum und deutsche Literatu (ZfdA) Band 140 . Heft 3 . 201 1 O S. Hirzel Verlag, Stuttgart
368 Rezensionen
Zeichen aufGoldbrakteaten von SsaN Nowara und CHARrorre BrHn,s die fantasievollenInterpretationen in der Edition von SrppsaN Oprrz6 sowie die Studien von Urs Scrwas.TDen runenähnlichen Ritzungen auf den Pfeilschäften aus dem Kriegsbeuteopfermoorvon Nydam hat inzwischen der Rezensent8 einen Beitrag gewidmet. Aus jüngster Zeitkönnte nun auch die (leider unveröffentlichte) Magisterarbeit von FraNr BeHnBNs an-gefiihrt werden, der sich ausführlich mit der Deutung von "runenähnlichen Zeichen"und "Pseudorunen", insbesondere etwa mit den g- und d-runenähnlichen Ritzungenauseinandersetzt. e
Gnep fasst den Begriff "paraschriftliche Zeichen" denkbar weit und schließt auchvollständig aus schriftzeichenähnlichen Ritzungen bestehende Komplexe, die häufig alsSchriftimitationen zubezeichnen sind, sowie runenähnliche E,inzelzeichen (nämlich dasderg-Rune ähnelnde Zeichen auf dem Fingerring von Bopfingen) mit ein. Erstere machenein Drittel der im Band besprochenen Inschriften aus. Schließlich bezieht Gnar mit derScheibenfibel von Oettingen eine Inschrift ein, die er selbst - nach seiner eigenen Autopsieund der Lesung von Tt|{sre LoorrsNca entsprechend als eindeutige Runenfolge auffasst(S. 121).10 Allein die ersten beiden Zeichen des Komplexes sind in der Vergangenheitals runenarlig bzw. unlesbar angesehen worden. Genau genommen fasst der Autor unter"paraschriftliche Zeichen" fünf verschiedene Arten von Ritzungen zusammen:
1. Runenähnliche (bzw. kapitalisähnliche) Zeichenkomplexe ("Schriftimitationen";.tt2. Linguistisch nicht deutbare (nicht-lexikaiische) Runeninschriften ("schriftimitationen"?).12
Sre.N Nowar, Schrift auf den Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Untersuchungen zuden Formen der Schriftzeichen und zu formalen und inhaltlichen Aspekten der Inschriften,Diss. Göttingen 2003 (http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2003/nowak/nowak.pdfl
5 Cuenrorre BEun, Die Beizeichen aufden völkerwanderungszeitlichen Goldbrakteaten (Euro-päische Hochschulschriften XXXVIII,3S), Frankfurt a.M. u.a. 1991.
6 SrppnaN OpIrz, Südgermanische Runeninschriften im älteren Futhark aus der Merowingerzeit,Kirchzarten 21980, S. 84-96.
7 UrE Scnwae, Runen der Merowingerzeit als Quelle für das Weiterleben der spätantiken christ-lichen und nichtchristlichen Schriftmagie?, in: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärerForschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen und Runen-inschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995, hg. von Klaus Düwtr- (Ergänzungsbändezum Reallexikon der germanischen Altertumskunde I 5), Berlin,AJew York 1998, S. 37 6-433,hier S. 386-400.SrcnuNn Oounl, Runen, runenähnliche Zeichen und Tierdarstellungen auf Waffen. Über-legungen zu den Ritzzeichen aufPfeilschäften aus dem Kriegsbeuteopt-ermoor von Nydamund tauschierten Lanzenspitzen der Römischen Kaiserzeit, Offa 2011 (in Druckvorbereitung).Gn.q,rs Arbeit konnte in diesem Artikel leider noch nicht berücksichtigt werden.FnaNr BBnnrNs, Studien zu den runenflihrenden Gräbern der Merowingerzeit in Mitteleuropa.Erweiterte Magisterarbeit, Freiburg i.Br. 2009, S. 108-123.
10 TrNtxr LoolmNcl, Texts and Contexts of the Oidest Runic Inscriptions (The Northern World 4),Bosten/Leiden 2003, S. 252.
1 I Eine Auflistung von "Inscriptions (or rune-like carvings) [...] of doubtful runic charakter"hat jüngst MrnuN FrNou-r- in seiner noch unveröffentlichten Doktorarbeit vorgelegt: MenrrxFrNonll,Vocalism in the Continental Runic Inscriptions, Diss. masch. Nottingham 2009,s.181f.
12 Eine Auflistung von "lnscriptions [...] wich are positively identified as runic, but have nolinguistic interpretation" findet sich ebenfalls in Manrm FrNoerls Dissertation von 2009(s. 182f.).
ZeitschriftfürdeutschesAltertumunddeutscheLiteratur(ZfdA)Band140.Heft3.20ll OS.HizelVerlag,stuttgart
Rezensionen 369
3. Runenähnliche (bzw. kapitalisähnliche) Zeichen innerhalb von Runeninschriften oder diese
begleitend.4. Runenähnliche (bzw. kapitalisähnliche) Einzelzeichen.
5. Nicht-runische und nicht-lat. Zeichen innerhalb von Runeninschriften oder diese begleitend.
Das Buch teilt sich in zweiAbschnitte: Teil I behandelt "Konzeptionelle, methodischeund theoretische Voraussetzungen zum Komplex Schriftlichkeit und Paraschriftlichkeitin den südgermanischen Runeninschriften" (S. 13-67), während Teil II eine kommentierteEdition zwölf ausgewählter Inschriften darstellt (5. 7 1 - 1 62).
Es handelt sich um das Lanzenblatt von Wurmlingen (stimmgabelförmige Zeichen, insbeson-dere am Anfang der Runeninschrift und wabenarlige Muster), die Gürtelschnalle von Pforzen(Rautenmuster und Flechtband am Ende zweier Runenzeilen), die Saxe von Steindorf(dreieckigesZeichen am Beginn einer unklaren Runeninschrift und Flechtband) und Hailfingen (runenähnliche"Schriftimitation" und Ornament im Stil II), das Ringschwert von Schretzheim (Runenkreuz),
die Scheibenltbeln von Bülach (kammartiges Zeichen am Ende einer Runenzeile), Oettingen(umstrittene Runeninschrift) und Peigen ("Schriftimitation" aus Runen und runenähnlichenZeichen), den Fingerring (Kreuz) und das Scheidenmundblech ("Schriftimitation") von Bopfin-gen, das Scheidenmundblech von Eichstetten (nicht deutbare Runeninschrift und runenähnliche"Schriftimitation") und die Bernsteinperle von Weingarten (unleserliche Inschrift aus Runen undrunenähnlichen Zeichen).
Auf die Teile I und II folgt eine Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen (S. 163-170).
Die Absicht des Autors ist es weniger, den konkreten Sinngehalt bzw. die konkreteFunktion einzelner Zetchen oder Zeichenkomplexe zu rekonstruieren, sondern vielmehrüber das Phänomen der Paraschriftlichkeit zu allgemeinen Erkenntnissen bezüglichder südgermanischen runischen Schriftlichkeit und des dieser Schriftkultur zugrunde-liegenden Schriftverständnisses zu gelangen. Es geht Gn rE. zunächst darum, das Verhältnisvon Schrift und Nicht-Schrift zu bestimmen und somit den Stellenwert der paraschrift-lichen Ritzungen zu ermitteln. Was etwa die häufigen "Schriftimitationen" und die lin-guistisch nicht deutbaren Runeninschriften anbelangt, so kommt Gnar zu dem Schluss,dass diese kaum als naive Schreibversuche von gänzlich Unkundigen zu deuten sind,l3sondern durchaus als wirksame Medien aufgefasst wurden, die den les- und deutbarenInschriften bisweilen gleichwertig zur Seite zu stellen sind. Häufig sei eine konkretesprachliche Bedeutung der Inschrift gar nicht wichtig und beabsichtigt, entscheidendsei vielmehr, dass der entsprechende Gegenstand beschriftet sei. Im Fall der Fibel vonPeigen formuliert Gnen bspw.:
"Es mag dabei flir die Besitzerin oder Trägerin der Fibel einerlei gewesen sein, was die Zer-chen 'bedeutet' haben. Wichtig war flir sie, dass auf ihrer Fibel Schriftzeichen standen, deren
Existenz für sie von wie auch immer gearteter Wirkmächtigkeit waren" (S. 126). Der Mehrwerteiner Beschriltung sei "nicht in deren Stellvertreterfunktion als codierte Speicherung von münd-licher Rede [zu] verstehen, sondern als integrierter Komplex, der sich selbst genügt und der aufPräsentation und Ostentation, zentral aber auch auf darüberhinausgehende Wirkungsabsichten
[...] ausgelegt ist" (S. 165).
13 Vgl. K,qrnn LürsI, South Germanic Runic Inscriptions as Testimonies of Early Literacy, in:Runes and their Secrets. Studies in runology, hg. von MAnrs SrornrNn u.a., Kopenhagen2006, s. 169-182.
Zeitschrift fi.ir deutsches Altedum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 140 . Heft 3 . 201 1 - O S. Hirzel Verlag, Stuttgart
370 Rezensionen
So misst derAutor etwa der Schriftimitation auf den Scheidenmundblechen von Eich-stetten und Bopfingen, die dem Träger zugewandt waren, eine apotropäische Funktionzu, die auf den Schutz der Waffe sowie ihres Besitzers abziele (S. 141, 162). Die mitOrnament vergesellschaftete runenähnliche Inschrift aufder Saxklinge von Hailfingenhabe hingegen die Aufgabe, "Schrifthaftes zu ostendieren bzw. inszenieren", wobeilat. waffenepigrafische Traditionen imitiert und unter dem Einfluss schriftmagischerVorstellungen umgedeutet worden seien (S. 111). Die von Düwpr- ins Spiel gebrachtebuchstabenmagische Kommunikation in der Sprache der Götter und Geister sowie an-dere magische Vorstellungen seien bei der Beurteilung von Paraschrift von besondererBedeutung (S. 36-48, 1 54).ra Entscheidend könne der Vorgang des Beschriftens gewesensein, den man sich (wie Zeugnisse derartiger Praktiken aus anderen Epochen nahelegen)als Teil eines größeren ritualhaften, medial wirksamen Handlungskomplexes vorstellenkönne (S. 39-41, l53ff .). Das Resultat selbst und insbesondere seine überprüfbare Kor-rektheit seien folglich nebensächlich gewesen. Zrr PerIe von Weingarten, deren Inschriftkaum mehr identifizierbar ist, heißt es:
"War schon bei der ursprünglichen Beritzung der Perle keine 'sinnvolle'(im modernen Sinn)Inschrift intendiert oder stecken arkanisierende Absichten hinter der Unkenntlichkeit der Zeichen,so spricht dies in keinem Fall gegen die eigentliche Funktion der Schdft, nämlich Schrift zu seinqua Schrift: in die Dauerhaftigkeit überführter Prozess einer einmaligen sprachlichen Handiung(Invokation und Beschriftung) oder Manifestation von Sprache als Sprachhandlung, Dokumenteines Faszinosums in einer Gesellschaft am Beginn der Schriftlichkeit" (S. 145).
Der gleiche Stellenwert, der sowohl Schrift als auch Schriftimitation und "sinnlosen"Runeninschriften zukomme, könne auch ornamentalen Darstellungen beigemessen wer-den. Dies gelte etwa flir Ornamentik, die sich aus Knoten-, Schlingen- und Netzmotivenzusammensetzt, dajenen eine apotropäische, bindende Kraft inhärent sei (S. 29-35). Indiesem Sinne sei auch das Flechtband auf dem Sax von Steindorf ebenso wirkmächtigwie die Inschrift auf der gegenüberliegenden Seite der Klinge (S. 104). Auch dort, woSchriftzeichen bzw. schriftähnliche Zeichen in ornamentaler Verwendung, in scheinbarsinnloser Reihung auftreten, wie es etwa auf der Bügelfibel vonAschheim (Aschheim I)der Fall zu sein scheine, sei nicht zwingend von einer Sinnentleerung auszugehen (S. 5 1 f.).
Nur in einzelnen Fällen unternimmt Gnar den Versuch, der tatsächlichen Bedeutungund Herkunft bestimmter symbolartiger paraschriftlicher Zeichen näher zu kommen undvermag dabei äußerst ansprechende Interpretationen zu formulieren. So etwa im Fall desstimmgabelförmigen Zeichens auf der Wurmlinger Lanze, das isoliert am Beginn derInschrift sowie inAneinanderreihung zu einem teils wabenartigen bzw. schriftähnlichenMuster zusammengesetzt auftaucht. Es wird mit der Symbolfunktion des Y-Zeichensverknüpft, das als littera Pythagoraebzw.furca Pythagorica seitder Antike als weggabel-Piktogramm aufgefasst und im Sinne eines "schicksalszeichens" verwendet worden sei(S. 77-84). Nicht zuletzt durch die Etymologien des Isidor von Sevilla sei das Y-Zeichenals Symbol des Lebensweges im Okzident verbreitet worden und habe von der Antike
l4 Dem Komplex der Magie ordnet Gup auch jene Inschriften zu, die Namen- oder objekt-nennungen darstellen (S. 44f., 53f.). Was Letztere anbelangt, so scheint ihm jedoch dereinschlägige Beitrag von Düwel entgangen zu sein: KrAUs DüwEL, Zu einem merkwürdigenInschriftentyp: Funktions-, Gegenstands- oder Materialbezeichnung?, in: Forschungen zurArchäologie und Geschichte in Norddeutschland (Festschrift Wolf-Dieter Tempel), hg. vonUrr-nrcn M,rsnr'ae.xrv, Rotenburg 2002, S. 27 9 -289.
ZeitschdftflirdeutschesAltertumunddeutscheLiteratur(ZfdA)Bmd140.Heft3.20l1 OS.HirzelVerlag,Stuttgart
Rezensionen 371
über das Mittelalter bis in die Neuzeit fortgelebt. Gnar verweist auf einen Beitrag vonTHsooor MovMSEN über die Wahl des Herkules am Scheideweg, die Arbeit von WoLpcaNcHanvs über das Y-Signum im Mittelalter und in der Neuzeit sowie FnaNz DonNsnrrrsBuch über das "Alphabet in Mystik und Magie".ls Ansonsten heißt es lediglich, dass
"die Form der furcae variieren kann" (S. 78). Hier hätte sich der Leser jedoch einigeanschauliche Beispiele, Beschreibungen oder besser Abbildungen der vermeintlichenParallelen aus Spätantike und Frühmittelalter gewünscht, um die tatsächliche Nähedes Wurmlinger Stimmgabelzeichens zu dieser Überlieferung besser einschätzen:ui;rdder Argumentation folgen zu können. Dies gilt auch flir die vermeintlichen Parallelenauf skandinavischen und südgermanischen Waffen und Buntmetallobjekten wie das
Ringknaufschwert von Kösching und einige gotländische Fibeln und Gürtelbeschläge.Auf diesen ist das besagte Zeichen aus (unterschiedlich großen) gestempelten Punktenzusammengesetzt und erinnert mit seiner mondsichelförmigen Gabel bisweilen eher an
die simplifizierte Darstellung eines Boviden.l6 Besonders hilfreich wäre eine Abbildungder Lanzenspitzen von Herbrechtingen (?) und Pflaumheim gewesen, auf denen das
Zeichen - wie im Fall von Wurmlingen - in durchlaufenden Linien zu sehen sei. Aufdem angefiihrten Riemendurchzug eines Spathagurts aus einem alamannischen Grab inJengen (Ostallgäu) sind mehrere Y-Zetchen (teils liegend) in eine Folge lat. Buchstabenintegriert. Die Parallele ist in der Tat bemerkenswert und hätte m.E. eine Abbildungverdient.lT Die Zeichen auf dem Stück von Jengen werden von Gner zunächst als "Y"bzw. "Y-Zeichen", dann jedoch als "Wurmlinger Zeichen" angesprochen, so dass manohne entsprechende Abbildung nicht recht weiß, wie das Zetchen nun tatsächlich aus-
sieht - stimmgabel- oder Y-förmig, was m.E. einen relevanten Unterschied ausmacht(S. 82). Auch bei der angeführten Münze des ostanglischen Königs Beonna, auf der einY-ähnliches Zeichen verblüffenderweise stellvertretend für REX zl stehen scheint,l8
sowie weiteren alamannischen Objekten, insbesondere aus dem Fundkomplex vonNiederstotzingen,le ist es bisweilen schwer, sich ein konkretes Bild von der Form des
15 Fn,q.NzDonNsrrrr,DasAlphabetinMystikundMagie(StoicheiaT),Leipzig21925;TrnooonMolrlrsnN, Petrarch and the Story of the Choice of Hercules, in: Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 16 (1953), S. 178-192; Wor-pceNc Henus, Homo Viator in Bivio. Studienzur Bildlichkeit des Weges (Medium Aevum 21), München 1970. Die bei H.q.nvs gebotenenAbbildungen stammen fast alle aus dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit.
16 HenvaNN D.r.NrurrvEn, Ein skandinavisches Ringknaufschwert aus Kösching, Ldkr. Ingolstadt(Oberbayern), in: Germania 52 (1974), S. 448-453. Siehe dort etwa Abb. 1b auf Taf. 56 miteiner kerbschnittverzierten Ringknopffibel von Trullhalsar, auf der die Mondsicheln sehr
deutlich sind. Der "Stimmgabel" von Wurmlingen am ähnlichsten sind die aus gleichgroßenPunkten zusammengesetzten Stempelmotive auf der Krötenfibel aus Visby (Taf. 56, Abb. 5b).
17 Gner verweist auf die Zeichnung der lnschrift bei Klaus Düwrr-, Runische und lateinischeSchriltlichkeit im süddeutschen Raum zur Merowingerzeit, in: Runische Schriftkultur inkontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, hg. von Klrus DüwEr,Berlin,A{ew York 1994,5.267 .
18 So bereits LootteNcl [Anm. 10], S. 263. Gnqe versäumt darauf aufmerksam zu machen, dassjenes Zeichen aufden Münzen des Beonna neben Runen auftritt.
1 9 Tatsächlich ist im Fal1 der Gürtelbeschläge aus Grab 12 schwer nachvollziehbar, wie aus der
komplexen Ornamentik ein Y- oder stimmgabelähnliches Zeichen herauszulesen sein soll:Prrnn Pnur-srN, Alamannische Adelsgräber von Niederstotzingen, Kreis Heidenheim (Ver-öffentlichungen des staatlichen Amtes für Denkmalptlege, Reihe A. Vor- und Frühgeschich-te l2ll),Stuttgart 1967, Taf. 31.
ZeitschriftfürdeutschesAltertumunddeutscheLiteratur(ZfdA)Bandl40.Heft3.20l1-OS.HiEelVerlag,Stuttgart
372 Rezensionen
entsprechenden Zeichens zu machen. Verwirrend wirkt sich aus, dass derAutor fast stets
den Begriff "Y-Zeichen" verwendet, auch dort, wo ein stimmgabelförmiges Zeichengemeint ist. Schließlich fasst der Autor das Stimmgabelzeichen von Wurmlingen als
Schicksalszeichen, Herrschaftszeichen oder Apotropaion auf (S. 84).Gneps methodischer Zugriff, mit dem er den Sinngehalt des Gabelzeichens zu ent-
schlüsseln versucht, ist m.E. der einzig taugliche: Zunächst wird eine möglichst um-fangreiche Sammlung von zeitlich und räumlich nahem Vergleichsmaterial, quasi einikonografischerbzw. signografischer20 Kontext geschaffen. Dass dieser Schritt bei derInterpretation eines vermeintlichen Sinnzeichens amAnfang zu stehen hat, dürfte sichvon selbst verstehen, doch ist er in dieser Weise - wenn ich richtig sehe - bisher nichtgegangen worden. Der zweite Schritt besteht darin, das Material nach aussageftihigenKonstellationen zu durchsuchen (hier etwa die Verwendung eines Y-ähnlichen Zei-chens als Ideogramm auf der ostanglischen Münze oder das wiederholte Auftreten aufPrunk-/Fahnenlanzen) und zu prüfen, inwiefern sichjene Aussagen und Informationenauf das Gesamtmaterial übertragen lassen. Im günstigsten Fall - wie eben im Fall derlittera Pythagorae können literarische Quellen zur Erhellung herangezogen werden.Auch wenn die archäologischen Parallelen nicht immer schlagend und die Schlussfol-gerungen somit nicht restlos überzeugend sind, halte ich Gnars Versuch für äußerstgewinnbringend und geradezu vorbildlich.
Auch die Bedeutung der Runenkreuze und g-runenähnlichen Zeichen versucht Gnapnach diesem Muster zu eruieren. Wie Gnar feststellt, begegnen kreuzförmige Zeichenim Umfeld der südgermanischen Runenüberlieferung auffailend häufig (etwa auf derBügelfibel B von Trossingen oder den Scheibenfibeln von München-Aubing und Kirch-heim/Teck, S. 131-138). Den Hintergrund dieserArt der "Beschriftung" sieht derAutoru.a. in der römischen Rechtstradition, welche die X-Markierwg (crux decussa) zwecksEigentumsbeglaubigung kennt. Diese Praxis habe auch in die germanischen Stammes-rechte Eingang gefunden. So zeugten insbesondere die 'Lex Visigothorum'und die 'LexBaiuvariorum' von der Verwendung des X-Zeichens als Eigentumsmarke. Angesichtsdieser Fakten sei es denkbar, dass das kreuzförmige Zeichen auf dem Ring von Bop-fingen oder auch das Runenkreuz aufdem Schwert von Schretzheim (wobei ferner diespätantik-christliche Monogrammtradition einwirken dürfe) als eineArl Eigentumsmarkeeine beglaubigende bzw. individualisierende Wirkung entfalten sollte (S. 118f., 131).
Was das Rautenmuster und das kleine Flechtband hinter den beiden Runenzeilenauf der Gürtelschnalle von Pforzen anbelangt, so argumentiert Gne.r auf Grundlage derAutopsieergebnisse von Pnrrn Preenn, der davon ausgeht, das die Vorritzung der nicht-runischen Zeichen vor der Vorritzung der Runeninschrift entstanden ist, und folgertrichtig: "'Zeilenfüllsel', wie sie Nedoma postuliert, sind die Ritzungen daher sicherlichnicht" (S. 91). Vielmehr seien sie "hochgradig motiviert bzw intendiert, und zwar ins-besondere in bezug auf ihre Position auf dem Inschriftenträger. Damit bilden sie einenebenso wichtigen Bestandteil der Ausarbeitung des Beschlags wie die Inschrift i. e. S."(S. 93). Vor dem Hintergrund seiner treffenden Ausführungen zu "Netz, Knoten, Schlinge"(S. 29-35), die sich im Wesentlichen auf die einschlägigen Arbeiten von Scssprerowrrzund Wsrcsnr stützen,2l deutet der Autor das Flechtband zunächst als Apotropaion, was
20 Ztm Begriff der Signographie siehe: ANonsas SrörzNtn, Signographie als eigenständigesFach, in: Signa I (22005), S.23-36.
21 Isnon ScrsprrI-owlrz, Das Schlingen- und Netzmotiv im Glauben und Brauch der Vö1ker
Zeitschrift fiiI deutschesAltertum und deutsche Literatur (ZfdA) Band 140. Heft 3 .2011 - O S. Hiruel Verlag, Stuttgart
Rezensionen 3',73
absolut einleuchtend ist. Das Zeichen am Ende der oberen Zeile bringt er, da es zwei
Rauten bildet, mit der mythischen Namendopplung am Anfang det Zeile (Aigil andiAilrün) in Verbindung. Es sei "grundsätzlich denkbar, dass der Paarigkeit mythischer
Wesen ein Symbol entsprach, das deren Vorbildcharakter auszudrücken vermochte"(S. 96). Diese vermeintliche Text-Bild-Relation verknüpft Gnen mit der im germanischen
Altertum mehrfach bezeugten Vorstellung der doppelten Anftihrerschaft, die sich in al-
literierenden Namenpaaren poetisch niederschlägt (Hengist und Horsa, Ibor und Agio).Auch wenn letzteres eine weniger stabile Hypothese darstellt, sind der Weitblick und die
erfrischend innovative Herangehensweise des Autors hier besonders deutlich und beacht-
lich. Die Positionierung der beiden Zeichen am Ende der Inschriftenzeilen ermögliche
es zudem, Überlegungen zu ihrer spezifischen Funktion anzustellen. So kommt Gnar zu
dem Schluss, dass eine Art Bekräftigungs-, Bestätigungs- oder Beglaubigungssignum
vorliegen könnte.Mit der ornamentalen, symbolischen, arkanisierenden und nachahmenden Verwendung
von Schrift sowie ihrer Vergesellschaftung mit Sinnzeichen, die einer ganz anderen,
älteren Tradition angehören, weist die südgermanische runische Schriftlichkeit typische
Merkmale junger Schriftkulturen auf, die in ähnlicher Weise auch im römisch-lateinischen
und griechisch-byzantinischen Kontext oder auch in Pergamenthss. des Frühmittelalters
begegnen. Schrift wird in jenem noch weitgehend illiteraten Umfeld nicht ausschließ1ich
als Codierung von Sprache aufgefasst, sondern kann darüber hinaus bzw. stattdessen
weiter reichende, nicht-sprachliche Inhalte transportieren und ist somit multifunktionalbzw. multimodal. Es liegt ein "offenes Schriftverständnis" zugrunde - eine Erkenntnis,
die für die Bewertung und Deutung südgermanischer Runeninschriften von großer Rele-
vanz ist. "Zur Entschlüsselung der Inschriften stellt die formal-linguistische Analyse
(graphematisch, etymologisch, d. i. phonologisch-morphologisch u.s.w.) nur einen von
mehreren notwendigen Zrgängen dar" (S. 16).
Etwas bescheiden ftillt die Bebilderung des Bandes aus. Vergleichsmaterial, das bei
einer derartigen Studie so enorm wichtig ist und vom Leser, sofem er Schritt für Schritt
folgen und beurteilen möchte, selbst betrachtet werden muss, wird nur im Fall der g-
runenähnlichenZerchen in Form vonAbbildungen geliefert (Abb. 9-14). Bisweilen sind
die besprochenen Zeichen auf den gebotenen Abbildungen nur schwer auszumachen
und im Detail nachzuvollziehen (etwa Abb. 11, 14, 17). Die gewählten Bilder (z.T'
ganzhervorragende Fotografien!) hätten es verdient, in Farbe und aufbesserem Papier
abgedruckt zu werden (ntmal es sich lediglich um 18 Abbildungen handelt). Auch wä-
ren Zeichnungen der Inschriften oder Hervorhebungen bestimmter Zetchen hilfreichgewesen.
Meiner positiven Einschätzung des Buches tut dieser Umstand jedoch keinen Abbruch.
MenrrN HeuNas Gn-a.r hat mit seiner Studie einen neuen Blick auf das Phänomen der
paraschriftlichen Zeichen im südgermanischen Kontext eröffnet und damit auch einen
(Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 12.2), Gießen 1912; HaNs Wrtcnnr, Die
Bedeutung des germanischen Ornaments, in: Festschrift für Wilhelm Pinder zum 60. Ge-
burtstag überreicht von Freunden und Schülern, Letpzig 1938, S. 81-i16. Zur Verbreitung
und Bedeutung von Fesselungsvorstellungen bei den Nordgennanen siehe nun auch: StclrtxoOpnnr, Merbeinerdarstellungen aufschwedischen Runensteinen. Studien zur nordgermanischen
Tier- und Fesselungsikonografie (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischenAlter-
tumskunde 72), Berlin,A{ew York 2011.
ZeitschriftfürdeutschesAltertumunddeutscheLiteratur(ZfdA)Bandl40.Heft3.201l OS.HirzelVerlag,Stuttgart
374 Rezensionen
wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der in vielerlei Hinsicht fremd anmutendenrunischen Schriftkultur geleistet. Sicher hätte wesentlich mehr Material in die Unter-suchung einbezogen werden können - angefangen bei dem F-ähnlichen Zeichen nebender Runeninschrift aufder Bügelfibel von Herbrechtingen, das im Buch von Gnep nichterwähnt wird, obgleich er die Fibel einbezieht (S. 112), bis hin zu einer ganzen Reiheparaschriftlicher Zeichen und Zeichenkomplexe, die von der Runenforschung bisher nochgar nicht zur Kenntnis genommen wurden.22In der von Gner vorgegebenen Weise wärenneben den südgermanischen Zeugnissen etwa auch die runenähnlichen Ritzungen aufaltsächsischer Keramik, die Sinnzeichen auf ostgermanischen Lanzenspitzen (S. 42f.)und das nordische Material, bei dem sich der Bogen von der römischen Kaiserzeit biszur ausgehenden Wikingerzeit23 spannen ließe, zu untersuchen. Den Anspruch, dieses
gesamte Material zu sichten und auszuwerten, wollte und konnte das vorliegende Buchselbstverständlich nicht erheben. Vielmehr ist dies Aufgabe zukünftiger Arbeiten, dienun aufden Erkenntnissen Gnars aufbauen und an seine Methodik anknüpfen können. Indiesem Sinne ist Menrm HeNNes Gnep ein echter Vorreiter, sein Buch eine Pionierarbeit.
Dr. Sigmund Oehrl, Universität Göttingen, Skandinavisches Seminar -Akademieprojekt "RuneS",Käte-Hamburger-Weg 3, D 37073 GöttingenE-Mail: [email protected]
22 Als Beispiel nenne ich die runenähnliche Schriftimitation auf einer Bügelfibel aus Grab 72von Flombom, Kr. Alzey-Worms: MoNtra LlNcE, Das fränkische Gräberfeld von Flombornin Rheinhessen (Der Wormsgau. Beiheft 38), Worms 2004, S. 101f. Viele weitere Objekte,die im vorliegenden Kontext von Interesse wären, sind bislang noch unveröffentlicht.
23 Hier ist das jüngst erschienene Buch von Mrnco BraNcur zu erwähnen, das sich auch mit"nicht-lexikalischen" Inschriften aufschwedischen Runensteinen beschäftigt. BrlNcsr kommtzu vergleichbaren Ergebnissen wie Gn.qr: "Diese Ritzungen mit nichtlexikalischen Inschriftenschliessen sich in alien wesentlichen Punkten mitAusnahme der Sprache an die Konventionendes Runensteingenres an und drücken Bedeutung auf die gleiche Weise aus, wie die übrigenRitzungen auf Runensteinen. [...] Nichtlexikalische Inschriften sind auf diese Weise zentralftir das Verständnis der spätwikingerzeitlichen Schriftkultur; sie sind zwar selten, kommenaber trotzdem vor und zeigen ein Verhältnis zur Schrift, das im Visuellen verankert ist. [...]Dagegen war es wichtig, dass die Schrift auf dem Monument präsent war, auch wenn diesekeine sprachliche Botschaft vermittelte" (vgl. Menco BreNcHr, Runor som resurs. Mkingatidaskriftkultur i Uppland och Södermanland [Runröm 20], Uppsala 2010, S. 233f.).
Zeitschrift ftr deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) Bmd 140 . Heft 3 . 201 I O S. Hirzel Verlag, Stuttgart