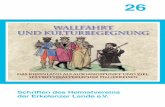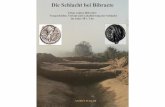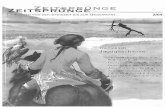Oldenburg Burnout Inventory - student version: cultural adaptation and validation into Portuguese
Eichfeld, I., 2007: Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg. In: H....
Transcript of Eichfeld, I., 2007: Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg. In: H....
BEIHEFTE DER BONNER JAHRBÜCHER
LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND
Rheinisches Landesmuseum Bonn
und
VEREIN VON ALTERTUMSFREUNDEN IM RHEINLANDE
Band 57
VERLAG PHILIPP VON ZABERN · MAINZ AM RHEIN
herausgegeben von
Hendrik Kelzenberg, Petra Kießling und Stephan Weber
Hans-Eckart Joachimzum 70. Geburtstag
gewidmet
Forschungen zurVorgeschichte und Römerzeit
im Rheinland
XXII, 354 Seiten; 189 Abbildungen, 2 Tabellen
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie (http://dnb.ddb.de)
Alle Rechte vorbehalten© Landschaftsverband Rheinland / Rheinisches Landesmuseum Bonn
Redaktion: J. Eichfeld, M. Göhlich, C. Jeuthe, K. Rehn, H. Ritzdorf, J. WegertSatz: www.wisa-lektorat.de
Druck und Einband: Druckpartner Rübelmann GmbH, HemsbachISBN 978-3-8053-3860-8
289
Die sichere Versorgung von Mensch und Tier mitTrink- und Brauchwasser ist eine wesentliche Vor-aussetzung für die Gründung dauerhafter ländlicheroder städtischer Siedlungen. Vor allem dort, wo kei-ne oder nur eingeschränkte Süßwasservorräte alsQuell- oder Oberflächenwasser zur Verfügung ste-hen, muss Trinkwasser mit Hilfe besonderer Einrich-tungen gewonnen werden1. So berichtet Plinius derÄltere in seiner naturalis historia (nat. hist. XVI, 2 – 6),dass die an der Nordseeküste lebenden Chauken Re-genwasser tranken, das sie vor ihren Häusern inGruben sammelten2. Tatsächlich werden bei Sied-lungsgrabungen in den vom Salzwasser beeinflus-sten Gebieten Norddeutschlands immer wiederBefunde aufgedeckt, die offenbar mit der Wasserver-sorgung in Zusammenhang stehen. EntsprechendeAnlagen – Zisternen für Trinkwasser, Fethinge fürBrauchwasser – wurden etwa bei Ausgrabungen aufder Feddersen Wierde oder in der schleswig-holstei-nischen Wurt Haferwisch nachgewiesen3. Andersals in den Gebieten in unmittelbarer Küstennähekonnte im Hinterland auf das Grund- und Oberflä-chenwasser zurückgegriffen werden. Während mandas Vieh zur Wasseraufnahme vermutlich an einenSee oder Fluss führte, wurde das Trinkwasser für dieMenschen spätestens seit dem Neolithikum demGrundwasser entnommen. Zu diesem Zweck wur-den in aller Regel Brunnen angelegt. Besonders zahl-reich sind die Belege für den Zeitraum zwischendem 1. und 5. Jahrhundert n.Chr. Ein bislang nur inVorberichten publizierter Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe lieferte dendrochronologische Daten und
Funde, die trotz ihrer großen zeitlichen Spannbreitefür eine kurze Lebensdauer der Brunnenanlage spre-chen4.
Die Fundstelle
Der Fundort Wardenburg-Oberlethe (FstNr. 21) liegtim Landkreis Oldenburg westlich der OrtschaftOberlethe in der Flur „Speckkamp“ auf einem Geest-rücken zwischen 15 bis 20m ü.NN. Der Untergrundbesteht aus Geschiebedecksand über Geschiebe-lehm, dem stellenweise eine Flugsanddecke wech-selnder Stärke aufliegt (Bodenkundliche Standort-karte Niedersachsen 1 : 200 000, Bl. Oldenburg). Ausdem Ausgangsmaterial haben sich Braunerden so-wie Pseudogley-Braunerden gebildet, örtlich herr-schen von Podsol unterlagerte Plaggenesche vor. DerFlurname „Speckkamp“ geht wahrscheinlich auf dieBezeichnung „Specken“ (neuniederdt.) bzw. „Spek-ke“ (mittelniederdt.) für Reisigbüschel oder dünneZweige zurück. Der Flurname ist in der Gegend häu-figer anzutreffen und auch als Ortsname verbreitet5.Möglicherweise bezieht er sich auf einen mit Knüp-pelhölzern oder Ästen befestigten Weg, über den dasGelände ehemals zu erreichen war6.
Auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche wa-ren schon in den 1960er Jahren zahlreiche Funde derRömischen Kaiserzeit zutage getreten, weshalb hierein Siedlungsplatz von größerem Ausmaß vermutetwurde7. Als 1987 bei der Reparatur einer Felddraina-
Ein kaiserzeitlicher Brunnenaus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
INGO EICHFELD
1 Vgl. Schöneburg 2006.2 Capelle 1929, 406.3 Feddersen Wierde: Haarnagel 1979, 168 – 172. – Hafer-
wisch: Meier 2001.4 U. a. Eckert 1989. – Herrn Dr. Jörg Eckert (Niedersächsi-
sches Landesamt für Denkmalpflege, Stützpunkt Olden-burg) danke ich für seine freundliche Hilfe und die Erlaub-
nis, die Funde und Befunde aus Wardenburg veröffentli-chen zu dürfen.
5 Specken, Lkr. Ammerland; Specken, Lkr. Diepholz; Speckenund Speckenholz, beide Lkr. Verden; Friesoythe-Specken,Lkr. Cloppenburg; Speckenbüttel, Land Bremen.
6 Ramsauer 1905, 110; Scheuermann 1995, 147.7 Steffens 1967.
290
ge ein kleiner Schacht ausgehoben wurde, konnteebenfalls eine große Menge Siedlungskeramik ge-borgen werden. Um den Befundzusammenhang zuklären, fand im Winter 1987/88 eine Ausgrabungstatt, in deren Verlauf eine etwa 100m2 große, zumTeil durch moderne Bodeneingriffe gestörte Flächearchäologisch untersucht wurde (vgl. Abb.1). Ne-ben zahlreichen Gruben, Pfostenverfärbungen undWandgräbchen konnte im östlichen Bereich der Gra-bungsfläche eine Brunnengrube mit den teilweise er-haltenen Resten der hölzernen Brunnenfassung frei-gelegt werden. Die ungefähre Lage des Brunnensinnerhalb der Siedlung sowie deren äußere Grenzenkonnten im Rahmen einer Oberflächenprospektionermittelt werden, die im November 1989 von der Ar-beitsgemeinschaft „Archäologische Denkmalpflege“der Oldenburgischen Landschaft durchgeführt wur-de8. Der Brunnen liegt demnach am Nordostrand ei-nes Bereichs mit erhöhtem Fundaufkommen, demwahrscheinlichen Zentrum der Siedlung (vgl.Abb.2). Die gesamte Siedlungsfläche erstreckt sichüber ein Gebiet von mindestens 2,5ha.
Der Brunnen
Etwa 0,60 bis 0,70 m unter der rezenten Oberfläche(ca. 20mü. NN) zeigte sich der Befund (BefNr.15) alseine ungefähr 3 ×4m große Verfärbung. Zur Klärungder Befundsituation wurden zunächst zwei Profilein O-W- und in N-S-Richtung im oberen Bereich derVerfärbung angelegt (Profile 1 und 2; Abb.1 und 3).Da bereits ab einer Tiefe von 0,8 bis 1m unter derOberfläche Grundwasser einströmte, konnten dieGrabungsarbeiten erst nach der Installation einerGrundwassersenkungsanlage fortgeführt werden.Beim weiteren Abtragen traten dann in einer Tiefevon ca. 1,60m (18,40 mü.NN) die ersten Holzresteund bald darauf auch die Umrisse der annäherndquadratischen Brunnenfassung von etwa 1 m äuße-rer Seitenlänge zutage. Ausgehend von einem weite-ren Planum in 2 m Tiefe (ca. +18,00 mü. NN) wurdendann zwei Profilschnitte (Profile 3 und 4; Abb.3 und4) in Richtung O-W und NNW–SSO angelegt. Einweiterer Profilschnitt (Profil 5; Abb.3) an der Nord-ostseite der Brunnengrube erfasste das gesamte Pro-fil von der Geländeoberkante bis zur Sohle der Brun-nengrube in ca. 2,40m Tiefe (17,60mü. NN).
Für die Anlage des Brunnens hat man offenbarzunächst eine muldenförmige Baugrube ausgeho-
gestörte Bereiche
1 2 m0Profil 1
Prof
il 2
Pro
fil 5Brunnen
Abb. 1 Grabungsplan Wardenburg-Oberlethe FstNr. 21 mit Einzeichnung der Profile 1, 2 und 5.
8 Eckert 1990.
Ingo Eichfeld
291
ben. Anschließend wurden unten angespitzte Pfählesowie halbrunde Hölzer und Bohlen von der Sohleder Brunnengrube durch den anstehenden Sand bisin den darunter liegenden Geschiebelehm getrieben.Bei einer erhaltenen Länge von bis zu 1,40 m reichtendie längsten Hölzer an der Südseite der Brunnenfas-sung bis zu 0,65 m unter die Grubensohle. An derAußenseite des Gevierts lagen horizontale Bretterund behauene Planken. Verzapfungen oder andereVerbindungen wurden nicht beobachtet. Die Kon-struktion wurde vermutlich allein durch den umge-benden Erddruck in Position gehalten. Die am bes-ten erhaltene Ostwand war noch etwa 0,50m hoch.Über die ehemalige Gesamthöhe kann keine sichereAngabe gemacht werden, da die Hölzer im oberenBereich abgefault waren. Als Bauholz wurde nebeneinem dünnen Birkenstamm überwiegend Eichen-holz verwendet. Außerdem konnten bereits wäh-
rend der Ausgrabung zwei offensichtlich sekundärverwendete Hölzer identifiziert werden, von deneneines eine Durchlochung aufwies. Beide waren alshorizontale Bretter in der Brunnenwand verbaut.Die aufgrund des hohen Grundwasserspiegels gutenErhaltungsbedingungen ermöglichten eine dendro-chronologische Untersuchung der Brunnenhölzer.Die absolutchronologischen Daten der insgesamtzehn bestimmbaren Hölzer lassen sich drei Zeitpha-sen zuordnen. Drei Hölzer gehören in die Zeit um241 n. Chr., sechs in die Jahre um 275/276 n.Chr. undeines der beiden sekundär verwendeten Hölzer indie Zeit nach 308 n.Chr., vermutlich in die Jahre um320 n.Chr.
Die Brunnengrube besaß in ihrem oberen Bereicheine Füllung aus fleckig-graubraunem Material(Schicht 1), das zwei weniger starke, dunklere undweitgehend homogene Schichten überlagerte
Anzahl der Streufundepro Geländeeinheit ( 20 x 20 m)
1
2–5
6–15
16–20
21–30
31–40
über 40
Grabungsfläche
0 50 100 m
Abb. 2 Wardenburg-Oberlethe. Übersichtsskizze der Oberflächenprospektion, durchgeführt von der Arbeitsgemein-schaft „Archäologische Denkmalpflege“ der Oldenburgischen Landschaft, November 1989.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
292
Profil 3+ 19,40 m NN
0
0,5
1,0
Profil 1
Profil 4Profil 2
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
+ 19,40 m NN + 18,10 m NN
+ 18,20 m NN
0 0,5 1,0 m
+ 20,10 m NN
4
K
7
10
8
9
65
1
238
1
2
3
8
1
2
4
5
3
8
9 6
5
10
Legende
fleckig-graubraun
dunkelgraubraun
mittelgraubraun
dunkelbraun, teilweise mit Holz durchsetzt
schwarzbraun, teilweise mit Holz durchsetzt
feine streifige Sandeinfüllung, unten torfartig mit Holz durchsetzt
feiner Schlämmsand mit eingeschlämmten Holzpartikeln
anstehender Sand, durch Brunnenwasserstände ausgewaschen
anstehender Geschiebelehm
sekundär verwendetes Holz
Keramik
1,5
Profil 5
1,5
2,5
2,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K
Abb. 3 Wardenburg-Oberlethe. Profilzeichnungen Nr. 1 – 5.
Ingo Eichfeld
293
(Schichten 2 – 3). Das Brunneninnere war oben mitfeinen streifigen Sandschichten verfüllt, die in ihremunteren Bereich torfartig mit teilweise vergangenenHolzstückchen vermischt waren (Schicht 6). Aufdem anstehenden Boden (Schicht 8), der durch dasBrunnenwasser stark ausgewaschen war, hatte sichfeiner Schlämmsand abgelagert (Schicht 7). Die seit-liche Anschüttung neben dem Brunnenschacht be-stand aus schwarzem, teilweise mit Holz vermisch-tem Sand, der zu den Rändern hin marmoriert undmit hellem Sand durchsetzt war (Schichten 4 – 5).
Die Funde
Neben Steinen, Eisenschlacke, verziegeltem Lehm(Abb. 6,12; mit Flechtwerkabdruck), Basaltlavafrag-menten und Webgewichten (Abb.6,11) konnten zahl-reiche Scherben römisch-kaiserzeitlicher Keramikaus dem Bereich des Brunnens geborgen werden.Die überwiegende Zahl der Scherben fand sich imoberen Teil der Brunnengrube (Schichten 1 – 3), wäh-rend aus der seitlichen Anschüttung (Schichten 4 – 5)und dem Brunnenkasten (6 – 7) nur wenige Fundegeborgen wurden.
Bei der Keramik handelt es sich um handgeform-te, durch reduzierenden Brand meist grau- bisschwarzbraun gefärbte Tonware. Als Magerungs-mittel war dem Ton überwiegend feiner bis mittel-grober Granitgrus beigemengt. Zu den am bestenerhaltenen Stücken gehören zwei Gefäßoberteile mitSchulterabsatz, senkrechtem Hals und Randlippe(Abb. 5,4.5). Beide lassen sich Gefäßen der Form IInach von Uslar9 an die Seite stellen, wenngleich dieRandlippe bei einem Exemplar (Abb.5,4) nurschwach ausgeprägt ist. Da die Fragmente lediglichbis zum Schulterumbruch erhalten sind, kann überdas Gefäßunterteil oder die Fußausbildung keineAngabe gemacht werden. Gefäße der Form II sindcharakteristische Erscheinungen der jüngeren Kai-serzeit des rhein-wesergermanischen Formenkrei-ses. Zu den ältesten Exemplaren gehören Grabfundeaus der Mitte des 2. Jahrhunderts, während Spätfor-men bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts vorkom-men. Vergleichsstücke zu den aus Wardenburg ge-borgenen Fragmenten lassen sich nicht nur aus demArbeitsgebiet von Uslars, sondern auch aus den wei-ter nördlich gelegenen Gebieten, dem nordöstlichenHolland, Nordwestniedersachsen und dem Nord-seeküstenbereich anführen. Demgegenüber sind sieöstlich der Weser nur sporadisch verbreitet. Wie einevon Krabath und Hesse erstellte und von Bischopergänzte Verbreitungskarte zeigt, ist die Form UslarII im Weser-Hunte-Gebiet häufig anzutreffen10. Wei-
Profil 5
Profil 4
Profil 3
+18,01 m NN
+10,40 m NN
0 0,5 1 m
Abb. 4 Wardenburg-Oberlethe. Oben: Planumszeich-nung des Brunnens (BefNr. 15) mit Einzeichnung der Pro-file 3, 4 und 5. Unten: Rekonstruktionszeichnung des
Brunnens (unmaßstäblich).
9 von Uslar 1938.10 Krabath/Hesse 1996, Abb. 28; Bischop 2001, Abb. 82.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
294
tere Parallelen zu den Funden aus Wardenburg-Oberlethe liegen etwa aus den Siedlungen Mahl-stedt, Gristede und Huntebrück-Wührden vor11. Ausdem ostfriesischen Raum lassen sich Übereinstim-mungen zum Beispiel aus Jemgum oder Leer-Wes-terhammrich anführen12. Die Funde aus Grapper-möns und Logabirum zeigen, dass diese Tonwareauch im Grabritus Verwendung fand13.
In das Umfeld der von Plettke herausgestelltenFormen A6 und B2 gehört das Bruchstück eines Ge-fäßes mit engmündigem, ausschwingendem Hals(Abb. 5,3)14. Gefäße der Form B2 wurden von Tisch-ler unter der Bezeichnung „Topf vom Cuxhaven-Galgenberg Typ“ zusammengefasst15. Diese Bezeich-nung schließt sowohl Töpfe mit Schulterhenkeln alsauch henkellose Gefäße gleicher Profilgebung ein16.Von ihren älteren Vorläufern mit scharf gewinkeltemRand, Plettkes Form B1 bzw. Tischlers „Töpfe vomWesterwanna-Typ“, unterscheiden sich diese Gefäßedurch das S-förmig gebogene Oberteil, das gelegent-lich in einer kleinen Randlippe endet. Beide Formensind typische Bestandteile der sogenannten Topfur-
nenfelder im Bereich östlich der Weser (z.B. Galgen-berg, Westerwanna), wo sie aufgrund von Fibelfun-den in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiertwerden. In der oberen Schichtenfolge der Wurt Fed-dersen Wierde treten sie gemeinsam mit der FormPlettke A6 auf17. Diese Gefäße, die über die FormPlettke A7 zu den sächsischen Buckelurnen überlei-ten, sind ebenfalls bauchig und engmündig. VomTyp Cuxhaven-Galgenberg unterscheiden sie sichdurch den mit Wulsten oder Ritzlinien abgesetztenHals sowie ihre oft reichere Verzierung. Allerdings
1 2
3 4
5 6
7 8
Abb. 5 Wardenburg-Oberlethe. Funde aus dem Brunnen. – M. 1 : 3.
11 Mahlstedt: Wegner 1981, Abb. 17 c. – Gristede: Zoller
1969, Abb. 7,3; Ders. 1975, Abb. 8,5.6. – Huntebrück-Wühr-den: Först 1991, z. B. Taf. 56,425 – 433.
12 Jemgum: Haarnagel 1957, Taf. 3,8.9. – Leer-Westerhamm-rich: Schmid 1965, Abb. 2,1.
13 Grappermöns: Marschalleck 1969, Abb. 3,1 – 2.5. – Loga-birum: Schmid 1969.
14 Plettke 1921.15 Tischler 1954, 48.16 Schmid 2006, 64 f.17 Schmid 2006, Taf. 82.
Ingo Eichfeld
295
wies bereits Schmid darauf hin, dass eine Unter-scheidung der verschiedenen Varianten der FormenA6 und B2 nicht immer möglich ist18. Das Bruchstückeines im Halsbereich S-förmig profilierten, eherweitmündigen Gefäßes lässt sich diesen Typen nurbedingt zuordnen (Abb.5,8). Eine gute Parallele, diezweifelsfrei der Römischen Kaiserzeit angehört,stammt aus dem Gräberfeld Bremen-Brinkum19.
Lediglich im Schulterbereich erhalten ist ein Ge-fäß, das sich durch einen geknickten Umbruch, einekurze gerade Schulter und einen abgesetzten Randunbekannter Profilgebung auszeichnet (Abb. 5,6).Obschon der fragmentarische Erhaltungszustandkeine sichere Zuweisung erlaubt, sei darauf hinge-wiesen, dass der betont scharfe Umbruch sowie diekurze konische Schulter kennzeichnende Merkmaleeiner Variante von Trichterschalen und Standfußge-fäßen sind, die aufgrund ihrer Profilierung häufigmit Gefäßen der Form Uslar I in Zusammenhang ge-bracht werden20. Wenn – wie hier – nur ein geringerTeil des Gefäßoberteils erhalten ist, lässt sich aller-dings nicht entscheiden, ob es sich um das Fragment
eines Standfußgefäßes oder einer Trichterschale han-delt. Gleiches gilt für eine zweite Variante, die sichdurch ihren weichen Umbruch und eine gewölbteSchulter auszeichnet. Aufgrund entsprechenderFundvergesellschaftungen in Gräbern vor allem desElbe-Weser-Dreiecks sowie der angeführten Parallel-erscheinungen im rhein-wesergermanischen Gebietwird für beide Gefäßformen eine Datierung von derMitte des 1. Jahrhunderts bis ans Ende des 2. Jahr-hunderts angenommen. Im Laufe des 3. Jahrhun-derts werden die beschriebenen Gefäße von einerTonware mit langgezogenen, aufgerichteten Rän-dern abgelöst21.
Mehrere Randfragmente lassen sich einer Gruppevon Gefäßen zuordnen, die sich durch ihre ausge-sprochene Weitmündigkeit auszeichnen. Hierzu ge-hören Randscherben mit kurzem, waagerecht abge-
1 2 3 4 5
6 7 8
9
10
1112 13
Abb. 6 Wardenburg-Oberlethe. Funde aus dem Brunnen. – 13 M. 1 : 4, sonst M. 1 : 3.
18 Schmid 2006, 65.19 Bischop 2001, Taf. 125,6.20 Först 1991, 82 f.; Schmid 1965, 23; Ders. 2006, 42 ff.21 Schmid 1965, 20.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
297
strichenem Rand, der nicht abgesetzt ist (Abb.7,4 – 5).Die besten Vergleichsformen finden sich in Gefäßendes Typs HB 4 der Siedlung Hatzum-Boomborg.Dort gehören sie zum Material des jüngeren Sied-lungshorizonts 6/7, der von der Spätlatènezeit bis indas 4. / 5. Jahrhundert n.Chr. reicht22. Übereinstim-mende Funde aus den Siedlungen Einswarden oderHuntebrück-Wührden sprechen ebenfalls für einfrühes Auftreten dieser Gefäße23. Andere Rand-scherben besitzen einen deutlich abgesetzten, nachaußen knickenden Rand, der mitunter leicht in dieLänge gezogen ist (Abb.7,3.6). Diese Randscherbenzählen zu den von Schmid24 herausgestellten weit-mündigen Terrinen, die sowohl in Siedlungen desKüstengebiets als auch auf Fundplätzen des Binnen-landes einen wichtigen Bestandteil der Siedlungswa-re des 2. / 3. Jahrhunderts ausmachen25. Nicht aufeine Zeitstufe zu beschränken ist das Vorkommeneinfacher kumpfförmiger Gefäße, die sowohl inSiedlungen der vorrömischen Eisenzeit als auch derRömischen Kaiserzeit anzutreffen sind26.
Das Fragment eines Gefäßes mit ausbiegendemRand und konischer Schulter (Abb. 7,7) ist an derRandaußenseite mit senkrechten Nagelkerben ver-ziert. Während die Formgebung kaum zeitliche An-haltspunkte liefert, spricht die Art der Randverzie-rung für eine Datierung in die fortgeschrittenereKaiserzeit. Parallelen lassen sich etwa aus der nie-derländischen Siedlung Wijster anführen, wo ent-sprechende Verzierungen vor allem an der Form IIB2vorkommen, die von van Es in das ausgehende 2.und frühe 3. Jahrhundert datiert wurde27. Auch Hal-paap betonte das hauptsächliche Vorkommen dieserRandverzierung während der jüngeren Kaiserzeit28.
Neben der verzierten Randscherbe fanden sichzahlreiche Wandungsscherben mit unterschiedlichenZierweisen. Eine Scherbe ist unterhalb des schulter-ständigen Griffknubbens mit einem Tannenzweig-muster versehen (Abb.6,8). Tannenzweigmuster undKnubben als Handhaben lassen sich kulturell nichtnäher eingrenzen. Zeitlich sind sie nach Först vor al-lem an Gefäßen des 2. / 3. Jahrhunderts bzw. des „jün-geren Fundhorizontes“ verbreitet29. Die engen Bezie-hungen zum rhein-wesergermanischen Raumunterstreichen einreihig verlaufende Schulterdellen(Abb.6,6), die vor allem in westfälischen Siedlungenan Gefäßen des 2. bis 4. Jahrhunderts anzutreffensind. Ein weiteres Kennzeichen der rhein-weserger-manischen Keramik sind die flächenhaft angebrach-ten Gruben mit seitlichem Wulst (Abb.6,3 – 5), die inden weiter nördlich gelegenen Siedlungen nur nochsehr vereinzelt auftreten30. Nach einer vermutlicheher selten genutzten Möglichkeit ihrer Anbringungwerden die Gruben mit seitlichem Wulst auch als Fin-gernageleindrücke bezeichnet31. Diese Zierweise ist
bereits auf spätlatènezeitlichen Gefäßen zu findenund innerhalb der Römischen Kaiserzeit zeitlich nichtenger einzugrenzen32. Letzteres gilt auch für rundeund ovale Einstiche, die als flächendeckendes Musterwie auch als Füllornament in Kombination mit verti-kalen (Abb.6,2) oder horizontalen Furchen (Abb.5,4;6,1) auftauchen. Diese Verzierungsart ist ebenfalls aufrhein-wesergermanischen Einfluss zurückzuführen.Demgegenüber stellen geometrische Verzierungenwie ineinandergestellte hängende Dreiecke (Abb.6,10.13), von parallelen Linien eingefasste Punkt-bzw. Einstichbänder (Abb.6,13), oder gegeneinander-gesetzte Schrägstrichbündel mit vertikalen Zwi-schenlinien (Abb.6,9) ein typisches Kennzeichen dersogenannten „chaukischen“ Keramik dar. Diese Or-namente treten gegen Ende der jüngeren RömischenKaiserzeit zugunsten „sächsischer“ Zierelemente zu-rück. Entsprechende Verzierungen in Form von Stem-peleindrücken, Dellen oder Rosettenmustern fehlenjedoch auf der Keramik aus Wardenburg.
Überregionaler Vergleich
Aus der Römischen Kaiserzeit und frühen Völker-wanderungszeit liegt eine große Zahl archäologischerschlossener Brunnenanlagen vor33. Einen Über-blick über die Verhältnisse in Norddeutschland ver-mittelt die Arbeit von Gaude, in der auch ältereFundmeldungen und der bis dahin erreichte For-schungsstand zusammenfassend wiedergegebenwerden34. Seither haben Neuentdeckungen und Ver-öffentlichungen, vor allem aus dem ostfriesischenRaum35, aber auch von anderen Fundorten36, dazugeführt, dass sich die Anzahl der bekannten Brun-nenanlagen aus der Zeit der ersten Jahrhunderten. Chr. Geb. weiter erhöht hat. Der Zuwachs verdeut-
22 Löbert 1982, 79 f. 95.23 Einswarden: Schmid 1957, 52 Taf. 7 (Keramikgruppe 4). –
Huntebrück-Wührden: Först 1991, 78.24 Schmid 1965, 20 f.25 Först 1991, 85.26 Först 1991, 92 f.; Schmid 2006, 56 f.27 van Es 1967, 301.28 Halpaap 1994, 107.29 Först 1991, 40; 42.30 Först 1991, 40.31 Krabath/Hesse 1996, 58; von Uslar 1938, 38 f.32 Halpaap 1994, 106; Krabath/Hesse 1996, 58; von Uslar
1938, 38 f.33 Vgl. allg. Hinz 1981; Ders. 1983.34 Gaude 1985.35 Bärenfänger 1998; Ders. 2000.36 Z. B. Bischop 2000; Dödtmann 1996.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
23
1821
24
20
31
22
27
30
1529
26
25
14
19
16
0 10 20 50 km
28
17
Abb. 8 Kaiser- und völkerwanderungszeitliche Brunnenanlagen in Nordwestdeutschland(großes Symbol: mehrere Nachweise am selben Fundort; vgl. Liste 1).
Ingo Eichfeld
299
licht, dass das in Abb.8 gezeigte Verbreitungsbildnur eine Momentaufnahme des gegenwärtigen For-schungs- und Publikationsstands sein kann. Zudemmuss in manchen Fällen die Frage offen bleiben, obes sich tatsächlich um einen Brunnen oder um eineGrube anderer Zweckbestimmung gehandelt hat37.
Das Spektrum der Befunde reicht von einfachenSchöpfstellen ohne Einfassung über Flechtwerk- undBaumstammbrunnen bis hin zu aufwendig gezim-merten Brunnenschächten mit Filtrier- und Schöpf-einrichtungen (vgl. Fundstellenkatalog). Für die Kon-struktionsweise und die Wahl des Baumaterialsdürften nicht zuletzt die vorhandenen Ressourcenund damit die naturräumlichen Gegebenheiten aus-schlaggebend gewesen sein. Wie im Mittelalter griffman auch während der Römischen Kaiserzeit undVölkerwanderungszeit in baumarmen Gegendenhäufiger auf Strauchwerk zurück, was die Verbrei-tung der Flechtwandbrunnen in den Gebieten derFluss- (Nr.6) und Küstenmarsch (Nr.9 – 11, 15, 20, 24,29) erklärt38. Ab dem Frühmittelalter sind für dasKüstengebiet auch Sodenbrunnen gesichert. Für de-ren Bau wurden vor allem getrocknete Torfsoden ver-wendet, da sich diese nicht nur zu passgenauen Bau-steinen zurechtschneiden lassen, sondern auch einegute Filterwirkung besitzen39. Möglicherweise wardieses Bauprinzip schon während der RömischenKaiserzeit bekannt. Ein aus Grassoden aufgemauer-ter Brunnenschacht auf der Feddersen Wierde (Nr.10)war jedoch ebenso wie eine aus Kleisoden bestehendeGrubenwand auf der Wurt Haferwisch (Nr.15) zu-sätzlich mit einer Flechtwand gesichert. Gaude gingdavon aus, dass bei einem weiteren Befund aus derSiedlung Flögeln (Nr.11), von Zimmermann als So-denbrunnen bezeichnet, eine Wandabsteifung ausFlechtwerk vorhanden gewesen sein muss40. Mittelal-terlich oder frühneuzeitlich ist ein auf einem Holz-rahmen errichteter Sodenwandbrunnen aus Brill,Lkr. Wittmund41. Nur für die Vorgängeranlage desKastenbrunnens von Stickenbüttel (Nr.28) ist eineTorfsodenwand mit einiger Sicherheit nachgewie-sen42.
Neben Flechtwerkbrunnen und möglicherweisezusätzlich versteiften Sodenbrunnen wurden auchHolzkonstruktionen errichtet. Nicht selten wurdenverschiedene Bautechniken miteinander kombiniert,so dass eine eindeutige Zuweisung nicht immer mög-lich ist. Nach der Art des Wandaufbaus lassen sichBlock- und Stabbauten, Eckpfostenkonstruktionenund Brunnen in Spundbauweise unterscheiden. Un-ter den Holzkonstruktionen stellen Stabbauten mitsenkrecht in den Boden getriebenen Hölzern diegrößte Gruppe (Nr.2, 10, 13, 15, 18 – 22, 24, 31). Um dieBrunnenwände gegen den Erddruck zu stabilisieren,wurden diese häufig mit einem inneren Rahmen aus
horizontalen Hölzern versehen. Diese Rahmen wei-sen in vielen Fällen sorgfältig bearbeitete und solideEckverbindungen auf (Nr.2, 13, 18, 24). Auch der Be-fund aus Wardenburg-Oberlethe ist in die Gruppeder Stabbrunnen einzureihen. Eine Besonderheit sindhier die von außen um den Brunnenkasten gelegtenHölzer.
Unter den in Blockbauweise errichteten Brunnensind diejenigen mit Eckvorstoß häufiger anzutreffen,während Brunnenkästen mit bündig verkämmtenoder verzapften Eckverbindungen (Nr.19, 20) dieAusnahme darstellen. Verhältnismäßig selten sindauch Pfostenkonstruktionen mit drei (Nr.16) odervier (Nr.5, 22) Eckpfosten sowie Brunnen in Spund-bauweise (Nr.13, 28). Bei den in Spundbauweise er-richteten Brunnen sind die vier Eckpfosten mit Nut-rinnen versehen, in die Bohlen eingelassen wurden,so dass eine dicht abschließende Wand entstand. Ab-solute Ausnahmeerscheinungen bilden aufwendiggezimmerte Anlagen wie der bereits erwähnte Brun-nen von Stickenbüttel (Nr.28), oder der bekannteBrunnen von Algermissen, Lkr. Hildesheim43. Ohnezeitgleiche Parallelen bleiben der Fund einer rechte-ckigen Holzeinfassung auf einem Unterbau aus Find-lingen in Grappermöns (Nr.12), die mit Steinen befe-stigte Schöpfstelle von Stickenbüttel (Nr.28) sowie einFassdaubenbrunnen aus Gristede (Nr.13). Unge-wöhnlich ist auch die Kombination von Stab- undBlockbau bei einer Anlage aus Speckenbüttel (Nr.27),die vom Ausgräber als Zisterne gedeutet wurde44.Für ihre Datierung in das 3. Jahrhundert stehen ledig-lich zwei Scherben aus dem Schachtinneren zur Ver-fügung.
Die mit Abstand häufigste Konstruktionsweisewar die Verwendung von Baumstämmen als Brun-nenröhre. Ob für diese Brunnen saftfrische Stämmeausgehöhlt oder – wie Zimmermann vermutete – aufim Wald vorgefundene, hohle Stämme zurückgegrif-fen wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen45.Möglicherweise wurden die Röhren hohler Stämmeradial erweitert, um sie dann durch Ausbrennen wi-derstandsfähiger gegen Fäulnis zu machen46. Daraufkönnten Brandspuren an Baumstammröhren aus Flö-geln (Nr.11), Bremen-Rekum (Nr.7), Gristede (Nr.13),
37 Bärenfänger 1998, 289.38 Gaude 1995; Hinz 1983.39 Bärenfänger 1995.40 Gaude 1995; Zimmermann 1992.41 Lehmann 2002, 181 f.42 Waller 1929.43 Jacob-Friesen 1925.44 Eggers 1973, 52.45 Zimmermann 1992, 293.46 Friedrichsen 1953/55, 210.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
300
oder auch Wijster47 hindeuten. In zwei Fällen wurdenvielleicht auch Klotzbeuten, also aus hohlen Baum-stämmen hergestellte Bienenstöcke, als Brunnenröh-ren verwendet (Nr.11, 13). Auffällig ist, dass die Zahlder Baumstammbrunnen im frühen Mittelalter starkzurückgeht48.
Für die Abtiefung der Brunnen kamen je nach Bau-weise der Schachtröhre verschiedene Verfahren inBetracht. Die für kaiser- und völkerwanderungszeitli-che Brunnen geläufige Bauweise scheint jedoch über-all das einfache, aber auch arbeitsintensive Aufbau-verfahren gewesen zu sein. Hierbei wurde zunächsteine trichter- oder muldenförmige Baugrube ausge-hoben, in die man dann die Brunnenfassung setzte.Bei den Eckpfostenkonstruktionen oder in Stabbau-weise errichteten Anlagen – so auch beim Brunnenvon Wardenburg – wurden die aufrechten Hölzermeist noch ein Stück weit in den Grubenboden getrie-ben. Die Verbreitung der einzelnen Brunnentypenlässt keine deutlichen Schwerpunkte erkennen. Anmanchen Fundorten überwiegen jedoch bestimmteBautypen (z.B. Baumstammbrunnen in Flögeln), sodass möglicherweise mit lokalen Bautraditionen zurechnen ist49.
Datierung und Nutzungsdauer
Für mehrere Brunnenanlagen liegen mit Hilfe derDendrochronologie oder der 14C-Methode ermittelteDatierungen vor (Nr.2, 11, 22). Wie in Wardenburg-Oberlethe zeigt sich nicht selten, dass die Alter derzum Bau verwendeten Hölzer um viele Jahrzehnteauseinander liegen. Dieser Befund lässt zwei Deutun-gen zu: Entweder wurden die Brunnen mehrfach re-pariert und ausgebessert oder es wurden bereits beimBau Hölzer unterschiedlichen Alters verwendet. Tat-sächlich wurden nicht nur während der RömischenKaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit immerwieder ältere Bauteile für den Brunnenbau genutzt.So fanden im mittelalterlichen Ostfriesland zum Bei-spiel Dachbalken oder auch Boots- und WagenteileVerwendung. In einem Fall wurden auch zwei ausge-diente Eggenbalken als Rahmenhölzer benutzt50.Ebenfalls aus Ostfriesland, jedoch aus der RömischenKaiserzeit, stammen zwei anthropomorph anmuten-de Hölzer, die im kleineren der beiden Brunnen vonBackemoor (Nr.2) gefunden wurden. Vom Ausgräberwird eine Primärverwendung als Zaunholz ange-nommen51. Ein dendrochronologisch ermittelter Al-tersunterschied von mehr als einem halben Jahrhun-dert veranlasste Bärenfänger zu der Vermutung, fürden Bau des größeren Brunnens sei auf älteres Holzzurückgegriffen worden, zumal frisches Eichenholz
aufgrund seines Gerbsäuregehalts für den Brunnen-bau ungeeignet sei52. Aus der späten Römischen Kai-serzeit oder frühen Völkerwanderungszeit stammendie Fragmente einer mehrteiligen Radfelge, die vonHahne aus einem Baumstammbrunnen in Hoya(Nr.19) geborgen wurden53. Die Felge diente mögli-cherweise der Versteifung des Brunnenschachts oder– zusammen mit weiteren Hölzern – als Brunnende-ckel. Weitere offenbar sekundär verbaute Hölzer lie-gen aus Brunnen der Siedlungen von Mahlstedt(Nr.22) und Bremen-Kirchhuchting (Nr.6) vor.
Möglicherweise wurde auch für den Brunnen ausWardenburg-Oberlethe kein frisches Holz verwen-det. In dem Fall könnte der Brunnen frühestens um320 n.Chr. errichtet worden sein. Da die jüngste Probejedoch von einem sekundär verbauten Holz stammt,ist zu vermuten, dass der Bau einige Jahre später statt-fand. In der Schachtverfüllung wurden zwei Gefäß-fragmente gefunden, von denen eines der Formen-gruppe Plettke A6 / B2 zugeordnet werden konnte(Abb.5,3). Dieser Fund macht es wahrscheinlich, dassdie Anlage nicht vor der zweiten Hälfte des 4. Jahr-hunderts verfüllt wurde. Mithin wäre der Brunnen,sofern das jüngste Holz die ungefähre Erbauungszeitangibt, über einen Zeitraum von etwa drei Jahrzehn-ten in Betrieb gewesen. Eine wesentlich längere Be-nutzung kann jedoch ausgeschlossen werden, da jün-gere Funde fehlen. Nimmt man jedoch an, dass dieAltersunterschiede auf Reparaturen oder Umbautenzurückgehen, ist eine sehr viel längere Nutzungsdau-er zu veranschlagen. Zwischen den ältesten Hölzernund dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Aufgabeliegen wenigstens 110 Jahre – ein Alter, das normaleHolzbrunnen auch mit aufwendigen Reparaturen si-cherlich nur selten erreichten, da das oberhalb vomGrundwasserspiegel liegende Holz nach etwa 30 bis50 Jahren verrottet war. Insbesondere bei den in Stab-bauweise errichteten Brunnen dürfte es kaum mög-lich gewesen sein, die fest eingerammten Hölzernachträglich auszuwechseln. Zwar lässt sich diemögliche Nutzungsdauer vorgeschichtlicher Brun-nen in vielen Fällen nur abschätzen, einzelne gut da-tierte Beispiele zeigen jedoch, dass die Lebensdauerauch massiver Holzkonstruktionen nicht viel mehrals 25 Jahre betrug54.
47 van Es 1967, 101.48 Bärenfänger 1995, 27.49 Vgl. Mertens 1998, 415.50 Bärenfänger 1995.51 Bärenfänger 2000.52 Bärenfänger 2000, 76 f.53 Hahne 1909.54 Z. B. Stäuble 2007.
Ingo Eichfeld
301
Zusammenfassung
Im Winter der Jahre 1987/88 wurden bei Ausgra-bungen in Wardenburg-Oberlethe Teile einer rö-misch-kaiserzeitlichen Siedlung mit den Überresteneiner hölzernen Brunnenfassung untersucht. NachAusweis des hier vorgestellten Scherbenmaterialsbestand die Siedlung während der ersten vier Jahr-hunderte n. Chr. In kultureller Hinsicht sind Anklän-ge sowohl zum „chaukischen“ Material des Nord-seeküstenbereichs als auch zum rhein-weserger-manischen Gebiet erkennbar. Die aufgrund des ho-hen Grundwasserspiegels guten Erhaltungsbedin-gungen ermöglichten eine dendrochronologischeUntersuchung der aus der Brunnenanlage geborge-nen Hölzer. Auch wenn nicht auszuschließen ist,dass der Brunnen mehrfach instandgesetzt wurde,scheint seine Nutzungsdauer auf wenige Jahrzehntebegrenzt gewesen zu sein. Darauf deuten nicht nurdie dendrochronologischen Daten, sondern auch dasaus der Brunnenverfüllung geborgene Scherbenma-terial hin.
Fundstellenkatalog
Die folgende Zusammenstellung kaiser- und völkerwan-derungszeitlicher Brunnen basiert auf den Angaben vonGaude (1995) und einer Durchsicht nordwestdeutscherSiedlungsgrabungen.
1 Arle, Lkr. Aurich1 × unklar.Lit.: Zoller 1986, 14 f.
2 Backemoor, Lkr. Leer2 × Stabbrunnen.Lit.: Bärenfänger 2000, 75 – 77 Abb. 2 – 4.
3 Bentumersiel, Lkr. Leer1 × unklar, 1 × Erdgrube ohne Fassung,1 × Brunnengrube mit Holzrahmen.Lit.: Brandt 1977, 22 f.
4 Bremen-Brokhuchting, Land Bremen1 × unklar.Lit.: Bischop 2000, 61.
5 Bremen-Grambke, Land Bremen3 × Kastenbrunnen mit Eckpfosten.Lit.: Wesemann / Witte 1990/91, 18 f. Abb. 3; Witte
1990/91, 464 – 468 Abb. 6 – 8; Witte 1994/95, 25Abb. 4; Witte 2000, 92.
6 Bremen-Kirchhuchting, Land Bremen4 × Kastenbrunnen (Blockbau),4 × Baumstammbrunnen, 6 × Flechtwerkbrunnen,5 × unklar.Lit.: Bischop 2000, 57 – 60 Abb. 84; Dödtmann 1996/97, 21 Abb. 3.
7 Bremen-Rekum, Land Bremen2 × ohne Fassung, 1 × Baumstammbrunnen.
Lit.: Brandt 1982/83, 216 Abb. 6; Ders. 1989, 107 –118 Abb. 14 – 17.
8 Driefel, Lkr. Friesland1 × ohne Fassung.Lit.: Michaelsen 1936; Ders. 1940, 18 f. Abb. 1 Taf. 1.
9 Eppingawehr, Lkr. Leer1 × Flechtwerkbrunnen, 1 × unklar.Lit.: Schroller 1940, 96.
10 Feddersen-Wierde, Lkr. Cuxhaven1 × Stabbrunnen, 1 × Kastenbrunnen (Blockbau),1 × Flechtwerkbrunnen, 1 × ohne Fassung, 3 × Fething.Lit.: Haarnagel 1979, 168 – 172 Taf. 149 – 155.
11 Flögeln, Lkr. Cuxhaven7 × Baumstammbrunnen, 1 × Flechtwerkbrunnen,1 × unklar.Lit.: Zimmermann 1992, 278 – 291 Abb. 222 – 234.
12 Grappermöns, Lkr. Friesland1 × Holzkonstruktion mit Steinfundament.Lit.: Fissen 1938, 24; Schroller 1936, 68 Abb. 18.
13 Gristede, Lkr. Ammerland3 × Kastenbrunnen (davon 1 × Spundbau),7 × Baumstamm, 5 × Stabbrunnen, 1 × Fassbrunnen,1 × unklar.Lit.: Zoller 1963, 145 f. Abb. 6; Ders. 1969, 138 – 140Abb. 4; 5 Taf. 17,1.2; Ders. 1972, 124 – 126; 132Taf. 20,2; 21,1; Ders. 1975, 46 f. 49; 51.
14 Groß Meckelsen, Lkr. Rotenburg / Wümme10 × unklar (möglicherweise Flechtwerk),1 × Holzkonstruktion.Lit.: – ; Mündl. Mitt. W.-D. Tempel.
15 Haferwisch, Lkr. Dithmarschen1 × Fething, 1 x Stabbrunnen, 2 × Flechtwerkbrunnen.Lit.: Meier 2001, 49 – 50; 52 Abb. 25 – 26 Beil. 8,9; 15 Taf. 4.
16 Hamburg-Farmsen, Land Hamburg1 × Kastenbrunnen mit Eckpfosten.Lit.: Westhusen 1953/55, 205 – 208 Taf. LXX.
17 Helle, Lkr. Ammerland3 × Holzbrunnen, 2 × unklar.Lit.: Zoller 1974, 165.
18 Hohegaste, Lkr. Leer2 × Stabbrunnen, 3 × unklar.Lit.: Stilke 1995, 206 – 208 Abb. 4.
19 Hoya, Lkr. Nienburg1 × Kastenbrunnen, 2 Baumstammbrunnen,1 × Stabbrunnen.Lit.: Hahne 1909, 68 – 76 Taf. XIV,2 – 6; XV,18 – 23.
20 Leer-Westerhammrich, Lkr. Leer4 × Baumstammbrunnen, 3 × Flechtwerkbrunnen,1 × Kastenbrunnen, 1 × Stabbrunnen, 1 × unklar.Lit.: Bärenfänger 1998, 290 Abb. 3 – 5; Fundchro-
nik 1996, 440 Nr. 200 Abb. 60; Fundchronik 1997,105 – 107 Nr. 169; Fundchronik 1998, 166 – 168 Nr. 271Abb. 103.
21 Loga, Lkr. Leer1 × Stabbrunnen.Lit.: Fundchronik 1995, 358 Nr. 323.
22 Mahlstedt, Lkr. Oldenburg1 × Kastenbrunnen (Blockbau), 1 × Kastenbrunnen mitEckpfosten, 1 × Stabbrunnen,1 × Baumstammbrunnen.Lit.: Wegner 1981, 49 – 51 Abb. 8 – 10.
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
302
23 Nenndorf, Lkr. Wittmund2 × ohne Fassung.Lit.: Kreibig 2006, 59; 126 Nr. 1; 190 f. Nr. 643Abb. 47 – 48.
24 Nortmoor, Lkr. Leer1 × Flechtwerkbrunnen, 1 × Stabbrunnen.Lit.: Bärenfänger 1998, 28 f. Abb. 2; Fundchronik
1995, 347 f. Nr. 299; Fundchronik 1996, 443 – 445Nr. 204; Fundchronik 1997, 108 Nr. 171.
25 Ostermoor, Lkr. Dithmarschen1 × unklar.Lit.: Bantelmann 1957/58, 65 Abb. 7 Taf. 3,6.
26 Osterrönfeld, Lkr. Rendsburg-Eckernförde2 × unklar, 1 × Speicherbecken.Lit.: Jöns 1993, 47 – 53 Abb. 27 – 28 Taf. 20 Anhang 4.
27 Speckenbüttel, Land Bremen1 × Kombination Stab- und Blockbau.Lit.: Eggers 1973, 52 Abb. 5.
28 Stickenbüttel, Lkr. CuxhavenDreiphasig: Steinbrunnen, Sodenbrunnen (?),Kastenbrunnen (Spundbau).Lit.: Waller 1929, 250 – 265 Abb. 2 – 14.
29 Tiebensee, Lkr. Dithmarschen1 × Flechtwerkbrunnen.Lit.: Meier 2001, 31 Abb. 13 Beil. 2.
30 Tofting, Lkr. Flensburg1 × ohne Fassung, 1 × Holzbrunnen.Lit.: Bantelmann 1955, 46 – 51 Abb. 8 – 10 Taf. 11,2;12 – 13.
31 Wardenburg, Lkr. Oldenburg1 × Stabbrunnen.Lit.: Eckert 1989, 18.
Bärenfänger 1995R. Bärenfänger, Pütt und Sod – Mittelalterliche Brun-nen in Ostfriesland als Geschichtsquellen. In: H. vanLengen (Hrsg.), Collectanea Frisica. Beiträge zur histo-rischen Landeskunde Ostfrieslands. Walter Deeterszum 65. Geburtstag. Abhandl. u. Vortr. Gesch. Ostfries-lands 74 (Aurich 1995) 11 – 43.
Bärenfänger 1998R. Bärenfänger, Archäologisches zur frühen Wasser-versorgung in Ostfriesland. In: G. M. Veh / H.-J. Rapsch(Hrsg.), Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasser-künsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung inNiedersachsen (Neumünster 1998) 288 – 294.
Bärenfänger 2000R. Bärenfänger, Kaiserzeitlicher Brunnenbau im ost-friesischen Backemoor. Arch. Niedersachsen 3, 2000,75 – 77.
Bantelmann 1955A. Bantelmann, Tofting. Eine vorgeschichtliche Warftan der Eidermündung. Offa-Bücher N. F. 12 (Neu-münster 1955).
Bantelmann 1957/58A. Bantelmann, Die kaiserzeitliche Marschensied-lung von Ostermoor bei Brunsbüttelkoog. Offa 16,1957/58, 53 – 79.
Bischop 2000D. Bischop, Siedler, Söldner und Piraten. In: M. Rech(Hrsg.), Siedler, Söldner und Piraten. Chauken undSachsen im Bremer Raum. Beih. Bremer Arch. Bl. 2(Bremen 2000) 9 – 82.
Bischop 2001D. Bischop, Die römische Kaiserzeit und frühe Völker-wanderungszeit zwischen Weser und Hunte. Eine ar-
AbbildungnachweisAbb. 1, 3 – 7 I. Eichfeld nach Landesamt für Denkmalpflege,Stützpunkt Oldenburg. – Abb. 2 nach Eckert 1990. – Abb. 8I. Eichfeld.
Literatur
chäologische Bestandsaufnahme des LandkreisesDiepholz (Oldenburg 2001).
Brandt 1977K. Brandt, Die Ergebnisse der Grabung in der Mar-schensiedlung Bentumersiel / Unterems in den Jahren1971 – 1973. Probl. Küstenforsch. 12, 1977, 1 – 31.
Brandt 1982/83K. H. Brandt, Neue Ausgrabungen und Funde in derFreien Hansestadt Bremen 1981 und 1982. Brem. Jahrb.60/61, 1982/83, 205 – 228.
Brandt 1989K. H. Brandt, Ausgrabungen in Bremen-Nord. Jahrb.Wittheit Bremen 31, 1989, 89 – 122.
Capelle 1929W. Capelle, Das alte Germanien. Die Nachrichten dergriechischen und römischen Schriftsteller. Erster Band:Frühgermanentum (Jena 1929).
Dödtmann 1996D. Dödtmann, Eine Siedlung der Römischen Kaiser-zeit und Völkerwanderungszeit aus Bremen-Kirch-huchting. Bremer Arch. Bl. N. F. 4, 1996/97, 17 – 22.
Eckert 1989J. Eckert, Wardenburg, Landkreis Oldenburg. Nachr.Marschenrat 26, 1989, 18.
Eckert 1990J. Eckert, „Ausgrabungen ohne Spaten“ bei Warden-burg. Mittbl. Oldenburgische Landschaft 66 I, 1990,10 – 11.
Eggers 1973R. Eggers, Fundchronik, Land Freie Hansestadt Bre-men. Bremer Arch. Bl. 6, 1973, 43 – 62.
Ingo Eichfeld
303
van Es 1967W. A. van Es, Wijster, A native village beyond the im-perial frontier 150 – 425 A. D. Palaeohistoria 11 (Gronin-gen 1967).
Fissen 1938K. Fissen, Von alten Brunnen im Oldenburger Lande.Kunde 6, 1938, 24 – 27.
Först 1991E. Först, Zur Besiedlungsgeschichte der Flußmarschim Kreis Wesermarsch. Veröff. Urgesch. Slg. Landes-mus. Hannover 37 (Hildesheim 1991).
Friedrichsen 1953/55O. Friedrichsen, Ein Brunnen der vorchristlichen Ei-senzeit aus Pinneberg-Waldenau. Hammaburg 4,1953/55, 205 – 208.
Fundchronik 1995Fundchronik Niedersachsen 1995. Nachr. Niedersach-sen Urgesch. 65/2, 1996.
Fundchronik 1996Fundchronik Niedersachsen 1996. Nachr. Niedersach-sen Urgesch. 66/2, 1997.
Fundchronik 1997Fundchronik Niedersachsen 1997. Beih. Nachr. Nieder-sachsen Urgesch. 1, 1998.
Fundchronik 1998Fundchronik Niedersachsen 1998. Beih. Nachr. Nieder-sachsen Urgesch. 2, 1999.
Gaude 1995B. Gaude, Brunnenanlagen der römischen Kaiserzeitund frühen Völkerwanderungszeit in Norddeutsch-land (unveröffentlichte Magisterarbeit, Univ. Kiel).
Haarnagel 1957W. Haarnagel, Die spätbronze-früheisenzeitliche Ge-höftsiedlung Jemgum bei Leer auf dem linken Ufer derEms. Kunde N. F. 8, 1957, 2 – 44.
Haarnagel 1979W. Haarnagel, Die Grabung Feddersen Wierde. Me-thode, Hausbau, Siedlungs- und Wirtschaftsformen so-wie Sozialstruktur. Feddersen Wierde 2 (Wiesbaden1979).
Hahne 1909H. Hahne, Bericht über Ausgrabungen bei Hoya.Jahrb. Prov.-Mus. Hannover 69, 1909, 68 – 76.
Halpaap 1994R. Halpaap, Der Siedlungsplatz Soest-Ardey. Boden-alt. Westfalen 30 (Mainz 1994).
Hinz 1981H. Hinz, Brunnen. Vorgeschichtliche und GermanischeBrunnen. RGA2 4 (Berlin, New York 1981) 7 – 11.
Hinz 1983H. Hinz, A. Römische, germanische und frühmittelal-terliche Brunnen. LexMA II (München, Zürich 1982)764 – 767.
Jacob-Friesen 1925K.-H. Jacob-Friesen, Die Ausgrabung einer urge-schichtlichen Zisterne bei Algermissen, Kr. Hildes-heim. Nachrbl. Niedersächs. Vorgesch. 2, 1925, 29 – 36.
Jöns 1993H. Jöns, Ausgrabungen in Osterrönfeld. Univforsch.Prähist. Arch. 17 (Bonn 1993).
Krabath / Hesse 1996S. Krabath /S. Hesse, Germanische Keramik. In: F.Siegmund u. a., Das Gräberfeld der jüngeren Römi-schen Kaiserzeit von Costedt. Bodenalt. Westfalen 32(Mainz 1996) 55 – 70.
Kreibig 2006N. Kreibig, Die bronze- und kaiserzeitliche Siedlungvon Nenndorf, Ldkr. Wittmund. Beitr. Arch. Nieder-sachsen 11 (Rahden / Westf. 2006).
Lehmann 2002T. D. Lehmann, Brill, Ldkr. Wittmund. Ein Siedlungs-platz der Römischen Kaiserzeit am ostfriesischenGeestrand. Beitr. Arch. Niedersachsen 2 (Rahden /Westf. 2002).
Löbert 1982H. W. Löbert, Die Keramik der Vorrömischen Eisenzeitund der Römischen Kaiserzeit von Hatzum / Boom-borg (Kr. Leer). Probl. Küstenforsch. 14, 1982, 11 – 122.
Marschalleck 1969K. H. Marschalleck, Frühkaiserzeitliche Brandgru-bengräber auf der ostfriesischen Geest. Neue Ausgr. u.Forsch. Niedersachsen 4, 1969, 150 – 157.
Meier 2001D. Meier, Landschaftsentwicklung und Siedlungsge-schichte des Eiderstedter und Dithmarscher Küstenge-bietes als Teilregion des Nordseeküstenraumes. Univ-forsch. Prähist. Arch. 79 (Bonn 2001).
Mertens 1998E.-M. Mertens, Überlegungen zur Wasserversorgungländlicher Siedlungen Norddeutschlands um ChristiGeburt. In: A. Müller-Karpe et al. (Hrsg.), Studien zurArchäologie der Kelten, Römer und Germanen in Mittel-und Westeuropa (Festschr. A. Haffner). Internat. Arch.Studia honoraria 4 (Rahden / Westf. 1998) 301 – 416.
Michaelsen 1936K. Michaelsen, Ein chaukisches Gräberfeld bei Driefelin Oldenburg. Kunde 4, 1936, 123 – 128.
Michaelsen 1940K. Michaelsen, Vier Friedhöfe der Chauken aus demOldenburger Land. Mannus 32, 1940, 178 – 211.
Plettke 1921A. Plettke, Ursprung und Ausbreitung der Angelnund Sachsen. Beiträge zur Siedlungsarchäologie der In-gväonen. Urnenfriedhöfe Niedersachsen 3,1 (Hanno-ver 1921).
Ramsauer 1905W. Ramsauer, Beiträge zur Flurnamenforschung. Ol-denburger Jahrb. 14, 1905, 88 – 119.
Scheuermann 1995U. Scheuermann, Flurnamenforschung. Bausteine zurHeimat- und Regionalgeschichte. Schr. Heimatpflege 9(Melle 1995).
Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg
304
Schmid 1957P. Schmid, Die vorrömische Eisenzeit im nordwest-deutschen Küstengebiet. Probl. Küstenforsch. 6, 1957,49 – 120.
Schmid 1965P. Schmid, Die Keramik des 1. bis 3. Jahrhundertsn. Chr. im Küstengebiet der südlichen Nordsee. Probl.Küstenforsch. 8, 1965, 9 – 72.
Schmid 1969P. Schmid, Die vor- und frühgeschichtlichen Grundla-gen der Besiedlung Ostfrieslands nach der Zeitenwen-de. In: J. Ohligs, Ostfriesland im Schutze des Deiches 1.Beiträge zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte desostfriesischen Küstenlandes (Pewsum 1969) 107 – 200.
Schmid 2006P. Schmid, Die Keramikfunde der Grabung FeddersenWierde (1. Jh. v. bis 5. Jh. n. Chr.). Probl. Küstenforsch 29(Oldenburg 2006).
Schöneburg 2006P. Schöneburg, Wasserversorgung. RGA2 33 (Berlin,New York 2006) 306 – 309.
Schroller 1936H. Schroller, Die Vorgeschichte des Jeverlandes. In:K. Fissen (Hrsg.), Tausend Jahre Jever – 400 Jahre Stadt(Oldenburg 1936) 55 – 81.
Schroller 1940H. Schroller, Die Friesen und Sachsen. In: H.Reinerth (Hrsg.), Vorgeschichte der deutschen Stämme1 (Leipzig 1940) 67 – 100.
Stäuble 2007H. Stäuble, Gigantische Fundgrube. Arch. Deutsch-land 1, 2007, 18 – 33.
Steffens 1967H.-G. Steffens, Eine kaiserzeitliche Siedlung auf derFlur ‘Speckkamp’, Wardenburg, Landkreis Oldenburg.Nachr. Niedersachsens Urgesch. 36, 1967, 186.
Stilke 1995H. Stilke, Siedlungsbefunde der Römischen Kaiserzeitund der Völkerwanderungszeit aus Hohegaste, StadtLeer. Probl. Küstenforsch. 22, 1995, 203 – 219.
Tischler 1954F. Tischler, Der Stand der Sachsenforschung, archäo-logisch gesehen. Ber. RGK 35, 1954 (1956) 21 – 215.
von Uslar 1938R. von Uslar, Westgermanische Bodenfunde des er-sten bis dritten Jahrhunderts nach Christus aus Mittel-und Westdeutschland. Germ. Denkm. Frühzeit 3 (Ber-lin 1938).
Waller 1929K. Waller, Der Stickenbütteler Brunnen. Prähist. Zeit-schr. 20, 1929, 250 – 265.
Wegner 1981G. Wegner, Eine Siedlung der römischen Kaiserzeit
und der Völkerwanderungszeit in Mahlstedt, Gemein-de Winkelsett, Ldkr. Oldenburg. Vorbericht über dieGrabungen 1979 – 1981. Arch. Mitt. Nordwestdeutsch-land 4, 1981, 43 – 63.
Wesemann/Witte 1990/91M. Wesemann/H. Witte, Neue Ausgrabungen in Bre-men-Grambke. Bremer Arch. Bl. N. F. 1, 1990/91,17 – 24.
Westhusen 1953/55F. Westhusen, Der Brunnen in der germanischen Sied-lung in Hamburg-Farmsen. Hammaburg 4, 1953/55,205 – 208.
Witte 1990/91H. Witte, Ein Beitrag zur Datierung völkerwande-rungszeitlicher Keramik auf dem Siedlungsplatz Bre-men-Grambke. Kunde N. F. 41/42, 1990/91, 461 – 492.
Witte 1994/95H. Witte, Ausgrabung 1993 in der sächsischen Sied-lung von Bremen-Grambke Bremer Arch. Bl. N. F. 3,1994/95, 24 – 34.
Witte 2000H. Witte, Frühgeschichtliche Besiedlung in Bremen-Grambke. In: M. Rech (Hrsg.), Siedler, Söldner und Pi-raten. Chauken und Sachsen im Bremer Raum. Beih.Bremer Arch. Bl. 2 (Bremen 2000) 83 – 105.
Zimmermann 1992W. H. Zimmermann, Die Siedlungen des 1. bis 6. Jahr-hunderts nach Christus von Flögeln-Eekhöltjen, Nie-dersachsen: Die Bauformen und ihre Funktion. Probl.Küstenforsch. 19 (Hildesheim 1992).
Zoller 1963D. Zoller, Die Ergebnisse der Grabung auf dem Gri-steder Esch, Kr. Ammerland, in den Jahren 1960 – 1961.Neue Ausgr. u. Forsch. Niedersachsen 1, 1963, 132 –151.
Zoller 1969D. Zoller, Die Ergebnisse der Grabung Gristede, KreisAmmerland, im Jahre 1966. Neue Ausgr. u. Forsch.Niedersachsen 4, 1969, 131 – 149.
Zoller 1972D. Zoller, Die Ergebnisse der Grabung Gristede, Kr.Ammerland, 1967 – 1970. Neue Ausgr. u. Forsch. Nie-dersachsen 7, 1972, 111 – 134.
Zoller 1974D. Zoller, Notgrabung einer kaiser- bis völkerwande-rungszeitlichen Siedlung auf dem Esch des Dorfes Hel-le, Gem. Zwischenahn, Kr. Ammerland. Nachr. Nieder-sachsen Urgesch. 43, 1974, 165.
Zoller 1975D. Zoller, Die Ergebnisse der Grabung Gristede, Kr.Ammerland, 1971 – 1973. Neue Ausgr. u. Forsch. Nie-dersachsen 9, 1975, 35 – 57.
Zoller 1986D. Zoller, Arle, Gemeinde Großheide, Landkreis Au-rich / Ostfr. Nachr. Marschenrat 23, 1986, 14 f.
I. Eichfeld, Ein kaiserzeitlicher Brunnen aus Wardenburg-Oberlethe, Lkr. Oldenburg


























![Giger_Menzel_Wiemer Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia [= Studia Slavica Oldenburgensia 2]. Oldenburg 1998](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225cfc61d7e169b00c98c0/gigermenzelwiemer-lexikologie-und-sprachveraenderung-in-der-slavia-studia-slavica.jpg)