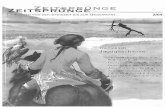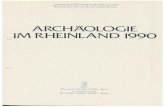Die Mittlere Steinzeit im südlichen Rheinland-Pfalz. In: N.J.Conard & C.-J.Kind (Hrsg.) Aktuelle...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Mittlere Steinzeit im südlichen Rheinland-Pfalz. In: N.J.Conard & C.-J.Kind (Hrsg.) Aktuelle...
Urgeschichtliche Materialhefte 12, Tübingen 1998: 111-120
Die Mittlere Steinzeit im südlichen Rheinland-Pfalz
Erwin Cziesla Wurzel Archäologie GmbH. Fasanenstr. 25 b & d, 14532 Stahnsdorf, Deutschland
Summary
Before 1980, published sources suggested that the numerous caves in the Palatinate Forest generally remained unoccupied during the Mesolithic. No open air occupation was known during the Mesolithic in the area enclosed by the drainages of the Rhine, the Saar and the Moselle Rivers. However, as a result of intensive archaeological work during the last decade, this notion has been disproved. Beginning in the Pre-Boreal and ending in the Early Atlantic, the complete Mesolithic sequence has been recorded using data from more than one hundred sites. In the first two thousand years of Mesolithic occupation, this regionwas dominantly influenced from the south and west, as indicated by comparisons to sites in France and Luxembourg. Gradually, distinct, regional characteristics of the Palatinate became noticeable. During Final Mesolithic times a complex relationship had developed in the Rhinehessian Palatinate area: Regional Mesolithic tribes lived in the hilly region during the 6th Millennium BC, while contemporaneous La Hougette herders and early agriculturalists were also present. Future research should be directed toward studying the interaction between late hunting and gathering groups and the early Neolithic societies of the region.
Zusammenfassung
Nach Auskunft der archäologischen Fachliteratur des Pfälzer Raumes galt die Pfalz zur Steinzeit als unbesiedelt. Seit Mitte der 80er Jahre gehört diese Meinung zur überhc•lten Forschungsgeschichte. Im pfälzischen Raum liegt, beginnend mit dem präborealen Fundplatz Kleine Kaimit bis hin zur ausgegrabenen Fundstelle im Weidental bei Wilgartswiesen, die in ein frühes Atlantikum zu datieren ist, eine nunmehr\ Ollständige mesolithische Sequenz vor. In den ersten zwei Jahrtausenden des Frühmesolithikums wurde diese Region vornehmlich aus dem Südwesten, aus dem französisch- IuxemburgischenRaum beeinflußt. Dann nahmen auch andere Regionen Einfluß, zudem wird eine allmähliche Regionalisierung neben einer allgemeinen Verkleinerung der Mikrolithen erkennbar, die schließlich zu einer eigenständigen Region, als Palatinat bezeichnet, führte. Das Ende des Mesolithikums in diesem Raum, d.h. im Bergland der Pfalz und in der rheinischen Tiefebene der Vorderpfalz, ist geprägt durch ein komplexes Kulturgeschehen. Im 6. vorchristlichen Jahrtausend lebten in diesem Raum nicht nur regionale, mesolithische Jäger und Sammler-Gruppen, sondern gleichzeitig La Houguette-Viehhirten neben bandkeramischen Bauern, die hier zwar gleichzeitig ihr Auskommen fanden, wo es aber möglicherweise aufgrund kultureller Andersartigkeit auch zu konkurrierenden Gesellschaften kam, wie bei den biblischen Brüdern Kain und Abel.
Forschungsgeschichte
Im südlichen Rheinland-Pfalz, d.h. im Dreieck zwischen den Flüssen Mosel, Saar und Rhein (Abb. 1), hat die Forschung zur Mittleren Steinzeit kaum Tradition. Lediglich F. Sprater bemühte sich in der ersten Häfte unseres Jahrhunderts auch diesen Zeitabschnitt ln eine allgemeine pfälzische Geschichtsbetrachtung mit einzubeziehen, wenngleichaufgrundder schlechten Fundlage mit nur geringem Erfolg (vgl. Sprater 1928; 1948). Selbst nach Landesauf- , nahmen in den Landkreisen Kirchheimbolanden und Kusel wurde die Vermutung geäußert, daß Funde aus der
i Mittleren Steinzeit nicht oder kaum vorhanden seien (Bantelmann 1972; Kriese! 1978). Auch die an natürlichen Höhlungen und Felsunterschlüpfen reiche Buntsandsteinregion wurde nicht, ganz im Gegensatz zu den süddeut-
UM 12, 1998
Abb. I Verbreitungskarte sämtlicher mesolithischer Fundstellen zwischen Mosel, Saar und Rhein. (Zur Liste der Fundstellen vgl. E. Cziesla 1992, 271; Sterne geben La Houguette-Fundorte an). 21 Maudach-Husarenbuckel 39 Obersulzbachtal 56 Waldfischbach-Burgalben 60 Schmitshausen I 72 Weidental-Höhle 73 Kleine Kaimit
Erwin Cziesla
sehen Kalkhöhlen, als potentielles steinzeitliches Wohngebiet verstanden. Bereits 1918 schrieb der Nestor der Pfälzer Heimatgeschichte, Daniel Häberle (1918), daß "bei der genaueren Untersuchung einzelner Höhlen ... durch Fachleute kaum wichtige Ergebnisse zu erwarten seien, die ein Licht auf die Frühgeschichte unserer Heimat werfen könnten". Aufgrund dieser Überlegungen stagnierte die Forschung, die Denkmalbehörde tat ihr übriges, und die vermeintliche These einer Siedlungsleere zur Steinzeit schien bestätigt.
Diese Siedlungsfeindlichkeit war allgemein anerkannte Meinung. Besonders während des Mesolithikums stellte sich die Pfalz als weißer Fleck auf den Verbreitungskarten dar. Jedoch lagen in kleinen Privatsammlungen die ersten Funde bereits vor, die dieses Bild hätten revidieren können. So waren bereits 1928 in der Branntweinhöhle bei Pirmasens Steinartefakte ausgegraben worden; seit 1943 wurden regelmäßig "Aufm Benneberg" bei Waldfischbach-Burgalben Oberflächenfunde abgesammelt, und neben Fundbergungen auf anderen mesolithischen Fundstellen, u.a. Maudach und Rheingönheim in der Rheinebene, waren es besonders die Bergungen auf der Kleinen Kaimit bei Ilbesheim in den Jahren 1962 und 1963, die hier zu nennen sind.
Den eigentlichen Anstoß zur Erforschung des Mesolithikums im südlichen Rheinland-Pfalzlieferte jedoch eine Ausgrabung in einer kleinen Höhle bei Wilgartswiesen, die vom Lehrer W. Ehescheid 1971 durchgeführt wurde. Diese spärlichen Funde waren Anlaß für Verf., zwischen 1980 und 1989 in der Weidental-Höhle mehrere Ausgrabungen durchzuführen. Gleichzeitig wurden an anderen Stellen Untersuchungen vorgenommen, Privatsammlungen gesichtet und eine Gesamtaufnahme aller Pfälzer Fundstellen vom Mittelpaläolithikum bis einschließlich Frühneolithikum angestrebt.
Die mittlere Steinzeit in Rheinland-Pfalz UM 12, 1998
Zusammengefaßt wurden die Ergebnisse von Verf. (vgl. Cziesla I992a), weitere Fundplätze sowie Übersichten wurden ergänzend nachgeliefert (Cziesla 1994, I 997). Jetzt gilt der Pfälzer Raum mit seinen mehr als I 00 mittelsteinzeitlichen Fundstellen (vgl. Abb. I) nachweislich als kontinuierlich besiedelt und als gut erforschte Region. Die folgende Sequenz vom Präboreal bis Früh-Atlantikum, d.h. vom 8.-5. vorchristlichen Jahrtausend konnte so vollständig wie in kaum einem anderen Bundesland erarbeitet werden.
Typologie und Formenkunde
Da aus dem südlichen Rheinland-Pfalz- wie auch in den meisten mitteleuropäischen Fundregionen- aus der Mittleren Steinzeit keine absoluten Datierungen vorliegen, erfolgt die Gliederung des Fundstoffes auf Basis typologischer Betrachtungen. So werden Fundsequenzen aber auch grundsätzliche typologische Untersuchungen aus den Nachbarregionen zum Vergleich herangezogen. Hierbei sind besonders die Region südwestlich und westlich der Pfalz zu nennen (vgl. hierzu die Arbeiten von Thevenin 1990; 1991; 1995 und den Beitrag in diesem Band), das Iuxemburgische Territorium (vgl. hierzu Spier 1991; 1994) und nicht zuletzt der süddeutsche Raum (Nuber 1954; Taute 1975). Die erarbeiteten oder ausgegrabenen Mikrolith-Sequenzen haben dabei grundsätzlichen Bestand und lassen sich auch in weiter entfernten Regionen wiederfinden (vgl. u.a. Cziesla 1992b, Eickhoff 1992; Cziesla u. Eickhoff I 995), wobei regionale Besonderheiten und auffallende Sonderformen stets zu berücksichtigen sind 1 ). So hat man z.B. im pfälzischen Raum dem Vorhandensein bzw. der Ausprägung der Basis bei den präborealen Mikrospitzen keine solche Bedeutung zuzumessen, wie dies z.B. im süddeutschen Raum in den ergrabenen Sequenzen zu erkennen ist und von W. Taute (I 975) besonders herausgestellt wurde.
Auch die hier verwendeten Begriffe wurden aus dem süddeutschen Raum übernommen, wenngleich gelegentlich differenziertere Sinninhalte mit ihnen verbunden werden (vgl. hierzu Cziesla u. Tillmann I 984). Grundsätzlich gliedert sich das Mesolithikum in Rheinland-Pfalz in ein Präboreales und Boreales Frühmesolithikum mit den typologischen Einheiten Beuronien A, BI und B2, ein boreales Mittel-Mesolithikum mit der Stufe Beuronien C sowie ein bislang schwer zu definierendes regionales Spätmesolithikum (Palatinat) ohne Viereck-Mikrolithen.
Chronologie und Fundinventare
Präboreales Frühest-Mesolithikum und Beuronien A
Aus dem frühesten Abschnitt des Mesolithikums (ca. 8000-7000 v. Chr.) liegen uns au~ diesem Raum gleich zwei der seltenen Fundorte vor. Zunächst zu nennen ist die Kleine Kaimit bei Ilbesheim, die noch in den 70er Jahren als einzige pfälzische Fundstelle aus der Steinzeit galt. Der hohe Bekanntheitsgrad dieser Fundstelle geht nicht zuletzt auf W. Taute zurück, der im Mai I 963 als Tübinger Assistent auf diesem exponierten vorderpfälzer Höhenrücken eine "Schürfung" vornahm. Außer in seiner Habilitationsschrift (I 971) kam das Material dieser Untersuchung jedoch nicht zur Veröffentlichung. Anders dagegen die Funde, die von den beiden an der Maßnahme beteiligten Freizeit-Archäologen, A. Mora und W. Storck (1963), geborgen wurden und vom Verfasser (Cziesla 1994) vorgelegt wurden.
So konnten neben dem von W. Taute untersuchten Fundareal (Fundstelle 1 südwestlich der Kapelle) fünf weitere Fundstellen im Bereich des Höhenrückens lokalisiert werden, die vermutlichjedochjünger sind. Die Fundstelle Kleine Kaimit 1 datiert aufgrunddes Vorherrschens der schräg endretuschierten Mikrospitzen, des FehJens der ungleichschenkligen Dreiecke sowie des hohen Anteils von Segmenten (vgl. Abb. 2, 1-35), zweifelsfrei an den Beginn des Präboreals.
A. Thevenin (1990, Abb. I 8) sieht in diesem Fundmaterial unmittelbare Vergleiche zu Fundstellen aus dem luxemburgisch-ostfranzösischen Raum und schlägt eine präboreale, weit nach Westen und Süden ausgreifende Verbreitungsgruppe mit der Bezeichnung Verseilles-le-Bas und Kleine Kaimit vor (Thevenin 1995, 225 ff.), deren kulturelle Ursprünge in der (regionalen) Ahrensburger-Kultur zu suchen sind.
Anders dagegen ist die kulturelle Herkunft des zweiten präborealen Fundplatzes aus der Pfalz zu sehen, der Fundstelle Obersulzbachtal. Hier vermutet A. Thevenin (I 995, 26 I) eine Fortentwicklung aus dem lokalen Federmesser-Substrat, wobei sich diese beiden pf<ilzischen frühmesolithischen Inventare sehr nahe stehen. Dieser sehr
I Bei der Vetwendung der Begriffe "Mesolithikum" oder "Mittlere Steinzeit" werden die Klimaphasen Aller\'Sd und Jüngere Dryas-Zeit nicht mit einbezogen, wie dies noch gelegentlich vorkommt (Bosinski 1995, 850). Die Kulturgruppen
1des Spätpaläolithikums (u.a. die auch im pfalzischen Raum durch Funde belegten Federmessergruppen) sind somit nicht Bestandteil dieser Betrachtung.
11'1
UM 12, 1998 Erwin Cziesla
~1 ~.243 '~~0~11~L . \ • • • \ a • • f
•
~·~. {ij,'?: ~~' ~-. 4).' ·~ \ ~: . -· . ,' . '·. . .. ' ~ . ~. 15 I • i 16 - . 17 " ~ 18 ' · - 19 ·. :. : 20 21
0~--~---L---L--~ __ _Jscm
IL • " •
~A36 M:\37 ~d)~ ~ ~~ JA~41 ~~42 ~i!~ ~~~ ~ Ii~ At ~·~ ~~ ~~ ~w <l 4s2 ~~ 4~ ~~ ~~ <I&
Abb. 2 Auswahltypischer präborealer Mikrolithformen von der Kleinen Kaimit (Fundstelle I; oben: 1-35) und von Obersulzbachtal bei Kaiserslautern (unten: 36-57).
große, ca. 8 km nordnordwestlich von Kaiserslautern in einem Quertal zur Lauter gelegene Fundplatz, der an die Wende vom Beuronien AzuBI datiert, wurde über Jahre systematisch abgesammelt. Bedauerlicherweise ließ aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit der Denkmalbehörde das Interesse des Sammlers nach, noch bevor es zu einer umfangreicheren Veröffentlichung kam. Wenige Stücke wurden bislang vorgelegt (Becker 1986), die jedoch eine erste Stellungnahme erlauben. So wird die Anzahl der schräg-endretuschierten Formen geringer und Mikrospitzen mit konkaver Basis dominieren. Zudem leiten die Segmente und zahlreich vorhandenen gleichschenkligen Dreiecke in den nächstjüngeren Zeitabschnitt über (vgl. Abb. 2, 36-57).
Präboreales und Boreales Früh-Mesolithikum- Beuronien Bl
Im ersten Abschnitt des folgenden Boreals (ca. 7000 bis ca. 6500 v. Chr.) wurden in Südwestdeutschland als Pfeil-; bewehrungen vorwiegend gleichschenklige Dreiecke sowie Mikrospitzen mit gerader oder leicht konkaver Basisretusche hergestellt. Neben wenigen anderen Fundstellen lieferte der vorderpfälzische, nördlich von Schifferstadt
114
Die mittlere Steinzeit in Rheinland-Pfalz UM 12, 1998
-®-0 c;. 1a
~ 1 • • 27cm
34cm
0 -'<m
Abb. 3 Auswahl typischer borealzeitlicher Mikrolithen und Geräte (Beuronien BI) vorn Fundplatz Maudach-Husarenbuckel, Schlagplatz 2a (1-24). Die Zentimeter-Angaben bei den zusammmengepaßten
Artefakten beziehen sich auf eine Einzel-Bergung unter Oberfläche.
gelegene Fundplatz Maudach-Husarenbuckel, und hier speziell der eng begrenzte sogenannte Schlagplatz 2a (Storck 1957; Cziesla 1992c, 87), ein solches typisches Inventar (Abb. 3). Die Einheitlichkeit des Inventars konnte auch durch Zusammenpassungen untermauert werden, ein für mesolithische Fundstellen seltener Beleg. Das Fundensemble läßt aufgrundseiner gleichschenklig-spitzwinkligen Dreiecke weitreichende Vergleiche nach Luxemburg, in den Aachener Raum sowie zu den süddeutschen Fundplätzen Backnang, Birkenäcker und zur Jägerhaus-Höhle, Schicht 10-12, zu (dazu ausführlich Cziesla u. Tillmann 1984,95 ff.; Cziesla 1992a, 58 ff.; Cziesla 1992c, 84 ff.).
Die Rohmaterialien von diesem Fundplatz sind von besonderer Bedeutung, da sie ein weitreichendes Beziehungsgeflecht erkennen lassen, welches besonders den Saar-Nahe-Raum hervorhebt. Ob die Jura-Hornsteine vom Isteiner Klotz den Rheinschottern entnommen wurden oder auf eine direkte Verbindung weisen, muß offen bleiben.
Boreales Frühmesolithikum - Beuronien B2
In der zweiten Hälfte des Boreals (ca. 6500- ca. 6200 v. Chr.) herrschten Inventare vor, in denen der ungleichschenklige Dreieckstyp gegenüber dem (spitzwinklig-) gleichschenkligen Dreieck dominiert, letzteres dann auch gänzlich verschwindet. Diese typologische Entwicklungsstufe wird als Beuronien B2 bezeichnet. Zu den Gründen, zwischen dem vorangegangenen Frühmesolithikum B 1 und dem folgenden Mittelmesolithikum (Beuronien C) ein Beuronien B2 einzufügen, haben sich E. Cziesla und A. Tillmann ausführlich geäußert (1984, 89 ff.). Dabei läßt sich das Beuronien B 1 vom Beuronien B2 aufgrundder gleichschenklig bzw. Ungleichschenkligen Dreieck-Anteile trennen, wobei das gleich häufige Vorkommen beider Dreiecksausformungen die Grenze zu bilden scheint. Überwiegen die gleichschenkligen Dreiecke, so wird das Inventar dem Beuronien B 1 zugewiesen, sind die (deutlich und stark) Ungleichschenkligen Dreiecke dominant, so sprechen wir von einem B2-Inventar, wobei hier offenbar
1ursächlich ein funktional-technologischer Wandel in der Pfeilbewehrung seinen Niederschlag findet.
Aus der zweiten Hälfte des Boreals liegen gleich mehrere B2-zeitliche Fundstellen in Rheinland-Pfalz vor, im
UM 12, 1998 Erwin Cziesla
4~ @, tiJ" tJ~ fA 6)~ 1~t ~ ·~ o • • • f I ~
tJJ ~ f/; ~t i ttJ~ f)ß ~t!J% d).~ &~~ Abb. 4 Waldfischbach-Burgalben. Typische Beuronien B2-zeitliche Mikrolithen und andere Geräte.
Gegensatz zu Süddeutschland, wo diese Fundstellen vergleichsweise rar sind. Ob sich hier tatsächlich bevölkerungsdynamische Prozesse widerspiegeln, ist eher unwahrscheinlich, da diese komplexe Fragestellung stets in Abhängigkeit vom zufälligen Auffinden von Fundstellen zu bewerten ist.
Am Material von Waldfischbach-Burgalben (Abb. 4), wenige Kilometer nordöstlich von Pirmasens gelegen, läßt sich die Trennung wie folgt darstellen: Von zehn Dreiecks-MikroEthen sind neun als ungleichschenklig zu klassifizieren. In der süddeutschen Jägerhaus-Höhle (Schicht I 0-12) sind dagegen von insgesamt 13 Dreiecken zehn gleichschenklig. Somit datieren die drei Schichten der Jägerhaus-Höhle in ein Beuronien B 1, die Funde aus Waldfischbach-Burgalben sind dagegen den Funden vom belgischen Kleinenbusch I und II sowie dem Ardennen-Fundplatz Roche-aux-Faucons zur Seite zu stellen und in ein frühes Beuronien B2 zu datieren.
Die Beuronien B2-zeitlichen Fundstellen in der Pfalz sind zum Teil überraschend groß, so der Fundplatz Schmitshausen I - 'Kurze Ahnung' (mehr als I 0000 Artefakte; Cziesla 1992d; Cziesla 1992a, 69-73; Abb. 5) und das bereits zuvor genannte ausgedehnte Fundareal 'Aufm Benneberg' bei Waldfischbach-Burgalben. Ebenfalls in diesen Zeithorizont gehören die Fundstellen Schmitshausen 2 und 3 sowie die Funde vom Kohlwoog-Acker bei Wilgartswiesen. Suchen wir den überregionalen Vergleich, so sind in der Schweiz die Fundstellen Zwingen,
116
Die mittlere Steinzeit in Rheinland-Pfalz UM 12, 1998
0 Sem
Abb. 5 Auswahl von B2-zcitlichen Anefakten vom Fundplatz Schmitshausen 1, nördlich von Pirmasens (1-19).
Birsmatten und Ritzigrund zu nennen, in Ostfrankreich Bavans (Schicht 6 u. 7) und in Lothringen unmittelbar an der deutschen Grenze der Fundplatz Walschbronn (Goret u. Thevenin 1995), und schließlich in Süddeutschland das Helga Abri (Schicht 111, 4-6). Ebenfalls häufig sind vergleichbare Inventare in Luxemburg, so u.a. Diekirch, Flaxweiler, Gonderange und Ermsdorf. Da sich mit dem Beuronien B2 auch ein überregionales Beziehungsgeflecht auftut, ist u.a. auch auf das rechtsrheinische Overath östlich von Köln (Eickhoff 1992) hinzuweisen.
Hervorzuheben ist, daß einige Mikrolithen von Schmitshausen nicht nur ungewöhnlich groß sind, sondern zudem einen deutlich herausgearbeiteten Dorn besitzen (Abb. 5, 5). Dieser läßt sich auch auf anderen vorderpfälzer Fundstellen wiederfinden (so in Rheingönheim-Limburgerhof lb bei Ludwigshafen), ist aber auch aus der Eitel, vom Fundplatz Holsthum im Kreis Bitburg-Prüm belegt. Ob hier regionale Eigenarten bzw. Gruppen kartiert werden können, muß die Zukunft weisen.
Regionale Gruppen im borealen Mittel-Mesolithikum- Beuronien C und Früh-Atlantischen SpätMesolithikum
Der letzte mesolithische Abschnitt, das sogenannte Mittel- und Spätmesolithikum, ist im südlichen Rheinland-Pfalz bislang nur durch wenige Fundstellen belegt. Wie auch im übrigen Deutschland, so macht sich hier eine deutliche Zäsur im Artefaktspektrum bemerkbar. Einerseits erlaubte die Montbani-Technik die Herstellung langer, kantenparalleler Klingen zur Herstellung genormter viereckiger und trapezförmiger Mikrolithen, also quergeschäftete Pfeilschneiden. Andererseits erreichten die mittel- und spätmesolithischen Werkzeugtraditionen einen höchsten Grad der Mikrolithik, so daß Kerbreste und Mikrolithen lediglich durch Sieben überhaupt noch geborgen werden können. Dort, wo die Viereck-Mikrolithik keinen Eingang in die Werkzeugherstellung fand, blieben die mesolithischer Gruppen ihrer Werkzeugtradition verbunden und formten ihre Pfeilspitzen zu winzigen Gerätetypen-was nicht nur für die Pfeilköpfe, sondern auch für die Kratzer, Stichel und Bohrer gilt. So gliederten sich allmählich
UM 12, 1998 Erwin Cziesla
0
Abb. 6 Mikrolithen aus der Weidental-Höhle bei Wilgartswiesen (1-43).
lokale Gruppen aus, die als Ardennien oder, im Pfälzer Raum, als Palatinat bezeichnet werden. Möglicherweise reichen diese lokalen mesolithischen Gruppen bis weit ins Atlantikum hinein, also auch noch bis in jenen Zeithorizont, in dem La Hoguette/Limburg-Gruppen sowie die frühe Bandkeramik in der z.T. unmittelbaren Umgebung eine seßhaft-bäuerliche Lebensweise pflegten (vgl. Cziesla 199 I).
Neben kleinen Inventaren wie Rheingönheim-Limburgerhof I bundmöglicherweise dem Iuxemburgischen Hesperange "Im Gründchen" ist hier besonders das Inventar aus der Weidental-Höhle (Abb. 6) zu nennen, welches zwischen I 980 und 1989 ergraben wurde (Cziesla 1992a). Eine Datierung ist aufgrundder Kleinheit der Geräte durchaus auch ins fortgeschrittene Atlantikum denkbar.
Dieses Inventar aus der Weidental-Höhle istjedoch nicht nur aufgrundseiner besonders kleinen Geräte erwähnenswert, sondern besonders deshalb, weil hier einer der wenigen Lagerplätze großflächiger dokumentiert werden konnte. Auf einer Fläche von 70m2 fanden sich in drei unterschiedlichen Konzentrationen bislang rund 400Ö Steinartefakte. Unter dem ehemaligen Höhlenvordach war die Feuerstelle angelegt worden, die offensichtlich mindestens eine Reinigung erkennen läßt und dem Aufenthalt eine größere zeitliche Tiefe gibt. Hier konzentrierten sich Geräte und die Abfälle ihrer Herstellung. Im mittleren Hang vor der Höhle fand sich eine weitere Artefaktkonzentration mit bearbeiteten Porphyren, einem bislang unikaten Bimsartefakt und Graniten, die offensichtlich als Kochsteine gedient haben. Begrenzt wird diese Konzentration durch eine hufeisenförmige Steinsetzung, die aufgrund des erhöhten
I 18
Die mittlere Steinzeit in Rheinland-Pfalz UM 12, 1998
Phosphatgehaltes als Fleisch-Cache gedeutet wird. Wenige Granit-Absplisse bilden eine kleine Konzentration im Bereich eines Bachesam Fuß der Höhle und legen die Vermutung nahe, daß hier die Kochbeutel ausgewaschen bzw. mit Wasser gefüllt wurden. Die Weidental-Höhle erlaubt somit einen überraschend vollständigen Blick in einen kleinen, kurzzeitig genutzten mesolithischen Lagerplatz wie an kaum einem anderen Fundplatz dieser Zeitstellung in Deutschland.
Schlußbemerkung
Innerhalb nur eines Jahrzehntes war es möglich, im südlichen Rheinland-Pfalz in einem zunächst als fundleer angenommenen Raum eine kontinuierliche Siedlungsabfolge während des Mesolithikums zu erarbeiten. Zunächst vornehmlich aus dem ostfranzösisch, belgisch-luxemburgischen Bereich beeinflußt, entwickelten sich hier allmählich regionale Eigenheiten. Diese regionalen Gruppen, als Palatinat bezeichnet, entwickelten sich im höher gelegenen Bergland vermutlich zeitgleich mit den jüngeren Phasen des frühen Neolithikums.
Obwohl von Seiten der Denkmalbehörde und den Universitäten kaum Interesse an diesen Untersuchungen besteht, ist zu hoffen, daß diese vielversprechenden Arbeitsansätze auch in Zukunft weitergeführt werden und die engagierten Sammler eine entsprechende Betreuung erfahren.
Literatur
Bantelmann 1972: N. Bantelmann, Die Urgeschichte des Kreises Kusel. Veröff. der Pfälzischen Ges. Förderung der Wissenschaften 62 (Speyer 1972).
Becker 1986: M. Becker, Eine neuentdeckte mesolithische Freilandfundstelle bei Obersulzbachtal, Landkr. Kaiserslautern. Arch. Korrbl. 16, 1986, 127-134.
Eosinski 1995: G. Bosinski, The Palaeolithic and Mesolithic of the Rhineland. In: W. Schirmer (Hrsg.), Quaternary field trips in Central Europe. INQUA (München 1995) 829-899.
Cziesla 1991: E. Cziesla, Betrachtungen zur Kulturgeschichte des 6. vorchristlichen Jahrtausends in Südwestdeutschland. Bull. Soc. Prehist. Luxernbourgeoise 13, 1991, 15-35.
Cziesla 1992a: E. Czicsla, Jäger und Sammler. Die mittlere StetnzciL im Landkreis Pinnasens (Brühl 1992).
Cziesla 1992b: E. Cziesla, Spätpaläolithikum und Mesolithikum in der Euregio- Epipaleolithique et Mesolithique d'Euregio. Spurensicherung- Archäologische Denkmalpflege in der Euregio Maas-Rhein (Mainz 1992) 44-57.
Cziesla 1992c: E. Cziesla, Drei Jahrzehnte Sammeltätigkeit in der V orderpfalz. Das archäologische Vermächtnis des Oberlehrers Walter Storck. Bull. Soc. Prehist. Luxembourgeoise 14, 1992,75-90.
Cziesla 1992d: E. Cziesla, Schmitshausen. Mittelsteinzeitliche Fundstellen der Westrieher Hochfläche. Heimatkalender 1993 für das Pirmasenser und Zweibrücker Land. Landkreis Pirmasens (Hrsg.), 162-169.
Cziesla 1994: E. Cziesla, Mittelsteinzeitliche Funde von der "Kleinen Kalmit" bei Ilbesheim (Krs. Südliche Weinstrasse). Mitt. Hist. Ver. Pfalz 92, 1994, 7-30.
Cziesla 1997: E. Cziesla, The Weidental Cave: Changing use in changing times. In: C. Bonsall u. C. Tolan-Smith (Hrsg.), The Human Use of Caves- Conference 1993. BAR Int. Ser. 667 (Oxford) 52-62
Cziesla u. Tillmann 1984: E. Cziesla u. A. Tillmann, Mesolithische Funde der Freilandfundstelle "Auf'm Benneberg" in Burgalben/Waldfischbach, Kreis Pirmasens. Zugleich ein Beitrag zur Gliederung des "Beuronien". Mitt. Hist. Ver. Pfalz 82, 1984, 69-110.
Cziesla u. Eickhoff 1995: E. Czies1a u. S. Eickhoff, Recent excavations at Jühnsdorf, south of Berlin. A contribution of Mesolithic dwellings and fire-p1aces. In: M. Otte (Hrsg.), Nature et Cu1ture, Colloque de Liege 1993. E.R.A. U.L. 68 (Liege 1995) 389-402.
110
UM 12, 1998 Erwin Cziesla
Eickhoff 1992: S. Eickhoff, Zwei mittelsteinzeitliche Fundplätze bei Overath. Bonner Jahrb. 192, 1992, 275-298.
Goret u. Thevenin 1995: A. Goret u. C. Thevenin, Le site mesolithique moyen de Walschbronn (Moselle). In: Epipaleolithique et Mesolithique entre Seine et Rhin. Table ronde d' Ancerville 1989. Annales litteraires de I'Universite de Besanc;on 41 (1995) 165-174.
Häberle 1918: D. Häberle, Die Höhlen der Rheinpfalz. Beitr. z. Landeskunde d. Rheinpfalz I (Kaiserslautern 1918).
Kriese! 1978: 0. Kriese!, Zur vorgeschichtlichen Besiedlung des Kreises Kirchheimbolanden (Pfalz). Veröff. Pfälz. Ges. Förderung Wissensch. 66 (1978 Speyer).
Nuber 1954: A. Nuber, Zur Schichtenfolge des kleingerätigen Mesolithikums in Württemberg-Hohenzollern (Festschrift für P. Goessler). Tübinger Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte (Stuttgart 1954) 113-131.
Spier 1991: F. Spier, Mesolithique recent et Neolithique ancien au Luxembourg: etatdes recherches. In: Actes du 113e Congres National des Societes Savantes. Strasbourg 1988: Mesolithique et Neolithisation en France et dans I es regions limithrophes (Paris 1991) 453-465.
Spier 1994: F. Spier, L'Epipaleolithique et Mesolithique du Grand-Duchede Luxembourg. Essai de synthese. Bull. Soc. Prehist. Luxembourgoise 16, 1994, 65-96.
Sprater 1928: F. Sprater, Die Urgeschichte der Pfalz. Zugleich ein Führer durch die vorgeschichtliche Abtlg. Hist. Museums der Pfalz. Veröff. Pfalz. Ges. Förderung Wissensch. 5 (Speyer 1928).
Sprater 1948: F. Sprater, Die Pfalz in der Vor- und Frühzeit. Museumsführer Historisches Museum der Pfalz (Speyer 1948).
Storck 1957: W. Storck. Ein mesolithischer Werkplatz bei !\laudach, Kreis Ludwigshafen a. Rh. Ein Beitrag zum Mesolithikum in der Pfalz. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 55, 1957,77-87.
Storck 1963: W. Storck, Mittlere Steinzeit auf der "Kleinen Kalmit" entdeckt. Ein Beitrag zur Erforschung des Mesolithikums in der Pfalz. Pfälzische Heimatblätter (Beilage zur Zeitschrift "Die Rheinpfalz") 1 1, 1963, 62-63.
Taute 1971: W. Taute, Untersuchungen zum Mesolithikum und zum Spätpaläolithikum im südlichen Mitteleuropa. (Unpubl. Habilitationsschrift Univ. Tübingen 1971).
Taute 1975: W. Taute, Ausgrabungen zum Spätpaläolithikum und Mesolithikum in Süddeutschland. In: Ausgrabungen in Deutschland. Gefördert von der DFG 1950-1975. RGZM, Monographien 1.1 (Mainz 1975) 64-73.
Thevenin 1990: A. Thevenin, Du Dryas III au debut de I' Atlantique: pour une approche methodologique des industriesetdes territoires dans l'Est de Ia France. Rev. Arch. Est et Centre-Est 41, 1990, 177-212.
Thevenin 1991: A. Thenenin, Du Dryas III au debut de I' Atlantique: pour une approche methodologique des industriesetdes territoires dans I'Est de Ia France. Rev. Arch. Est et Centre-Est 42, 1991,3-62.
Thevenin 1995: A. Thevenin, Le peuplement de I'Est de Ia France du Tardiglaciaire au debut de Postglaciaire. In:
120
A. Thevenin (Hrsg.), Epipaleolithique et Mesolithique entre Seine et Rhin. Table ronde d' Ancerville 1989. Annales litteraires de I'Universite de Besanc;on 41 (Besanc;on 1995) 213-273.
NICHOLAS J. CONARD CLAUS-JOACHIM KIND (HRSG.)
Aktuelle Forschungen zum Mesolithikum Current Mesolithic Research
Mo Vince Verlag Tübingen
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung durch die Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V.
Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme
Aktuelle Forschungen zum Mesolithikum= CurTent Mesolithic research I Nicholas J. Conard ; Claus-Joachim Kind (Hrsg.).Tübingen : Mo-Vince-Ver!.. 1998
(Urgeschichtliche Materialhefte, Bd. 12)
ISBN 3-9804834-4-4
Alle Rechte vorbehalten © 1998 Mo Vince Verlag Mona Ziegler Verlag und Versandbuchhandel Postfach 21 02 30 D-72025 Tübingen
DTP und Produktion: Mo Vince Verlag, Tübingen Druck: Zeeb-Druck, Tübingen
Gedruckt mit Druckfarbe auf rein pflanzlicher Bindemittelbasis auf RecyMago matt (hergestellt aus I 00% Altpapier, Träger des Zertifikats 'Blauer Engel' und alterungsbeständig gemäß DIN 6738, d.h. mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von einigen 100 Jahren).
i ISBN 3-9804834-4-4



















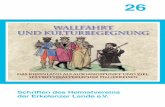




![M. Treister, Predmety vooruženija i konskogo snarjaženja achemenidskogo kruga iz Južnogo Priural’ja [Waffen und Zaumzeug des achämenidischen Kreises aus dem südlichen Uralvorland]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d3bbe1c5736defb02838a/m-treister-predmety-vooruzenija-i-konskogo-snarjazenja-achemenidskogo-kruga.jpg)