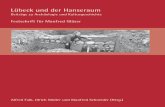Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglicher Goldbemalung aus...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglicher Goldbemalung aus...
Sonderdruck aus:
ALTEUROPÄISCHE FORSCHUNGEN
Arbeiten aus dem Institut für
Kunstgeschichte und Archäologien Europas
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Neue Folge 7
Herausgegeben von François Bertemes
VON DER WESER IN DIE WELT
FESTSCHRIFT FÜR HANS-GEORG STEPHAN
ZUM 65. GEBURTSTAG
HERAUSGEGEBEN VON TOBIAS GÄRTNER,
STEFAN HESSE & SONJA KÖNIG
59,00 EUR, ISBN 978-3-95741-035-1 Bestellungen: www.archaeologie-und-buecher.de
BEIER & BERAN. ARCHÄOLOGISCHE FACHLITERATUR
LANGENWEISSBACH 2015
Inhalt
Grußwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabula Gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Felix Biermann, Ulf Frommhagen und Normen PosseltZum Verhältnis von spätmittelalterlicher Motte und neuzeitlichem Gutshaus am Beispiel von Lindstedt in der Altmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Erhard CosackGlaziale Gerölle mit Röteleinlagerungen aus dem Leinetal bei Sarstedt, Ldkr . Hildesheim, und ihre Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Michael DapperDas Zangentor der Pfalz Tilleda - Ein Versuch die Vergangenheit zu rekonstruieren . . . . . . . . . . . 61
Volker DemuthMittelalterliches Steinzeug aus Südniedersachsen in Bergen/Norwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sabine Felgenhauer-SchmiedtDer Becher von Pöbring, Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tobias GärtnerTimenti dominum non deerit ullum bonum – Ausgrabungen auf Burg und Amtssitz Wölpe bei Nienburg (Weser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
David Gaimster, Erki RussowThe Sun, Mercury and their companions of the True Faith: a Reformation-period tile stove from the bishop’s castle at Haapsalu, Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Willy GerkingKöhlerei im Schwalenberger Wald und seinen Nebenforsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Gerald Volker Grimm, Tünde Kaszab-OlschewskiZu einer künstlerischen Rekonstruktion der Grabmemorie Karls des Großen . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Stefan HesseDas „Alte Dorf“ bei Hellwege, Ldkr . Rotenburg (Wümme) . Eine mittelalterliche Wüstung mit Adelssitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Yves HoffmannSpätgotische „Türmchenkacheln“ von der Burg Gnandstein in Nordwestsachsen . . . . . . . . . . . . 155
Peter IlischÜberlegungen zur Bedeutung der Münzstätte Corvey im 11 . Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4 Inhalt
Jan KlápštěLittera scripta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Michael KochDie mittelalterliche Weinreise der westfälischen Reichsabteien Corvey und Herford (Nordrhein-Westfalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Andreas KönigRenaissancezeitliche Werrawarefunde aus Höxter – ein Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Sonja König, Henny GroenendijkEine reich verzierte spätmittelalterliche Parierstange aus Mensingeweer (De Marne, Groningen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Stefan KrabathBrigantinen und Plattenharnischfragmente aus der sächsischen Oberlausitz . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Thomas KüntzelIst das römisch? Gedanken zur Klosterbaukunst der Karolingerzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Christian LeiberÜberfall auf eine Waldglashütte im Hils bei Grünenplan während des Dreißigjährigen Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Monika Lüdtke, Michael MeierTöpferwerkzeug aus den frühneuzeitlichen Töpfereien in Bad Münder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Heinz-Peter MielkeOfenkacheln mit dem Bildnis der Sibylle von Kleve in neuem Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Jan Nováček, Kristina ScheelenOpfer oder Täter? - Anthropologisch-paläopathologischer Befund der Männerbestattung aus Grab 24 vom Friedhof der Dorfwüstung Winnefeld (Ldkr . Northeim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski„Das Heimische und das Fremde” in der Kulturlandschaft auf den polnischen Gebieten im Mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Uwe RichterEine frühbarocke Deckenmalerei mit Stadtansichten in Freiberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Harald RosmanitzDie Ofenkacheln vom Typ Tannenberg - Eine spätgotische Massenproduktion im Spannungsfeld von Produzent und Konsument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Max Jakob Schünemann, Michael SchultzZur Zahngesundheit der mittelalterlichen Bevölkerung von Drudewenshusen . . . . . . . . . . . . . . . 375
Peter SteppuhnIndividualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor aus Lübeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Gerhard StreichWüstungsvorgänge vor der Wüstungsphase - Das Beispiel Lamspringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
5Festschrift für Hans-Georg Stephan
Heidrun Teuber, Stefan Teuber Abdrücke von Fibelspiralen auf Keramik der Römischen Kaiserzeit aus Südniedersachsen . . . . 407
Günter UnteidigHohnstädt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Friedrich-Wilhelm Wulf, Robert LehmannDer Goldring von Eldagsen - Archäologische und archäometrische Beobachtungen an einem hochmittelalterlichen Würdezeichen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Jaromír ŽegklitzZu den Anfängen der Malhornware in Böhmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
aus Lübeck
Peter Steppuhn
Schlüsselworte: Mittelalter, Neuzeit, Hohlglas, Lübeck, Golddekor .
Unter den zahlreichen Glasfunden aus archäologi-schen Zusammenhängen seit dem 12 . Jahrhundert innerhalb der Lübecker Altstadt befinden sich ne-ben größeren Komplexen Gebrauchsglas eine Rei-he von Unikaten, die an verschiedenen Stellen eine Publikation erfuhren1 . Größere Studien zum mit-telalterlichen und neuzeitlichen Glasrepertoire der Hansestadt liegen zum Teil vor (dumitrAchE 1990), harren publikationsreif einer Drucklegung2 oder sollten (aufgrund einer breiten Materialbasis mit hohem zu erwartendem Informationsgehalt)3 in Angriff genommen werden . Nach jetzigem Kenn-
1 nEuGEbAuEr 1965; ders. 1967a; ders. 1967b; ders. 1968; ders. 1976; chArlEston 1976; hAhn 1978, 119 ff. Abb. 53; stEphAn
1978, 79 Taf. 16; FAlk 1980; ders. 1981; ders. 1982; ders. 1987; ErdmAnn 1986; ErdmAnn/nitsch 1986; bAumGArtnEr/kruE- GEr 1988, Nr. 66; 87; 98; 121; 134; 210;211; 219; 220; 226; 283; 330; 355; 389; 505; 540; 541; 548; 551; dumitrAchE 1988; bArGEn 1989, 195; GläsEr 1989, 58 f.; 116, Abb. 39,6; Taf. 7,5–6; ders. 1992a, 82, 174 Abb. 66,7–13; ders. 1992b, 204; kruE- GEr 1990, 296 ff.; ders. 1996, 284 f.; ders. 2002, 119 ff.; ders. 2005, 275 f.; mührEnbErG 1993, 115 ff. Abb. 17,1.3–9; müllEr 1992, 157 f., 166 Abb. 6,1–4; pAusE/stEppuhn i . Dr .; stEppuhn 1993; ders. 1996a; ders. 1996b; ders. 1996c; ders. 1997a; ders. 1997b; ders. 1998; ders. 1999b; ders. 2002b; ders. 2003a; ders. 2003b; ders. 2004; ders. 2014; ders. i. Dr.; stEppuhn/rAdis 2000 .
2 pAusE/stEppuhn (i . Dr .) . Im Rahmen eines DFG-Projektes wurden zwischen März 1995 und März 1999 insgesamt 16 269 Glasobjekte in 2164 Gruppen- oder Einzelaufnahmen aus 36 verschiedenen Plangrabungen der Jahre 1974 bis 1993 aufgenommen und auf 454 Abbildungen vorgestellt (stEppuhn, i . Dr .) . Dabei fanden insbesondere die Glasfun-de des 12. bis 16. Jahrhunderts Beachtung; weitere etwa 25000–30000 Glasfunde der daran anschließenden neu-zeitlichen Perioden sind zunächst nicht erfasst worden .
3 Das viereinhalbjährige Großgrabungs-Projekt „Ausgra-bungen im Lübecker Gründungsviertel“ wurde im Juni 2014 abgeschlossen . Bis Mitte 2016 werden zunächst die archäologischen Befunde und Siedlungsstrukturen ausge-wertet; eine Bearbeitung der verschiedenen Materialgrup-
tnisstand lässt sich schätzen, dass einschließlich der unten genannten Arbeiten etwa die Hälfte des in Lübeck geborgenen gläsernen Fundmaterials bekannt und ausgewertet ist . Das wirft nicht nur ein Licht auf die enormen Fundmengen an histo-rischem Hohl- und Flachglas innerhalb der Stadt, sondern unterstreicht zugleich die hohe kulturge-schichtliche Bedeutung Lübecks für die Glasge-schichte Nord- und Mitteleuropas zur Hansezeit .
Gegenstand dieses Aufsatzes sind Glasgefäße verschiedener Zeitstellungen und Formen, die nach- träglich mit Blattgold oder Goldfarbe verziert wur- den, ohne dass dieser Dekor zur jeweiligen
„Grundausstattung“ des Hohlglases gehörte . Das sind in der Regel relativ schlichte Exemplare, bei denen der Gold-Zusatz eher „stört“, weil er un-gewohnt oder unüblich ist bzw . kaum bis nicht über Parallelen verfügt4 . Daher werden hier bei-spielsweise keine Islamischen Goldemailgläser oder
pen ist bislang noch nicht vorgesehen . Nach erster Schät-zung sind hier etwa 30000–40000 Glasobjekte zu erwarten .
4 Beispiele für Glasgefäße mit nachträglich angebrachten Golddekoren sind sporadisch bekannt, so u . a . von der Burg Rauenwörth, Lkr . Eichstätt/Bayern – 13 . Jahrhundert
– (Baumgartner/Krueger 1988, 209 Nr . 191), aus Burgstein- furt, Nordrhein-Westfalen – vor 1338 – (Baumgartner, Krueger 1988, 175 Nr . 142) oder Frankfurt am Main, Buch- gasse 3 – 15 . Jahrhundert – (Denkmalamt Frankfurt, Inven-tar-Nr . FFM193-St13-F6193-M1-2-NGlasGold-301009) . Alle Informationen zu dem Frankfurter Stück, einem kleinen grünen Nuppenbecher, dessen unteres Drittel mit kleinen vierblättrigen Blüten aus Blattgold besetzt ist, verdanke ich Frau Dr . Andrea Hampel, Denkmalamt 60B, Frankfurt am Main . Unter dem Titel Das staufische „Westend“ (FFM 193) . Archäologie in Frankfurt am Main . Fund- und Gra-bungsberichte für die Jahre 2007 bis Ende 2011 . Beiträge zum Denkmalschutz in Frankfurt am Main, Heft 18 ist das Glasobjekt für eine Publikation im Jahre 2015 vorgesehen .
386 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
Emailbemalten Gläser5 des 13 ./14 . Jahrhunderts be-handelt sowie keine neuzeitlichen Glasgefäße mit Email- und/oder Gold-Dekor, sondern ausschließ-lich solche Gläser, die, mit welchem zeitlichen Ab-stand auch immer, eine zusätzliche goldene Auf-wertung erfuhren .
Vorgestellt werden hier sieben bislang bekann-te Beispiele aus den Lübecker Glasbeständen, die in den Zeitraum um 1300 bis um 1600 datieren . Das älteste Glasgefäß ist ein sogenannter Farbloser Rip-penbecher mit blauem Rand, der vermutlich um 1300 entstanden ist und eine florale/zweigartige Gold-bemalung im unteren Teil des Bechers trägt (Abb. 1) . Alle drei noch erhaltenen Fragmente des Glases befanden sich zusammen mit weiteren Glas- und Keramikscherben des 15 . Jahrhunderts im ehe-maligen Brunnen III auf dem Grundstück Dr .-Julius-Leber-Straße 18, das der Ratsherren- und Bürgermeisterfamilie Pleskow zugeschrieben wird (nEuGEbAuEr 1976, 323; bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 122) und dort seit der Mitte des 14 . Jahrhunderts als
5 Emailbemalte Gläser wurden nur selten mit Golddekor versehen; dieser war dann Bestandteil der ursprünglichen Verzierung (z . B . bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, Nr. 106; 107; 116; 118; möllEr 1994; kruEGEr 1998) .
Abfallschacht diente6 . Diese Fundsituation belegt, dass bisweilen mit recht langen Umlaufzeiten von Glasgefäßen gerechnet werden muss, insbe-sondere bei solchen „Spezialanfertigungen“ . Die Fundumstände des Exemplars sind noch aus ei-nem anderen Grunde interessant: In derselben Abfallgrube fand sich ein nahezu komplettes is-lamisches Goldemailglas der zweiten Hälfte des 13 . Jahrhunderts zusammen mit Keramikfragmen- ten aus dem 14 . Jahrhundert7 . Ganz offensichtlich hatte die damalige Bürgermeister-Familie Ples-kow ein gewisses Faible für goldverzierte Hohl-gläser .
Farblose Becher mit formgeblasenen Rippen und zumeist blauem Randfaden sind aus vielen Fundkomplexen der zweiten Hälfte des 13 . und der ersten Hälfte des 14 . Jahrhunderts bekannt geworden . Die meisten Gefäße besitzen 12 model-geblasene Vertikal-Rippen, doch weisen einige Lübecker Exemplare auch 10 oder 16 Rippen auf . Die Rippenköpfe unterhalb des Lippenansatzes sind leicht kugelig verdickt oder ausgezogen . Am Boden befindet sich ein wellenförmig eingedrück-ter Standringfaden . Charakteristisch für die Glä-ser ist eine stark entfärbte, farblos wirkende Glas-masse, die oft einen leichten Grau-, Gelb- oder Violett-, selten auch Grünstich aufweist . Der ältes-te schriftliche Beleg für die Herstellung von Rip-penbechern in Venedig liegt für das Jahr 1312 vor (zEcchin 1987, 13; 61; ders. 1990, 124), doch dürften auch die aus dem 13 . Jahrhundert stammenden Funde dieser Glasform aus Süddeutschland und der Schweiz nach pAusE (1996, 46) ebenfalls in ve-nezianischen Glashütten hergestellt worden sein . Die Darstellung eines Bechers mit Rippendekor auf der zwischen 1340/1341 und 1345 umgestalte-ten Fassade des Dogenpalastes in Venedig gibt zu erkennen, dass gerippte Gläser in dieser Zeit in Venedig durchaus geläufig waren (WoltErs 1976, 41 ff.; 172 ff., Kat.-Nr. 48). Gläser mit modelgeblase-ner Rippenverzierung wurden jedoch nicht nur in den Werkstätten auf der nahegelegenen Insel Mu-rano hergestellt, sondern ebenfalls auf dem Bal-kan (bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 218) sowie in der Glashütte von Korinth und weiteren venezianisch geprägten Glashütten im Triveneto und östlichem Mittelmeergebiet (pAusE 1996, 15 ff .) .
6 bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 222 f. Nr. 211; dumitrAchE 1990, 32 f ., G 69, G 72, G 76, Abb . 8,6) .
7 chArlEston 1976; nEuGEbAuEr 1976; bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 121 f., Nr. 65; stEppuhn 1996c, 323 ff.; Abb. 7; ders. 2014, 201 f.; Abb. 8.
Abb. 1: Hansestadt Lübeck, Dr. Julius-Leber-Straße 18. Rip-penbecher mit zusätzlich aufgebrachter Goldbemalung.
387Festschrift für Hans-Georg Stephan
Ähnlich wie bei Emailbemalten Gläsern (stEpp-uhn 2014, 194 ff .) fällt bei den Rippenbechern auf, dass aus der vermeintlich hauptsächlichen Pro-duktionsregion Norditalien nur verschwindend wenig archäologische Funde bekannt sind (bAum-GArtnEr/kruEGEr 1988, 218; pAusE 1996, 46) . Zudem lassen die vielen Varianten gerippter Gläser in Bezug auf Form und Funktion der Gefäße sowie Verlauf und Anzahl der Rippen Raum für Überle-gungen, dass bestimmte Typen auch bestimmten Herstellungs- und Verbreitungsgebieten zuzuord- nen sind . Dazu kommen die bisweilen recht gro-ßen Fundmengen solcher Gläser, die eine Produk-tion der Rippenbecher ausschließlich am Hütten- standort Murano wenig wahrscheinlich erschei-nen lassen (bAumGArtnEr 1993, 316; pAusE 1996, 47) . Wenngleich noch exakte archäologische Nach-weise fehlen, wird man doch davon ausgehen können, dass auch nördlich der Alpen farblose Rippenbecher hergestellt worden sind . Die sehr einheitliche Form insbesondere des Typs mit gerader Wandung, formgeblasenen senkrechten Rippen und (kobalt)blauem Rand findet sich nur in geringer Zahl in Frankreich (Foy, sEnnEQuiEr 1989, 228 f . Nr . 195–196), dafür aber häufig im süd-deutsch-schweizerischen Gebiet, im Rheinland sowie im mittleren und nördlichen Deutschland, was ein gemeinsames Ursprungsgebiet, vielleicht sogar in Deutschland, möglich erscheinen lässt8 . Die zahlreichen farblosen Rippengläser aus Lü-becker Fundkomplexen entsprechen durchweg dem „nordalpinen” Typ der Rippenbecher mit senkrechten Rippen und (wohl durchgehend) mit blauem Rand . Die Variationen in der Ausformung der Lippe sind nur minimal, die ermittelbare Höhe der Gläser liegt zwischen 12 und 14 cm, der Mündungsdurchmesser zwischen 9 und 11 cm . Die absolute Ausnahme, auch im Vergleich zu al-len anderen überhaupt bekannt gewordenen farb-losen Rippenbechern mit blauem Rand stellt das Exemplar aus einem ehemaligen Brunnen in der Alfstraße 1 dar . Mit einem Mündungsdurchmes-ser von 16,6 cm und einer anzunehmenden Höhe von etwa 20 cm bei einer Wandungsstärke (ohne Rippe) von 0,6 mm ist das Stück der Gigant unter diesen rippenverzierten Bechern . Zusammen mit den bereits von dumitrAchE vorgestellten 18 farb-losen Rippenbechern (1990, 13, G 66–79, Abb . 7, 8, 9,1–2) sind aus Lübeck nun insgesamt 47 solcher Gläser bekannt . Damit liegt für Nordeuropa der
8 bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 218 ff.; Foy/sEnnEQuiEr 1989, 228; prohAskA-Gross/soFFnEr 1992, 306; bAumGArtnEr 1993, 315 f. Abb. 5; schäFEr 1995, 65 .
bislang größte Komplex dieses Typs vor . In den meisten Fällen sind die Lübecker Rippenbecher Einzelstücke verschiedener Haushalte . Viermal lassen sich größere Kollektionen mit mehreren gerippten Bechern nachweisen, und zwar auf den Grundstücken in der Breiten Straße 39–41, Dr . Ju-lius-Leber-Straße 18, Königstraße 32 und, beson-ders zahlreich, vom ehemaligen Johanniskloster; allesamt Adressen, die den gehobenen sozialen Schichten Lübecks zur damaligen Zeit zuzurech-nen sind .
Von den Grundstücken Königstraße 70–74 liegen zwei Glasgefäße mit nachträglicher Gold-bemalung vor, die sich in einer ehemaligen Holz-bohlen-Kloake befunden haben und in das späte 14 ./frühe 15 . Jahrhundert datieren . Sie gehören zu den sogenannten Bechern mit Fadenrippen und in-nerhalb dieser Gruppe wiederum zu den größten ihrer Art . Neben den blauen Punkt-Applikationen weist das vollständiger erhaltene Glas in seinem Schulterbereich eine rankenförmige Goldbema-lung auf, die korrodiert ist und sich schwärzlich verfärbt hat (Abb. 2)9 . Der Becher aus farblosem, leicht blaustichigem Glas mit vielen kleinen Bläschen (müllEr 1992, 158 Nr . 3) unterscheidet sich von einer Einzel-Scherbe aus farblosem, kaum gelbsti-chigem Glas mit wenigen Bläschen (müllEr 1992, 158 Nr . 4), die gleichfalls einen rankenähnlichen De-kor aufweist . Die unterschiedliche Glasqualität deutet an, dass es sich hier um Produkte verschie-dener Hütten, aber doch aus der gleichen Herstel-lungs-Region handeln dürfte, die in Lübeck zu ei-nem Glas-Satz mit mindestens zwei gleichartigen Gefäßen zusammengestellt und später mit Gold
9 Vgl . auch müllEr 1992, 157 f.; 166 Abb. 6,3.
Abb. 2: Hansestadt Lübeck, Königstraße 70–74. Becher mit Fadenrippen und nachträglicher Goldbemalung. Größte Brei-te des Gefäßes 15,8 cm.
388 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
bemalt wurden . Die Vergesellschaftung beider Exemplare innerhalb derselben Kloake und in der gleichen Fundschicht legt nahe, dass sie während des gleichen Zeitraumes in Gebrauch waren10 .
Gläser mit Fadenrippen (zudem oftmals kom-biniert mit blauen Tropfen oder Punkten und blauen Fadenauflagen) sind insbesondere als böhmische Produkte anzusprechen und vor al-lem aus dieser Hüttenregion bekannt . Das Ver-breitungsgebiet solcher Gläser erstreckt sich von Böhmen über Ost- und Norddeutschland sowie Polen11 bis nach Schweden und Finnland12 . Die westlichsten Funde von Fadenrippenbechern sind aus den Niederlanden bekannt geworden (hEn-kEs 1994, 42 f . Abb . 29–30, Nr . 9,1), dagegen fehlen sie in süddeutschen Fundkomplexen . Im Herstel-lungsgebiet angetroffene Fundzusammenhänge verweisen in eine Entstehungszeit der Fadenrip-penbecher vom Ende des 13 . bis zur Mitte des 15 . Jahrhunderts, wobei gerade in der Zeit um 1400 eine besondere Fundhäufigkeit festzustellen ist13 . Neben archäologischen Befunden geben ebenso bildliche Quellen (černá 1996) und darüber hin-aus die Verwendung von Fadenrippenbechern als Reliquiengefäße Hinweise auf eine Datierung der Gläser . Bekanntestes Beispiel für einen solchen Becher zur Aufbewahrung von Reliquien ist das Glas aus dem Hochaltar der Kirche des Prämons-tratenser-Nonnenklosters von Rehna, Kr . Gade-busch in Mecklenburg-Vorpommern14 . Das Gefäß wurde 1851 im Altartisch der Kirche entdeckt . Es enthielt kleine Reliquien und eine Weiheurkunde vom 10 . Oktober 1456, die vom Ratzeburger Bi-schof Johann III . Preen (1454–1461) gesiegelt war . Dieser terminus ante quem belegt, dass das Stück aus Rehna früher entstanden ist, vergleichbar an-deren zu einem späteren Zeitpunkt sekundär als Reliquiengefäße verwendeten Gläsern (GAi 1993, 384; 392).
10 müllEr (1992, 158) datiert beide Glasgefäße in Periode V, was bei dieser Ausgrabung dem Zeitansatz 14 .-15 . Jahr-hundert entspricht .
11 rAdEmAchEr 1933, Taf. 30d; küAs 1966, 512 f., Abb. 156; schüt- tE 1976, 104 Abb. 3; lAppE 1983, 205 f., Abb. 11.7; dumitrAchE 1990, 34 ff., Abb. 10–12, G 88–107; gołęBiewski 1993, 122 Abb. 7,9; schäFEr 1999, 39 f., Abb. 2,f–i; möllEr 1999, 47 Abb. 1,a–b; stEppuhn 2002a.
12 hAGGrén 1997, 355 ff. Abb. 4–5; ders. 1999, 66 f. Abb. 3–4; hAGGrén/mäEsAlu 1999, 21 ff .
13 hEjdová/nEchvátAl/ŠEdivý 1975, 536 f.; hEjdová et al . 1983, 250 ff.; bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 290 ff.; Černá 1994, 52 f.; 89 f.; ders. 1996, 128 Abb. 1.
14 bAumGArtnEr/kruEGEr 1988, 291 Nr . 329 mit weiter-führender Literatur .
Im Lübecker Fundgut kommen sowohl gro-ße als auch kleine Becher mit Fadenrippen vor, wobei ein kleinerer Becher mit einem Mün-dungsdurchmesser von 7,0 cm einer Schicht des 14 . Jahrhunderts, ein größerer mit einem Mün-dungsdurchmesser von 13,2 cm einer Schicht des 15 . Jahrhunderts entstammt . Gleichwohl wird die Größe der Gläser keinen Hinweis auf deren Alter zulassen, denn kleine wie große Becher befin-den sich in Lübeck innerhalb derselben Befunde (vgl . dumitrAchE 1990, 34 ff ., G 88-105, Abb . 10–12) . Diese Auffindungssituation widerspricht den Recherchen von bAumGArtnEr und kruEGEr (1988, 290), wonach größere Fadenrippenbecher nur in Böhmen, kleinere hingegen nur in Norddeutschland gefunden wurden . Man wird also davon ausge-hen müssen, dass kleinere wie größere Fadenrip-penbecher nicht nur zeitgleich benutzt wurden,
Abb. 3: Hansestadt Lübeck, Schrangen. Untere Partie eines Keulenglases mit Goldblattauflagen und Goldbe- malung. Erhaltene Höhe 22,9 cm; Fußdurchmesser 10,1 cm.
389Festschrift für Hans-Georg Stephan
sondern auch innerhalb wie außerhalb Böhmens zum allgemein verfügbaren Glasrepertoire zähl-ten .
Zwei andere Gläser mit zusätzlicher Goldverzie-rung aus der Lübecker Altstadt zählen zu den run-den Stangen- bzw . Keulengläsern des 15 ./16 . Jahr-hunderts . Die Fragmente beider keulenförmiger Glasgefäße lagen innerhalb desselben Brunnens am Schrangen, der sich zum damaligen Zeitpunkt auf dem Grundstück des Lübecker Scharfrichters befand . Sie bestehen aus gelbgrüner (Abb. 3) bzw . aus grünblauer Glasmasse (Abb. 4) und weisen je-weils eine nachträgliche Goldbemalung in Form sechsstrahliger Sterne und floraler Motive auf .
Die Form der spätmittelalterlichen böhmischen Stangen- und Keulengläser des 14 . und 15 . Jahr- hunderts wurde von deutschen Glashütten im frühen 15 . Jahrhundert aufgenommen und bis
um die Mitte des 16 . Jahrhunderts produziert . Die jüngeren Varianten bestehen in der Regel aus grünlichem oder gelblichgrünem Glas, und der Fuß ist nicht mehr angesetzt, sondern durch Hochstechen der Glasblase gebildet, worauf der gewölbte hohle Fußrand hinweist . Der Schaft misst am Fuß oft nur 2 bis 4 cm und Höhen von 40 bis 50 cm sind auch für die Exemplare aus deut-schen Hütten nicht außergewöhnlich (bAumGArt-nEr/kruEGEr 1988, 387 f . Nr . 484–485) . Die Dekore, die an fast allen Gläsern zu finden sind, bestehen
– wie bei den Glasgefäßen vom Schrangen – zu-meist aus schwachen, optisch geblasenen Verti-kalriefen und dünnen, plastisch aufgelegten, spi-ralförmigen Fäden . Das Hauptverbreitungsgebiet des Keulenglases liegt im mittleren und nörd-lichen Deutschland . Ausgrabungen in Erfurt15, Halle (pAul 1990, 306 f . Abb . 5), Göttingen (schüttE 1982, Abb . 5–6), Höxter16, Braunschweig (röttinG 1985, 96 ff., Abb. 54; bruckschEn 2004), Wismar (stEppuhn 1999a, 63), Lübeck (FAlk 1987, Abb . 24,12–15; dumitrAchE 1990, G 274-284, Abb . 34–35), Kiel (huckE 1981) und Schleswig (stEppuhn 2002a) ha-ben bereits große Fundmengen dieses Typs erge-ben . Neben der Niestehütte im Kaufunger Wald (köniG/stEphAn 1987, Abb . 4) und den Volsba-cher Glashütten im Eichsfeld (lAppE/möbEs 1984, 227 f. Abb. 12.2; 13) werden solche Gläser ebenso in anderen Hütten dieser Regionen hergestellt worden sein . Auch in Dänemark (jEXlEv/riismØl-lEr/schlütEr 1970, 101 Abb. 16,2; 111 Abb. 21,2), Schweden und Finnland gibt es Hinweise auf eine Produktion von Keulen- und Stangengläsern (hAGGrén/mäEsAlu 1999, 34 ff .) . Als westlichstes Vorkommen sind Keulengläser in den Niederlan-den belegt (hEnkEs 1994, 84 ff., Nr. 21,1–2; bruck-schEn 1994, 43, GL 323, Taf . 6,1) . Im Verlauf des 16 . Jahrhunderts werden Keulengläser allmählich von achteckigen Stangengläsern abgelöst, die insbesondere zwischen der Mitte des 16 . und der Mitte des 17 . Jahrhunderts zum vorherrschenden Trinkglastypus im kontinentalen Nordwesteuro-pa werden (stEppuhn 2003c, 99) . Die Ausformung des Fußes des ersten Stückes mit angesetztem Scheibenfuß (Abb. 3) deutet darauf hin, dass hier ein Keulenglas aus der ersten Hälfte des 15 . Jahr-hunderts vorliegt . Es ist anzunehmen, dass beide Gläser als Service in Benutzung gestanden haben, was aus der gleichartigen Bemalung und aus dem-
15 lAppE 1983, 202 Abb. 10.4; ders. 1988, 94 f. Abb. 3–4; ders. 1990, 241 Abb . 23 .6 .8–9 .
16 stEphAn 1972, 164 ff., Abb. 129; ders. 1980, 122 f., Abb. 15.1; ders . 1986, 285 f ., Abb . 37 .
Abb. 4: Hansestadt Lübeck, Schrangen. Obere Partie eines keulenförmigen Stangenglases mit Goldblattauflagen und Goldbemalung. Erhaltene Höhe 12,2 cm.
390 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
selben Fundort zu schließen ist . Wie bei den ande-ren bereits erwähnten Gläsern mit Goldbemalung werden ebenso die Keulengläser vom Schrangen vermutlich in Lübeck bemalt worden sein . Der Zeitpunkt der nachträglichen Dekorierung lässt sich auch in diesen Fällen nicht genau ermitteln . Entweder wurden sie kurz nach ihrem Eintref-fen in Lübeck bemalt oder ein bis zwei Gene- rationen später, denn das vergesellschaftete weite-re Glasmaterial der beiden Keulengläser umfasst jeweils das 15 ./16 . Jahrhundert .
Die jüngsten Exemplare der hier vorgestellten Gläser-Gruppe datieren in die Zeit um 1600 . Das Kelchglas (Abb. 5) wurde aus einer Kloake auf dem Grundstück Fischstraße 10 unter einer mehr als neun Meter mächtigen Abfallschicht geborgen, wobei sich der Fuß des Gefäßes in dessen Oberteil befand . Diese Auffindungssituation deutet darauf hin, dass das Glas bereits vor etwa 400 Jahren zer-brach und weggeworfen wurde (stEppuhn 1997a) . Das 15,5 cm hohe Gefäß aus entfärbter Glasmasse hat eine leicht graue Tönung . Das Filigranmus-ter besteht aus Netzglasstangen sowie locker ge-kreuzten schmalen Doppelbändern, die jeweils durch breite weiße Streifen in farbloser Umhül-lung getrennt sind . Der kleine Fuß ist in der Mit-te hochgezogen und hat einen umgeschlagenen Rand; er endet in einem gedrückten Kugelknauf ohne diesen begrenzenden Scheiben . Der koni-sche Kelch ist im unteren Teil in eine Form mit Traubenmuster geblasen, oben jedoch glattwandig . Fuß und Knauf des Trichterkelches sind den Kelch- gläsern mit gemodeltem Traubenmuster an der Kuppa verwandt; gleiches gilt für die Kombination der Filigranstangen, die hier recht gleichmäßig aus-fallen . Für eine Datierung gibt das Glas aus Liège (chAmbon 1955, Taf . XIV,49) einen Anhaltspunkt: Die Fassung jenes Glases enthält das Wappen von Sarah Vincx; die sich auf das Wappen stützende Datierung umfasst den Zeitraum 1584 bis 164717 . Die charakteristische Form des Kelches kommt nur in der Verbindung mit dem kleinen hochgezo-genen Fuß und dem gedrückten Kugelknauf vor (thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994, 231) . Diese Form ist typisch für die zweite Hälfte des 16 . Jahrhun-derts . Der Knauf wird meistens durch farblose Glas-scheiben von Fuß und Kelch getrennt . Beispiele ohne Scheiben, wie bei den Exemplaren aus Lübeck und Coburg (thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994, 230 f ., Nr . 201), kommen dagegen nur vereinzelt vor . Die
17 Sarah Vincx heiratete 1584 den Glashüttenmeister Ambro-sio Mongarda, sie starb im Jahre 1647 .
Stangen mit den locker geschlungenen breiten Bändern sind nicht häufig, gehören aber zu den Mustern, die auch bei anderen venezianischen Gläsern der zweiten Hälfte des 16 . Jahrhunderts verwendet wurden .
Parallelfunde des späten 16 ./frühen 17 . Jahr-hunderts sind in großer Zahl vorhanden, wenn-gleich alle keine nachträgliche Goldbemalung aufweisen . Besonders starke Ähnlichkeit besteht zu dem Kelchglas von der Veste Coburg (thEuEr-kAuFF-liEdErWAld 1994, 230 f ., Nr . 201), dazu kom-men noch weitere Exemplare aus dieser Samm-lung (thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994, 196 f. Nr. 177; 231 f . Nr . 202–203) sowie aus London (tAit 1982, 209 f. Nr. 155; ders. 1991, 168 f. Nr. 213), Amsterdam (lAméris/lAméris 1991, 74 f . Nr . 46), Frankfurt (bAuEr/ GAbbErt 1980, 77 Nr . 148), Köln (klEssE/rEinEkinG-von bock 1973, 152 Nr . 298) und Hamburg (von sAldErn 1995, 212 Nr . 200)18; weitere Gläser sind
18 Viele weitere Hinweise insbesondere bei thEuErkAuFF-liEdErWAld (1994, 230 f) .
Abb. 5: Hansestadt Lübeck, Fischstraße 10. Kelchglas à la fa-çon de Venise mit Betonung des Filigranmusters durch par-tiellen Auftrag von Goldfarbe. Höhe des Glasgefäßes 15,5 cm.
391Festschrift für Hans-Georg Stephan
aus Haarlem, Antwerpen und Metz bekannt19 . Bei allen Gläsern sind Form und Größe recht ähnlich; die Beschaffenheit der verendeten Glasmassen reicht von kräftig bis schwach grau getönt . Die Stangenauflagen variieren ebenfalls stark mit großen Qualitätsunterschieden in der Ausfüh-rung . Ganz offensichtlich handelt es sich hier um eine sehr beliebte Glasform, die, nach den Quali-tätsunterschieden zu urteilen, in vielen verschie-denen Hütten hergestellt wurden, die à la façon de Venise arbeiteten .
Aus derselben Kloake von der Fischstraße 10, allerdings aus einer tieferen Schicht, stammt das Fragment eines Glasdeckels, der gleichfalls aus farblosem und Filigranglas besteht . Wie für die oben beschriebenen Kelchgläser sind für Glasge-fäße mit Deckel eine Vielzahl von Gegenstücken bekannt . Allerdings lässt sich nicht mehr feststel-len, ob der Deckel ehemals zu einem Pokal20, Stan-genglas21, Kelchglas22, zu einer Vase (von sAldErn 1995, 213 Nr . 203) oder Kanne (vrEEkEn 1994, 217) gehörte .
Sowohl Kelchglas als auch Deckel sind nicht nur in aufwändiger Filigran-Technik nach vene-zianischer Art hergestellt, sie tragen zudem eine zusätzliche sehr feine Goldbemalung, die das Filigranmuster betont . Deutlich sind dabei die Ansatzpunkte des Pinsels zu sehen, der jeweils von links unten nach rechts oben geführt wurde (Abb. 6) . Möglicherweise ist der Dekor das Produkt eines Lübecker Kunsthandwerkers, der in der Zeit um 1600 die vermutlich aus einer belgischen oder niederländischen Glashütte stammenden Gläser mit Goldfarbe bemalte . Die Fundsituation inner-halb derselben Kloake und der außergewöhnliche Dekor sprechen dafür, dass beide Glasgefäße zu einem Service im gleichen Haushalt gehörten . Die Lage der Objekte in voneinander getrennten Schichten führt zu dem Schluss, dass sie zu un-terschiedlichen Zeiten zerbrachen und wegge-worfen wurden .
19 In einer Email vom 10 .12 .2014 teilte mir Michel Hulst, Amsterdam, freundlicherweise diese Fundorte mit; Herr Hulst favorisiert Antwerpen als Herstellungsort für diese Kelchgläser .
20 klEssE/rEinEkinG-von bock 1973, 141 Nr. 266; bAuEr/GAb- bErt 1980, 90 f. Nr. 188-189; tAit 1982, 142 ff. Nr. 80; 94; 101; drEiEr 1989, 71 f. Nr. 49; thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994, 221 f . Nr . 191 .
21 brEmEn 1964, 390 f. Nr. 207; klEssE/rEinkinG-von bock 1973, 141 Nr. 265; bAuEr/GAbbErt 1980, 90 f. Nr. 187; 191.
22 hEnkEs 1994, 177, Nr. 41,13; thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994, 229 f . Nr . 200 .
Ausblick
Die hier vorgestellten Gläser zeigen nicht nur, dass Hohlgläser vom Spätmittelalter bis zur Neu-zeit allgemein eine hohe Wertschätzung besaßen, sie belegen gleichfalls das Bemühen darum, durch zusätzliche Dekorierung einzelne Exemplare dar-über hinaus individuell herauszuheben . Ob und zu welchem Anlass bzw . zu welchem Zeitpunkt die nachträgliche Vergoldung durch Künstler oder (vermutlich bei einfacheren Motiven) durch Privatpersonen und/oder Besitzer solcher Gläser selbst erfolgte, ist jedoch kaum zu ermitteln . Si-cherlich wird es eine viel größere Zahl von Glas-objekten dieser Art in vergleichbaren Fundkom-plexen geben; diese Spezies zu entdecken ist aber nicht nur vom Zufall abhängig, sondern vor allem vom Erhaltungszustand der Dekore, denn diese sind durch Korrosion oder Abrieb oftmals nicht mehr als solche zu erkennen .
Zusammenfassung
Glasgefäße besaßen in Mittelalter und früher Neu-zeit einen hohen Wert . Sie hatten Prestige-Cha-rakter und manifestierten gesellschaftlichen Sta-tus . Darüber hinaus hat es außerdem vereinzelt ein individuelles Bedürfnis gegeben, einzelne oder mehrere gleichartige Gläser aufzuwerten bzw . un-verkennbar als einer Person oder einem Personen-kreis zugehörig zu kennzeichnen . Die Aufwertung eines Glasgefäßes durch das nachträgliche Anbrin-gen eines Golddekors beleuchtet Persönlichkeit und Stolz der BesitzerInnen auf vererbte und/oder selbst erworbene Gläser – hier dargestellt an sieben Beispielen zwischen etwa 1300 und 1600 aus dem reichhaltigen Lübecker Glas-Repertoire .
Abb. 6: Hansestadt Lübeck, Fischstraße 10. Kelchglas à la fa-çon de Venise mit Betonung des Filigranmusters durch par-tiellen Auftrag von Goldfarbe, Detail.
392 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
LiteraturverzeichnisbArGEn 1989
D . Bargen, Eine archäologische Untersuchung zur Hafenrandbebauung im Norden des Lübecker Stadt-hügels, An der Untertrave 7 . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 16, 1989, 185–208 .
bAuEr/GAbbErt 1980M . Bauer, G . Gabbert, Europäisches und außereuro-päisches Glas . Museum für Kunsthandwerk Frank-furt am Main (Frankfurt 21980) .
bAumGArtnEr 1993E . Baumgartner, Fundverbreitung und Produkti-onsgebiete . Zur Glasherstellung im mittelalterlichen Europa . In: Annales du 12e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Wien 1991) (Amsterdam 1993) 307–317 .
bAumGArtnEr, ErWin/kruE GEr, inGEborG 1988E . Baumgartner, I . Krue ger, Phönix aus Sand und Asche . Glas des Mittelalters . Ausstellungskatalog Rheinisches Landesmuseum Bonn und Historisches Museum Basel (München 1988) .
brEmEn 1964W . Bremen, Die alten Glasgemälde und Hohlgläser der Sammlung Bremen in Krefeld . Beihefte der Bon-ner Jahrbücher 13 (Köln, Graz 1964) .
bruckschEn 1994M . Bruckschen, Glasfunde des späten Mittelalters und der Neuzeit aus Dordrecht, Niederlande . Ma-gisterarbeit der Universität Kiel (Kiel 1994) .
bruckschEn 2004M . Bruckschen, Glasfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Braunschweig . Bedeutung, Ver-wendung und Technologie von Hohlglas in Nord-deutschland . Materialhefte zur Ur- und Frühge-schichte Niedersachsens 33 (Rahden 2004) .
černá 1994E. Černá (Hrsg.), Středovĕké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy (Most 1994).
černá 1996E. Černá, Böhmisches mittelalterliches Glas und seine Darstellung in Bilderhandschriften und in der bildenden Kunst . Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 15 = Realienfor-schung und Historische Quellen (Oldenburg 1996) 127–136 .
chAmbon 1955R . Chambon, L’histoire de la verrerie en Belgique du IIeme siècle à nos jours (Brüssel 1955) .
chArlEston 1976R . J . Charleston,A 13th century Syrian glass beaker excavated in Lübeck . In: O . Ahlers, A . Graß mann, W . Neugebauer, W . Schadendorf (Hrsg .), Lübeck 1226 . Reichsfreiheit und frühe Stadt (Lübeck 1976) 321–337 .
drEiEr 1989F . A . Dreier, Venezianische Gläser und ”Façon de Venise” . Kataloge des Kunstgewerbemuseums Ber-lin (Berlin 1989) .
dumitrAchE 1988M . Dumitrache, Glasfunde aus der Lübecker Innen-stadt . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kul-turgeschichte 17, 1988, 155–159 .
dumitrAchE 1990M . Dumitrache, Glasfunde des 13 .–18 . Jahrhunderts aus der Lübecker Innenstadt, Grabungen 1948–1973 . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturge-schichte 19, 1990, 7–161 .
ErdmAnn 1986W . Erdmann, Die Christophorus-Scheibe aus der Kloake der Fronerei auf dem Schrangen und spät-mittelalterliche Hausverglasungen in Lübeck . Lübe-cker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschich-te 12, 1986, 205–228 .
ErdmAnn/nitsch 1986W . Erdmann, H . Nitsch, Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Perlen aus einer Kloake der Frone-rei auf dem Schrangen zu Lübeck . Lübecker Schrif-ten zur Archäologie und Kulturgeschichte 12, 1986, 137–165 .
FAbEsch 1989U . H . Fabesch, Archäologische und baugeschicht-liche Untersuchungen in der Fleischhauerstraße 20 zu Lübeck . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 16, 1989, 137–159 .
FAlk 1980aA . Falk, Glasfunde aus der Lübecker Innenstadt . Ar-chäologie in Lübeck . Hefte zur Kunst und Kultur-geschichte der Hansestadt Lübeck 3, 1980, 102–104 .
FAlk 1980bA . Falk, Archäologisches Material aus der ehemali-gen Ratsapotheke zu Lübeck . Rotterdam Papers IV, 1982, 35–46 .
FAlk 1981A . Falk, Steinzeug- und Glasgefäße aus der ehema-ligen Ratsapotheke zu Lübeck . Die Heimat 88, 1981, 94–98 .
FAlk 1987A . Falk, Archäologische Funde und Befunde des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Lü-beck . Materialvorlage und erste Auswertungsergeb-nisse der Fundstellen Schüsselbuden 16/Fischstraße 1–3 und Holstenstraße 6 . Lübecker Schriften zur Ar-chäologie und Kulturgeschichte 10, 1987, 9–84 .
Foy/sEnnEQuiEr 1989D . Foy, G . Sennequier, A travers le verre du moyen age à la renaissance, Katalog zur Ausstellung in Rouen 1989 (Nancy-Maxéville 1989) .
GAi 1993S . A . Gai, Die Verwendung von Glasgefäßen für die Aufbewahrung von Reliquien . Die Glassammlung des Diözesanmuseums Rottenburg am Neckar . An-nales du 12e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Wien 1991) (Amsterdam 1993) 383–395 .
GläsEr 1989M . Gläser, Archäologische und baugeschicht liche Untersuchungen im St . Johanniskloster zu Lübeck .
393Festschrift für Hans-Georg Stephan
Auswer tung der Befunde und Funde . Lübecker Schriften zur Archäolo gie und Kulturgeschichte 16, 1989, 9–120 .
GläsEr 1992aM . Gläser, Die Ausgrabungen in der Großen Peters-grube zu Lübeck . Befunde und Funde . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 18, 1992, 41–185 .
GläsEr 1992bM . Gläser, Die Funde der Grabungen Alfstraße36/38 und An der Untertrave 111/112 . Niederschlag der Stadtentwicklung Lübecks und seines Hafens im 12 . und 13 . Jahrhundert . Lübecker Schriften zur Ar-chäologie und Kulturgeschichte 18, 1992, 187–248 .
GläsEr/krusE/lAGGin 1992M . Gläser, K . B . Kruse, D . Laggin, Archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen auf dem Grundstück Mengstraße 64 in Lübeck . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 18, 1992, 249–286 .
gołęBiewski 1993A. Gołębiewski, Mittelalterliche und neuzeitliche Glaserzeugnisse von ausgewählten Fundstätten Nordpolens . Zeitschrift für Archäologie des Mittel-alters 21, 1993, 107–134 .
hAch 1900T . Hach, Ueberblick über die ehemalige Glasindus-trie in und um Lübeck . Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde 8, 1900, 217–254 .
hAGGrén 1997G . Haggrén, Looking through Glass . Recent Glass Finds and Material Culture in Medieval Turku, Finland . In: Material Culture in medieval Europe . Papers of the ”Medieval Brugge 1997” Conference 7 (Zellik 1999) 353–360 .
hAGGrén 1999G . Haggrén, Medieval glass finds from Turku, es-pecially from the Aboa Vetus excavations . In: R . Vissak, A . Mäesalu (Hrsg .), The Medieval Town in the Baltic . Hanseatic History and Archaeology . Proceedings of the first & second seminar, Tartu, Estonia, 6th–7th 1997 and 26th–27th June 1998 (Tartu 1999) 65–73 .
hAGGrén/mäEsAlu 1999G . Haggrén, A . Mäesalu, Cheers! Fragments from the Middle Ages . Glassvessels and Their Users in the Medieval North-Europe (Turku 1999) .
hAhn 1978K .-D . Hahn, Grabung Königstraße 59–63 in Lübeck . Kommentierter Katalog der Kleinfunde aus Glas, Metall, Holz usw . Lübecker Schriften zur Archäo-logie und Kulturgeschichte 1, 1978, 119–132 .
hEjdová/nEchvátAl/ŠEdivý 1975D. Hejdová, B. Nechvátal, E. Šedivý, Použití kobaltu ve středověkém sklářství v Čechach (Die Verwen-dung von Kobalt in der mittelalterlichen Glaserzeu-gung Böhmens) . Archeologické rozhledy 27, 1975, 530–554 .
heJDoVá/frýDa/šeBesta/černá 1983D. Hejdová, F. Frýda, P. Šebesta, E. Černá, Stredověke sklo Čechach (Mittelalterliches Glas in Böhmen). Archaeologia Historica 8, 1983, 243–266 .
hEnkEs 1994H . E . Henkes, Glas zonder glanz . Vijf eeuwen ge-bruiksglas uit de bodem van de Lage Landen 1300-1800 . Rotterdam Papers 9 (Den Haag 1994) .
huckE 1981K . Hucke, Zwei Keulengläser des 16 . Jahrhunderts aus der Kieler Altstadt . Offa 38, 1981, 387–390 .
jEXlEv/riismØllEr/schlütEr 1970T . Jexlev, P . Riismøller, M . Schlüter, Dansk Glas i Renæssancetid 1550–1560 (København 1970) .
klEssE/rEinEkinG-von bock 1973B . Klesse, G . Reineking-von Bock, Glas . Katalog des Kunstgewerbemuseums Köln (Köln 21973) .
köniG/stEphAn 1987A . König, H .-G . Stephan, Eine frühneuzeitliche Glas- hütte im Tal der Nieste bei Großalmerode . Archäo-logische Denkmäler in Hessen 64 (Wiesbaden 1987) .
kruEGEr 1990I . Krueger, Glasspiegel im Mittelalter . Fakten, Funde und Fragen . Bonner Jahrbücher 190, 1990, 233–319 .
kruEGEr 1996I . Krueger, Research in medieval glass . Where are we standing now? Annales du 13e congrès de l’As-sociation Internationale pour l’Histoire du Verre (Niederlande 1995) (Lochem 1996) 277–288 .
kruEGEr 1998I . Krueger, An enamelled beaker from Stralsund: a spectacular new find . In: R . Ward (Hrsg .), Gilded and Enamelled Glass from the Middle East (London 1998) 107–109 .
kruEGEr 2002I . Krueger, A Second Aldrevandin Beaker and an Update on a Group of Enameled Glasses . Journal of Glass Studies 44, 2002, 111–132 .
kruEGEr 2005I . Krueger, Magister Doninus und seine Vogel . Ein Glas-Neufund aus Mainz und was damit zusam-menhangt . Mainzer Archaologische Zeitschrift 5/6, 1998/1999 (2005) 275–292 .
küAs 1966H . Küas, Mittelalterliche Keramik und andere Funde vom Ranstädter Steinweg und Pleissemühlgraben zu Leipzig . Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 14/15, 1966, 347–519 .
lAGGin 1989D . Laggin, Eine archäologische Untersuchung am Fuße von Burg und Burgkloster zu Lübeck, Kleine Altefähre 15 . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 16, 1989, 161–184 .
394 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
lAméris/lAméris 1991F . Laméris, K . Laméris Venetiaans & Façon de Ve-nise Glas 1500–1700 (Amsterdam 1991) .
lAppE 1983U . Lappe, Mittelalterliche Gläser und Keramikfunde aus Erfurt . Alt-Thüringen 18, 1983, 182–212 .
lAppE 1988U . Lappe, Mittelalterliches Glas aus Erfurt . Veröffent- lichungen des Museums für Thüringische Volks-kunde und des Museums für Stadtgeschichte in Erfurt, (Erfurt 1988) 82–96 .
lAppE 1990U . Lappe, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Funde vom Domplatz in Erfurt . Alt-Thüringen 25, 1990, 199–242 .
lAppE/möbEs 1984U . Lappe, G . Möbes, Glashütten im Eichsfeld . Alt-Thüringen 20, 1984, 207–232 .
möllEr 1994G . Möller, Ein goldemailbemalter Glasbecher des frühen 14 . Jahrhunderts aus der Altstadt von Stral-sund . Jahrbuch Bodendenkmalpflege in Mecklen-burg-Vorpommern 1993, 1994, 215–227 .
möllEr 1999G . Möller, Mittelalterliches und renaissancezeitli-ches Hohlglas aus Stralsund . Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 5, 1995 (1999) 43–48 .
mührEnbErG 1984D . Mührenberg, Grabungen auf den Grundstücken Hundestraße 9-17 in Lübeck: Stratigraphie und Chronologie, Bau- und Besiedlungsgeschichte im Mittelalter . Wissenschaftliche Hausarbeit zur Er-langung des akademischen Grades eines Magis-ter Artium der Universität Hamburg . Ungedruckt (Hamburg 1984) .
mührEnbErG 1993D . Mührenberg, Der Markt zu Lübeck . Ergebnisse archäologischer Untersuchungen . Lübecker Schrif-ten zur Archäologie und Kulturgeschichte 23, 1993, 83–154 .
müllEr 1992U . Müller, Ein Holzkeller aus dem späten 12 . Jahr-hundert: Erste Ergebnisse der archäologischen Un-tersuchungen auf den Grundstücken Königstraße 70–74 in Lübeck . Mit einem Beitrag zu ausgewähl-ten Glasfunden . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 22, 1992, 145–166 .
nEuGEbAuEr 1965W . Neugebauer, Mittelalterliche und jüngere Glas-funde bei den Ausgrabungen in der Hansestadt Lü-beck . VIIe Congrès International du Verre (Bruxelles 1965), Comptes Rendus II (Bruxelles 1965) 235 .1–12 .
nEuGEbAuEr 1967aW . Neugebauer, Altes Glas im Herzogtum Lauen-burg . Lauenburgische Heimat 66, 1967, 22–47 .
nEuGEbAuEr 1967bW . Neugebauer, Altes Glas in Lübecker Bodenfun-den . Der Wagen 1967, 129–135 .
nEuGEbAuEr 1968W . Neugebauer, Die Ausgrabungen in der Altstadt Lübecks . Rotterdam Papers 1 (Rotterdam 1968) 93–113 .
nEuGEbAuEr 1976W . Neugebauer, Fundstelle und Funde . In: R . J . Charleston (Hrsg .), A 13th Century Syrian Glass Beaker excavated in Lübeck = Lübeck 1226 . Reichsfreiheit und frühe Stadt (Lübeck 1976) 321–323 .
pAul 1990M . Paul, Mittelalterliche Gläser aus den Fund-komplexen von Halle (Saale) . In: Archäologische Stadtkernforschung in Sachsen . Arbeits- und For-schungsberichte zur sächsischen Bodendenkmal-pflege, Beiheft 19 (Berlin 1990) 295–316 .
pAusE 1996C . Pause, Spätmittelalterliche Glasfunde aus Vene-dig: Ein archäologischer Beitrag zur deutsch-venezi-anischen Handelsgeschichte . Universitätsschriften zur Prähisto rischen Archäologie 28 (Bonn 1996) .
pAusE/stEppuhn (im Druck)C . Pause, P . Steppuhn, Ein spätmittelalterlicher Fund- komplex mit qualitätvollen Importgläsern aus dem ehemaligen Johanniskloster in Lübeck (Ma-nuskriptabgabe Juni 1998) . In Vorbereitung für die Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturge-schichte .
posEr 1981K .-H . Poser, Alte Trinkgläser in Schleswig-Holstein (Neumünster 1981) .
prohAskA-Gross/soFFnEr 1992Chr . Prohaska-Gross, A . Soffner, Hohlglasformen des 13 . und 14 . Jahrhunderts in Südwestdeutschland und der nördlichen Schweiz . In: N . Flüeler (Hrsg .), Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch – Die Stadt um 1300 . Ausstellungskatalog (Zürich 1992) 299–310 .
rAdEmAchEr 1933F . Rademacher, Die deutschen Gläser des Mittelal-ters (Berlin 1933) .
röttinG 1985H . Rötting, Stadtarchäologie in Braunschweig . Ein fachübergreifender Arbeitsbericht zu den Grabun-gen 1976–1984 (Hameln 1985) .
schäFEr 1995H . Schäfer, Bemerkenswerte Funde aus dem frühen 14 . Jahrhundert vom Grundstück Markt 12 in Greifs-wald . Baltische Studien N . F . 81, 1995, 55–66 .
schäFEr 1999H . Schäfer, Mittelalterliches Hohlglas aus Rostock . Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 5, 1995 (1999) 35–42 .
schüttE 1976S . Schütte, Mittelalterliches Glas aus Göttingen . Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 4, 1976, 101–117 .
schüttE 1982S . Schütte, Glas in der mittelalterlichen Stadt . In: R . Pohl-Weber (Hrsg .), Aus dem Alltag der mittel-
395Festschrift für Hans-Georg Stephan
alterlichen Stadt . Handbuch zur Sonderausstellung im Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kultur-geschichte . Hefte des Focke Museums 62 (Bremen 1982) 133–144 .
stEphAn 1972H .-G . Stephan, Hausrat aus einem Abfallschacht der Frührenaissance in Höxter . Westfalen 50, 149–178 .
stEphAn 1978H .-G . Stephan, Archäologische Grabungen im Handwerkerviertel der Hansestadt Lübeck (Hun-destraße 9–17); ein Vorbericht. Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 1, 1978 75–80 .
stEphAn 1980H .-G . Stephan, Überlegungen zur wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Interpretation archäologi-scher Fundmaterialien des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit . Am Beispiel ausgewählter Fundkomplexe des 16 . und 17 . Jahrhunderts aus Göt-tingen und Höxter . Lübecker Schriften zur Archäo-logie und Kulturgeschichte 4, 1980, 120–131 .
stEphAn 1986H .-G . Stephan, Beiträge zur archäologischen Er-forschung der materiellen Kultur des hohen und späten Mittelalters im Weserbergland . Funde aus zwei Kloaken der Altstadt von Höxter . Neue Aus-grabungen und Forschungen in Niedersachsen 17, 1986, 219–308 .
stEppuhn 1993P . Steppuhn, Ein islamisches Goldemailglas aus Lübeck, Königstraße 32 . In: M . Gläser (Hrsg .), Ar-chäologie im Hanseraum . Eine Festschrift für G . P . Fehring, Schriften des Kulturhistorischen Museums in Rostock 1 (Rostock 1993) 479–484 .
stEppuhn 1996aP . Steppuhn, Die Glasfunde . In: G . Schmitt, Der früh- neuzeitliche „Moor- und Dreckwall“ von 1554–1560 in Lübeck . Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 24, 1996, 293–295 .
stEppuhn 1996bP . Steppuhn, Eine Glasschale aus der Zeit um 1200 . Archäologie in Deutschland 1996, Heft 4, 56 .
stEppuhn 1996cP . Steppuhn, Gold- und emailbemalte Gläser des 12 . und 13 . Jahrhunderts aus Norddeutschland . In: Annales du 13e congrès de l’Association Internati-onale pour l’Histoire du Verre (Niederlande 1995) (Lochem 1996) 319–331 .
stEppuhn 1997aP . Steppuhn, Ein Kelchglas á la façon de Venise . In: M . Gläser (Hrsg .), geFUNDEn in Lübeck . Archäolo-gie im Weltkulturerbe . Ausstellungen zur Archäo-logie in Lübeck 3 (Lübeck 1997) 16–21 .
stEppuhn 1997bP . Steppuhn, Ein Mittelpunkt für die festliche Ta-fel . In: M . Gläser (Hrsg .), geFUNDEn in Lübeck . Archäologie im Weltkulturerbe . Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck 3 (Lübeck 1997) 52–57 .
stEppuhn 1998P . Steppuhn, Neues aus der Glasforschung . Archäo-logie in Deutschland 1998, Heft 3, 51–52 .
stEppuhn 1999aP . Steppuhn, Die Gläser aus dem Brunnen des Rat-hauskellers in Wismar . Mit besonderer Berücksichti-gung der spätmittelalterlichen Rippen- und Kreuz-rippenbecher . Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 5, 1995 (1999) 57–81 .
stEppuhn 1999bP . Steppuhn, Der mittelalterliche Gniedelstein: Glätt- glas oder Glasbarren? Zu Primärfunktion und Kon-tinuität eines Glasobjektes vom Frühmittelalter bis zur Neuzeit . Nachrichten aus Niedersachsens Urge-schichte 68, 1998 (1999) 113–139 .
stEppuhn 2002aP . Steppuhn, Glasfunde des 11 . bis 17 . Jahrhunderts aus Schleswig . Ausgrabungen in Schleswig . Berich-te und Studien 16 (Neumünster 2002) .
stEppuhn 2002bP . Steppuhn, Ein außergewöhnlicher blauer Glasbe-cher . Archäologische Gesellschaft der Hansestadt Lübeck (Hrsg .), Jahresschrift 4, 2000/2001 (Lübeck 2002) 66–68 .
stEppuhn 2003aP . Steppuhn, Glasschale mit Fadenauflagen / Glass-kål med pålagt tråd . In: M . Gläser, D . Mührenberg, P . B . Hansen (Hrsg .), Dänen in Lübeck / Danskere i Lübeck 1203–2003 . Katalog zur Ausstellung in Lü-beck / Næstved [Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck 6] (Lübeck 2003) 169–170 .
stEppuhn 2003bP . Steppuhn, Ein wertvolles Glas aus dem Nahen Osten . In: M . Gläser, D . Mührenberg (Hrsg .), Welt-kulturerbe Lübeck . Ein Archäologischer Rundgang (Lübeck 2003) 86–87 .
stEppuhn 2003cP . Steppuhn, Katalog . In: E . Ring (Hrsg .), Glaskultur in Niedersachsen . Tafelgeschirr und Haushaltsglas vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit . Archäolo-gie und Bauforschung in Lüneburg 5 (Husum 2003) 47–187 .
stEppuhn 2004P . Steppuhn, Ein Scherzglas des 14 . Jahrhunderts aus Lübeck . In: M . Grabowski, D . Mührenberg, I . Scha-lies, P . Steppuhn (Hrsg .), Curiosa Archaeologica . Ungewöhnliche Einblicke in die Archäologie . Eine Festschrift für Alfred Falk . Jahresschrift 5 der Ar-chäologischen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck 2002/2003 (Lübeck 2004) 78–80 .
stEppuhn 2014P . Steppuhn, Emailbemalte Gläser des 13 ./14 . Jahr-hunderts aus der Altstadt von Lübeck . In: A . Falk, U . Müller, M . Schneider (Hrsg .), Lübeck und der Hanseraum – Beiträge zu Archäologie und Kultur-geschichte . Festschrift für Manfred Gläser (Lübeck 2014) 193–206 .
stEppuhn (im Druck)P . Steppuhn, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Glasfunde aus der Altstadt von Lübeck (Manu-
396 Steppuhn, Individualität in Mittelalter und Neuzeit: Glasgefäße mit nachträglich angebrachtem Golddekor
skriptabgabe März 1999) . In Vorbereitung für die Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturge-schichte .
stEppuhn/rAdis 2000P . Steppuhn, U . Radis, Sakrale Glaspracht – profane Nutzung . Archäologie in Deutschland 2000, Heft 3, 47–48 .
tAit 1982H . Tait, Venezianisches Glas (Dortmund 1982) .
thEuErkAuFF-liEdErWAld 1994A .-E . Theuerkauff-Liederwald, Venezianisches Glas der Veste Coburg (Lingen 1994) .
von sAldErn 1995A . von Saldern, Glas . Antike bis Jugendstil . Die Sammlung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (Hamburg 1995) .
vrEEkEn 1994H . Vreeken, Kunstnijverheid Middeleeuwen en Re-naissance . Museum Boymans-van Beuningen (Rot-terdam 1994) .
WoltErs 1976W . Wolters, La scultura veneziana gotica (1300–1460), Band 1–2 (Venezia 1976) .
zEcchin 1987L . Zecchin, Vetro e vetrai di Murano . Studi sulla storia del vetro 1 (Venezia 1987) .
zEcchin 1990L . Zecchin, Vetro e vetrai di Murano . Studi sulla storia del vetro 3 (Venezia 1990) .
AbbildungsnachweisAbb . 1, 5–6: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäolo-
gie und Denkmalpflege . Abb . 2–4: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie und Denkmalpflege, Zeichnung: B . Scheele .
Anschrift des VerfassersDr . Peter SteppuhnHauptstraße 10D-23972 Rambowp .steppuhn@gmx .de
www.beier-beran.de Archäologische Fachliteratur Reihe "Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas"
Bd. 1: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee
und Thüringer Wald. Von H.-J. Beier. 1991– vergriffen -
Bd. 2: Untersuchungen zur Stellung der Salzmünder Kultur im Jungneolithikum des Saalegebietes. Von J. Beran. 1993, 22,50 EUR
Bd. 3: Macht der Vergangenheit - Wer macht Vergangenheit. Archäologie und Politik. Hrsg. von S. Wolfram et al. 1993- vergriffen-
Bd. 4: Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet und in der Altmark. Eine Übersicht und ein Abriss zum Stand der Forschung. Hrsg. von
H.-J. Beier und R. Einicke. Nachauflage lieferbar, 33,00 EUR
Bd. 5: The Swidrian Reindeer-Hunters of Eastern Europe. Von L.L: Zaliznyak. 1995, Preis: 22,00 EUR, ISBN 3-930036-06-1
Bd. 6: Der "Rössener Horizont" in Mitteleuropa. Hrsg. von H.-J. Beier.1994 - vergriffen
Bd. 7: Selecta Preahistorica. Festschrift für Joachim Preuß. Hrsg. von H.-J. Beier und J. Beran. 1995, Preis: 18,50 EUR, ISBN 3-930036-09-6
Bd. 8: Studien zur reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Von Bodo Anke. Bd. 8/1: Text. Bd. 8/2: Katalog und Tafeln. 1998
Bd. 9: Terra & Praehistoria. Festschrift für K.-D. Jäger. Hrsg v. S. Ostritz u. R. Einicke. 1996, Preis: 24,50 EUR, ISBN 3-930036-12-6
Bd.10: Studien zum Siedlungswesen im Jungneolithikum. Beiträge der Sitzung der AG Neolithikum, gehalten in Kempten/Allgäu 1995.
Hrsg. v. H.-J. Beier. 1996, 154 S., zahlr. Karten u. Abbildungen, Preis: 23,25 EUR, ISBN 3-930036-15-0
Bd.11: Die Bronze- und die vorrömische Eisenzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Eine Übersicht und ein Abriss zum Stand der Forschung.
Hrsg. von A. Neubert, T. Schuncke und H.-J. Beier. – in Vorbereitung
Bd.12: Hornsteinnutzung und -handel im Neolithikum Südostbayerns. Von Angelika Grillo. 1997, Preis: 19,50 EUR, ISBN 3-930036-17-7
Bd.13: Eine Holzstraße aus der Zeit um 1265 und weitere mittelalterliche Befunde vom Grundstück Schuhagen 1 in Greifswald. Von Cathrin
Schäfer. 1997, 144 S., 23 Tabellen, 24 Pläne, 42 Abbildungstafeln, Preis: 21,00 EUR, ISBN 3-930036-18-5
Bd.14: Frühgeschichte der Landwirtschaft in Deutschland. Hrsg. von N. Benecke, P. Donat, E. Gringmuth-Dallmer, U. Willerding. 2003, 372
S., 125 Karten u. Abbildungen, 6 Farbtafeln, Preis: 50,00 EUR, ISBN 3-930036-21-5
Bd.15: Urgeschichtlicher Silexbergbau in Europa. Eine kritische Analyse zum gegenwärtigen Forschungsstand. Von S. Gayck. 2000
Bd.16/1: Aus Bronzezeit und Mittelalter Sachsens. (Ausgewählte Arbeiten von G. Billig von 1956 - 1990). Hrsg. St. Herzog, et al.
Bronzezeit. 2000, 159 S., zahlr. Karten, Pläne u. Abbildungen, Preis: 27,00 EUR, ISBN 3-930036-23-1
Bd.16/2: Aus Bronzezeit und Mittelalter Sachsens. (Ausgewählte Arbeiten von G. Billig von 1956 - 1990). Hrsg. St. Herzog, et. al.
Mittelalter. 2011, ca. 230 S. zahlr. Karten, Pläne u. Abbildungen, Preis: 37,00 EUR, ISBN 978-3-941171-59-6
Bd.17: Die linien- und stichbandkeramische Siedlung in Dresden-Cotta. Eine frühneolithische Siedlung im Dresdener Elbkessel. Von A.
Pratsch - Teil 1: Text, Tafeln und Pläne. Teil 2: Katalog (12,50 EUR) 1999, 170 S.,56 Tafeln, Preis 25,50 EUR, ISBN 3-930036-26-6
Bd.18: Die Schlacht im Teutoburger Wald. Von Bruno Krüger. 1999 – vergriffen -
Bd.19: Siedlungs- und Grabfunde der älteren Eisenzeit aus Rheinhessen und dem Gebiet der unteren Nahe. Von H. Koepke.
Bd.19,1: Text und Katalog. Bd.19,2: Tafeln 1998, 224 S., 5 Karten, 272 Tafeln, Preis: 44,44 EUR, ISBN 3-930036-29-0
Bd.20: Den Bogen spannen ... Festschrift für Bernhard Gramsch. Hrsg. v. E. Cziesla, et al. 56 Beiträge zur Forschung. 2 Bände. 1999,
Bd.21: Studien zur Megalithik. Forschungsstand und ethnoarchäologische Perspektiven. Hrsg. v. K. W. Beinhauer et al.
1999, ca. 532 S., zahlr. Karten, Pläne u. Abbildungen, Preis: 69,50 EUR, ISBN 3-930036-36-3
Bd.22: Varia neolitihica I. Hrsg. v. H.-J. Beier. Zahlreiche Beiträge zur Forschung. 2000, 203 S., Preis: 30,00 EUR, ISBN 3-930036-38-X
Bd.23: Die jungpleistozäne und holozäne Tierwelt Mecklenburg-Vorpommerns - Faunenhistorische und kulturgeschichtliche Befunde. Von
Norbert Benecke. 2000, 155 S., zahlr. Karten, Abbildungen u. Tabellen, Preis: 23,50 EUR, ISBN 3-930036-39-8
Bd.24: Besiedlungsgeschichte des frühen Mittelalters im nördlichen Bayerisch-Schwaben. Von Thomas Kersting. 2000, Preis: 39,50 EUR
Bd.25: Untersuchungen zur Siedlungsplatzwahl im mitteldeutschen Neolithikum. Von Sven Ostritz. 2000, 46,00 EUR, ISBN 3-930036-41-X
Bd.26: Der Pennigsberg bei Mittenwalde - Ein frühmittelalterlicher Burgwall auf dem Teltow. Hrsg. v. Felix Biermann. 2001, 42,00 EUR
Bd.27: Goethe, der Thüringisch-Sächsische Verein und die Entwicklung der Altertumskunde in den Jahrzehnten nach 1800. Von Sylke
Kaufmann und Dieter Kaufmann. 2001, ca. 400 S., zahlr. Abbildungen, Register, Preis: 44,50 EUR, ISBN 3-930036-51-7
Bd.28: Bunte Pracht - die Perlen der frühmittelalterlichen Gräberfelder von Liebenau, Kreis Nienburg / Weser und Dörverden, Kr. Verden /
Aller. Von Maren Siegmann.
2002, Teil 1: 183 S. Textteil, 54 Abb., 4 Farbtafeln, Preis: 30,60 EUR, ISBN 3-930036-57-6
2003, Teil 2: 224 S. Textteil, 13 Farbtafeln, 4 Beilagen, 1 CD-Beilage, Preis: 40,00 EUR, ISBN 3-930036-84-3
2004, Teil 3: 211 S. Textteil, 127 Abbildungen, Farbtafeln, Preis: 28,00 EUR, ISBN 3-937517-01-4
2005, Teil 4: 286 S. Textteil, zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Farbtafeln, Preis. 35,00 EUR, ISBN 3-937517-35-9
2006, Teil 5: 232 S. Textteil, zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Farbtafeln, Preis: 28,00 EUR, ISBN 3-937517-25-1
Bd.29: Die Germanen - Mythos, Geschichte, Kultur, Archäologie. Von Bruno Krüger. 2003, 239 S., Preis: 33,50 EUR, ISBN 3-930036-54-1
Bd.30: Berge und Boote. Ausgewählte Arbeiten. Von Dietrich Evers. 2001, 236 S..Preis: 19,50 EUR, ISBN 3-930036-55-X
Bd.31: Zähne, Menschen und Kulturen. Von Rolf Will. 2001, 275 S., über 500 Abb. in Farbe, Preis: 74,00 EUR, ISBN 3-930036-56-8
Bd.32: Varia neolithica II. Beiträge der Sitzung der AG Neolithikum in Trier 2001. Hrsg. von H.-J. Beier. 2002, 32,00 EUR, ISBN 3-930036-66-5
Bd.33: Untersuchungen zu den Wendelringen der älteren vorrömischen Eisenzeit unter besonderer Berücksichtigung der Thüringischen
Kultur. Von Sven Ostritz. 2002, 84. S., 16 Karten, CD- u. 1 Textbeilage, Preis: 24,00 EUR, ISBN 3-930036-68-1
Bd.34: Dino, Zeus und Asterix. Zeitzeuge Archäologie in Werbung und Alltag. Bearbeitet von Inken Jensen. 2003, 49,00 EUR
Bd.35: Bilzingsleben VI. Hrsg. von Dietrich Mania im Auftrage des Fördervereines Bilzingsleben - World Culture Monument e.V.
2003, 392 S., zahlreiche Abbildungen u. Pläne, Preis: 64,00 EUR, ISBN 3-930036-69-X
Bd.36: Das Megalithsyndrom. Ein Phänomen des Neolithikums. Von Jürgen E. Walkowitz. 2004, Preis: 39,00 EUR, ISBN 3-930036-70-3
Bd.37: Varia neolithica III. Beiträge der Sitzung der AG Neolithikum. Hrsg. von H.-J. Beier und R. Einicke
2004, 334 S., zahlreiche Abbildungen und Tafeln, 1 Beilage, Preis: 39,00 EUR, ISBN 3-937517-03-0
Bd.38: Studien zur Geschichte und Kultur der Germanen. Von Günter Behm(Blancke). 2004, 136 S., 67 Tafeln, ISBN 3-937517-09-X
Bd. 39: Metrologische Strukturen der Kultur mit Schnurkeramik und ihre Bedeutung für die Entwicklung des mitteleuropäischen Raumes.
Von Aleksander Dzbynski, 2004, 50 S., 21 Abbildungen, 4 Tafeln, Preis: 24,00 EUR, ISBN 3-939936-96-7
Bd. 40: Bilzingsleben V / Homo erectus – seine Kultur und Umwelt / Zum Lebensbild des Urmenschen. Von Dietrich Mania, Ursula Mania,
Wolf-Dieter Heinrich et al. 2004, 295 S., zahlr. Abb., 23 Tafeln, Preis: 39,00 EUR, ISBN 3-930036-99-1
Bd. 41: Die schwedische Matrikelkarte von Vorpommern und ihre Bedeutung für die Erforschung der Bodendenkmäler. Von Michaela
Riebau 2005, 211 S., 16 Farbtafeln, 9 Farbkarten, Preis: 33,50 EUR, ISBN 3-937517-19-7
Bd. 42: Keller in Mittelalter und Neuzeit. Bericht über die Tagung „Kellerkataster“ Stralsund 2005. Hrsg. von Stefanie Brüggemann. 2006, 15
Beiträge, 196 S., zahlreiche Abbildungen, Preis. 34,50 EUR, ISBN 3-937517-31-6
Bd. 43: Varia neolithica IV. Beiträge der Sitzung der AG Neolithikum. Hrsg. von H.-J. Beier.
2006, 11 Beiträge, 174 S., zahlreiche SW- und Farbabbildungen, Preis: 34,00 EUR, ISBN 3-937517-43-X
Bd. 44: Mittelalterliche Landeserschließungen und Siedlungsprozesse und Siedlungsprozesse in der unteren Wartheregion . Von Armin
Volkmann. 2006, 149 S., zahlr. SW- und Farbab., 16 Tafeln, CD-Beilage, Preis: 39,50 EUR, ISBN 3-937517-47-2
Bd. 45: Reiter, Reiterkrieger und Reiternomaden zwischen Rheinland und Korea: Zur spätantiken Reitkultur zwischen Ost und West, 4.-8.
Jahrhundert n. Chr. Von Ulf Jäger. 2006, 188 S., 70 SW Tafeln, Preis: 39,50 EUR, ISBN 978-3-937517-55-1
Bd. 46: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Hrsg. F. Biermann &Th. Kersting.
2007, 408 S., 34 Einzelbeiträge, zahlr. SW Abb., Pläne und Karten, Preis: 49,00 EUR, ISBN 978-3-937517-65-0
Bd. 47: Die unteren Zehntausend – auf der Suche nach den Unterschichten der Eisenzeit. Hrsg. P. Trebsche et al.
2007, 176 S., 16 Einzelbeiträge, zahlr. SW Abb., Pläne und Karten, Preis: 32,00 EUR, ISBN 978-3-937517-74-2
Bd. 48: Terra Praehistorica. Festschrift für K.-D. Jäger zum 70. Geburtstag. Hrsg. Archäologische Gesellschaft in Thüringen e. V. 2007, 552
S., 44 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 37,00 EUR, ISBN 978-3-937517-97-7
Bd. 49: Ritus und Religion in der Eisenzeit. Hrsg. Chr. Eggl. et al.
2008, 159, S. 17 Einzelbeiträge, zahlreiche Illustrationen in SW, Preis: 32,00 EUR, ISBN 978-3-941171-00-8
Bd. 50: Hunnen zwischen Asien und Europa. Hrsg. Historisches Museum der Pfalz Speyer.
2008, 194 S., 14 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 36,00 EUR, ISBN 978-3-937517-91-9
Bd. 51: Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze- zur Eisenzeit. Hrsg. F. Falkenstein et al.
2009, 114 S., 12 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 27,50 EUR , ISBN 978-3-941171-07-7
Bd. 52: Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Hrsg. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt
2009, 403 S., 28 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 55,00 EUR, ISBN 978-3-941171-12-1
Bd. 53: Varian neolithica V: Mobilität, Migration und Kommunikation in Europa während des Neolithikums und der Bronzezeit Hrsg. A.
Krenn-Leeb et al. 2009, 226 S. 22 Beiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 35,00 EUR, ISBN 978-3-941171-27-05
Bd. 54: Corona Funebris – Neuzeitliche Totenkronen. Von Juliane Lippok
2009, 131 S. komplett farbig, Katalog als CD-Beilage, Preis: 29,50 EUR, ISBN 978-3-941171-09-1
Bd. 55: Architektur: Interpretation und Rekonstruktion. Hrsg. Peter Trebsche, Ines Balzer et al.
2009, 280 S., 22 Einzelbeiträge, zahlr. Abb. SW, teilweise in Farbe, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-19-0
Bd. 56: Varia Neolithica VI: Neolithische Monumente und neolithische Gesellschaften. Hrsg. H.-J. Beier et al.
2009, 159 S. , 16 Einzelbeiträge, komplett farbig, Preis: 35,00 EUR, ISBN 978-3-941171-28-2
Bd. 57: Das Gräberfeld von Klein Lieskow (= Studien zur Lausitzer Kultur Bd. I). Von D.-W. R. Buck & D. Buck. 2 Bände
2010, ca. 600 S., davon 330 Tafeln, Text in Farbe, Preis: 79,00 EUR, ISBN 978-3-941171-37-4
Bd. 58: Macht und Ohnmacht des positivistischen Denkens. Von Raimund Karl. 2010, 174 S., Preis: 32,00 EUR, ISBN 978-3-941171-40-4
Bd. 59: 100 Jahre Die Vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens. Hrsg.: Archäologische Gesellschaft in Thüringen e.V.
2010, 174 S., komplett farbig, Preis: 20,00 EUR, ISBN: 978-3-937517-83-4
Bd. 60: Der Wandel um 1000. Hrsg. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt
2011, 496 S., 42 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 59,00 EUR, ISBN 978-3-941171-45-9
Bd. 61: Das Gräberfeld von Klein Lieskow / Qu. 136–254 (= Studien zur Lausitzer Kultur Bd. II). Von D.-W. R. Buck & D. Buck
2011, 342 S., Katalog und 234 Tafeln, Gräberfeldplan, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-52-7
Bd. 62: Studien zu Chronologie und Besiedlung der Lausitzer Kultur in Sachsen auf Grundlage des Gräberfeldes von Lieber-
see (= Studien zur Lausitzer Kultur Bd. III). Von Esther Wesely-Arents
2011, 233 S., SW und farbig illustriert, 4 Beilagen, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-51-0
Bd. 63: Varia Neolithica VII: „Dechsel, Axt, Beil & Co. … . Hrsg. H.-J. Beier, E. Biermann & R. Einicke
2011, 228 S., 15 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, 1 Beilage, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-54-1
Bd. 64: Transformationen und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts. Hrsg. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt, T. Westphalen
2012, 367 S., 32 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 49,00 EUR, ISBN 978-3-941171-56-5
Bd. 65: Technologieentwicklung und –transfer in der Eisenzeit. Hrsg. A. Kern et al.
2012, 306 S., 29 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert; Preis: 45,00 EUR, ISBN 978-3-941171-68-8
Bd. 66: Finden und Verstehen. Festschrift für Thomas Weber. Hrsg. V. Schimpff et al.
2012, 434 S., 29 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert; Preis: 49,00 EUR, ISBN 978-3-941171-67-1
Bd. 67: Paläoumwelt und Genese der mittelpleistozänen Fundstelle Bilzingsleben – Die Mollusken – Von Dirk Vökler.
2012, 106 S., SW und farbig illustriert; Preis: 29,00 EUR, ISBN 978-3-941171-46-6
Bd. 68: Das Gräberfeld der Lausitzer Kultur von Lübbinchen, Kreis Spree-Neiße. Von Benjamin Wehry
2012, 206 S., 25 Abb. SW, 25 Tafeln, 10, Klappkarten, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-72-5
Bd. 69: Wege und Transport. Hrsg. Claudia Tappert et al. 2012, 19 Einzelbeiträge, 252 S., Preis: 42,50 EUR, ISBN 978-3-941171-47-3
Bd. 70: Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum. Hrsg. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt.
2013, 512 S., 33 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 55,00 EUR, ISBN 978-3-941171-85-5
Bd. 71: Die Keramik der Lausitzer Gruppe I. Das Gräberfeld Klein Lieskow III,1 und 2 (= Studien zur Lausitzer Kultur Bd. V). Von D.-W. R.
Buck & D. Buck, 2 Bd. 2013, 560 S., Text, Katalog und 278 Tafeln, 3 Planbeilagen, Preis: 79,00 EUR, ISBN 978-3-941171-86-2
Bd. 72: Bilder – Räume – Rollen. Hrsg. St. Wefers et al. 2013, 164 S. 13 Einzelbeiträge, Preis: 37,00 EUR, ISBN 978-3-941171-87-9
Bd. 73: „Das Gericht“ in Alkersleben – arch. und hist. Nachweis einer mittelalterlichen Richtstätte in Thüringen. Von Marita Genesis
2014, 209 Seiten, 60 Tafeln, Faltpläne und CD, SW und farbig illustriert, Preis: 42,50 EUR, ISBN 978-3-941171-92-3
Bd. 74: From Copper to Bronze (Festschrift V. Moucha). Hrsg. M. Bartelheim, J. Peška & J. Tuurek
2013, 190 S., 16 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-941171-94-7
Bd. 75: Varia Neolithica VIII: „Material – Werkzeug: … . Hrsg. H.-J. Beier, E. Biermann & R. Einicke
2014, 178 S., 15 Einzelbeiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 39,00 EUR, ISBN 978-3-95741-016-0
Bd.76: Altes und Neues – Vom Museum in den Landtag. Festschrift für Volker Schimpff. Hrsg. H.-J. Beier & Th. Weber
2014, 438 S., 41 Beiträge, SW und farbig illustriert, Preis: 55,00 EUR, ISBN 978-3-95741-017-7
Bestellung bitte an: Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur
08134 Langenweißbach, Thomas-Müntzer-Straße 103
Email: [email protected] oder unter www.archaeologie-und-buecher.de