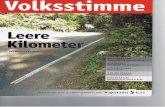Von der Sprache der Götter und Geister: bedeutungsgeschichtliche ...
Holger Baitinger, Der Glauberg – eine Grabung zwischen den Fronten. In: E. Schallmayer (Hrsg.),...
Transcript of Holger Baitinger, Der Glauberg – eine Grabung zwischen den Fronten. In: E. Schallmayer (Hrsg.),...
Fundberichte aus hessen
beiheFt 7 • 2011
GlauberG-ForschunGen
Landesamt für Denkmalpflege Hessen
hessenArchäologie
Keltenwelt am Glauberg
band 1
Wiesbaden 2011
Selbstverlag des landesamtes für Denkmalpflege hessenin Kommission bei Dr. rudolf habelt gmbh, Bonn
archäoloGie und Politik
Internationale Tagung anlässlich„75 Jahre Ausgrabungen am Glauberg“
vom 16. bis 17. Oktober 2008in Nidda-Bad Salzhausen
Archäologische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts
im zeitgeschichtlichen Kontext
herausgegeben von egon Schallmayer,in Zusammenarbeit mit Katharina von Kurzynski
Der Glauberg – eine Grabung zwischen den Fronten
Von Holger Baitinger
Der 13. Oktober 1934 war ein stolzer Tag für das kleine oberhessische Dorf Glauberg am Ost-rand der Wetterau. Der ganze Ort war auf den Beinen und feierte, denn es hatte sich hoher Besuch angesagt. In Anwesenheit der Politprominenz weihte man am Fuß der befestigten Höhensied- lung auf dem Glauberg zwei neu errichtete Grabungshäuser ein (Abb. 1). Das größere davon – das sogenannte Jakob Sprenger-Haus – diente als Unterkunft für die Männer des Freiwilligen Arbeits-dienstes (FAD), die als Helfer bei den Ausgrabungen tätig waren; das kleinere beherbergte Ar-beits- und Magazinräume und sollte später zu einem Museum ausgebaut werden. Damit besaß die Glauberggrabung, die Heinrich Richter mit bescheidenen finanziellen Mitteln im Sommer 1933 aufgenommen hatte, eine hervorragende Infrastruktur, die als Basis für eine längerfristige archäo-logische Unternehmung dienen konnte.
Die Eröffnungsrede an diesem Festtag hielt der Ehrengast und Mäzen der Grabung, der NS-Gauleiter Jakob Sprenger, den Hitler am 5. Mai 1933 zum Reichsstatthalter in Hessen ernannt hatte1. Obgleich an kulturellen Fragen wenig interessiert, hatte Sprenger im Dezember 1933 die Gründung einer „Reichsstatthalter Jakob Sprenger-Stiftung“ bekannt gegeben, für die er den stol-
1 St. Zibell, Jakob Sprenger (1884 –1945). NS-Gauleiter und Reichsstatthalter in Hessen. Quellen u. Forsch. Hess. Gesch. 121 (Darmstadt, Marburg 1999).
Archäologie und PolitikArchäologische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im zeitgeschichtlichen Kontext
Fundberichte aus HessenBeiheft 7 =
Glauberg-Forschungen 1(Wiesbaden 2011)
57
Seite 57 – 74
Abb. 1. Einweihung des Jakob Sprenger-Hauses am 13.10.1934. Links (mit Brille) Hein-rich Richter, in Bildmitte (mit Uniform) Oberstfeldmeister Sander, der Führer des Arbeitsdienstes Gruppe 225 Schlüchtern, und rechts (mit Anzug und Hut) Gau-leiter Jakob Sprenger. Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 57 29.03.2011 18:55:02 Uhr
58
zen Betrag von 20.000,- RM zur Verfügung stellte2. Aus welchen Quellen dieses Geld stammte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, aber wohl kaum aus dem Privatvermögen des ehemaligen Postbeamten Sprenger.
Der Zweck der Stiftung war in § 2 der Satzung wie folgt beschrieben: „Die Stiftung dient der Förderung (Feststellung) vorgeschichtlicher Feststellungen durch Ausgrabungen am Glauberg bei Büdingen und aller damit in Zusammenhang stehenden und notwendig werdenden Aufgaben, ins-besondere auch der Pflege und der Erhaltung der gewonnenen Ergebnisse“3. Dieser Satz könnte ganz ähnlich noch heute in der Satzung des Fördervereins einer archäologischen Ausgrabung ste-hen, und er macht deutlich, dass sich Sprenger auf ein längerfristiges Engagement am Glauberg eingestellt hatte. Zum ehrenamtlichen Vorsitzenden der Sprenger-Stiftung wurde mit dem stellver-tretenden Gauleiter Heinrich Reiner ein enger Vertrauter Sprengers ernannt, und auch im Beirat saß geballte hessische NSDAP-Prominenz4:
1) Staatsminister Philipp Wilhelm Jung, der Leiter der hessischen Landesregierung.2) Verwaltungsdirektor Otto Löwer, der Leiter des hessischen Personalamtes.3) Ministerialrat Friedrich Ringshausen, der Leiter der Ministerialabteilung für Bildungswesen,
Kultus, Kunst und Volkstum im Hessischen Staatsministerium.4) Bürgermeister Alfred Klostermann aus Schlitz.
Die hochkarätige Besetzung des Beirats zeigt, welche politische Dimension den Ausgrabungen auf dem Glauberg beigemessen wurde. Wie war es dazu gekommen?
Der Plan, auf dem Glauberg großflächige Ausgrabungen durchzuführen, reicht weit in die 1920er Jahre zurück5. Damals versuchten der Büdinger Geschichtsverein und sein Vorstandsmit-glied, der pensionierte Frankfurter Museumskustos Rudolph Welcker, auf dem Berg aktiv zu wer-den, zunächst allerdings ohne Erfolg. Welcker war es aber zu verdanken, dass am 7. Oktober 1932
2 Hess. Regierungsbl. 1934, 2 (Bekanntmachung vom 29.12.1933).3 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 11 Nr. 63/21.4 Ebd.5 Eine ausführliche Darstellung der Grabungsgeschichte am Glauberg findet sich bei H. Baitinger, Der Glauberg
– ein Fürstensitz der Späthallstatt-/Frühlatènezeit in Hessen. Mat. Vor- u. Frühgesch. Hessen 26 = Glauberg-Stud. 1 (Wiesbaden 2010) 3 ff.
Abb. 2. Heinrich Richter (1895–1970), der Leiter der Ausgrabungen auf dem Glauberg, zwischen zwei Arbeitsdienstmännern (1935). Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 58 29.03.2011 18:55:03 Uhr
59
ein Ortstermin am Glauberg anberaumt wurde6. Bei diesem Treffen sollte die Frage diskutiert wer-den, ob man eine Ausgrabung mit Unterstützung durch den Freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) initiieren könnte. Dieser Arbeitsdienst war im Jahr zuvor ins Leben gerufen worden und sollte Arbeitslose bei gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen7. Eingeladen hatte zu diesem Treffen der Gießener Privatdozent für Geologie Heinrich Richter8 (Abb. 2), der knapp ein Jahr zuvor zum ehrenamtlichen Denkmalpfleger für die Provinz Oberhessen bestellt worden war9. Richter zeigte sich über diesen Vorstoß wenig begeistert, weil er dem greisen Welcker und seinen Büdinger Mit-streitern die nötige Grabungskompetenz absprach. Allerdings trat in diesem kritischen Moment mit Gerhard Bersu (Abb. 3) eine entschlossene und durchsetzungsstarke Persönlichkeit auf den Plan, die das Heft des Handelns ergriff. Bersu war 1931 – nach dem tragischen Freitod Fried-rich Drexels – zum Ersten Direktor der Römisch-Germanischen Kommission (RGK) in Frankfurt a. M. ernannt worden und galt mit Recht als einer der besten Ausgräber seiner Zeit10. Die großflä-chigen Untersuchungen auf dem Goldberg im Nördlinger Ries hatten ihn zu einem Pionier sys-tematischer Siedlungsforschung werden lassen11. Mit Richter stand Bersu seit den 1920er Jahren
6 Brief von H. Richter an die Römisch-Germanische Kommission (RGK) vom 4.10.1932 (Archiv RGK 1053, Schriftwechsel Richter).
7 P. Dudek, Erziehung durch Arbeit. Arbeitslagerbewegung und freiwilliger Arbeitsdienst 1920–1935 (Opladen 1988).
8 W. Jorns, Fundber. Hessen 9/10, 1969/70, 1–3 (mit Schriftenverzeichnis); H. Baitinger, 75 Jahre archäologische Ausgrabungen auf dem Glauberg – Die Untersuchungen von Heinrich Richter 1933–1939. Denkmalpflege u. Kulturgesch. 2008, H. 3, 10–15.
9 P. Helmke, Mitt. Oberhess. Geschver. N. F. 30, 1932, 215.10 W. Krämer, Gerhard Bersu – ein deutscher Prähistoriker (1889 –1964). Ber. RGK 82, 2001, 5 –101.11 H. Parzinger, Der Goldberg. Die metallzeitliche Besiedlung. Röm.-Germ. Forsch. 57 (Mainz 1998) 6 ff. bes.
9 ff.
Abb. 3. Gerhard Bersu (1889 –1964) mit seiner Frau (1937). Foto nach Ber. RGK 82, 2001, 64 Abb. 9.
03_DFG_Baitinger.indd 59 29.03.2011 18:55:04 Uhr
60
in Kontakt12, und Bersu hatte auch maßgeblich an der Ernennung Richters zum oberhessischen Denkmalpfleger mitgewirkt. Auch wenn sich dies nicht anhand schriftlicher Unterlagen belegen lässt: Die beiden Männer müssen im Herbst 1932 die Vereinbarung getroffen haben, dass anstelle des Büdinger Geschichtsvereins Richter selbst einen Antrag stellen sollte, um mithilfe des Freiwil-ligen Arbeitsdienstes auf dem Glauberg auszugraben. Schon Ende November 1932 reichte Richter ein solches Gesuch bei den zuständigen Behörden in Gießen ein. Und Bersu war es auch, der seine guten Beziehungen nach Berlin spielen ließ, nachdem der Antrag im Januar 1933 abgelehnt worden war und das ganze Unternehmen kläglich zu scheitern drohte. Nur dank Bersus Beharrlichkeit ge-lang es, im zweiten Anlauf doch noch eine Zusage des Landesarbeitsamtes Hessen zu erwirken, so dass der Arbeitsdienst ab Sommer 1933 auf dem Glauberg eingesetzt werden konnte.
Richter hatte bis dato lediglich in der paläolithischen Station von Treis an der Lumda13 Gra-bungserfahrung sammeln können und noch kein Unternehmen dieser Dimension geleitet. Er muss von Bersu das Versprechen bekommen haben, ihm bei der praktischen Durchführung der Aus-grabungen unter die Arme zu greifen. Tatsächlich besuchte Bersu den Glauberg in den beiden fol-genden Jahren sehr häufig, zuletzt noch im August 1935, als seine politisch motivierte Versetzung nach Berlin bereits offiziell beschlossen war. Bekanntlich war Bersu wegen seiner jüdischen Vor-fahren nach Hitlers Machtergreifung sehr rasch in die Schusslinie des Amtes Rosenberg geraten, was zu seiner Versetzung nach Berlin und schließlich zu seiner Zwangspensionierung im Jahre 1937 führte14. Bis zum Hochsommer 1935 aber bestimmte Bersu die Grabungsstrategie am Glau-berg maßgeblich mit.
Richter überzog das Plateau zunächst mit schmalen Längs- und Querschnitten, die auch durch den Ringwall an den Plateaukanten getrieben wurden. An den Stellen, an denen man Befunde an-traf, erweiterte man die Schnitte zu Grabungsflächen. Der rekonstruierte, durch Kriegsverluste bei der Dokumentation allerdings unvollständige Flächen- und Schnittplan des Glaubergs (Abb. 4) erinnert stark an denjenigen des Wittnauer Horns im Kanton Aargau15. Dort hat Bersu in den Jah-ren 1934 und 1935 eine mehrperiodige Höhensiedlung untersucht, also gleichzeitig mit den Unter-suchungen Richters und ebenfalls mithilfe des Freiwilligen Arbeitsdienstes. Dies war – nebenbei bemerkt – die erste wissenschaftliche Ausgrabung in der Schweiz, bei welcher der Arbeitsdienst zum Einsatz kam16.. Bereits Cornelius Müller hat in einem ungedruckt gebliebenen Manuskript darauf hingewiesen, wie stark die Glauberggrabung von der Methodik Bersus beeinflusst war. Ei-nige Beispiele mögen dies demonstrieren: 1926 veröffentlichte Bersu einen Leitfaden zur Ausgra-bung vorgeschichtlicher Befestigungen und empfahl darin, einen Wallschnitt dann zu erweitern und nach Schichten abzuheben, wenn sich die Datierung der Mauerphasen anhand des Schnitts nicht hatte klären lassen17. Genau diese Strategie verfolgte Richter im Sommer 1935, als er den so genannten Südschnitt auf dem Glauberg um eine 4 m breite Fläche erweiterte und diese sorgfältig
12 Richter publizierte zwei Vorberichte über seine Untersuchungen in der paläolithischen Station von Treis a. d. Lumda in der Zeitschrift „Germania“, die von der RGK herausgegeben wird: H. Richter, Die paläolithische Station bei Treis a. d. Lumda. Germania 9, 1925, 67–71; ders., Paläolithische Ausgrabungen bei Treis a. d. Lumda i. J. 1925. Germania 10, 1926, 95 –100.
13 Ebd.; L. Fiedler, Die Quarzitabris von Treis an der Lumda. Arch. Denkmäler Hessen 124 (Wiesbaden 1985) (mit älterer Literatur).
14 R. Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herr- schaftssystem. Stud. Zeitgesch. 12 (München 2006) 154 ff. bes. 159 ff.; Krämer (Anm. 10) 39 ff.
15 G. Bersu, Das Wittnauer Horn im Kanton Aargau. Seine ur- und frühgeschichtlichen Befestigungsanlagen. Monogr. Ur- u. Frühgesch. Schweiz 4 (Basel 1945) bes. 8 f. Beil. 2– 4. – Die Voraussetzungen für eine Aus-grabung waren in beiden Fällen ähnlich, weil sowohl der Glauberg als auch das Wittnauer Horn zu Beginn der Untersuchungen dicht bewaldet waren.
16 Bersu (Anm. 15) 1.17 G. Bersu, Die Ausgrabung vorgeschichtlicher Befestigungen. Vorgesch. Jahrb. 2, 1926, 1–22 hier 5 f.
03_DFG_Baitinger.indd 60 29.03.2011 18:55:04 Uhr
61
Abb
. 4. G
esam
tpla
n de
s G
laub
ergp
late
aus
mit
den
Gra
bung
sber
eich
en d
er J
ahre
193
3 –1
939
(grü
n) u
nd 1
985
–199
8 (r
ot).
Ohn
e M
aßst
ab. G
rafi
k: H
.-J.
Köh
ler,
Wöl
fers
heim
.
03_DFG_Baitinger.indd 61 29.03.2011 18:55:16 Uhr
62
nach Schichten untersuchte (Abb. 5). Die Funde wurden sowohl auf dem Glauberg wie am Witt-nauer Horn auf Holzpflöcke eingemessen, die man in regelmäßigen Abständen entlang der Gra-bungsschnitte eingeschlagen und durchnummeriert hatte; die Breite der Schnitte betrug in beiden Fällen 1 m18. Dokumentiert wurden die Wallprofile auf Millimeterpapier im Maßstab 1:20, wie es Bersu 1926 postuliert hatte19. Methodisch und technisch war die Glauberggrabung also zweifel-los auf der Höhe ihrer Zeit – zumindest so lange, wie Bersu als Fachberater zur Verfügung stand. Eine politische Einflussnahme lässt sich weder für die Grabungsstrategie noch für deren Methodik konstatieren. Inwiefern sich dieses Bild zwischen 1936 und 1939 geändert hat, ist angesichts der schlechten Quellenlage zwar schwer zu beurteilen, aber es liegen keinerlei Indizien dafür vor.
Wie groß das Renommee der RGK und Bersus in Ausgrabungsfragen war, zeigt sich in einer fast schon skurrilen Begebenheit, die sich im August des Jahres 1935 zutrug. Zu jener Zeit kursier-ten in Fachkreisen „Zweifel an der richtigen Führung der Ausgrabung auf der Glauburg in Ober-hessen“20, die möglicherweise Hans Reinerth gestreut hatte, der Leiter des Reichsbundes für Deut-sche Vorgeschichte und erbitterte Gegner Bersus21. Von diesen Gerüchten aufgeschreckt, erbat der Förderer der Glauberggrabung, Reichsstatthalter Sprenger, am 21. August 1935 bei der RGK ein Gutachten, „aus dem insbesondere zu ersehen ist, ob die Ausgrabungsarbeiten bei Dr. Richter in guten Händen liegen, ob das zu erwartende Ergebnis den Aufwand an Zeit und Geld rechtfertigt, den er erfordert, und ob sie auch durch andere Stellen unterstützungswürdig erscheinen“22. Der glühende Nationalsozialist und alte Kämpfer Sprenger forderte also bei dem Mann ein Gutachten an, der sich seiner jüdischen Vorfahren wegen übelsten Angriffen aus dem Reinerth-Lager ausge-setzt sah, dessen Versetzungsurkunde zu diesem Zeitpunkt schon unterzeichnet war und der bald darauf völlig seiner beruflichen Existenz beraubt wurde!
Doch kehren wir zum Ausgangspunkt dieses Beitrags zurück, dem Tag der Einweihung des Jakob Sprenger-Hauses am 13. Oktober 1934. Was war der Grund dafür, dass sich Sprenger so tat-kräftig für die Glauberggrabung engagierte? Schon bald nach seiner Ernennung zum Reichsstatt-halter hatte er sich offenbar auf die Suche nach einem kulturpolitischen Vorzeigeprojekt gemacht. Im Oktober 1933 besuchte er das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz und mehrere Grabungsstätten in Südhessen23, und auch der erste Besuch am Glauberg fällt in den Herbst 193324. Den Glauberg muss Sprenger als besonders förderungswürdig erachtet haben, so dass es noch im Dezember dieses Jahres zur Gründung der Reichsstatthalter Jakob Sprenger-Stiftung kam25. Und Sprenger machte Nägel mit Köpfen. Im Jahre 1934 wurde der Arbeitsdienst auf Zugstärke auf-gestockt, der Glauberg neu vermessen und die Planung zum Ankauf des Geländes vorangetrie-ben, der am 1. April 1935 erfolgte26; seither befindet sich der Berg im Besitz des Landes Hessen. Sprengers Festrede vom Oktober 1934 lässt die Motivation für sein Engagement durchscheinen: Ihn habe „von Anfang an die Tatsache begeistert [...], dass man hier nicht nach glänzenden, in die Augen springenden Einzelstücken grabe, sondern sich zur Aufgabe gemacht habe, das Werden des Glauberges im Laufe der Jahrtausende und den Gang der Besiedlung unseres Heimatgebietes bis
18 Bersu (Anm. 15) 8.19 Bersu (Anm. 17) 6.20 Brief von Th. Wiegand an E. Wildhagen (DFG) vom 26.7.1935 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).21 Richter hatte im Februar 1935 einen Antrag auf längerfristige Förderung seiner Ausgrabungen durch die DFG
gestellt, der Reinerth zur Begutachtung vorlag. Mit Schreiben vom 19.7.1935 bat ihn H. Arntz (DFG) um die Rücksendung dieses Antrags (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248). Eine schriftliche Stellungnahme Reinerths liegt nicht vor.
22 Archiv RGK 1042, Akte Reichsstatthalter in Hessen.23 G. Behrens/E. Sprockhoff, Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 86; 94.24 Unterlagen E. Kauschat (Glauberg).25 Vgl. Anm. 2.26 G. Wiesenthal, Die alten Namen der Gemarkung Glauberg. Hess. Flurnamenbuch, Bd. 3, H. 12 (Gießen
1936) 54.
03_DFG_Baitinger.indd 62 29.03.2011 18:55:17 Uhr
63
Abb. 5. Im Jahre 1935 wurde der Südschnitt auf dem Glauberg um eine 4 m breite Fläche erweitert und nach Schichten abgehoben. Richter folgte damit methodischen Vorgaben, die Bersu 1926 aufgestellt hatte. Foto: Nachlass H. Richter, Heimat- und Geschichtsverein Glauburg.
Abb. 6. Männer des Freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD) in einem Suchgraben auf dem Glaubergplateau. Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 63 29.03.2011 18:55:19 Uhr
64
Abb. 7. Das im Januar 1935 erschienene Heft der „NS-Briefe“ war ganz dem Thema „Deutsche Vorgeschichte“ gewidmet. Darin findet sich auch ein Artikel von Richter über den Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 64 29.03.2011 18:55:20 Uhr
65
in die graue Vorzeit zurück aufzuzeichnen, um so dem Volk vor Augen zu führen, dass und wie sehr wir bodenständig sind. Von diesem Augenblick an habe er sich mit allen Mitteln für die För-derung dieses Werkes eingesetzt“27. Außerdem betonte der Gauleiter den Wert des Arbeitsdienstes (Abb. 6), der auf der Grabung eingesetzt wurde, „Männer, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind und sich der Bedeutung der Arbeit für unser Volk bewusst sind“ 28. Das Jakob Sprenger-Haus sollte nach dem Abschluss der Grabungen der „deutschen Jugend“ zur Verfügung stehen, „damit sie aus der Vergangenheit den Glauben an die Zukunft unseres Volkes schöpfe“29. Es ist also zum einen die Verwurzelung der Menschen in der Heimaterde, die gerade an einem Platz mit einer solch langen Besiedlungsgeschichte wie dem Glauberg exemplarisch aufgezeigt werden sollte30, und es ist der volkserzieherisch-nationale Charakter des Arbeitsdienstes, der das Bewusstsein für die Ur-sprünge des deutschen Volkes stärken sollte31. Ein im September 1935 erschienener Zeitungsartikel über die Glauberggrabung endet denn auch mit dem folgenden Satz: „Wir haben es nicht mehr nötig, als Deutsche ehrfurchterschauernd auf Trojas Trümmer oder die Pyramiden Aegyptens zu schauen, im eigenen Vaterlande sprechen unwiderlegbare Jahrtausende zu uns und – für uns“32.
Die Bedeutung des erzieherischen Charakters der Grabung für die Arbeitsdienstleute im Sinne der NS-Ideologie und die wachsende Politisierung des Unternehmens lassen sich auch anhand der Vorberichte Richters aus den 1930er Jahren nachvollziehen. Eine abschließende Publikation der Grabungsergebnisse ist bekanntlich niemals erschienen, auch weil das gesamte Fundmaterial und Teile der Dokumentation bei Kampfhandlungen kurz vor Kriegsende im Jakob Sprenger-Haus vernichtet wurden33. Der erste Artikel Richters wurde bereits im Oktober 1933 in den Heimat-blättern für den Kreis Büdingen veröffentlicht34, also knapp vier Monate nach Beginn der Aus-grabungen und noch vor der Gründung der Sprenger-Stiftung. Er zeigt im Gegensatz zu allen späteren noch keine politische Färbung, und auch die Anwesenheit des Arbeitsdienstes wird nur lakonisch erwähnt. Beispielsweise spricht Richter – durchaus in der Terminologie der zeitgenös-sischen Prähistorie – vom „Rössener Volk […], dessen Heimat an der mittleren Elbe lag und das von dort nach Westen und Südwesten wanderte“35.
In einem anderen Aufsatz Richters, der im „Hartung“ (Januar) 1935 in den „NS-Briefen“ er-schienen ist, hat sich die Diktion bereits deutlich verändert36 (Abb. 7). Herausgegeben wurden diese „Schulungsblätter der NSDAP im Rhein-Main-Gebiet“ von der Gauleitung Hessen-Nassau der NSDAP; als ihr Hauptschriftleiter fungierte Franz Hermann Woweries, der 1934 mit einer schwülstigen Biografie über Jakob Sprenger an die Öffentlichkeit getreten war37. Der „NS-Brief“
27 N. N., Das Jakob Sprenger-Haus auf dem Glauberg eingeweiht. Niddaer Anz. Nr. 121 vom 15.10.1934.28 Ebd.29 Ebd.30 H. Baitinger/F.-R. Herrmann, Der Glauberg am Ostrand der Wetterau. Arch. Denkmäler Hessen 513 (Wies-
baden 2007); Baitinger (Anm. 5).31 Es bleibt unklar, inwieweit Sprenger von den Aktivitäten des „Frankenführers“ Julius Streicher beeinflusst
war, unter dessen Ägide der mittelfränkische Hesselberg als „Heiliger Berg“ der fränkischen Nationalsozialisten inszeniert wurde. Vgl. hierzu Th. Greif, Frankens braune Wallfahrt. Der Hesselberg im Dritten Reich. Mittelfränk. Stud. 182 (Ansbach 2007).
32 E. Krug-Jahnke, 6 Jahrtausende deutscher Vergangenheit. Der Glauberg, Deutschlands bedeutendste Aus- grabungsstätte. Hessische Landes-Ztg. Nr. 265 vom 27.9.1935, 12.
33 O. Klöppel, Kriegsende in Glauberg. In: Festschrift 1200 Jahre Glauberg und 50 Jahre Eintracht Glauberg, hrsg. von Gemeinde Glauberg/Eintracht Glauberg e. V. (Glauburg 2002) 285 – 298; Baitinger (Anm. 8) 14 f.
34 H. Richter, Die Ausgrabungen auf dem Glauberg bei Büdingen. Heimatbl. Kr. Büdingen Nr. 10, 1933, 37 f.35 Ebd. 37.36 H. Richter, Der Glauberg – ein Monument der deutschen Vorgeschichte. NS-Briefe – Schulungsbl. NSDAP
Rhein-Main-Gebiet 3. Jg. F. 31, Januar 1935, 15 –17.37 F. H. Woweries, Reichsstatthalter Gauleiter Jakob Sprenger. Lebensbild eines Gefolgsmannes Adolf Hitlers
(Berlin 1934). – Vgl. hierzu Zibell (Anm. 1) 17.
03_DFG_Baitinger.indd 65 29.03.2011 18:55:20 Uhr
66
vom Januar 1935 war ganz der deutschen Vorgeschichte gewidmet. Außer dem Beitrag Richters finden sich darin auch Artikel von Hans Reinerth, Alfred Rosenberg, Wolfgang Schultz und Ru-dolf Stampfuß, der als Landesleiter Hessen in Reinerths Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte fungierte. Richter beschreibt die Rössener nun als „Eroberer“, die „bei ihrem Vormarsch über Kurhessen und die Wetterau nach Süden zuerst die strategisch günstigen Punkte besetzten und befestigten“ und die „später von den unterworfenen Völkern den Ackerbau lernten und sich mit diesen vermischten“38. Die Wetterau wird als „das vorzeitliche Herz von Südwestdeutschland“ bezeichnet, in dem „die Völkerwellen wie die Blutströme in einem Herzen zusammen- und wie-der auseinandergeflossen sind“39. Die martialisch-militaristischen Untertöne in diesen Zeilen sind nicht zu überhören.
Die germanische Besiedlungsphase des Glaubergs in der späten Kaiser- und Völkerwanderungs-zeit spielte in Richters Vorberichten dagegen zunächst keine besondere Rolle, wie man vielleicht vermuten könnte. Erst im Sommer 1937 endet ein kurzer Beitrag in einer populärwissenschaft-lichen Zeitschrift mit dem folgenden Satz: „Von ganz besonderem nationalem Interesse ist der Glauberg durch seine starke und dauernde Besetzung während der Völkerwanderungszeit, wo-durch er unser Wissen über die kulturellen, sozialen und politischen Zustände bei den außerhalb des römischen Reiches wohnenden Germanen wesentlich zu erweitern verspricht“40. Möglicher-weise darf diese Schwerpunktverlagerung hin zu den Germanen als ein Reflex auf Aktivitäten der SS auf dem Glauberg verstanden werden. Darauf wird noch zurückzukommen sein.
Viel wichtiger als die Germanen war aber – wie bereits erwähnt – der erzieherische Aspekt der Ausgrabungen, wie er schon in Artikel 1 der Verordnung über den Freiwilligen Arbeitsdienst vom 16. Juli 1932 formuliert war. Darin heißt es: „Der freiwillige Arbeitsdienst gibt den jungen Deut-schen die Gelegenheit, zum Nutzen der Gesamtheit in gemeinsamem Dienst freiwillig ernste Ar-beit zu leisten und zugleich sich körperlich und geistig-sittlich zu ertüchtigen“41. In einem Vortrag, den Richter in Anwesenheit Sprengers am 29. Dezember 1933 in Glauberg hielt, ist vom großen „belehrenden und erzieherischen Wert“ der Ausgrabung die Rede, vor allem für die deutsche Ju-gend42. Und im Laufe des Jahres 1934 erschien in einer vom Autor bislang nicht recherchierten Zeitschrift ein Artikel von Richter mit dem Titel „Arbeitsdienst und vorgeschichtliche Bodenfor-schung“. Darin werden der erzieherische Aspekt und die Anforderung, sich in einer Gruppe einem gemeinsamen Ziel unterzuordnen, als „eine große Möglichkeit der Volkserneuerung“ in den Vor-dergrund gestellt.
Dieselben Motive schwangen auch mit, als Richter im März 1934 in Darmstadt einen Vortrag über seine Ausgrabungen hielt43, veranstaltet vom Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB)44 und vom Reichsbund für Volkstum und Heimat. Triebfeder dieser Veranstaltung war das Beirats-mitglied der Sprenger-Stiftung, Friedrich Ringshausen (Abb. 8), der sowohl Landschaftsleiter des Reichsbunds für Volkstum und Heimat (Landschaft Rheinfranken – Nassau – Hessen) als auch
38 Richter (Anm. 36) 16.39 Richter (Anm. 36) 15.40 H. Richter, Ringwallausgrabung in Oberhessen. Geistige Arbeit, Ztg. Wiss. Welt 4. Jg., Nr. 12 vom 20.6.1937,
4.41 Reichsgesetzbl. I, 1932, 352 f.42 H. Richter, Die Ausgrabungen auf dem Glauberg in Oberhessen. Vortragsmanuskript vom 29.12.1933.
Sonderdr. aus Wetzlarer Anz. (Lieb Heimatland/Sonntagsbl.) Nr. 4; 5; 7 (Wetzlar 1934) 2.43 A. Z., Die vorgeschichtlichen Ausgrabungen auf dem Glauberg. Darmstädter Ztg. vom 15.3.1934.44 W. Feiten, Der Nationalsozialistische Lehrerbund. Entwicklung und Organisation. Ein Beitrag zum Aufbau
und zur Organisationsstruktur des nationalsozialistischen Herrschaftssystems. Stud. u. Dokumentationen dt. Bildungsgesch. 19 (Weinheim, Basel 1981); H. W. Schaller, Der Nationalsozialistische Lehrerbund. Geschichte, nationale und internationale Zielsetzungen. Archiv Gesch. Oberfranken 82, 2002, 329 –362.
03_DFG_Baitinger.indd 66 29.03.2011 18:55:20 Uhr
67
45 Zu F. Ringshausen vgl. M. Grüttner, Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik (Heidelberg 2004) 139.
46 Am 3.6.1936 sprach Richter in Bonn auf einer Tagung, die der West- und Süddeutsche Verband für Altertumsforschung gemeinsam mit dem Nordwestdeutschen Verband ausgerichtet hatte, und zwar über das Thema „Die Glauburg von der Spätlatène [sic!] bis ins Mittelalter.“ Vgl. hierzu B. Pinsker, Arch. Nachrbl. 5, 2000, 58 ff. bes. 61 Abb. 2. – Der Hinweis auf diesen Vortrag wird A. Leube (Berlin) verdankt.
47 Aktennotiz von J. Werner über ein Gespräch mit H. Richter am 20.6.1967 (LfDH Wiesbaden, Ortsakte Glauberg).
48 P. Nieß, Die „Schatzgräber“ auf dem Glauberg. Der Vogelsberg, Bl. Heimatliebe u. Wanderlust – Monatsschr. Vogelsberger Höhen-Club 23/1, Januar 1934, 3–6 hier 5.
Gauobmann des NS-Lehrerbundes in Hessen war45. Ansonsten ist bislang nur recht wenig über die Vortragstätigkeit Richters bekannt, vor wem er sprach und wie häufig er referierte46. Nach sei-nen eigenen Angaben kam es freilich 1937 zum Bruch mit seinem Förderer Sprenger, weil Richter sich geweigert hatte, Vorträge im Gauschulungslager für höhere Beamte in Selters zu halten47.
Die Zahl der Führungen für Besucher der Ausgrabungen muss beträchtlich gewesen sein. Neben der Fachkollegenschaft kam auch hochkarätige Prominenz an den Glauberg, etwa Franz von Papen, der Vizekanzler im ersten Kabinett Hitler, und Prinz Oskar von Preußen, der fünfte Sohn Kaiser Wilhelms II. (Abb. 9). Auch Reichsstatthalter Sprenger hielt sich mehrfach am Glau-berg auf, um sich über den Fortgang der Grabungen zu informieren (Abb. 10). Begleitet wurde er dabei meist von einem großen Gefolge, zu dem u. a. sein Stellvertreter Heinrich Reiner und Lan-desbauernführer Dr. Richard Wagner gehörten. Ferner „kam der Lehrer mit seiner Kinderschar, der Pfarrer mit seinen Konfirmanden, da kamen Wandervereine, Gesang- und Turnvereine, die SA marschierte auf, Hitlerjugend und B. d. M. traten an“48 (Abb. 11).
Abb. 8. Friedrich Ringshausen (1880 –1941) im Jahre 1934. Foto nach Volk u. Scholle 12, 1934, Abb. auf S. 34.
03_DFG_Baitinger.indd 67 29.03.2011 18:55:23 Uhr
68
Schon früh hatte Richter erkannt, welche Bedeutung einer angemessenen Präsentation der Gra-bungsfunde zukam. Noch 1933 konnte er eine kleine Schausammlung in einem Privathaus im Dorf Glauberg präsentieren49. Im Jahre 1934 ließ er im Grabungshaus am Südabhang des Glaubergs eine Ausstellung einrichten, in der neben Fundstücken aus seinen Grabungen auch Leihgaben des Oberhessischen Museums Gießen zu sehen waren, dessen Leitung Richter Ende 1933 über-
Abb. 10. Reichsstatthalter Sprenger informiert sich über den Fortgang der Ausgrabun- gen auf dem Glauberg. In der Bildmitte Heinrich Richter (mit Brille), dahinter Landesbauernführer Dr. Richard Wag-ner; links (vor den Hitlerjungen) Jakob Sprenger (wohl 1934). Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
49 Die Sammlung befand sich im Haus Nickel/Schmidt in der Hauptstraße 35 (frdl. Hinweis von A. Nickel, Glauberg). Vgl. auch N. N., Ausflug nach der Glauburg. Niddaer Anz. Nr. 135 vom 17.11.1933.
Abb. 9. Prinz Oskar von Preußen, der fünfte Sohn Kaiser Wilhelms II., zu Besuch auf dem Glauberg (1935). Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 68 29.03.2011 18:55:25 Uhr
69
nommen hatte50; am 13. Oktober 1934 konnte Sprenger diese Ausstellung bereits besichtigen51. Nachdem der Arbeitsdienst abgezogen und das ursprünglich als Museum vorgesehene Gebäude von Richter zu Wohnzwecken umgewidmet worden war, verlagerte man die Sammlung ins Jakob Sprenger-Haus52. Dort blieb das Museum samt den Magazinräumen bis April 1945, als das Ge-bäude durch alliierten Artilleriebeschuss völlig zerstört wurde53.
Vieles hatte sich für Richter in den Jahren 1934 und 1935 positiv angelassen, doch der Spät-sommer 1935 bildete eine tiefe Zäsur für die Glauberggrabung. Mit Gerhard Bersu wurde der wichtigste Fachberater Richters nach Berlin versetzt, und am 31. August 1935 musste der am Glau-berg tätige Außenzug des Arbeitsdienstes in sein Stammlager nach Schlüchtern einrücken. Ursache dafür war eine Anordnung von Reichsarbeitsführer Hierl, wonach alle Außenzüge des Arbeits-dienstes zum 1. September 1935 eingezogen wurden54. Sprenger hielt dem Glauberg zwar zunächst weiterhin die Treue, doch wurde die Finanzierung der Ausgrabungen ohne die billigen Kräfte des Arbeitsdienstes zum Problem.
Hatte Richter zwischen 1933 und 1935 fünf Vorberichte über seine Grabungen veröffentlicht – darunter einen recht ausführlichen in der Zeitschrift „Volk und Scholle“55 –, so erschien zwi-
Abb. 11. Eine Gruppe des Bundes Deutscher Mädel (BDM) aus dem Ort Grebenhain auf dem Glauberg am 27.7.1935. Rechts (mit Hut) Hein-rich Richter. Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
50 H. Szczech, Mitt. Oberhess. Geschver. N. F. 65, 1980, 136.51 Vgl. Anm. 27.52 Bei N. N., Der Glauberg – unwissenschaftlich gesehen. Gießener Anz. Nr. 105, Viertes Bl., vom 8.5.1937 ist
von „einem kleinen Museum“ die Rede, „das in einem Raum des ‚Jakob Sprenger-Hauses’ untergebracht ist.“
53 Klöppel (Anm. 33).54 Brief von H. Richter an H. Arntz (DFG) vom 17.9.1935 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).55 H. Richter, Die Ausgrabungen auf dem Glauberg bei Büdingen. Heimatbl. Kr. Büdingen H. 10, 1933, 37 f.;
ders., Die Ausgrabungen auf dem Glauberg in Oberhessen. Vortragsmanuskript vom 29.12.1933. Sonderdr. aus Wetzlarer Anz. (Lieb Heimatland/Sonntagsbl.) Nr. 4; 5; 7 (Wetzlar 1934); ders., Arbeitsdienst und vorgeschichtliche Bodenforschung. Aus einer nicht ermittelten Zeitschrift (1934) 45 f.; ders., Der Glauberg (Bericht über die Ausgrabungen 1933 –1934). Volk u. Scholle 12, 1934, 289 –316; ders., Der Glauberg. Ein Monument der deutschen Vorgeschichte. NS-Briefe – Schulungsbl. NSDAP Rhein-Main-Gebiet 3. Jg. F. 31, Januar 1935, 15 –17.
03_DFG_Baitinger.indd 69 29.03.2011 18:55:26 Uhr
70
schen 1936 und 1939 nur noch ein einziger und zudem sehr kurzer Beitrag56. Auch die erhaltenen Grabungsfotos stammen vor allem aus der Zeit zwischen 1933 und 1935, während aus späteren Kampagnen nur noch eine begrenzte Zahl von Aufnahmen zur Verfügung steht. Dies sind deut-liche Indizien dafür, dass sich der Wind für die Glauberggrabung gedreht hatte. Einen Antrag auf dauerhafte finanzielle Unterstützung hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Jahre 1935 abgelehnt – trotz wärmster Befürwortung durch Theodor Wiegand, den Präsidenten des Ar-chäologischen Instituts des Deutschen Reiches57. So setzte Richter seine Hoffnungen nun auf die Abteilung „Ausgrabungen“ im Persönlichen Stab des Reichsführers-SS, Heinrich Himmler, der sich bekanntermaßen stark für archäologische Untersuchungen im Deutschen Reich engagierte58. Tatsächlich wurde der Glauberg 1936 in das Grabungsprogramm der SS aufgenommen. Er ist auf einer Karte, die Alexander Langsdorff und Hans Schleif im Dezember 1936 veröffentlichten, als Projekt für das Jahr 1937 eingezeichnet59 (Abb. 12). Schon in einem Brief vom September 1935 an
56 H. Richter, Ringwallausgrabung in Oberhessen. Geistige Arbeit, Ztg. Wiss. Welt 4. Jg. Nr. 12 vom 20.6.1937, 4.
57 Brief von Th. Wiegand an J. Stark, den Präsidenten der DFG, vom 15.2.1935 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248). – Im Juli 1935 setzte sich auch Sprenger bei der DFG nachdrücklich für Richter ein (Brief von J. Sprenger an H. Arntz [DFG] vom 25.7.1935, Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).
58 M. H. Kater, Das „Ahnenerbe“ der SS 1935 –1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Stud. Zeitgesch. 62 (München 1997).
59 A. Langsdorff/H. Schleif, Die Ausgrabungen der Schutzstaffeln. Germanien 1936, 391–399 hier 392 Abb. – In diesem Artikel wird der Glauberg allerdings mit keinem Wort erwähnt.
Abb. 12. Karte der SS-Grabungen im Deutschen Reich. Karte nach A. Langsdorff/H. Schleif, Germanien 1936, Abb. auf S. 392.
03_DFG_Baitinger.indd 70 29.03.2011 18:55:27 Uhr
71
Helmut Arntz, den Leiter des Referats Vorgeschichte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, schrieb Richter von der „Aussicht, die SS, von denen jetzt schon Leute freiwillig mitgearbeitet haben, für die Fortführung der Arbeit zu gewinnen“60, und auch für 1936 sind SS-Leute als Mit-arbeiter auf der Grabung bezeugt61. In diesem Jahr trat Heinrich Himmler, der Reichsführer-SS, „mit der Zusicherung einer geldlichen Unterstützung“ in die Sprenger-Stiftung ein62, doch sind die Gelder aus unbekannten Gründen niemals geflossen. Man könnte erwägen, ob die für den Glauberg vorgesehenen Mittel für die Ausgrabung des hallstattzeitlichen Großgrabhügels „Hoh-michele“ in Südwürttemberg verwendet wurden. Mit der Untersuchung dieses Tumulus hatte die SS im Winter 1936/37 fast überstürzt begonnen, um einer Ausgrabung durch Reinerth zuvorzu-kommen63. So fehlt denn auch der „Hohmichele“ auf der Karte der SS-Grabungen vom Dezember 1936 (Abb. 12), und das, obwohl der Grabungsleiter Gustav Riek zu diesem Zeitpunkt bereits die Bäume auf dem Hügel abholzen ließ.
Nachdem die Gelder der SS ausgeblieben waren, musste sich Richter erneut nach anderen Geld-gebern umsehen, zumal nach seinen eigenen Angaben auch die Sprenger-Stiftung 1937 die För-derung einstellte64. Richter wandte sich im Herbst 1937 direkt an Ministerialrat Herman-Walther Frey, den Referenten der Wissenschaftsabteilung im Reichserziehungsministerium (REM)65, und durch die Vermittlung des dortigen Referenten für Bodendenkmalpflege, Werner Buttler, flossen 1938 tatsächlich Mittel des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches an den Glauberg. Diese Gelder verwendete Richter dazu, um den mächtigen Abschnittswall im Osten des Plateaus zu durchschneiden. Für das Jahr 1939 ging Richter nochmals den gleichen Weg, und ihm wurde aus Sondermitteln des REM ein nennenswerter Betrag für seine Grabung bewilligt66. Ob diese Gelder allerdings noch ausbezahlt wurden, bleibt unklar, denn das Bewilligungsschreiben datiert auf den 15. Juli 193967, also keine sieben Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der die Grabungen zum Erliegen brachte.
Betrachtet man die Geschehnisse am Glauberg zusammenfassend, so gibt es wohl nur wenige archäologische Ausgrabungen im Deutschland der 1930er Jahre, die eine solch bewegte Geschichte und so viele unterschiedliche Facetten aufzuweisen haben. Die verschiedensten Protagonisten archäologischer Forschung in Deutschland – untereinander teilweise bis auf das Blut verfeindet – haben mit dem Glauberg mehr oder weniger intensiv zu tun gehabt, und man kann Heinrich
60 Brief von H. Richter an H. Arntz (DFG) vom 17.9.1935 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).61 Brief von Ch. Rauch an das Rektorat der Universität Gießen vom 16.3.1937 (Archiv der Universität Gießen,
Berufungsakte H. Richter [PrA Phil Nr. 23]); Brief von H. Richter an H.-W. Frey (REM) vom 1.10.1937 (Bundesarchiv Koblenz R 72/11248).
62 Brief von H. Richter an H.-W. Frey (REM) vom 1.10.1937 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248). – Möglicherweise ist eine zweite, nicht erhaltene Stiftungsurkunde der Reichsstatthalter Jakob Sprenger-Stiftung, die auf den 14.12.1936 datiert (Hess. Regierungsbl. 1937, 17 [Bekanntmachung vom 9.2.1937]), auf den Eintritt Himmlers in die Stiftung zurückzuführen.
63 W. Kimmig in: E. Gersbach, Ausgrabungsmethodik und Stratigraphie der Heuneburg. Heuneburgstud. VI = Röm.-Germ. Forsch. 45 (Mainz 1989) 99 ff.; G. Riek/H.-J. Hundt, Der Hohmichele. Ein Fürstengrabhügel der späten Hallstattzeit bei der Heuneburg. Heuneburgstud. I = Röm.-Germ. Forsch. 25 (Berlin 1962) 4 ff.; M. Strobel in: Ch. Kümmel/N. Müller-Scheeßel/A. Schülke (Hrsg.), Archäologie als Kunst. Darstellung – Wirkung – Kommunikation (Tübingen 1999) 83 f.
64 Aktennotiz von J. Werner über ein Gespräch mit H. Richter am 20.6.1967 (LfDH Wiesbaden, Ortsakte Glauberg).
65 Brief von H. Richter an H.-W. Frey (REM) vom 1.10.1937 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).66 Jahresber. DAI 1939/40. Arch. Anz. 1940, V f.; vgl. auch S. von Schnurbein, Ber. RGK 82, 2001, 189.67 Brief von M. Wegner an H. Richter vom 15.7.1939 (Archiv RGK 116, Allgemeiner Schriftwechsel Zentral-
direktion 1939/40); vgl. auch den Brief von W. Schleiermacher an E. Sprockhoff vom 20.7.1939 (Archiv RGK 1116, Schriftwechsel Sprockhoff).
03_DFG_Baitinger.indd 71 29.03.2011 18:55:27 Uhr
72
Richter nicht den Respekt dafür versagen, dass er seine Feldforschungen in diesem spannungsge-ladenen Umfeld über sechs lange Jahre hinweg am Leben erhalten hat. Die Glauberggrabung ist ein Kind der späten Weimarer Republik, und mit Gerhard Bersu stand ein ausgewiesener Experte für Siedlungsgrabungen an ihrer Wiege. Mit der Gründung der Reichsstatthalter Jakob Sprenger-Stiftung wurde das wissenschaftliche Forschungsprojekt zu einem kulturpolitischen Aushänge-schild der Nationalsozialisten in Hessen. Sprenger wollte damit die Bevölkerung schulen, ihnen Stolz auf die Vorfahren vermitteln und aufzeigen, wie sehr das Volk mit dem Boden verbunden, in ihm verwurzelt ist. Der finanzschwache Privatdozent und wissenschaftliche Außenseiter Heinrich Richter – er war von Hause aus Geologe, kein Fachprähistoriker – ließ sich von den Nationalsozia-listen vereinnahmen, sicher eher aus Opportunismus denn aus Überzeugung. Dafür sprechen die spöttischen, ja sogar abfälligen Bemerkungen über Sprenger, die Richter eigenhändig auf die Rück-seite verschiedener Fotos geschrieben hat (Abb. 13). Diese bissigen Kommentare zeigen, dass sich Richter den Nationalsozialisten intellektuell überlegen fühlte und das Wohlwollen des Reichsstatt-halters vor allem als Mittel zum Zweck betrachtete, um seine Existenz und die seiner Familie zu sichern. Außerdem wurde dem knapp Vierzigjährigen nun endlich die berufliche Anerkennung zuteil, die ihm so lange versagt geblieben war.
Richter erscheint somit als ein Opportunist, der sich und sein Fach für politische Zwecke ver-einnahmen ließ, ohne offenbar die Auswirkungen solchen Handelns ernsthaft zu hinterfragen. In-wiefern die schwerwiegenden Folgen, die dieses Verhalten für die Vorgeschichtsforschung und für Deutschland haben sollte, im Herbst 1933 schon zu übersehen waren, wage ich als Prähistoriker freilich nicht zu beurteilen – dies ist Aufgabe der Historiker.
Nachtrag
Nach Abschluss des Manuskripts brachte uns Barbara Stenger (Paderborn) Unterlagen aus ihrem Privatbesitz zur Kenntnis, welche die Aktivitäten der SS auf dem Glauberg im Jahre 1936 in einem neuen Licht erscheinen lassen. Frau Stenger ist die Tochter von Dr. Walther Steinhäuser (1908–1946), der – ebenso wie Heinrich Richter – in Gießen Geologie studiert hatte und dort 1936 pro-moviert worden war. Als Abteilungsleiter im Rasse- und Siedlungshauptamt organisierte er im Sommer 1936 Ausgrabungen der SS auf dem Glauberg, die von Anfang Juli bis Anfang Okto-ber andauerten; allerdings ist seine Anwesenheit auf dem Glauberg durch Fotodokumente bereits für Sommer 1935 bezeugt. Dies kann offenbar auf die oben zitierte Äußerung Richters in einem Schreiben an Helmut Arntz vom September 1935 bezogen werden, wonach die Aussicht bestünde, „die SS, von denen jetzt schon Leute freiwillig mitgearbeitet haben, für die Fortführung der Arbeit
Abb. 13. Heinrich Richter und Jakob Sprenger bei der Einweihung des Jakob Sprenger-Hauses am 13.10.1934. Auf die Rückseite des Fotos hat Richter den bissigen Kom-mentar geschrieben: „Der Gauleiter überbringt die Huldigung der Unterta-nen, sieht aus, als sagt er „Mein Führer“ zu mir“. Foto: Privatbesitz E. Kauschat, Glauberg.
03_DFG_Baitinger.indd 72 29.03.2011 18:55:28 Uhr
73
68 Brief von H. Richter an H. Arntz (DFG) vom 17.9.1935 (Bundesarchiv Koblenz R 73/11248).69 Kater (Anm. 58) 87; 128; 389 Anm. 205.
zu gewinnen“68. In privaten Briefen an seine spätere Frau schilderte Steinhäuser seine Arbeit im Sommer 1936 und das bald schon stark angespannte Verhältnis zu Richter, dem mit dem jüngeren Kollegen wenig willkommene Konkurrenz erwuchs. Diese Konfliktsituation wog umso schwerer, als Richter Protegé des Reichsstatthalters Sprenger war und Steinhäuser der Reichsführung SS – also Himmler – unterstand. Steinhäuser machte keinen Hehl aus seiner Erleichterung, als er An-fang Oktober die Grabung beenden und den Glauberg verlassen konnte, und er muss seine wenig positiven Eindrücke auch Alexander Langsdorff mitgeteilt haben. Diese Einschätzung wird maß-geblich dazu beigetragen haben, dass die SS ihre Arbeiten auf dem Glauberg im Jahre 1937 nicht weiter fortsetzte.
Im Oktober 1938 wurde Steinhäuser Leiter der neu geschaffenen Abteilung Karst- und Höh-lenkunde im „Ahnenerbe“ mit Hauptsitz in Salzburg, später in München, aber schon bald auf die-sem Posten durch Dr. Ing. Hans Brand ersetzt69. Während des Krieges war er als „Wehrgeologe“ eingesetzt; er starb am 23. März 1946 an den Folgen einer Diphtherie.
Frau Stenger stellt die schriftlichen und bildlichen Unterlagen aus ihrem Besitz dem im Aufbau befindlichen Archiv des neuen Keltenmuseums am Glauberg zur Verfügung, wofür ihr auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt sei.
Summary
The excavations at the Glauberg, which were directed by the Gießen geologist and prehistorian Heinrich Richter between 1933 and 1939, were among the largest archaeological projects under-taken during the National Socialist regime in Germany. One of the main initiators was Gerhard Bersu, the First Director of the Römisch-Germanische Kommission in Frankfurt, but the excava-tions soon took on a strong political element when in December 1933 the “NS-Gauleiter” (Gau Leader) and “Reichstatthalter” (Imperial Deputy) in Hessen, Jacob Sprenger, formed a founda-tion named after himself that provided financial support for the project. As a result the Glauberg became one of the National Socialists’ cultural political showcases in Hessen. With his participa-tion Sprenger pursued two goals: on the one hand a site with a long history of settlement was to impress upon people how closely they were rooted in their native soil; on the other hand the men from the Voluntary Work Service (Freiwilliger Arbeitsdienst) who worked at the excavations were to be educated in the spirit of NS-ideology and develop a feeling for the origins of the Germans and for their history. In this Sprenger was aided by an excellent presentation of the most important finds in a small museum at the site, as well as numerous guided tours and lectures by the excava-tion director. The political and ideological component of the project was also reflected in the few reports on the excavations published by Richter in the 1930s, but not in the strategy and method of the fieldwork. The surviving documentation contains no evidence for direct intervention by political instances in the excavations at the Glauberg, which until 1935 were heavily influenced by Bersu, one of the best excavators of his times. As a result, Bersu’s politically motivated removal to Berlin and the withdrawal of the Work Service in the summer of 1935 were a severe loss for the work, which suffered from increasing financial problems in the following years. The involvement of the SS in the summer of 1936 was only temporary, probably in part due to personal conflicts which seriously hampered the work. This led to the permanent suspension of the excavations at the Glauberg in the summer of 1939 – only a few weeks before the outbreak of the war. All of the finds, and much of the documentation, were destroyed on April 2 1945, when the Jakob Sprenger-Haus on the west slopes of the Glauberg, named after the sponsor of the excavations, burned down – five weeks before its patron committed suicide in Tyrol.
03_DFG_Baitinger.indd 73 29.03.2011 18:55:28 Uhr
Abkürzungen
AALSH ArchivdesArchäologischenLandesmuseumsSchleswig-HolsteinAbt. AbteilungAIDR ArchäologischesInstitutdesDeutschenReichesALVR ArchivLandschaftsverbandRheinlandAOO AlloverornamentedAPM ArchivPfahlbaumuseumAMS ArbeitsmarktserviceARGK ArchivRömisch-GermanischeKommissionAStA AllgemeinerStudierendenausschussASW AktiengesellschaftSächsischeWerkeAufl. AuflageAusg. AusgabeBArch BundesarchivBerlin-LichterfeldeBDC BerlinDocumentCenterBDM BunddeutscherMädelCSVD Christlich-SozialerVolksdienstDAI DeutschesArchäologischesInstitutDBFU BeauftragterdesFührersfürdieÜberwachungdergesamtengeistigenundweltanschau-
lichenSchulungundErziehungderNSDAPDDP DeutscheDemokratischeParteiDGK5 DeutscheGrundkarte1:5.000DGPh DeutscheGesellschaftfürPhotographieDNVP DeutschnationaleVolksparteiDVP DeutscheVolksparteiDFG DeutscheForschungsgemeinschaftDoz. DozentEAA EuropeanAssociationofArchaeologistsERR EinsatzstabReichsleiterRosenbergETH EidgenössischeTechnischeHochschuleFAD FreiwilligerArbeitsdienstHAIT Hannah-Arendt-InstitutfürTotalitarismusforschungHJ Hitler-JugendHSSPF HöhererSS-undPolizeiführerKap. KapitelKfdK KampfbundfürdeutscheKulturKL KonzentrationslagerKPD KommunistischeParteiDeutschlandsKWG Kaiser-Wilhelm-GesellschaftzurFörderungderWissenschaftenKZ Konzentrationslagerk.u.k. kaiserlichundköniglichLAS LandesarchivSchleswig-HolsteinLVR LandschaftsverbandRheinlandLDA LandesdenkmalamtLfDH LandesamtfürDenkmalpflegeHessenLkr. LandkreisLM LandesmuseumLMK LandesmuseumKärnten
327
16_Nachspann 327 11.04.2011 18:11:18 Uhr
328
MdR MitglieddesReichstagesMU MontanuniversitätMIRAG MitteldeutscheRundfunkA.G.HStAH HauptstaatsarchivHannoverNapola NationalpolitischeLehranstaltNLA NiedersächsischesLandesarchivNLD NiedersächsischesLandesamtfürDenkmalpflegeNS Nationalsozialismus,Nationalsozialistische(r)NSD- Nationalsozialistische(r)Deutsche(r)NSDAP NationalsozialistischeDeutscheArbeiterparteiNSDDB NationalsozialistischerDeutscherDozentenbundNSDDoB NationalsozialistischerDeutscherDozentenbundNSDStB NationalsozialistischerDeutscherStudentenbundNSLB NationalsozialistischerLehrerbundNSZ NationalsozialistischeZeitungOA OrtsaktePA PersonalakteO.N. OhneNamenOPG OberstesParteigerichtORL Obergermanisch-RaetischerLimesRAD ReichsarbeitsdienstREM ReichsministeriumfürWissenschaft,ErziehungundVolksbildungRFSS Reichsführer-SSRGF Reichsgeschäftsführerdes„Ahnenerbe“RGK Römisch-GermanischeKommissionRGZM Römisch-GermanischesZentralmuseumRM ReichsmarkRSHA ReichssicherheitshauptamtderSSRuS Rasse-undSiedlungshauptamtderSSRuSHA Rasse-undSiedlungshauptamtSA SturmabteilungSD SicherheitsdienstdesReichsführers-SSSPD SozialdemokratischeParteiDeutschlandsSED SozialistischeEinheitsparteiDeutschlandsSS SchutzstaffelSS-Hst. SS-HauptsturmführerSSO SS-OrganisationenSS-Ostuf. SS-ObersturmführerSS-Standartenf. SS-Standartenführers.Mgf. seineMagnifizienzTBK TrichterbecherkulturTU TechnischeUniversitätUA UniversitätsarchivUAG,Kur UniversitätsarchivGöttingen,KuratoriumUfA UniversumFilmAGUFI UrgeschichtlichesForschungsinstitutUSPD UnabhängigeSozialdemokratischeParteiDeutschlandsVLA VerbandderLandesarchäologenVB VölkischerBeobachter
16_Nachspann 328 11.04.2011 18:11:18 Uhr
329
Autoren
Dr.HolgerBaitinger,Archäologe.–DFG-Projekt:MetallfundeSelinunt.Römisch-GermanischeKommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Palmengartenstraße 10–12, D-60325Frankfurta.M.–E-Mail:[email protected]
Dr. Marieke Bloembergen, Historikerin. – Projekt: Sleeping Beauties Hidden Forces. Archaeo-logical and historical sites and the dynamics of heritage formation in colonial and postcolonialIndonesia.KoninklijkInstituutvoorTaal-,Land-enVolkenkunde/RoyalNetherlandsInstituteofSoutheastAsianandCaribbeanStudies,Reuvensplaats2,NL-2311BELeiden.–E-Mail:[email protected]
Univ.-Doz.Dr.HeimoDolenzM.A.,Archäologe.–LandesmuseumKärnten,AbteilungfürPro-vinzialrömischeArchäologieundFeldforschung,AußenstelleArchäologischerParkMagdalens-berg,Magdalensberg15,A-9064Pischeldorf.–E-Mail:[email protected]
Dr.JörgEckert,Archäologe.–BremerHeerstraße156,26135Oldenburg
Dr. Martijn Eickhoff, Historiker. – Projekt: Sleeping Beauties Hidden Forces. ArchaeologicalandhistoricalsitesandthedynamicsofheritageformationincolonialandpostcolonialIndone-sia,NIOD–InstituteforWar-,Holocaust-andGenocidestudies,Herengracht380,NL-1016CJAmsterdam.–E-Mail:[email protected]
Prof.Dr.UtaHalle,Archäologin.–LandesarchäologieBremen,AnderWeide50,D-28195Bre-men, und Universität Bremen, Institut für Geschichtswissenschaft, Abteilung Ur- und Früh-geschichte,GebäudeGW2,Bibliothekstraße1,D-28359Bremen.–E-Mail:[email protected]
Prof.Dr.Frank-RutgerHausmann,Romanist.–UntereDorfstraße9,79241Ihringen.–E-Mail:[email protected]
Dr.RainerKossian,Archäologe.–BrandenburgischesLandesamtfürDenkmalpflegeundArchäo-logisches Landesmuseum, Dezernat Museum/Restaurierung, Ortsteil Wünsdorf, WünsdorferPlatz4–5,D-15806Zossen.–E-Mail:[email protected]
Dr.ThomasKreckel,Archäologe.–GeneraldirektionKulturellesErbeRheinland-Pfalz,DirektionArchäologie,AußenstelleSpeyer,KleinePfaffengasse10,D-67346Speyer.–E-Mail:[email protected]
Katharinav.KurzynskiM.A.,Archäologin.–KeltenweltamGlauberg.Museum–ArchäologischerPark–Forschungszentrum.AmGlauberg1.63695Glauburg.–E-Mail:[email protected],Archäologe.–Fichtelbergstraße30,D-12685Berlin.–E-Mail:[email protected]
16_Nachspann 329 11.04.2011 18:11:19 Uhr
330
Dr. des Dirk Mahsarski, Biologe, Historiker und Archäologe. – Forschungsprojekt (gefördertvonderVolkswagenStiftung):„VorgeschichtsforschunginBremenuntermHakenkreuz“.–Focke-Museum – Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Schwachhauser Heer-straße240,D-28213Bremen.–E-Mail:[email protected]@uni-bremen.de
Prof.Dr.HansjürgenMüller-Beck,PaläohistorikerundArchäologe.–Eberhard-Karls-Universi-tätTübingen,InstitutfürUr-undFrühgeschichteundArchäologiedesMittelalters,Abt.ÄltereUrgeschichteundQuartärökologie,SchlossHohentübingen,Burgsteige11,D-72070Tübingen.–E-Mail:[email protected]
JudithSchachtmannM.A.,Archäologin.–DFG-Projekt:„ArchäologieimpolitischenDiskurs“.–LandesamtfürArchäologie,ZurWetterwarte7,D-01109Dresden,E-Mail:[email protected]
Prof.Dr.EgonSchallmayer,Archäologe. –Landesamt fürDenkmalpflegeHessen,ArchäologieundPaläontologie,SchlossBiebrich (Ostflügel),D-65203Wiesbaden.–E-Mail: [email protected]
Dr.DirkSchmitz,Archäologe.–LVR-ArchäologischerParkXanten,AbteilungMuseumundRes-taurierung,Trajanstraße4,D-46509Xanten.–E-Mail:[email protected]
PD Dr. Gunter Schöbel, Archäologe. – Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee, Freilicht-museum und Forschungsinstitut, Strandpromenade 6, D-88690 Unteruhldingen-Mühlhofen. –E-Mail:[email protected]
Dr.MichaelStrobel,Archäologe.–LandesamtfürArchäologie,Abt.II–ArchäologischeDenk-malpflege,ZurWetterwarte7,D-01109Dresden.,–E-Mail:[email protected]
Dr.ThomasWidera,Historiker.–DFG-Projekt:„Archäologie impolitischenDiskurs“.–Han-nah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden,Tillich-Bau,Helmholtzstraße6–8,D-01062Dresden.–E-Mail:[email protected]
16_Nachspann 330 11.04.2011 18:11:19 Uhr