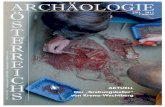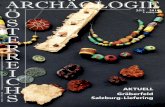Schamanen, Goldgräber und Soldaten - frühe Formen der `Aneignung` von Gebirgen in Vorarlberg
Formen knapper Bewertungen beim Fussballspielen an der Playstation
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Formen knapper Bewertungen beim Fussballspielen an der Playstation
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Heike Baldauf-Quilliatre Formate knapper Bewertungen beim empraktischen Sprechen 1. (Methodische) Vorbemerkung In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit der sprachlichen Realisierung expliziter sprachlicher Bewertungen in Interaktionen, bei denen das Sprechen eine andere, nichtsprachliche Tätigkeit begleitet. Was auf den ersten Blick banal erscheinen mag – was soll schon untersuchenswert sein an einer Bewertung wie „das ist schön“? –, erweist sich durchaus als interessant, wenn man sich fragt, warum an einer bestimmten Stelle in einer Interaktion ein bestimmtes Format auftritt. Dabei zeigt sich nämlich, a) dass die Möglichkeiten durchaus beschränkt sind und b) dass bestimmte Formate in einem bestimmten Interaktionstyp auch bestimmte Funktionen erfüllen, das heißt dass sie nicht willkürlich austauschbar sind. Bewertungen sind in der Gesprächs- und Konversationsanalyse bereits vielfach untersucht worden. Allerdings beschäftigt man sich erst seit kurzem im Rahmen einer multimodalen Analyse der Interaktion mit Bewertungen von nichtsprachlichen Ereignissen/Objekten/Aktivitäten, die in der Interaktionssituation präsent sind (etwa Mondada/Lindström 2009a). Meine Untersuchung setzt sowohl thematisch, als auch methodisch an diesem Punkt an: Thematisch insofern als sie der Frage nachgeht, welche Funktionen Bewertungen in einer bestimmten Interaktionssituation haben, genauer gesagt im Rahmen eines „collective engagement in a specific activity, developed here and now by the participants and often involving the copresence of the assessable and assessed objects” (Mondada/Lindström 2009b: 304). Methodisch insofern als sie, den Prinzipien der Konversationsanalyse folgend, turns bzw. turn construction units in ihrer sequentiellen Umgebung betrachtet. Meine Untersuchung unterscheidet sich von den oben erwähnten Studien vor allem in zwei Punkten: 1) Mein Interesse gilt weniger der sequentiellen Organisation der Interaktion, sondern vielmehr der sprachliche Realisierung von Äußerungen und situiert sich daher im Bereich der Interaktionalen Linguistik (Selting/Couper-Kuhlen 2000, Deppermann/Fiehler/Spranz-Fogasy 2006, Günthner/Imo 2006, Günthner/Bücker 2009). Verschiedene Studien haben in den letzten Jahren
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
versucht, vor allem konstruktionsgrammatische Ansätze für die Gesprächsanalyse fruchtbar zu machen und grammatische Phänomene in der Interaktion zu beschreiben (zu einer theoretischen Diskussion des Verhältnisses von Konstruktionsgrammatik und Gesprächsanalyse siehe etwa Auer 2007, Deppermann 2006, Günthner 2009 und 2011). Auch den untersuchten Formaten kann man in diesem Interaktionstyp ganz spezifische Funktionen zuschreiben, die sich verallgemeinern lassen und die auch über die spezifische Interaktionssituation hinaus Gültigkeit haben. 2) Meine Überlegungen setzen nicht an der lokalen Koordination verschiedener multimodaler Aktivitäten an (auch wenn dies natürlich in der Mikroanalyse eine wesentliche Rolle spielt), sondern auf der Mesoebene, das heißt bei den Besonderheiten des Interaktionstyps. Diesem Vorgehen folgend soll daher zunächst anhand des Korpus’ auf den Interaktionstyp und die Rolle von Bewertungen in diesem Rahmen eingegangen werden (Kap. 2). Anschließend diskutiere ich verschiedene Formate von Bewertungen und ihre Spezifika (Kap. 3). 2. Videospielen als eine Form empraktischen Sprechens Spätestens seit Etablierung der workplace studies (Suchman 1987, Heath/Luff 2000, Goodwin 2000, einführend auch Heath/Knoblauch/Luff 2000 und Mondada 2006) hat man sich vermehrt mit der Einbettung sprachlicher Kommunikation in einen bestimmten materiellen Rahmen beschäftigt, etwa der Kommunikation in Kontrollräumen, in Operationsräumen oder in Film- und Fernsehstudios. In den letzten Jahren haben sich verschiedene Untersuchungen nun Interaktionen gewidmet, bei denen die sprachliche Kommunikation nicht die primäre Rolle spielt. Solche Interaktionen sind zum einen im Rahmen einer multimodalen Konzeption der Interaktion analysiert worden – wobei natürlich nicht jeder talk-in-interaction auch handlungsbegleitend im oben angeführten Sinne ist, zum anderen als empraktisches Sprechen (Holly/Baldauf 2001) bzw. „empraktische Qualität“ der Sprache (Ehlich 2007: 268). 2.1 Das Korpus Meine Untersuchungen basieren im Weiteren auf der detaillierten Analyse eines eineinhalbstündigen Videospiels. Zwei Jugendliche, Raph und Luc, spielen gemeinsam an der Playstation PS3 fünf Fußballmatche (Fifa08) gegen ein anderes Team via Internet. Vier Matche spielen sie dabei zu Ende, das fünfte wird abgebrochen. Vor jedem Spiel wählen sie die Spieler ihres Teams (Real Madrid) und deren Positionen aus. Während des Spiels bewegen sie jeweils verschiedene Fußballer ihres Teams. Raph hat das Spiel schon oft gespielt, Luc
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
ist zwar erfahren mit Videospielen, spielt dieses Spiel jedoch zum ersten Mal. Das Korpus wurde 2007 im Rahmen eines ILF-Projektes zur Jugendsprache in Lyon (ICAR UMR 5191, CNRS & Universität Lyon 2) erhoben und ist Teil der Datenbank CLAPI (clapi.univ-lyon2.fr). Es handelt sich um eine Videoaufnahme mit zwei Kameras (eine Kamera ist auf die Spieler, eine auf den Bildschirm gerichtet). Die beiden Spieler sitzen nebeneinander und fixieren den Bildschirm (siehe Abb.1). Zusätzlich zur Kommunikation der Spieler hört man den (hier nicht mittranskribierten) Kommentar eines Reporters. Abb. 1: Setting Videospiele (links Luc, rechts Raph) 2.2 Empraktisches Sprechen
Der Begriff des „empraktischen Sprechens“ verweist auf Bühler (1934/1982), der mit dem Konzept „empraktisches/symphysisches Umfeld“ die Einbettung sprachlicher Zeichen in ein Umfeld nichtsprachlicher Handlungen, eine soziale „Praxis“ (ibid.: 159) beschreibt. Im deutschsprachigen Raum wird Empraktik vielfach auf eine bestimmte Äußerungsform und ihre Verwendung in einem nichtsprachlichen Kontext bezogen. So bezeichnen laut Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun u.a. 1997) „empraktische Ellipsen“ sogenannte Handlungsellipsen, das heißt „Ausdrucksformen, die nur dann verstanden werden können, wenn der Hörer ihren Punkt im Rahmen eines aktualisierten Handlungsmusters sieht“ (ebd.: 420). Deppermann (2007) beschreibt u.a. empraktische Deontische Infinitivkonstruktionen, die sich „auf eine praktische, nicht-kommunikative Handlungssituation“ richten und „zumeist auch zu gegenständlichem oder motorischem Handeln und nicht zu kommunikativen Aktivitäten“ auffordern (ebd.: 189). Ähnlich auch Uhmann (2010), die „empraktische freie Infinitive“ untersucht und Liedtke (2007), der von „empraktischen Äußerungen“ spricht.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Holly/Baldauf (2001) haben versucht, Bühlers Empraktik für die Gesprächsanalyse nutzbar zu machen und zu definieren. Unter „empraktischem Sprechen“ verstehen sie Äußerungen, die auf andere, gleichzeitig stattfindende Handlungen bezogen sind (ebd.: 45). Sie können Teil eines größeren Interaktionszusammenhangs sein oder eine eigenständige Interaktion bilden, und sie sind vor allem durch zeitliche und thematische Diskontinuität gekennzeichnet (ebd.: 46, siehe auch Baldauf 2002). Vergleichbare Beobachtungen gab es bereits bei Brünner (1987) und Fiehler (1993). O’Connell/Kowal (2012), die diese Überlegungen aufgreifen, unterscheiden diesbezüglich zwischen „conversation, where sustained speaking ist the primary activity, and empractial speech, where nonlinguistic activities are primary and speaking occurs only occasionally“ (ebd.: 16). Im letzten Jahrzehnt sind verschiedene konversationsanalytische, multimodale Analysen der Frage nachgegangen, wie sprachliche Äußerungen in eine nicht nur sprachliche Handlungssequenz eingebettet sind. Dabei wurde sehr detailliert gezeigt, wie man Sprache und Nichtsprachliches (Gestik, Mimik, Blick, Haltung, Bewegung, Umgang mit Objekten etc.) koordiniert und wie Nichtsprachliches im Rahmen einer Interaktion Handlung und Teil einer Sequenz sein kann (z.B. Fasulo/Monzoni 2009). Andere Studien haben vor allem den Interaktionsraum und die gemeinsame Orientierung als nicht per se vorhandenes, sondern zuerst von den Interaktanten zu konstituierendes Objekt hervorgehoben (z.B. Mondada 2009). Diese und weitere Untersuchungen haben dazu beigetragen, sprachliches Handeln als eine Modalität unter anderen, als Teil einer Interaktion und einer sozialen Praxis genauer zu beschreiben. Indem man prinzipiell jede Interaktion als multimodal betrachtet, werden die Unterschiede zwischen empraktischem, handlungsbegleitendem Sprechen im obigen Sinne und Konversationen (die natürlich auch talk-in-interaction sind) zum Teil bewusst verwischt. Das Konzept des empraktischen Sprechens wird dadurch jedoch nicht obsolet, ganz im Gegenteil. Es erlaubt nämlich, die Beobachtungen verschiedener Einzelanalysen aufeinander zu beziehen (etwa hinsichtlich einer ganz spezifischen Form des Zusammenwirkens verschiedener Modalitäten bzw. der Präferenz für bestimmte Äußerungsformate) und dadurch die Gemeinsamkeiten eines Interaktionstyps herauszustellen. Ich werde daher das Korpus, das den Mikroanalysen in dieser Studie zu Grunde liegt, als spezifische Form empraktischen, handlungsbegleitenden Sprechens untersuchen und dabei vor allem fragen, welche Funktionen bestimmte Äußerungs-, genauer Bewertungs-formate im Rahmen empraktischen Sprechens haben. 2.3 Videospiele als Interaktion
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Gemeinsames Videospielen ist eine Aktivität, bei der Kommunikation nur sekundär ist, auch wenn lange Sprechpausen in diesem Korpus nicht vorkommen und verschiedene Untersuchungen zu Videospielen gezeigt haben, wie wesentlich die Kommunikation für die Koordination der Spieler ist (etwa Mondada 2011, 2012, i.Dr.). Die primäre Interaktion erfolgt zunächst über das Spiel, in dem Luc und Raph wechselseitig verschiedene Spieler ihrer Mannschaft bewegen. Alle sprachlichen Aktivitäten sind dieser primären Aktivität untergeordnet. Die Besonderheit des Videospielens besteht zum ersten darin, dass es sich um eine Aktivität handelt, die man nicht nur gemeinsam durchführen kann (wie gemeinsames Fernsehen oder den gemeinsamen Besuch einer Ausstellung), sondern die primär eine gemeinsame Aktivität ist, wenn man von mehreren Spielern ausgeht (wie ‚ein Brettspiel spielen’). Dabei können die Spieler wie beim Brettspiel gegeneinander spielen (wobei der „Gegner“ durchaus abwesend sein kann und die Interaktion dann nur über das Spiel bzw. im Rahmen des Spiels angebotene Kommunikationsmöglichkeiten läuft) oder sie können gemeinsam gegen einen abwesenden „Gegner“ spielen, wie in diesem Korpus. Bei dem Gegner kann es sich um einen menschlichen Gegenspieler handeln oder einen computergenerierten. Zum zweiten handelt es sich um eine komplexe Tätigkeit, da die Videospieler nicht nur verschiedene Fußballspieler im Spiel bewegen (im hier untersuchten Korpus), sondern auch das Videospiel an sich regeln müssen. Dazu gehört sowohl das Bewältigen von technischen und strategischen Fragen bzw. Problemen während des Spiels, als auch das Regeln von Einstellungen zwischen den Matchen. Zum dritten sind in die primäre Aktivität nicht nur die beiden aufgezeichneten Videospieler involviert, die auf dem Bildschirm verschiedene Fußballspieler verkörpern und bewegen, sondern auch - über Internet - andere Videospieler und deren Fußballer. Insofern resultieren bestimmte Konstellationen nicht aus den Handlungen von Luc und Raph bzw. ihrer Fußballspieler. Dennoch sind sie entscheidend für die Interaktion der beiden, und die Videospieler sowie ihre Fußballer agieren dementsprechend. Mondada (2012) spricht für das gleiche Korpus von zwei verschiedenen Interaktionsräumen, die die Sprecher konstruieren und in denen sie sich kommunikativ bewegen: „Out of the game“ liegt der Fokus auf dem Gespräch, man spricht über das Spiel (und über anderes), über Technik, Einstellungen, Strategien etc., „in the game“ müssen verschiedene sprachliche und nichtsprachliche Aktivitäten koordiniert werden (ebd.: 238). Die Interaktionsräume entsprechen dabei nicht immer den jeweiligen Aktivitäten. So kann auch während des Spielens durchaus über Sinn und Unsinn einer Strategie philosophiert, über tatsächliche Fußballer gelästert, können technische Fragen erörtert oder erfolgreiche Aktionen immer wieder angepriesen werden. Mich interessiert hier nur die Interaktion „in the game“. Bereits Mondada (2012, i.Dr.) weißt auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
„Fußballinteraktionen“ wie Kommentare von Reportern (Kern 2010), von Fernsehzuschauern (Gerhardt 2008) oder Schiedsrichtern hin. Besonders in Hinblick auf Kommentatoren und Zuschauer bemerkt sie: „players not only follow moment by moment the unfolding of the game but also actively and reflexively intervene in its emergent configuration“ (2012: 253). Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Spieler „in the game“ vor allem Handlungsanweisungen geben, bewerten, Emotionen äußern oder anfeuern. Im Weiteren sollen nun vor allem die spielbegleitenden Bewertungen näher betrachtet werden. 2.4 Bewertungen während des Videospiels: Diskussion eines Ausschnitts Kommentiert und bewertet werden im Wesentlichen Konstellationen, Handlungen als Teil einer Strategie, Resultate von Spielhandlungen (als erfolgreich oder nicht) und manchmal auch Spielhandlungen (als schön oder nicht schön). Die Bewertungen beziehen sich dabei zum überwiegenden Teil auf Strategien. Sie sind in der Mehrzahl positiv, negative Bewertungen werden meist als Bedauern („oh dommage“/„schade“) oder Fluchen („oh putain“/„scheiße“) ausgedrückt. Neben den in konversationsanalytischen Arbeiten oft beschriebenen Bewertungssequenzen (auf ein und das selbe Objekt bezogene Bewertungen) finden sich sogenannte Bewertungsreihen: mehrere, auf verschiedene Objekte bezogene Bewertungen folgen aufeinander. Ich möchte im Weiteren einen etwas längeren, exemplarischen Ausschnitt einer Bewertungsreihe näher analysieren und dabei zeigen, welche Besonderheiten die Bewertungen aufweisen. Der Ausschnitt aus dem zweiten Match setzt zu Beginn einer neuen Spielsequenz nach einem Einwurf und zu Beginn einer neuen kommunikativen Sequenz ein. Die Transkription ist angelehnt an GAT2 (Selting u.a. 2009)
Beispiel 1 Match2 (00:28:38:25-00:28:51:80) 01 (0.5)
ein Spieler von Luc und ein gegnerischer Spieler kämpfen um den Ball, einer der beiden kickt den Ball weg, ein anderer Spieler von Luc übernimmt ihn
02 RAP .H:: ⇒ 03 LUC oh belle belle belle belle? le contre?
OH SCHÖN SCHÖN SCHÖN SCHÖN? DER ANGRIFF? 04 (0.6)
nach zweimaligem Ballwechsel im Team läuft ein anderer Spieler von Luc ungehindert mit dem Ball in Richtung gegnerisches Tor
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
⇒ 05 LUC oh belle belle? OH SCHÖN SCHÖN? 06 RAP t` es tout seul DU BIST GANZ ALLEIN 07 (0.8)
Spieler ist weiterhin unbehindert, Spieler von Raph läuft parallel zu ihm
⇒ 08 LUC belle belle belle belle belle? SCHÖN SCHÖN SCHÖN SCHÖN SCHÖN? 09 RAP je peux monter? ICH KANN HINKOMMEN? 10 (3.0)
in Höhe des gegnerischen Tors kickt der Spieler von Luc den Ball zu einem anderen Spieler von Luc, der vor dem Tor Position bezogen hat und dabei von einem Gegner gedeckt wird, Gerangel um den Ballbesitz, der gegnerische Spieler kickt den Ball ins Tor und produziert somit ein Eigentor
⇒ 11 LUC OH BELLE [OH BELLE] OH SCHÖN [OH SCHÖN] 12 RAP [OH: YEAH?] [OH: YEAH?]
[Luc und Raph wenden sich einander zu, schauen sich an, geben sich die Hand]
13 LUC J` L'AI CENTRÉ FORT? (.) ICH HAB RICHTIG IN DIE MITTE GESCHOSSEN? (.) Spielpause, jubelnde Spieler umarmen sich 14 LUC j` l'ai centré fort? ICH HAB RICHTIG IN DIE MITTE GESCHOSSEN?
Luc et Raph wenden sich wieder dem Bildschirm zu, die Hände bleiben weiterhin verschränkt
15 (.) In dieser kurzen Spielsequenz bewerten Luc und Raph ihre Spielhandlungen (bzw. die ihrer Spieler) und benutzen dabei verschiedene sprachliche und sprecherische Formate. Im Anschluss an eine Nachverbrennungssequenz äußert Luc zunächst einen Bewertungsausdruck („belle”), den er mehrfach mit kontinuierlich ansteigender Melodie wiederholt. Anschließend präzisiert er, mit noch einmal ansteigender Melodie, das Objekt der Bewertung „le contre” (Z.3). Während der Bewertungsausdruck deutlich auf die gemeinsame primäre Aktivität, also das Spiel und damit auch den Bildschirm orientiert, verlangt der sequenzielle Kontext (und vielleicht auch das Bewertungsobjekt) hier eine
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
genauere Angabe: Die vorangegangenen Äußerungen bezogen sich nicht auf das aktuelle Spielgeschehen, es handelt sich hier also um die Eröffnung einer neuen kommunikativen Sequenz. Außerdem vereindeutigt Luc das Bewertungsobjekt mit dem anschließenden Account: Bewertet wird eine ganz bestimmte Spielhandlung, die zu einem für das Team positiven Resultat geführt hat. Auf diese Äußerung erfolgt keine Antworthandlung von Raph, weder als sprachliche Äußerung (etwa in Form einer zweiten Bewertung), noch als Handlung im Spiel. Wenig später äußert Luc wiederum einen Bewertungsausdruck, wieder mit steigender Intonation, diesmal aber nur einmal wiederholt (Z.5 „oh belle belle?“). Beide Spieler sind jetzt, nicht zuletzt dank der vorangegangenen Bewertung, auch sprachlich auf das aktuelle Spielgeschehen orientiert. Das Bewertungsobjekt wird nicht präzisiert und als „bekannt”, „eindeutig”, „sichtbar” etc. präsentiert. Der Ball befindet sich auch nach zweimaligem Spielerwechsel noch im Besitz des eigenen Teams und Lucs Spieler läuft in Richtung gegnerisches Tor, ohne von einem Gegner behindert zu werden. Raph antwortet diesmal mit einer Beschreibung der für sie favorablen Situation (Z.6 „t’es tout seul“). Diese Antwort zeigt, dass er verstanden hat, was Luc als “belle” bewertet. Insofern ließe sich die kurze Sequenz als kollaborative Turnkonstruktion (Lerner 2004) und Raphs Äußerung als Abschluss der Sequenz interpretieren. Allerdings handelt es sich gleichzeitig um ein Anfeuern, eine Aufforderung, diese favorable Spielsituation zu nutzen. Und in diesem Sinne ist die Äußerung eindeutig vorwärts gerichtet, nicht im Rahmen der Kommunikation, aber im Rahmen des Spiels. Während Lucs Spieler sich weiterhin ungehindert vorwärts bewegt, äußert Luc erneut einen mehrfach wiederholten Bewertungsausdruck mit steigender Endphasenmelodie (Z.8 „belle belle belle belle belle“). Auch hier wird das Bewertungsobjekt als „bekannt” präsentiert und die Aufmerksamkeit auf Bildschirm und Spielgeschehen orientiert. Raph antwortet mit einem die weitere Spielstrategie betreffenden Vorschlag (Z.9 „je peux monter?“). Er antwortet insofern nicht auf die Bewertung, zeigt aber mit seiner Äußerung an, dass er dem Spielgeschehen folgt und damit auch die Bewertung verstanden hat. Sein Vorschlag weist wiederum nach vorn, sowohl im Rahmen der Kommunikation (als erster Teil einer Paarsequenz), als auch im Rahmen des Spiels (als Hinweis auf eine mögliche zu verfolgende Strategie). Luc antwortet nicht auf diesen Vorschlag, weder im Rahmen der Kommunikation, noch im Rahmen des Spiels, sondern spielt den Ball seinem eigenen Spieler zu. Nach dem Eigentor des gegnerischen Spielers äußert Luc lautstark und mit sehr hoher Stimme einen Affektmarker und einen Bewertungsausdruck. Während Luc und Raph bis zu diesem Zeitpunkt unbeirrt auf den Bildschirm schauten, wenden sie sich jetzt einander zu (körperlich, aber auch mimisch und gestisch). Luc wiederholt im Falsett Affektmarker und Bewertungsausdruck (Z.11 „OH BELLE OH BELLE“), Raph bestätigt gleichzeitig und überlappend die
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Bewertung (Z.12 „OH: YEAH?“). Das Spiel geht dabei in eine Pause, die Spieler auf dem Bildschirm bejubeln das erzielte Tor. Luc präzisiert daraufhin, stimmlich etwas tiefer ansetzend, aber mit stark ansteigender Melodie, was seiner Ansicht nach zu diesem Eigentor geführt hat (Z.13 „je l’ai centre fort”). Die Äußerung kann dabei als nachträgliche Präzisierung des Beungsobjekts verstanden werden, jedoch die Wiederholung der Konstruktion „Affektmarker + Bewertungsausdruck”, die parallele, jeweils ansteigende Melodieführung und der prosodische Neuansatz auf tieferem Niveau weisen der Einheit eine größere Eigenständigkeit zu. Luc fokussiert damit seine Spielhandlung als herausragend, der kurz zuvor geäußerte Bewertungsausdruck bleibt bestehen und gilt auch für die nachfolgend explizierte Spielhandlung. Beide Spieler wenden sich wieder dem Bildschirm zu. Luc wiederholt noch einmal die bewertete Handlung, mit der gleichen Melodieführung, aber noch etwas tiefer ansetzend, eine Wiederholung, die sowohl die Handlung, als auch die damit verbundene positive Bewertung verstärkt und seine emotionale Beteiligung deutlich macht (Z.14 „je l’ai centré fort“). Diese ziemlich ausführliche Beschreibung eines für das Korpus durchaus typischen Ausschnitts soll die Aufmerksamkeit auf einige charakteristische Punkte lenken, die einer genaueren Untersuchung bedürfen und auf die in Kapitel 3 detailliert eingegangen wird. Punkt 1) Betrachtet man die sequenzielle Struktur dieses Ausschnitts, fällt auf, dass auf manche Bewertungen keine Antworthandlung erfolgt (Z.4), auf andere erfolgt eine auf das Spiel bezogene Antwort (Z.6 und 9), wieder andere werden bestätigt, allerdings nicht durch das von Pomerantz (1984) beschriebene präferierte up-grading (Z.12). Diese Struktur scheint typisch, nicht nur für das hier untersuchte Korpus, sondern mehr oder weniger ausgeprägt für empraktisches Sprechen im Allgemeinen: Ist Kommunikation nicht die primäre Aktivität, wird nur dann gesprochen, wenn die primäre Aktivität dies erfordert bzw. ermöglicht. Antworthandlungen können a) im Rahmen der primären Aktivität erfolgen, hier zum Beispiel in Form einer bestimmten Spielhandlung, b) nur minimal ausfallen, im Sinne eines „ok, aber ich bin/muss mich auf die primäre Aktivität konzentrieren” oder c) in diesem selben Sinne ganz ausbleiben, ohne dass dies von den Teilnehmern in irgendeiner Form markiert wird. Das hier analysierte Korpus ist durch eine extrem schnelle Temporalität gekennzeichnet, die Situation wechselt ständig, eine Antworthandlung würde oft in einer völlig neuen Spielsituation erfolgen, die ihrerseits bereits wieder die Aufmerksamkeit der Spieler/Sprecher beansprucht (siehe auch Mondada i.Dr.). Gar keine oder eine minimale Antworthandlung wird als präferierte und zustimmende Antwort gewertet, in komplizierteren Konstellationen (etwa präferierte Ablehnung) dagegen oder bei dispräferierten Antworten erfolgt in der Regel eine Antworthandlung (siehe dazu auch Baldauf-Quilliatre i.V.). Dass
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
dies nicht nur auf dieses Korpus und die Spielsituation zutrifft, sondern auch auf andere empraktische Korpora, haben etwa Untersuchungen des Sprechens beim Fernsehen oder beim gemeinsamen Arbeiten am Computer gezeigt (Baldauf 2001, 2002, Baldauf-Quilliatre 2007, 2012). Punkt 2) Betrachtet man die Äußerungsstruktur der Bewertungen hier, fallen vor allem zwei Formate auf, die nach mikrosyntaktischer Beschreibung eigentlich „ungrammatisch“ wären: a) Der Sprecher äußert lediglich einen Bewertungsausdruck, eventuell wiederholt, eventuell eingeleitet durch einen Diskursmarker und mit ansteigender Melodie (Z.5 und 8). b) Der Sprecher äußert zunächst einen Bewertungsausdruck und anschließend ein Bewertungsobjekt, ohne jedoch dieses Objekt direkt dem geäußerten Wert zuzuordnen (Z.3). Bewertungsausdruck, Bewertungsobjekt und Zuordnung stellen laut Hartung (2000: 4) das Kernstück der Bewertungshandlung dar. Während das zweite Format zumindest Bewertungsobjekt und Bewertungsausdruck expliziert, wird im ersten Format nur der Bewertungsausdruck geäußert. Da keine der hier geäußerten Bewertungen von den Beteiligten als problematisch markiert wird, müssen die nicht-explizierten Komponenten der Bewertungshandlung also in irgendeiner Art „mitzuverstehen“ (von Polenz 1988) sein. Beide oben angeführten Formate sind rekurrent. Sie erfüllen beide bestimmte Funktionen, die über den Einzelfall hinaus für diesen Interaktionstyp gelten. Ich möchte sie, ebenso wie ein weiteres rekurrentes Format daher im Folgenden genauer untersuchen und dabei herausstellen, welche strukturellen Besonderheiten sie aufweisen und welche Funktionen sie haben. 3. Formate In den meisten, auch interaktionsanalytischen Arbeiten, werden Formate als syntaktisch-prosodische Struktur und/oder als Besetzung bzw. Nicht-Besetzung bestimmter topologischer Felder beschrieben. Auch wenn dies aus grammatischer Perspektive verständlich ist, scheint es mir aus einer konsequent interaktionsanalytischen Perspektive in die Irre zu führen. Aus zwei Gründen: Zum einen ist die Frage meines Erachtens nicht, welche syntaktisch-prosodischen Elemente/Einheiten expliziert sind, sondern welche Elemente der sprachlichen Handlung geäußert werden. Ich greife hier Überlegungen von Jürgens (1999) auf, der sich auf frames bezieht um zu beschreiben, wie (mit welchen syntaktischen Strukturen) Fußballreporter bestimmte Handlungen der Spieler kommentieren. Zum anderen halte ich es bei empraktischem Sprechen für sinnvoll, die Sprachzentriertheit aufzugeben und nicht zu fragen, was aus welchen Gründen nicht expliziert werden muss. Sinnvoller scheint mir die Frage, was warum an einer bestimmten Stelle sprachlich expliziert wird, eine
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Prämisse, die konsequent an Bühler und den „diakritischen Gebrauch von Sprachzeichen“ (1934/1982: 158) anknüpft. Die beiden bereits erwähnten Äußerungsformate aus Beispiel (1) lasst sich insofern beschreiben als : 1) alleinige Explizierung des Bewertungsausdrucks – dass dies hier in Form eines Adjektivs geschieht, ist zunächst einmal sekundär und 2) Explizierung eines Bewertungsausdruck, anschließend Explizierung des Bewertungsobjekts (Dabei kann das Objekt durch ganz verschiedene syntaktisch-prosodische Strukturen ausgedrückt werden, die mich an dieser Stelle allerdings nur sekundär interessieren.) Ein drittes Format (3), das im oben angeführten Ausschnitt nicht vorkam, jedoch ebenfalls hier betrachtet werden soll umfasst die alleinige Explizierung des Bewertungsobjekts, in allen von mir untersuchten Fällen durch ein nominales oder präpositionales Syntagma. 3.1 Format 1: „Bewertungsausdruck“ Das alleinige Äußern eines Bewertungsausdrucks ist für andere Interaktionstypen und andere kommunikative Gattungen bereits beschrieben worden. Imo (2012: 12) etwa erklärt, dass das gewählte Format vom sequenziellen Kontext abhänge: „Ist der Bezugspunkt für die Bewertung eindeutig erkennbar, wird präferiert das Muster (Gradpartikel) + Adjektiv eingesetzt.“ Chauvin (2011 und 2012), die sich für Bewertungsausdrücke dieser Art im Englischen interessiert, stellt fest, dass sich diese Ausdrücke immer auf die Gesamtheit dessen beziehen, was zuvor gesagt wurde, also etwa den gesamten Turn (und nicht nur auf ein Element der Äußerung). Es handele sich um „holistische Bewertungen“, die die „allgemeine Situation“ oder die „gesamte Prädikation“ betreffen (2012: 22). Betrachtet man zunächst das folgende Beispiel (kurz nach dem oben diskutierten Ausschnitt), bestätigen sich diese Beobachtungen.
Beispiel 2 Match2 (00:29:31:20-00:29:36:70) 01 (0.6)
gegnerische Spieler sind im Ballbesitz und bewegen sich in Richtung Tor, Spieler gibt Ball ab, Spieler von Luc fängt den Ball ab
⇒ 02 RAP bien? GUT? 03 (.)
Spieler von Raph behindert Spieler von Luc, beide stoßen fast aneinander
04 RAP i:? I:?
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
05 (0.2) Spieler von Luc setzt seinen Lauf mit dem Ball fort
⇒ 06 RAP bien bien bien. GUT GUT GUT. 07 (3.2)
Raphs Bewertungen in Zeile 2 und 6 lassen sich jeweils auf unmittelbar vorangegangene Spielhandlungen bzw. deren Resultate beziehen: das Abfangen des Balls (und damit einen Wechsel im Ballbesitz zu Gunsten des eigenen Teams) in Zeile 2, das Sich-Nicht-Behindern-Lassen trotz schlechter Koordination (und damit das Beibehalten der favorablen Situation) in Zeile 6. Der Bezugspunkt ist, wie Imo (2012: 12) sagt, „eindeutig erkennbar“. Allerdings ist er nur dann eindeutig erkennbar, wenn alle Teilnehmer den gleichen Fokus haben, zumal es sich nicht um ein bereits geäußertes und damit in der Kommunikation präsentes Bewertungsobjekt handelt. Dass gemeinsame Orientierung nicht selbstverständlich ist, sondern erst hergestellt werden muss, hat Hausendorf (2010) sehr eindrücklich veranschaulicht. Eine gemeinsame Aktivität kann diese gemeinsame Orientierung nun erleichtern – weil der Fokus aller Teilnehmer auf der primären Aktivität (hier dem Videospielen) liegt. Es kann sie aber auch erschweren – weil die Teilnehmer im Rahmen der primären Aktivität möglicherweise unterschiedliche Dinge tun und daher Unterschiedliches wahrnehmen und fokussieren (wenn etwa der eine noch beim Nachverbrennen einer vorangegangenen Handlung/Strategie ist, während der andere sich bereits wieder dem aktuellen Spiel zugewendet hat). Das Format dient daher auch dazu, diese gemeinsame Orientierung herzustellen, dem Partner anzuzeigen, dass man jetzt wieder auf die primäre Aktivität fokussiert ist. In diesem konkreten Fall heißt das: Raph setzt mit diesem Format nicht nur einen bestimmten Fokus voraus, er orientiert seinen Partner durch das alleinige Explizieren des Bewertungsausdrucks auf den Bildschirm und das aktuelle Spiel. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Während in Interaktionen, in denen die Kommunikation primär ist, auf eine sprachliche Bewertung meist auch mit einer sprachlichen Bewertung geantwortet wird, ist dies bei empraktischem Sprechen nicht der Fall. Dabei müssen die einzelnen Teilnehmer die Situation nicht gleich einschätzen, wie die Untersuchungen zum gemeinsamen Fernsehen gezeigt haben (Holly/Baldauf 2001). Das gewählte Format zeigt insofern auch an, ob der Sprecher der Kommunikation das Primat gibt oder der anderen gemeinsamen Aktivität, ob er eine sprachliche Antworthandlung erwartet oder nicht. Stivers/Rossano (2010) haben für Konversationen festgestellt, dass „whereas most of the time first assessments [...] are responded to with a secon assessment or an agreement, it is not difficult to find a) instances without response where b) this is treated by both participants as unproblematic“ (ibid.:
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
10). Sie untersuchten dahingehend englische Bewertungsäußerungen hinsichtlich ihres turn designs und kamen zu dem Schluss, dass bestimmte Eigenschaften des Formats Antworthandlungen initiieren und verlangen, während andere dies nicht oder weniger tun: „[...] when a speaker designs an assessment with interrogative morphology or syntaxe, interrogative intonation, as within the recipient’s domain of epistemic expertise or with gaze toward the recipient, then s/he holds the recipient more accountable for not responding than without these features“ (ibid.: 16). Diese grundsätzliche Beobachtung wird hier bestätigt und trifft auf empraktisches Sprechen sicher noch mehr zu als auf Konversationen (siehe dazu auch Baldauf 2001). Nur in einigen wenigen Fällen erfolgt auf Bewertungen mit diesem Format eine tatsächliche Antworthandlung, das heißt eine Handlung, die auf die Bewertung reagiert (etwa im Sinne einer zweiten Bewertung). Dies ist der Fall im folgenden Ausschnitt, in dem Luc der positiven Bewertung von Raph widerspricht (Z.4).
Beispiel 3 Match3 (00:39:41:40-00:39:46:50) 1 (1.6) (00:39:41:40) Spieler von Luc nimmt gegnerischen Spieler den Ball
ab und kickt ihn weit in Richtung gegnerisches Tor 2 RAP bien. GUT. 3 (0.2) kein Spieler des Teams befindet sich in der Nähe des
Balls, Ball wird von gegnerischem Spieler aufgenommen
⇒ 4 LUC NAN. DÉSOLÉ:? ((rit)) NEIN TU MIR LEID:? ((LACHT)) 5 RAP bon on t'excuse. OKAY ENTSCHULDIGUNG ANGENOMMEN 6 (2.0) (00:39:46:50)
Bei allen Antworthandlungen handelt es sich, wie hier (Z.4) um dispräferierte, der ersten Bewertung widersprechende Antworten. Betrachtet man die syntaktisch-prosodische Realisierung der ersten Bewertungen in Beispiel 1, 2 und 3 fällt zunächst Folgendes auf: 1) Der Wert wird in jedem Fall ausgedrückt durch ein Adjektiv mit dem Sem /positiv bewertend/ (Subjektiveme nach Kerbrat-Orecchioni 1980). Negative Bewertungen gibt es weder in diesem, noch in anderen vergleichbaren, daraufhin untersuchten Korpora. 2) Das Adjektiv findet sich in unterschiedlichen Formen, einzeln oder mehrfach wiederholt, als Adverb oder als qualifizierendes Adjektiv in femininer Form.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Dabei verweist die syntaktische Form auf verschiedene Typen von Bewertungsobjekten: Während mit „bien“ Situationen, Strategien oder Resultate von Handlungen bewertet werden, bezieht sich „belle“ überwiegend auf Handlungen oder Strategien. Insofern trifft Chauvins These, dass es sich bei diesem Format um ein holistisches, auf die gesamte Situation bezogenes Werturteil handele, für das Französische nur bedingt zu. Man könnte hier mit von Polenz (1988: 27) von einer kompakten Ausdrucksweise sprechen: das nicht explizit Ausgedrückte ist zumindest teilweise „nicht neben dem Ausgedrückten weggelassen, sondern im Ausgedrückten selbst hintergründig mitenthalten“. Die syntaktische Form verweist auf eine bestimmte Art von Bewertungsobjekt (siehe dazu auch Baldauf-Quilliatre i.Dr. und i.V.). 3) Das Format wird auf verschiedene Weise stimmlich-artikulatorisch realisiert. Dabei scheinen mir für dieses Korpus vor allem drei Muster wesentlich: a) ein eindeutig rückwärts gerichtetes BEWERTEN mit fallender Melodie und eher tiefem Stimmeinsatz, gleichbleibender oder abnehmender Lautstärke, geringer oder abnehmender Artikulationsspannung (wobei nicht alle Parameter in gleicher Intensität auftreten müssen), b) ein in Hinblick auf das Spiel eher vorwärts gerichtetes ANSPORNEN und ANFEUERN mit progredienter oder steigender Endphasenmelodie, eher tiefem Stimmeinsatz, gleichbleibender oder ansteigender Lautstärke und eher gespannter Artikulation und c) ein SICH BEGEISTERN, das als Bewertung im Spiel rückwärts gerichtet ist, als interaktionales Konstrukt aber eine Antworthandlung im Rahmen der Kommunikation projiziert und prosodisch mit steigender Melodie, hohem bis sehr hohem Stimmeinsatz, hoher Lautstärke, hoher Artikulationsspannung und sehr starker Akzentuierung realisiert wird. 3.2 Format 2: „Bewertungsausdruck + Bewertungsobjekt“ Das zweite Format besteht aus den Konstituenten ‚Bewertungsausdruck’ und ‚Bewertungsobjekt’, wobei zunächst der Bewertungsausdruck und erst als danach das Bewertungsobjekt geäußert werden. In Hinblick auf die Prämisse, dass man nur das expliziert, was notwendig ist, stellt sich hier die Frage, unter welchen Bedingungen es notwendig ist, das Bewertungsobjekt an zweiter Stelle zu präzisieren, und zwar unabhängig von der Art des Syntagmas und unabhängig davon ob es sich um eine syntaktisch „normgerechte“ („bien joué“/„gut gespielt“) oder „nicht normgerechte“ („bien la tête“/„gut der Kopfball“)) Struktur handelt. Das Format kann aus einer Einheit (turn construction unit) bestehen, die Werturteil und Bewertungsobjekt zusammenfasst oder aus zwei Einheiten, das heißt das Bewertungsobjekt wird als Account, als neue Einheit präsentiert. Das folgende Beispiel zeigt beide Varianten.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Beispiel 4 Match5 (01:10:18:00-01:10:21:70)
01 (1.4) gegnerischer Torhüter wirft den Ball ins Spiel zurück, Spieler von Luc fängt ihn ab und kickt ihn per Kopfball zu einem Spieler von Raph
⇒ 02 RAP [BIEN la tête;] [GUT DER KOPFBALL;] 03 LUC [allez ] [KOMM ] Spieler von Raph empfängt den Ball 04 (1.4)
Spieler von Raph läuft mit dem Ball los und zwischen zwei gegnerischen Spielern durch
⇒ 05 RAP bien, entre les deux, GUT, ZWISCHEN DEN BEIDEN, 06 (0.5) 07 RAP oui JA 08 (.)
In Zeile 2 bewertet Raph den Kopfball eines Spielers von Luc, mit dem er den Ball abfängt und wegkickt. In Zeile 5 bewertet er die Agilität seines eigenen Spielers, der mit dem Ball zwischen zwei gegnerischen Spielern durchläuft. Im ersten Fall handelt es sich um eine syntaktisch-prosodische Einheit (ein Akzent auf „BIEN“, eine Intonationskurve mit fallender Endphasenmelodie, keine Pause usw.), im zweiten Fall legt die prosodische Realisierung zwei Einheiten nahe, die Äußerung einer Bewertung „bien“ und eine ergänzende Präzisierung (zwei Akzente und zwei parallele Intonationskurven). In beiden Fällen stellt sich nun die Frage, welche Funktion an dieser Stelle das Explizieren des Bewertungsobjekts hat. Ein Vergleich mit den zuvor diskutierten Beispielen zeigt, dass die Bewertung hier entweder den Beginn einer neuen kommunikativen Sequenz markiert (Z.2) oder aber ein ganz konkretes Element bewertet wird (Z.5). Beide Situationen sind typisch für dieses Format: Bewertungen zu Beginn einer neuen Spielsequenz oder einer neuen kommunikativen Sequenz (hier hatte nach dem Einwurf eine neue Spielsequenz begonnen, die Sprecher sind jedoch noch beim Bewerten und Nachverbrennen vorangegangener Spielhandlungen) bedürfen wohl einer genaueren Präzisierung (siehe dazu auch Mondada 2012). Erst im Anschluss, wenn nämlich etabliert ist, dass man jetzt das aktuelle Spiel kommentiert, können Handlungen, Resultate, Strategien oder Situationen nur durch Explizieren des Bewertungsausdrucks bewertet werden. Dies zeigt sich deutlich auch in Beispiel (1). Der Ausschnitt
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
beginnt nach einer Nachverbrennungssequenz und Luc orientiert auf das aktuelle Spiel und auf das Bewerten des aktuellen Spiels (Z.3). Dabei expliziert er in einem zweiteiligen Turn zunächst den Bewertungsausdruck und ergänzt anschließend das Bewertungsobjekt („oh belle belle belle belle le contre“). Im weiteren Verlauf werden jeweils andere Spielsituationen bewertet, die Aktivität ‚Bewerten (oder allgemeiner Kommentieren) des aktuellen Spiels’ ist jedoch etabliert und das Explizieren des Bewertungsausdrucks reicht zum einen aus und kontextualisiert zum anderen die Kommunikation als der primären Aktivität nachgeordnet (Z.5 „oh belle belle“, Z.8 „belle belle belle belle belle“, Z.11 „oh belle“). Wenn auch im vorangegangen Kapitel darauf hingewiesen wurde, dass das Französische dem Format „Bewertungsausdruck“ mehr als nur die holistische Bewertung einer allgemeinen Situation erlaubt, wird das Format „Bewertungsausdruck + Bewertungsobjekt“ dann benutzt, wenn das Bewertungsobjekt genauer identifiziert werden soll. So lässt sich in Beispiel (4) der Bewertungsausdruck „bien“ (Z.5) auf das Annehmen des Kopfballs beziehen, die Ergänzung „entre les deux“ erlaubt es aber auf einen spezifischen Aspekt hinzuweisen – dass nämlich Raph den Ball in einer gefährlichen Situation angenommen hat und dass er geschickt mit dem Ball zwischen seinen beiden Gegnern durchgelaufen ist. Je konkreter bewertet werden soll, desto wichtiger wird wohl das Explizieren des Bewertungsobjekts. Insofern finden sich bei diesem Format in meinem Korpus auch keine Mehrdeutigkeiten zwischen Bewerten und Anfeuern wie bei Format (1): Eine solche Bewertung ist immer Bewertung und in keinem Fall im Spiel vorwärts gerichtetes Anfeuern. Dies zeigt sich besonders dann, wenn das Bewertungsobjekt ebenfalls sehr vage durch ein Verb geäußert wird.
Beispiel 5 Match4 (01:01:13:40-01:01:20:40)
1 Einwurf von Spieler von Raph, zu Spieler von Luc 2 RAP à van nistelrooy, ZU VAN NISTELROY, 3 (0.4)
Gegner fängt Ball per Kopfball ab, kickt ihn weg zu anderem Gegner
4 RAP domma::ge; SCHA::DE; 5 (2.2)
Gegner läuft mit Ball zu anderem gegnerischem Spieler, Spieler von Luc fängt Ball ab und kickt ihn zu anderem Spieler von Luc, der übernimmt,
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
ändert die Richtung und läuft mit dem Ball in Richtung gegnerisches Tor
⇒ 6 RAP bien joué:, GUT GESPIELT, 7 (1.1) Spieler von Luc wird von Gegnern bedroht 8 RAP là bas, DORT,
Raph bewertet in Zeile 6 das Spiel von Luc, der zwei Spielern der gegnerischen Mannschaft den Ball wieder abnimmt. Die Präzisierung „joué“ erlaubt es dabei, genauer auf die Strategie und ihre gelungene Ausführung zu verweisen. Deutlich wird aber vor allem, dass der Sprecher hier die gerade ausgeführten Spielhandlungen bewertet und nicht zum Weitermachen in diesem Sinne anspornt. Die hier und in Hinblick auf dieses Korpus beschriebenen Funktionen lassen sich in ähnlicher Form auch in anderen Korpora empraktischen Sprechens wiederfinden. Das Format „Bewertungsausdruck + Bewertungsobjekt“ orientiert ebenso auf die primäre Aktivität wie das Format „Bewertungsausdruck“, fokussiert dabei jedoch entweder ein ganz konkretes Bewertungsobjekt oder es etabliert zu Beginn einer neuen interaktiven oder kommunikativen Sequenz einen bestimmten Handlungstyp: Bewerten/Kommentieren der gegenwärtigen primären Aktivität. 3.3 Format 3: „Bewertungsobjekt“ Während die Bewertungen in den vorangegangenen Beispielen vor allem den Wert fokussierten, stellt das dritte untersuchte Format das Bewertungsobjekt in den Vordergrund, eine Möglichkeit, die meines Wissens bisher nur ansatzweise berücksichtigt wurde (etwa Baldauf 2002 und Baldauf-Quilliatre 2012 für das fernsehbegleitende Sprechen). Imo (2012) hat drei verschiedene syntaktische Bewertungsformate beschrieben: „(Gradpartikel) + Adjektiv“, „Gradpartikel“ und „Kopulasatz“. Er geht – für primär sprachliche Interaktionen – davon aus, dass nur das expliziert wird, was nicht bereits vorher erwähnt wurde bzw. was nicht eindeutig zu erkennen ist. Nun ist dies bei empraktischem Sprechen insofern anders, als eine andere gemeinsame Aktivität als die Kommunikation im Mittelpunkt steht und die Teilnehmer auf diese gemeinsame Aktivität orientiert sind. Außerdem findet sich dieses Format durchaus als erste Bewertung, dem keine andere Bewertung des gleichen Objekts und damit auch kein Bewertungsausdruck vorangegangen ist. Wenn ein Bewertungsausdruck nicht expliziert wird, so muss man in jedem Fall davon ausgehen, dass die Bewertung (d.h. der Bewertungsausdrucks) den
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
anderen Teilnehmern bekannt ist, sofern sie nicht anderweitig, also gestisch, mimisch, körperlich etc. geäußert wird (wie z.B. bei Fasulo/Monzoni 2009). Allerdings bedeutet dies nicht, zumindest nicht bei empraktischem Sprechen, dass sie zuvor erwähnt wurde. Im folgenden Beispiel bewertet Luc einen Kopfball seines Spielers, der allerdings nicht zu dem anvisierten Resultat geführt hat.
Beispiel 6 Match1 (00:16:16:40-00.16.23.30) 1 Einwurf Spieler von Raph 1 RAP ah si; AH DOCH; 2 (1.1)
gegnerischer Spieler ist dabei, den Ball zu übernehmen, Spieler von Luc fängt ihn durch Kopfball ab und kickt den Ball in Richtung gegnerisches Tor, Ball wird von Torhüter abgefangen
⇒ 3 LUC OH::: la tête.= OH::: DER KOPFBALL.= 4 RAP =mai:s sur coup franc y a hors jeu; =ABER NACH FREISTOß IST ER IM ABSEITS; 5 (0.3) 6 LUC euh:: ah bon? ÄH:: ACH SO? 7 RAP ah oui autant qu` sur corner;
AH JA SO WIE BEI ECKE; 8 (0.7)
Lucs Äußerung „OH::: la tête“ (Z.3) wird von seinem Partner auch ohne Bewertungsausdruck als positive Bewertung verstanden, denn dieser antwortet mit einer Zurückweisung (Z.4). Das Nicht-Explizieren des Bewertungsausdrucks ist nur dann möglich, wenn aus Sicht des Sprechers alle Teilnehmer die Bewertung kennen und teilen. In diesem Fall sind es Kenntnisse über Fußball, über Regeln, Strategien und Handlungen der Fußballspieler, die notwendig sind um zu verstehen, dass das Abfangen eines Balls durch einen Kopfball an sich eine herausragende und positiv zu bewertende Leistung ist, unabhängig davon ob es dadurch gelingt, ein Tor zu erzielen oder nicht. Zwar widerspricht Raph im Weiteren der positiven Bewertung, bezieht sich dabei jedoch nicht auf den Kopfball an sich, dessen positiver Wert nicht in Frage gestellt wird (Z.4). Zudem war Raphs Einwand für Luc nicht erwartbar, wie seine Anerkennung des Einwands (Z.6) deutlich macht.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Das Format setzt also Kenntnisse über die Bewertung voraus, sei es auf Grund von Wissen über die primäre Aktivität (wie in Beispiel (6)) oder aufgrund von Wissen über den Partner (etwa Baldauf-Quilliatre 2012). Gleichzeitig unterscheidet es sich von der Bewertung durch Diskursmarker (ICOR 2010, i.Dr.) oder interjektionsartige Lautobjekte (Reber 2012), also sogenannte minimale Äußerungen (Baldauf 2001, 2002) durch das Fokussieren des Bewertungsobjektes. Luc verweist in Beispiel (6) ganz explizit auf den Kopfball, im folgenden Beispiel verweisen beide Sprecher explizit auf die Latte des Tores.
Beispiel 7 Match1 (00:04:57:90-00:05:07:60) 01 (4.1)
Spieler von Raph spielt Ball zu Spieler von Luc, der sich direkt vor dem gegnerischen Tor befindet, Spieler von Luc schiesst Ball in Richtung Tor
02 LUC OUI? JA? 03 (.) Ball trifft Latte des Tores und prallt ab
⇒ 04 LUC [OUH:: LE POTEAU] [OUH:: DIE LATTE] 05 RAP [OUH:: LE POTEAU] [OUH:: DIE LATTE] 06 (0.2) 07 LUC LE POTEAU= DIE LATTE 08 RAP =oh le [poteau] =OH DIE [LATTE] 09 LUC [oh nan] [OH NEIN] 10 (0.5) 11 LUC oh putain OH SCHEISSE 12 (1.4)
In diesem Ausschnitt bewerten die Sprecher in einer ganzen Sequenz den Schuss gegen das Tor und verweisen dabei immer wieder auf „le poteau“. Die Bewertung an sich bereitet den Teilnehmern auch hier keine Probleme, obwohl an keiner Stelle der Bewertungsausdruck expliziert wird. Ähnlich wie „OH::: la tête“ in Beispiel (6) bewerten die Äußerungen in Zeile 4, 5, 7 und 8 nicht nur, sondern stellen das Bewertungsobjekt explizit in den Mittelpunkt der
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Betrachtung, ja zeigen auf es. Der Äußerung kommt somit eine „deiktische Funktion“ (Hausendorf 2003) zu, auch wenn sie keine Deiktika enthält. Graumann (1994) spricht in diesem Zusammenhang vom „Zeigen im Nennen“. Die Bewertung bleibt implizit und wird damit sekundär. Explizit und primär ist das Aufmerksam-Machen, die gemeinsame Orientierung auf etwas ganz bestimmtes. In Beispiel (7) geht es meines Erachtens weniger darum, den Schuss gegen die Torlatte zu bewerten, sondern vielmehr darum, ihn als in irgendeiner Form „bemerkenswert“ herauszustellen – wobei dieses Herausstellen natürlich immer mit einer Bewertungshandlung verbunden ist. Das Herausstellen des Kopfballs (Beispiel (6)) oder der Torlatte (Beispiel (7)) als „bemerkenswert“ zeigt sich in der Gestaltung der Äußerungen, in der Fokalisierung auf das Bewertungsobjekt. Fehlender Widerspruch und Übernahme der gleichen syntaktischen Form in Beispiel (7) verweisen dabei auf Zustimmung. 4. Schlussbetrachtung Die Untersuchungen und Analysen haben gezeigt, dass die Wahl eines Äußerungsformats nicht zufällig ist, sondern an die Interaktionssituation angepasst wird. Dabei lassen sich durchaus rekurrente und regelhafte Strukturen finden, denen bestimmte Funktionen im Rahmen eines Interaktionstyps zugeschrieben werden können. Meine Untersuchungen konzentrieren sich dabei auf empraktisches, handlungsbegleitendes Sprechen. Wenn Sprechen sekundär und begleitend ist, werden Funktionen zentral, die in anderen Interaktionssituationen nur peripher eine Rolle spielen, etwa das Herstellen einer gemeinsamen Orientierung oder das Aushandeln, ob jemand sprechen darf oder nicht. Die drei hier beschriebenen Äußerungsformate haben jeweils eine spezifische Funktion in diesem Rahmen: Sie fokalisieren ein Element, setzen damit aber nicht unbedingt andere als bekannt voraus, sondern lenken vielmehr die Aufmerksamkeit ihrer Interaktionspartner in eine bestimmte Richtung und/oder zeigen an, inwiefern sie eine Antworthandlung erwarten oder nicht. Ich plädiere dafür, diese Formate nicht primär syntaktisch zu bestimmen, sondern pragmatisch-semantisch, als Komponenten eines bestimmten Handlungstyps. Meine Untersuchung zeigt am Beispiel von Bewertungen, dass eine solche Vorgehensweise eine anschließende syntaktisch-prosodische Bestimmung keinesfalls ausschließt, dass sie jedoch zunächst den Vorteil hat, konsequent von der Handlung auszugehen und den Blick nicht durch syntaktische Normen zu verstellen. Argumentiert wird ebenso konsequent, warum in einer bestimmten Situation welche Komponenten der Handlung geäußert werden müssen – und nicht, warum welche syntaktischen Einheiten nicht expliziert sind.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Die drei im Detail analysierten Bewertungsformate sind rekurrente Strukturen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie „knapp“ (Baldauf 2002) sind, das heißt, nicht alle zentralen Komponenten der Handlung BEWERTEN sind expliziert. Syntaktisch-prosodisch werden diese Formate durch bestimmte, regelhaft gebildete Muster realisiert, von denen einige hier beschrieben wurden. Ihre genaue Bestimmung im Rahmen einer interaktionalen Linguistik steht erst am Anfang. Bibliographie Auer, Peter (2007): Syntax als Prozess. In: Hausendorf, Heiko (Hg.)(2007):
Gespräch als Prozess. Linguistische Aspekte der Zeitlichkeit verbaler Interaktion. Tübingen: Narr, 95-142.
Baldauf, Heike (2001): Strukturen und Formen des Fernsehbegleitenden Sprechens. In: Holly, Werner / Püschel, Ulrich / Bergmann, Jörg (Hg.)(2001): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Opladen: WV, 61-82.
Baldauf, Heike (2002): Knappes Sprechen. Tübingen: Niemeyer. Baldauf, Heike (2007): L’organisation verbale du travail: formes et fonctions.
In: Behr, Irmtraud u.a. (Hg.)(2007): Langue, économie, entreprise. Le travail des mots. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 217-232.
Baldauf-Quilliatre, Heike (2012): „Das ist X“: Ein Format expliziter Bewertungen und seine Varianten. In: Zukunftsfragen der Germanistik. Beiträge der DAAD-Germanistentagung 2011 mit den Partnerländern Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, hrsg. vom DAAD. Göttingen: Wallstein, 210-224.
Baldauf-Quilliatre, Heike (i.Dr.): Knappe Bewertungen im empraktischen Sprechen. Vom Nutzen und Nachteil der „Ellipse“ für die Analyse. In: Marillier, Jean-François / Vargas, Elodie (Hg.): Fragmentarische Äußerungen. Tübingen: Stauffenburg.
Baldauf-Quilliatre, Heike (in Vorb.): Les énoncés évaluatifs du type „adjectif“ en allemand et en français dans des paroles empratiques. In: Diao-Klaeger, Sabine / Thoerle, Britta (Hg.): Linguistique interactionnelle contrastive. Tübingen: Narr.
Brünner, Gisela (1987): Kommunikation in institutionellen Lehr-Lern-Prozessen. Tübingen: Narr.
Bühler, Karl (1934/1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart, New York: Fischer.
Chauvin, Catherine (2011): Existe-t-il des constructions averbales? Le cas des énoncés évaluatifs avec adjectif de type „Great!“ en anglais. In: Lefeuvre, Florence / Behr, Irmtraud (Hg.)(2011): Les énoncés averbaux entre grammaire et discours. Paris: Ophrys, 137-149.
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Chauvin, Catherine (2012): Enoncés sans sujet et/ou sans verbe en anglais et fonction expressive: évaluation/expressivité, structuration de l’énoncé/expressivité. In: Paulin, Catherine (Hg.)(2012): La fonction expressive. Vol.1 Dijon: PUF de Franche Comté, 13-26.
Deppermann, Arnulf (2006): Construction Grammar – Eine Grammatik für die Interaktion? In: Deppermann, Arnulf / Fiehler, Reinhard / Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.)(2006): Grammatik und Interaktion. Untersuchungen zum Zusammenhang von grammatischer Struktur und Interaktionsprozessen. Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung, 43-65 [www.verlag-gespraechsforschung.de].
Deppermann, Arnulf (2007): Grammatik und Semantik aus gesprächsanalytischer Sicht. Berlin, New York: de Gruyter.
Deppermann, Arnulf / Fiehler, Reinhard / Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.)(2006): Grammatik und Interaktion. Untersuchungen zum Zusammenhang von grammatischer Struktur und Interaktionsprozessen. Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung [www.verlag-gespraechsforschung.de].
De Stefani, Elwys / Mondada, Lorenza (2007): L’organizzazione multimodale e interazionale dell’orientamento spaziale in movimento. In: Bulletin VALS-ASLA 85, 131-159.
Fasulo, Alessandra / Manzoni, Chiara (2009): Assessing Mutable Objets: A multimodal Analysis. In: Mondada, Lorenza / Lindström, Anna (Hg.)(2009): Assessments in Social Interaction. Research on Language & Social Interaction. Special Issue. 42/4, 362-379.
Fiehler, Reinhard (1993): Spezifika der Kommunikation in Kooperationen. In: Schröder, Hartmut (Hg.)(1993): Fachtextpragmatik. Tübingen: Narr, 343-357.
Gerhardt, Cornelia (2008): Turn-by-turn and move-by-move. A multimodal analysis of English life television football commentary. In: Lavric, Eva u.a. (Hg.)(2008): The linguistics of football. Tübingen: Narr, 288-299.
Goodwin, Charles (2000): Action and embodiment within situated human interaction. In: Journal of Pragmatics 32/10, 1489-1522.
Graumann, Carl Friedrich (1994): Wieviel Zeigen steckt im Nennen? Zur Situiertheit des Sprachgebrauchs. In: Konradt, Hans-Joachim u.a. (Hg.)(1994): Sprache und Kognition. Perspektiven moderner Sprachpsychologie. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 55-69.
Günthner, Susanne (2009): Konstruktionen in der kommunikativen Praxis. Zur Notwendigkeit einer interaktionalen Anreicherung konstruktionsgrammatischer Ansätze. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 37, 402-426.
Günthner, Susanne (2011): Aspekte einer Theorie der gesprochenen Sprache – ein Plädoyer für eine praxisorientierte Grammatikbetrachtung. WWU
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Münster, Gidi-Arbeitspapier n°32 [http://noam.uni-muenster.de/gidi/arbeitspapiere/arbeitspapier32.pdf].
Günthner, Susanne / Imo, Wolfgang (Hg.)(2006): Konstruktionen in der Interaktion. Berlin, New York: de Gruyter.
Günthner, Susanne / Bücker, Jörg (Hg.)(2009): Grammatik im Gespräch: Konstruktionen der Selbst- und Fremdpositionierung. Berlin, New York: de Gruyter.
Hartung, Martin (2000): Überlegungen zur Untersuchung von Bewertungsprozessen in Gesprächen.“ In: Warnke, Ingo (Hg.)(2000): Schnittstelle Text:Diskurs. Frankfurt: Lang, 119-131 [zit. nach http://www.gespraechsforschung.de/preprint/bewerten.pdf]
Hausendorf, Heiko (2003): Deixis and speech situation revisited: The mechanism of perceived perception.“ In: Lenz, Friedrich (Hg.)(2003): Deictic conceptualization of space, time and person. Amsterdam: Benjamins, 249-269
Hausendorf, Heiko (2010): Interaktion im Raum. Interaktionstheoretische Bemerkungen zu einem vernachmlässigten Aspekt von Anwesenheit. In: Deppermann, Arnulf / Linke, Angelika (Hg.)(2010): Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton. Berlin, New York: de Gruyter, 163-198.
Heath, Christian / Luff, Paul (2000): Technology in Action. Cambridge: Univ. Press.
Heath, Christian / Knoblauch, Hubert / Luff, Paul (2000): Technology and Social Interation: The emergence of ‚workplace studies’. In: British Journal of Sociology 51/2, 299-320.
Holly, Werner / Baldauf, Heike (2001): Grundlagen des fernsehbegleitenden Sprechens. In: Holly, Werner / Püschel, Ulrich / Bergmann, Jörg (Hg.)(2001): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Opladen: WV, 41-60.
ICOR (M. Bert, S. Bruxelles, C. Etienne, L. Mondada, S. Teston, V. Traverso)(2008): „Oh::, oh là là, oh ben...“, les usages du marqueur „oh“ en français parlé en interaction. In: Durand Jacques / Habert Benoït / Laks Bernard (Hg.)(2008): Congrès Mondial de Linguistique Française CMLF'08. Paris: Institut de Linguistique Française [http://www.linguistiquefrancaise.org].
ICOR (H.Baldauf-Quilliatre, S. Bruxelles, S. Diao-Klaeger, E. Jouin-Chardon, S.Teston-Bonnard, V. Traverso)(i.Dr.): Oh là là: the contribution of the multimodal database CLAPI to the analysis of spoken French. In: Tyne, Henry u.a. (Hg.): Ecological and Data-driven perspectives in French Language Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00765855].
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
Imo, Wolfgang (2012): Ellipsen, Inkremente und Fragmente aus interaktionaler Perspektive. WWU Münster, Gidi-Arbeitspapier n°45 [http://noam.uni-muenster.de/gidi/arbeitspapiere/arbeitspapier45.pdf].
Jürgens, Frank (1999): Auf dem Weg zu einer pragmatischen Syntax. Eine vergleichende Fallstudie zu Präferenzen in gesprochen und geschrieben relaisierten Textsorten. Tübingen: Niemeyer.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1980): L’énonciation – De la subjectivité dans le langage. Paris: Armand Colin.
Kern, Friederike (2010): Speaking dramatically: The prosody of life radio commentary of football matches. In: Barth-Weingarten, Dagmar / Selting, Margret (Hg.)(2010): Prosody in Interaction. Amsterdam: Benjamins, 217-238.
Lerner, Gene (2004): Collaborative Turn Sequences. In: Lerner, Gene (Hg.)(2004): Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam: Benjamins, 225-256.
Liedtke, Frank (2007): Wie wir Fragmentarisches verstehen. In: Hermanns, Fritz / Holly, Werner (Hg.)(2007): Linguistische Hermeneutik. Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens. Tübingen: Niemeyer, 59-99.
Mondada, Lorenza (2006): Interactions en situations professionnelles et institutionnelles: de l’analyse détaillée aux retombées pratiques. In: Revue française de linguistique appliquée 2/XI, 5-16.
Mondada, Lorenza (2009): Emergent focused interactions in public places: A systematic analysis of the multimodal achievement of a common interactional space. In: Journal of Pragmatics 41, 1977-1999.
Mondada, Lorenza (2011): The Situated Organisation of Directives in French. Imperatives and Action Coordination in Video Games. In: Nottingham French Studies 50/2, 19-50.
Mondada, Lorenza (2012): Coordinating action and talk-in-interaction in and out of video games. In: Ayass, Ruth / Gerhardt, Cornelia (Hg.)(2012): The Appropriation of Media in Everyday Life. Amsterdam: Benjamins, 231-270.
Mondada, Lorenza (i.Dr.): Coordinating mobile action in real time: The timely organization of directives in video games. In: Haddington, Pentti / Mondada, Lorenza / Nevile, Maurice (Hg.): Mobility and Interaction. Berlin: de Gruyter.
Mondada, Lorenza / Lindström, Anna (Hg.)(2009a): Assessments in Social Interaction. Research on Language & Social Interaction. Special Issue. 42/4
Mondada, Lorenza / Lindström, Anna (Hg.)(2009b): Assessments in Social Interaction. Introduction tot he Special Issue. In: Mondada, Lorenza / Lindström, Anna (Hg.)(2009): Assessments in Social Interaction. Research on Language & Social Interaction. Special Issue. 42/4, 299-304
In: Schwarze, Cordula / Konzett, Carmen (Hg.)(2014): Interaktionsforschung: Gesprächsanalytische Fallstudien und Forschungspraxis. Berlin: Frank & Timme
O’Connell, Daniel / Kowal, Sabine (2012): Dialogical Genres. Empractical and Conversational Listening and Speaking. New York, Heidelberg: Springer.
Polenz, Peter von (1988): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin: de Gruyter.
Pomerantz, Anita (1984): Agreeing and disagreeing with assessments: some preferences of preferred / dispreferred turn shapes. In: Atkinson, Maxwell / Heritage, John (Hg.)(1984): Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Univ. Press, 57-101.
Reber, Elisabeth (2012): Sound Objects in English. Amsterdam: Benjamins. Selting, Margret / Couper-Kuhlen, Elisabeth (2000): Argumente für die
Entwicklung einer „interaktionalen Linguistik“. In: Gesprächsforschung 1, 76-95 [http://gespraechsforschung-ozs.de/].
Selting, Margret u.a. (2009): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT2). In: Gesprächsforschung 10, 353-402 [http://gespraechsforschung-ozs.de/].
Suchman Lucy (1987): Plans and Situated Actions. The problem of human- machine communication. Cambridge: Univ. Press.
Stivers, Tanya / Rossano, Federico (2010): Mobilizing Responses. In: Research on Language & Social Interaction 43/1, 3-31.
Uhmann, Susanne (2010): „Bitte einmal nachfassen.“ Professionelles Wissen und seine interaktive Vermittlung. Empraktische freie Infinitive im Operationssaal. In: Dausenschön-Gay, Ulrich / Domke, Christine / Ohlhus, Sören (Hg.)(2010): Wissen in (Inter-)Aktion. Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern. Berlin, New York: de Gruyter, 37-70.
Zifonun, Gisela u.a. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter.