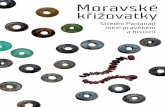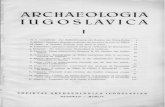Eisenzeitliche und archaische Funde aus dem ‚Santuario Orientale’ von Gabii
Fundort Schausammlung – Neuzeitliche Funde beim Umbau der prähistorischen Schausäle im...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Fundort Schausammlung – Neuzeitliche Funde beim Umbau der prähistorischen Schausäle im...
Archäologie Österreichs 25/2, 2014 1
Ö S T E R R E I C H S
ARCHÄOLOGIE25/2 2014
2. Halbjahr
€ 8,
20 –
CH
F 13
,50
Zula
ssun
gsnu
mm
er: 0
2Z03
2910
M –
Ver
lags
post
amt A
-119
0 W
ien
– P.
b.b.
AKTUELLGräberfeld
Salzburg-Liefering
Archäologie Österreichs
Redaktionsteam: Mag. Sandra Sabeditsch & Mag. Ulrike Schuh Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte Franz-Klein-Gasse 1, A–1190 Wien E-Mail: [email protected]
Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Franz-Klein-Gasse 1, A–1190 Wien, Tel: (+43) 01/4277–40477, Fax: (+43) 01/4277–9409 E-Mail: [email protected], [email protected], Homepage: www.oeguf.ac.atSchriftleitung: Mag. Ulrike Schuh, Mag. Sandra Sabeditsch, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebLektorat: Mag. Ulrike Schuh, Mag. Sandra SabeditschGraphische Bearbeitung, Satz & Layout: Mag. Sandra Sabeditsch, Mag. Ulrike SchuhFinanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin KrennEditorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Mag. Dr. Karina Grömer, HR Dir. Dr. Anton Kern, Mag. Dr. Martin Krenn, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Prof. Dr. Annaluisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban Wissenschaftliche Beratung: Ausschuss der ÖGUFDruck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, A–3504 Krems/SteinTitelbild: Salzburg-Liefering, Lexengasse: Inventar Grab 46 (Quelle: BDA)
EDIT
OR
IAL
IMP
RES
SUM
ISSN-Nr. 1018-1857
Gedruckt mit der Unterstützung der Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen und Niederösterreichischen Landesregierung sowie des Magistrats der Stadt Wien, MA 7–Kultur
Die Autoren sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!
Geschätzte Leserinnen und Leser!
Das aktuelle Thema dieser Ausgabe widmet sich einer der größten und bestausgestatteten völkerwande-rungszeitlichen Nekropolen in Salzburg – dem Gräberfeld Salzburg-Liefering. Zahlreiche Beigaben deuten auf weit reichende Handelskontakte hin und ermöglichen eine Einbettung der Fundstätte in überregionale historische Zusammenhänge.Die Rubrik „News“ spannt den Bogen von der Urnenfelderkultur bis zur Neuzeit und zeigt u. a., dass auch „Befunddokumentation“ im Zuge von Renovierungsarbeiten Spuren der Vergangenheit aufdecken kann.Die weiteren Beiträge gewähren Einblick in aktuelle archäologische Projekte von Ost- bis Westösterreich. Ein Pionier der archäologischen Forschung Vorarlbergs, John Sholto Douglass, wird in einem interessanten Artikel gewürdigt. Auch der Frauenberg bei Leibnitz blickt auf eine lange Forschungsgeschichte zurück, dennoch ergaben sich durch Funde der letzten Jahre neue Perspektiven.Die Experimentelle Archäologie ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der archäologischen Ausbildung und findet im MAMUZ Schloss Asparn optimale Rahmenbedingungen – ein Beitrag zu Salzherstellungsexperi-menten zeigt, dass diese „Versuchsmöglichkeiten“ auch international gerne genutzt werden.Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftsvermittlung sind wichtige Aspekte der archäologischen Forschung. In Hallstatt legt das Projekt „Sparkling Science“ den Fokus auf die Kooperation mit Schulen. Die wissen-schaftliche Nachwuchsförderung führt zu Ergebnissen, von denen auch die Wissenschaft profitieren kann.Die Rubrik „Forschung im Ausland“ ist diesmal dem Kulturgüterschutz gewidmet und beleuchtet diese Problematik am Beispiel Zyperns.
Abschließend wünschen wir Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr!
Wien, im Dezember 2014 Sandra Sabeditsch und Ulrike Schuh
Archäologie Österreichs 25/2, 2014 1
Archäologie Österreichs 25/2 2. Halbjahr 2014
INH
ALT
DAS AKTUELLE THEMA
Salzburg-Liefering, LexengasseEin völkerwanderungszeitliches Gräberfeld mit bemerkenswerten BefundenUlli Hampel und Peter Höglinger 2–14
NEWS
Die fünfte Grabungskampagne in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-GasteilPeter Trebsche 15–17
Der urnenfelderzeitliche Bestattungsplatz in Hollabrunn, „An der Aspersdorferstraße“ – Ein Forschungsprojekt der NÖ Landesarchäologie in Zusammenarbeit mit dem Museum HollabrunnErnst Lauermann und Nadine Eibler 18–20
Ausgrabung des vierten kleinen Heiligtums Objekt 40 am Sandberg 2014Veronika Holzer 20–21
Grabungen im Wirtschaftsbereich der villa rusticaVerena Gassner und René Ployer 21–23
Grüße aus Sizilien! Ein bronzezeitliches sizilianisches Rasiermesser im alpinen RaumSebastian Krutter 23–24
Fundort Schausammlung – Neuzeitliche Funde beim Umbau der prähistorischen Schausäle im Naturhistorischen MuseumCarmen Löw und Karina Grömer 24–27
FORUM
John Sholto Douglass (1838–1874). Archäologe in VorarlbergHelmut Swozilek 28–30
Ein Objekt der späten Lengyelkultur aus Oslip. Erste Ergebnisse der Ausgrabung auf der B50 Nordumfahrung Schützen am Gebirge (Burgenland) und ein Überblick über die Forschungsgeschichte der Gemeinde OslipKurt Fiebig, Patrick Hillebrand und Ruth Steinhübl 31–37
Frauenberg bei Leibnitz. Heiligtum einer einheimischen Muttergottheit?Bernhard Schrettle 38–42
Experimentelle Salzherstellung unter Verwendung von Textilien in spätbronze-/früheisenzeitlicher BriquetageSebastian Ipach, Daniel Scherf und Karina Grömer 43–48
Sparkling Science – prickelnde Forschung in HallstattWissenschaftsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Salzbergbau, HolzwirtschaftHans Rudorfer und Hans Reschreiter 49–53
MUSEUM INTERN
News from the Past. Niederösterreich • Archäologie • AktuellRonald Risy 54–55
FORSCHUNG IM AUSLAND
Zypern. Geteilte Insel, gestohlenes Erbe, unsichere ZukunftRainer Feldbacher 56–63
24 Archäologie Österreichs 25/2, 2014
Abb. 13: Pass Lueg: Bronzezeitliches sizilianisches Rasiermesser (Quelle: © Salzburg Museum).
der obersten Humusschicht angetroffen wurde.2 Dieses vorliegende – bislang jedoch fälschlicher-weise als Dolch angesprochene – Rasiermesser (L: 175 mm) zeigt eine glatte hell- bis dunkelgrü-ne Patina und charakterisiert sich durch ein langschmales und im oberen Drittel stark ver-breitertes Blatt, konvex einziehende Schneiden, einen annähernd konvexen Blattausschnitt und eine abgesetzte längliche Griffplatte mit einem Nietloch. Während im gesamten mitteleuropä-ischen Raum bislang keine weiteren typologi-schen Parallelen zu dem vorliegenden Rasier-messer auftreten, sind hingegen in den Beiga-benspektren der beiden Felskammernekropolen von Pantalica und Monte Dessueri3 im südost-sizilianischen Raum mehrere typologisch über-aus gut vergleichbare Rasiermesser überliefert. Jene Grabbefunde mit typologisch relevanten Rasiermessern, welche hierbei unter anderem in Vergesellschaftung von einfachen Bogenfibeln auftreten, datieren nach H. Müller-Karpe4 in die Stufe Pantalica II und sind demnach relativchro-nologisch mit den mitteleuropäischen Stufen HaA2–HaB1 zu korrelieren, das somit auch als Datierungsansatz für das vorliegende Rasier-messer vom Pass Lueg gelten darf. Weitere ty-pologisch nahestehende und unter dem Typ Pertosa5 subsumierte Rasiermesser finden sich vereinzelt im süd- und norditalischen Raum, welche hierbei ebenfalls in urnenfelderzeitlichen Fundkontexten auftreten. Dass derartige „sizili-anische“ Rasiermesser jedoch auch weitab ihres eigentlichen Kernverbreitungsraumes auftreten, verdeutlichen darüber hinaus zwei Funde im ostenglischen und niederländischen Raum, wel-che nach A. Jockenhövel6 als Typ Pantalica be-zeichnet und hierbei als mediterrane Importe über den Seeweg interpretiert werden.Anhand der überlieferten Fundsituation und ei-nem erkennbaren „Muster“ hinsichtlich weiterer bronzezeitlicher Passfunde ist das hier zu disku-tierende Rasiermesser vom Pass Lueg wohl we-niger als Resultat eines unbemerkten Verlustes als vielmehr einer bewussten Entäußerung eines ideell und materiell wertvollen Metallobjektes im Sinne einer Einzelstückdeponierung zu interpre-tieren, welches während der Begehung der Transitroute zwischen dem vor- und inneralpinen Salzachtal sprichwörtlich am „Wegesrand“ depo-niert worden ist und zudem einen der seltenen Nachweise von Rasiermessern im materiellen Spektrum der Metalldeponierungen des Saalach-Salzach-Raumes darstellt. Angesichts der mor-phometrisch weitgehend identen Merkmale mit Rasiermessern aus dem sizilianischen Raum und dem bisherigen Fehlen von weiteren Vergleichs-funden im mitteleuropäischen Raum ist für das vorliegende Rasiermesser – unter Vorbehalt einer
ausstehenden geochemischen Analyse – zu postulieren, dass es sich um einen echten Import aus dem mediterranen Raum handelt, womit letztendlich auch ein weiterer Hinweis auf die weitreichenden – in diesem Fall südlich orien-tierten – kulturellen Interaktionen des bronze-zeitlichen Saalach-Salzach-Raumes gegeben scheint.
Anmerkungen
* Dieser Beitrag sei meinem Kollegen Herrn Bruno Reiterer – archäologischer Restaurator am Salzburg Museum – zu seiner Pensionierung gewidmet!1 Freundlicher Hinweis von A. Tadic (Salzburg).2 P. Orsi 1912: La necropoli sicula di Pantalica e di Dessue-ri. Monumenti Antichi 21, Milano 1912, 302–408, Taf. V/11–13, XVIII/20–22.3 H. Müller-Karpe 1959: Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Römisch-Germanische Forschungen 22, Berlin 1959, 23–25, Abb. 64, Taf. 1/B5, 3/A4.4 V. Bianco Peroni 1979: I rasoi nell’Italia continentale. Prähistorische Bronzefunde VIII/2, München 1979, 12–14, Taf. 111/B, 112/A.5 A. Jockenhövel 1980: Die Rasiermesser in Westeuropa. Prähistorische Bronzefunde VIII/3, München 1980, 80–81.
Sebastian Krutter
Wien
Fundort Schausammlung – Neuzeitliche Funde beim Umbau
der prähistorischen Schausäle im Naturhistorischen Museum
KG Wien 1, Innere StadtVB Wien
Bei den Umbauarbeiten der Schausäle für die Prähistorischen Sammlungen, die seit Oktober 2013 laufen, sind Bauarbeiter und Museumsmit-arbeiterInnen auf unerwartete Funde aus der
Archäologie Österreichs 25/2, 2014 25
Abb. 14: NHM Wien: Notiz der Tapezierergesellen aus dem Jahr 1887, Vorder- und Rückseite (Quelle: A. Schumacher, NHM).
Abb. 15: NHM Wien: Diverse Fundstücke beim Umbau der prähistorischen Schausäle (Quelle: A. Schumacher, NHM).
125jährigen Geschichte des Hauses gestoßen. Derzeit sind unterschiedliche Gewerke mit der Anpassung der Ausstellungsräume an heutige Bedürfnisse betraut. Neu konzipiert sollen in den Schausälen Nr. 11–13 des Naturhistorischen Museums in Wien ab Sommer/Herbst 2015 wie-der die Kostbarkeiten der prähistorischen Samm-lungen zu sehen sein.
Nachricht der Tapezierer von 1887
Bei den Arbeiten an einer Vitrine erlebte der Montagetischler Georg Fleck1, der für die Firma Auer Holzmanufaktur aus Innsbruck tätig ist, im August 2014 eine besondere Überraschung: Er fand auf einem Zwischenboden, der einen Zu-griff auf die ausgestellten Objekte über die Schubladen verhindern sollte, eine 127 Jahre alte
Nachricht von den Erbauern des Schaukastens (Abb. 14). Dort war in Kurrentschrift zu lesen:„Diese Semdlichen Kästen haben die folgenden
Tapezierer und Gesellen überzogenFranz Ferbler Johan Köhler
Ferdinand Binder Josef Reinisch Karl Later [?]
und noch edliche fon Juni bis August 1887.“Unterschrieben ist der 12,5 × 9,8 cm große, beidseitig beschriebene Zettel aus vergilbtem Papier mit
„Hüller Franz Tapeziererbeihilfe bei Herrn K. Schat [?] 1887“.2
Noch in den 1960er-Jahren gehörten zu den Aufgaben des Tapezierergewerbes neben den Tapetenarbeiten an Wänden auch die Verlegung von Bodenbelägen aller Art, das Anbringen von Jalousien, die Herstellung von Polstermöbeln und vieles mehr.3
Der Zettel der Tapezierer aus dem Jahr 1887 wurde mit Bleistift geschrieben und an zwei Seiten aus einem größeren Papier herausge-trennt. Vielleicht wurde das Papier, an dem Schmutz anhaftet, über längere Zeit in der Werkzeugkiste aufbewahrt. Bei genauerer Be-trachtung zeigen sich außerdem auf der Vorder-seite vereinzelt Spuren von mindestens einem weiteren Text. Dabei dürfte es sich um Abdrücke von Buchstaben in brauner Farbe handeln. Es scheint, als sei der Zettel als Schreibunterlage auf einer noch ein wenig feuchten, braun lackier-ten Fläche verwendet worden. Möglich, dass es sich dabei um Farbe einer der Vitrinen handelt. Vom Schreiben der erhaltenen Nachricht stam-men diese Abdrücke nicht. Sie decken sich an keiner Stelle mit den Linien des umseitigen Textes und weichen selbst in Position und Ori-entierung von diesem ab.Der Tischler G. Fleck reagierte besonnen, als er den Fund entdeckte. Er zog sich zunächst sau-bere Handschuhe an, bevor er den Zettel barg und ihn ins Sekretariat der Prähistorischen Ab-teilung brachte. Es war für ihn das erste Mal, dass er ein offenkundig deponiertes Objekt bei seinen Arbeiten fand, und freimütig gibt er zu, sich ein wenig wie Indiana Jones gefühlt zu haben.
Malerhut von 1965
Der Brief der Tapezierer war eine von drei De-ponierungen, die beim Umbau der Prähistori-schen Schausammlung gefunden wurden. Leider nur noch unvollständig erhalten blieb ein aus Zeitung gefalteter Malerhut, der von Ausmalar-beiten im Jahr 1965 stammt (Abb. 15). Die heu-tigen Arbeiter der Firma Malerei Schmied in
26 Archäologie Österreichs 25/2, 2014
Abb. 16: NHM Wien: Deckenmalarbeiten in Saal 11 mit Fundort des Maler-hutes (Quelle: K. Grömer, NHM).
Wien4 fanden ihn im April 2014 auf dem Gesims in Schausaal 11 (Abb. 16). Leider wurde der Hut auseinandergefaltet. Auf der Titelseite der Zei-tung, es ist eine Ausgabe des „Kurier“ vom Dienstag, dem 23. März 1965, wird berichtet von Post- und Bahnstreiks, vom Weltraumspazier-gang des russischen Kosmonauten Alexeij Leo-now und von Robert Kennedys Ambitionen, den 4236 m hohen Mount Kennedy zu besteigen. Auf dem gesamten Zeitungspapier findet sich kein einziger Farbfleck. Daher dürfte es sich auch bei diesem Fund um eine bewusste Hinterlassen-schaft der Arbeiter handeln.Die Handwerker, die die aktuellen Arbeiten aus-führen, haben sich entschlossen, ebenfalls auf dem Gesims Nachrichten für ihre Nachfolger zu hinterlassen und leisten damit auch einem Wunsch der Prähistorischen Abteilung Folge.
Schafgarbe für die Venus von Willendorf
Die dritte Deponierung in der Schausammlung dürfte erst wenige Jahre alt sein und stammt nicht von Handwerkern, die in den Räumen tätig waren. Sie fand sich unter dem Sockel der Venus von Willendorf, die zu Beginn des Umbaus im Oktober 2013 aus ihrem „Tempel“ in Saal 11 herausgenommen und in Saal 4 neu aufgestellt wurde, wo sie – bis zum Abschluss der Arbeiten in den prähistorischen Sälen – den Besuchern weiterhin zugänglich ist. Unter besagtem Sockel fand sich ein Bündel Schafgarbe mit weißen Blüten (Achillea clavennae), vom dem ein ca. 14 cm langer Zweig geborgen werden konnte (Abb. 15). Der lateinische Name dieser Pflanze, Achillea, geht auf den griechischen Heros Achil-leus zurück, der Verletzungen damit behandelt haben soll. Der Pflanze wird von Alternativmedi-zinern auch heute noch eine große Heilkraft zugeschrieben. Besonders soll sie Frauenleiden lindern, wie zum Beispiel Bauchkrämpfe, Gicht, Menstruationsbeschwerden und Wechseljahres-beschwerden.5 Schafgarbe kommt insbesondere in Heidegebieten und auf trockenen Wiesen vor; in der Umgebung des Museums jedoch ist sie nicht zu finden. Der Auffindungsort des Zweiges, das Fehlen von Schafgarbe in der näheren Um-gebung und der besondere Bezug zu Frauener-krankungen legt nahe, dass es sich hier um eine bewusst deponierte Opfergabe an die Venus von Villendorf handelt. Dass die ca. 25.000 Jahre alte Frauenstatuette in manchen esoterischen Kreisen aktiv verehrt wird, konnte die Kuratorin der be-rühmten Statuette, Frau Dr. Walpurga Antl-Weiser, schon mehrfach feststellen.6
Schuhsohle
Abgesehen von diesen gezielten Deponierungen gab es auch einen Zufallsfund. So zumindest werten wir die in den Bauschutt geratene Einla-ge eines Schuhs (Abb. 2), die sich in der Unter-konstruktion des Parkettbodens in Saal 12 fand. Sie ist 24,7 cm lang, was der Schuhgröße 39 entspricht. Die handgefertigte Einlage dürfte von einem Frauenschuh mit niedrigem Absatz stam-men. Sie scheint auf eine Holzsohle, von der sich Reste im Fersenbereich erhalten haben, mit Holzstiften aufgenagelt worden zu sein.
Funde in anderen Abteilungen
Die Prähistorische Abteilung ist nicht die einzige Abteilung im Haus, die derartige Funde zu ver-zeichnen hat.7 Auch im Meteoritensaal der Geo-logischen Abteilung wurde während des 2012 stattfindenden Umbaus ein Zettel aus dem
NEW
S
Archäologie Österreichs 25/2, 2014 27
Jahre 1910 in einer der Vitrinen gefunden, der von Handwerkern unterschrieben war. Zudem gab es mehrfach an unsichtbarerer Stelle Be-schriftungen in den Vitrinen. Besonders ein-drucksvoll war weiters ein Wandgraffiti, in dem sich ebenfalls Handwerker verewigt hatten. Das Graffiti war weit über 100 Jahre hinter einem Schaukasten verborgen und wurde erst nach dessen Demontage sichtbar. Beim Umbau des Saales konnte es erhalten bleiben, da an dieser Stelle eine hohe Schautafel mit dem Halbrelief des Mondes angebracht wurde.
Literatur
S. Jovanovic-Kruspel & A. Schumacher 2014: Das Natur-historische Museum. Baugeschichte, Konzeption & Archi-tektur. Wien 2014.Ch. Riedl-Dorn 1998: Das Haus der Wunder. Zur Geschich-te des Naturhistorischen Museums in Wien. Wien 1998.
Anmerkungen
1 Wir bedanken uns bei Herrn Georg Fleck, Fa. Auer, für sein umsichtiges Vorgehen.2 Transkription E. Wexberg, 27. 8. 2014. Wir danken für die Übertragung des Textes.3 E. Fröhlich 1967: Das Gewerbe der Tapezierer. Wien 1967, 3.4 Den Arbeitern der Fa. Schmied, 1120 Wien sei herzlich gedankt, dass sie uns auf die Funde aufmerksam gemacht haben.5 E. Marbach 2010: Heilkräuter Hausapotheke. Die wich-tigsten Heilpflanzen für die Anwendung zu Hause. Breisach 2010, Stichwort „Schafgarbe“.6 W. Antl-Weiser 2008: Die Frau von W. Die Venus von Willendorf, ihre Zeit und die Geschichte(n) um ihre Auf-findung. Veröffentlichungen der Prähistorischen Abteilung 1, Wien 2008, 12–13, 168.7 Wir danken HR Dr. Herbert Kritscher und Ludovic Ferrie-re für weitere Hinweise zu Fundstücken bei diversen vor-angegangenen Bauarbeiten.
Carmen Löw und Karina Grömer
Entdecke die Zukunft der digitalen ArchäologieUnser archäologisches Informationssystem gibt dir die Zeit dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dokumentiere deine Grabung auf deinem Tablet oder PC immer und von überall. Verwende vorde�nierte Werte oder verändere die Vorauswahl nach deinen Bedürfnissen. Blende Felder aus, wenn du sie nicht brauchst. Wechsle die Eingabesprache für Kollegen aus dem Ausland. Teste jetzt unsere Anwendung unter www.inari-software.com.
P.S.: Ab 2015 kannst du dir auch die Harris Matrix zu deinen Grabungen ansehen, Point Pattern Analysen durchführen oder deine Aufzeichnungen verö�entlichen.
www.inari-software.com
NEW
S
64 Archäologie Österreichs 25/2, 2014
Mag. Nadine Eibler, Landessammlungen Niederösterreich, Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterarchäologie, MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn an der Zaya, E-Mail: [email protected]
Mag. Rainer Feldbacher, Kompetenzzentrum Kulturelles Erbe und Kulturgüterschutz, Universität Wien, c/o Blue Shield Office Vienna, Schottengasse 3a, II. Hof, V. Stiege, 1. Stock, Tür 19, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Ing. Mag. Kurt Fiebig, Verein PannArch, Josef-Haydn-Gasse 4–8/8-2, A-7000 Eisenstadt, E-Mail: [email protected]
ao. Univ.-Prof. Dr. Verena Gassner, Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Dr. Karina Grömer, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Ulli Hampel, ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH, Porschestraße 39, A-3100 St. Pölten, E-Mail: [email protected]
Patrick Hillebrand, Verein PannArch, Meiselstraße 65/44–46, A–1140 Wien, E-Mail: [email protected]
Dr. Peter Höglinger, Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie, Sigmund-Haffner-Gasse 8, A-5020 Salzburg, E-Mail: [email protected]
Dr. Veronika Holzer, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Sebastian Ipach, BA, Friedrich-Schiller-Universiät Jena, Bereich für Ur- und Frühgeschichte, Löbdergraben 24a, D-07743 Jena, E-Mail: [email protected]
Sebastian Krutter, BA, Landesarchäologie Salzburg, c/o Salzburg Museum, Alpenstraße 75, A-5020 Salzburg, E-Mail: [email protected]
Dr. Ernst Lauermann, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterarchäologie, MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn an der Zaya, E-Mail: [email protected]
Mag. Carmen Löw, talk about science – Agentur für Wissenschaftskommunikation, Lorenz-Stein-Straße 8, A-1140 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. René Ployer, Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Hans Reschreiter, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Dr. Ronald Risy, Fachbereich Kultur und Bildung, Magistrat St. Pölten, Prandtauerstraße 2, A-3100 St. Pölten, E-Mail: [email protected]
Mag. Hans Rudorfer, Falkenburg 84, A-8952 Irdning, E-Mail: [email protected]
Daniel Scherf, MA, Friedrich-Schiller-Universiät Jena, Bereich für Ur- und Frühgeschichte, Löbdergraben 24a, D-07743 Jena, E-Mail: [email protected]
Mag. Dr. Bernhard Schrettle, ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark, Waldertgasse 7e/9, A-8020 Graz, E-Mail: [email protected]
MMag. Ruth Steinhübl, Verein PannArch, Bahnhofstraße 12, A-4650 Lambach, E-Mail: [email protected]
Dr. Helmut Swozilek, Dir. i. R. des Vorarlberger Landesmuseums, Hoferfeld 16, A-6911 Lochau
Mag. Dr. Peter Trebsche, Landessammlungen Niederösterreich, Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterarchäologie, MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn an der Zaya, E-Mail: [email protected]
AutorInnen dieser Ausgabe AU
TO
REN
VER
ZEIC
HN
IS