Zeiler & Kapteiner 2012 - Feldbefestigungen des Zweiten Weltkriegs beim Hof Kapune in Arnsberg - AiW
Transcript of Zeiler & Kapteiner 2012 - Feldbefestigungen des Zweiten Weltkriegs beim Hof Kapune in Arnsberg - AiW
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Säugetiere aus einer Verkarstung des devoni-schen Massenkalkes im Hönnetal bei Balve
Wadersloh – ein bedeutender Fundplatz der spätmittelpaläolithischen Keilmessergruppen
Neue Erkenntnisse zur Besiedlung Westfalens am Ende des späten Jungpaläolithikums
Frühe Hirschjäger am Hellweg bei Werl-Büderich
Menschenreste und Besiedlungsspuren – Meso- und Neolithikum aus der Blätterhöhle
Die befestigte linearbandkeramische Zentral-siedlung von Borgentreich-Großeneder
Neue Hinweise zum Frühneolithikum – die linearbandkeramische Siedlung von Werl
Eine ungewöhnliche neolithische Steinaxt-klinge aus der Hellwegzone bei Werl
Lange gesucht und wieder gefunden – das Großsteingrab I von Beckum-Dalmer
Die Toten in den Galeriegräbern von Erwitte-Schmerlecke – erste Erkenntnisse
Von Kollektiv- zu Einzelbestattungen – die Kreisgräben von Erwitte-Schmerlecke
Das mittelbronzezeitliche Halbstegbeil von Lintel-Schledebrück
Eines der reichsten bronzezeitlichen Gräber Westfalens: das Brandgrab in Barkhausen
Klaus-Peter Lanser
Manfred Schlösser
Jörg Holzkämper, Andreas Maier
Michael Baales, Martin Heinen
Jörg Orschiedt, Birgit Gehlen,
Werner Schön, Flora Gröning
Hans-Otto Pollmann
Franz Kempken,Katja Oehmen
Michael Baales
Judith Heinen, Kerstin Schierhold,
Bernhard Stapel
Susan Klingner, Kerstin Schierhold,
Michael Baales, Ralf Gleser,
Michael Schultz
Eva Cichy, Kerstin Schierhold
Johannes Werner Glaw
Hannelore Kröger
17
20
25
28
32
36
40
45
47
50
52
56
60
Leitartikel
Ausgrabungen und Funde
In dubio pro reo? Das archäologische Jahr 2011 in Westfalen-Lippe
Michael M. Rind 7
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Ein ungewöhnlicher Grabbefund in Westerkappeln
Neues aus dem Höllenloch bei Brilon-Rösenbeck
Neue 14C-Daten zu alten Funden aus Olfen
Die späteisenzeitliche Lanzenspitze aus Olfen-Kökelsum – ein Bauopfer?
Wettringen-Bilk – ein früheisenzeitliches Gefäßdepot aus dem nördlichen Münsterland
Eine eisenzeitliche Siedlung am »Wietheimer Weg« in Geseke
Eisenzeitliche Stege in die Emscher – die Grabung Castrop-Rauxel-Ickern 2011
Olfen-Sülsen – ein neues Römerlager aus der Zeit der Drususfeldzüge
Prospektionen im augusteischen Marschlager Haltern-»In der Borg« (Ostlager)
Archäologische Forschung in der Siedlung Aspethera in Paderborn
Mit Blick auf die Seseke – Reste eines frühmit-telalterlichen Gräberfeldes in Bergkamen
Karolingische Funde aus zwei Wüstungen bei Bad Lippspringe
Serie und Einzelstück – spätkarolingische und ottonische Metallobjekte aus Westfalen
Ein neuer Hinweis auf den mittelalterlichen Königshof in Lennestadt-Elspe
Der Erzbischof im Brandschutt: Eine Schachfigur von der Falkenburg
Bischofsstäbe aus Münster? Ein ungewöhnlicher mittelalterlicher Geweih-Nodus
»Fuchsspitze« und »Burgstätte« in Datteln-Markfeld
Eine Grundstücksentwicklung im 12.–14. Jahrhundert im Paderborner Schildern
Neufunde auf der Flur Borgstätte in Hamm-Heessen – ein Teil der Burg Nienbrügge?
Jürgen Gaffrey
Eva Cichy
Jürgen Gaffrey
Alexandra Stiehl
Andrea Stapel, Bernhard Stapel
Kai Bulka
Jürgen Pape, Angelika Speckmann
Bettina Tremmel
Bettina Tremmel
Sven Spiong
Eva Cichy, Martha Aeissen
Sven Spiong
Christoph Grünewald
Eva Cichy, Elena Kolbe
Hans-Werner Peine, Elke Treude
Bernd Thier
Baoquan Song, Georg Eggenstein
Sven Spiong
Eva Cichy
63
67
70
74
76
80
82
86
89
92
96
99
102
104
106
111
114
117
121
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Wohlfeiler Tand? Ein mittelalterlicher Glasring aus Dortmund, Kuckelke 10
Gefäßkeramik des 14. Jahrhunderts aus Höxter
Ein Brand im ehemaligen Kloster Kentrop in Hamm als Glücksfall für die Archäologie
Die Hüffert – eine Siedlung vor den Toren der Stadt Warburg
Am Rande der Domburg – Ausgrabung am Geologisch-Paläontologischen Museum
Wasserbaukunst an der Werse – Ausgrabungen an der Havichhorster Mühle bei Handorf
Leben in der Stadt: Archäologie zwischen Ems- und Münsterstraße in Rheine
Wasserbauliche Zufallsfunde der frühen Neuzeit aus Geseke und Arnsberg
Landsknechte in Porta Westfalica-Barkhausen
Ein Schatzfund des späten 17. Jahrhunderts aus Coesfeld-Lette
Endlich gefunden: die Mikwe der jüdischen Gemeinde Warburg
Feldbefestigungen des Zweiten Weltkriegs beim Hof Kapune in Arnsberg
Der Splittergraben Uferstraße 4 in Höxter aus dem Zweiten Weltkrieg
Ein langer Schnitt in die Vergangenheit – Ausgrabungen in Werl-Büderich
Eine fast verpasste Chance – zur Verlegung einer Gasleitung zwischen Werl und Welver
Menschliche Skelettreste aus der Weißen Kuhle bei Marsberg
Erdwerk und Glockengussgrube – die Ausgra-bungen an der Höggenstraße 28 in Soest
Montanarchäologie am und im Bastenberg bei Bestwig-Ramsbeck
Gerard Jentgens, Regina Machhaus
Andreas König
Wolfram Essling-Wintzer, Cornelia Kneppe
Andrea Bulla, Franz-Josef Dubbi
Agnieszka Marschalkowski
Ulrich Holtfester
Wolfram Essling-Wintzer, Cornelia Kneppe
Michael Baales, Eva Cichy,
Reinhard Köhne
Werner Best
Peter Ilisch
Hans-Werner Peine, Franz-Josef Dubbi
Manuel Zeiler, Torsten Kapteiner
Johannes Müller-Kissing
Martin Heinen
Franz Kempken
Linda Gomolakova, Jörg Orschiedt,
Eva Cichy
Frederik Heinze
Martin Straßburger
124
128
131
135
139
142
145
149
153
156
159
163
166
170
175
179
182
185
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Das spätpaläolithische Fundgebiet Rietberg und die allerødzeitliche Landschaft
Holozäner Landschaftswandel an der Emscher bei Castrop-Rauxel-Ickern
Ein Blick zurück – Neues von der Fischfauna der Emscher
Luftbildarchäologie in Westfalen – methodische Erfahrung im Jahr 2011
Prospektionen und Siedlungsarchäologie in Westfalen 2011
Digitale Geländemodelle – eine Methode zur Lokalisierung von archäologischen Fundstellen
Ergebnisse des Airborne Laserscanning am Nordrand der Warburger Börde
Eisenzeitliche Montanregion Siegerland: Forschungen und Präsentationen 2011
Die Amphoren aus den römischen Militäranlagen in Haltern
Ortswüstungen in den Hochlagen des Rothaargebirges
Hochmittelalterliche Rodungssiedlungen auf der Bulderner Kleiplatte des Westmünsterlandes
Auf beiden Seiten der Emscher – Adelssitze im Stadtgebiet von Gelsenkirchen
Voxel versus STL – die Aussagekraft von 3-D-Scans archäologischer Objekte
Die Rekonstruktion einer mittelbronzezeit- lichen Schwertscheide aus Porta Westfalica
Methoden und Projekte
Jutta Meurers-Balke, Andreas Maier, Arie J. Kalis
Jutta Meurers-Balke, Till Kasielke
Margret Bunzel-Drüke, Lothar Schöllmann
Baoquan Song
Wolfgang Ebel-Zepezauer, Michael M. Rind, Klaus Röttger, Thomas Stöllner, Beate Sikorski, Baoquan Song
Ingo Pfeffer
Rudolf Bergmann, Hans-Werner Peine, Hans-Otto Pollmann, Martin Schaich
Manuel Zeiler, Thomas Stöllner
Bettina Tremmel, Horacio González Cesteros, Torsten Mattern, Patrick Monsieur
Rudolf Bergmann, Maja Thede
Rudolf Bergmann
Cornelia Kneppe
Andreas Weisgerber
Eugen Müsch
191
196
200
203
208
212
217
221
225
227
233
236
241
244
INH
ALT
Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Schätze des Mittelalters – Schmuck aus dem Staatlichen Archäologischen Museum Warschau
Die Landesausstellung »Fundgeschichten. Neueste Entdeckungen von Archäologen in NRW«
Fundgeschichten en Blog – das museumspäda-gogische Modellprojekt ArchäoLOGIN
Kulturstrolche erobern die Kaiserpfalz
Sommerferien mit Asterix – Aktion, Ausstellung oder Event?
Ausstellungen
Martin Kroker
Kai Jansen, Susanne Jülich
Michael Lagers
Renate Wiechers
Renate Wiechers
251
254
257
261
264
Autorenverzeichnis
Neuerscheinungen
Ansprechpartner, Adressen
270
273
280
163 Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Au
sg
rA
bu
Ng
eN
uN
d F
uN
de
LiteraturHans-Werner Peine/Franz-Josef Dubbi, Ein jüdisches Ritualbad in der Warburger Altstadt. Jahrbuch Kreis Höxter 2012, 2011, 136–145 (mit Literatur- und Quellenangaben).
Feldbefestigungen des Zweiten Weltkriegs beim Hof Kapune in ArnsbergHochsauerlandkreis, Regierungsbezirk ArnsbergN
euze
it
Manuel Zeiler, Torsten Kapteiner
Militärische Anlagen des Zweiten Weltkriegs zählen zu den eher selten erforschten Boden-denkmälern in Nordrhein-Westfalen. Obwohl sie aus einer historischen Epoche mit reichen Schriftquellen stammen, können sie dennoch wichtige Zeugen schriftlich kaum bekannter Vorgänge sein. Die ausgedehnten Feldbefes-tigungen beim Hof Kapune in Arnsberg sind ein gutes Beispiel dafür. Sie waren Gegen-stand einer Prospektion und Ausgrabung im September 2011, die im Auftrag des Arnsber-
ger Heimatbundes e. V. gemeinsam vom Ar-chäologischen Institut der Ruhr-Universität Bochum sowie dem Fachbereich Montanar-chäologie des Deutschen Bergbau-Museums Bochum mit Unterstützung der LWL-Archäo-logie für Westfalen, Außenstelle Olpe, und des Landesbetriebes Wald und Holz NRW durch-geführt wurden (Abb. 1).
Arnsberg war ab 1944 und besonders ab 1945 im Fokus der alliierten Bomberoffensive. Kernziele waren neben Industrieanlagen In-
Abb. 1 Feldbefestigung Arnsberg: Fundstellenüber-sicht auf Grundlage der DGK 5 sowie der DGM 1 (Grafik: LWL-Archäologie für Westfalen/M. Zeiler).
164
Au
sg
rA
bu
Ng
eN
uN
d F
uN
de
A
rchä
olog
ie in
Wes
tfal
en- L
ippe
201
1
frastruktureinrichtungen für den Nachschub der Wehrmacht, weswegen besonders das Arnsberger Eisenbahnviadukt bis zu seiner Zerstörung im März 1945 vielfach angegrif-fen wurde, wobei die Stadt erhebliche Schä-den davontrug.
In Arnsberg war zu diesem Zeitpunkt das Baupionier-Ersatz- und Ausbildungsbataillon 6 stationiert, das neben der Ausbildung zuneh-mend Luftabwehr-, Sanitäts- und Bergeauf-gaben wahrnahm. Die Informationen über die Aktivitäten dieser Einheit im März 1945 sind spärlich, jedenfalls wurde sie bei Einnahme der
Stadt kaum mehr in die wenigen Kämpfe ver-wickelt.
Die geschilderten historischen Vorgänge sind um die folgende Tagebuchaufzeichnung von Hermann Bietzker vom 29. März 1945 zu ergänzen: »Hinter Kapune, aber noch vor Wi-cheln, beiderseits der Straße MG-Nester. Tie-fer im Wald Unterstände der Soldaten (…)«. Es handelt sich um das Areal beim Hof Ka-pune am Tempelberg und der Wicheler Hö-he südwestlich Arnsbergs. Es ist Teil der Kulturhistorischen Route des Kurfürstlichen Thiergartens Arnsberg und durch rechteckige Geländedepressionen mit muldenförmigem Profil charakterisiert. Bemerkenswert ist, dass diese Geländedepressionen mangels histori-scher Überlieferung nicht als Relikte des Welt-krieges bekannt waren, sondern ihre Funkti-on in der Erzgewinnung und ihre Herkunft im Mittelalter gesucht wurden. Erst im Ver-lauf der zunächst montanarchäologisch kon-zipierten Ausgrabungen wurden Funktion und Alter der Bodendenkmäler erkannt. Trotz der großen Ausdehnung der Feldbefestigungen und ihrer ebenfalls großen Nähe zur Stadt waren sie nach 66 Jahren beinahe aus der Er-innerung verschwunden! Lediglich ein Zeit-zeuge, Josef Hausmann aus Arnsberg, teilte mit, dass im Hungerwinter 1946/1947 mili-tärische Unterstände bei Kapune zur Brenn-stoffgewinnung abgerissen wurden.
Es handelt sich um 3 Feldbefestigungen mit 4 Unterständen bzw. Beobachtungsständen in Feldbefestigung 3, 16 Unterständen in Feld-befestigung 2 sowie 10 Unterständen und ei-nem Kampfgraben mit angesetzten Schützen-nischen in Feldbefestigung 1 (Abb. 2). Darüber hinaus kann eine Maschinengewehrstellung in Feldbefestigung 2 vermutet werden.
Grundlage der Begehungen waren neben kleinmaßstäbigen Plänen (DGK 5) vor allem sehr präzise LIDAR-Karten (DGM 1, durch luftgestützte 3D-Laserscanning-Vermessungs-technologie erstellt). Während alle Feldbefes-tigungen prospektiert und die Einfüllungen der Unterstände mittels Pürckhauer-Bohrun-gen untersucht wurden, fanden Grabungen ausschließlich in Feldbefestigung 1 statt. Dort konnten ein Unterstand (Unterstand 1) und der Kampfgraben dokumentiert werden. Un-terstand 1 wurde in mehreren Schnitten un-tersucht, um mit Profilen den genauen Be-fundaufbau klären zu können (Abb. 3). Die Zusammenschau der Grabungsergebnisse mit den Vorgaben zum Stellungsbau des Ober-kommandos des Heeres aus dem Jahr 1944
Abb. 2 Übersicht über Topografie und Gra- bungsflächen in Feld- befestigung 1 (Grafik: LWL-Archäologie für Westfalen/M. Zeiler).
165 Arc
häol
ogie
in W
estf
alen
- Lip
pe 2
011
Au
sg
rA
bu
Ng
eN
uN
d F
uN
de
(»Merkblatt Stellungsbau«), ergänzt durch die Aussagen des Zeitzeugen, ergeben eine schlüs-sige Deutung des Befundes (Abb. 4). Demnach wurde bei Anlage des Unterstandes das Ge-lände stufig in das verwitterte Gestein abge-tieft und mit einer Holzkastenkonstruktion ausgebaut, die durch den angesetzten und ge-bogenen Graben erreicht wurde. Von dem Un-terstand waren noch Teile des Dielenbodens sowie der verstürzten Abdeckung erhalten. Die Holzteile wiesen, ebenso wie die Dielen-schichten in den Bohrungen anderer Unter-stände bei Feldbefestigung 1, Brandspuren auf.
Bauart und Maße des Unterstandes ent-sprechen beinahe exakt den Merkblattvorgaben, weswegen dieser Unterstand und die meis-ten übrigen Geländedepressionen bei Kapune mit den gleichen Abmessungen als Halbgrup-penunterstände angesprochen werden können. Es handelt sich somit um Mannschaftsunter-künfte, Beobachtungsstände oder Feldküchen der Armee. Die Gesamtanzahl von 31 dieser Bodendenkmäler lässt auf höchstens 15 bis 16 Gruppen und damit auf maximal 186 statio-nierte Personen schließen.
An den rund 142 m langen, gewinkelten und wenig eingetieften Kampfgraben setzen westlich Schützennischen bzw. Maschinenge-wehrfeuerstellungen an. Die Stellungen si-cherten eine westlich vorgelagerte Freifläche und eine wichtige regionale Verbindungsstraße (Abb. 5). Das Profil des Kampfgrabens findet, ähnlich wie beim Unterstand, seine Entspre-chung in den Vorgaben des Merkblattes von 1944.
Nachweise von Kampfhandlungen, wie z. B. Patronenhülsen, fanden sich nicht. Außerdem sind bis auf den Kampfgraben kaum gefechts-fähige Stellungen im Sinne der Vorgaben von 1944 auszumachen. Aufgrund der vorgaben-getreuen Ausführung sowohl des Kampfgra-
bens als auch des Unterstandes ist die in Arnsberg stationierte Pioniereinheit als Urhe- ber der Anlagen anzunehmen. Da die Erbau- ung der Unterstände mit den verstärkten Luftangriffen der Alliierten auf Arnsberg zu-sammenfällt, kann vermutet werden, dass die Feldbefestigungen primär Schutzfunkti-on hatten. Dafür spricht auch, dass Unterstän-de und Kampfgräben sehr dicht angelegt wur-den und im Feuerkampf dadurch eine höhere Gefährdung eingetreten wäre. Zudem befin-den sich alle Anlagen abseits der favorisierten Ziele der Luftangriffe.
Es bleibt zu wünschen, dass die gut er-haltenen Bodendenkmäler der schon beinahe vergessenen Feldbefestigungen dauerhaft ge-schützt werden. Erfreulicherweise sind sie Bestandteil einer Kulturhistorischen Route durch den Arnsberger Wald: Der etwa 12 km lange Wanderweg auf dem Gelände des Kur-fürstlichen Thiergartens Arnsberg erläutert an derzeit 41 Stationen Aspekte der Waldnut-zung sowie der regionalen Geschichte. Als Be-standteil der Kulturhistorischen Route, die be-
Abb. 3 Studierende der Ruhr-Universität Bo-chum beim Freilegen von Unterstand 1 (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/M. Zeiler).
Abb. 4 Nord-Süd-Profil durch Unterstand 1 mit rekonstruiertem Halb-gruppenunterstand (rote gestrichelte Linie) (Grafik: LWL-Archäologie für Westfalen/M. Zeiler).
166
Au
sg
rA
bu
Ng
eN
uN
d F
uN
de
A
rchä
olog
ie in
Wes
tfal
en- L
ippe
201
1
reits die Weltkriegsgeschehnisse am Viadukt thematisiert, können die untersuchten Unter-stände Anknüpfungspunkt sein, um an die Kriegsereignisse der Stadt zu erinnern.
SummaryGerman Wehrmacht shelters and emplace-ments west of Arnsberg were examined in 2011 by means of surveys and test excava-tions. Rectangular shelters with asymmetri-cally placed entrances were characteristic fea-tures. These structures dating from the final
months of the Second World War were proba-bly not used for fighting, but to provide shel-ter from allied air strikes.
SamenvattingIn 2011 werden ten westen van Arnsberg schuilplaatsen en stellingen van de weermacht door middel van prospectie en proefsleuven archeologisch onderzocht. Karakteristiek zijn de rechthoekige, ondergrondse schuilplaatsen, met een asymmetrisch aangebrachte toegang. Bij de stellingen en schuilplaatsen, die in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog werden aangelegd, vonden geen gevechtshan-delingen plaats. Zij dienden waarschijnlijk als bescherming tegen geallieerde luchtaanvallen.
LiteraturOberkommando des Heeres (Hrsg.), Bildheft neuzeit-licher Stellungsbau. Merkblatt 57/5 (1.6.1944). – Werner Bühner, Bomben auf Arnsberg 1940–1945. Chronik der Luftangriffe in Bildern und Augenzeugenberichten. Städte-kundliche Schriftenreihe über die Stadt Arnsberg 21 (Arns-berg 1995). – Michael Gechter u. a., Archäologie des Zweiten Weltkriegs im Rheinland – ein Überblick. In: Tho-mas Otten u. a. (Hrsg.), Fundgeschichten – Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen 9 (Mainz 2010) 302–307. – Arns-berger Heimatbund (Hrsg.), Kurfürstlicher Thiergarten Arnsberg. Erlebnis-Wanderführer. Kulturhistorische Route (Arnsberg 2011). – Torsten Kapteiner, Faszination Wald – auf den Spuren zu den Zeitzeugen in Arnsbergs Wäldern. Sauerland 2011/2, 2011, 96.
Abb. 5 Schützennischen bzw. Maschinengewehrnes-ter von Kampfgraben 1 mit Schussfeld im Hintergrund
(Foto: I. Luther).
Der Splittergraben Uferstraße 4 in Höxter aus dem Zweiten WeltkriegKreis Höxter, Regierungsbezirk DetmoldN
euze
it
Johannes Müller-Kissing
Im Dezember 2010 wurden in Höxter in der Uferstraße 4 die Reste eines Splittergrabens aus dem Zweiten Weltkrieg archäologisch un-tersucht, der bereits aus einer vorhergehenden Grabungskampagne von 1999 bekannt war. Durch die genaue Aufnahme des Befundes sowie die Befragung von Zeitzeugen konnte nun dieses Relikt des Luftschutzes nicht nur in seiner Konstruktion, sondern auch im Hin-blick auf seine (Bau-)Geschichte rekonstruiert werden, die mit archäologischen Methoden allein nicht zu fassen gewesen wäre.
Bei dem vorliegenden Splittergraben mit Holzausbau und Überdeckung handelt es sich um einen klassischen Schutzbau des Zweiten Weltkrieges, der mit sehr geringen Mitteln er- richtet werden konnte. Diese Anlagen be-standen zumeist aus einem mannstiefen, im Zickzack verlaufenden Graben, der eine Ab-deckung aus Holz und Erde besaß. Aus den Er-fahrungen des Ersten Weltkrieges entwickelt, sollte der Splittergraben Schutz vor Trümmern, Bombensplittern und Treffern von Stabbrand-bomben bieten. Während es auch Ausführun-




















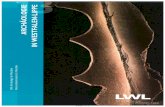

![»Wollen Sie wirklich Armee und Bevölkerung ohne Hosen lassen […]?!« Die Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg in der usbekischen Sowjetrepublik (»Do you really want to leave](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d34ab665120b3330c3b7c/wollen-sie-wirklich-armee-und-bevoelkerung-ohne-hosen-lassen-die-mobilisierung.jpg)









