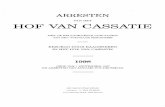Frühe Neue Zeiten. Zeitwissen zwischen Reformation und Revolution
Babylonische Gelehrte am neuassyrischen Hof: zwischen Anpassung und Individualität
Transcript of Babylonische Gelehrte am neuassyrischen Hof: zwischen Anpassung und Individualität
Krieg und Frieden im Alten Vorderasien
52e Rencontre Assyriologique Internationale International Congress of Assyriology and
Near Eastern Archaeology Münster, 17.–21. Juli 2006
Herausgegeben von Hans Neumann, Reinhard Dittmann,
Susanne Paulus, Georg Neumann und Anais Schuster-Brandis
Alter Orient und Altes Testament Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte des Alten Orients und des Alten Testaments
Band 401
Herausgeber
Manfried Dietrich • Hans Neumann
Lektorat
Kai A. Metzler • Ellen Rehm
Beratergremium
Rainer Albertz • Joachim Bretschneider • Stefan Maul Udo Rüterswörden • Walther Sallaberger • Gebhard Selz
Michael P. Streck • Wolfgang Zwickel
Krieg und Frieden im Alten Vorderasien
52e Rencontre Assyriologique Internationale International Congress of Assyriology and
Near Eastern Archaeology Münster, 17.–21. Juli 2006
Herausgegeben von Hans Neumann, Reinhard Dittmann,
Susanne Paulus, Georg Neumann und Anais Schuster-Brandis
2014
Ugarit-Verlag Münster
Krieg und Frieden im Alten Vorderasien. 52e Rencontre Assyriologique Internationale International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology, Münster, 17.–21. Juli 2006
Herausgegeben von Hans Neumann, Reinhard Dittmann, Susanne Paulus, Georg Neumann und Anais Schuster-Brandis
Alter Orient und Altes Testament, Band 401
© 2014 Ugarit-Verlag, Münster www.ugarit-verlag.de Alle Rechte vorbehalten
Rencontre-Logo: Susanne Paulus, Georg Neumann All rights preserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. Herstellung: Hubert und Co, Göttingen Printed in Germany
ISBN: 978-3-86835-075-3
Printed on acid-free paper
Inhaltsverzeichnis
Anacleto D’Agostino Assyrian Wars and Ceramic Production. The Tell Barri Late Bronze/ Iron Age Sequence: An Attempt of Historical Reading ................................................... 1
Alfonso Archi Who led the Army of Ebla? Administrative Documents vs. Commemorative Texts ....... 19
Julia M. Asher-Greve Insinuations of Peace in Literature, the Standard of Ur, and the Stele of Vultures .......... 27
Richard E. Averbeck The Third Millennium Temple. War and Peace in History and Religion ......................... 41
Fabrice De Backer Notes sur les machines de siège néo-assyriennes ............................................................. 69
Heather D. Baker Babylonian City Walls in a Historical and Cross-Cultural Perspective ............................ 87
Daliah Bawanypeck Die Auguren und das hethitische Heer ............................................................................. 97
Richard H. Beal Hittite Reluctance to Go to War ....................................................................................... 109
Gary Beckman The Hittites Make Peace ................................................................................................... 117
Daniel Bodi The ‘Widow’s Tablet’ for the Wife of an Assyrian War Prisoner and the Rabbinic ‘Divorce Letter’ of the Hebrew Warriors ......................................................................... 123
Daniel Bonneterre Les deux bateaux du roi Zimri-Lim, le transport des troupes et la symbolique du pouvoir selon une vision onirique................................................................................ 133
Joachim Bretschneider und Karel van Lerberghe Das Reich von Ugarit vor und nach dem Seevölkersturm. Neue Forschungen im antiken Gibʾala ............................................................................................................ 149
Anna Maria G. Capomacchia and Marta Rivaroli Peace and War: A Ritual Question ................................................................................... 171
Dominique Charpin Guerre et paix dans le monde amorrite et post-amorrite ................................................... 189
Inhaltsverzeichnis VI
Petr Charvát Primeval Statesmen. Winnie the Pooh at Archaic Ur ...................................................... 215
Tamás Dezső Neo-Assyrian Military Intelligence ................................................................................. 221
Rita Dolce Beyond Defeat. The Psychological Annihilation of the Vanquished in Pre-Classical Near Eastern Visual Communication ..................................................... 237
Jeanette C. Fincke Babylonische Gelehrte am neuassyrischen Hof: zwischen Anpassung und Individualität ............................................................................................................. 269
Kristina A. Franke und Christian K. Piller Überlegungen zur kulturgeschichtlichen und chronologischen Einordnung der Stelen von Hakkâri unter besonderer Berücksichtigung der Waffen ......................... 293
Sabina Franke Der Zorn Marduks, Erras und Sanheribs. Zu Datierung und Funktion von „Erra und Išum“ ........................................................................................................ 315
Hannes D. Galter Sargon II. und die Eroberung der Welt ............................................................................ 329
Agnès Garcia-Ventura Women, Work and War. A Proposal to Analyze Their Relationship During the Neo-Sumerian Period ....................................................................................................... 345
Steven J. Garfinkle The Economy of Warfare in Southern Iraq at the End of the Third Millennium BC ....... 353
Susanne Görke Fremde in hethitischen Festritualtexten ........................................................................... 363
Laurent Hebenstreit The Sumerian Spoils of War During Ur III ..................................................................... 373
Nils P. Heeßel Krieg und Frieden in den Apodosen von Omen-Texten .................................................. 381
Bruno Jacobs Kriegsentscheidung durch göttliche Gunst. Zur Bewertung von DBi §§ 72 und 75 ........ 391
Greta Jans and Joachim Bretschneider The Glyptic of Tell Beydar. An Impression of the Sealing Evidence for an Early Dynastic Official Household .................................................................................. 401
Wojciech Jaworski Automatic Tool for Semantic Analysis of Neo-Sumerian Documents ............................ 421
Inhaltsverzeichnis VII
Kristin Kleber Zu Waffen und Ausrüstung babylonischer Soldaten in der zweiten Hälfte des 1. Jt. v. Chr. ................................................................................................................ 429
Roland Lamprichs A Period of Peace and Prosperity in Gilead. Tell Johfiyeh and its Surrounding During the (Late) Iron Age A Report on the 2002-2004 Seasons .................................... 447
Martin Lang Einige Beobachtungen zur sumerisch-akkadischen Überlieferung der Fluterzählung(en) ....................................................................................................... 461
Jürgen Lorenz Termingeschäfte in unsicheren Zeiten .............................................................................. 475
Alessandro Di Ludovico The Reign of Šulgi. Investigation of a King Above Suspicion ......................................... 481
Steven Lundström Die Baugeschichte des Alten Palastes von Assur ............................................................. 495
Duncan J. Melville The Mathland Mirror. On Using Mathematical Texts as Reflections of Everyday Life .. 517
Sarah C. Melville Win, Lose, or Draw? Claiming Victory in Battle ............................................................. 527
Bernd Müller-Neuhof Kriege im Neolithikum Vorderasiens? ............................................................................. 539
Davide Nadali and Lorenzo Verderame Experts at War. Masters Behind the Ranks of the Assyrian Army ................................... 553
Zoltán Niederreiter Le rôle des insignes votifs et des insignes de pouvoir néo-assyriens. Un parallèle étonnant entre les deux catégories de masses d’armes ................................. 567
Takayoshi Oshima The Battle of Bel Against Omorka ................................................................................... 601
Elisabeth von der Osten-Sacken Federn für Pfeile ............................................................................................................... 609
Giovanni Pettinato† and Silvia M. Chiodi Attività italiana in ambito archeologico relativa all’Iraq, 2004-2005 ............................... 629
Marco Ramazzotti Royal Administration During the Conquest. New Archaeological and Epigraphic Discoveries in the Royal Palace G at Ebla – Tell Mardikh .............................................. 651
Jack M. Sasson Casus belli in the Mari Archives ...................................................................................... 673
Inhaltsverzeichnis VIII
Ingo Schrakamp Krieger und Bauern. RU-lugal und aga3/aga-us2 im Militär des altsumerischen Lagaš ................................................................................................. 691
JoAnn Scurlock kallāpu: A New Proposal for a Neo-Assyrian Military Term .......................................... 725
Cristina Simonetti Peace After War. Ḫammurapi in Larsa ............................................................................ 735
Marek Stępień Les changements d’application des sceaux dédicatoires dans les archives d’Umma ....... 743
Thomas Friedrich Sturm Öle, Fette und Bitumen nach den Keilschrifttexten der 1. Hälfte des 2. Jt. v. Chr. ......... 757
Igor A. Sviatopolk-Czetvertynski The Weapon of Ninurta mi-tum and ĝišmittu (lugal-e). Akkadian mittu(m) and its Semitic Parallels Aspects of etymology and poetics ............................................ 779
Sara Tricoli The Ritual Destruction of the Palace of Mari by Hammurapi under the Light of the Cult of the Ancestors’ Seat in Mesopotamian Houses and Palaces ....................... 795
Klaas R. Veenhof Old Assyrian Traders in War and Peace .......................................................................... 837
Tommaso De Vincenzi Development of the “Kastenmauern” Building Technique in Anatolia in the First Half of the II Millennium B.C. ...................................................................... 851
K. Lawson Younger, Jr. “War and Peace” in the Origins of the Arameans ............................................................ 861
Stefan Zawadzki Nabonidus and Sippar ...................................................................................................... 875
Nele Ziegler Kriege und ihre Folgen. Frauenschicksale anhand der Archive aus Mari ........................ 885
Gábor Zólyomi The Competition Between the Enclitics –/ʾa/ and –/e/ in Sumerian ................................ 909
Babylonische Gelehrte am neuassyrischen Hof: zwischen Anpassung und Individualität1
Jeanette C. Fincke (Leiden)
Das vom British Museum, London, initiierte Ashurbanipal Library Project hat es sich zur Aufgabe gemacht, in einer ersten Phase den Anteil der babylonisch geschriebenen Tafeln dieser bedeutenden Bibliothek eingehend zu untersuchen. Während sich die ersten beiden Abschnitte dieses Teilprojektes auf die Erfassung und inhaltliche Auswertung aller babylo-nisch geschriebenen Tontafeln aus Ninive konzentrierten,2 wird nun im dritten Abschnitt der am neuassyrischen Hof tätige babylonische Schreiber selbst ins Zentrum der Aufmerk-samkeit gerückt. Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung sollen im folgenden präsentiert werden.3
Nachdem der assyrische König Sargon II. 710 v. Chr. den babylonischen Thron bestie-gen hatte, ließ er nicht nur ein Netz babylonischer Agenten aufbauen, welche den Königs-
1 Den Trustees des British Museum, London, gebührt Dank für die Genehmigung, die hier präsen-
tierten Tafeln und Photos publizieren zu dürfen. Dem Direktor des Ancient Near East Department, Dr. John Curtis, möchte ich für sein Vertrauen danken, mich in der ersten Phase des Ashurbanipal Library Project mitarbeiten zu lassen und mir den Zugang zu den Tontafeln der Sammlung zu er-möglichen. Die ersten beiden Abschnitte des Projektes wurden von Christopher B. F. Walker und Dr. Irving L. Finkel geleitet, für deren freundschaftliche Hilfsbereitschaft ich beiden herzlich dan-ken möchte. Der dritte Abschnitt, den ich von April bis Juni 2006 durchzuführen die Ehre hatte, erfolgte unter der Leitung von Dr. I. L. Finkel und Dr. Jonathan Taylor; in beiden habe ich gute Freunde und zuvorkommende Kollegen gefunden. Allen Mitarbeitern des Ancient Near East De-partment möchte ich für die freundliche Aufnahme und Unterstützung danken, die ich in vielerlei Hinsicht erfahren durfte. Ein besonderer Dank geht an die Museum Assistants des Department, ohne deren Hilfe viele Teiluntersuchungen nicht hätten durchgeführt werden können. Gleiches gilt für die Konservatoren des British Museum, die unermüdlich von mir benötigte Tafeln reinigten und meine Joins zusammenfügten. Mein spezieller Dank geht an die Townley Group der Freunde des British Museum, deren finanzielle Unterstützung dieses Projekt erst möglich gemacht hat. Schließlich möchte ich noch Nicole Pfeifer, Würzburg, dafür danken, daß sie eine frühere Fassung des Manuskriptes gelesen und kommentiert hat.
Der vorliegende Artikel wurde im März 2007 abgeschlossen. 2 Eine Übersicht über die Ergebnisse des ersten Abschnittes sind in meinen Artikeln The British
Museum’s Ashurbanipal Library Project, Iraq 66 (2004), 55–60 und The Babylonian Texts of Ni-neveh. Report on the British Museum’s Ashurbanipal Library Project, AfO 50 (2003/04 publ. 2005), 111–149, nachzulesen. Die Ergebnisse der ersten beiden Abschnitte sind in die im Internet online verfügbaren Datenbanken „The Babylonian Nineveh Texts“ und „List of Nineveh Joins“ eingegangen, welche unter http://fincke.uni-hd.de/nineveh/index.htm einzusehen sind.
3 Im vorliegenden Artikel werden die besprochenen Texte nach ihrer Museumsnummer und der Publikation der Keilschriftkopie zitiert. Auf Bearbeitungen der Tafeln wird in der Regel nicht hin-gewiesen; diese können mit Hilfe der online Datenbank „The Babylonian Nineveh Texts“ (siehe die vorangehende Anmerkung) leicht aufgefunden werden.
Jeanette C. Fincke 270
hof über die Vorgänge in den verschiedenen Gebieten Babyloniens unterrichtete, sondern beschäftigte auch babylonische Schreiber am assyrischen Hof. Das lässt sich unter anderem daran belegen, dass Abschriften von Briefen, welche der König an Beamte in Babylonien schreiben ließ, in babylonischer Schrift – also von Babyloniern – geschrieben und im kö-niglichen Archiv von Ninive aufbewahrt wurden.4 Ob zu dieser Zeit jedoch bereits baby-lonische Gelehrte am Hof in Ninive wirkten und literarische Texte niederschrieben, lässt sich anhand der Textzeugnisse nicht ermitteln.
Die ersten namentlich bekannten babylonischen Gelehrten, die in Ninive tätig waren, sind in die Regierungszeit Asarhadddons zu datieren, also in die Zeit um 680–669 v. Chr. Es ist auffällig, dass die Namen dieser Gelehrten in der Regel nur in Briefen und Leber-schau-Berichten genannt werden, nicht jedoch in den Kolophonen der von ihnen geschrie-benen literarischen Texte. Diesen sind meist nur Herkunft der Vorlage oder Titel der Kom-position sowie Tafelnummer, sofern es sich um eine Serientafel handelt, zu entnehmen, was z. B. anhand der Ritualtafel K. 2773+ (Caplice, OrNS 39, Tab. VI–VII) deutlich wird: Bei dieser einkolumnigen Ritualtafel findet sich nur der Vermerk, die Tafel sei nach dem Wort-laut einer Schreibtafel geschrieben, der Text anschließend jedoch nicht kollationiert worden ([... ša] KA GIŠ.le-u5-um NU.IGI.TAB SAR).
4 Vgl. M. Dietrich, The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib (SAA XVII), Hel-
sinki 2003, Nrr. 1–3, 5 und 6.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 271
Auch diejenigen Tafeln, in deren Kolophon der Name der Schreiber genannt bzw. erhal-ten ist, lassen sich oft zeitlich nicht näher einordnen, weil die fraglichen Tafeln äußerst selten datiert sind. Exemplarisch für die wenigen Beispiele für einen datierten literarischen Text dient die Tafel mit Mondomina K. 75+ (Virolleaud, ACh Suppl. 7): Dem außerge-wöhnlich ausführlichen Kolophon ist zu entnehmen, dass die Tontafel am „23. Tag, im Eponymat des Ilu-ittīja, des Statthalters von Damaskus, und 11. Jahr des Sanherib, des Königs des Landes Assur“, also um 694 v. Chr., in Kalḫu geschrieben wurde. Sie gehört zur Bibliothek des berühmten Schreibers Nabû-zuqup-kēnu, des Sohnes von Marduk-šuma-iqīša und Nachfahren von Gabbi-ilāni-ēreš. Als Vorlage diente eine Tafel, welche der Ba-bylonier Nabû-nāsir, Sohn des Ea-paddāni, für „sein Lesen“ geschrieben und kollationiert hat. Bei K. 75+ ist auffällig, dass Nabû-zuqup-kēnu nicht nur für den Text den babyloni-schen Duktus seiner Vorlage übernommen hat, sondern auch für den von ihm selbst formu-lierten Kolophon. Es darf also als gesichert gelten, dass die bedeutenden assyrischen Ge-lehrten der damaligen Zeit nicht nur in der Lage waren, assyrische und babylonische Keil-schrift zu lesen, sondern auch beides zu schreiben.
Gleiches scheint auch für den assyrischen Oberschreiber und Astrologen Issar-šumu-ēreš, Sohn des Nabû-zēru-lēšer, zu gelten, welcher am assyrischen Hof zur Zeit von Asar-haddon (680–669 v. Chr.) und Assurbanipal (668– ca. 627 v. Chr.) eine zentrale Funktion ausübte.5 Neben den zahlreichen Briefen und Berichten über Himmelserscheinungen, wel-che Issar-šumu-ēreš in assyrischer Schrift abgefasst hat, lässt sich auch eine Tontafel mit
5 Vgl. hierfür zuletzt H. Hunger, Astrological Reports to Assyrian Kings (SAA VIII), Helsinki
1992, XX–XXI, und S. Parpola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars (SAA X), Hel-sinki 1993, XXV–XXVII.
Jeanette C. Fincke 272
Leber-Omina in babylonischer Schrift finden (K. 3877), die er während der Regierungszeit Assurbanipals niedergeschrieben hat. Der fragmentarisch erhaltene Abschnitt am Ende der 4. Kolumne dieser Tafel lässt sich mit Hilfe eines anderen Kolophons (LSS II 4, 4, 43–46) größtenteils ergänzen, wie bereits Hermann Hunger in seinem Buch Babylonische und assyrische Kolophone (AOAT 2, Neukirchen-Vluyn 1968) unter Nr. 344 notiert hat. Der Kolophon dieser Tafel lautet in Übersetzung: „122 Einträge. Für das Lesen exz[erpiert]. Tafel des Issar-šumu-ēreš, [des Oberschreibers] von Assurbanipal, dem Kön[ig des Landes Aššur], des Sohnes des Nabû-zēru-lēšer, [des obersten Lehrers]“.
Diese beiden gerade vorgestellten Tafelkolophone stellen jedoch Ausnahmen unter den babylonisch geschriebenen Tafeln aus Ninive dar. Die meisten Texte sind in einem frag-mentarischen Zustand und verfügen nicht über einen Kolophon. Von den 1594 literarischen Texten und Textfragmenten aus Ninive in babylonischer Schrift sind nur bei 125 Tafeln Kolophone bzw. Reste von Kolophonen erhalten. Unter diesen lassen sich an 13 Tafeln die
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 273
Namen der Schreiber bzw. Reste davon lesen. In 11 Kolophonen sind Angaben über die Herkunft der Vorlage enthalten, nach welcher die fragliche Tafel geschrieben wurde: Sie stammen aus Babylonien, Assyrien, Akkad und einer unbekannten Stadt. Alle diese Tafeln gehören dem Bereich der religiösen Texte an, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf der Divination bzw. der Abschrift von Omentexten liegt.6 In zwei Kolophonen wird die Her-kunft des Schreibers bezeichnet. In einem Schaubild läßt sich diese Situation folgenderma-ßen verdeutlichen:
In babylonischer Keilschrift geschriebene literarische Tafeln aus Ninive
1594 Babylonisch geschriebene literarische Tafeln
125 Tafeln mit (Resten von) Kolophonen
13 Kolophone mit Nennung des Schreibers
11 Angaben über Herkunft der Vorlage
davon 6 aus Babylonien (Babylon7, Kutha8)
3 aus Assyrien9
1 aus Akkad (sc. Nordbabylonien)10
1 aus (K. 5824+10337)11
2 Kolophone mit Herkunft des Schreibers
Nur zwei Kolophonen lassen sich Angaben über die Herkunft des Schreibers entneh-men: Der erste befindet sich auf der in Kalḫu geschriebenen Tafel von Nabû-zuqup-kēnu, dessen Schreibvorlage von dem Babylonier Nabû-nāsir, Sohn des Ea-paddāni, stammt (sie-he oben K. 75+). Der zweite Schreiber, dessen Herkunft bekannt ist, hat die astrologische Omentafel K. 6113 verfasst. Er scheint aus der Stadt Dūr-anunīti zu stammen. Diese Stadt ist ferner in dem an Sargon II. gerichteten Brief K. 999 (ABL 455, vgl. A. Fuchs/S. Parpola, The Correspondence of Sargon II, Part III [SAA XV], Helsinki 2001, Nr. 30) Rs. 7 bezeugt und liegt in der Nähe von Mê-turnat (Tall Haddād) in der Dijāla-Region.
6 Nur zwei Texte enthalten Hymnen: K. 5268+5333a (Macmillan, BA 5.5, 642–643) enthält eine
zweisprachige Hymne an Nergal und K. 6073 (Geers Heft B, 28)+Bu. 91-5-9-132 (Gray, The Šamaš Religious Texts, pl. 20) eine Hymne an Šamaš.
7 K. 75+ (Virolleaud, ACh Suppl. 7), K. 3139 (Craig, AAT Pl. 6 = Virolleaud, ACh Sin 1); K. 8637 (Geers Heft A, 19); K. 12188; Th. 1905-4-9, 88 (CT 34, Pl. 8–9); 79-7-8, 121 (Virolleaud, ACh Sin 34)+125.
8 K. 5268+5333a (siehe Anmerkung 5). 9 Rm.II 127 (Photo: AfO 24, 101); K. 6073+ (siehe Anmerkung 5). 10 Rm.II 569 (L. Verderame, Le Tavole I–VI della serie astrologica Enūma Anu Enlil [NISABA 2],
Roma 2002, pl. VII Nr. 2). 11 E. Reiner, Babylonian Planetary Omens Part Three (CM 11), Groningen 1998, 123, transliteriert
die fragliche Zeile: B2 colophon [ Z]I RI ÁŠ TE DIŠ KI.
Jeanette C. Fincke 274
Aus der königlichen Korrespondenz12 und den sogenannten „library records“ der Pa-
lastbibliothek13 geht hervor, dass sich der Herrscher in Ninive das babylonische Fachwissen nicht nur durch das Konfiszieren von Tontafeln zunutze machte,14 sondern auch zahlreiche babylonische Gelehrte direkt am Hof beschäftigte. Über ihre Herkunft ist jedoch nur in seltenen Fällen etwas bekannt: So werden in diesem Zusammenhang z. B. nur Nippur und Babylon erwähnt, während als Herkunft der Vorlagen für wohl in Ninive von assyrischen Schreibern gefertigte Abschriften neben den allgemeinen Bezeichnungen für Babylonien („Sumer und Akkad“) bzw. spezieller Nordbabylonien („Akkad“) besonders die nordbaby-lonischen Städte Babylon, Borsippa und Kutha genannt werden.
Wenn man bedenkt, dass ihre Herkunft gleichzeitig die „Schule“ bezeichnet, aus wel-cher sie ihr Wissen bezogen haben, ist es erstaunlich, dass die Herkunft dieser babyloni-schen Schreiber offenbar nicht von Interesse war. Das überrascht, denn die Arbeit dieser Gelehrten in Ninive umfasste sicher nicht nur das Unterrichten assyrischer Schreiberschü-ler. Auf diesen Tätigkeitsbereich wird in den Kolophonen mit der Formulierung verwiesen, die Tafel sei ana pî ummâni šater, „nach dem Diktat eines Gelehrten geschrieben“. Es ist zu vermuten, dass die babylonischen Fachkundigen ihr im Gedächtnis gespeichertes Wissen auch selbst auf Tontafeln verewigten, wie sich aus den verschiedenen Handschriften der Tontafelfragmente schließen lässt. Oder muss man davon ausgehen, dass die meisten in
12 Vgl. für diese besonders S. Parpola, SAA X (siehe oben Anmerkung 4) sowie die anderen Bände
der Reihe State Archives of Assyria (SAA). 13 Vgl. für diese S. Parpola, Assyrian Library Records, JNES 42 (1983), 1–29, F.M. Fales/J.N. Post-
gate, Imperial Administrative Records, Part I (SAA VII), Helsinki 1992, Nrr. 49–56, und J.C. Fincke, AfO 50 (2003/04 publ. 2005), 126–129.
14 Vgl. hierfür zuletzt G. Frame/A. George, The Royal Libraries of Nineveh: New Evidence for King Ashurbanipal’s Tablet collecting, Iraq 67 (2005), 265–284, und J.C. Fincke, AfO 50 (2003/04 publ. 2005), 122–124.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 275
Ninive aufgefundenen babylonischen Tontafeln aus den privaten Bibliotheken dieser Ge-lehrten stammen?
Aufgrund der dürftigen Informationslage schriftlicher Hinweise müssen die Tontafeln selbst untersucht werden, um etwas über die Herkunft dieser babylonischen Migranten am neuassyrischen Königshof zu erfahren. Diesbezüglich sollte nicht nur der Duktus der Ton-tafeln genauer betrachtet werden, sondern auch andere Merkmale, wie z. B. die Art und Weise, in welcher Linien auf der Tontafel gezogen werden, oder welche Form die soge-nannten Brennlöcher haben.
Bei den zweikolumnigen Bibliothekstafeln aus Ninive gibt es in der Regel einen ganz eindeutigen Unterschied zwischen assyrischen und babylonischen Tontafeln: Bei den baby-lonischen Tafeln werden sowohl die waagerechten Paragraphenstriche als auch die senk-rechten Kolumnentrenner mit dem Stylus oder einem Lineal in den noch feuchten Ton gedrückt, wie man bei dem Fragment des medizinischen Textes K. 9579 (Thompson, AMT 58, 7) deutlich erkennen kann.
Jeanette C. Fincke 276
Bei assyrisch geschriebenen Tontafeln können die Linien auf zweierlei Art gezogen wer-den: Während die waagerechten Linien wie bei den babylonischen Tontafeln mit dem Stylus oder einem Lineal gezogen werden, können die senkrechten Kolumnentrenner mit Hilfe eines gezwirnten Fadens erzeugt werden,15 wie am Beispiel von K. 2308+ (Virolleaud, ACh Suppl. 21 + ACh Sin 35+32) zu sehen ist.
Dieser relativ leicht zu erkennende Unterschied hilft in der Regel bei der Einordnung kleiner Tafelfragmente, bei denen die erhaltenen Zeichenreste keinen Hinweis darauf ge-ben, ob ein assyrischer oder babylonischer Duktus vorliegt. Aber wie bei jeder Regel gibt es auch hier Ausnahmen: So konnte ich z. B. in der Kouyunjik-Collection des British Mu-
15 Auf diesen Unterschied hat mich freundlicherweise Stefan M. Maul aufmerksam gemacht.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 277
seum eine babylonisch geschriebene Tontafel mit Beschwörungen finden (Th. 1905-4-9, 72+73), bei welcher die Kolumnentrenner mit einem gezwirnten Faden erzeugt wurden.
Entweder hat hier ein babylonischer Schreiber aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit mit assyrischen Kollegen angefangen, deren Angewohnheiten zu übernehmen, oder ein assyrischer Schreiber hat sich im Schreiben babylonischer Keilschrift geübt, dabei jedoch übersehen, dass die Babylonier senkrechte Linien anders ziehen.
Bei einigen assyrischen wie auch bei einigen babylonischen Tontafeln aus Ninive gibt es sogenannte Brennlöcher. Diese Brennlöcher, für deren Anbringung an Tontafeln als frühestes Beispiel ein altbabylonisches Exemplar angeführt werden kann,16 sind in der Regel rund – man nimmt an, dass sie mit dem hinteren runden Ende des Stylus in den noch feuchten Ton eingetieft worden sind. In Bezug auf ihre Größe können sie variieren. Als Beispiel einer babylonisch geschriebenen Tafel aus Ninive mit besonders großen Brennlö-
16 Vgl. hierfür B. Alster/C.B.F. Walker, Some Sumerian Literary Texts in the British Museum, in: H.
Behrens et al (Hg.) DUMU-E2-DUB-BA-A. Studies in Honor of Ǻke W. Sjöberg, Philadelphia 1989, 10–11 (BM 96573).
Jeanette C. Fincke 278
chern kann K. 5168+17 dienen. Bei dem Text dieser Tafel handelt es sich um zweisprachige Gebete. Für ein Beispiel mit kleineren Brennlöchern siehe unten das Photo der später in Verbindung mit dem Duktus zu besprechenden Tafel K. 2887 (Virolleaud, ACh 2 Suppl. 15).
Unter den babylonisch geschriebenen Tontafeln finden sich drei Tafelfragmente, bei denen die Brennlöcher rechteckig sind. Zwei dieser Tafelfragmente gehören mit an Sicher-
17 K. 5168 + 5171 (Geers Heft K, 15) + 5189 (Geers Heft C, 22) + 5354 (Geers Heft K, 15) + 6099 +
8728 + 10728 + 11219 + 13412 (Langdon, BL, pl. 42) + 13935 + 13949.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 279
heit grenzender Wahrscheinlichkeit zu derselben Tafel (K. 5167 [Meek, ASJ 7, 81] und K. 5362+18, beide enthalten den Text von zweisprachigen balags), während das dritte, das hier vorgestellt werden soll, sicher von einer anderen Tafel stammt (K. 41 [Pinches, PSBA 17, Pl. I–II; Black, ASJ 7, 77]). Die rechteckigen Brennlöcher sind innerhalb der Zeilen waagerecht und zwischen den Kolumnen senkrecht angebracht. Es ist auffällig, dass alle drei Tafelfragmente zweisprachige balags enthalten.
Rechteckige Brennlöcher sind äußerst selten und ich musste lange suchen, bis ich in der Babylon Collection des British Museum ein weiteres Beispiel hierfür finden konnte. Es handelt sich um BM 47753 (Geller bei Stol, Epilepsy in Babylonia [CM 2], 156–157), ein Exemplar der 26. Tafel der Serie SA.GIG,19 der sogenannten diagnostischen Omenserie. Leider gibt der Kolophon dieser Tontafel nur Auskunft über die Serienzugehörigkeit, nicht aber über den Schreiber oder den Ort der Verschriftung. Somit lässt sich nicht feststellen, ob die Ange-wohnheit, rechteckige Brennlöcher zu produ-zieren, typisch für eine bestimmte Schule oder vielleicht nur für eine bestimmte Schreiberfa-milie ist.
18 K. 5362 (unpubliziert) + K. 8898 (Meek, BA 10, 92) + K. 11938 (Geers, Heft A, 135) + K. 13410
(Black, ASJ 7, 83) + Rm. 385 (Meek, BA 10, 122). 19 Diese Tafel ist zuletzt von N.P. Heeßel, Babylonisch-assyrische Diagnostik (AOAT 43), Münster
2000, 278–296, bearbeitet worden.
Jeanette C. Fincke 280
Bei meinem Versuch, die Schrift der babylonischen Tafeln aus Ninive zeitlich und/oder regional einzuordnen, bin ich zunächst die Babylon Collection des British Museum durch-gegangen, um etwa zeitgleiches Vergleichsmaterial zu finden, bei welchem der Ort der Verschriftung genannt wird. Die früheste datierte Tafel, bei welcher die Herkunft bekannt ist, wurde im 2. Regierungsjahr von Darius, also 500 v. Chr., mehr als 100 Jahre nach der Zerstörung Ninives in Babylon geschrieben. Es handelt sich um die Tafel mit der babyloni-schen Chronik (BM 92502), die in CT 34 Plate 46–50 (dort fälschlich als BM 99502 be-zeichnet) publiziert und von A. K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, New
York 1975, 69–87 (Text A) bearbeitet worden ist. Die Zeichenformen weisen im Grunde keinen Unterschied zu denjenigen des 8. und 7. Jh.s v. Chr. auf. Die senkrechten Keile sind jedoch etwas länger nach unten gezogen als bei den früheren Texten aus Babylon, so dass der eindeutige Zwischenraum zwischen den Zeilen − in der Regel typisch für Tontafeln aus Babylon − nicht mehr so deutlich zu erkennen ist.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 281
Anders sieht es hingegen z. B. bei der nebenstehenden astrologischen Omentafel (BM 32162) aus der Babylon Collection des British Museum aus: Die Zeichen erscheinen kom-pakter, als wären sie in ein Quadrat oder ein liegendes Rechteck eingepasst, und nur wenige senkrechte Keile greifen bis in den darunterliegenden Keil der nachfolgenden Zeile hinein. Ansonsten sind die Zeichenformen mit denjenigen der Tafel aus der Regierungszeit von Darius vergleichbar.
Aus diesen Beobachtungen könnte man schließen, dass die lang nach unten gezogenen senkrechten Keile ein Datierungskriterium darstellen. In diesem Zusammenhang mag man an den Duktus der spätbabylonischen Texte aus Uruk denken, bei denen die Keile nicht nur lang nach unten gezogen, sondern darüber hinaus auch nach links geneigt, also kursiv sind. Wenn die lang nach unten durchgezogenen senkrechten Keile typisch für die späteren Texte wären, müssten folgende Tafelfragmente der Omenserie iqqur īpuš (BM 68058; BM 72516) aus Sippar ebenfalls spätbabylonisch zu datieren sein, denn hier werden die senk-rechten Keile ausschließlich durch die später in die darunterliegende Zeile eingefügten Keilschriftzeichen begrenzt.
Jeanette C. Fincke 282
Diese Annahme lässt sich jedoch angesichts der in Ninive gefundenen babylonischen Tafelfragmente mit lang nach unten ausgezogenen senkrechten Keilen nicht halten: Die Tafel Rm. 518 (CT 46, 52) enthält ein Gebet an die Gottheiten Baba und Gula von Isin und ist laut Kolophon die Kopie einer Tafel aus Babylon.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 283
K. 2782 (Photo: Caplice, OrNS 36, Tab. 60) enthält ein namburbi-Ritual, hier ist kein Kolophon erhalten. Diese beiden Fragmente müssen vor 612 v. Chr. geschrieben worden sein, denn in jenem Jahr wurde Ninive zerstört. Es wäre natürlich möglich, dass diese Fragmente im British Museum versehentlich in die Kouyunjik-Sammlung eingereiht wur-den, während sie ursprünglich aus Babylonien stammen und einer späteren Periode zuzu-ordnen sind. Dies lässt sich mit Hilfe des Fragmentes K. 2912 (Koch, Secrets of Extispicy [AOAT 326], Pl. LIII–LIV) leicht widerlegen: K. 2912 ist Bruchstück einer Tafel mit Lebe-romina (multābiltu) und trägt einen Assurbanipal-Kolophon. Damit ist diese Abschrift auf die Mitte des 7. Jh. v. Chr. datiert.
Jeanette C. Fincke 284
Keilschriftzeichen können auch wie in die Breite gezogen wirken, wie dieses Beispiel aus Ninive zeigt: Bei dem Fragment K. 20930 ist das Zeichen BAL in der untersten Reihe breiter als das Zeichen MUL schräg rechts darüber; das Zeichen IGI ist gleichfalls sehr in die Breite gezogen. Auch bei anderen Fragmenten babylonisch geschriebener astrologischer Omentexte ist in Bezug auf die Schrift eher die Breite betont.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 285
Einige Ninive-Fragmente sind von Schreibern angefertigt worden, die sehr große Keil-schriftzeichen bevorzugen, zahlreiche andere weisen eine sehr kleine Handschrift auf. Wäh-rend der Schreiber von K. 1930+ (Thompson, AMT 65, 2 + CT 28, 40) innerhalb eines Zentimeters nur zwei Zeilen unterbringt, kann der Schreiber von K. 2231 in demselben Abschnitt drei Keilschriftzeilen eintiefen.
Diese Beispiele zeigen, dass die Art und Weise, in welcher die äußere Form der Keil-schriftzeichen gestaltet ist – ob die senkrechten Keile nach unten „langgezogen“ oder die Zeichen insgesamt wie in die Breite gezogen erscheinen, ob sie groß oder sehr klein sind – nicht in erster Linie ein Datierungskriterium darstellt, sondern vielmehr Hinweis auf die Tradition einer Schreiberschule oder eines Ortes sein muss bzw. Kennzeichen einer indivi-duellen Handschrift darstellt.
Neben der allgemeinen äußeren Erscheinung der Keilschriftzeichen gibt es unter den babylonisch geschriebenen Tafeln aus Ninive auch bei der Zusammensetzung der einzelnen Keile zu einem Zeichen Unterschiede. Das soll an einigen Beispielen demonstriert werden:
Jeanette C. Fincke 286
Die Tafel mit Mondfinsternisomina K. 3561+20 zeigt einen Duktus, der mit dem mittel-babylonischen eng verwandt ist. Entsprechende Zeichenformen finden sich auch auf an-deren Fragmenten aus Ninive; es handelt sich hierbei also nicht um einen Einzelfall.
Die Form des Zeichens KI mit nur einem schrägen Keil bzw. Winkelhaken findet sich gelegentlich auf alt- und mittelbabylonischen Tafeln, aber auch auf spätbabylonischen Tafeln aus Uruk (vgl. z.B. SpTU I21 Nr. 30, wo auch das RU mit drei nebeneinander ste-henden senkrechten Keilen erscheint; siehe für dieses unten Sm. 219 Rs.). Soll man die späte Verwendung dieser Zeichenformen als Zufall werten oder ist sie eben doch in einer oder mehreren Schreiberschulen über die allgemein übliche Verwendungszeit hinaus tra-diert worden?
20 Bearbeitet von F. Rochberg-Halton, Aspects of Babylonian Celestial Divination (AfO Beiheft 22),
Horn 1988, 179–219 (Rec. B text S). 21 H. Hunger, Spätbabylonische Texte aus Uruk I (Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemein-
schaft in Uruk-Warka 9), Berlin 1976.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 287
Eine andere Art, das Keilschriftzeichen KI zu schreiben, zeigt z. B. die Tafel mit Mon-domina K. 2887 (Virolleaud, ACh 2. Suppl. 15): Während das Zeichen KI beim soeben vorgestellten Duktus nur einen Winkelhaken aufweist und damit der assyrischen Form sehr ähnlich ist, hat das KI bei diesem Duktus zwei Winkelhaken, so wie es seit der mittelbaby-lonischen Zeit allgemein üblich ist. Bei diesem Duktus steht der untere Winkelhaken vor dem senkrechten Keil, während der obere Winkelhaken hinter dem Kopf des ersten senk-rechten Keiles, gleichsam über dem Zeichen angebracht ist. Im Grunde ist diese Ausprä-gung des Zeichens die Weiterentwicklung derjenigen altbabylonischen Zeichenform, bei welcher die waagerechten Keile im Grunde in ein schräggestelltes Rechteck eingeschrieben werden. Diejenige Variante des Zeichens KI, welche im Text K. 2887 Verwendung findet, kann auch auf neubabylonischen Tafeln aus Nippur, Dēr und Babylon nachgewiesen werden.
Die ungewöhnliche Zeichenform des LU – es handelt sich eindeutig um ein LU, denn das Zeichen ist dem Logogramm für die Menschheit, NAM.LÚ.U19.LU, entnommen – ist gelegentlich auch auf anderen babylonischen Tafeln aus Ninive zu finden (siehe unten Sm. 219). Beim Duktus von K. 2887 ist ferner das Zeichen TI auffällig, bei welchem der Schreiber auf einen zweiten waagerechten Keil, welcher in dem zweiten Winkelhaken hin-ter dem senkrechten Keil enden würde (vgl. oben das TI in BM 92052), verzichtet. Der zweite Winkelhaken ist so dicht an den senkrechten Keil herangerückt, dass das Fehlen des zweiten waagerechten Keils nicht auffällt.
Jeanette C. Fincke 288
Beim Duktus der Tafel Sm. 219 (Loretz/Mayer, Šu-ila-Gebete [AOAT 34], Nr. 39) er-scheinen zwei unterschiedliche Ausgestaltungen des Zeichens TI: Die erste Form entspricht derjenigen von K. 2887, bei welcher es nur einen waagerechten Keil gibt und der zweite Winkelhaken dicht an den senkrechten Keil herangezogen ist. Bei der zweiten Form zieht der Schreiber den ersten waagerechten Keil so lang aus, dass er durch den ersten Winkelha-ken hindurch bis zum Beginn des zweiten reicht. Diese Ausgestaltung des Zeichens hat Ähnlichkeit mit demjenigen TI, bei welchem vor jedem Winkelhaken je ein waagerechter Keil steht (vgl. oben das TI in BM 92052). Indem der Schreiber den ersten waagerechten Keil so weit in die Horizontale zieht, kann er auf den zweiten Waagerechten verzichten, das Zeichen bleibt immer noch eindeutig erkennbar. Das Zeichen ID beginnt in Sm. 219 mit drei waagerechten Keilen, während es beim oben besprochenen Duktus von K. 2887 vier waagerechte Keile hat, von denen die beiden mittleren leicht nach rechts eingerückt sind. Darüber hinaus zeigt die Vorderseite von Sm. 219 keine Besonderheiten.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 289
Eine Inspektion der Keilschriftzeichen der Rückseite führt jedoch zu einem anderen Er-gebnis: Hier steht ein ganz normales TI mit zwei waagerechten Keilen, die jeweils mit einem Winkelhaken abgeschlossen werden. Bei der besonderen Zeichenform der Vorder-seite handelt es sich demnach nicht um einen neu zu konstatierenden Duktus, sondern ein-fach um das Ergebnis eines Schreibers, der gelegentlich etwas unachtsam bei der Kompo-sition der Keilschriftzeichen auf dem noch feuchten Ton ist. Es handelt sich hierbei ledig-lich um Merkmale einer individuellen Handschrift.
Anhand dieser Beobachtung stellt sich die Frage, ob die ungewöhnliche Ausformung des Zeichens RU, welche mit den drei nacheinander gesetzten senkrechten Keilen im Grun-de der altbabylonischen Zeichenform ähnlich ist (vgl. hierfür z. B. auch SpTU I22 Nr. 30), ebenfalls als Ergebnis der Unachtsamkeit des Schreibers zu betrachten oder Kennzeichen eines besonderen Duktus ist.
22 Siehe oben Anmerkung 20.
Jeanette C. Fincke 290
Als nächstes soll die Tafel mit Jupiteromina K. 2916+23 vorgestellt werden. Auf dieser Tafel findet sich derjenige Duktus, in welchem die meisten babylonischen literarischen Tafeln aus Ninive geschrieben sind. Auch diejenigen Tontafeln, welche einen Assur-banipal-Kolophon tragen, weisen diesen Duktus auf.
Auf der hier exemplarisch ausgewählten Tafel gibt es eine Variante, die auf den ersten Blick eine Datierung in eine frühere Zeit zulassen würde. Der Schreiber dieser Tafel ver-wendet ebenfalls die eher altbabylonische Form des Zeichens RU mit den drei hintereinan-der gesetzten senkrechten Keilen, wie sie bereits auf Sm. 219 (siehe oben) zu sehen war. Es handelt sich hierbei jedoch nur um ein einzelnes Beispiel für diese Zeichenform auf dieser Tafel, alle anderen Keilschriftzeichen RU zeigen die rechts daneben abgebildete mittel- bis spätbabylonische Form, die sich auf fast allen Texten aus Ninive wiederfindet. Bei den Ninive-Texten ist es demnach nicht ratsam, allein anhand der Zeichenform des RU eine Datierung vorzunehmen.
Als weitere Besonderheiten dieses Duktus der neubabylonischen Keilschrift sind fol-gende zu nennen: Beim Keilschriftzeichen KI stehen beide Winkelhaken vor dem ersten senkrechten Keil. Beim MEŠ ist der erste Winkelhaken entweder vor oder auf den senk-
23 Bearbeitet von E. Reiner, Babylonian Planetary Omens 4, Groningen 2005, 166–172.
Babylonische Gelehrte am assyrischen Hof 291
rechten Keil gesetzt. Bei MEŠ und beim TI beginnt der waagerechte Keil eindeutig vor dem senkrechten Keil. Diese Zeichenformen konnte ich auch auf Tontafeln aus Babylon, Kiš, Ur und Uruk ermitteln.
Die in diesem Beitrag vorgestellten Beispiele zeigen die typischen Ausprägungen der babylonischen Keilschrift auf den Ninive-Tafeln. Zur besseren Übersicht seien die unter-schiedlichen Zeichenformen in einem Schaubild einander gegenübergestellt:
Die Zuordnung dieser Duktus-Formen zu denjenigen der verschiedenen babylonischen Städte gestaltet sich schwierig, weil die meisten der hierbei zu vergleichenden Tafeln nur in Autographie zugänglich sind und die Kopisten der früheren Jahre nicht immer den An-spruch hatten, den Duktus der Tafel wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Dies hat sich in-zwischen glücklicherweise geändert, dennoch ist die Zahl an zuverlässigem Vergleichsma-terial für eine derartige Untersuchung noch nicht groß genug.24 Zudem sollte untersucht werden, ob weitere Kriterien für die eindeutige Zuordnung einer Tontafel zu bestimmten Schulen oder Städten gefunden werden können bzw. ob eine Kombination mehrerer Krite-rien hierbei zum Erfolg führen kann. In diesem Zusammenhang sei nicht nur auf die bereits genannten Merkmale wie Zeilenabstand und Größe der Keile sondern z. B. auch auf die Form der Tafel oder die Reihenfolge, in welcher die Schreiber ihre Keilschriftzeichen zu-sammensetzten,25 hingewiesen.
24 Eine Untersuchung der Keilschriftpaläographie wird derzeit in dem von A. Livingstone geleiteten
„Cuneiform Digital Palaeography Project“ der University of Birmingham und dem British Muse-um, London, durchgeführt. Erste Ergebnisse sind online unter http://www.cdp.bham.ac.uk/
index.htm zu finden. 25 Vgl. den grundlegenden Beitrag von D.O. Edzard über die Paläographie der Keilschrift, in: Real-
lexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 5, Berlin – New York 1976/80, 555–561. Vgl. ferner W. Sallaberger, in: F. Ismail/W. Sallaberger/P. Talon/K. van Lerberghe, Admi-
Jeanette C. Fincke 292
Der hier präsentierte Überblick über die auf den babylonischen literarischen Tafeln aus Ninive vertretenen Duktus-Formen soll als Anregung verstanden werden, bei zukünftigen Bearbeitungen von Tontafeln dem Duktus der Texte größere Beachtung zu schenken, damit es eines Tages möglich wird, anhand der hierbei zu beobachtenden Information die Her-kunft der Schreiber, wenn nicht in Bezug auf eine bestimmte Stadt, so doch vielleicht in Hinblick auf eine Region erkennen zu können.
nistrative Documents from Tell Beydar (Seasons 1993–1995) (Subartu 2), Turnhout 1996, 61–67, aber auch besonders die Ergebnisse des in der vorangehenden Anmerkung genannten Projektes.