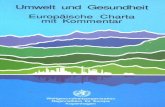European Cities in World War II / Europäische Großstädte während des Zweiten Weltkriegs
Transcript of European Cities in World War II / Europäische Großstädte während des Zweiten Weltkriegs
619
ZUSAMMENFASSUNG / SUMMARY
Olga Fejtová
Übersetzt von Anna Ohlídalová / Translated by Miloš Rataj
*
EUROPEAN CITIES DURING WORLD WAR IIEVERYDAY LIFE IN AN OCCUPIED CITY
PRAGUE 1939–1945 IN A EUROPEAN COMPARISON
Conference proceedings from the 24th scientifi c session of the Archives of the Capital City of Prague held in co-operation with the Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf and the Institute of International Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University
Prague on October 11th and 12th, 2005, in the representative Halls of the Clam-Gallas Palace in Prague
Edited by Olga Fejtová, Václav Ledvinka and Jiří Pešek with the Editorial Board
*
EUROPÄISCHE GROSSSTÄDTE WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES
DER ALLTAG DER BESETZTEN GROSSSTADT
PRAG 1939–1945 IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH
Tagungsband der 24. wissenscha� lichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf und dem Institut für internationale Studien der Fakultät für Sozialwissenscha� en der Karlsuniversität
Prag am 11. und 12. Oktober 2005 im Palais Clam-Gallas in Prag
Herausgegeben von Olga Fejtová, Václav Ledvinka und Jiří Pešekmit dem Redaktionsausschuss
*
620
Documenta Pragensia XXVI (2007)
620
Jiří Pešek, Europäische Großstädte während des Zweiten Weltkrieges (S. �–��)
Die Geschichte der (Groß-)Städte ist ein sehr komplexer For-schungsbereich mit ausgeprägten (und traditionell dominierenden) rechts-, sozial-, wirtscha� s- und kulturhistorischen Zügen.¹ Neben den rechtlichen, administrativen und – auf verschiedenen Ebenen – politischen Aspekten der Geschichte spielt die breit verstandene Problematik von Urbanistik, Architektur, Wohnraum und Wirt scha� (sowohl im Produktionsbereich als auch vor allem in der Sphäre des Konsums) eine Rolle. Weiter muss im Kontext der Position der Großstädte als „Oberzentren“ vielfach ausgedehnter Einzugsberei-che über Verkehrs- oder allgemeiner Kommunikations- sowie Infor-mationsfragen im breitesten Sinne des Wortes gesprochen werden.² Hieran knüp� der umfangreiche � emenbereich der Forschungen zum sozialen Charakter der Städte an, und zwar nicht nur auf der Ebene der sozialen Strukturen und der Dynamik ihrer Veränderun-gen, sondern auch auf der Ebene der sozialen Kommunikation und der Artikulierung sozialer Interessen, die sich in Großstädten in vie-len, o� sehr „verdichteten“ Formen präsentierten.³ Die erfolgreiche
¹ Die neueste Inventur des Forschungsstandes fi ndet sich bei Friedrich Lenger, Pro bleme einer Geschichte der europäischen Stadt im 20. Jahrhundert. Anmer-kungen zum Forschungsstand samt einiger Schlussfolgerungen, Informationen zur modernen Stadtgeschichte (weiter IMS) 1, 2005, S. 96–113, bzw. ders. in einer geringfügig verbesserten Version dieses Textes als Einleitung in: Friedrich Lenger – Klaus Tenfelde (Hrsg.), Die europäische Stadt im 20. Jahrhundert. Wahr-nehmung – Entwicklung – Erosion, Köln – Weimar – Wien 2006, S. 1–21. Hier erklärt der Autor sowohl die gängigen Handbücher – Christian Engeli – Horst Matzerath (Hrsg.), Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, USA und Ja-pan, Stuttgart 1989, und Richard Rodger (ed.), European Urban History. Prospect and Retrospect, Leicester 1993 – wie auch (namentlich für das 20. Jahrhundert) die auf die ältere Geschichte konzentrierte Synthese von Paul H. Hohenberg – Lynn H. Lees, � e Making of Urban Europe. 1000–1994, Cambridge 1995, für überholt. Die Arbeit von Leonardo Benevolo, Die Stadt in der europäischen Geschichte, München 1993, wird von Lenger wegen ihrer allzu engen architek-tonisch-urbanistischen Ausrichtung abgelehnt.
² Zu den Fragen der Einbeziehung des Hinterlandes der Großstädte in deren urbanistischen Kontext vgl. neuerdings Walter Siebel (Hrsg.), Die europäische Stadt, Frankfurt a. M. 2004.
³ Vgl. den Sammelband Andreas R. Hofmann – Anna Veronika Wendland (Hrsg.), Stadt und Öff entlichkeit in Ostmitteleuropa 1900–1939, Stuttgart 2002.
621621
Zusammenfassung / Summary
Expansion der „neuen Kulturgeschichte“ in zahlreiche historische Fachgebiete macht allerdings die besondere, jedoch etliche andere Bereiche überlappende traditionelle � ematisierung der Geschichte der Kultur nicht überfl üssig: Diese umfasst eine Reihe von Ebenen, vom Schulwesen über die Medien, das künstlerische Schaff en und die Bil dung von Werten bis zu kulturell geprägten oder interpretierba-ren Festivitäten bzw. zur vielfältigen Rezeption kultureller Modelle.⁴ Und an den bereits erwähnten sozialen Aspekt der Geschichte der (Groß-)Städte knüp� dann die bevölkerungsgeschichtliche Proble-matik zusammen mit Fragen der Migrations- und der Siedlungsge-schichte an. Kurz gesagt, im Fall der Großstädte, die in der „moder-nen Welt“ des 20. Jahrhunderts und besonders in Europa eine Art verdichtete Form der Gesamtgesellscha� darstellen, handelt es sich um eine ungewöhnlich komplexe � ematik⁵, um Geschichtssubjekte, die hier spätestens seit dem Ersten Weltkrieg manchmal als Kontra-hent, häufi ger als Objekt staatlicher Interessen und Eingriff e oder auch – besonders zur Zeit der großen Kriege – als Opfer mangeln-der staatlicher Kompetenz erscheinen.⁶
Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Tagung muss der aufge zeigte breite thematische Horizont noch um eine modern ver-standene Militärgeschichte ergänzt werden: um die Geschichte der repressiven Organe des Besatzungsregimes, die Geschichte des Wi-derstandes und der Kollaboration und natürlich die Geschichte des Terrors als politische, kulturelle und psychosoziale Erscheinung.⁷ Die
⁴ F. Lenger, Probleme einer Geschichte, S. 99: „Stand die Industrie- und Arbei-terstadt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts noch im Zentrum des sozialge-schichtlichen Interesses der 1970er und 1980er Jahre, ließ die Hinwendung zur Kulturgeschichte und zur Kulturwissenscha� überhaupt andere Gegenstände und andere Herangehensweisen reizvoller erscheinen.“ Er verweist dabei auf die Arbeit von Peter Borsay – Gunther Hirschfelder – Ruth E. Mohrmann (edd.), New Directions in Urban History. Aspects of European Art, Health, Tourism and Leisure since the Enlightenment, Münster 2000.
⁵ In diesem Kontext spricht F. Lenger, Probleme einer Geschichte, S. 105, von der Großstadt als dem Ort der Entstehung der Massengesellscha� und dem „Symbol der Moderne“.
⁶ Im Kontext dieser Tagung vgl. Rainer Hudemann – François Walter (éd.), Villes et guerres mondiales en Europe au XXe siècle, Paris – Montréal 1997.
⁷ Vgl. Marcus Funck (Hrsg.), Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert. � emen schwer-punkt, IMS 2, 2004, S. 5–84. In der Einleitung zu dieser � emennummer der IMS spricht Funck vom 20. Jahrhundert als dem Zeitalter des „Urbizids“,
622
Documenta Pragensia XXVI (2007)
622
Großstädte wurden zum bevorzugten Ziel von fl ächendeckendem, zerstörerischem Kriegsterror. Ihre totale Vernichtung oder im Ge-genteil der zähe Widerstand der Verteidiger und vor allem der staats-bürgerlichen Öff entlichkeit wurde zum dominierenden, bedeuten den Faktor und Symbol des Kriegserfolgs (und natürlich auch des natio-nalen Erfolgs), zum Symbol für entschlossene Widerstandsfähigkeit, für Sieg oder Niederlage.⁸ Wenn wir – unter Berücksichtigung der Prager Besonderheiten – noch die Geschichte der nationalsozialis-tischen „Endlösung der Judenfrage“ in Prag betonen⁹, das im Hin-blick auf Siedlung, Wirtscha� und Kultur immer das Schlüsselzen-trum der jüdischen Ethnie in den böhmischen Ländern war, oder auf die nationalsozialistischen Pläne für den Nachkriegsumbau der Stadt Prag in eine vorbildha� e und mustergültige deutsche Stadt hinwei-sen, so stehen wir erschöp� vor einer umfangreichen Aufzählung thematischer Forderungen, die in ihrer Gänze von einer einzigen in-ternationalen, vergleichend angelegten Konferenz nicht abgedeckt werden können.
Gerade dieser internationale komparatistische Aspekt erweitert jedoch den Horizont unserer Forschungen und Fragen ungemein – und verleiht zugleich der Prager � ematik endlich allgemeine Pro-
also der gezielten Zerstörung der Städte in Folge der komplexen Transforma-tion der Ökonomie der Kriegsführung, die einerseits auf eine militarisierende Einbeziehung der Gesamtgesellscha� gerichtet ist und sich andererseits um die Liquidierung der Grundlagen ihres urbanen Lebens bemüht – um die systema-tische Zerstörung der Routine des städtischen Alltagslebens bzw. beim national-sozialistischen Durchmarsch nach Osteuropa um die direkte Liquidierung der städtischen Bevölkerung, besonders der städtischen Eliten. Vgl. M. Funck, Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert, IMS 2, 2004, S. 5–9, hier S. 6. Wichtige Beiträge zu unserer Problematik enthält auch der Band von Martin Körner (Hrsg.), Stadt-zerstörung und Wiederau� au, Bd. 2, Zerstörung durch Stadtherrscha� , innere Unruhen und Kriege, Bern 2000, hier besonders die Studien von Pim Kooij, � e Destruction of Dutch Cities during the Second World War, S. 289–299, und Eckhard Müller-Mertens, Berlins Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg und sein Wiederau� au, S. 367–394.
⁸ Vgl. allgemeiner Marcus Funck – Roger Chickering (edd.), Endangered Cities. Mi-litary Power and Urban Societies in the Era of the World Wars, Boston 2004.
⁹ Vgl. die inspirative Studie von Wolf Gruner, Die NS-Judenverfolgung und die Kommunen. Zur wechselseitigen Dynamisierung von zentraler und lokaler Politik 1933–1941, Vierteljahrshe� e für Zeitgeschichte (weiter VfZ) 48, 2000, S. 75–126.
623623
Zusammenfassung / Summary
portionen, indem er ein besseres Verständnis der Prager Situation, der Schicksale, aber auch der Rolle und der Perspektiven der Stadt während der Besatzungsjahre 1939–1945 ermöglicht.¹⁰ Es handelte sich hierbei um den längsten Besatzungszeitraum in Europa. Und Prag besaß sicherlich eine Reihe von Besonderheiten.¹¹ Dies wird sowohl aus dem Vergleich mit brutal eroberten und dabei oder später (bei Kriegs- und „Straf“-Operationen) bis auf die Fundamente zer-störten Großstädten vom Typ Warschau¹², Rotterdam oder Belgrad deutlich, wie auch in der Gegenüberstellung mit russischen Städten, deren Bevölkerung von den Nationalsozialisten in die Steppe ge jagt (Stalingrad)¹³ oder gezielt für den Hungertod ausersehen wurde (Le-ningrad)¹⁴. Die russischen Großstädte wurden zudem in erheblichem
¹⁰ Eine hervorragende Basis für die Kontextualisierung des Prager Falls bietet die Forschungsübersicht in Marcus Funck, Urbanisierte Gesellscha� en, Krieg und Gewalt. Stand und Perspektiven der Forschung, IMS 2, 2004, S. 72–79. Aus der etwas älteren Literatur vgl. Tomasz Szarota, Życie codzienne w stolicach okupo-wanej Europy. Szkice historyczne, Warszawa 1995.
¹¹ Überblicksartig zu Prag während der nationalsozialistischen Besatzung vgl. Václav Ledvinka, Praha v období nacistické okupace a druhé světové války (1939–1945), in: Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Praha, Praha 2000, S. 599–632.
¹² Tomasz Szarota, Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten Warschau 1. 10. 1939 bis 31. 7. 1944, Paderborn 1985; aus der älteren Literatur vgl. Krzystof Dunin-Wąsowicz – Halina Winnicka (edd.), Warszawa lat wojny i okupacji, 1939–1945, Warszawa 1975.
¹³ Gert C. Lübbers, Die 6. Armee und die Zivilbevölkerung von Stalingrad, VfZ 54, 2006, S. 87–123.
¹⁴ Das neueste, voller Respekt breit diskutierte, quellengestützte kritische Werk zur Blockade Leningrads zwischen dem 7. September 1941 und dem 27. Januar 1944, die von mindestens einer Million Einwohnern mit dem Leben bezahlt wurde, ist das Buch von Jörg Ganzenmüller, Das belagerte Leningrad 1941–1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern, Paderborn 2005. Die deutsche Führung bestimmte diese Großstadt, die von der sowjetischen Führung planlos ihrem Schicksal überlassen wurde, gezielt für den Hungertod. Die deutsche Artillerie zerstörte die Versorgungsinfrastruktur der Stadt, beschoss dauerha� die Wohnviertel und bemühte sich, den Versorgungsweg über den Ladogasee zu blockieren. Die Wehrmacht griff nicht an, die Eroberung der Stadt war nicht erlaubt: Die Belagerer erwogen ein Vorrücken nur für den Fall, dass die hungern-den russischen Zivilisten versuchen würden, die Blockade zu „durchbrechen“ und sich gefangen nehmen zu lassen. Die kün� igen Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 überlegten damals noch, wie viele fl iehende Frauen und Kinder die Soldaten der Wehrmacht erschießen könnten, ohne ihre eigene psychische Stabi-lität zu gefährden. Vgl. auch Ganzenmüllers Studie „…die Stadt dem Erdboden gleichmachen.“ Zielsetzung und Motive der deutschen Blockade Leningrads,
624
Documenta Pragensia XXVI (2007)
624
Maß während der Frontkämpfe zerstört. Anders zeigt sich die Prager Besonderheit im Vergleich mit den wiederholten Zie len nationalsozia-listischer Lu� angriff e (Coventry, London)¹⁵ und mit den späteren Zielen der angloamerikanischen systematisch-strategischen Bombar-dierung (zum Beispiel Düsseldorf¹⁶, Hamburg¹⁷ oder Dresden¹⁸). Weiter würde sich sicherlich ein Vergleich zwischen Prag und den
in: Stefan Creuzberger (Hrsg.), St. Petersburg – Leningrad – St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit, Stuttgart 2000, S. 179–195.
¹⁵ Zu London vgl. Philip Ziegler, London at War 1939–1945, London 1995, allgemei-ner Nick Taratsoo, � e Reconstruction of Blitzed Cities. 1945–1955. Myths and Reality, Contemporary British History 14/1, 2000, S. 15–36.
¹⁶ Vgl. Volker Zimmermann, In Schutt und Asche. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Düsseldorf, Düsseldorf 1995.
¹⁷ Zur Zerstörung der „Führerstadt Hamburg“ vgl. Uwe Bahnsen – Kerstin von Stühmer, Die Stadt, die sterben sollte. Hamburg im Bombenkrieg. Juli 1943, Hamburg 2003; Ursula Büttner, „Gomorrha“ und die Folgen. Der Bombenkrieg, in: Hamburg im Dritten Reich, Göttingen 2005, S. 613–632. Zu urbanistischen und baulichen Kontexten vgl. Dirk Schubert, „Seizing the moment“. Planungen und Realitäten sozialräumlicher Transformationsprozesse in Hamburg und Lon-don zwischen 1940 und 1960, in: F. Lenger – K. Tenfelde (Hrsg.), Die europäische Stadt, S. 343–372.
¹⁸ Zum Bombenkrieg der alliierten Lu� waff e gegen die deutschen Städte bzw. zur deutschen Tradition der Bombardierung militärisch nicht geschützter Städte, die sich vom Wirken der Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg bis zum Mai 1945 erstreckte, vgl. zusammenfassend Jiří Pešek, Friedrichův „Požár“. Německé publikum a německá historiografi e, in: Kristina Kaiserová – Jiří Pešek (edd.), Viri-bus unitis – nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem 2005, S. 53–74. Vgl. aus der deutschen Literatur den mehr als spezi-fi schen, von Friedrichs „Brand“ faszinierten Band von Stephan Burgdorff (Hrsg.), Als Feuer vom Himmel fi el. Der Bombenkrieg in Deutschland, München 2003; aus der wissenscha� lichen Literatur dann den Überblick über die Regionalfor-schung von Winfried Mönch, Städte zwischen Zerstörung und Wiederau� au. Deutsche Ortsliteratur zum Bombenkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg, Die Alte Stadt 30, 2003, S. 265–289. Es ist sinnlos, hier die umfangreiche Literatur zum berühmten, von der nationalsozialistischen und später auch von der ostdeut-schen Propaganda restlos ausgeschöp� en, bis heute ausgesprochen „populären“ Lu� angriff der Alliierten auf Dresden am 13. 2. 1945 zusammenzufassen. Erin-nert sei nur daran, dass die Stadt unvergleichlich weniger litt als die meisten Großstädte in Westdeutschland und dass die Zahl der Opfer dieses Angriff s nicht 250.000 betrug, sondern „nur“ ein Zehntel davon. Zu den Ergebnissen der Untersuchungskommission der Stadt Dresden in dieser Angelegenheit vgl. das Gespräch der Zeitung Die Welt mit dem Kommissionsvorsitzenden Rolf-Dieter Müller: siehe http://www.welt.de/kultur/article726910/ Wie_viele_Menschen_starben_im_Dresdener_Feuersturm.html.
625625
Zusammenfassung / Summary
vom Krieg eher wenig beschädigten internationalen Zentren vom Typ Paris oder Amsterdam lohnen. Vergleichen lassen sich auch Charak-ter, Dynamik und Ergebnisse der städtischen Aufstände gegen Kriegs-ende (Warschau, Paris, Turin, Prag), die Formen des Besatzungster-rors, die wirtscha� liche Ausbeutung, die Germanisierung oder die urbanistischen Vorbereitungen auf den – nationalsozialistischen oder im Gegenteil befreiten – Wiederau� au nach dem Krieg.¹⁹
Weil es sich der Bedeutung des internationalen Vergleichs be-wusst ist, verband sich das Archiv der Hauptstadt Prag anlässlich des 60. Jah restags der Befreiung der Stadt vom Nationalsozialismus nicht nur mit seinem traditionellen Partner, dem Institut für interna-tionale Studien der Fakultät für Sozialwissenscha� en an der Karls-Universität, sondern auch mit einem bedeutenden und allgemein be-kannten Zentrum für die Erforschung der böhmischen und der Pra-ger Geschichte und der nationalsozialistischen Okkupation, näm-lich mit dem Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Heinrich-Heine-Universität im rheini schen Düsseldorf. Gemeinsam luden diese Institutionen zahlreiche Wissen-scha� ler aus verschiedenen europäischen Ländern ein, um wichtige gemeinsame oder im Gegenteil individuelle Aspekte zur Geschichte der europäischen Großstädte in jener traumatischen Zeit zu verfol-gen und zu diskutieren. Die Aufmerksamkeit der Referenten kon-zentrierte sich vor allem auf Großstädte in Mittel-, Ost- und Südost-europa, wobei allerdings Wert auf eine Kontextualisierung in einem breiten westeuropäischem Rahmen gelegt wurde.²⁰
Das Forschungsinteresse an Schicksal und Geschichte so komple-xer Phänomene wie der europäischen Großstädte richtete sich im Kontext der nationalsozialistischen Okkupation, des Krieges und der Befreiung lange Jahre auf militärische Fragen und Fragen des Wi-derstandes, auf die � ematik von Gemeindepolitik und -verwaltung oder auf den Holocaust. Mit der Zeit zeigte sich jedoch, dass die zeit-
¹⁹ Die Nachkriegsrekonstruktion liegt eher außerhalb unserer Fragerichtung, vgl. dazu wenigstens Werner Durth – Niels Gutschow, Träume in Trümmern. Planun-gen zum Wiederau� au zerstörter Städte im Westen Deutschlands 1940–1950, Bd. 1, 2, Braunschweig – Wiesbaden 1985; Jeff rey M. Diefendorf (ed.), Rebuilding Europe’s Bombed Cities, New York 1990.
²⁰ Vgl. den Sammelband von Marlene P. Hiller – Eberhard Jäckel – Jürgen Rohwer (Hrsg.), Städte im Zweiten Weltkrieg. Ein internationaler Vergleich, Essen 1991.
626
Documenta Pragensia XXVI (2007)
626
genössische Realität sehr viel komplizierter war und dass die häufi g betonten militärisch-politischen Aspekte ohne die übrigen Kompo-nenten der Alltagsrealität weder verstanden noch eingeordnet werden können: Für Prag zeigte dies eindeutig die umfangreiche Edition der behördlichen Korrespondenz des nationalsozialistischen Primator-Stellvertreters Josef Pfi tzner mit Karl Hermann Frank, bzw. die Edi-tion von Pfi tzners regelmäßig an Frank geschickten Lageberichten zum Geschehen in Prag, die von Vojtěch Šustek erstellt wurde.²¹ In die gleiche Richtung zielt eine Reihe quellengestützter deutscher Ar-beiten, die sich in den letzten Jahren innovativ mit der kommunalen Sphäre in der Zeit von Nationalsozialismus und Krieg auseinander-gesetzt haben.²² Wenn die Geschichtsschreibung die zeitgenössische Situation und die Probleme einer sozial, politisch und (im Kontext der nationalsozialistischen Politik zur Zwangsarbeit der unterwor-fenen Völker) auch in ihrem Status sehr diff erenzierten großstäd-tischen Gesellscha� verstehen soll, muss sie in die alles andere als schwarz-weiße Verfl echtung von Gruppeninteressen und individu-ellen, breit angelegten Überlebensstrategien eintauchen, aber sich
²¹ Alena Míšková – Vojtěch Šustek, Josef Pfi tzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, sv. 1, Deník Josefa Pfi tznera. Úřední korespondence Josefa Pfi tznera s Kar-lem Hermannem Frankem (= Documenta Pragensia monographia 11/1), Praha 2000; Vojtěch Šustek, Josef Pfi tzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, sv. 2, Měsíční situační zprávy Josefa Pfi tznera (= Documenta Pragensia monographia 11/2), Praha 2001.
²² Diese Arbeiten knüpfen systematisch an folgende Studie an: Horst Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, Stuttgart 1970. Vgl. den Band von Sabine Mecking – Andreas Wirsching (Hrsg.), Stadtverwaltung im Na-tio nal sozialismus. Systemstabilisierende Dimensionen kommunaler Herr scha� (= Forschungen zur Regionalgeschichte 53), Paderborn 2005, oder den Sammel- band von Detlef Schmiechen-Ackermann – Steffi Kaltenborn (Hrsg.), Stadtgeschichte in der NS-Zeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und vergleichende Perspektiven, Münster 2005. Unter den Monographien stießen aktuell die quellengestützten Studien zu Augsburg und Hannover auf großen Widerhall: Bernhard Gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik. Administrative Normalität und Sys-temstabilisierung durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933–1945, München 2006; Rüdiger Fleiter, Stadtverwaltung im Dritten Reich. Verfolgungspolitik auf kommunaler Ebene am Beispiel Hannovers, Hannover 2006. Bemerkenswert ist auch die Betonung der Schlüsselrolle der nationalsozialistischen Partei unter konkreten städtischen oder regionalen Bedingungen. Vg. neuestens Carl-Wilhelm Reibel, Das Fundament der Diktatur. Die NSDAP-Ortsgruppen 1932–1945, Pa-derborn 2002.
627627
Zusammenfassung / Summary
auch mit jenen Versuchen auseinandersetzen, von der neuen, un-gewöhnlichen Situation zu profi tieren.
Ich bin mir der Breite der Problematik ebenso bewusst wie der Tat-sache, dass die Erforschung der erwähnten Fragen für Prag erst am Anfang steht. Dennoch möchte ich hier zehn allgemeiner gehaltene � esen (oder vielleicht zum Teil eher Fragen) formulieren, die – in Anknüpfung an unsere Tagung – zur Basis für eine breitere Diskus-sion über Zustand, Veränderungen und Schicksale der von den Na-tionalsozialisten besetzten Großstädte werden könnten:²³
1) Auch während der Militäroperationen, der Besatzung bzw. der Aufstände und Befreiungskämpfe büßten die europäischen Großstädte ihre langfristigen inneren und regionalen Funktionen nicht ein – diese wurden nur (vorübergehend) modifi ziert.
2) Daraus ergibt sich ein „Primat des Alltags“, das heißt die Not-wendigkeit, das Funktionieren der Versorgung (mit Wasser und Le-bensmitteln, Energie und medizinischen Gütern), des Verkehrs, der wichtigste Dienstleistungen und des Gesundheitswesens oder allge-meiner ge sagt die Leistungen der kommunalen Verwaltung sicherzu-stellen. Eine dauerha� e Zerrüttung der Großstadtorganismen lag in Mitteleuropa „bis zur zerstörerischen bzw. autodestruktiven Nero-befehl-Endphase des Krieges nicht nur im Interesse der Großstadt-bevölkerung und ihrer Einzugsregionen, sondern eigentlich auch der Besatzungsmacht (eine Ausnahme bilden die von den National-sozialisten gezielt zerstörten Städte, vor allem Warschau, das im Spät-sommer 1944 systematisch dem Erdboden gleich gemacht wurde).
²³ Im Kontext der wiederholt politisierten und einseitig moralisierenden Diskus-sionen über die durch alliierte Bombardierungen zerstörten deutschen Städte erlaube ich mir, an den Seufzer von M. Funck, Urbanisierte Gesellscha� en, S. 77, zu erinnern: „Wichtige Fragen nach dem Verlust bzw. der Wiederherstellung des städtisches Raumes als alltäglichem Handlungsraum, nach den Deutungs- und Sinngebungsmustern im Bombenkrieg oder nach den Veränderungen der men-tal maps von Stadtbewohnern und der Suche nach neuen Orien tierungshilfen wurden angesichts der massenmedial ausgestalteten Debatten gar nicht mehr gestellt.“ Und ich möchte die Frage anschlie ßen, ob die Veränderungen der „mental maps“ nicht auch die in ihrer baulichen Substanz nicht zerstörten Großstädte betrafen, die durch die „bloße“ Einschreibung eines Militär-, Wohn-, Funktions- und Repräsentationsnetzes der Besatzer mit „Stützpunkten“ und „be-herrschten Räumen“ in die geläufi ge, bisher gelebte Struktur der Stadt sicherlich ebenfalls verwandelt wurden.
628
Documenta Pragensia XXVI (2007)
628
3) Die Großstädte verwandelten sich während der nationalsozia-listischen Okkupation in eine Gesellscha� der „Besatzer“ und „Be-setzten“, die in hohem Maß unabhängig voneinander lebten, funktio-nal, kooperativ und hierarchisch jedoch fest verbunden und innerlich noch stärker strukturiert waren. Über die militärischen und zivilen „Besatzer“ als eine spezifi sche, mächtige und arrogante, aber doch inmitten der Mehrheit der örtlichen „besetzten“ Bevölkerung nicht vollkommen sicher und ruhig lebende Gesellscha� weiß man bisher unvergleichlich weniger als über die innerlich wiederum sehr diff e-renzierte Gemeinscha� der „Besetzten“.
4) Die nächste � ese besagt daran anknüpfend, dass in den besetz-ten Großstädten sich nach und nach abgrenzende „deutsche Viertel“ entstanden. Zum Teil stützten sie sich auf die Tradition einer älte-ren deutschen (Minderheiten-)Siedlung, zum Teil konstituierten sie sich neu – beispielsweise in Anbindung an die Zentren von Militär-, Polizei- und Besatzungsverwaltung in der Stadt, an sichere Wohn-projekte und -bezirke, an Casinos und Unterhaltungsbetriebe oder an Hochschulen. Es existierte jedoch auch eine negative Anbindung an „frei gewordene“ Häuser und Wohnungen von ermordeten oder ghettoisierten Juden, von Emigranten oder inha� ierten Angehörigen der Widerstandsbewegung, von Geiseln aus den Reihen der Eliten usw. In Prag zog sich so ein markanter Gürtel deutscher Besiedlung über das linke Ufer der Moldau: von der Kleinseite über den Hrad-schin und Dejvice bis nach Holešovice und dessen „Klein-Berlin“.
5) Es handelte sich aber bei weitem nicht um eine spontane Besied-lung, sondern ganz eindeutig um die Bildung „sicher beherrschter“ Räume und Stützpunkte, von denen man die Stadt militärisch be-herrschen bzw. die deutsch-nationalsozialistische Anwesenheit und Überlegenheit demonstrieren konnte. Die Verteilung militärischer und polizeilicher Stützpunkte in der besetzten Großstadt, deren Ver-netzung, Ausstattung und Aufgaben bei unterschiedlichen vorausge-sehenen Szenarien sind schon im Kontext mit der Vorbereitung der Besatzer auf einen möglichen Aufstand der Bevölkerung oder auf be-waff nete Kämpfe gegen angreifende alliierte Truppen gegen Kriegs-ende eine Untersuchung wert.
6) Im Rahmen dieses, aber auch zahlreicher anderer Kontexte ist es erforderlich, die Rolle Prags als Großstadt und etabliertes multi-funktionales Zentrum in den aktuellen Konzepten und langfristigen Plänen der Nationalsozialisten gründlicher zu erforschen – und zwar
629629
Zusammenfassung / Summary
sowohl in Bezug auf das Reich als auch in „ostmitteleuropäischen“ Zusammenhängen. Für wen wurden eigentlich während der Besat-zung die zahlreichen, großen, prächtigen und kostspieligen national-sozialistischen Festivitäten aller Art inszeniert? Für die tschechi schen Prager? Für die Prager deutsche (Eliten-)Minderheit? Für das „Alt-reich“? Für überregionale Zwecke der in den besetzten Ländern Eu-ropas wirkenden Propaganda?
7) Bei den Überlegungen zum zeitgenössischen Alltag und zu den Plänen kurzfristiger Natur (von Widerstand und Besatzern für den zeitlichen Horizont des Kriegsendes) sollte das dauerha� anwesende Motiv der urbanistischen und funktionalen Planung der Stadt für die Zeit nach dem Krieg vergessen werden. Hier stießen auf beiden Sei-ten der „Barrikade“ zahlreiche Konzepte aufeinander: Im Fall der na-tionalsozialistischen Betrachtung Prags standen sich beispiels weise das Konzept von Prag als einer (sudeten-)deutschen Musterstadt und das Konzept einer regionalen Metropole inmitten der breiteren ur-banen Hierarchie des Gesamtreiches und der nationalsozialistischen funktionalen Geographie gegenüber.
8) Zumindest ein Teil der nationalsozialistischen Pläne wurde be-reits während des Krieges in Angriff genommen, als man begann, Prag zu einem wichtigen Zentrum für die deutsche Expansion nach Osten umzuformen. Dieses Zentrum war derart bedeutend, dass be-reits sehr schnell klar wurde, dass es (auf städtischer, aber besonders auf universitärer, administrativer und auch justizieller Ebene) den altmodischen „Sudetendeutschen“ weggenommen und der Verwal-tung verlässlicher „Parteigenossen“ aus dem „Altreich“ überantwortet werden musste, die in großer Zahl und weit aufgefächerter Typolo-gie hierher übersiedelten. Übrigens erreichte Prag mit seiner deut-schen Garnison im Jahr 1940 (vorübergehend) die Grenze von einer Million Einwohnern; noch eine Generation vorher hatten hier „nur“ 667.000 Personen gelebt.
9) Die Kehrseite dieses Wachstums war die Segregation, die De-portation und in großem Ausmaß die Ermordung der Prager jüdi-schen Minderheit. Diese wurde nicht nur von Personen gebildet, die sich über konfessionelle oder nationale Zugehörigkeit als Juden de-fi nierten, sondern sie bestand in Prag – einer Stadt, wo der Prozess der Assimilation und Integration der jüdischen Bevölkerung sehr viel intensiver verlaufen war als in anderen Großstädten Mitteleuro-pas – vor allem aus Personen, die dieser Gruppe direkt oder indirekt
630
Documenta Pragensia XXVI (2007)
630
(als Eheleute) aus „rassischen Gründen“ zugeordnet worden waren. Die Besatzungsmacht versuchte, sie komplett aus dem wirtscha� li-chen, politischen und kulturellen Leben auszuschalten. Das Maß der (Nicht)ausgrenzung der Juden aus der Prager Gesellscha� und die nationalsozialistische Wahrnehmung dieser Tatsache ist eine off ene, seit Jah ren diskutierte Frage, die sich für einen internationalen Ver-gleich geradezu anbietet.
10) Der Prager Aufstand und die Befreiung Prags dürfen nicht nur im Kontext der Prager Ereignisse – der Kämpfe, politischen Ver hand lungen, alltäglichen Ausdrucksformen bürgerlicher Opfer-bereitscha� , der Massaker an Zivilisten und der Welle der Begeiste-rung, die sich bei der tschechischen Bevölkerung nach der Befreiung Bahn brach – wahrgenommen werden, sondern müssen auch die Zu-sammenhänge der alliierten Kriegspolitik, der alliierten langfristigen wie aktuellen taktischen und strategischen Interessen, den Kontext der „Geschä� emacherei“ der Generäle sowie deren Gleichgültig keit und Inkompetenz berücksichtigen. Kokoškas Buch über Prag im Mai 1945 bildet hier den – bisher ungenutzten – Ausgangspunkt für eine breitere, europäisch-vergleichende Diskussion.²⁴
Betrachten wir nun die Fokussierungen der Referenten unserer Tagung, die neben Prag (von Nord nach Süd betrachtet) die nor-wegische Hauptstadt Oslo, den Freihafen Danzig, die polnische Hauptstadt Warschau, die kleinpolnische Metropole Krakau, die schlesischen Städte, Budapest, Zagreb, Ljubljana und die slowe-nischen Städte thematisierte. Zu dieser „Nord-Süd-Achse“ kom-men noch zwei Beiträge hinzu, die sich mit Paris und Lille beschäf-tigen. Die 22 Konferenzbeiträge lassen sich thematisch in mehrere Blöcke gliedern, die den gesamten geographischen Untersuchungs-raum erfassen.
Die erste Gruppe von Beiträgen beschä� igt sich mit den besetz-ten Städten als selbstverwalteten urbanistischen Einheiten, spezi-fi schen gesellscha� lichen Organismen, großen und in Folge des Krieges überbevölkerten Gemeinden, die während der nationalsozia-listischen Besatzung unter extremen Bedingungen die Adaptation ihrer Infrastruktur, die Wohnungsnot, die sprungha� wachsenden
²⁴ Vgl. Stanislav Kokoška, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.
631631
Zusammenfassung / Summary
Preise auf dem offi ziellen und noch mehr natürlich auf dem Schwarz-markt, die Lieferung von Trinkwasser und Krisen bei der Versor-gung mit Lebensmitteln lösen mussten. In diesem Zusammenhang wird der Sammelband mit einer synthetisierenden Betrachtung der Prager Stadtverwaltung zur Zeit der „Zweiten Republik“ aus der Fe-der von Petra Slámová und Hana Svatošová eröff net; diese Zeit wies nach Ansicht der Autorinnen alle Zeichen des Kriegszustandes auf. Die Stadtverwaltung suchte angestrengt und wenn möglich wirksam nach Wegen, die anfallenden Probleme zu lösen. Wiederholte staat-liche Eingriff e in die Zusammensetzung und die Anzahl der städ-tischen Angestellten und die Aufl ösung der städtischen Selbstver-waltung durch die Regierung im Februar 1939 und deren Ersetzen durch eine ernannte Verwaltungskommission bezeichnen die Auto-rinnen als „Ausdruck staatlicher Willkür und Arroganz der Macht“. Ein Vergleich würde wohl zeigen, dass die Erfahrungen der Städte mit staatlichen Eingriff en in der Kriegszeit überall in Europa sehr ähnlich waren.
Tomasz Szarota, eine lebende Legende dieses Fachgebiets, be-handelt in europäisch-komparatistischer Weise den Alltag im be-setzten Warschau. Schlüsselmomente waren hier der nationalsozia-listische Terror, die Pauperisierung der Stadt und ihrer Einwohner, die Versorgungsnot und die Ghettoisierung der jüdischen Bevölke-rung. Eine konzeptionell ähnliche Betrachtung liefern Jacek Chro-baczyński und Piotr Trojański mit ihrer Analyse der Funktionen Kra-kaus als Hauptstadt des Generalgouvernements. Die kleinpolnische, mit Flüchtlingen aus ganz Polen überfüllte Metropole kämp� e mit bitterer Versorgungsnot und einer Explosion der Lebensmittelpreise. Der Schwarzmarkt, ein allen besetzten Großstädten gemeinsames Phänomen, spielte hier sowohl im Hinblick auf die Versorgung wie auch als eine von den Besatzern mit unterschiedlichen Absichten ge-duldete, manipulierte oder legal wie illegal ausgebeutete „Parallel-struktur“ und als ein Instrument zur Beeinfl ussung des Lebens der besetzten Bevölkerung eine große Rolle. Speziell mit der Versor-gung Krakaus beschä� igt sich dann Mariusz Kluczewski. Die Pro-bleme der Städte in der oberschlesischen Industrieregion werden von Ryszard Kaczmarek untersucht.
In Prag spiegelte sich die Kriegssituation im Versuch der Besat-zungsverwaltung wider, ein neues Zentrum der kün� igen deutschen Stadt Prag zu schaff en – und zwar nicht mehr in den traditionellen
632
Documenta Pragensia XXVI (2007)
632
Siedlungszentren der Prager deutschen Minderheit in der Alt- und Neustadt, sondern in den modernen Vierteln am linken Ufer der Stadt, in Bubeneč und Dejvice. Jaroslav Jásek schildert, wie auf Be-schluss der Besatzer „besseres“ Quellwasser aus Káraný in diese Vier-tel geliefert werden sollte. Die Versuche Josef Pfi tzners, faktischer „Führer“ im besetzten Prag, die kün� ige große, deutsche Stadt Prag mit gutem nordböhmischem Quellwasser zu versorgen, stießen aller-dings auf konkurrierende Ansprüche des kün� igen Groß-Berlin, das Anspruch auf dasselbe Wasserreservoir erhob.
Die den Großstädten Zagreb und Ljubljana sowie den kleineren slowenischen Städten gewidmeten Beiträge (Ivo Goldstein, Zdenko Čepič, Mojca Šorn, Vida Deželak Barič, Damijan Guštin) konzent-rieren sich auf die Formen des italienischen und des deutschen Besat-zungsregimes bzw. auf den Terror des von den Nationalsozialisten unterstützten Ustaša-Regimes in Kroatien, aber auch auf die For-men und die örtliche Unterstützung der Widerstandsbewegung in den südslawischen Städten. Auch hier war die Frage des sich in Aus-dehnung, Formen und Zielrichtung verändernden Widerstandes eng mit der enormen und dauerha� en Versorgungskrise verfl ochten, die nicht einmal durch italienische und später deutsche Lebensmittel-lieferungen in diese Region gelöst werden konnte. Das besetzte, von den italienischen Okkupanten mit einem Stacheldraht umzäumte Ljubljana diente dabei als logistischer Ausgangspunkt der slowe-nischen antifaschistischen und später antinazistischen Widerstands-bewegung.
Aus vielerlei Gründen litten alle besetzten Großstädte langfristig unter Wohnungsnot. In Prag, das lange nicht vom Kriegsgeschehen gezeichnet war, spielte das Verbot des Wohnungsbaus, die nicht mit den nationalsozialistischen Kriegsanstrengungen zusammenhing, eine wesentliche Rolle. Der Beitrag von Monika Sedlá ková zur Pra-ger Situation zeigt das erhöhte Wohnungsinteresse der schnell wach-senden Kolonie von reichs- und sudetendeutschen Zuwanderern (von Polizisten und Beamten der Besatzungsverwaltung bis zum Perso-nal deutscher Firmen), das sich nicht im Rahmen des bestehenden Wohnungsmarktes lösen ließ. Der Schwerpunkt verschob sich daher auf die Zuteilung von Wohnungen ghettoi sier ter oder ermordeter jüdischer Familien. Die intensive Forschung des letzten Jahrzehnts brachte viele Erkenntnisse über Ausmaß und Kontexte der national-sozialistischen „Arisierung“ jüdischen Eigentums. Die Verfl echtung
633633
Zusammenfassung / Summary
der nationalsozialistischen „Lösung der Woh nungs frage“ mit dem Holocaust ist ein � ema, das eine breite, gesamt eu ro päisch-verglei-chende Untersuchung verdienen würde. Der Beitrag von Gábor Gy-áni über die Ghettoisierung der Budapester Juden, die in der Zwis-chenkriegszeit 20 % der Stadtbevölkerung ausgemacht hatten, geht übrigens in eine ähnliche Richtung. Die Situation im Reich und in den besetzten Gebieten unterschied sich allerdings wesentlich hin-sichtlich des Maßes an Brutalität bei der Umsetzung der antijüdis-chen Maßnahmen. Grzegorz Berendt zeigt, dass die meisten Ju-den aus der Freistadt Danzig, die 1939 nach der Niederlage Polens von Deutschland annektiert worden war, emigrieren konnten, und dass man hier auch gegen den Rest der jüdischen Gemeinde rela-tiv gemäßigt vorging. Der Aufsatz von Ivana Dejmková über das als jüdisches Sammellager genutzte Prager jüdische Sportareal Ha-gibor erinnert an die paradoxe Umwandlung dieser Einrichtung in ein deutsches Flüchtlingslager, das nach dem Krieg parallel dazu als Auff anglager für die zu vertreibenden Deutschen diente.
Eine weitere große Beitragsgruppe beschä� igt sich mit dem Pro-blem der Kultur in den besetzten Großstädten, die zumeist natio-nale Schlüsselzentren des kulturellen Lebens waren. Die neuere Ge-schichtsforschung thematisiert die nationalsozialistische Zerstörung und den Raub von Kulturgütern, die Konfi skation von Kunstwer-ken sowie die Inha� ierung und Hinrichtung bedeutender Persönlich-keiten des kulturellen Lebens im Rahmen des nationalsozialistischen Strebens, die Eliten der besiegten, vor allem slawischen Völker bevor-zugt zu liquidieren. Besonders seit den neunziger Jahren entwi ckelte sich aber eine intensive Erforschung der Formen des Kulturbetriebs, der Veränderungen von Kultur-Schaff en, -Rezeption, -Kollaboration und „kultureller Kommunikation“ im besetzten Europa. Dabei zeigt sich klar, dass der Erhalt eines offi ziellen, privaten und natürlich auch eines sich im Untergrund abspielenden künstleri schen, kul-turel len und (in Polen) auch akademischen Lebens für die besetz-ten Na tio nen ein außerordentlich wichtiger Bestandteil der Resistenz war. Die vielfach umfangreichen kulturellen Aktivitäten in Gefan-genenlagern, Gefäng nissen, Ghettos und Konzentra tions lagern be-legen, dass Kunst und Kultur eine große Bedeutung für den Erhalt der Identität des Einzelnen oder der Gruppe, für den Lebenswillen und die Widerstandskra� haben. Die Hä� linge und umso mehr die „freien“ Einwohner der besetzten Städte widmeten sich daher mit
634
Documenta Pragensia XXVI (2007)
634
erhöhter Intensität kulturellen Aktivitäten und Interessen – und dies o� unter dem extremen Risiko, das mit der Enthüllung verbotener Tätigkeiten, Werke oder Personen durch die Nationalsozialisten ver-bunden war. Auch die Suche nach einer Balance zwischen Kollabo-ration und nationalsozialistischer Verfolgung im Bereich der legalen Kultur und deren Bemühen um den Erhalt des Kulturbetriebs und dessen Gemeinde war nicht einfach.
Die Kultur bevorzugte allerdings unter diesen Bedingungen in den früher avantgardistischen städtischen Zentren betont nationale, konservative und anspruchslose Formen von Kulturschaff en und -betrieb. Die bereits in den dreißiger Jahren einsetzende Krise der Zwischenkriegsavantgarde und die o� brutale und primitive Kritik an dieser Avantgarde vertie� en sich unter den Besatzungsbedingun-gen massiv. Die Situation wurde auch durch die Bereitscha� der Na-tionalsozialisten modelliert, diese oder jene Ebene des kulturellen Lebens der besetzten Völker zu dulden oder sogar zu unterstützen und zu beeinfl ussen, falls sie mit den langfristigen Zielen des kul-turellen Umbaus Europas nach dem „Endsieg“ harmonierten. Sehr klar wird diese komplizierte Situation durch die Beiträge dokumen-tiert, die sich mit der bildenden Kunst in Prag während des Krieges (Milan Pech, Tomáš Sekyrka) bzw. mit den Veränderungen der Pra-ger Musikkultur unter den Bedingungen des Protektorats (Undine Wagner, Jitka Bajgarová und Josef Šebesta) beschä� igen. In dieselbe Richtung zielt auch Petr Bednaříks Beitrag zu dem in großem Um-fang durch die Nationalsozialisten kontrollierten Prager Kinonetz während des Krieges. Sehr wertvoll ist der Vergleich mit der Situa-tion der „offi ziellen“ wie inoffi ziellen Kultur im besetzten Krakau (Stichwort: wiederbelebte private Krakauer Salons), das sich gezielt darum bemühte, seine Funktion als Stützpunkt der polnischen Kul-tur nicht einzubüßen (Anna Czocher, Anna Gabryś).
Die anregende Studie von Igor Zemljič vergleicht keine Städte, sondern ganze Länder; die komparatistische Analyse der Verlagsak-tivitäten während des Krieges in Dänemark, im Protektorat Böhmen und Mähren, in Slowenien und Italien konzentriert sich aber doch auf die großen städtischen Zentren als Orte mit der höchsten Kon-zentration verlegerischer und herausgeberischer Tätigkeit. Die Stu-die zeigt für die jeweiligen Länder ein sehr unterschiedliches Profi l: Die Zeit brachte eine erzwungene, aber ersichtlich auch natürliche Hinwendung zu traditionellen � emen mit sich. Es ist allerdings
635635
Zusammenfassung / Summary
symptomatisch, dass das Verschwinden der modernen Literatur im Protektorat besonders spürbar war und dieses Gebilde zugleich die einzige Region war, in der Übersetzungen aus dem Deutschen in enor mem Umfang erschienen. In den drei übrigen nationalen Umfeldern blühte auch während der Okkupation ein umfangrei-ches Übersetzungswesen besonders aus dem angloamerikanischen Bereich. � ematisch gehört zu der zuletzt angeführten Arbeit die Untersuchung der Rolle der Literatur in Danzig während des Krie-ges sowie die Refl exion der Entwicklung des Krieges in dieser Stadt nach 1945 (Peter Oliver Loew).
Wenigstens ein Beitrag (Marie Štemberková) thematisiert dann am Beispiel von Lille, dem Zentrum Nordostfrankreichs, die bedeu-tende Problematik des universitären Lebens in den besetzten Län-dern zur Kriegszeit – ein gewichtiges � ema, dass wegen des Dramas vom 17. November 1939 zumeist aus der tschechischen Perspektive zu verschwinden scheint. Zu diesem großen Kapitel gehört ebenfalls der Problembereich der von den Besatzern gegründeten Organisationen. Am Beispiel des Kuratoriums für Jugenderziehung belegt Tomáš Je-línek, dass diesen Bemühungen kein allzu großer Erfolg beschieden war (allerdings sollte er auch nicht zu gering eingeschätzt werden).
Damit kommen wir zur nationalsozialistischen Propaganda. Die Großstädte waren Orte ihrer Produktion und ihrer massenha� en Anwendung. Vojtěch Šustek widmet der propagandistischen Of-fensive seine Aufmerksamkeit, die den nationalsozialistischen Ter-ror nach dem erfolgreichen Attentat auf Heydrich begleitete. Die Propaganda, die Pfl icht der Bevölkerung an Massenaktionen teilzu-nehmen, die Einschüchterungen – dies alles untergrub zugleich je-doch auch den Rest des Vertrauens der Bevölkerung in die Protek-toratsregierung, wie auch in die tatsächliche Handlungsfähigkeit der Nationalsozialisten. Ähnliches weiß der Beitrag von Brice Plan-tagenest über die nationalsozialistischen Versuche zu berichten, die ersten britischen Lu� angriff e von 1942 auf Fabriken im besetzten Paris auszunutzen. Durch den Bombenkrieg litten schließlich die deutschen Städte am meisten: Der Beitrag von Volker Zimmermann zeigt dies exempla risch am Beispiel der niederrheinischen Metropole Düsseldorf. Interessant ist zudem ein Vergleich der Prager Proble-matik mit der Situation im besetzten Oslo, dessen Bevölkerung sich – entgegen den nationalsozialistischen und den parallel dazu ver-laufenden Bemühungen der Kollaborateure, Oslo im Kontext des
636
Documenta Pragensia XXVI (2007)
636
neuen nationalsozialistischen Europas zu redefi nieren – um den Er-halt der norwegischen kulturellen Identität der Stadt bemühte (Mar-tin Moll).
Einige Beiträge lassen sich im Prinzip als Analysen der verfügba-ren Quellenbasis verstehen. Hierzu gehören die Studie von Kateřina Kočová über den Aussagewert der Akten der Sonderschwurgerichte aus der Nachkriegszeit (am Beispiel von Liberec/Reichenberg), der Beitrag von Paweł Jaworski über die schwedischen Konsularberichte aus dem besetzten Prag oder der Text von Christof Neidiger über bo-hemikale Informationen in den Stürmer-Kästen der Partei.
Die Konferenz bestätigte die Verschiebung bzw. neue thematische Akzentuierung des Forschungsinteresses. An konkreten Beispielen zeigte sie auch die erheblichen Möglichkeiten einer komparatisti-schen Untersuchung der europäischen Städte während des Krieges. Der Vergleich (und nicht nur die Präsentation thematisch harmo-nierender Studien zu verschiedenen Orten) sollte in Zukun� aller-dings systematisch sowohl auf Westeuropa als auch auf die großstäd-ti schen Zentren östlich von Prag ausgedehnt werden.²⁵ Die Jahre der nationalsozialistischen Besatzung sind für ganz Europa ein bis heute nicht bewältigtes Trauma. Der Band der Prager Tagung zeigt einen der produktiven Wege auf, wie diese Traumata thematisiert und his-to ri siert werden können.
²⁵ Vgl. wenigstens: Norbert Kunz, Das Beispiel Charkow. Eine Stadtbevölkerung als Opfer der deutschen Hungerstrategie 1941/42, in: Christian Hartmann – Johannes Hürter – Ulrike Jureit (Hrsg.), Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte, München 2005, S. 136–144, 208–211.
637637
Zusammenfassung / Summary
Jiří Pešek, Big European Cities in World War II (pp. 9–22)
� e history of (big) cities is a highly complex fi eld of study with (traditionally dominant) distinctive aspects of legal, social, eco-nomic and cultural history.¹ In addition to legal, administrative and, at miscellaneous levels, political aspects of history, the general urban, architectural, housing and economic issues also play an im-portant role (in production and, in particular, in consumption). In the context of the position of big cities as “supreme centers” of ex-pansive catchment areas, it is also necessary to include traffi c and, more general, communication, information issues in the broadest sense possible.² � e extensive thematic fi eld of social research is also worth mentioning, not only at the level of social structures and the dynamism of their changes, but also with respect to social commu-nication and articulation of social interests, presented in big cities o� en in numerous, excessively “dense” forms.³ � e successful expan-sion of the “new cultural history” in many historical fi elds has not rendered useless the special, traditional thematic categorization of cultural history, overlapping with many other areas, which involves many aspects, from education to the media, the art and the produc-tion of values and to culturally tinted or interpretable festivities,
¹ � e most recent comprehensive work in this fi eld of study was undertaken by Friedrich Lenger, Probleme einer Geschichte der europäischen Stadt im 20. Jahr-hundert – Anmerkungen zum Forschungsstand samt einiger Schlussfolgerun-gen, Informationen zur modernen Stadtgeschichte (hereina� er “IMS”) 1, 2005, pp. 96–113, and idem in a slightly modifi ed version of this text as introduction to: Friedrich Lenger – Klaus Tenfelde (Hrsg.), Die europäische Stadt im 20. Jahr-hundert. Wahrnehmung – Ent wicklung – Erosion, Köln – Weimar – Wien 2006, pp. 1–21. Here the author declares as fully outlived some standard works – Chris-tian Engeli – Horst Mat zerath (Hrsg.), Moderne Stadtgeschichtsforschung in Eu-ropa, USA und Japan, Stuttgart 1989, and Richard Rodger (ed.), European Urban History. Prospect and Retrospect, Leicester 1993 – as well as (specifi cally for the 20th century) the synthesis focused on earlier history Paul H. Hohenberg – Lynn H. Lees, � e Making of Urban Europe, 1000–1994, Cambridge 1995. Lenger also discards Leonardo Benevolo, Die Stadt in der europäischen Geschichte, München 1993, because of its extremely narrow architectural and urban focus.
² For the issues of involvement of the hinterland of big cities in their urban context cf. most recently Walter Siebel (Hrsg.), Die europäische Stadt, Frankfurt a. M. 2004.
³ Cf. the anthology Andreas R. Hofmann – Anna Veronika Wendland (Hrsg.), Stadt und Öff entlichkeit in Ostmitteleuropa 1900–1939, Stuttgart 2002.
638
Documenta Pragensia XXVI (2007)
638
i.e. a highly varied reception of cultural models.⁴ And the social as-pect of the history of (big) cities is closely related to the historical issues of population, migration and settlement. In short, big cities, which create a “compact” form of a unit of society in the “modern world” of the 20th century, in particular in Europe, constitute an un-usually complex topic⁵, as they are historical entities emerging a� er World War I at the latest as a contractor, and more o� en as the sub-ject of state interests and interventions, and also – especially in major wars – as the victims of state incompetence.⁶
When we consider the topic of our meeting, we have to add some-thing more to this thematic area – the modern and comprehensive history of the military, the history of the repressive forces of the oc-cupation regime, the history of resistance and collaboration and the history of terror as a political, cultural and psycho-social phenome-non.⁷ Big cities became the preferred target for the totally destructive
⁴ F. Lenger, Probleme einer Geschichte, p. 99, says: “If, in the 1970s and 1980s, the research of social history was still centered around the industrial and working--class city of the 19th and the early 20th centuries, the swing to cultural history and cultural sciences made space for other topics and formal approaches to take the center stage.” He refers to Peter Borsay – Gunther Hirschfelder – Ruth-E. Mohrmann (edd.), New Directions in Urban History. Aspects of European Art, Health, Tourism and Leisure since the Enlightement, Münster 2000.
⁵ In this context, F. Lenger, Probleme einer Geschichte, s. 105, portrays a big city as the place of emergency of the mass society and the “symbol of modern trends”.
⁶ In the context of our conference cf. Rainer Hudemann – François Walter (éd.), Villes et guerres mondiales en Europe au XXe siècle, Paris – Montréal 1997.
⁷ Cf. Marcus Funck (Hrsg.), Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert, � emenschwer-punkt, IMS 2, 2004, pp. 5–84. In the introduction to this thematic issue of IMS, M. Funck talks about the 20th century as the age of “urbicide”, i.e. the targeted destruction of cities due to the complex transformation of war man-agement economy in the direction of the military involvement of the society as a whole on the one hand and with an eff ort to crush the very foundation of its urban life, to systematically destroy the routine of everyday city life, specifi cally to directly erase the city population, in particular city elites, during the Nazi campaign to the east of Europe, on the other hand. Cf. M. Funck, Stadt und Krieg im 20. Jahrhundet, IMS 2, 2004, pp. 5–9, here p. 6. Important contribu-tions for our topic were also made in Martin Körner (Hrsg.), Stadtzerstörung und Wiederau� au, vol. 2, Zerstörung durch Stadtherrscha� , innere Unruhen und Kriege, Bern 2000, here especially the study Pim Kooij, � e Destruction of Dutch Cities during the Se cond World War, pp. 289–299, and Eckhard Müller-Mertens, Berlins Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg und sein Wiederauf-bau, pp. 367–394.
639639
Zusammenfassung / Summary
war terror. � eir total destruction or, conversely, the tenacious re-sistance of their defenders, in particular the civil society, became a dominant factor and a symbol of military (and also national) suc-cess, a symbol of determined sturdiness, victory or defeat.⁸ When – taking into account the specifi c situation in Prague – we stress out the history of the Nazi “Final Solution of the Jew Question” in Prague⁹, which was always a key settlement, economic and cultural center of the Jewish community in Czech lands, and possibly also the Nazi plans of a postwar transformation of Prague into an exem-plary, model German city, we can see an exhaustive list of thematic requirements that cannot be comprehensively satisfi ed with a single international comparative conference.
� is international comparative aspect massively extends the ho-rizon of our research and investigations – so, on the other hand, it could also give more general proportions to the Prague issue, thus allowing to better understand the situation in Prague, the fates and the roles and perspectives of the occupied city between 1939–1945.¹⁰ It was the longest time of occupation in Europe. Prague certainly had many specifi c aspects.¹¹ � is is obvious when compared with brutally captured big cities, completely or almost completely wiped off during military or other “punitive” campaigns, such as Warsaw¹², Rotterdam and Belgrade, but also with Russian cities, whose population was
⁸ More generally cf. Marcus Funck – Roger Chickering (edd.), Endangered Cities. Mi-litary Power and Urban Societies in the Era of the World Wars, Boston 2004.
⁹ Cf. the inspirational study Wolf Gruner, Die NS-Judenverfolgung und die Kom-munen. Zur wechselseitigen Dynamisierung von zentraler und lokaler Politik 1933–1941, Vierteljahrshe� e für Zeitgeschichte (hereina� er “VfZ”) 48, 2000, pp. 75–126.
¹⁰ An excellent basis for creating a context for the Prague issue is a research sum-mary in Marcus Funck, Urbanisierte Gesellscha� en, Krieg und Gewalt. Stand und Perspektiven der Forschung, IMS 2, 2004, pp. 72–79. And as regards some older literature, cf. Tomasz Szarota, Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne, Warszawa 1995.
¹¹ For clear information on Prague during the Nazi occupation cf. Václav Ledvinka, Praha v období nacistické okupace a druhé světové války (1939–1945), in: Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Praha, Praha 2000, pp. 599–632.
¹² Tomasz Szarota, Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten Warschau 1. 10. 1939 bis 31. 7. 1944, Paderborn 1985; as for the older literature, cf. Krzystof Dunin-Wąsowicz – Halina Winnicka (edd.), Warszawa lat wojny i okupacji, 1939–1945, Warszawa 1975.
640
Documenta Pragensia XXVI (2007)
640
driven out by the Nazis to the barren steppes (Stalingrad)¹³ or spe-cifi cally marked for starving (Leningrad).¹⁴ Big Russian cities were largely destroyed during frontline fi ghting. A diff erent picture of the specifi c Prague situation is obtained in comparison with the re-peated targets of Nazi air raids (Coventry, London)¹⁵ and later with the targets of systematic Anglo-American strategic bombing, such as Düsseldorf ¹⁶, Hamburg¹⁷ and Dresden.¹⁸ It would be also interest-
¹³ Gert C. Lübbers, Die 6. Armee und die Zivilbevölkerung von Stalingrad, VfZ 54, 2006, pp. 87–123.
¹⁴ � e most recent, broadly discussed critical source on the Siege of Leningrad between 7 September 1941 and 27 January 1944, which cost at least one million human lives among its population, is the book by Jörg Ganzenmüller, Das be-lagerte Leningrad 1941–1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern, Paderborn 2005. German leaders marked this big city, le� to its fate by the Russian military leadership as there were no plans for it, for complete starvation. German artillery destroyed the city’s supply infrastructure, perma-nently bombarded its residential districts and attempted to suff ocate the sup-ply route on Lake Ladoga. Wehrmacht did not attack; it was not permitted to capture the city: its besiegers only considered what to do if the starving Russian civilians tried to break the siege in an eff ort to get captured. In this situation, the future resistance fi ghters against Hitler in 1944 were trying to think how many fl eeing women and children the Wehrmacht troops could shoot to death without threatening their own mental state. Cf also Ganzenmüller’s study “…die Stadt dem Erdboden gleichmachen.” Zielsetzung und Motive der deutschen Blockade Leningrads, in: Stefan Creuzberger (Hrsg.), St. Petersburg – Leningrad – St. Pe ters-burg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit, Stuttgart 2000, pp. 179–195.
¹⁵ For London cf. Philipp Ziegler, London at War 1939–1945, London 1995, in general also Nick Taratsoo, � e Reconstruction of Blitzed Cities. 1945–1955. Myths and Reality, Contemporary British History 14/1, 2000, pp. 15–36.
¹⁶ Cf. Volker Zimmermann, In Schutt und Asche. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Düsseldorf, Düsseldorf 1995.
¹⁷ For the destruction of “Führerstadt Hamburg” cf. Uwe Bahnsen – Kerstin von Stühmer, Die Stadt, die sterben sollte. Hamburg im Bombenkrieg. Juli 1943, Hamburg 2003; Ursula Büttner, „Gomorrha“ und die Folgen. Der Bombenkrieg, in: Hamburg im Dritten Reich, Göttingen 2005, pp. 613–632. For the urban and building context cf. Dirk Schubert, „Seizing the moment“. Planungen und Realitäten sozialräumlicher Transformationsprozesse in Hamburg und London zwischen 1940 und 1960, in: F. Lenger – K. Tenfelde (Hrsg.), Die europäische Stadt, pp. 343–372.
¹⁸ For the bombing campaign of the Allied air forces against German cities, also in light of the German tradition of bombing cities without any military defenses, which ranges in time from the actions of Legie Condor in the Spanish Civil War until May 1945, cf. collectively Jiří Pešek, Friedrichův „Požár“. Německé publi-kum a německá historiografi e, in: Kristina Kaiserová – Jiří Pešek (edd.), Viribus
641641
Zusammenfassung / Summary
ing to compare Prague with international centers such as Paris and Amsterdam, which survived relatively undamaged. We could also compare the nature, dynamism and results of city uprisings at the end of the war (Warsaw, Paris, Turin, Prague), the forms of occupational terror, economic exploitation, Germanization and urban preparation for – Nazi or, conversely, Allied – postwar construction.¹⁹
Aware of the importance of international comparison, the Ar-chives of the Capital City of Prague joined forces with its traditional partner – the Institute of International Studies of the Faculty of So-cial Sciences of Charles University – and with a major and generally recognized center of research of Czech and Prague history and the Nazi occupation – the Institute of Research of Culture and the His-tory of the Germans in Mid-Eastern and Eastern Europe, Heinrich Heine University, Düsseldorf. � ey jointly invited many scientists from many European countries and tried to monitor and discuss major social aspects as well as specifi cally individual aspects of the history of big European cities during that traumatic era. � e atten-tion of all participants focused primarily on big cities in Central,
unitis – nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem 2005, pp. 53–74. Among German books cf. the more than specifi c volume, fascinated by Friedrich’s “Fire”, called Stephan Burgdorff (Hrsg.), Als Feuer vom Himmel fi el. Der Bombenkrieg in Deutschland, München 2003; in scientifi c literature there is a comprehensive summary of regional research in: Winfried Mönch, Städte zwischen Zerstörung und Wiederau� au. Deutsche Orts-literatur zum Bombenkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg, Die Alte Stadt 30, 2003, pp. 265–289. It is pointless to summarize the numerous literary sources on the Allies’ notorious air raid on Dresden on 13 February 1945, fully exploited by the Nazi and later by the East German propaganda, which remains very “popular” until now. We should only remind that the city suff ered incomparably less than most big cities in the west of Germany and the number of casualties of the raid was not 250,000, but “only” a tenth of that fi gure. For the results of research conducted by a commission of the city of Dresden on this issue cf. the interview in the German daily Die Welt with the Commission Chairman Rolf-Dieter Müller – see http://www.welt.de/kultur/article726910/Wie_viele_Menschen_starben_im_ Dresdener_Feuersturm.html.
¹⁹ � e postwar reconstruction remains out of our focus, cf. at least Werner Durth – Niels Gutschow, Träume in Trümmern. Planungen zum Wiederau� au zerstörter Städte im Westen Deutschlands 1940–1950, Bd. 1, 2, Braunschweig – Wiesbaden 1985; Jeff ry M. Diefendorf (ed.), Rebuilding Europe’s Bombed Cities, New York 1990.
642
Documenta Pragensia XXVI (2007)
642
Eastern and Southeastern Europe, but in the context of broad West-ern European issues.²⁰
� e scholastic interest in the fate and the general history of com-plex phenomena, such as big European cities, has long focused, in the context of the Nazi occupation, war and liberation, on military and resistance aff airs, on issues of municipal politics or administration, or on the Holocaust. However, the wartime situation has gradually turned out to be much more complicated and the usually accentuated military and political aspects to be neither understandable nor clas-sifi able without the other components of the everyday reality; in case of Prague this has been clearly emphasized by the extensive publica-tion of offi cial correspondence between Josef Pfi tzner, Assistant Lord Mayor, and Karl Hermann Frank, specifi cally the publication of Pfi tz-ner’s reports on the situation in Prague, sent regularly to Frank²¹, which has been compiled by Vojtěch Šustek. � is fi nding is quite in line with many investigative German sources on the municipal sector during Nazism and the war, published in recent years.²² Should his-tory understand the wartime situation and comprehend the problems
²⁰ Cf. the anthology Marlene P. Hiller – Eberhard Jäckel – Jürgen Rohwer (Hrsg.), Städte im Zweiten Weltkrieg. Ein internationaler Vergleich, Essen 1991.
²¹ Alena Míšková – Vojtěch Šustek, Josef Pfi tzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, vol. 1, Deník Josefa Pfi tznera. Úřední korespondence Josefa Pfi tz-nera s Karlem Hermannem Frankem (= Documenta Pragensia monographia 11/1), Praha 2000; Vojtěch Šustek, Josef Pfi tzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, vol. 2, Měsíční situační zprávy Josefa Pfi tznera (= Documenta Pra-gensia monographia 11/2), Praha 2001.
²² � ese works are related to Horst Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, Stuttgart 1970. Cf. the anthology Sabine Mecking – Andreas Wirsching, Stadtverwaltung im Nationalsozialismus. Systemstabilisierende Di-mensionen kommunaler Herrscha� (= Forschungen zur Regionalgeschichte 53), Paderborn 2005, or the anthology Detlef Schmiechen-Ackermann – Steffi Kaltenborn (Hrsg.), Stadtgeschichte in der NS-Zeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und ver-gleichende Perspektiven, Münster 2005. Among monographs, huge response has been received by studies for Augsburg and Hannover, see Bernhard Gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik. Administrative Normalität und Sys-temstabilisierung durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933–1945, München 2006, and Rüdiger Fleiter, Stadtverwaltung im Dritten Reich. Verfolgungspolitik auf kommunaler Ebene am Beispiel Hannovers, Hannover 2006. � e accentua-tion of the key role of the Nazi Party under specifi c municipal or regional condi-tions is also worth noting. Cf. most recently Carl-Wilhelm Reibel, Das Fundament der Diktatur. Die NSDAP-Ortsgruppen 1932–1945, Paderborn 2002.
643643
Zusammenfassung / Summary
of the municipal society, highly diff erentiated socially and politically (and from a statutory point of view in the context of the Nazi policy of forced labor from the subjugated nations), it must delve deep into the highly intriguing network of interests, group strategies and indi-vidual and broadly conceived methods of fi ght for survival or even for some profi t from unusual situations.
While I am aware of the complexity of this issue and the very low level of elaboration of such issues for Prague, I will take the liberty to formulate ten general theses (in some cases rather questions) that could – in connection with our conference – become the basis for a broader discussion on the condition, changes and destiny of big cit-ies occupied by the Nazis:²³
1) During military operations, occupation and rebellions and fi ghts for liberation big European cities could not lose their long-term inner and regional functions – they only modifi ed them (tempo rar ily).
2) � is implies the “primacy of everyday life”, i.e. the need to pro-vide for working supply (with water and food, energies and health materials), transport, key services and healthcare, or more gener-ally the performance of municipal administration. � e permanent eradication of big municipal organisms was not in the interest of the population and catchment areas of big cities as well as the occupying forces in Central Europe (except for the cities picked by the Nazis for destruction – especially Warsaw, systematically razed to the ground in the late summer of 1944) until the “totally destructive, or self-de-structive” fi nal months of the war.
3) During the Nazi occupation big cities changed into societies
²³ In the context of the repeatedly politicized and single-handedly moralized dis-cussions on German cities destroyed by Allied bombing, I would like to recall the sad sigh of M. Funck, Urbanisierte Gesellscha� en, p. 77: “Because of the debates staged by the media, important questions have never been asked regarding the loss, and potentially the reconstruction of the municipal space as an everyday place of meetings, the semantic patterns of the city under bombardment and the changes in the “mental maps” of the municipal population its search for new landmarks as points of orientation.” And I will add the following question: did the changes in the mental maps also aff ect big cities not completely destroyed, but only transformed by the “mere” interpolation of the intruder’s military, resi-dential, functional and prestigious network of “strategic points” and “controlled areas” in the city’s ordinary living structure?
644
Documenta Pragensia XXVI (2007)
644
of the “occupiers” and the “occupied”, living independently of each other to a large degree, but interconnected in terms of functions, co-operation and hierarchy, with further inner structuring; we know extremely little about the military and civilian “occupiers” as a spe-cifi c, powerful and proud, yet rather uncertain and troubled society in the middle of the local majority of “occupied” population, signi-fi cantly less than about the “occupied” society, with a high degree of inner diff erentiation.
4) Another related thesis states that crystallized German districts were gradually springing up in big occupied cities. � ey were partly supported by the tradition of older German (minority) settlement, and partly set up as new districts – e.g. in relation to the focal points of military, police or occupying administration in the city, to pro-tected residential facilities and quarters, casinos and entertainment facilities and universities. However, there was also a negative link to the “vacated” houses le� a� er murdered or ghettoized Jews, refugees and imprisoned resistance fi ghters, hostages from the elites etc. In Prague there was a distinct trail of German settlement in le� -bank Prague from the Lesser Town to Hradčany, Dejvice and Holešovice, and its “Little Berlin”.
5) � is was not by far a spontaneous residential development, but ab solutely clearly the formation of “safely controlled” spaces and strong points from which the city could be ruled with military power, so the German Nazi presence and supremacy could be haugh-tily presented in it. � e deployment of military and police strong points in the occupied city, their “networking”, equipping and task-ing for diff erent projected scenarios are worth researching, if only in the context of the occupier’s preparation for an uprising of the po-pulation or defensive fi ghts against the attacking Allied forces at the end of the war.
6) In this as well as in many other contexts it will be necessary to study in greater detail the role of Prague as a hub and established multi-functional center in the Nazis’ contemporary concepts and long-term plans from the point of view of the Reich as well as the Central European region. Who were the numerous, spectacular, ex-quisite and costly Nazi festivities of all kinds staged for during the occupation? For the Prague Czechs? For the German (elite) minor-ity in Prague? For the “Altreich”? For the supraregional purposes of the propaganda in the occupied European territories?
645645
Zusammenfassung / Summary
7) � e contemplations on contemporary everydayness and short-term plans (of the resistance as well as the occupiers, made until the end of the war), we must not forget about the all-pervading motive of urban and functional city planning for the postwar period. � ere were many concepts at play on both sides of the “barricade”: in the Nazi planning this involved the concept of postwar Prague as an ex-emplary (Sudeten) German city or a regional metropolis within the broader imperial urban hierarchy and Nazi functional geography.
8) At least some Nazi plans were launched during the war, when specifi cally the transformation of Prague into a major center for German expansion to the east kicked off ; as a center it would be so important that very soon it became clear that (along municipal, but in particular higher educational, administrative and e.g. judicial lines) it would be taken away from the old-fashion Sudeten Germans and given over to the reliable “Parteigenossen” from the “Altreich” for administration, who came to Prague in large numbers and in a rich structure. By the way: Prague with its German garrison had one million residents in 1940 (temporarily). One generation earlier the number was “only” 667,000 residents.
9) � e downside of this growth was the segregation, deportations and, to a large extent, the extinction of the Prague Jewish community, which included people defi ning themselves in terms of religion and nationality as well as people grouped directly or indirectly (spouses) for racial reasons – in Prague, a city where the process of assimilation and integration of the Jewish population was much more intensive than in other big European cities. � e occupying force attempted to completely exclude them from economic, political and cultural life. � e rate of (non-) exclusion from the Prague society and the Nazi re-fl ections on this fact constitute an open, widely discussed issue that calls for international comparison.
10) � e Prague Uprising and the liberation of Prague cannot be only perceived in the context of Prague events – fi ghts, political ne-gotiations, everyday acts of civil self-sacrifi ce, killings of civilians and a wave of relaxed enthusiasm of the Czech population a� er libera-tion, but also in the context of the Allied military policy, long-term and current Allied tactical and strategic interests, in the context of the “haggling” of generals, indiff erence and incompetence. Kokoška’s book about Prague in May 1945 constitutes a basis – still unexploited – for a general European comparative study.²⁴
646
Documenta Pragensia XXVI (2007)
646
Let’s look now at what the participants of this conference have paid their attention to: in addition to Prague, they also talked (listed from the north to the south) about the Norwegian capital Oslo, the free port of Gdańsk, the Polish capital Warsaw, the Lesser Polish center of Kraków, Silesian cities, Budapest, but also Zagreb, Ljubljana and Slovenian cities. � is “north-south” axis discussed at the conference is joined by two contributions on Paris and Lille. � e set of thirty-two conference contributions can be thematically grouped into several categories that span across the whole area of focus.
� e fi rst group of contributions deals with the occupied cities as self-administrative urban units, specifi c social organisms, numerous and, due to the war, overpopulated communities that had to solve, during the Nazi occupation, miscellaneous issues of adaptation of their infrastructure, housing shortage, leap increases in prices on le-gal and, even more, black markets, drinking water supply and food supply crisis. In this context the anthology is opened by a summary view by Petra Slámová and Hana Svatošová of Prague’s municipal administration during the so-called Second Republic, at a time that “showed all signs of a state of war” according to the authors. Muni-cipal administrations were feverishly and effi ciently looking for ways to solve problems. � e repeated state interventions in the structure and number of municipal workers and, in February 1939, the disso-lution of the municipal self-government and its replacement with an appointed administrative commission are described by the authors as a “sign of state despotism and arrogance of power”. A compari-son would show that the experience with state interventions during the war was very similar in cities in the whole Europe.
A famous historian studying these issues for many years, Tomasz Szarota discusses an ordinary day in the occupied Warsaw in compar-ison with other cities in Europe. Key moments include Nazi terror, pauperization of the city and its population, supply shortage and ghettoization of the Jewish population. A very similar view is of-fered by Jacek Chrobaczyński and Piotr Trojański in their analysis of the functions of Kraków as the capital of the General Government. � e Lesser Polish metropolis, overcrowded with refugees from the whole Poland, fought against a dire supply shortage and a food price
²⁴ Cf. Stanislav Kokoška, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.
647647
Zusammenfassung / Summary
explosion. � e black market, a phenomenon common to all occupied big cities, played a huge role for supply, but also as a “parallel struc-ture” and a tool for infl uencing the lives of the occupied population, condoned, manipulated or legally and illegally exploited by the Na-zis. Mariusz Kluczewski pays special attention to supply issues in Kraków. � e problems of cities in the Upper Silesian industrial re-gion are discussed by Ryszard Kaczmarek.
� e war situation in Prague mirrored in an eff ort of the occupying administration to create a new center of the future German Prague – not in the traditional centers of settlement of Prague’s German minority in the Old and New Towns, but in the modern districts of le� -bank Prague, in Bubeneč and Dejvice. Jaroslav Jásek states that the Nazis decided to supply “better” water, namely spring water from the Káraný reservoir, to these districts. � e eff orts of Josef Pfi tzner, the actual “Führer” of the occupied Prague, to secure good North Bohemian spring water for the future big German Prague were ob-structed by the competitive demands of the planners of the future Greater Berlin, who also fi xed their eye on this water source.
� e contributions on Zagreb, Ljubljana and smaller Slovenian cit-ies (Ivo Goldstein, Zdenko Čepič, Mojca Šorn, Vida Deželak Barič, Damijan Guštin) focus on the forms of the Italian and German occu-pying regime, namely on the terror of the Ustasha regime in Croatia supported by the Nazis, but also on the forms and civil support of the resistance movement in Yugoslav cities. Once again the issue of resistance – varying in terms of scope, forms and focus – blended together with a huge and persistent supply crisis, which could not be even solved by Italian and later German food supplies coming to this region. In fact, the occupied Ljubljana, enclosed with a barbwire fence by the Italian occupiers, served as the logistic base for Slove-nian anti-Fascist and later anti-Nazi resistance movement.
For many reasons all big occupied cities suff ered from a protracted housing shortage. In Prague, long unaff ected by war events, the ban on any construction investments was very important, but it was not related to the Nazi war eff orts. � e contribution by Monika Sedlá-ková on the Prague situation shows an increased interest in housing among the fast-growing colony of German (from the Altreich as well as the Sudeten) immigrants (policemen, offi cials of the occupation administration and staff of German enterprises), which could not be coped with on the existing housing market. � e main focus was
648
Documenta Pragensia XXVI (2007)
648
therefore diverted to the allocation of apartments le� by ghettoized or murdered Jewish families. An intensive research conducted during the last decade brought many observations on the scope and context of the Nazi “Aryanization” of Jewish property. � e links between the Nazi “solution to the housing issue” with the Holocaust is a topic that would deserve a pan-European comparative study. Gábor Gyáni’s contribution on the ghettoization of Budapest Jews, who constituted 20 % of the city population between the wars, goes in a similar di-rection. � e situation in the Reich and in the occupied territories, however, varied signifi cantly in the brutality of anti-Jewish measures. Grzegorz Berendt points out that most Jews from the free Gdańsk, annexed to Germany a� er the 1939 defeat of Poland, managed to run away and even the remaining Jewish community there was treated relatively mildly. Ivana Dejmková’s article on the Jewish sporting grounds Hagibor in Prague, converted into a Jewish reception camp, reminds us of the paradoxical change of the same facility into a Ger-man refugee camp and, a� er the war, a deportation camp.
Another major group of contributions focuses on the culture of the occupied cities – usually crucial national centers of cultural life. Recent historical research studies the Nazi destruction and misappro-priation of cultural values, the confi scation of individual works of art and their collections, the imprisonment and executions of important fi gures of cultural life within the framework of the Nazi eff ort to erad-icate primarily the elites of the defeated countries, especially Slavic nations. An intensive research of the forms of cultural operation, changes in cultural activities, reception, collaboration and “cultural communication” in the occupied Europe has been developing since the 1990s. Quite clearly the maintenance of offi cial, private but also underground artistic, cultural and (in Poland) also academic life was an extremely important part of the resistance eff orts of the occupied nations. O� en extensive cultural activities in prison camps, prisons, ghettoes and concentration camps show that the arts and culture are essential for maintaining individual as well as group identity, the will to live and the strength to resist. Prisoners, and obviously the “free” population of the occupied cities, paid an increased attention to cul-tural activities and interests – o� en at the cost of huge risks associated with the potential exposure of banned activities, works or persons by the Nazis. Likewise, it was not easy to fi nd the right balance between collaboration and Nazi persecution in the fi eld of legal culture and
649649
Zusammenfassung / Summary
its eff ort to maintain cultural activities and the cultural community. Under these conditions culture preferred remarkably national con-
servative and unchallenging cultural works and activities in former avant-garde city centers. The crisis of the interwar avant-garde triggered in the 1930s and its o� en brutal and primitive criticism intensified massively during occupation. The situation was also shaped by the willingness of the Nazis to condone or even support and infl uence certain levels of cultural life of the occupied nations in conformity to the long-term objectives of the cultural reconstruc-tion of Europe a� er their “fi nal victory”. � is complicated situation is clearly documented by contributions on the fi ne arts in Prague during the war (Milan Pech, Tomáš Sekyrka) and the changes of the Prague musical culture under the conditions of the Protectorate (Un-dine Wagner, Jitka Bajgarová and Josef Šebesta). Another related contribution by Petr Bednařík deals with the network of Prague cin-emas during the war, controlled to a large extent by the Nazis. Of great value is a comparison of culture in the occupied Kraków with the “offi cial” and unoffi cial situation – revived private Kraków salons, which expressly strived not to lose the position of a strategic point for Polish culture (Anna Czocher, Anna Gabryś).
� e inspirational study by Igor Zemljič compares not cities, but whole countries; however, the comparative analysis of wartime pub-lication activities in Denmark, in the Protectorate of Bohemia and Moravia, in Slovenia and Italy focuses primarily on large municipal centers as places of the highest concentration of editing and publish-ing activities. � e study points at the very diff erent edition profi les of the compared countries. � e time brought a forced, but obviously also natural slide to traditional themes. Symptomatically, however, the eradication of modern literature was visible most of all in the Protectorate, which was at the same time the only territory with the massive publication of translations from German. In the three other national territories, numerous translations, in particular from Anglo-American countries, were still published during occupation. � e last mentioned work is thematically associated with the research of the role of literature in Gdańsk during the war and the study of the city’s military development a� er 1945 (Peter Oliver Loew).
At least one contribution (Marie Štemberková) thematizes, on the example of the city of Lille in the north of France, the major issue of wartime life of the universities in the occupied countries, which is
650
Documenta Pragensia XXVI (2007)
650
a huge topic that always seems to be fading away from the Czech per-spective due to the dramatic events of 17 November 1939. � is large chapter also includes the issue of organizations set up by the occupi-ers. Tomáš Jelínek showed, using the example of the Board for Youth Education, that these eff orts were not too successful (however, they were not negligible, either).
� is leads us to the Nazi propaganda. Big cities were the place of its production and massive application. Vojtěch Šustek pays atten-tion to the propagandistic off ensive accompanying the Nazi terror a� er the successful assassination of Reinhard Heydrich. Propaganda, mandatory participation of the population in mass events, intimida-tion – all of this undermined the last remnants of confi dence among the population in the Protectorate government and the actual power of the Nazis. Similar fi ndings are made in the contribution by Brice Plantagenest on the Nazi eff orts to use the fi rst British air raids against the factories in the occupied France in 1942 for their propa-ganda. However, it was German cities that suff ered from the bombing war most of all – Volker Zimmermann’s article demonstrates this clearly on the North Rhineland capital of Düsseldorf. A comparison of the situation in Prague with the occupied Oslo is also very inter-esting; Oslo’s population was trying to maintain the city’s Norwegian cultural identity against the Nazi and parallel collaborative eff orts to redefi ne it as part of the new Nazi Europe (Martin Moll).
Several contributions virtually analyze the available sources. � ey include Kateřina Kočová’s study on the testimonial value of the acts of extraordinary postwar people’s courts (an example of Liberec), Paweł Jaworski’s contribution on Swedish consular reports from the occupied Prague and Christof Neidiger’s article on Czech-related in-formation in the party’s Stürmer-Kästen.
� e conference confi rmed a shi� or new thematic accentuation in the fi elds of research. It showed, on specifi c examples, the huge potential of the comparative research of European cities during the war. � e comparison (not just the presentation of thematically simi-lar studies from diff erent locations), however, should be extended to include Western Europe as well as big cities east of Prague in future.²⁵
²⁵ Cf. at least Norbert Kunz, Das Beispiel Charkow. Eine Stadtbevölkerung als Opfer der deutschen Hungerstrategie 1941/42, in: Christian Hartmann – Johannes Hürter
651651
Zusammenfassung / Summary
� e years of the Nazi occupation still remain a time of a lingering trauma for the whole Europe. � e anthology from the Prague con-ference shows a productive way of thematizing and historicizing this trauma as such.
– Ulrike Jureit (Hrsg.), Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte, Mün-chen 2005, pp. 136–144, 208–211