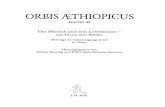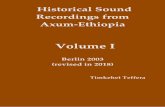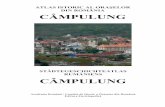Timkehet Teffera (2001). Musik zu Hochzeiten bei den Amara im Zentralen Hochland Äthiopiens....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Timkehet Teffera (2001). Musik zu Hochzeiten bei den Amara im Zentralen Hochland Äthiopiens....
Timkehet Teffera
Musik zu Hochzeiten bei den amārā im
Zentralen Hochland Äthiopiens
1. Band
Peter Lang
V
D a n k s a g u n g
Diese wissenschaftliche Arbeit wäre ohne die Hilfe einer großen Anzahl von Personen und
Institutionen nicht zustande gekommen. Zuerst möchte ich mich meinen Betreuer, Prof. Wolfgang
Auhagen (Humboldt Universität, Berlin), für seine großzügige Unterstützung bedanken. Mein Dank
gilt ebenso Prof. Arthur Simon (Freie Universität/Berlin), Prof. Christian Kaden (Humboldt
Universität/Berlin), Prof. Jürgen Elsner und Dr. Gisa Jähnichen, eine Kollegin und Freundin. Sie war
außerordentlich großzügig mit ihrer Zeit beim Korrekturlesen des Manuskriptes. Ihre Ratschläge und
ihre Unterweisung bezüglich des Faches Musikethnologie waren von Anfang bis Ende dieses Werkes
sehr hilfreich. Ihr großes Talent, verleiht mir viel Kraft und Mut, in diesem Wissenschaftsbereich viel
mehr beizutragen.
Ferner möchte ich mich bei der Fazit-Stiftung gemeinnützige Verlagsgesellschaft mbH (Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH/Frankfurter Sozietätsdruckerei GmbH), Frankfurt am Main, für die
Befürwortung des Druckkostenzuschusses, bedanken.
Meine tief empfundene Dankbarkeit und Bewunderung gilt meiner Schwester, Helena Teffera und
meinem Schwager, Sahilu Woldelioul, die mich während meiner Feldforschung im zentralen
Hochland Äthiopiens (1993 und 1997) finanziell und materiell unterstützt haben. Mein spezieller
Dank geht an meinen anderen Schwestern, Martha und Mulatework Teffera sowie an meinem lieben
Bruder, Gultu Teffera, für ihre Teamarbeit bezüglich der Sammlung von wichtigen Informationen über
das Thema diese Buches und insbesondere für ihre moralische und materielle Unterstützung währen
der ganzen Jahre.
Meinem liebevollen Ehemann, Abebe Bayru, der mit der exakten Mischung von Liebe unterstützt,
möchte ich meine tief empfundene Dankbarkeit ausdrucken. Seine unendliche Geduld, meine
Visionen mit mir zu teilen, hat mir den Mut gegeben, dieses Projekt zu realisieren.
Zuletzt gilt mein Dank sämtlichen Institutionen, die mir die notwendigen Unterstützungen gegeben
und somit auch für das Zustandekommen dieser Arbeit eine wesentliche Rolle gespielt haben. Diese
sind: Das Institut für äthiopische Studien („Institute of Ethiopian Studies“), Addis Abeba Universität,
die Yared Musikhochschule, Addis Abeba, das Kultur- und Tourismusbüro, Bahr Dar und Gonder
(Culture of Tourism Office/BATUMA), das Bildungsministerium, Addis Abeba („Ministry of
Education“) und das Völkerkundemuseum in Berlin.
VI
Inhaltsverzeichnis
1. Band D a r s t e l l u n g e n Seite
1. E i n f ü h r u n g 1
1.1. Das Thema 1
1.2. Forschungsstand und Material 6
1.2.1. Literatur 6
1.2.2. Eigene Vorarbeiten 13
1.2.3. Hinweise zu den Transkriptionen und zur Textdarstellung 16
1.3. Zum System der amārischen Tonreihen 18
1.3.1. Təzətā-qəñət {ትዝታ ቅኝት} 20
1.3.2. Bātī-qəñət {ባቲ ቅኝት} 21
1.3.3. Ambassäl-qəñət {አምባሰል ቅኝት} 21
1.3.4. Ančī Hoyē Länē-qəñət {አንቺ ሆዬ ለኔ ቅኝት} 21
1.4. Traditionelle Gesänge der amārā 25
1.4.1.Teil 1: Weltliche Gemeinschafts- und Sologesänge 26
1.4.1.1.Neujahrslieder 26
1.4.1.2.Gesänge zur Feier der Auffindung des wahren Kreuzes 29
1.4.1.3.Gesänge zum Dreikönigsfest 30
1.4.1.4.Gesänge zum religiösen Fest - būhē 30
1.4.1.5.Heldengesänge/Kriegslieder 33
1.4.1.6.Sanfter Gesang 34
1.4.1.7.Gesänge des ažmārī 35
1.4.1.8.Gesänge der lalibälā 36
1.4.1.9.Hirtenlieder 38
1.4.1.10.Wiegenlieder 38
1.4.1.11.Klagelieder 39
1.4.1.12. Besessenheitsritus und -gesänge 41
1.4.1.13. Arbeitsgesänge 43
1.4.1.14. Kinderlieder 44
1.4.1.15. Politische Lieder 46
1.4.1.16. Hochzeitslieder 48
1.4.2. Teil 2: Religiöse Gemeinschafts- und Sologesänge 49
1.4.2.1. Messegesang 49
1.4.2.2. Religiöser Chorgesang 52
1.4.2.3. Preisgesänge 53
1.4.2.4. Zusammenfassung zu traditionellen Gesängen der amārā 55
2. H o c h z e i t s b r ä u c h e d e r A m ā r ā 59
2.1. Verschiedene Formen der Eheschließung 60
2.1.1. Standesamtliche Eheschließung 61
2.1.2. Religiöse Eheschließung 62
2.1.2.1. Die christlich-orthodoxe Eheschließung 63
2.1.2.2. Das täklīl-Geheimnis 63
VII
2.1.2.3. Der heilige Korban 64
2.1.2.5. Voraussetzungen für eine täklīl-Feier 64
2.1.2.6. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen täklīl und
qūrbān-Zeremonien
66
2.1.3. Traditionelle Eheschließung 67
2.1.3.1. Traditioneller Ehevertrag der 80 Silbertaler 68
2.1.3.2. Eheschließung als Dienstmädchen und Ehefrau zugleich 68
2.1.3.3. Scheinehen und außereheliche Beziehungen 69
2.1.4. Materielle und finanzielle Unterstützung der Hochzeit 70
2.2. Vorhochzeitsbräuche 73
2.2.1. Schicken von Gesandten 73
2.2.2. Zeremonie des Überreichens von Hochzeitsgeschenken - təlõš {ጥሎሽ} 77
2.3. Der Hochzeitstag 81
2.3.1. Verabschiedung der Braut 83
2.3.2. Empfang des Bräutigams 87
2.3.3. Das Festmahl 92
2.3.4. Der Abend des Hochzeitstages 94
2.3.5. Der Aufenthaltsort während der Flitterwochen 95
2.4. Nachhochzeitsbräuche 97
2.4.1. Glückwunsch 97
2.4.2. Die Rückkehr 101
2.4.3. Die Mischung 101
2.5. Allgemeine Hochzeitsgesänge 102
3. A n a l y s e d e r H o c h z e i t s l i e d e r 114
Repertoire der amārischen Hochzeitslieder 115
Melodische, ryhthmische, metrische und textliche Aufbau und Aufführung der
traditionellen amārichen Hochzeitsgesänge
118
3.1. Analyse 1: Abschnitte im Lied 121
3.1.1. Lieder mit zwei Abschnitten 121
3.1.2. Lieder mit drei Abschnitten 123
3.1.3. Lieder mit vier Abschnitten 124
3.1.4. Lieder mit mehr als vier Abschnitten 126
3.2. Die Struktur der melodischen Formeln in den amārischen
Hochzeitsliedern
130
3.3. Analyse 2: Das Verhältnis zwischen Awrag und Täqäbay in den
amārischen Wechselgesängen
138
3.3.1. Rufwechselgesänge 140
3.3.2. Strophenwechselgesänge 143
3.3.3. Refrainwechselgesänge 145
3.3.4. Zeilenwechselgesänge 146
3.4. Der Text in den Amārā-Liedern 147
. 3.4.1. Funktion und Inhalt 147
3.4.2. Die Anzahl der Silben in den Gesangszeilen 150
VIII
3.4.3. Funktion und Rolle von Redundanzsilben 151
3.4.4. Verkürzungen und Verlängerungen von Liedtextzeilen 151
3.4.4.1. Verkürzung von Liedtextzeilen durch Verschmelzung von
Silben
152
3.4.4.2. Verlängerung von Liedtextzeilen durch Einschieben von Silben 152
3.4.5. Lieder und Liedtexte des ažmārī 153
3.5. Musikinstrumente 156
3.5.1. Die Trommel käbärõ 156
3.5.2. Die Trommeln atāmo und häbärõ 161
3.5.3. Die Längsflöten əmbiltā und die Längstuben mäläkät 162
3.5.4. Der ažmārī und die Kasten-Spießlaute masinqõ 162
4. D e r T a n z z u a m ā r i s c h e n H o c h z e i t s l i e d e r n u n d
d i e T ä n z e i n Ä t h i o p i e n
166
4.1. Traditionelle Tanzweisen der Amārā 166
4.2. Einige Grundlagen des əskəstā-Tanzes 173
4.3. Tanz und Kommunikation: das Verhältnis zwischen Musik und Bewegung 173
4.4. Tänze und Bewegungsmuster in ausgewählten Kulturen Äthiopiens 175
4.4.1. Die Qõttu Orõmõ 175
4.4.2. Die Harärē 175
4.4.3. Die Wwälayətta, Wällāmõ und Doržē 175
4.4.4. Die Gurāgē 176
4.4.5. Die Təgrāy 177
4.4.6. Die Orõmõ 177
4.5. Beeinflussungen von traditionellen Tänze Äthiopiens Durch fremde
Kulturen
178
S c h l u s s b e m e r k u n g e n 181
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 188
IX
2. Band Anhang
I Anmerkungen zur amarischen Schrift 1
II Verzeichnis der Tonaufnahmen und Notationen 4
Nr.
1 abäbāwū babäbāwū layə [Blumen über Blumen] 8
2 abäğäš yäñā ləğə [Gut gemacht, unser Kind] 9
3 ağäbayē [Redundanz] 11
4 ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 12
4a ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 1. Abschnitt,
Gesangszeilen des awrāğ
18
4b ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 2. Abschnitt,
Wechselgsangszeilen des awrāğ und der täqäbayõč
19
6 amõrā bäsämay siyayəš walä [Der Rabe sah dich vom Himmel herab] 20
7 amrwāl šägänū [Die Umgebung ist schön] 22
9 anāsgäbām sərgäñā [Wir lassen keinen Hochzeitsgast hinein] 24
11 arkā bälulāčäwu [Redundanz] 25
12 ašā gädawõ [Redundanz] 29
14 ašäwäynā wäynā [Redundanz] 31
16 atšäñwatəm wäy [Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?] 32
17 bähār ašəmäwu [Redundanz] 34
18 bālənğärē [Meine Freundin] 36
19 bəq bäy kägwadā [Komm aus dem Nebenzimmer] 38
20 bər ambār [Silbernes Armband] 40
21 čəbõ ayəmolām wägäbwā [Ihre Teille ist schmal] 42
22 ärä näy ətē [Oh, komm] 44
24 hay lõgā [Redundanz] 52
24a hay lõgā [Redundanz] Gegenüberstellung analoger Gesangszeilen 57
24b hay lõgā [Redundanz] Gesangsteil des 1. awrāğ 58
24c hay lõgā [Redundanz] Gesangsteil des 2. awrāğ 59
24d hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč 60
24e hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč, Gesang
vor den Verszeilen
61
24f hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč, Gesang
nach den Verszeilen
62
24g hay lõgā [Redundanz] Gesang binnen der Verszeilen, 2. Abschnitt 63
25 hēdäč alū [So ist fort, erzählt man] 64
26 65
27
dein Begleiter?]
66
28 ələl balē ohõ [Redundanz] 68
30 əndalayəš [So, dass ich dich nicht zu sehen bekomme] 69
31 əndäw yämərū [Redundanz] 70
32 ənē alsäə 72
33 ənē alsäə 74
34 əradõ wäšäbā [Redundanz] 75
35 əšätē wäynā [Redundanz] 76
36 əswās lõmī nāt [Sie (die Braut) ist eine Zitrone] 81
37 əstī šälmūn [Bitte beschenken Sie uns] 83
38 əstī amaw yädämūn šämā [Bring einmal das blutige Tuch] 85
40 ətē šänkõrē [Meine Schwester šänkõrē ] 86
41 əyäbälū yääū žə 88
42 kēlawu täsäbärä [Das Tor ist entzwei] 89
44 kūrāt kūrāt [Stolz ! Stolz !] 90
45 lõmī alubāt [Werft Zitronen auf sie] 93
47 mähēdwā näwū [Sie geht] 94
48 mīžēw šəttõ amā [Begleiter bring/gib uns Parfüm] 95
49 mīžew dəhā näwū [Der Begleiter ist arm] 96
X
50 mūšə 97
51 mūšərīt ləmäğī [Braut gewöhne dich] 98
54 nəbõ atənādäfī [Biene, Biene, stich nicht] 100
55 ohõ hõ munā [Redundanz] 102
56 sägurwā wärdõ wärdõ [Ihr Haar wallt herunter] 106
57 šäb əräb aläč mədə 107
58 šənätə [Redundanz] 110
61 wäläbē wäläbē [Redundanz] 111
62 wändəməyē [Mein Bruder] 112
63 yäbētä žämädū [Die Verwandtschaft] 113
64 yägwarõyē enādām [Meine Gartenpflanze] 121
65 yäñāmā mūšərā [Unsere Braut/unser Bräutigam] 123
66 yänē abäbā näš [Du bist meine Blume] 125
67 yäšī gabəččā [Redundanz] 128
68 yäwäfē bər abäbā [Redundanz] 129
69 yäwäyən abäbāyē [Meine Weintraubenblüte] 130
70 132
71 yəžwāt bärärä [Er nimmt sie und rennt davon] 133
72 žäbänay mārəyē [Redundanz] 134
73 Besessenheitslied/Sologesang 135
74 wašənt-Instrumentalstück 137
75 təžətā-əngūrgūrõ/Sologesang 138
76 yämatəbälā wäfə/Sologesang 139
77 lalibälā-Gesang/Sologesang 141
78 hõya hõyē/Wechselgesang 142
79 abūnä-žäbäsämayāt/Sologesang 144
80 abäbāyē hoyē/Wechselgesang 146
81 əyõha abäbāyē/Wechselgesang 150
82 əyõha abäbāyē/Wechselgesang (s. Nr. 81, 2. Variante) 150
III Verzeichnis der Tonbeispiele (MC) 151
IV Glossar 155
1 . E I N F Ü H R U N G
1.1. DAS THEMA
Äthiopien Äthiopien liegt im Nordosten Afrikas zwischen dem 4. und 18. Grad nördlicher Breite und dem 32.
und 49. Grad östlicher Länge (Welt Report 1990: 99). Im Norden grenzt das Land an Eritrea, im Osten
an Djibouti, im Osten und Südosten an Somalia, im Süden an Kenia und im Westen an den Sudan
(s. Anhang I: S. 3).
Der Begriff ityopəyā {ኢትዮeያ}, Äthiopien, ist in den Schriften von klassischen griechischen Histo-
rikern (z.B. Homer und Herodot) ausführlich behandelt worden. Dieser Begriff bezeichnete ursprüng-
lich das Gebiet der drei Kontinente, unter denen die hohen Kulturen verstanden wurden und be-
traf alle braun- und dunkelhäutigen Menschen von Nord- und Nordostafrika (Nil-Tal) durch die Län-
der des Mittleren Ostens bis weit nach Indien.
Die äthiopische Geschichte nahm mit der Einwanderung semitischer und kuschitischer Volksgruppen
aus benachbarten Ländern Afrikas und aus südarabischen Ländern vor ca. 3000 Jahren ihren Anfang
(s. auch Teffera 1994: 1). Im Laufe der Zeit bildeten sich aus diesen Volksgruppen verschiedene Ver-
bände, die sich in zwei Hauptbevölkerungsgruppen unterteilen: die Semiten, zu denen u.a. die ethni-
schen Gruppen der amārā {አማራ}1, təgrāy {ትግራይ}, gurāgē {ጉራጌ}, harärē {ሐረሬ}, arggobā
{አርጎባ} und gafāt {ጋፋት} zählen, und die Kuschiten, zu denen u.a. die orõmõ {ኦሮሞ}, affār
{አፋር}, agäw {አገው}, sumāle {ሱማሌ} und sidāmo {ሲዳሞ} gehören. Diese Völker unterscheiden
sich auch in ihren Sprachen, die entweder zu den semitischen oder kuschitischen Sprachen gerechnet
werden. Etwa 50% der äthiopischen Bevölkerung sprechen semitische und ca. 45% kuschitische Spra-
chen (Welt Report 1990: 100).
Die dritte Bevölkerungsgruppe ist zahlenmäßig gering und ist im südwestlichen Teil des Landes an-
sässig. Zu dieser Gruppe gehören z.B. die añu'āk {አኙአክ} und nū'är {ኑወር} die zu der nilotischen
Sprachgruppe zählen (Bartnicki 1978: XXIX).
Die multi-ethnische Bevölkerung Äthiopiens ist zudem ein Mischvolk, das sich seit Beginn der äthio-
pischen Geschichte beispielsweise durch verschiedene Formen des Einheiratens gebildet hat. Bekele
(1987: 19) beschreibt hierzu folgendes:
"When people immigrate from place to place and possess the right to live where they wish and marry
whoever they love this stems from mutual agreement. Despite varied traditions, different beliefs of
ethnic religions and social-economic compatibility, different cultural patterns emerge. Thus a Somali2
marries an Afar, an Oromo a Guraghe, a Tigre an Agew, an Amhara a Wolaita and so on and so
forth“3.
In Äthiopien leben heute rund 80 Völkerschaften und Stammesgruppen (Lah 1980: 268; Welt Report
1990: 99), die etwa 70 verschiedene Sprachen und ca. 200 Dialekte sprechen (Schubert 1991: 5; Rich-
ter 1987: 23). Diese Gruppen lassen sich durch ihre kulturellen, sprachlichen und soziologischen
Merkmale voneinander unterscheiden. Daher ist auch in deren musikalischen Traditionen eine große
Vielfalt zu beobachten.
1
Die Bezeichnung amārā wird in den meisten Abhandlungen mit einem 'h'; d.h. amhara, geschrieben. Das 'h' an dieser
Stelle hat jedoch keinerlei phonetische Bedeutung in der Sprache amārəñā und es erweist sich als unbegründet. Deshalb
ist in dieser Arbeit die Variante amārā benutzt worden. Beide Bezeichnungen beziehen sich dennoch auf dieselbe ethni-sche Gruppe.
2
In Äthiopien gibt es eine Gemeinschaft, die Somali genannt wird und in der Region Harär, Süd-Ost-Äthiopien, lebt. 3
In dieser Arbeit ist das Wort Guraghe als gurāgē, die Bezeichnung Tigre als təgrē, die hier mit einem 'h' (Amhara) ge-schriebene Gemeinschaft ist ohne das 'h' geschrieben, also amārā, und das Wort Wolaita als wälayətā angegeben
Ökonomisch betrachtet ist Äthiopien eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder unserer
Erde. Es ist somit immer auch stark von globalen Wirtschaftskrisen betroffen. Das durchschnittliche
Jahreseinkommen pro Kopf der Bevölkerung beträgt ca. 120 US$.
Die ökonomische Basis des Landes stellt die Landwirtschaft dar. Über 85% der äthiopischen Bevölke-
rung sind in der Agrarproduktion tätig.
Die Landwirtschaft versorgt die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und die Manufakturen und Export-
unternehmen mit Rohstoffen. Daher spielt sie eine wesentliche Rolle in der gesamten Wirtschaft des
Landes (Schubert 1991: 8ff).
Die Einwohnerzahl in Äthiopien betrug 1987 ca. 44 (Pickett 1991: 30) und 1988 ca. 48 Millionen
Menschen. Das Bevölkerungswachstum lag 1980-87 bei ca. 2,4%. Bis zum Jahre 2000 soll es jedoch
auf 3,1% jährlich ansteigen (Welt Report 1990: 100). Das bedeutet, dass die Einwohnerzahl bis zur
Jahrtausendwende auf ca. 70 Millionen anwachsen wird (Schubert 1991: 5). Dagegen betrug die Ein-
wohnerzahl in Addīs Abäbā {አዲስ አበባ} im Jahre 1988 ca. 1,5 Millionen Menschen mit einer Bevöl-
kerungsdichte von 78,5 Einwohnern pro km2 ((Griffin 1992: 276)). Im Jahre 1992 betrug die Einwoh-
nerzahl schon 2.111.500 Millionen. Diese Tatsache verdeutlicht, dass Addīs Abäbā ein kontinuierlich
zunehmendes Bevölkerungswachstum hat. Hauptursachen dafür sind einerseits die noch immer hohe
Geburtenrate, andererseits die stete Migration nach Addīs Abäbā (Ayele 1995: 37). Ayele bemerkt:
" Aufgrund der heute ansteigenden Geburtenrate und der noch relativ sinkenden Sterberate ist davon
auszugehen, dass die Zuwachsrate in den kommenden Jahren weiter ansteigt und dass womöglich ei-
ne Wachstumsrate von durchschnittlich 3,9% bis zum Jahr 2010 erreicht werden wird".
Von der gesamten Bevölkerung Äthiopiens, leben etwa 85% auf dem Lande. Die Bevölkerungsdichte
betrug im Jahre 1989 ca. 38 Einwohner pro km². Es gibt jedoch erhebliche regionale Unterschiede. Im
Hochland ist die Bevölkerungsdichte am größten. Beispielsweise erreichten die Regionen Arsī
{አርሲ} 76, Gondär {ጎንደር} 58 und Šäwā {ሸዋ} im selben Jahr 122 Einwohner pro km² (Schubert
1991: 5). Die Zentralregion des Landes ist damit am dichtesten besiedelt. Dies betrifft außerdem die
Hauptstadt Addīs Abäbā, die im Vergleich zu den anderen Großstädten Äthiopiens die größte Bevölke-
rungsdichte von 9.511,3 Einwohner je km² aufweist (Ayele 1995: 38).
Es gibt eine Reihe von Faktoren für diese ungleiche Bevölkerungsverteilung:
unterschiedliche geographische und klimatische Lage der verschiedenen Siedlungsräume
unterschiedlich hohe Entwicklung der Industrie und der Dienstleistungszentren, die einen gro-
ßen Einfluß auf die Verteilung der Arbeitsmöglichkeiten und auf die Konzentration der sozio-
ökonomischen Aktivitäten haben und
demographische Faktoren wie z.B. Binnenwanderung und natürliches Bevölkerungswachstum
(Ayele 1995: 39)
Die aktuelle Bevölkerungsanzahl Addīs Abäbās beträgt schätzungsweise 4-5 Millionen Menschen. In
Äthiopien hat bislang noch keine genaue Volkszählung stattgefunden. Deshalb sind weder die Bevöl-
kerungszahl noch die -dichte ganz genau bekannt. Das demographische Profil ist nur aus fragmentari-
schen Daten und Mustermessungen und -überblicken erkennbar (Griffin 1992: 276).
Die aus den ländlichen Regionen des Landes flüchtenden Menschen gehören verschiedenen Volks-
gruppen an. Dadurch entstehen eine Mischung und ein Zusammenleben vieler Gemeinschaften, deren
Traditionen in unterschiedlicher Weise reflektiert werden.
Die Volksgruppe der amārā, deren Hochzeitsgesänge hier untersucht werden sollen, hat eine Bevölke-
rungszahl von ca. 6-11 Millionen Menschen. Ein Hindernis für die Schätzung der Bevölkerung dieser
Gruppe wird dadurch verursacht, dass viele Gemeinschaften (d.h. nahezu 2/3 der gesamten Bevölke-
rung) amārəñā {አማርኛ} sprechen (Bartnicki 1978: XXX). Daher schwanken Angaben zu dieser
Bevölkerungsgruppe.
Außerdem sind die politischen und ökonomischen Probleme Äthiopiens, die häufig entstehenden sozi-
alen Notsituationen, die vor allem in den Regionen Təgrāy und Wällõ4 {ወሎ} heute noch zum Teil
existierenden Hungersnöte, die Missernten und Naturkatastrophen (Eshete 1982: 15; Mengistab 1990:
39, 57) Faktoren, die zusätzlich zu großen kulturellen Veränderungen geführt und zugleich das traditi-
onelle soziale Gefüge gestört haben.
Methodische Vorüberlegungen
In Äthiopien spielen Lebensereignisse wie z.B. die Geburt, die Hochzeit und der Tod eine wichtige
kulturelle Rolle.
Die Arbeit wird sich mit einem dieser Lebensereignisse beschäftigen, und zwar mit der Hochzeit und
den damit im Zusammenhang stehenden Traditionen. Das Thema lautet Musik zu Hochzeiten
bei den amārā im Zentralen Hochland Äthiopiens.
Zu dem Komplex Hochzeitsmusik sind bis in die Gegenwart kaum Untersuchungen angestellt
worden. Es ist in keiner der bislang bekannten wissenschaftlichen Arbeiten zu Hochzeitskulturen bzw.
-musik, -sitten oder -bräuche Äthiopiens im Allgemeinen oder der amārā im Besonderen geforscht
worden. Daher ist es sinnvoll, sich diesem noch unbekannten Thema zu widmen und in dessen Rah-
men neue Erkenntnisse zur traditionellen Musik der amārā, zum Verhältnis zwischen Musik und
Tanz, zu den Formen amārischer Wechselgesänge wie z.B. Ruf- und Zeilenwechselgesänge, zum Ver-
hältnis zwischen Vorsänger, awrāğ {አውራጅ} und der ihn begleitenden Gesangsgruppe täqäbayõč
{ተቀባዮች}, zu den verschiedenen Gesangsstilen bzw. Musizierpraktiken und letztendlich auch zum
Akkulturationsprozeß der traditionellen Musik zu erarbeiten.
Ein wichtiger Grund für die Wahl des Themas besteht außerdem darin, dass mir die amārā-Kultur
vertraut ist. Aus einer amārischen Musikerfamilie stammend konnte ich frühzeitig Kenntnisse sowohl
über die traditionelle Musik unseres Volkes als auch über die in Äthiopien reflektierte europäische
Musiktheorie und -geschichte erwerben, die ich als Klavierschülerin an der Yared-Musikschule in
Addīs Abäbā vertiefen konnte. Ausschlaggebend für mein Interesse an der Aufarbeitung des Themas
war die zunehmende Diskrepanz zwischen der Wertschätzung europäischer Musikkultur und dem
Verständnis der eigenen Musiktraditionen in der äthiopischen Gesellschaft. Besonders angeregt hat
mich meine fünfjährige Tätigkeit im Institut für äthiopische Forschungen an der Addīs Abäbā Univer-
sität. Dort hatte ich die Aufgabe, die Sammlung traditioneller Musikinstrumente aus dem ganzen Land
aufzubauen, zu archivieren und zu dokumentieren. Außerdem konnte ich im ethnografischen Museum
des Instituts an den Archivierungs- und Dokumentationsarbeiten teilnehmen. Dabei habe ich sehr viele
Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass die Vielfalt der gesammelten Objekte auf noch wenig
erforschte Differenzierungen nicht nur zwischen verschiedenen Gemeinschaften, sondern auch inner-
halb dieser Gemeinschaften zurückgeht. Selbstverständlich ist eine wichtige Voraussetzung auch die
4
Im Jahre 1984 plante die damalige äthiopische Regierung, die von Hunger bedrohte Bevölkerung der Regionen Təgrāy und
Wällõ in die fruchtbaren Regionen Goğām (Zentrales Hochland) und Illubabõr (Westäthiopien) zu evakuieren. Es wurde
dafür eine große Aktion gestartet, an der mehr als 24.000 Lehrer, Studenten, Dozenten und Mitarbeiter aller in Äthiopien
existierenden Hoch- und Fachschulen, Universitäten und Ausbildungszentren beteiligt waren. Ziel dieser Aktion war, Häu-
ser für die Betroffenen zu bauen und damit auch ihnen ein neues Zuhause zu errichten. An dem Programm, das etwa drei
Monate dauerte, war auch ich - als damalige Mitarbeiterin der Addis-Abeba-Universität - beteiligt. Fast die Hälfte der be-
drohten Bevölkerung wurde zwangsevakuiert. Auch die Häuser, die von uns gebaut werden sollten, konnten nicht wie ge-
plant hergestellt werden, da wir kaum Kenntnisse und Erfahrungen im Häuserbau besaßen. Außerdem gab es in der Ge-
gend keinen Tropfen Wasser, so dass die gesamte Aktion ein Fehlschlag war. Dies erschwerte die Situation der hungern-
den Menschen beträchtlich.
In den folgenden Jahren wurden ähnliche Pläne für Evakuierungen ausgearbeitet, die kein positives Ergebnis zeigten,
sondern die Hungerkatastrophe im erheblichen Maße verschlimmerten. Durch das ganze Durcheinander konnten auch
Hilfsgüter die Betroffenen nur selten erreichen, sodass in der Zwischenzeit viele starben. Diese und andere Gründe haben
in Äthiopien seit Jahrzehnten Hungersnöte verschärft, teilweise sogar erst heraufbeschworen. Auch heute gibt es u.a. auch bürokratische Probleme, die geplante Hilfsaktionen verhindern.
Kenntnis der amārəñā-Sprache, sowie der vielgestaltigen Sitten und Bräuche der amārā, die mein
wissenschaftliches Vorgehen wesentlich erleichtert.
Eingrenzend konzentriert sich das Thema auf die Hochzeitstraditionen und die Hochzeitsmusik der im
Zentralen Hochland Äthiopiens lebenden amārā. Zum Vergleich werden außerdem auch einige As-
pekte von Hochzeitssitten und -bräuchen bzw. allgemeine kulturelle Aspekte anderer Volksgruppen
Äthiopiens behandelt. Die Möglichkeit, zwischen den Kulturen anderer Gemeinschaften im Allgemei-
nen und der amārā-Kultur im Besonderen differenzieren zu können, wird weitere Ansatzpunkte zur
historischen Herkunft bestimmter Gemeinschaften aufzeigen.
Wichtig ist dies vor allem deshalb, weil in vielen wissenschaftlichen Abhandlungen und Beschreibun-
gen zu oft recht grobe Verallgemeinerungen gewagt werden, so besonders in musikethnologischen
Forschungen zu Afrika. Der gesamte afrikanische Kontinent wird weitgehend als ein homogenes bzw.
einheitliches Gebiet betrachtet (vgl. Nketia 1972: 278). Der afrikanische Kontinent besteht aus vielen
Staaten, in denen vielfältige und unterschiedliche Kulturen beheimatet sind. Die grobe Gliederung des
Kontinents könnte gewissermaßen einen Sinn ergeben, wie z.B. der Teil südlich der Sahara, Zentral-
oder Nordafrika. Die Kulturen dieser Gebiete weisen grundsätzliche Gemeinsamkeiten auf, die auf
ihre historische Herkunft zurückzuführen sind. Doch sollten bei der Erforschung dieser kulturellen
Gebiete weitere detaillierte Abgrenzungen vorgenommen werden, damit möglichst keine Fehlbe-
schreibungen zustande kommen können.
Zwar existieren die afrikanischen Kulturen nicht voneinander isoliert, aber die Homogenität ihrer Kul-
turen hält sich trotzdem in Grenzen (Nketia 1972: 278); d.h. es bestehen große und kleine Unterschie-
de, die bei einer wissenschaftlichen Untersuchung stets einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen5
(Bekele 1990: 139; Nketia 1974: 3 und 1975: 9).
"As every African society observes its own norms in respect of 'scales' and certain details of musical
organisation, the music of Africa shows itself in several varieties, varieties comparable in rank to the
dialects of a language as well as varieties that constitute stylistic groups within a large family"
(Nketia 1975: 9).
Eine Ähnlichkeit stellt Nketia (1972: 278)6 beispielsweise in ihren Aufführungsweisen fest:
"In all African societies, music may be performed by an individual on his own or with the support of
others for expressing his own feelings or those of others, for paying tribute or homage to individuals
or to the unseen. It may also be performed by social groups for their own entertainment, for worship
and ceremonial acitivities or as expressions of group consciousness".
Die verallgemeinerte Darstellung afrikanischer Musik ist nicht nur das Problem ausländischer For-
scher, sondern auch afrikanischer Ethnologen. Es stehen sehr wenige wissenschaftliche Studien zur
Verfügung, die sich auf spezielle Themen wie z.B. Instrumentenkunde, Stilelemente, Melodiestruktu-
ren und Rhythmus konzentrieren (Nketia 1972: 277). Daher ist es bei einer wissenschaftlichen Unter-
suchung sehr wichtig, sich mit einem konkreten Inhalt zu befassen und dies auch mit großer Sorgfäl-
tigkeit und Tiefe zu behandeln. Kubik (1988: 57) schreibt hierzu:
"Die intrakulturelle Betrachtungsweise ermöglicht die präzise und umfassende Erforschung spezifi-
scher afrikanischer Musikkulturen oder -subkulturen, etwa der amara Musik Äthiopiens (Kebede
1982), der Hofmusik von Buganda (Kyagambiddwa 1955; Wachsmann 1956...) oder der musikali-
schen Vorstellungswelt eines Kwela-Musikensembles".
Auch Nketia (1972: 278) erläutert dies:
5
Nketia spricht in diesem Zusammenhang von unity "Gleichheit" und diversity "Verschiedenartigkeit". Siehe auch
Nketia "Unity and Diversity in African Music: A Problem of Synthesis. - In: Proceedings of the First International Congress
of Africanists. - New York 1964, S. 256-263. 6
Siehe auch Bekele 1990: 139.
".....partial studies and surveys give us a good insight into the major problems with which music rese-
arch in Africa must concern itself........"
Damit ist gemeint, dass die Erforschung zunächst nur einer bestimmten Gemeinschaft und die wissen-
schaftliche Spezialisierung auf diesem weiter einzugrenzenden Gebiet, etwa einer speziellen Musik-
tradition, ein qualitativ brauchbares Ergebnis ermöglicht. Die Arbeit soll sich nicht zuletzt deshalb auf
die Forschungen zur amārā-Kultur beschränken.
Äthiopien ist ein Land mit verschiedenen Kulturen und Traditionen, die sowohl wesentliche Gemein-
samkeiten, aber auch Unterschiede besitzen. Grundsätzlich wird an erster Stelle zwischen den Musik-
traditionen der amārā, wälāmo {ወላሞ} təgrāy, sidāmõ, gambēllā {ባምቤላ}, šanqəllā {ሻንቅላ},
gumūž {ጉሙዝ}, wälayətta {ወላይታ}, doržē {ዶርዜ}, hamär {ሐመር}, šənašā {ሽናሻ}, mursī
{ሙርሲ}, orõmõ, gurāgē, harärē, qottū {ቆቱ}, sumāle, arsī usw. unterschieden. Dennoch können all
diese Gemeinschaften in bestimmter Hinsicht zugleich Gemeinsamkeiten z.B. der gemeinsamen
Sprachfamilie besitzen.
Doch sogar innerhalb einer einzigen ethnischen Gruppe wie beispielsweise der orõmo, der gurāgē
oder der amārā sind Unterschiede u. a. im Sprachdialekt, der Lebensweise, der Tradition und der Mu-
sik, z.B. in Lied- und Textstrukturen, sowie in den Tänzen festzustellen. Aufgrund dessen wird in die-
ser Arbeit versucht, möglichst genaue Analysen und Darstellungen anzufertigen, die detailbezogen
sind und für weitere wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Gebiet einen Weg öffnen. Es wer-
den zwar Vergleiche mit anderen ethnischen Gruppen Äthiopiens angestellt, die mögliche kulturelle
Verknüpfungen und Kontakte zwischen diesen anzeigen, doch soll gerade die Konzentration auf eine
Gemeinschaft die Vielfalt und Verschiedenartigkeit in den Kulturen Äthiopiens hervorheben, z.B. in
den Hochzeitstraditionen der amārā und der adärē {አደሬ}.
Die amārā
Die amārā sind eine der bekanntesten Volksgruppen Äthiopiens. Die Herkunft der amārā wird unter-
schiedlich dargestellt. Einige Erzählungen legen die Vermutung nahe, dass sie Einwanderer seien.
Andere sind der Meinung, dass die ethnischen Wurzeln der amārā auf semitische Einwanderer aus
dem heutigen Gebiet des Yemen zurückzuführen sind. Etwa in der zweiten Hälfte des zweiten vor-
christlichen Jahrtausends begannen sie den nördlichen Teil des äthiopischen Hochlands zu besiedeln.
Andere rechnen sie zu den Ureinwohnern Äthiopiens, die schon seit Jahrtausenden Zentraläthiopien
bewohnten (Bartnicki 1978: 626f). Jedoch liefern all diese Beschreibungen keine festen Beweise, so
dass weiterhin nur spekuliert wird.
Geographisch betrachtet bewohnen die amārā zum größten Teil das Zentrale Hochland Äthiopiens
und zwar die Regionen Šäwā, Goğām, Gondär und Wällõ auch als die amārā-Hochebene bezeichnet7,
die nördlich von Addīs Abäbā liegt. Jedoch haben sie sich laut Heinrich (1984: 41)
"insbesondere seit der Etablierung des Staatswesens unter Kaiser Menelik II. ........ in fast allen Lan-
desteilen vornehmlich entlang der neuen Straßenverbindungen und in den Verwaltungszentren der
Distrikte und Provinzen niedergelassen".
Somit bilden sie neben den orõmo, gurāgē, təgrāy, adärē, wälāmõ, doržē u.a. einen wichtigen Bevöl-
kerungsanteil.
Die amārā besitzen insbesondere seit der Salomonischen Dynastie (ca. 1270 n. Chr.) eine dominante
politische Macht. Das bedeutet, dass
7
Vgl. hierzu Kaplan 1971: 12.
"seit dieser Zeit fast alle Kaiser - bis auf einen: Yohannes IV, 1872-1889 - des 'hochäthiopischen Rei-
ches' amhara"
waren (Heinrich, 1984: 41). Das Volk der amārā ist für seine kriegerische und kämpferische Natur
bekannt und war auch stets auf seine Unabhängigkeit bedacht. Bartnicki (1978: 537f) berichtet in sei-
nem Buch über die Reaktion der amārā zur Zeit der italienischen Invasion im Jahre 1937 wie folgt:
"Eine besonders aktive Widerstandsbewegung entwickelte sich unter der amharischen Bevölkerung,
wo sich auch die Repressalien des Aggressors verheerend auswirkten. Die Amharen hatten vor dem
italienisch-äthiopischen Krieg die politische Hegemonie im Staate inne, deshalb empfanden sie den
Verlust der Unabhängigkeit am schmerzhaftesten und nahmen sehr aktiv am Befreiungskampf teil".
Ferner sind die amārā u.a. für ihre Silbenschrift8, ihre poetische Kunst qənē9 {ቅኔ} und ihre Mu-
sikkultur bekannt, die in den typischen traditionellen Liedern žäfän {ዘፈን} und dem Schultertanz
əskəstā {እስክስታ} gesehen wird.
Die Hochzeitsgesänge sind ein wichtiger Bestandteil der amārā-Kultur. Sie umfassen direkt oder indi-
rekt einen Großteil des Musikrepertoires. Die verschiedenartig gestalteten Gesänge bzw. Gesangsfor-
men sind im Hochzeitsrepertoire präsent. Daher ist es sinnvoll, anhand eines doch recht bedeutenden
sozialen und auch individuellen Ereignisses einen tieferen analytischen Zugang zur Musikkultur der
amārā zu finden, zugleich aber auch für kommende Generationen dieses spezielle Thema ausführlich
zu behandeln und die Hochzeitskultur mit den dazu gehörenden traditionellen Gesängen aufzuzeich-
nen und bekannt zu machen.
1.2. FORSCHUNGSSTAND UND MATERIAL
1.2.1. Literatur
Die allgemeine Geschichte Äthiopiens und dessen Politik betreffend sind umfangreiche wissenschaft-
liche Abhandlungen angefertigt worden. Eines der wichtigsten literarischen Werke der äthiopischen
Geschichte ist das im 14. Jahrhundert in der gə'əž {ግዕዘ} Sprache geschriebene historische Buch
kəbrä nägäst {ክብረ ነገስት}, "Ruhm der Könige". Desweiteren dienen die Arbeiten von Rossini10
(1928); Budge (1928); Ullendorf (1960) u.a. als wesentliche Grundlage.
Die von Lapiso (1982) und Andrzej Bartnicki/Mantel Niecko (1978) herausgegebenen Werke stellen
einen ausführlichen Bericht über die allgemeine und die politische Geschichte Äthiopiens dar.
Auch Punkhurst, ein international bekannter Äthiopinist, hat eine wichtige Arbeit zur äthiopischen
Geschichte geleistet und eine große Anzahl von wissenschaftlichen Abhandlungen herausgegeben
(z.B. 1982).
In Verbindung mit Richard Punkhurst, ist dessen Sohn, Alula Punkhurst, zu erwähnen, der sich eben-
falls mit der äthiopischen Geschichte befasst und zwar vor allem mit dem literarischen Werk kəbrä
nägäst.
8
Die Silbenschrift beruht auf dem sabäisch-kalligraphischen System. Am Anfang u. Z. wurde sie im axumitischen Reich
verwendet. Die gə'əž Sprache ging aus dieser Silbenschrift hervor und entwickelte sich über all die Jahre hindurch. Anfang
des 19. Jahrhunderts wurde sie dann von der amārischen Sprache ersetzt (Bartnicki 1978: XXX; 365; siehe auch Richter 1987:37f.).
9
Diese Kunst der Poesie, die auch eng mit der traditionellen Musik der amārā verknüpft ist, wird als säm und wärq "Wachs
und Gold" bezeichnet. Es geht um Gedichte, deren Inhalte so dargestellt werden, dass sie eine Zweideutigkeit einschließen, wobei die zuerst klare und leicht verständliche Bedeutung als säm und die verdeckte Bedeutung als wärq bezeichnet wird.
10
Carlo Conti Rossini, ein berühmter italienischer Wissenschaftler, hat über die äthiopische Geschichte zahlreiche bedeuten-
de wissenschaftliche Arbeiten angefertigt, die zwischen 1894 und 1947 veröffentlicht wurden. Außerdem ist er für die Ab-
fassung seiner hervorragenden und ausführlichen Monographie bekannt, die der äthiopischen Altertumsgeschichte ge-widmet ist (siehe Bartnicki 1978: XVI).
Als eine Einführung in die äthiopische Kunst, Architektur, und Kultur sind u.a. die Schriften von
Buxton (1970); Lipsky (1962); Levine (1965) und Eshete (1982) ausschlaggebend.
Zu den verschiedenen Religionskulturen Äthiopiens, d.h. die jüdische, christlich-orthodoxe und mus-
limische, haben u.a. Ullendorf (1968: hinsichtlich der jüdischen Elemente in der christlich-orthodoxen
Kultur Äthiopiens); Trimmingham (1965: zu moslemischen Praktiken und Glauben) und Shelemay
(1989: im Hinblick auf die jüdische Religionskultur) außerordentliche Arbeiten geliefert.
Die Erforschung der äthiopischen Musikkulturen befindet sich noch in einem Anfangsstadium. Im
Vergleich zu den kaum untersuchten Gemeinschaften des Landes wie beispielsweise die gurāgē,
wälāmo, orõmõ, qottū und šanqəllā ist die Musikkultur der amārā immerhin in geringem Maße er-
forscht worden. Dennoch ist dies als dürftig einzustufen, da nur eine handvoll wissenschaftlicher Ar-
beiten dem Leser zur Verfügung stehen.
Eine größere Anzahl von wissenschaftlichen Abhandlungen ist von ausländischen Musikethnologen
angefertigt worden. Einen Teil davon stellen Reiseberichte11 dar. Andere basieren lediglich auf litera-
rischen Abhandlungen12, die keine detaillierten Beschreibungen anbieten.
Von den äthiopischen Forschern bzw. Musikethnologen haben Kebede und Bekele eine wichtige Rolle
in der Bekanntmachung der äthiopischen Musik. Dies gilt besonders für die Musikkultur der amārā.
Kebede hat sowohl in seiner Dissertation (1971a) als auch in zahlreichen Artikeln (1971b; 1977a und
b; 1979/80; 1980; 1982; 1989) viele Transkriptionen, Analysen und ausführliche Beschreibungen über
die Gesänge der amārā angefertigt. Bezüglich der traditionellen Musikinstrumente, insbesondere des
Zentralen Hochlands, hat er gleichfalls wichtige Studien (1967; 1971a; 1977a; 1989) veröffentlicht.
Bekele hat zwei Arbeiten (1987 und 1990) veröffentlicht. In seiner Arbeit (1987) beschäftigt er sich
mit den in Äthiopien verwendeten Tonsystemen, die er als səlt'13 {ስለት} bezeichnet, mit Musiziersti-
len und -formen und mit einer instrumentenkundlichen Analyse, insbesondere bezogen auf das Zentra-
le Hochland Äthiopiens. Ferner beschreibt er die weltliche und religiöse Musik und deren musikali-
sche Regeln. Er bezieht sich jedoch in seiner Gesamtdarstellung nicht auf eine bestimmte ethnische
Gruppe, sondern er geht stets von der allgemeinen äthiopischen Musikkultur aus.
Die zweite Arbeit von Bekele (1990) ist eine Art Lehrbuch, das in amārəñā-Sprache verfasst ist und
dem Leser allgemeine Grundkenntnisse über Musik und musikalische Entwicklungen u. a. in Afrika,
Europa und Amerika vermittelt. Spezielle Kapitel geben Auskunft über die äthiopische Musikkultur,
deren historischen Hintergrund und Entwicklung.
Von den Personen, die sich zwar nicht als Musikethnologen, sondern als Amateurforscher mit der
traditionellen Musik beschäftigt haben, ist als Beispiel Lemma (1975) zu nennen, der u.a. ein kleines
Bulletin über traditionelle Musikinstrumente herausgegeben hat. Die Beschreibung der in unterschied-
lichen Regionen Äthiopiens gebräuchlichen Instrumente besteht vor allem aus Abbildungen. In dieser
Arbeit sind zwar keine ausführlichen Analysen angefertigt worden, dennoch sind allgemeine Informa-
tionen über Herstellungsprozess, Material, Struktur und Verwendung der einzelnen Instrumente ange-
geben. Des Weiteren gehört Lemma zu dem Personenkreis, der die traditionelle Musik Äthiopiens
intensiv gepflegt hat und noch heute pflegt.
Ausländische Musikethnologen wie z.B. Kimberlin haben auch für die traditionelle Musik Äthiopiens
viel geleistet. Sie hat sowohl in ihren Artikeln (1975; 1978; 1980; 1984; 1989, 1991; 1993) als auch in
ihrer Dissertation (1976) spezielle Themen behandelt, die u. a. traditionelle Musikinstrumente (1976;
1978 und 1984) und das qəñət-System {ቅኝት} (1976) betreffen. Dazu hat Kimberlin eine große An-
zahl von Musikbeispielen aufgenommen, transkribiert und diese entsprechend analysiert.
Weiterhin ist Powne zu nennen, der in seinem Buch (1968) u. a. die christlich-orthodoxen und die
weltlichen Musizierbereiche Äthiopiens im Zusammenhang mit deren historischen Hintergründen und
11
S. u. a. die Arbeit von Hans Helfritz 1972. 12
S. z. B. Mondon Vidailleth - "La Musique Ethiopiennč. - in: Encyclopedie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire. - Paris 1922.
13
Bekele hat für den Begriff qəñət, "Tonreihe", die Bezeichnung səlt bevorzugt, weil er der Meinung ist, dass der qəñət-Begriff Verwirrungen erzeugt. Literarisch bedeutet das Wort səlt "Art und Weise".
Entwicklungen untersucht hat. Dazu kommen seine instrumentenkundlichen Analysen mit zahlreichen
Abbildungen und Fotomaterialien. Powne hat insbesondere Musikinstrumente analysiert, die im Zent-
ralen Hochland häufig verwendet werden wie beispielsweise die Leier kərār {ክራር}, die einsaitige
Kastenspießlaute masinqõ {ማሲንቆ} , die Jochlaute bägänā {በገና} und die Flöte wašənt {ዋሽንት}.
Dennoch sind manche seiner Beschreibungen kritisch zu betrachten, da sie zum Teil fehlerhafte bzw.
unzureichende Darstellungen beinhalten. Dies betrifft z.B. die Beschreibung der qəñət-Tonreihe təžətā
{}. Powne (1968: 47f.) hat in diesem Abschnitt versucht, die insbesondere für das Zentrale Hoch-
land typischen fünfstufigen qəñət-Tonreihen am Beispiel zweier Musikinstrumente, und zwar wašənt
und kərār darzustellen. Bis auf den təžətā-qəñət sind die restlichen qəñətõč (Plural von qəñət), d.h.;
batī {ባቲ}, ambassäl {አምባሰል} und ančī hoyē länē {አንቺ ሆዬ ለኔ} korrekt niedergeschrieben
worden. Die um einen Ton falsch notierte Tonreihe der təžətā-qəñət kann mit Hilfe eines Beispiels
erklärt werden, das zeigen soll, wie die Tonreihe der təžətā-qəñət von Powne (1968: 47) an einer Stelle
fehlerhaft veranschaulicht wurde. Er listet die von einem kərār gespielten Töne von links nach rechts
() aufeinander folgend so auf:
Abb. 1
1 2 3 4 5 6 Saitenzahlen
c' c ab g eb db qəñət-Töne
Abb. 2
Dieselben Tonhöhen sind in der nachfolgenden Tabelle noch einmal
von ihrem Ausgangston (in diesem Fall der Ton c) aus aufwärts im
Zusammenhang mit ihren Intervallgrößen angegeben worden, da
dies die praktizierte Reihenfolge aller qəñətõč ist und so auch op-
tisch ein besseres Bild entsteht.
Abb.3
traditionelles Modell
modernes Modell
Dabei ist der Oktavton c', der nur eine Wiederholung des Ausgangstones c ist, nicht in Betracht zu
ziehen, weil für die Erläuterung einer qəñət eigentlich nur die fünf, die jeweilige qəñət bildenden Ton-
höhen zur Diskussion stehen. Die Wiederholung des Ausgangstones in der Oktave kommt in allen
qəñət-Tonreihen vor. Dies ist beim Hören eines gestimmten Instruments z.B. ein kərār, der bei den
amārā gewöhnlich aus sechs Saiten besteht14 oder der einsaitigen Fidel masinqõ15 feststellbar.
14
Es gibt auch Leier, die nur aus fünf Saiten bestehen wie z.B. bei den təgrāy (Region Təgrāy).
Die təžətā-qəñət hat in der Regel zwei Versionen (s. Kapitel 3; Abschnitt 3.1.1.), die von Powne je-
doch nicht durchschaut wurden. Die erste Version besteht aus den Tonhöhen c-d-e-g und a, wobei der
Ton c als Ausgangston verstanden wird.
Abb. 4
Abb. 5
Saitenzahlen
kərār-Saiten
db eb g ab c c1 entsprechende Ton-
höhen der kərār-
Saiten lt. Powne
Die zweite Version dagegen ist die oben von
Powne angegebene Tonreihe. Jedoch ist hierbei
die Tonhöhe des, der richtig als vorzeichenlose
Tonhöhe notiert werden sollte, falsch. Der richti-
ge Aufbau dieser Tonreihe würde demnach die
Darstellung in Abbildung 4 entsprechen.
Die Intervallfolgen sind somit g2, k2, g3 und
k216.
Für die Notierung der qəñət-Tonreihen hat Pow-
ne (1968: 48) auch die 6 kərār-Saiten von rechts
nach links von 1-6 durchnumeriert (Abb. 5).
In Abbildung 1 nummeriert Powne die Tonreihe von links nach rechts (), so dass die Reihenfolge
mit den tatsächlichen Tonhöhen auf den kərār-Saiten nicht übereinstimmt. Daher führt seine Angabe
zu Verwirrungen und die charakteristisch aufsteigende Sequenz einer qəñət-Tonreihe bleibt undurch-
schaubar.
Aufgrund dessen ist es sinnvoll die kərār-Saiten nach dem Nummernsystem - d.h. Fingernummern-
und Saitenzahlsystem - zu ordnen, das kurz nach 1968 an der Yared Musik Schule in Addīs Abäba
Äthiopien entwickelt wurde17, um Musikschülern durch ein einfaches Aneinanderreihen von Zahlen
das Erlernen traditioneller Musikinstrumente zu erleichtern (Gelaw 1993).
Zunächst werden die sechs kərār-Saiten so gestimmt, dass sie durch ihre Zahlenanordnung nur eine
aufsteigende Tonreihe darstellen (s. die Richtungen der Pfeile).
Abb. 6
Saitennummern zum Stimmen
kərār-Saiten
d eb g ab c c' aufsteigende qəñət-Tonreihe = Ausgangston
-----
-----
-----
-----
-
Diese Nummerierung entspricht jedoch nicht dem Zahlensystem der Yared Musikhochschule. Abge-
sehen von der Melodievorstellung eines bestimmten Musikstücks, die beim Stimmen einer qəñət-
Tonreihe eine wesentliche Rolle spielt, muss sie zunächst einmal nur in dieser Reihenfolge gedacht
15
S. eine ausführliche Beschreibung über die masinqõ im Abschnitt 3.5.4. 16
Zur näheren Erläuterung siehe Abschnitt 1.3. 17
Pownes Forschungstätigkeit erfolgte vor 1968, da sein Buch erst in diesem Jahr herausgegeben wurde. Dies bedeutet, dass er möglicherweise von diesem Nummernsystem nicht Gebrauch machen konnte.
werden. So stimmt sie auch mit den Intervallen, der in der korrigierten Version dargestellten Tonhö-
hen (c-d-eb-g-ab-c'- Abb. 4) überein.
Laut Abbildung 6, weist die mit der Nummer 1 versehene kərār-Saite auf den Ausgangston des qəñət
hin. Danach schließt sich die Reihe weiterer Tonhöhen an (s.Pfeile).
Basierend auf dem Zahlensystem erhalten die sechs Saiten jedoch die Nummerierung wie sie in Ab-
bildung 7 angegeben ist. Diese Nummerierung verläuft zwar genauso wie die von Pownes von links
nach rechts (), aber die Tonhöhen der einzelnen Saiten sind andere (vgl. die Tonreihe c'-c-ab-g-
eb-db- Abb.2 von Powne mit der in Abb. 7 dargestellten Tonreihe d-eb-g-ab-c-c').
Abb. 7
D D ZF M RF KF D Daumen
ZF Zeigefinger
Fingernummern MF Mittelfinger
RF Ringfinger (Ausgangston)
kərār-Saiten KF kleiner Finger
d eb g ab c c' aufsteigende qəñət-Tonreihe
Es ist bei der Erläuterung einer Tonreihe auch sinnvoll, den Leser von vornherein auf die Reihenfolge
der Saiten und die parallel entsprechenden Tonhöhen aufmerksam zu machen, wenn die qəñət-
Tonreihe anhand des kərār demonstriert wird18.
Des Weiteren schreibt Powne, dass der erste Ton (s. c') der tiefste Ton wäre. Praktisch ist das Gegen-
teil der Fall, denn es ist der höchste Ton der gesamten Tonreihe. Der tiefste wäre der Ton c, der eine
Oktave tiefer gestimmt wird und in der Regel als erster und somit als Ausgangston fungiert. Der Ok-
tavton c' wird entweder unmittelbar nach dem Ausgangston, oder ganz am Ende gestimmt.
Es bleibt zu erwähnen, dass beim Stimmen des einen oder anderen Instruments durchaus geringe Ab-
weichungen entstehen können, die auf deren unterschiedlichen Bau, die Größe und das Material, das
dem einzelnen Instrumentenbauer zur Verfügung steht, Rücksicht nehmen. Diese Abweichungen kön-
nen in geringen Frequenzunterschieden deutlich werden, die jedoch für den erfahrenen Zuhörer nicht
als Unterschiede erkannt werden, solange eine qəñət von seiner groben Intervallfolge her seiner Vor-
stellung entspricht. Es bleibt dennoch ein und dieselbe qəñət.
Abb. 8
Es besteht kein Zweifel daran, dass Powne bei seiner Un-
tersuchung, die jeweils von kərār und wašənt vorgespiel-
ten Tonhöhen, nach seinem Gehör genau notiert hat, abge-
sehen davon, ob sie tatsächlich korrekt sind oder nicht.
Er hat jedoch nicht beachtet, dass die təžətā-qəñət zwei Varianten besitzt (s. Abschnitt 1.3.). Es ist an
den von Powne notierten Intervallen zu erkennen, dass der wašənt-Spieler die erste und der kərār-
Spieler die zweite Version dieser təžətā-qəñət gespielt haben, die von Powne allerdings nicht als Ton-
reihenvariante erkannt wurden. Anstatt diese Unterschiede getrennt zu analysieren, hat er sie als eine
einzige Tonreihe verstanden und alle vorkommenden Töne kombiniert dargestellt. Daraus ergibt sich
somit laut Powne die in Abbildung 8 demonstrierte Tonreihe.
Powne beschreibt damit, dass sich die təžətā-qəñət aus insgesamt neun Tönen besteht. Dies ist prak-
tisch jedoch falsch, da von vornherein keine getrennte Analyse für beide Versionen stattgefunden hat.
18
Bei einem anderen Instrument wie z.B. bei der masinqõ, ergibt sich ein verändertes Bild, das auf die Konstruktion des
Instruments, die Position der Finger im Zusammenhang mit den Tonfolgen oder mit der eigentlichen Tonreihe zurückzu-führen ist.
Zufälligerweise ist nur die bātī-qəñət von beiden Instrumenten mit völlig gleichen Tonhöhen gespielt
worden, so dass sich in der kombinierten Tonreihe laut Powne eine pentatonische Reihe ergeben hat.
Ansonsten sind die restlichen nach dem kərār-Spieler (Powne 1968: 47f.) angegebenen drei qəñət-
Tonreihen bātī, ambassäl und ančī hoyē länē auch mit dieser fehlerhaften Methode richtig. Es bleibt
also zu fragen, zu welchen Analyseergebnissen Powne am Ende seiner Untersuchung gekommen wä-
re, wenn sich in allen von beiden Musikinstrumenten, kərār und wašənt, demonstrierten qəñət-
Tonreihen Abweichungen ergeben hätten und damit verbundene Missverständnisse aufgetreten wären.
Außer den bislang erwähnten Musikethnologen haben sich auch viele ausländische Musikethnologen
mit verschiedenen Themen der äthiopischen Musikkultur beschäftigt. Bezüglich der äthiopischen Mu-
sikgeschichte geben unter anderem die Arbeiten von Baumann (1978) und Laurence (1957) einige
Auskünfte. Außerdem haben sie sich auch speziell mit der religiösen Musik der äthiopischen Orthodo-
xen Kirche beschäftigt.
Auf Musik und Tanz bezogene Analysen sind in den Arbeiten von Bamzai (1970), Baumann (1978),
Bender (1982), Günther (1970) und Sarosi (1967) zu finden.
Mit der Musik der fälāšā, der so genannten äthiopischen Juden, bieten die Abhandlungen von
Shelemay (1977, 1980 und 1982) ausführliche und interessante Informationen über die Geschichte und
die Musik dieser Volksgruppe an.
Sprachwissenschaftliche Publikationen über die amārəñā-Sprache sind ausreichend vorhanden. Es
sind hierbei u. a. Autoren wie Richter (1987), Leslau (1964) und Hartmann (1980) zu erwähnen, die
sich vor allem mit der Grammatik dieser Sprache detailliert auseinandergesetzt haben. Auch über
Sprachen anderer Gemeinschaften Äthiopiens, wie beispielsweise gurāgiñā {ጉራጊኛ} und oroməñā
{ኦሮሚኛ} stehen eine Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung.
Bei der Untersuchung einer fremden Musikkultur sind in vielen Fällen Fehlinterpretationen, die aus
verschiedenen Gründen zustande kommen können, nicht auszuschließen. Das Problem der Fehlinter-
pretation zeigt sich allerdings nicht nur in Bezug auf die äthiopische Musikkultur, sondern allgemein
auch in den Darstellungen einiger Musikkulturen Afrikas. Dies betrifft vor allem Reisende, Missiona-
re, Kolonialverwalter usw., die sich als Laien mit diesem Gebiet beschäftigen (Kubik 1988: 37). Da
diese Gruppe von Menschen völlig andere kulturelle Erfahrungen und im Zusammenhang damit auch
andere Wahrnehmungsarten besitzt, ist davon auszugehen, dass sie auch die fremde Musik falsch
versteht (Nketia 1975: 8; 10f.; Merriam 1964: 14; Danielou 1972: 56). Aufgrund dessen ist es nicht
ausreichend, mit der Untersuchung einer Musikkultur nur bewusst umzugehen, sondern wie Nketia
(1975: 9) es erläutert:
"We should endeavour also to enhance our understanding and appreciation in terms of the norms,
usages and modes of interpretation established in those cultures."
Für die Beschreibung und Analyse einer Musikkultur steht bis heute weitgehend die europäische Nota-
tion als einzige Möglichkeit zur Verfügung. Hierzu berichtet Bekele (1987: 20) folgendes:
"As far as known no non-literate culture has independently developed a notational system for its or-
ganisation of culturally defined musical sound and this means that there is relatively little hope of
reconstructing the aural shape of music with any degree of accuracy".
Daher dient diese europäische Notation bislang als ein wesentliches Hilfsmittel für die wissenschaftli-
che Verständigung vor allem der mündlich überlieferten Musikkulturen (Bekele 1987: 29). Dies be-
deutet, dass die zu untersuchende Musikkultur nicht im Sinne europäischer Musizierweisen verstanden
werden darf, nur weil deren Notation als Basis der wissenschaftlichen Untersuchung verwendet wird.
Das passiert jedoch selten. Die europäische Notation wird für die Untersuchung einer unbekannten
Musik als Hilfsmittel verwendet und beinhaltet gleichzeitig eine Interpretation. Dadurch können wich-
tige musikalische Normen dieser Kultur übersehen werden.
In manchen Fällen könnte die zu untersuchende Musik sogar als eine falsche Musik verstanden
werden, die falsche Modi, Skalen oder Tonleitern und daher auch falsche Gesän-
ge enthält, weil sie den Vorstellungen des jeweiligen Forschers nicht entspricht (Kubik 1988: 37;
Gottlieb 1986: 58). Eine falsche Musik bzw. falsche Gesänge gibt es jedoch in keiner Mu-
sikkultur. Im Gegenteil, jede Musik besitzt ihre eigene Normen und Besonderheiten, die von dem Mu-
sikethnologen auch als solche verstanden und wahrgenommen werden müssen.
Kebede (1971: 68), ein erfahrener äthiopischer Musikethnologe, kritisiert z.B. Powne (1968: 76), der
den allmählichen Höhepunkt eines fukärā-Liedes {ፉከራ}19 "Kriegs-, Heldenlied", der in Form eines
Sprechgesanges dargestellt wird, als ein gewaltiges Geschrei und Lärm bezeichnet hat, wie folgt:
"...Mr. Powne's remarkable lack of sympathy for Ethiopian culture and his subjective cultural orienta-
tion emerges unforgivably in the important concluding statement. This Euro-centered conclusion is
unfortunately obvious when Mr. Powne tells us that the fukera song builds "up to a tremendous climax
of noice and excitement, when the singing degenerates into shouting." On the contrary, the fukera
song progresses and climaxes with gutteral speech-recitation in fortissimo. It is this ending musical
height which, in fact, is known as fukera; it is also this same ending which Powne describes as noise -
- a loose term which is only culturally meaningful. Traditionally, it is in this climax or height that
every performer or listener of fukera encounters an emotional fulfilment; women break up into happy
flood of tears; it "boils up to the blood" of the men into frenzied, reckless and patriotic aggression".
Auch Nketia (1975: 11) äußert sich hinsichtlich dieser Problematik wie folgt:
"If we take note of the fact that African musicians neither write down their music nor verbalise its
principles in the same analytical terms, we can see that their understanding of the music they make is
based on other considerations. That is why those disillusioned by analytical studies that do not take
them any further stress that form is like a skeleton that needs to be clothed with flesh and given a soul.
Statements about music must not give us only skeletons but also the flesh and soul that make music
alive....It would be wrong, of course, to ignore 'outward form', because it is an important vehicle of
meaning, but we must also grapple with 'inner forms', or what has been variously described as con-
tent, message and meaning".
Eine Fehlinterpretation bei der Erforschung einer unbekannten Musikkultur wird nicht selten durch
den Mangel an Sprachkenntnissen und durch Übersetzungsschwierigkeiten hervorgerufen. Es kommt
nicht oft vor, dass sich ein Musikethnologe im Voraus bemüht, die Sprache der Einheimischen, deren
Musikkultur ihm noch unbekannt ist, zu erlernen. Tatsache ist, dass die meisten Wissenschaftler ver-
suchen, ihre Untersuchungen mit Hilfe einer dritten Person (Dolmetscher) durchzuführen. Natürlich
steht diese Methode dem Musikethnologen als einzige Möglichkeit zur Verfügung, sich mit Einheimi-
schen zu verständigen. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Verständigung durch Dritte auch zu
fatalen Missverständnissen und damit verbunden zu katastrophalen Fehlinterpretationen der zu unter-
suchenden Musikkultur führen (vgl. auch Nketia 1976: 9).
"Eines der konzeptuellen und methodologischen Hindernisse beim Studium und der Beschreibung af-
rikanischer Kulturen und ihrer verschiedenen Ausdrucksbereiche besteht in der Illusion ihrer Über-
setzbarkeit.
Besonders das Vokabular der europäischen Musiktheorie hat kaum eine Chance, die Vorstellungswelt
afrikanischer Musikkulturen zu erfassen, sondern erwies sich im Gegenteil bisher als das wichtigste
Werkzeug zu ihrer Fehlinterpretation" (Kubik 1988: 52).
Das Verstehen der Sprache, das dem Musikethnologen den Weg zu einer genaueren Analyse seiner
Forschung ebnet, hilft ihm, falsche Übersetzungen und Interpretationen zu vermeiden.
Zum Verstehen der Sprache gehört dann auch das Verstehen der Musik, die letztendlich den Schwer-
punkt der wissenschaftlichen Untersuchung bildet. Hier ist auch der Musikethnologe darauf angewie-
sen, andere musikalische Wahrnehmungsarten zu erlernen.
19
Siehe ausführliche Beschreibung im Abschnitt 1.4.1.5.
Zum Verstehen einer fremden Musikkultur muss zusätzlich ein gewisses Gefühl für die zu untersu-
chende Musik, die Musiker und in Verbindung damit für die sozialen Gegebenheiten, die sich histo-
risch ändern, vorhanden sein.
Im Allgemeinen bessert der Musikethnologe sein Wissen über die Bedeutung einer Musikkultur vor
allem dann auf, wenn er sich nicht nur auf die formale Analyse beschränkt, sondern darüber hinaus-
geht (Nketia 1962: 3; 1966: 35; 1976: 11).
1.2.2. Eigene Vorarbeiten
Ein wichtiger Ausgangspunkt dieser Arbeit besteht vor allem darin, eine schriftliche Dokumentation
der Musikkultur der amārā in Addīs Abäbā und besonders im Zentralen Hochland die Regionen
Goğām und Gondär vorzunehmen, dessen Ziel darin besteht, das gesamte Hochzeitsrepertoire aufzu-
nehmen, zu transkribieren, zu analysieren und dieses letztendlich zu dokumentieren. Dazu gehört die
Auseinandersetzung mit den sozialen und kulturellen Werten der Hochzeitstradition der amārā.
Gezielte und technisch gut vorbereitete Feldforschungen wurden von April bis Juli 1997 sowohl in der
äthiopischen Hauptstadt Addīs Abäbā als auch in den Regionen Goğām und Gondär durchgeführt,
dem Hauptsiedlungsgebiet der amārā. In dieser Zeit entstanden ca. 450 Min. Videoaufnahmen20, 105
DAT-Aufnahmen, ca.280 MC-Aufnahmen und 240 Fotos zum Thema.
Ergänzend sind auch wichtige Informationen in Form von Befragungen, Gesprächen, Diskussionen
und Interviews von Bekannten, Verwandten und Freunden protokolliert worden. Die diese For-
schungsarbeit unterstützenden Personen bzw. Institutionen sind im Folgenden aufgelistet:
Informationsquelle21 Ort
Institute of Ethiopian Studies /Institut für äthiopische Forschungen/ Addīs Abäbā
Universität
Addīs Abäbā
Äthiopisches Bildungsministerium Addīs Abäbā
Yared Musikhochschule Addīs Abäbā
Interview mit Yeshigeta Mekuria aus Šäwā Region Addīs Abäbā
Interview mit Bayru Gebreyesus aus Təgrāy Region Addīs Abäbā
Izra Abate (Direktor der Yared Musikhochschule) Addīs Abäbā
Ahmed Zekaria (Institute of Ethiopian Studies/Addīs Abäbā Universität Addīs Abäbā
Alemu Debissa (Bräutigam/Informant) Addīs Abäbā
Genet (Braut/Informantin) Addīs Abäbā
Martha Teffera (Reisebegleiterin) Addīs Abäbā
MIDROC-Ethiopia Addīs Abäbā
Helena Teffera (Braut/Informantin) Addīs Abäbā
Gultu Teffera (Informant) Addīs Abäbā
Sahlu Woldelioul (Bräutigam) Addīs Abäbā
Alemtsehay Worke (Informantin) Addīs Abäbā
Amaresch Admassu (Informantin) Addīs Abäbā
Kultur- und Tourismus-Büro (Bahəlna Turisəm Ma'əkäl-Batuma) Bahər Dār
Menkir Tibebu (Reisebegleiter und Informant) Bahər Dār
Abäbaw Berhanu (Reisebegleiter und Informant) Bahər Dār
Getachew Abebe (Bräutigam/Informant) Bahər Dār
Tirusäw Getahun (Braut/Informant/Informantin) Bahər Dār
Interview mit Zerfu Takele Bahər Dār
Mizanu Shambel (masinqõ-Spieler und Sänger) Bahər Dār
Meqwanent Adane (masinqõ-Spieler und Sänger) Bahər Dār
Alemayehu Gebresadik (Kultur und Tourismus-Büros/Informant) Bahər Dār
20
Die Aufnahmen wurden im Völkerkundemuseums Berlin, Fachreferat Musikethnologie archiviert. 21
siehe auch detaillierte Beschreibung im Literaturverzeichnis
Fekadu Haile (Lehrer/Informant/Reisebegleiter) Gondär
Siyoum (Informant) Gondär
Asmamaw...(Lehrer/ Informant) Gondär
Netsanet Asmamaw (Reisebegleiterin) Gondär
Rahel Asmamaw (Informantin) Gondär
Bitew Amare (wašənt-Spieler/Informant) Gondär
Gebremariam Adane (wašənt-Spieler/Informant) Gondär
Addisu Birhan (kərār-Spieler/Informant) Gondär
Ein Großteil der gesammelten und analysierten Musikbeispiele betrifft reine Hochzeitsgesänge, also
Gesänge, die nur zu Hochzeitsfeiern gesungen werden. Es gibt aber auch Musikbeispiele, die der
Gruppe der Unterhaltungsgesänge zugeordnet werden und somit funktional nicht an eine bestimmte
Handlung während des Hochzeitsfestes gebunden sind. Solche Gesänge können bei allen Musikveran-
staltungen stattfinden.
Von den auf Hochzeitsfeiern der amārā verwendeten Instrumente sind vor allem die Trommel käbärõ
{ከበሮ} und die randgeblasenen Längsflöten əmbiltāwõč {እምቢልታዎች} ausführlich zu beschrei-
ben. Die Trommel käbärõ ist das wichtigste Instrument, das auf jeden Fall die Hochzeitsgesänge be-
gleiten muss. Dagegen ist die əmbiltā nicht auf jedem Hochzeitsfest der amārā zu finden. Desweiteren
ist die einsaitige Kastenspießlaute masinqõ in Verbindung mit dem traditionellen Sänger und Instru-
mentenspieler ažmārī {አዝማሪ} vorzustellen. Die masinqõ ist zwar kein typisches Hochzeitsinstru-
ment, aber überall wo der ažmārī auftritt, wird sie in den meisten Fällen als Begleitinstrument ver-
wendet. Der ažmārī wird auf Hochzeitsfesten entweder von den Veranstaltern der Feier bestellt oder
er erscheint willkürlich und bietet seine Gesänge an, ohne aufgefordert zu werden22.
Zu den Hochzeitsgesängen gehört unmittelbar der traditionelle əskəstā-Tanz {እስክስታ}. Dieser Tanz
konzentriert sich vor allem auf Bewegungen im Bereich der Schultern und Schulterblätter. Der Tänzer
schüttelt seine Schultern, bewegt dazu den Kopf in bestimmten Abständen und stampft mit den Füßen.
Die Einzelheiten und Feinheiten unterscheiden sich allerdings von Tänzer zu Tänzer. In den amārā-
Liedern gibt es in der Regel keine Tanzlieder an sich, sondern nur Lieder zu denen man tanzt. Der
Tanz richtet sich nach bestimmten Formeln in einem Gesang. Es gibt intensive und entspannende
Tanzphasen, auf die der Tänzer entsprechend reagiert.
In den Liedern gründet sich die gesamte Handlung während eines Wechselgesanges auf freiwillige
Beteiligung eines jeden Teilnehmers. So kann jeder sich entweder mit der unmittelbaren Begleitung
des Vorsängers awrāğ {አውራጅ} beschäftigen oder tanzen, trillern und klatschen (Nketia 1974: 35).
Diese Rollenverteilung ergibt sich im Verlauf des Gesanges. Die Beteiligung an einem Gesang bzw.
Wechselgesang ist bei den amārā und in sehr vielen Kulturen Äthiopiens nicht altersbedingt. Dagegen
gibt es jedoch typische Männer- und Frauenlieder. Dies gilt auch für die Hochzeitsgesänge, die einer-
seits von Männern gesungen werden und den Bräutigam bewundern, hochschätzen, oder ihn als Hel-
den darstellen und andere, die von Frauen vorgetragen werden, die Braut trösten, ermutigen oder als
"Geschöpf Gottes" preisen.
Was die Gesangstexte der Hochzeitslieder anbelangt, so ist festzustellen, dass es einerseits Gesänge
gibt, die nur einen bestimmten Text und eine fixierte Melodie besitzen und auch nur in dieser einen
Textvariante als solche identifiziert werden. Auf der anderen Seite sind auch solche Lieder vorhanden,
die mit verschiedenen Texten, auch aus anderen Liedern, kombiniert werden können, solange die Sil-
benanzahl pro Verszeile mit der Melodiezeile zusammenpasst und der einzufügende Text auch inhalt-
lich mit dem vorhergehenden oder mit dem gesamten Textzusammenhang des Liedes übereinstimmt.
In dieser Arbeit sind deshalb viele Textbeispiele angegeben, um den Sinn und die Form der amāri-
schen Liedtexte darzustellen. Die meisten dieser Liedtextbeispiele sind den Musikbeispielen entnom-
men, während ein kleiner Teil aus anderen Alltagsliedern stammt.
22
Beobachtungen/Hochzeitsfeier /Addīs Abäbā und Bahər Dār/Goğām/1997.
Es sind ca. 70 verschiedene Gesänge aufgeführt worden, die in Form einer Tabelle übersichtlich nach
Titel, funktionaler Bindung, qəñət-Tonreihe, Aufführungsform, z.B. Wechselgesang mit Ruf-Antwort-
Schema, und modalen Eigenschaften zusammengefasst aufgelistet sind.
Ausgehend vom bisherigen Forschungsstand und ersten eigenen Beobachtungen seien wichtige
Kenntnisse für die Beschäftigung mit dem Thema der amārischen Hochzeitsmusik genannt:
1. Die enge funktionale Verknüpfung von Musik mit den sozialen, geschichtlichen, politischen,
ökonomischen, religiösen und rituellen Gegebenheiten soll möglichst im zeitigen Forschungs-
stadium akzeptiert werden (Nketia 1962: 4). Eine isolierte Betrachtung und Abtrennung des Mu-
sikalischen führt nicht unbedingt zu genaueren Analysen, im Gegenteil, die aus dem komplexen
Zusammenhang erwachsenen Erfahrungen helfen entscheidend mit, im Laufe der Zeit die musi-
kalischen Regelwerke zu überblicken.
2. Die Sänger gestalten ihre Gesänge variantenreich und vielseitig, bewegen sich jedoch in einem
relativ fest reglementierten Rahmen. Der Einsatz freier melodischer Variationen in den Gesän-
gen gewährt dem Sänger einen beschränkten Spielraum. Es geht dabei um die Bewahrung der
musikalischen Grundstruktur des betreffenden Liedes. Das Lied darf dadurch nicht aus seiner
Tonreihe (qəñət) ausbrechen.
3. Es sind damit sehr oft Melodievarianten, -variationen und -versionen, sowohl in den Liedern als
auch im Instrumentalpart anzutreffen. Es kommt darauf an, deren Ursachen und die Prinzipien
ihrer Bildung zu untersuchen23.
4. Die Textinhalte in Liedern sind für die musikalische Interaktion zwischen Darsteller/Sänger und
Zuschauer/Zuhöhrer von relativ großer Bedeutung. Es gibt andererseits aber auch die Möglich-
keit, gleiche Liedtexte in mehreren Liedern beliebig zu verwenden, wenn sie auf bestimmten ge-
forderten versmetrischen Regeln beruhen.
5. Es sind die Normen von traditionellen Körperbewegungen und Tänzen der amārā der Regionen
Goğām, Gondär, Šäwā und Wällo denen ebenfalls spezielle Prinzipien zugrunde liegen, ebenso
gründlich wie die Musik selbst zu untersuchen.
6. Das zwanglose Engagement eines jeden Menschen in einer musikalischen Veranstaltung und
zwar ohne Alters- oder Geschlechtsunterschied ist Gegenstand der Beobachtung des sozi-
kommunikativen Aspektes.
7. Die neueren sozialen Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen für die musikalische Tradition
(Nketia 1962: 5). Beobachtungen sollen Aufschluss über den Akkulturationsprozess und die dar-
aus resultierenden Probleme geben, um konkret beschreiben zu können, inwiefern die traditio-
nelle Musik durch fremde Einflüsse verändert wird und inwiefern ihre Identität aufrechterhalten
ist.
8. Durch eine konzentrierte Beobachtung des Zusammenhanges zwischen einem Sänger und seinen
Begleitern, zwischen einem Instrumentenspieler und einem Sänger, zwischen einem Tanzpaar
usw. können die musikalischen Charakteristiken und die Aufführungenpraktiken erlernt werden.
Dies ermöglicht eine noch intensivere Analyse.
Beispielhaft sei hier Nketia (1962: 2) angeführt, der während seiner Feldforschung bei den Akan
(Ghana) versucht hat, durch eine intensive Beteiligung an allen sozialen Geschehnissen die Musiktra-
dition zu erlernen:
"...I learnt many things about the musical tradition which I did not know before and which I had not
suspected. Moreover working extensively in the whole Akan area, recording and talking to musicians,
dancers, heads of organisations, attending festivals and ceremonies, I got a better overall picture of
the tradition than any single person I had talked to or worked with...".
23
Melodieabweichungen können z.B. mit dem Bau und der präzisen Stimmung eines traditionellen Instruments zusammen-
hängen. Da die traditionellen Musikinstrumente unterschiedliche Größe und Materialien haben und auch von verschiede-nen Instrumentenbauern hergestellt werden, sind solche Abweichungen nicht auszuschließen und werden toleriert.
1.2.3. Hinweise zu den Transkriptionen und zur Textdarstellung
Transkriptionsmethoden
Das Quellenmaterial der Transkriptionen ist im Museum für Völkerkunde Berlin als Sammlung "Athi-
opien 1997/Teffera" archiviert worden. Die angegebenen Signaturen entsprechen der archivierten
Transkriptionsvorlage oder bezeichnen vergleichbare Aufnahmen, wenn die Notation aus dem Ge-
dächtnis erstellt wurde. Notationen aus dem Gedächtnis erwiesen sich mitunter als notwendig, weil die
vergleichbaren Aufnahmen nicht genügend repräsentativ bzw. unvollständig waren. Die Notationen
"aus dem Gedächtnis" beruhen auf langjährigen Hörerfahrungen und eigener aktiver Teilnahme an den
Gesängen. Dabei sind grundsätzlich die am meisten praktizierten und dem mittleren Standard der Be-
herrschung angepassten Varianten gewählt worden, obgleich mir auch weitere, mitunter noch kompli-
zierte und individuell ausgearbeitete Darstellungsmöglichkeiten bekannt sind.
Das gesamte Hochzeitsrepertoire ist außerdem in einer Liste alphabetisch geordnet und mit Nummern
versehen worden, die für sämtliche Erläuterungen in dieser Arbeit maßgebend sind (s. Repertoireliste
Abschnitt 3.). Im Tonverzeichnis (s. Anhang II), sind neben den Signaturen der Transkriptionsvorlage
auch weitere Aufnahmesignaturen von Gesängen mit vergleichbarer musikalischer Struktur angeführt.
Außerdem sind im Tonverzeichnis im Anschluss an die Hochzeitsgesänge (s. Nr. 73 - 82) zusätzlich
Aufnahmen enthalten, die für einführende Erläuterungen und Gegenüberstellungen wesentlich sind.
Auch diese Aufnahmen sind nummeriert worden, um Verweise im Text zu erleichtern.
Zur Transkription der Gesänge ist in dieser Arbeit die europäische Notation angewendet worden, da
sie vorläufig eine der gebräuchlichsten Möglichkeiten ist, von der bislang nicht notierten Musik eine
klangliche Vorstellung zu vermitteln. In einem repräsentativen Beispiel ist das Erscheinen von Triller
durch dieses Zeichen vermerkt (s. Lied Nr. 66, Anhang II).
Die Vorzeichen der angegebenen qəñət gelten jeweils für die gesamte Notation, auch wenn sie nicht
zu Beginn einer jeden Notenzeile erscheinen. Außerdem sind der Metronomwert und die Quelle der
Transkriptionsvorlage vermerkt.
In allen Musikbeispielen sind Taktstriche generell vermieden worden, obwohl die meisten Lieder feste
metrische Gliederungen aufweisen, die von Anfang bis Ende gleich bleiben. Stattdessen sind proviso-
rische Taktstriche angegeben, um die Gliederungen anzudeuten. Der Einsatz der provisorischen Takt-
striche ist wichtig, um den gleichmäßigen bzw. ungleichmäßigen rhythmischen Verlauf zu kennzeich-
nen. Allerdings befinden sich diese Taktstriche in den Notenbeispielen nicht auf den Linien, sondern
in den Zwischenräumen zweier oder dreier Notenzeilen. Damit wird versucht, die europäisch verwur-
zelte Lesart von Taktstrichen abzuschwächen. Die Taktstriche zeigen nicht unbedingt betonte bzw.
unbetonte Stellen an. Sie bestimmen lediglich die Gliederungsart des Musikstückes in gleiche oder
ungleiche metrische Teile. Die quasi-Takte sind gesondert nummeriert. Doch auch bei diesen
Taktangaben muss von den europäisch verhafteten Zuordnungen von Akzenten abstrahiert werden.
Bindebögen gelten für die Verlängerung von Notenwerten. Nur in wenigen Beispielen, z.B. in freimet-
rischen Notationen, bezeichnen sie phraseologische Zusammenhänge (s. Lied Nr. 73, Anhang II).
In Zweifelsfällen war es notwendig, Phrasierungszeichen ( / )anzugeben, z.B. wenn Textzeilen nicht
durch eindeutige Pausen im Gesang getrennt erscheinen (s. z.B. Lied Nr. 12, Anhang II).
Die Partitur der Wechselgesänge zeigt von oben nach unten:
1. Vorsänger awrāg
2. ggf. die einsaitige Kastenspießlaute masinqo
3. der begleitende Gruppe täkäbayoč
4. die Trommel käbärõ, jeweils linke und rechte Hand getrennt (l.H. bzw. r.H.)
5. Klatschen und ggf. Triller
Über der Partitur erscheint jeweils die Angabe des aktuellen Abschnitts (vgl. ausführlich 3.1.). Der
Begriff Abschnitt bezeichnet zunächst die quantitative Gliederung des Gesangs. Er weist eine eigen-
ständige melodisch-rhythmische Syntax auf und ist insofern als "Lied im Lied" aufzufassen. Die
Nummerierung der Abschnitte erfolgt entsprechend der Reihenfolge und stellt keine Typisierung nach
Abschnittsmerkmalen dar. Ein Abschnitt kann aus einer oder mehreren Gesangszeilen bestehen, die
sich aus verschiedenen melodischen Formeln zusammensetzen, bezeichnet als a, b, c usw. bzw. bei
signifikanten Ähnlichkeiten oder direkten Ableitungen als a1, b1, b2 usw., und entsprechend der jewei-
ligen Wechselgesangsform zwischen awrāg und täkäbayoč aufgeteilt werden.
Textdarstellung
Die im laufenden Text vorkommenden Fremdausdrücke sind zumeist in Originalschrift, gesetzt in
Klammern {...} und in einer phonetischen Umschrift24 dargestellt. Übersetzungen sind, wenn sie nicht
schon im laufenden Text angegeben wurden, in kleinerer Schrift und in Anführungsstriche gesetzt.
Gesonderte Hervorhebungen sind am veränderten Schrifttyp zu erkennen.
Den Transkriptionen sind die Texte im Silben-Ton-Verhältnis unterlegt. Die Silbentrennungen unter
den Noten entsprechen den phonetischen Silben (s. Anhang II), doch stellen sie häufig einzeln stehen-
de Konsonanten oder Halbvokale dar, die aus Silbenkürzungen stammen, z.B.:
gesprochen: lägēšõ wäqätā manəmə säwu aləwätā
gesungen: lä-gē-šõ wä-qä-tā ma-nəm * sä-w * al-wä-tā
Sie sind absichtlich so geschrieben, um eben diese Kürzungen erkennen zu lassen. Die Texte in den
Notationen sind außerdem aus technischen Gründen durchgehend klein und in einer vereinfachten
Umschrift ohne Interpunktion geschrieben.
Die tabellarisch angegebenen Beispiele von Gesangstexten in der gesamten Arbeit (s. Band 1) sind
nach einem einheitlichen Muster dargestellt worden. Es sind jeweils die Bezeichnung der einzelnen
Gesangszeilen (1, 2, 3 usw.), die melodischen Formeln (a, b, c usw.), der Text in Originalschrift, die
Umschrift und anschließend die Übersetzung angegeben. Dabei ist die Übersetzung jeweils sinngemäß
mit Interpunktion vorgenommen worden. Nicht übersetzbare Textteile sind als Redundanz in dieser
Form: (Redundanz) gekennzeichnet. In diesem Fall ist auch die Umschrift kursiv gesetzt. Durch die
Umschrift sind sich reimende Silben leicht zu erkennen.
Alle Grafiken, Fotografien und Schemata sind durchgehend als Abbildungen nummeriert. Tabellari-
sche Textangaben sind mit der Quellenangabe des dazugehörigen Gesangs (s. Nummerierung in der
Repertoireliste) versehen. Die entsprechenden Archivsignaturen sind im Tonverzeichnis (s. Band
2/Anhang) nachzuschlagen. Einige wenige Notationen aus dem Gedächtnis sind im laufenden Text
namentlich ohne Nummerierung aufgeführt. Alle konkret erläuternden Gegenüberstellungen in Tabel-
lenform gelten als laufender Text.
24
Die phonetische Umschrift wurde von mir nach dem Vorbild der Schriftsilben im amarischen Alphabet vorgenommen.
Lange Vokale erhalten dabei zusätzlich einen quer liegenden Strich, z.B. ā, ē, ī, õ, ū. Außerdem gibt die tabellarische Übersicht zur Originalschrift gleichzeitig Hinweise zur Aussprache der Silben bzw. -verbindungen.
1.3. ZUM SYSTEM DER AMARISCHEN TONREIHEN
Das Wort qəñət (Mehrzahl: qəñətõč) stammt aus dem Verb mäqāñät {መቃኘት} mit der Bedeutung
stimmen [engl.: "tuning"]. Qəñət weist demnach auf eine nach festgelegten Regeln gestimmte Ton-
reihe hin. Das hiervon hergeleitete System stammt nicht aus oral tradierten Reflexionen, sondern
wurde erst nach 1968 von Musiklehrern der Yared Musikhochschule in Addīs Abäbā entworfen. Ziel
dieses Entwurfes war die Vereinfachung musikpädagogischer Methoden. Daher ist die darin darge-
stellte Systematik auch nicht sehr weit verbreitetet bzw. in vielen Landesteilen überhaupt nicht
bekannt (vgl. Teffera 1999).
Mit der Erforschung der qəñətõč haben sich Musikethnologen wie Kebede (1971 und 1977), Powne
(1968), Kimberlin (1976) und Bekele (1987) beschäftigt. Es bleiben dennoch sehr viele Fragen offen.
Die Herkunft der qəñətõč ist bis heute ungeklärt. Kimberlin (1976: 77f.) vermutet, dass sie etwas mit
der musikgeschichtlichen Entwicklung Äthiopiens zu tun hat. Kimberlin (1976: 77) erläutert, dass z.B.
die Tonreihe ančī hoyē länē {አንቺ ሆዬ ለኔ} bereits im 6. Jahrhundert existierte:
"Anci hoye is said to have been ascribed to David's harp by Yared (496-571 A.D.) who also set down
the rules of music as used in the Ethiopian Orthodox Church. Thus, anci hoye was known in the sixth
century and at that time was reputed to be from before Solomon".
Kimberlin erläutert (1976: 78) die Herkunft der Tonreihe təžətā {ትዝታ ቅኝት} wie folgt:
"Perhaps a bit more reasonable than the diffusion route for anci hoye is the diffusion route for təzətā.
Supposedly, Yared also wrote of təzətā but it appears that he was more vague about it than about anci
hoye. This and present day arguments that təzətā is younger than anci hoye lead one to the hypothesis
that təzətā qəñət arrived concurrently with Christianity".
Die weiteren zwei Tonreihen, bātī {ባቲ} und ambassäl {አመባሰል}, stammen laut Kimberlins Ver-
mutung (1976: 78) aus den Tonreihen təžətā und ančī hoyē länē.
"Təzəta and ancihoye are the basic interval sets with bati and ambasəl susequently formed from the
original. Bati and ambasəl became popular intervallic sets in Wallo, Shoa and Begemder. Because of
this popularity they were given names in the eighteenth or nineteenth century corresponding to the
towns in which they were first used".
Die qəñətõč werden als eine Gruppe von bestimmten Modi verstanden, die im gesamten Äthiopien
verwendet werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, da im eigentlichen Sinne die in den vier qəñətõč
vorhandenen Tonreihen nicht alle Musikkulturen Äthiopiens betreffen. Die Vielfalt der Musizierstile
dieser Gemeinschaften bietet uns unterschiedliche Tonreihen, die jeweils differenziert betrachtet wer-
den müssen.
Beispielsweise hat Bekele (1987: 24) in seiner Studie versucht, über 300 Gesänge aus ganz Äthiopien
zu sammeln und festzustellen, ob das System der Tonreihen in allen Gemeinschaften anwendbar ist.
Als Ergebnis jedoch stellte er fest, dass insgesamt sieben unterschiedliche Modi für die äthiopische
Musikkulturen existieren, die er als kädamai, {ቀዳሚ} dagmai {ዳግማይ}, salisai {ሳልሳይ}, rabai
{ራባይ}, hamisai {ሐሚሳይ}, sadisai {ሳዲሳይ} und sabai {ሳባይ} bezeichnet. Für den Begriff Modus
gibt er die amārische Bezeichnung səlt {ስልት} an. Es ist wahrscheinlich, dass diese Modi aus der
äthiopischen Kirchensprache gə'əž {ግዕዝ} stammen, jedoch der weltlichen Musik angehören. Dage-
gen ordnet Bekele der kirchlichen Musik drei Modi zu, die als gə'əž, əžəl {ዕዝል}, und ararāy25
{አራራይ} bezeichnet werden (s. Teffera 1994: 5; Kebede 1980: 20-34 und Shelemey 1989: 169).
Laut Bekele ergeben sich für die äthiopische Musik insgesamt zehn Modi. Abgesehen von den drei
25
S. ausführliche Definition der verschiedenen Gesangsstile im Glossar.
bekannten Modi, die in der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche verwendet werden, beschreibt Bekele in
seiner Arbeit (1990: 93f.) die sieben, der weltlichen Musik zugeordneten Modi, wie folgt:
a) kädamai Modus: unhemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: c-d-e-g-a; von vielen
äthiopischen Gemeinschaften verwendet
b) dagmai Modus: hemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: des-d-ges-as-a.
c) salisai Modus: hemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: es-g-a-b-d.
d) rabai Modus hemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: f-g-b-c-d; wird für verschiedene
moderne Lieder und Tgriña-Gesänge verwendet
e) hamisai Modus: hemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: as-a-des-es-e.
f) sadisai Modus: hemitonisch-pentatonisch; Intervallfolgen: a-b-h-e-f-ges; entspricht z.B.
einem oromõ-Gesangsstil {ኦሮሞ}, genannt gärärsõ {ገረርሶ}(s. Bekele 1987: 24)
g) sabai Modus: chromatischem Intervalle; Intervallfolgen: c-des-es-e-f-ges-a-b;
repräsentiert die Gesänge der adärē-Gesänge26 {አደሬ} (s. Bekele 1987: 24 und 1990:94).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine solche pauschal quantifizierende Studie unweigerlich zu
Fehlinterpretationen führen muss, denn eine jede Gemeinschaft verdient prinzipiell eine ausführliche
und gesonderte Forschung, um anschließend genaue Beschreibungen und Analysen anfertigen zu kön-
nen, die ein realistisches Bild ihrer musikalischen Kultur wiedergeben.
Zunächst ist das System der qəñətõč nur im Zusammenhang mit der Musikkultur der amārā zu ver-
stehen, obwohl andere Gemeinschaften Zentraläthiopiens ebenfalls Elemente dieses Systems in ihrer
Musikkultur verwenden. Jedoch ist dies noch nicht vollständig nachzuweisen. Aufgrund dessen sollte
eine zu frühe Verallgemeinerung vermieden werden, um Missverständnissen vorzubeugen.
Meine Studien27 in den amārā-Gebieten Goğām und Gondär ergaben, dass kaum ein Instrumenten-
spieler die Bezeichnung qəñət kennt bzw. sich der Tatsache, dass es verschiedene Tonreihen gibt,
nicht bewusst ist. Sie spielen die Lieder auf ihren Instrumenten und nutzen die verschiedenen Tonrei-
hen mit der typischen Intervallik. Sie abstrahieren aber konkrete Lieder und Melodien nicht in einer
theoretischen und diesen übergeordneten Tonalität.
Wird von qəñət gesprochen, so ist vorerst nur von der grundlegenden Anordnung der fünf Hauptton-
höhen die Rede. Diese reichen jedoch nicht aus, um das praktische Verständnis eines Modus zu be-
schreiben, denn auch wenn sich melodische Strukturen eindeutig innerhalb eines festgelegten Ok-
tavrahmens entfalten, sind doch spezielle Klangfolgen, melodische Mikrostrukturen bzw. formelhafte
Verbindungen zu berücksichtigen, die den jeweiligen Modus entscheidend mitbestimmen.
In den amārischen Hochzeitsgesängen, kommen die überwiegend im Zentralen Hochland Äthiopiens
gebräuchlichen Tonreihen zum Tragen. Alle traditionelle Gesänge, sowohl der amārā als auch anderer
in diesem Gebiet lebenden ethnischen Gruppen wie z.B. die təgrāy und die gurāgē, basieren auf diesen
Tonreihen. Sie umfassen fünf verschiedene Tonhöhen mit einer charakteristischen Intervallik inner-
halb einer gegebenen Oktave. Kimberlin (1976: 54) erklärt:
"Qenet could be defined, as a sett of intervallic relationship between pitches rather than a pitch set".
Es ist keine absolut festgelegte Ausgangstonhöhe erforderlich. Die qəñətõč sind zunächst durch ihre
typischen Intervallverhältnisse zu erkennen.
Der Tonumfang der Lieder ist größer als in der jeweiligen Tonreihe angegeben und überschreitet häu-
fig eine Oktave. Dennoch wird die modale Fixierung nur innerhalb einer Oktave gedacht. Überschrei-
tungen dieses Rahmens haben einerseits mit der melodischen Gestaltung und der Individualität der
Gesänge zu tun, können aber auch gesangs- oder instrumetaltechnische Ursachen haben. Zum Beispiel
26
Das hier angegebene Wort adare ist in der Dissertation als adärē ausgeschrieben. Damit ist die gleiche Stammesgruppe
gemeint, die heute auch als harärē bezeichnet wird. 27
Forschungsreise Äthiopien /1997/.
lassen sich beim kərār nicht immer alle Saiten in aufsteigender Folge stimmen, weil die Stimmwirbel
mäqañawõč {መቃኛዎች} (Plural zu mäqāñā) dies bei durchgehend gleicher Saitenstärke nicht zulas-
sen. Beim Spiel der einsaitigen masinqõ erlauben die Fingerpositionen nur das Spiel einer solchen
Tonreihe mit der leeren Saite als variable Ausgangstonhöhe. Sänger bzw. Sängerinnen gestalten die
Melodie eines Liedes entsprechend ihrem Stimmumfang. Der Lagenwechsel ist ihnen häufig des-
halb nicht bewusst, weil sie die typische Intervallik als Tonschrittfolgen und nicht in transponierbaren
Intervallen mit Umkehrungen und Spiegelungen wahrnehmen.
Aus der Gesamtheit des Musikrepertoires im Zentralen Hochland28 Äthiopiens lassen sich die
qəñətõč mit vier Haupttonreihen darstellen. Diese sind die Tonreihen təžətā, bātī, ančī hoyē länē und
ambassäl. Alle qəñətõč beziehen sich zugleich auf bekannte traditionelle Lieder gleichen Namens.
Das bedeutet, dass die typischen Tonreihen eines jeden qəñət aus der Melodik dieser Lieder schöpfen.
Das gesamte Repertoire an Liebes-, Unterhaltungs-, Arbeits-, Kriegs- und selbstverständlich auch
Hochzeitsliedern der amārā ist jeweils einer dieser Tonreihen zuzuordnen.
1.3.1. təžətā qəñət {ትዝታ ቅኝት}
a)
b)
Abb. 9
Im Folgenden ist die Tonhöhe c' als Beispiel gewählt wor-
den, um einen einheitlichen Ausgangston für alle nachfol-
genden qəñətõč zu benutzen.
Die təžətā qəñət existiert in zwei qəñət-Typen, die sich von-
einander unterscheiden. Der erste Typ lässt sich an der Inter-
vallfolge g2, g2, k3 und g2 und der zweite Typ an der Inter-
vallfolge g2, k2, g3 und k2 erkennen29 (Abb. 9).
In beiden qəñət-Beispielen ist c' der Ausgangston. Der Unterschied zum ersten Typ besteht darin,
dass hier die 3. und die 5. Stufe der Tonreihe jeweils um einen ½ Ton tiefer sind. Die Variante a) wird
in der traditionellen Musik häufig gebraucht, während die Variante b) höchstwahrscheinlich eine in
der Yared Musik Schule entwickelte Tonreihe ist. Sie wird mehr in Verbindung mit dem Lied təžətā
verwendet und erscheint selten im Zusammenhang mit den restlichen Gesängen aus der Tonreihe
təžətā. Mit anderen Worten ist die Variante b) eine vor kurzem entwickelte Version dieser Tonreihe.
Sie wird meistens von den ažmārīwõč verwendet. Beginnt der ažmārī seinen Gesang, so ist oft nicht
ganz eindeutig, in welcher der beiden Varianten er zu singen beabsichtigt. Erst im weiteren Gesangs-
ablauf entscheidet er sich dann endgültig. Die anfängliche Verwirrung kommt durch den alternativen
Gebrauch der 3. und 5. Tonstufe beider Varianten zum Ausdruck. Dies dauert jedoch nur kurze Zeit
und wird auch von den Zuhörern nicht als Fehler registriert. Im Übrigen wird die Variante b) auch in
den modernen Schlager- und Pop-Ensembles neben der Variante a) gleichermaßen verwendet.
Tonreihen wie təžətā in der ersten Variante findet man auch in vielen anderen Kulturen Afrikas. Hugh
Tracey (1958:17) hat in seinem Artikel ca. 30 Gemeinschaften aus dem Zentral- und Südafrikanischen
Bereich aufgelistet, die ganz oder teilweise pentatonische Tonreihen in ihrer Musik verwenden (man-
che dieser Gemeinschaften verwenden aber auch heptatonische Tonreihen). Diese sind u. a. die Alur,
Balendau, Chopi, Dhola und die Ganda. So stellt auch Kubik (1988: 274) fest, dass beispielsweise das
Tonsystem der Yoruba30:
28
Es ist in einem Land wie Äthiopien, wo eine Vielfalt von Kulturen herrscht, durchaus möglich, dass außerhalb des Zentra-
len Hochlandes völlig andere qəñət-Systeme verwendet werden. Daher beschränke ich mich nur auf den genannten Teil des Landes, um Missverständnisse zu vermeiden.
29
g = groß; k = klein, ü = übermäßig/2 = Sekunde, 3 = Terz, 4 = Quart, 5 = Quint...usw. 30
Laut Kubik betrifft diese Beschreibung die Yoruba, die im Raum des einstigen Òyo-Königreiches leben, zu dem die Be-wohner der Stadt Oshogo gehören.
"...eine Art Pentatonik zeigt, die durchaus ein altes sudanisches Erbe sein könnte, das sie mit einer
Reihe anderer Völker der Savannenzone Westafrikas gemeinsam hat. In dieser Pentatonik, als c-d-e-
g-a31 oder c-d-f-g-a notierbar, werden Ganztöne und kleine Terzen deutlich differenziert".
1.3.2. bātī qəñət {ባቲ ቅኝት}
a)
b)
Abb. 10
Die bātī-qəñət ist neben der təžətā-qəñət die meist verwendete
Tonreihe in den amārischen Gesängen. Bātī besitzt auch zwei
Tonreihen (Abb. 10). Die typischen Intervallfolgen sind g3, k2,
g2 und g3 in der ersten Variante. Die zweite Variante dagegen
zeigt die Intervallfolgen k3, g2, g2 und k3 mit der Besonderheit,
dass die zweite und fünfte Tonstufe in der angegebenen Rich-
tung ein wenig verändert sind.
Hier werden beide Varianten gleichermaßen im traditionellen Musikrepertoire verwendet. Die erste
Variante ist einfacher zu singen und auch mit Instrumenten zu spielen, während die zweite Variante
wegen der für diese Tonreihenvariante charakteristischen Intervalle, in Abb.10 mit Pfeilen gekenn-
zeichnet, genaues Intonieren um wenige Cent Unterschied erfordert.
In modernen Folklore-Ensembles, in denen europäische Musikinstrumente gespielt werden, ist es nicht
möglich, die Tonreihe dieser Variante in der hier gegebenen Intervallfolge wiederzugeben. Das bedeu-
tet, dass sich sowohl der Sänger als auch die Instrumentalisten und auch die Zuhörer allmählich an die
von den Instrumenten erzeugte fehlerhafte Tonreihe gewöhnen. Daher gibt es auch heutzutage immer
weniger Sänger, die diese Tonreihenvariante in ihrer Originalgestalt sauber intonieren.
Die letzten zwei Tonreihen die als ambassäl und ančī hoyē länē bezeichnet werden, sind fast mitei-
nander identisch:
1.3.3. ambassäl-qəñət {አመባሰል ቅኝት}
Abb. 11
Die Intervallfolgen sind k2, g3, g2 und k2. Die zweite und fünfte Tonstufe
sind um wenige Cent tiefer als dargestellt.
1.3.4. ančī hoyē länē-qəñət {አንቺ ሆዬ ለኔ ቅኝት}
Abb. 12
Die Intervallfolgen sind k2, g3, k2 und ü2. Hier sind die zweite und die
vierte Tonstufe verändert. Allerdings kann aus der übermäßigen Sekun-
de (zwischen 4. und 5. Ton), je nachdem von welchem Ton aus die je-
weilige qəñət-Tonreihe gebildet wird, eine kleine Terz entstehen. Zum
Beispiel entsteht aus dem Ausgangston des' die Tonreihe des'-e'-
ges'-a'-c'' mit den Intervallen k2 (des'-e'), g3 (e'-ges'), k2
(ges'-a') und k3 (a'-c''). Der einzige Unterschied zwischen den letzten zwei qəñətõč besteht in
der Intervallik zwischen der 4. und 5. Tonstufe. Bei ersterer handelt es sich um die Töne g' und as',
31
Vgl. təžətā-qəñət; Abbildung 9.
während es beim letzteren qəñət die Töne ges' und a' sind. D.h. bei der ambassäl-qəñət ist der 5.
Ton der qəñət-Tonreihe, der Ton a, tiefer, während bei dem ančī hoyē länē-qəñət der 4. Ton, der Ton
g, tiefer ist.
Die ančī hoyē länē-qəñət soll nach Powne (1968: 48) und Kebede (1971: 235) eigenartig klingen.
Im Bezug darauf schreibt Kebede (1971:235) folgendes:
"Type IV" (damit ist die ančī hoyē länē-qəñət gemeint) "has a tendency toward microtonality and
chromaticism. The Anci hoye kignit is probably the most complicated melodic-mode to hear, write or
play. It consists of intervalls made up of microtones which can not be indicated accurately with the
western notation system".
Die zwei Tonreihen ančī hoyē länē und ambassäl erwecken sowohl vom Hören als auch vom Spielen
her fast den gleichen Höreindruck für den unerfahrenen Hörer. Auch beim Stimmen von Instrumenten
ist es schwierig, diese komplizierten Tonabstände genau herzustellen. Es ist mit kleineren Abweichun-
gen zu rechnen.
Im Gegensatz zu den Tonreihen təžətā und bātī wird die Tonreihe ambassäl fast auschließlich von den
ažmārīwõč verwendet (s. Abschnitte 1.4.1.7.; 3.4.5. und 3.5.4.). Die Tonreihe ančī hoyē länē kommt
u.a. auch im Hochzeitsrepertoire relativ häufig vor, dies gilt aber nicht für das gesamte traditionelle
Musikrepertoire der amārā.
Wichtig ist die Feststellung, dass in der bislang erläuterten qəñət-Problematik absolute Tonhöhen kei-
ne Rolle spielen. Kebede (1971: 234) erklärt dazu:
"These four kignits consist of relativ pitches that adhere to the pentatonic types of basic melody-
patterns".
Außerdem kann es durchaus möglich sein, dass auch in der Intervallik kleinere und größere Abwei-
chungen in einem Gesang und/oder im Instrumentenspiel vorkommen, die sich im Rahmen einer ge-
wissen Toleranz bewegen und dennoch die jeweilige Tonreihe erkennbar lassen. Eine Abweichung
kann aber auch, wenn sie festgestellt werden sollte, im Laufe des Gesanges bzw. des Instrumental-
spiels korrigiert werden.
Es ist insgesamt nicht damit zu rechnen, dass durch Abweichungen, die einerseits vor allem mit dem
Instrumentenbau und andererseits mit dem Stimmen eines Instruments zusammenhängen, absolute
Veränderungen der intonatorischen Wahrnehmung auftreten können.
Beim Stimmen eines Instruments muss zuerst der Ausgangston, der zumeist auch ein zentraler Ton des
jeweiligen Stückes wird, fixiert werden, da alle nachfolgenden Töne sich nach diesem Ton richten.
Der Sänger, der sich auf einem Instrument begleitet, muss den Ausgangston zuerst passend zu seiner
Stimmlage festlegen. Dies geschieht z.B. beim Stimmen von Saiteninstrumenten durch Spannen und
Lockern der Saiten mit Hilfe von Stimmwirbeln oder Knebeln, an denen die Saiten befestigt sind.
Im Gegensatz zu Saiteninstrumenten, besitzen Blasinstrumente wie beispielsweise die Flöte wašənt
{ዋሽንት} schon bei ihrer Herstellung festgelegte Tonhöhen, die dann nur durch bestimmte Grifftech-
niken erweitert werden können. Hinsichtlich der Bestimmung von Stimmlagen kann man unterschied-
lich große wašəntõč (Pl. zu wašənt) benutzen (Teffera 1994: 35).
Ein anderer Weg, Instrumente zu stimmen, ist das Sich-vorstellen von Melodien, die zu-
nächst im Stillen gedacht werden (siehe auch Nketia 1974: 147). Ist die gewünschte Tonreihe nicht
ganz korrekt, so werden die Melodien bzw. Teile davon parallel dazu laut gesummt. Der erfahrene
Instrumentenspieler stimmt im Vergleich zu einem Laien auf diese Weise wesentlich schneller.
Es muss auch deutlich gemacht werden, dass der erfahrene Zuhörer mögliche Abweichungen nicht
bewusst wahrnimmt; d.h. einige für die wissenschaftliche Betrachtung als Abweichung analysierte
Tonhöhen werden praktisch selten erkannt. Es sei denn, der Gesang ist völlig falsch, entspricht also
nicht den Hörerwartungen und erscheint im melodischen und rhythmischen Verlauf völlig fremd.
Sowohl in der Musikkultur der amārā als auch in denen anderer Gemeinschaften Äthiopiens können
deswegen auch Tonhöhen nicht immer genau definiert werden. Um die möglichen Abweichungen
feststellen zu können, muss, wie beispielsweise Gottlieb (1986: 58) es beschreibt, folgendes beachtet
werden:
"....in order to determine the principles which relate to scales one must obtain measurements of the
melodic intervals from as many performances as possible. With this information one can then deter-
mine the average measurements which apply to these performances and thereby arrive at some mean-
ingful conclusions regarding to intended norms".
Die in den Beispielen angegebenen Tonreihen verlaufen aufsteigend. Die Oktavwiederholungen der
Ausgangstöne bzw. Grundtöne sind nicht notiert worden, da sie für die Erläuterung der Tonreihen
nicht unbedingt relevant sind.
Bei einer Untersuchung von Instrumentenstimmungen kommt die bislang typische aufsteigende Ton-
reihe unter Umständen nicht immer so vor. Aufgrund dessen wird auch der Tonumfang über die Okta-
ve hinaus vergrößert. Dies geschieht beim Stimmen der Leier kərār {ክራረ} und der Kastenleier
bägänā {በገና}, deren Saiten unterschiedliche Spannungen durch die Stimmwirbel zulassen. Anhand
der kərār wird dies wie folgt erklärt:
Zu den kərār-Saiten gehört ein Nummernsystem, das gewöhnlich einer qəñət-Tonreihe eine aufstei-
gende Sequenz ermöglicht. Jedoch kann es vorkommen, dass die eine oder andere kərār-Saite sich
nach einer zu festen Drehung der Stimmwirbel nicht spannen lässt, so dass der/die gewünschte/-n
Tonhöhe/n jeweils eine Oktave tiefer gestimmt werden müssen. Die folgenden Beispiele sind näher zu
betrachten:
Abb. 13
qəñət -Tonreihe Reihenfolge Tonumfang
a) c'-d'-e'-g'-a'- (c'') typische c'-c" Oktave
b) c'-d'-E-g'-A-(c'') veränderte E-c" Oktave + Sexte
c) c'-D-e'-G-a'-(c'') veränderte D-c" Oktave + Septime
a) b) c)
Die Zeile a) ist die Tonreihe in einer normalen Aufwärtsbewegung. Zeilen b) und c) zeigen dagegen
nicht die gewöhnliche Sequenz der Tonreihe. Der Tonumfang ist in diesen Zeilen größer als 1 Oktave.
Auch wenn die Tonreihe sich in einer auf- bzw. absteigende Richtung bewegt, ist es empfehlenswert,
stets an die einfach aufsteigende Sequenz der Tonreihen, wie in der Zeile a) angegeben, zu denken, die
innerhalb einer Oktave liegt.
Das Erlernen eines Instruments mit Hilfe des Finger- bzw. Saitenzahlsystems ermöglicht demjenigen,
der sich zum ersten Mal mit der qəñət-Problematik befasst, die Tonreihen und Toneigenschaften dieser
Tonreihen und somit auch die dazu gehörigen Melodien und Gesänge besser kennen zu lernen.
Dennoch hilft dieses Nummernsystem alleine nicht, das jeweilige Instrument und in Verbindung damit
die Tonreihen der Lieder und deren charakteristischen Merkmale zu beherrschen. Das Erlernen mit
Hilfe der Aneinanderreihung von Zahlen ist, im Gegensatz zu einem unerfahrenen Menschen, für den
erfahrenen Zuhörer bedeutend einfacher, da er die traditionellen Lieder bereits kennt und von Kindheit
an mit ihnen vertraut ist. Diese Grundlage erleichtert den Lernprozess und den Umgang mit dem je-
weiligen Instrument.
Für den Außenstehenden dagegen ist es empfehlenswert, so viele Lieder wie möglich zu hören, ein
Instrument zu spielen und es auch bewusst nach den Regeln der Tonreihen zu stimmen. Abbildung 14
zeigt die Fingernummern der kərār, wodurch das Erlernen der Tonreihe beschleunigt werden kann:
Abb. 14
aufsteigende Bewegungen absteigende Bewegungen
1 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5
2 55 + 11 + 22 + 33 + 44 + 66 66 + 44 + 33 + 22 + 11 + 55
3 512 + 123 + 234 + 346 643 + 432 + 321 + 215....usw.
Diese Fingernummern entsprechen auch den kərār-Saiten. Ausgehend vom Daumen, der für die ersten
zwei Saiten (von links nach rechts) eingesetzt wird, geht es der Reihe nach mit dem Zeige- (3. Saite),
dem Mittel- (4. Saite), dem Ring- (5. Saite) und dem kleinen Finger (6. Saite) weiter. Die Position der
Finger ist in allen Tonreihen gleich. Die zuvor angegebenen Saitenzahlen entsprechen beispielsweise
in der təžətā-qəñət mit dem Ton c' als Ausgangston den folgenden Noten:
Abb. 15
Übung 1:
təžətā qəñət aufsteigende Bewe-
gung
absteigende Bewe-
gung
Übung 2:
aufsteigend
absteigend
Übung 3:
aufsteigend absteigend
Auf diese Weise können die Tonstufen, die die qəñətõč aufbauen, Schritt für Schritt erlernt werden.
Nach einer gewissen Übungszeit können Melodien verschiedener Lieder erlernt werden32.
32
Im Zahlensystem des masinqõ-Spiels wird der Grundton, also die leere Saite, mit der Zahl 0 angegeben, während beim
der Grundton mit der Zahl 5 angegeben wird. Beim wašənt-Spiel werden wiederum die Grifflöcher (meistens 4) mit
einem anderen Zahlensystem verwendet.
1.4. TRADITIONELLE GESÄNGE DER AMĀRĀ
In Äthiopien werden alle sozialen, ökonomischen, politischen, und religiösen Geschehnisse des All-
tags von Musik begleitet. Zenebe (1987: 19-20) schreibt hierzu folgendes:
"In Ethiopia, birth, weddings and death are accompanied by songs. These types of songs are put into
what we call social categories. While things like fishing, wood cutting, coffee grinding etc. which are
based on various kinds of professional work are put into the economic section. Songs such as national
anthems, military and children's songs belong to the political section. Songs such as Woreb33, Kidas-
se34 ecclesiastical manifestations, Yezar Chuhet35 are put in the religious category. In other words it
is defined as music and recreation, music and work, music and politics, music and spiritual belief".
Bei den amārā existieren verschiedenartige Musizierformen, die mit dem sozialen Alltag eng ver-
knüpft sind. Aus der Gesamtheit dieser Musizierformen sind grundsätzlich drei Bereiche zu unter-
scheiden. Diese sind:
- Gesänge, die im Wechsel zwischen einem awrāğ {አውራጅ}, dem Vorsänger, und täqäbayõč
{ተቀባዮች}, dem begleitenden Chor, ausgeführt werden, und die zu der Gruppe der Gemein-
schafts-gesänge zählen
- Gesänge, die durch Gesangsgruppen; d.h. traditionelle Musikgruppen, vor einem Publikum
aufgeführt werden36 und
- solistische Gesänge37.
Im Gegensatz zu Sologesängen sind Gemeinschaftsgesänge mit ihren unterschiedlichen Gesangsfor-
men (Zeilen-, Ruf-, Refrain- und Strophenwechselgesang) stark vertreten. Hierzu gehören stets der
awrāğ, der den Gesang leitet, und die täqäbayõč, die die Begleitung übernehmen. Die Begleitung ei-
nes solchen Gesanges kann außer der gesanglichen Unterstützung auch Klatschen, Trillern38 und Tan-
zen beinhalten.
Neben den unmittelbar am Gesang beteiligten täqäbayõč gibt es auch die Zuschauer, die tämälkačõč
{ተመልካቾች}, die die Aufführung entweder ohne eine aktive Teilnahme verfolgen, oder solche, die
den Gesang so interessant und verlockend finden, dass sie sich daran beteiligen. Dies ist auch eine
charakteristische Erscheinung vieler afrikanischer Musikkulturen wie Nketia (1975a: 32) es be-
schreibt:
"Some may come out of curiosity or merely because they are attracted by the sound of music, others
attend because they like the musical genre performed by the group. There are always some who attend
for ethnic or social reasons - to grace the occassion or give support to the performers because they
are relatives, neighbours, or members of the community, or because they are guests or patrons of the
performing group. Others may attend because they are leaders of the community or ritual experts who
have a function to perform".
Neben den Wechselgesängen gibt es auch Sologesänge, zu denen u.a. die ažmārī-Gesänge gehören39.
Darüberhinaus gibt es geschlechts- und altersspezifische Gesänge. Ersteres bezieht sich u.a. auf Män-
ner- oder Frauenlieder, während mit der zweiten Kategorie z.B. Kinderlieder gemeint sind.
33
Woreb oder wäräb ist ein instrumental begleiteter sakraler Tanz. 34
Qədasse bedeutet Messe. 35
Siehe ausführliche Information über das Thema žār im Abschnitt 1.4.1.12. 36
Vgl. auch Zinke 1992: 301. 37
Diese sind z.B. religiöse Preisgesänge begleitet von der Kastenleier bägänā (siehe auch Abschnitt 1.4.2.3). 38
Das Trillern ist mit wenigen Ausnahmen Aufgabe der Frauen. 39
Die Besonderheit einer ažmārī-Aufführung liegt jedoch darin, dass das Publikum Liedtexte vorsagen darf, die unmittelbar danach von dem ažmārī gesungen werden (siehe auch Abschnitt 1.4.1.7. sowie 3.5.4.).
Im Gegensatz zu Aufführungspraktiken, sind bei den Musikveranstaltungen, die von Musikgruppen
ausgführt werden, meistens nur die Mitglieder dieser Gruppe aktiv (Nketia 1975a: 41). Deshalb wer-
den hier Darsteller und Zuschauer stark differenziert. In den am häufigsten gebräuchlichen Auffüh-
rungsarten, wo sich die tämäləkačõč auch nach dem Grad des Angeregtseins unmittelbar an den Ge-
sängen beteiligen können, beschränkt sich deren Beteiligung entweder z.B. aufs Tanzen und/oder
Klatschen oder sie verfolgen und bewundern die Aufführung nur aus der Ferne.
1.4.1. Teil 1: Weltliche Gemeinschafts- und Sologesänge
Das Wort žäfän {ዘፈን} wird im Allgemeinen als Zeichen der Freude verstanden (Hiob 21: 11-12; Mt
14: 6; 11: 17; Jer 31: 4; 2.Sam 6: 14 u.a.). Kebede (1971: 60) definiert es auch als einen Oberbegriff für
alle Musizierformen, die mit Freude und Lust verbunden sind und die entweder solistisch oder im
Wechsel vorgetragen werden können. Literarisch bedeutet es Lied bzw. Gesang und stammt aus dem
Verb singen, mäžfän {መዝፈን}. In der Praxis werden folgende žäfänõč (Plural zu žäfän) unterschie-
den:
Gesänge zum Neujahrsfest እንቁጣጣሸ ənqutatāš
Gesänge zur Feier der Auffindung des wahren Kreuzes መስቀል mäsqäl
Gesänge zum Dreikönigsfest ጥምቀት təmqät
Gesänge zum religiösen Fest būhē ቡሄ būhē
Heldengesänge/Kriegsgesänge የሽለላ ዘፈኖች yäšəläla žäfänõč
sanfter Sologesang እንጉርጉሮ əngurgūrõ
Gesänge der ažmārī የአዝማሪ ዘፈኖች yä'ažmārī žäfänõč
Gesänge der lalibälā የላሊበላ ዘፈኖች yälalibälā žäfänõč
Hirtenlieder የእረኛ ዘፈኖች yä'əräñā žäfänõč
Wiegenlieder የማባበያ ዘፈኖች yämababäyā žäfänõč
Klagelieder የለቅሶ ዘፈኖች yäläqsõ žäfänõč
Besessenheitsgesänge የዛር ዘፈኖች yäžār žäfänõč
Arbeitslieder የስራ ዘፈኖች yäsərā žäfänõč
Kinderlieder የልጆች ዘፈኖች yäləğoč žäfänõč
politische Lieder የፓለቲካ ዘፈኖች yäpolätikā žäfänõč
Hochzeitsgesänge የሰርግ ዘፈኖች yäsärg-žäfänõč
1.4.1.1. Neujahrsgesänge
ənqutatāš ist das äthiopische Neujahrsfest, das jährlich am 11. September, dem 1. Monat des äthiopi-
schen Kalenders, stattfindet. An diesem Tag singen Mädchen im Alter von ca. 10-15 Jahren Neujahrs-
lieder, deren Texte Glückwünsche für das bevorstehende Jahr zum Inhalt haben. Dafür gehen sie in
Gruppen von Haus zu Haus (vgl. Kebede 1971: 72).
Die Gesänge werden entweder mit oder ohne die Trommel käbärõ {ከበሮ} ausgeführt. Eines der Mäd-
chen, das sich mit dem Trommelschlagen auskennt, übernimmt die Aufgabe der rhythmischen Beglei-
tung durch die Trommel.
Die Lieder werden in Form von Wechselgesängen aufgeführt, wobei die Rollenverteilung in der
Gruppe zumeist im Voraus untereinander abgesprochen wird. Einer der typischen Neujahrsgesänge ist
das Lied abäbayē hõy {አበባዬ ሆይ}, "Du meine Blume", das aus vier Abschnitten und unterschiedli-
chen Wechselgesangformen besteht und einen epischen Text zum Inhalt hat (die hier verwendete Dar-
stellung40 wird für alle folgenden Beispiele beibehalten):
Text zu Nr. 80 abäbaye hõy
Gz. mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt41
1 a A ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Ho! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
2 a T ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Hõ! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
3 a A ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Hõ! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
4 a T ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Hõ! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
5 b A እማማ አሉ ብለን əmāmā alū bəlän Wir hoffen əmāmā42 ist da.
6 a T ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Hõ! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
7 b A አባባ አሉ ብለን abābā alū bəlän Wir hoffen ababā43 ist da.
8 a T ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን
hõ! bəlän mätān
hõ! bəlän
Hõ! sagten wir und kamen,
hõ! sagten wir.
2. Abschnitt 9 c A አበባዬ ሆይ abäbayē hõy Du meine Blume!
d T ለምለም lämläm Blüte,
10 c1 A አበባዬ ሆይ abäbayē hõy du meine Blume!
d T ለምለም lämläm Blüte,
11 c A ባልንጀሮቼ balənğärõčē meine Freundinnen,
d T ለምለም lämläm Blüte,
12 c1 A ቁሙ በተራ qumū bätärā Steht in einer Reihe,
d T ለምለም lämläm Blüte,
13 c A እንጨት ሰብሬ ənçät säbərē bis ich Holz breche,
d T ለምለም lämläm Blüte,
14 c1 A ቤት እስክሰራ bät əskəsärā und ein Haus baue.
d T ለምለም lämläm Blüte,
15 c A እንክዋን ቤትና ənkwān bätənā Geschweige ein Haus,
d T ለምለም lämläm Blüte,
16 c1 A የለኝም አጥር yäläñəm atər ich habe nicht mal einen Zaun.
d T ለምለም lämläm Blüte,
17 c A እደጅ አድራለሁ ədäğ adralähu ich übernachte im Freien,
d T ለምለም lämläm Blüte,
18 c1 A ኮከብ ስቆጥር kokõb səqõtər und zähle die Sterne.
d T ለምለም lämläm Blüte,
19 c A ኮከብ ቆጥሬ kokõb qotərē nach dem ich die Sterne zähle,
d T ለምለም lämläm Blüte,
20 c1 A ስገባ ቤቴ səgäbā bētē und zu Hause ankomme,
d T ለምለም lämläm Blüte,
21 c A ትቆጣኛለች təqõtañaläč schimpft mich,
d T ለምለም lämläm Blüte,
22 c1 A እንጀራ እናቴ ənğära ənatē meine Stiefmutter aus.
40
In der Übersicht entspricht Gz. = Gesangszeile, d.h. der elementare melodische Zusammenhang; mF = dische Formel, d.h.
kleinste melodische Sinneinheit innerhalb der Gz.; A/T = awrāğ/täqäbayõč., d.h. die alternative Besetzung durch Vorsän-
ger und Begleiter. Die Umschrift gibt formativ die Zusammenhänge der jeweiligen Textzeilen an, wobei der Abschluß ei-
ner solchen stets rechtsbündig erscheint. 41
Siehe ausführliche Beschreibung im Abschnitt 3.1. 42
Amārische Bezeichnung für Mama. 43
Amārische Bezeichnung für Papa.
d T ለምለም lämläm Blüte!
3. Abschnitt 23 e A አደይ የብር ሙዳይ adäyə yäbər mudayə adäyə silberner Korb,
ኮለል በይ koläl bäyə rolle auf!
24 e T አደይ የብር ሙዳይ adäyə yäbər mudayə adäyə silberner Korb,
ኮለል በይ koläl bäyə rolle auf!
Der erste Abschnitt ist eine Einführung, die aus einem Zeilen- und einem Rufwechselgesang besteht.
In den ersten Gesangszeilen singt die awrāğ44 eine ganze Verszeile vor, die danach von den
täqäbayõč in gleicher Weise wiederholt werden muss. Diese Zeilen werden gewöhnlich zweimal wie-
derholt (s. Takte 1-21 der Notation Nr. 80). Danach folgen weitere Gesangszeilen bestehend aus neu-
en Text- und Melodiezeilen (s. Takte 21-24 und 29-31). Die täqäbayõč dagegen wiederholen stets die
Gesangszeile, die sie am Anfang gesungen haben (s. Takte 6-11, 24-29 und 32-37), bis zum Beginn
des zweiten Abschnitts im Takt 37.
Der zweite Abschnitt besteht textinhaltlich und melodisch betrachtet aus zwei Teilen. Die awrāğ be-
endet die erste Hälfte der Gesangszeile auf dem Ton des45 (s. Takte 37-39), dem zweiten Ton der
qəñət-ambassäl. Danach schließen die täqäbayõč, den von der Vorsängerin eröffneten Teil mit dem
Ausgangston c' (s. Takte 39-41) ab. In der nachfolgenden Gesangszeile endet die awrāğ dann auf
dem Ausgangston c' (s. Takte 41-43), bevor die Zeile von den Begleiterinnen gesanglich nochmals
bestätigt wird und zwar mit dem Wort lämläm {}(s. Takte 43-45).
Im dritten Gesangsabschnitt beginnt eine neue Melodie in Form eines Zeilenwechselgesanges. Die
Gesangszeilen dieses Abschnittes werden in der Regel bis zu dreimal wiederholt (s. Takte 93-105).
Die Mädchen werden für ihre Gesänge in jedem Haus mit Geschenken (u.a. Essen, Getränke, Beklei-
dung oder Geld; vgl. Kebede 1971: 89) belohnt. Nach Erhalt ihrer Geschenke bedanken sie sich mit
einem einstimmigen Gemeinschaftsgesang, der im vierten Abschnitt dargestellt worden ist (s. Takte
106-125) und dessen Text folgendes beinhaltet:
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
4. Abschnitt
25 a A/T ከብረው ይቆዩኝ ከብረው
käbräwu yəqõyūñ käbräwū Mögen Sie bald reich werden46,
26 a A/T በዓመት ወንድ ልጅ ወልደው
be'amät wändə ləğ wäldäwū mögen Sie nächstes Jahr einen Sohn
gebären,
27 a A/T ሰላሳ ጥጆች አስረው sälasā təğõč asəräwū mögen Sie 30 Kälber in ihrem Stall zu
stehen haben,
28 a1 A/T ከብረው ይቆዩኝ ከብረው käbräwu yəqõyūñ käbräwū mögen Sie bald reich werden!
Somit ist der vierte Abschnitt im Gegensatz zu den bisherigen Gesangsabschnitten, an eine konkrete
Handlung gebunden und er fungiert als Dankeschön auf das/die Geschenk/e. Dazu wünschen die Mäd-
chen der schenkenden Familie viel Reichtum, Liebe und Kindersegen für das bevorstehende Jahr.
Auf diese Weise singen die Mädchen bis zum späten Nachmittag bzw. bis zum Einbruch der Dunkel-
heit. Am Ende verteilen sie die gesammelten Geschenke untereinander und gehen nach Hause.
1.4.1.2. Gesänge zur Feier der Auffindung des wahren Kreuzes
44
In diesem Gesang fungiert ein Mädchen bzw. eine Frau als awrāğ. 45
Der Ton c' ist hier als Ausgangston verwendet worden. 46
Das nächste Mal bedeutet "nächstes Jahr". Mit "reich werden" ist die schenkende Familie gemeint.
Die mäsqäl-Feier {መስቀል} wird seit der Einführung des Christentums in Äthiopien im 4. Jahrhun-
dert u. Z. jährlich einmal und zwar 16 Tage nach dem Neujahrsfest am 27. September, dem ersten
Monat des äthiopischen Kalenders, von der christlich-orthodoxen Bevölkerung gefeiert.
Die Bezeichnung mäsqäl bezieht sich auf die Entdeckung des wahren Kreuzes, an dem Jesus Christus
kruzifiziert wurde (Kebede 1971: 72). In den Erzählungen der äthiopischen Geschichte geht man da-
von aus, dass etwa zu Beginn unseres Jahrhunderts eine Gruppe von Menschen den Rauch eines Feu-
ers entdeckten und ihm soweit folgten, bis sie auf einem Hügel ankamen, wo sie ein Kreuz fanden
(Ayen, Engida, Alene 1988: 38). Seitdem findet als Andenken der Auffindung dieses Kreuzes das Fest
statt (Haile 1996). Inwieweit jedoch diese Erzählungen stimmen, ist unklar, da keine schriftlichen
Quellen zur Verfügung stehen.
Das mäsqäl-Fest ist mit der schönsten Jahreszeit verbunden, wo die sogenannten adäy-abäba47 {አደይ አበባ} nach der zwei bis drei monatigen Regenzeit zwischen August und Oktober, zu blühen beginnen
und überall die grüne Landschaft zu bewundern ist (vgl. Ayen, Engida, Alene 1988: 33f.).
Zum mäsqäl gehört das Feuerfest dämärā{ደመራ}48, das am Vorabend, dem 26. September, gefeiert
wird. An diesem Tag werden an öffentlichen bzw. zentral gelegenen Orten49 große Feuerstellen aus
Holzbalken errichtet, die in Form von Pyramiden aufgebaut werden (Kebede 1971: 72).
Die Feier beginnt am Abend um ca. 18°° Uhr. Das Feuer wird entweder von einem Kirchenoberhaupt,
z.B. dem äthiopischen Patriarch50, oder vom Bürgermeister der Stadt angezündet. Kebede (1971: 72)
erläutert dieses Fest angesichts der religiösen Bedeutung:
"The pyramid of poles is ...set on fire at dusk symbolizing the search for, and the finding of the Cross
on which Christ was crucified".
Tausende von Feiernden versammeln sich um die Feuerstelle herum und singen verschiedene Lieder.
Ein typisches, zu diesem Fest passendes Lied ist das folgende əyõha abäbayē {እዮሃ አበባዬ}:
Text zu Nr. 81 und 82: əyõhā abäbayē
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A እዮሃ አበባዬ əyõhā abäbayē Das Licht der Blume ist enthüllt,
b T መሰከረም ጠባዬ mäskäräm täbayē der Januar dämmert51.
2 a1 A እዮሃ አበባዬ əyõhā abäbayē Das Licht der Blume ist enthüllt,
b1 T መሰከረም ጠባዬ mäskäräm täbayē der Januar dämmert.
3 a A መሰከረም ሲጠባ mäskäräm sitäbā Wenn der Januar dämmert,
b T ወደ አገሬ ልግባ wädä agäre ləgbā gehe ich zu meinem Geburtsort.
4 a1 A መሰከረም ሲጠባ mäskäräm sitäbā Wenn der Januar dämmert,
b1 T ወደ አገሬ ልግባ wädä agäre ləgbā gehe ich zu meinem Geburtsort.
Dieses in Form eines Rufwechselgesanges gestaltete Lied wird im ančī hõyē länē-qəñət dargestellt
und es kann entweder fest- oder freimetrisch vorgetragen werden. Die festmetrisierte Variante setzt
47
Adäy abäbā sind gelbe Blumen, die um diese Jahreszeit blühen. 48
Die Bedeutung des Wort dämärā ist unbekannt. Es ist jedoch mit dem an diesem Tag brennenden Feuer und mit der ge-samten Handlung diesbezüglich verbunden.
49
In der Hauptstadt Addīs Abäbā gibt es den sogenannten mäsqäl-adäbabay "Platz des Kreuzes", der für diesen und andere
Feste sowie Paraden und Demonstrationen zur Verfügung steht. Es ist ein großer Platz, auf dem sich mehrere tausend Menschen versammeln können.
50
Der äthiopische Partriarch hat seinen Sitz in der Hauptstadt Addīs Abäbā. Als Ehrengast zündet er gewöhnlich das Feuer
an. Wenn er nicht anwesend ist, so übernimmt entweder ein Hohepriester oder der Bürgermeister der Stadt die Aufgabe.
Die gesamte Beschreibung bezieht sich auf Beobachtungen eines mäsqäl-Festes in der äthiopischen Hauptstadt, Addīs Ab-äbā, September 1993.
51
Mit dem Monat Januar ist das neue Jahr gemeint. Demnach bedeutet es Das neue Jahr dämmert (siehe Kebede
1971: 72).
sich aus geregelten Zweiergruppen und kurzen Melodiezeilen zusammen (s. Notation Nr. 81). Die
freimetrische Variante dagegen weist einen völlig anderen Melodieverlauf und andere Tondauern auf.
In diesem Fall sind nicht die rhythmischen Werte der einzelnen Töne, sondern lediglich die Tonhöhen
und die allgemeine Melodiebewegung in Betracht zu nehmen (s. Notation Nr. 82).
Am nächsten Morgen, dem eigentlichen Feiertag, malt jeder Gläubige mit der Asche der am Vorabend
ausgebrannten Holzpyramide ein Kreuz auf seine Stirn.
1.4.1.3. Gesänge zum Dreikönigsfest
Təmqät {ጥምቀት} ist ebenfalls ein religiöser Feiertag, der sich auf das Dreikönigsfest bezieht und
vom 18.-20. Januar, dem fünften Monat des äthiopischen Kalenders, stattfindet. Der wichtigste Feier-
tag ist allerdings der 19. Januar.
Die Feierlichkeiten beginnen am 18. Januar, wo in jedem Ort des Landes Priester aus verschiedenen
Kirchen ihre Bundesladen, genannt tabotõč {ታቦቶች; Plural zu tabõt}, an einen hierfür bestimmten
Ort mitbringen. In Addīs Abäbā steht insbesondere der sogenannte ğān mēdā52 {ጃን ሜዳ}, eine große
Wiesenfläche, für diesen Anlaß zur Verfügung. Es ist wichtig, dass die Bundesladen in der Nähe eines
Flußes oder eines Pools versammelt werden, da zu diesem Fest Wasser gesegnet werden muss, das am
folgenden Tag als Weihwasser auf alle Gläubigen gespritzt wird. Priester versammeln sich um die
Wasserquelle herum, halten eine Nachtmesse, genannt yälälīt qədassē {የሌሊት ቅዳሴ}, beten und
singen die ganze Nacht hindurch.
Am nächsten Morgen wird eine Morgenmesse, genannt yätäwāt qədassē {የጠዋት ቅዳሴ} gehalten.
Danach erfolgen weitere religiöse Gesänge um die Bundesladen herum, während gleichzeitig in einer
bestimmten Entfernung weltliche Gesänge und Tänze gruppenweise ausgeführt werden.
Der dritte und letzte Feiertag ist der 20. Januar. An diesem Tag werden die Bundesladen an ihre Ur-
sprungsorte zurückgebracht und zwar genauso begleitet von einer singenden und tanzenden Men-
schenmasse. Damit endet das təmqät-Fest.
1.4.1.4. Religiöses Fest - būhē
Būhē {ቡሄ} gehört zu den religiösen Festen, dessen Herkunft und Bedeutung unbekannt ist. Es findet
jährlich im Monat Juli, dem 11. Monat im äthiopischen Kalender, statt. Im Gegensatz zu den Mäd-
chengesängen zum Neujahrsfest, singen an diesem Tag junge Knaben zwischen 14-17 Jahren und
erwachsene Männer ab ca. 20 Jahren jeweils in getrennten Altersgruppen. Genauso wie die Mädchen-
gruppen gehen sie von Haus zu Haus und singen53 den funktional an diesen Feiertag gebundenen
Wechselgesang hõyā-hõyē {ሆያ ሆዬ}.
Die Besonderheit des hõyā-hõyē-Gesanges besteht darin, dass jedes Mitglied der Gruppe beim Singen
ein ca. 1m langes Stück Holz als Begleitinstrument in der Hand hält, womit beim Singen der Boden
gestampft wird. Durch das Stampfen des Bodens, das stets auf der schweren Zählzeit erfolgt, wird die
metrische Struktur des Gesanges deutlich zum Ausdruck gebracht.
Das metrische Muster des Liedes weist eine geregelte Zweiergruppe im Text und in der Melodie auf:
52
Ğān mēdā bzw. yäğānhoy mēdā. Dieser für größere Volks- und Sportveranstaltungen vorbereitete, mit Mauern umzäunte
Platz wurde nach dem ehemaligen äthiopischen Kaiser Haile Silasse genannt. Ğānhõy war die volkstümliche Bezeichnung für Haile Silasse, mēdā bedeutet Wiese.
53
Tagsüber sind die jungen Knaben im Einsatz, während nach der Abenddämmerung die Erwachsenen diese Aufgabe über-nehmen.
Text zu Nr.78: hõyā hõyē
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አሲዮ ቤሌማ asiyõ bēlēmā (Redundanz)
b T ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
c A አሃይ በል ahāy bälə Sag ahay - (Redundanz),
2 a A የቤሌማ ጥጃ yäbēlēmā təğā belemas Kalb,
b T ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
c A አሃይ በል ahāy bälə Sag ahay - (Redundanz),
3 a A አብረን እንንጫጫ abrän ənənəçāçā lasst uns gemeinsam toben!
b T ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
c A አሃይ በል ahāy bälə Sag ahay - (Redundanz),
2. Abschnitt
4 d A ክፈት በለው በሩን kəfät bäläwu bärunə Sag ihm, er soll das Tor aufmachen,
e A የጌታዬን yägetāyenə die meines Herren.
5 d T ክፈት በለው በሩን kəfät bäläw bärunə Sag ihm, er soll das Tor aufmachen,
e T የጌታዬን yägētāyenə die meines Herren.
6 d A ክፈት በለው ተነሳ kəfät bäläwu tänäsā Sag ihm, steh auf!
e A ያንን አንበሳ yanən anəbässā dem Löwen.
7 d T ክፈት በለው ተነሳ kəfät bäläwu tänäsā Sag ihm, steh auf!
e T ያንን አንበሳ yanən anəbässā dem Löwen.
3. Abschnitt
8 f A ሆያ ሆዬ hõyā hõyē (Redundanz)
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A ሆያ ሆዬ hõyā hõyē (Redundanz)
g T ሆ hõ! (Redundanz)
9 f A አዚያ ማዶ əžia mādõ Dort drüben
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A ጭስ ይጨሳል çəs yəçäsāl qualmt es.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
10 f1 A አጋፋሪ agafārī Ein Diener
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A ይደግሳል yədägəsāl feiert ein Fest.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
11 f A ያቺን ድግስ yačin dəgəs Auf diesem Fest
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A ውጬ ውጬ wəçe wəçe aß und aß ich.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
12 f1 A በድንክ አልጋ bädənk algā Auf ein kleines Bett
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A ተገልብጬ tägälbəçe begab ich mich.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
13 f A ድንክ አልጋዋ dənk algāwā Das kleine Bett
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A አመለኛ amäläñā war ungemütlich.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
14 f1 A ያላንድ ሰው yalä andə säwu Für mehr als eine Person
g T ሆ hõ! (Redundanz)
f1 A አታስተኛ atastäñā paßt es nicht.
g T ሆ hõ! (Redundanz)
4. Abschnitt
15 h A ሆያ ሆዬ ጉዴ hõyā hõyē gudē hõyā hõye; Oh ! Meine Güte,
i ብርዋን ብርዋን ይላል ሆዴ
bərwan bərwan
yəlāl hõdē
Geldschein, Geldschein,
sagt mir mein Bauch.
16 h T ሆያ ሆዬ ጉዴ hõyā hõyē gudē hõyā hõye; oh! Meine Güte
i ብርዋን ብርዋን ይላል ሆዴ
bərwān bərwān
yəlāl hõdē
Geldschein; Geldschein
sagt mir mein Bauch54.
Das Lied wird in der bātī-qəñət gesungen, dessen erster Abschnitt melodisch und rhythmisch gleich-
mäßig verläuft und von Synkopen dominiert (s. Takte 1 - 12; Notation 78) wird. Durch diesen Gesang
kündigt die Gruppe von einer bestimmten Entfernung aus ihre Ankunft an. Der awrāğ singt variierte
Verszeilen, die er beliebig oft wiederholen kann, bis er mit seiner Gruppe an dem zuvor ausgewählten
Hauseingang ankommt.
Unmittelbar nach der Ankunft beginnt der zweite Abschnitt. Dieser ist funktional an eine konkrete
Handlung gebunden, in der die Gruppe gesanglich das Öffnen des Toreinganges fordert, so dass sie
hineintreten und direkt vor dem Hausherren bzw. seiner gesamten Familie ihre Aufführung fortsetzen
darf (s. Takte 13-27).
Im folgenden, dritten Abschnitt sind alle Gesangszeilen gleichmäßig gestaltet und sie beginnen stets
mit der betonten Zählzeit (s. Takte 28-55).
Danach wird der vierte Abschnitt, ein Refrainwechselgesang, gesungen. Er wird auf Wunsch des
awrāğ zwei- bis dreimal wiederholt. Weitere Verszeilen, die in diesem Abschnitt gesungen werden
können, sind u.a. die folgenden:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
ሆይሻ ሎሚታ hõyəša lõmitā (Redundanz)
ልምጣ ወይ ወደማታ ləmta wäy wädämatā Soll ich am Abend vorbeikommen?
ሆያ ሆዬ ነው hõyā hõyē näwū (Redundanz)
የምንለው yämənəläwū Sagen wir.
ሆያ ሆዬ ዜና hõyā hõyē žənā (Redundanz)
ተው ስጠኝ ድገምና täwu sətäñə dəgämənā Bitte gib mir noch einmal55!
Je nach der Konstruktion der einzelnen Verszeilen finden Melodievariationen im Rahmen der gegebe-
nen Struktur statt. Der vierte Abschnitt (s. Takte 56 - 63) fungiert im Allgemeinen als gesanglicher
Abschluss des dritten Abschnitts.
Nachdem die jeweilige Familie auf den Gesang reagiert und darauffolgend die Gabe, u.a. Geld oder
nur zu dieser Feier gebackene sogenannte mulmul-Brötchen {ሙልሙል}, ausgeteilt hat56, wird sei-
tens der Gesangsgruppe aus Dankbarkeit folgendes gesungen (s. Abschnitt 5 und 6):
54
Der Inhalt der gesamten Gesangszeile bedeutet ich sehne mich nach Geld. 55
Der Hausherr ist gemeint. 56
Das Maß der Geschenke hängt von dem sozialen Status der einzelnen Familie ab (vgl. Kebede 1971: 89). Es besteht jedoch
auch keinen Zwang die Gruppe unbedingt zu beschenken. Es kommt auch häufig vor, dass sich im Laufe des Tages mehre-
re Gesangsgruppen vor den Toren stehen und dieselben Gesänge singen. Dann kann die Familie der Gruppe bescheid sa-
gen, dass sie zuvor bereits eine andere Gesangsgruppe beschenkt hat und nicht in der Lage ist eine weitere Gruppen zu be-schenken.
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
5. Abschnitt
17 j A ዓመት ዐውድ ዓመት amät awəd amätə57 Jahr, Feiertag!
k T ድገምና dəgämənā Nochmal:
j1 A ዓመት amätə Jahr!
k1 T ድገምና dəgämənā Nochmal:
18 j A የጌታዬን ቤት yägätayēn bētə Im Haus meines Herren.
k T ድገምና dəgämənā Nochmal:
j1 A ዓመት amätə Jahr!
k1 T ድገምና dəgämənā Nochmal:
19 j A ወርቅ ይዝነብበት wärk yəžənäbəbätə Möge Gold regnen!
k T ድገምና dəgämənā Nochmal:
j1 A ዓመት amätə Jahr!
k1 T ድገምና dəgämənā Nochmal:
6. Abschnitt
20
l
l1
m
A
A
A
ክበር በስንዴ ክበር በጤፍ ምቀኛህ ይርገፍ
kəbär bäsəndē
kəbär bätēffə
məqäñahə yərgäfə
Werde reich mit Weizen!
Werde reich mit tēff 58!
Tod deinen Feinden!
21
l
l1
m
T
T
T
ክበር በስንዴ ክበር በጤፍ ምቀኛህ ይርገፍ
kəbär bäsəndē
kəbär bätēffə
məqäñahə yərgäfə
Werde reich mit Weizen!
Werde reich mit tēff!
Tod deinen Feinden!
Im Gesang wird die schenkende Familie gesegnet. Der būhē-Gesang weist von seiner Funktion, Hand-
lungweise, seinem Ziel und Zweck her eine Ähnlichkeit mit dem Neujahrsgesang abäbayē hõy auf. In
beiden Fällen laufen die Gesangsgruppen von Haus zu Haus und singen ihre Lieder so lange, bis die
betreffende Familie sie beschenkt. Nach Annahme der Geschenke wird ein erweiterter Gesangsab-
schnitt gesungen, dessen Text Glückwünsche und Danksagungen enthält.
1.4.1.5. Heldengesänge/Kriegslieder
Der Gesangsstil des šəlälā59 zählt zu den Kriegsliedern, yäšəlälā žäfänõč {የሸለላ ዘፈኖች}, die auf
einen weit zurückliegenden historischen Hintergrund zurückgehen. Seit der Entstehung des äthiopi-
schen Staates im 1. Jahrhundert, haben mehrere Kriege stattgefunden, die sowohl mit äußeren Invasio-
nen (z.B. Italien im Jahre 1936) als auch mit Binnenkriegen (z.B. Religionskrieg zwischen Moslems
und Christen im 7. Jahrhundert) verbunden sind und die zu der Entwicklung und Verbreitung dieses
Gesangsstils viel beigetragen haben60.
Der Begriff šəlälā ist aus dem Verb mäšäläl {መሸለል} hergeleitet. Es bedeutet prahlen bzw. er-
zählen über Heldentaten. Kebede (1971: 66) beschreibt ihn:
"Shilela style employs sarcasm in order to redicule the enemy"....the Shilela song ist used to establish
a sense of attack; it is intended as well to scare away an enemy who might happen to be listening to
songs dealing with the heroic deeds and recklessness of Ethiopian men. It must be indicated here that
all the social criteria of ideal manly behaviour are conclusively enumerated in the fierce, war loving,
and aggressive attitudes and actions of a hero in a Shilela song".
57
Awəd amät bedeutet Feiertag. 58
gerichtet an eine männliche Person, tēff ist eine Getreidesorte 59
Die Musizierform des šəlälā wird auch in anderen Gemeinschaften wie beispielsweise bei den oromõ und təgrāy in ähnli-
cher Weise aufgeführt. 60
Vgl. auch Kebede 1971: 66.
Kriegslieder können sowohl solistisch als auch im Wechselgesang gesungen werden. Zum
šəlälā gehört der fukärā {ፉከራ}, ein Sprechgesang. Das Wort fukärā bedeutet Prahlerei. Dieser
Sprechgesang findet in bestimmten Abständen im Laufe eines šəlälā-Gesangs statt. Der fokārī {ፎካሪ}
gestaltet diesen Sprechgesang solistisch. Es wird eine Reihe von Versen im schnellen Tempo hinterei-
nander ausgesprochen. Parallel dazu bewegt er sich mit energischen Schritten und deutet symbolisch
auf seine Kampfbereitschaft hin.
Hierzu trägt er traditionell eine aus Löwenhaar hergestellte Perücke. In der einen Hand hält er als
Schutz ein rundes Schild, genannt gaššā {ጋሻ}, und in der anderen den ca. 1,5 m langen Speer, ge-
nannt tõr {ጦር}. Um die Taille wird ein mit Gewehrpartronen bestückter Gürtel žənnār {ዝናር} und
ein Schwert gorādē {ጎራዴ} getragen.
An den Kriegsliedern können sowohl Männer als auch Frauen teilnehmen. Die Gesänge weisen freie
und feste Metren auf, wobei der freimetrische Teil stets unmittelbar nach dem zuvor gesungenen fest-
metrisierten Gesangsabschnitt folgt.
1.4.1.6. Sanfter Gesang
Eine der ältesten Musizierformen der amārā ist der Gesang des əngurgūrõ {እንጉርጉሮ}(Bekele 1987:
24), der auschließlich solistisch ausgeführt wird. Er ist meistens bei Hausfrauen und Dienstmädchen
während der Verrichtung allgemeiner Hausarbeiten anzutreffen. Diese Aussage wird von Kebede
(1971: 64) bestätigt:
"In Ethiopia, ingurguro is largely performed by servants as part of the ma'id-bet (servant quarter) ac-
tivities. In fact, ingurguro is conceived as one of the attributes of slaves and servants".
Mit einem əngurgūrõ Gesang drückt man u.a. Einsamkeit, Unzufriedenheit und/oder Trauer im Leben
aus. Er ist somit als ein persönliches Lamentieren (Kebede 1971: 63; Bekele 1987: 26) zu verstehen,
der für die private Unterhaltung und zum Zeitvertreib gedacht ist. Kebede (1971: 65) ə
"It is apparently understandable and clearly comprehensible why and how songs of frustration, la-
ment, and tears should emanate from and belong to the souls of men and women at the lowest stratum
of society, who obviously have a lot of reasons to cry and a lot of words to sing over their tears".
Aufgrund dessen hört man solche Gesänge nicht in öffentlichen Musikveranstaltungen. Im Gegenteil,
solche Lieder werden vor allem dann gesungen, wenn die jeweilige Person ganz alleine und meistens
mit irgendeiner Arbeit beschäftigt ist. Die meisten Gesänge dieser Art stammen von Liebesliedern ab.
Von dem angoragwārī {አንጎራጉዋሪ}, dem Sänger eines əngurgūrõ-Liedes, werden vorwiegend me-
lancholische Melodien und Textinhalte bevorzugt, die er dann auch mit einer starken, inneren Be-
wegtheit singt.
Der angoragwārī hat die Freiheit, beliebige Text- und Melodievariationen im Gesang hinzuzufügen
und das Tempo frei zu gestalten. Im Folgenden ist ein solcher Gesang təžətā {ትዝታ} näher in Be-
tracht zu nehmen:
"Ingurguro song texts carry a good deal of valid and important information pertaining to interrelati-
onships between the existing social and political classes, between the individual and his family,
between the individual and his own class, between the individual and his God….. the ingurguro serves
as psychotherapeutic release for repressed feelings" (Kebede 1971: 64).
Text zu Nr.75: təžətā61
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Strophe
1 a ትዝታዬ አንተ ነህ təžətayē antä nähə Du bist meine Nostalgie,
b ትዝታም የለብኝ təžətām yäläbəñə ich bin sonst nicht nostalgisch.
2 a1 ትዝታዬ አንተ ነህ təžətayē antä nähə Du bist meine Nostalgie,
b1 ትዝታም የለብኝ təžətām yäläbəñə ich bin sonst nicht nostalgisch.
3 c እመጣለሁ እያልክ əmätalähū əyalək Du versprichst, dass Du kommst,
d እየቀረህብኝ əyäqärähəbəñə aber du kommst nicht.
4 c1 እመጣለሁ እያልክ əmätalähū əyalək Du versprichst, dass Du kommst,
d1 እየቀረህብኝ əyäqärähəbəñə aber du kommst nicht.
2. Strophe
5 a2 በፈረስ ይምጣልኝ bäfäräs yəmətaləñə Lasst ihm mit einem Pferd zu mir kommen,
b2 በሚለሰልሰው bämiläsäləsäwu das weich ist.
6 a3 በፈረስ ይምጣልኝ bäfäräs yəmətaləñə Lasst ihm mit einem Pferd zu mir kommen,
b3 በሚለሰልሰው bämiläsäləsäwu das weich ist.
7 c2 መቼ በቅሎ ያውቃል mäčē bäqlõ yawqalə Wann hat es denn einen Menschen gegeben,
d2 እንዳንተ ያለ ሰው əndantä yalä säwu der so ist wie du?
8 c2 መቼ በቅሎ ያውቃል mäčē bäqlõ yawqalə Wann hat es denn einen Menschen gegeben,
d2 እንዳንተ ያለ ሰው əndantä yalä säwu der so ist wie du?
Der Gesang ist in veränderlichem Tempo gestaltet mit variativen Melodiestrukturen. Die Gesangsdau-
er wird von der Sängerin bzw. dem Sänger bestimmt.
1.4.1.7. Gesänge des ažmārī
Die Gesänge des ažmārī {አዝማሪ}, werden zumeist in den sogenannten täğ- {ጠጅ} bzw. ažmārī-bēt
{አዝማሪ ቤት} "traditionelle Kneipen" gesungen. Sie haben alle Lebensereignise zum Inhalt. Der
ažmārī begleitet sich beim Singen in der Regel auf der einsaitigen Kastenspießlaute masinqõ
{ማሲንቆ}. Seine Lieder sind zum größten Teil solistisch gestaltet. Hier ein typisches ažmārī-Gesang,
yämatəbäla wäfə{የማትበላ ወፍ} in der bātī-qəñət :
Text zu Nr.76: yämatəbälā wäfə62; 1. Strophe
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a የማትበላ ወፍ yämatəbälā wäfə Ein unessbarer Vogel63
b ተይዛ በጭራ täyəža bäçərā gefesselt mit einem Wedel,
2 a1 የማትበላ ወፍ yämatəbälā wäfə ein unessbarer Vogel
b1 ተይዛ በጭራ täyəža bäçərā gefesselt mit einem Wedel
3 c ልቤን አጠፋችው አልማዜ ləbēn atäfağəwu almažē64 ließ mein Herz verbluten,
d ቦጫጭራ ቦጫጭራ boçaçərā boçaçərā kratzend, kratzend,
4 c ልቤን አጠፋችው አልማዜ ləbēn atäfağəwu almažē ließ mein Herz verbluten,
d1 ቦጫጭራ ቦጫጭራ boçaçərā boçaçərā kratzend, kratzend.
Das Musikbeispiel beginnt mit einem Instrumentalvorspiel, das die Gesangsmelodie vorstellt. Solche
Melodievariationen werden im Allgemeinen von erfahrenen Zuhörern mit großer Begeisterung wahr-
61
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 62
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 63
Im Amārischen symbolisiert das Wort Vogel die Weiblichkeit. In diesem Fall ist die Liebhaberin gemeint, die von dem azmārī geschmeichelt wird.
64
Das Wort almāžē stammt aus dem weiblichen Namen almāž. In diesem Gesang hat es nichts mit diesem Namen zu tun, sondern es gilt als Redundanz.
genommen. Dabei bleibt der Instrumentenspieler bzw. Sänger im Rahmen der entsprechenden melo-
disch-ryhthmischen Struktur.
Melodievariationen werden bereits existierenden Melodien hinzugefügt, um sie auszuschmücken. Je-
doch gehört das Ornamentieren von Musikstücken nicht zu der Hauptmelodie des jeweiligen Gesangs,
aber alle für diesen Zweck verwendeten Töne sind Teil der dazugehörigen Tonreihe bātī, d.h. das Ein-
fügen von Verzierungen ändert keineswegs die Tonreihe, da keine fremde Töne bzw. Tongruppen
vorkommen dürfen.
Nach dem Instrumentalvorspiel, dessen Länge vom Spieler entschieden wird, beginnt der strophische
Gesang im Takt 50 (s. Notation Nr, 76). Jede Strophe besteht aus 8 Melodieformeln, wobei jeweils
zwei eine ganze Gesangs- und Verszeile bilden. Jeweils im Anschluß jeder Strophe findet ein Instru-
mental-Zwischenspiel statt (Takte 81 - 96), dessen Melodieverlauf dem zweiten Teil der Hauptmelo-
die (vgl. Takte 65 - 72 bwz. 73 - 80) ähnelt65.
1.4.1.8. Gesänge der lalibälā66
Die lalibälõč {ላሊበሎች; Plural zu lalibälā) sind eine Gruppe von Menschen, die in früheren Zeiten,
vor allem während der Zeit des feudalbourgeoise Regimes bis ca. 1974, von der Gesellschaft stark
ausgeschlossen waren (Shelemay 1982: 350-351). Die libälā-Gesänge {የላሊበላ ዘፈኖች}, die sehr
wenig erforscht wurden (s. ebd. 1982 und Bekele 1987), hört man heutzutage kaum noch.
Die lalibälõč waren Leprakranke oder deren Nachkommen. Sie singen ihre Gesänge täglich frühmor-
gens, weil sie befürchten, dass sich die Krankheit entweder weiter ausbreitet oder bei ihren gesunden
Angehörigen ausbricht (ebd. 1987: 40). So gehen sie paarweise von Haus zu Haus und singen vor den
Toren reicher und wohlhabender Familien (vgl. Shelemey 1982: 350). Das Gesangspaar besteht ge-
wöhnlich aus einem Mann und einer Frau67. Die Gesänge werden abwechselnd solistisch vorgetragen.
Eine Besonderheit bei den lalibälā-Gesängen besteht darin, dass während des Singens der Vortragen-
de gewöhnlich einen Zeigefinger in sein rechtes oder linkes Ohr steckt68. Die Bedeutung bzw. der
Grund ist nicht bekannt. Diese Geste weist eine Ähnlichkeit mit den Straßenrufen der Straßenhändler
in Kairo/Ägypten auf. Elsner (1983: 46) schildert sie wie folgt:
"Etwa fünzig Prozent der Straßenhändler legen eine, manche gar beide Hände an die Backe oder an
das Ohr. Es handelt sich um jene mit der Gesangsausführung im Zusammenhang stehende Geste... Ihr
Sinn konnte bisher trotz der vielen historischen Zeugnisse und der zahlreichen Erklärungen von Musi-
kern nicht bündig erschlossen werden".
Hier ein Beispiel:
65
Als Demonstration ist in diesem Notenbeispiel die Transkription einer Strophe mit dem dazugehörigen Instrumental- Vor-
und Zwischenspiel vorgenommen worden. Im weiteren Gesang werden neue Strophen mit unterschiedlichen Melodievaria-tionen vorgetragen. Dabei werden Textauswahl und Gesangsdauer dem ažmārī überlassen.
66 Die lalibälõč werden auch amīna {አሚና} (Bekele 1987: 40) bzw. hamīna {ሀሚና} (Shelemay 1982: 352) genannt.
67
Es handelt sich meistens um Ehepaare. 68
S. ausführliche Information über die Geschichte, Musik, Herkunft und sozialen Status der lalibälõčin Shelemay 1982: 350-356.
Text zur Notation 77
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Strophe
1 a (%) እሰዬ እሰዬ እሰይ የኔ አበባ (ä)əsäyē əsäyē əsäy yänē
abäbā
(Redundanz) meine Blume.
2 a1 (%) ሞንሙዋናዉ (ä)monmwanawu Der gut aussehende,
3 a2 (%) አወይ ጉግሳው (ä)wäy gugəsawu oh gugəsā69,
4 a3 (%) የነ እያሱ አባት (ä)yä'ənä əyāsū abātə der Vater əyāsū's70 .
5 b (%) %ረግ አለም %ረግ አለም %ረግ አለም
(ä)əräg aläm əräg aläm
əräg aläm
(Redundanz)
6 a (%) ወዴጠተ ትሄዳለህ? (ä)wädät təhädalähə Whin gehst du ?
7 c1 (%) ወዴጠተ ትሄዳለህ? ስትል ደፋ ደፋ?
(ä)wädät təhädalähə
sətələ däfā däfā
Wohin gehst du, so
strauchelnd, strauchelnd?
8 c2 (%) ወዴጠተ ትሄዳለህ? ስትል ደፋ ደፋ?
(ä)wädät təhädalähə
sətələ däfa däfā
Wohin gehst du, so strau-
chelnd, strauchelnd?
9 d (%) ቤትህ መሰለህ ወይ? መደድም ቢሰፋ?
(ä)bätəhə mäsälähə wäy
mädädəm bisäfā
Denkst du, es ist dein Heim,
obwohl es groß genug ist71?
2. Strophe
10 b1 (%) %ረግ አለም %ረግ አለም (ä)əräg aläm əräg aläm (Redundanz)
11 c4 ያበላኝ ነበረ (ä) yabälañə näbärä Er hatte mich gefüttert,
12 c5 ያበላኝ ነበረ እያግበሰበሰ
yabälañə näbärä
əyagəbäsäbäsä
er hatte mich im Überfluss
gefüttert,
13 c6 (%) ወይ እያሱ (ä)wäy əyāsū oh əyāsū's,
14 e (%) የነ እያሱ አባት እጁ በሰበሰ
(ä)yä'ənä əyāsū abātə
əju bäsäbäsä
Der Vater von əyāsū.
Im Text geht es um die Verehrung eines Verstorbenen, dessen gute Taten während seiner Lebenszeit
vom Sänger dargestellt werden. Die Verszeilen, die sich auch reimen, werden lückenlos und im
schnellen Tempo nacheinander gesungen.
Der Gesang hat sowohl kurze als auch lange wiederkehrende Melodiezeilen, die vom Sänger nach
Belieben variiert werden. Am Anfang jeder Verszeile ist die Redundanzsilbe ä zu hören, die aus einer
Gruppe von drei Tönen, H cis' e' besteht und als Übergang zu den regulären Melodie- und Verszei-
len dient. Es gibt auch Gesangszeilen, die fast oder ausschließlich aus Redundanzensilben oder -
wörtern bestehen (z.B. Gz. 1 und 10), was in amārā-Gesängen häufig vorkommt. Der Sinn solcher
Redundanzen besteht in der Regel darin, dass sie dem jeweiligen Sänger Zeit geben, sich den weiteren
Gesangstext zu überlegen.
Es ist unklar, in welcher Tonreihe das Lied gesungen wurde, da sich der Sänger zum größten Teil in
einem Tonvorrat von drei Tönen H cis' und e' bewegt. Nur an zwei Stellen kommt der Ton A vor.
Auch der Ausgangston der Tonreihe ist undeutlich. Von der Gesamtheit der melodischen Bewegung
her ist jedoch zu vermuten, dass es sich eher um die təžətā-qəñət handelt, in der der Ton A als Grund-
ton fungieren kann. Der Ton fis', der eigentlich diese Tonreihe vollenden sollte, kommt im Gesang
überhaupt nicht vor.
69
Name des Verstorbenen 70
Sohn des Verstorbenen; es können auch andere Namen der Geschwister genannt werden. 71
Inhalt bezieht sich auf den Verstorbenen. Es hat den folgenden Sinn: Warum gehst Du von uns weg? Glaubst Du das Grab wäre dein Zuhause?
1.4.1.9. Hirtenlieder
Die Hirtenmusik yä'əräñā žäfänõč {የእረኛ ዘፈኖች} ist, wie viele andere Musizierpraktiken Äthiopi-
ens, kaum untersucht worden. Bei den amārischen Hirtenliedern sind ausschließlich Instrumentalstü-
cke anzutreffen, die auf der Flöte wašənt {ዋሽንት} gespielt werden und aus bekannten Alltagsgesän-
gen stammen. Dabei werden häufig melancholische Melodien bevorzugt, die stark variiert werden und
sich von Spieler zu Spieler unterscheiden. Die Hirten spielen die Flöte während der Aufsicht ihrer
Herde, um sich die Langeweile und die Einsamkeit zu vertreiben. Ein Beispiel ist die Notation Nr.74
in der təžətā-qəñət.
1.4.1.10. Wiegenlieder
In der Musikkultur der amārā weisen die Wiegenlieder yämababäyā žäfänõč {የማባበያ ዘፈኖች}
kurze, zyklisch aufgebaute Melodiezeilen und meistens epische Texte auf. Diese Lieder sind funkti-
onsgebunden und zwar dienen sie dazu, einen weinenden Säugling zu beruhigen. So singt die Mutter
dem Baby das folgende Wiegenlied əšurūrū {እሹሩሩ} vor, bis es wieder beruhigt ist bzw. einschläft
(s. Bekele 1987: 30-32). Das Lied kann beliebig oft wiederholt werden72.
Text zum Wiegenlied əšurūrū
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a እሹሩሩ əšurūrūrūrū (Redundanz)
2 a1 ማሙዬ እሹሩሩ mamūyē əšurūrū mamūyē73 (Redundanz),
3 a ስፈጭም አዝዬ səfäçəm ažəyē beim Mahlen trage ich dich auf meinem Rücken,
4 a1 ስጋግር አዝዬ səgagər ažəyē beim Brotbacken trage ich dich auf meinem Rücken,
5 a ሳቦካም አዝዬ sabokam ažəyē beim Teig machen trage ich dich auf meinem Rücken.
6 a1 ጀርባዬ ቆሰለ ğärbayē qõsälä Mein Rücken ist verletzt.
7 a2 በል ውረድ ማሙዬ bäl wəräd mamūyē Komm runter mamūyē!
72
Das im Notenbeispiel angegebene Wiegenlied existiert auch in der təgrəñā-Sprache mit gleichem Melodieverlauf und fast
identischem Textinhalt. 73
Allgemeiner gebräuchlicher Name für männlche Babys
Abb.16: transkribiert aus dem Gedächtnis
qəñət-təžətā
Die in Abbildung 16 veranschaulichte Transkripti-
on gehört zu den meist verwendeten Beispielen für
Wiegenlieder in der amārəñā-Sprache. Während
des Singens trägt die Mutter den Säugling entwe-
der auf ihrem Rücken, oder sie hält ihn in ihren
Händen und bewegt sich hin und her.
1.4.1.11. Klagelieder
Diese Musizierform betrifft Klagelieder bzw. Lamenti yäläqsõ žäfänõč {የለቅሶ ዘፈኖች}, die aus-
schließlich während einer Trauerzeremonie gesungen werden. Das Wort läqsõ "Trauer", stammt aus
dem Verb malqäs {ማልቀስ} "betrauern, heulen, weinen".
Wenn ein Mensch stirbt, so wird bei den amārā eine Trauerzeit gehalten, die sich über einen Zeitraum
von ca. einem Jahr erstreckt, in welcher an bestimmten Tagen Trauerzeremonien stattfinden. Die
wichtigsten Zeremonien, die nach dem Tod hintereinander gefeiert werden sind u.a. der
Tag des Begräbnisses qäbər {ቀብር} 3. Tag säləst {ሰልስት}
30. Tag sälasā {ሰላሳ} 40. Tag arbā {አርባ} 80. Tag sämanyā {ሰማንያ} und das 1. Todesjahr mūt amätə {ሙት ዓመት]
All diese Tage haben einen religiösen Hintergrund und sind auch mit festen Handlungen und Bräuchen
verknüpft. Die läqsõ-Gesänge finden insbesondere in den ersten drei Tagen statt, da sich vor allem in
dieser Zeit eine große Anzahl von Trauergästen läqästäñā {ለቀስተኛ}, versammelt, um der betroffe-
nen Familie ihr Beileid auszurichten.
Die organisatorischen Aufgaben für die Trauerfeier wird nahestehenden Bekannten, Verwandten und
Freunden der trauernden Familie und dem sogenannten ədər {እድር} überlassen74.
74
Jede Wohngemeinde hat einen eigenen ədər. Eine solche Organisation besteht zum einen aus Männern und Frauen (500 bis
über 1000 Mitglieder) und zum anderen gibt es parallel dazu eine sogenannte yäsetõč-ədər {የሴቶች እድር}, Frauen-
Organisation (aus ca. 20 Personen), dessen Mitglieder nur Frauen sind. Im Gegensatz zu der ersten Organisation besteht
die zweite aus einer relativ kleineren Anzahl von Mitgliedern. Jede Organisation hat einen bestimmten Aufgabenbereich zu erfüllen.
Für eine Trauerfeier wird eine spezielle und möglichst erfahrene Sängerin von Trauergesängen, ge-
nannt asläqaš {አስለቃሽ}, bestellt75 (s. Bekele 1990:86). Sie ist meistens eine ständig trauernde Per-
son, die selbst einen nahestehenden Menschen aus der eigenen Familie oder einen engen Verwandten
verloren hat und sich aufgrund der untröstlichen Situation entschieden hat, eine solche Tätigkeit auf-
zunehmen und bei jeder Gelegenheit an den Verstorbenen zu denken. Beim Singen der Klagelieder,
deren Texte meistens mit dem Namen oder Taten des Verstorbenen (z.B. als Held, Soldat oder Häupt-
ling76) in Verbindung gesetzt werden, weint sie sehr heftig.
Die Lieder weisen sowohl freie und feste Metren auf, die je nach ihrer rhythmisch-melodischen Struk-
tur im Wechsel zwischen der Vorsängerin und den gesanglichen Begleitern vorgetragen werden (vgl.
Zegeye 1986: 5). Meistens werden die frei metrisch gestalteten Gesänge solistisch von der asläqāš
vorgetragen.
Im Gegensatz zu anderen Musizierpraktiken, werden die läqsõ-Gesänge werden nicht instrumental
begleitet. Es gibt funktionsgebundene Klagelieder, die u.a. berichten, welche Taten der Verstorbene zu
seiner Lebenszeit vollbracht hat, welchen Charakter er hatte und ähnliche konkrete Kenntnisse.
An den Gesängen nehmen gewöhnlich nur Frauen teil. Im Verlauf des Gesanges gibt es ausgeprägte
Bewegungsmuster, die sich sowohl nach dem Melodieverlauf als auch nach dem Textinhalt richten.
Zum größten Teil ist jedoch der Text entscheidend. Es ist u.a. auch das Schlagen des Brustkorbes
wichtig77. Diese Handlung wird in bestimmten Abständen wiederholt. Als Leiterin der Gruppe gibt
die asläqāš, die sich stets in der Mitte des Kreises bewegt, bestimmte Signale und Gesten zum Schla-
gen des Brustkorbes oder sie fängt selbst an, ihren Brustkorb zu schlagen. Danach folgt ihr sofort der
Rest der Gruppe.
Durch das Schlagen des Brustkorbes erzeugt der Trauernde das Gefühl, von dem Verstorbenen Ab-
schied genommen zu haben78.
Als Mitglied eines ədər ist man verpflichtet, monatlich einen Beitrag zu zahlen, dessen Höhe von der Größe der Organisa-
tion und vom durchschnittlichen Monatseinkommen der Mitglieder dieser Gegend abhängt. Dies bedeutet, dass in anderen
Wohngegenden, wo beispielsweise ein größerer Anteil von wohlhabenden Familien lebt, der monatliche Beitrag auch ent-
sprechend höher sein kann. Unabhängig davon ändert sich auch der Beitrag, wenn sich die Kasse in einem finanziellen
Rückstand befindet. Da einer trauernden Familie je nach dem, ob sie ein Familienmitglied (u.a. Kind, Frau und Mann) oder
einen entfernteren Verwandten verloren hat, unterschiedlich hohe Summen von Geld gespendet wird, muss die Organisati-
on danach u.a. durch eine einmalige Erhöhung des monatlichen Beitrages die Kasse wieder auffüllen. 75
Die asläqāš kann sich auch freiwillig aus den Trauergästen zum Gesang melden; d.h. ohne Bezahlung (vgl. Zegeye 1986:
5). Dies geschieht vor allem in den ländlichen Gegenden. Für sie ist es wichtig, sich vor Beginn ihrer Gesangstätigkeit über
den Verstorbenen alle zugänglichen Informationen; d.h. Name, Taten zu Lebzeiten usw., zu sammeln und zu wissen, ob es
andere bereits verstorbene Verwandte in der Familie gibt. All diese Informationen helfen der asləqāš den Inhalt ihrer Ge-
sangstexte zu gestalten. Die meisten Texte der läqsõ-Gesänge sind allerdings bereits feststehend, so dass nur der Name des
Verstorbenen hinzugefügt und der aktuelle Moment deutlicher zum Ausdruck gebracht wird. Im Übrigen gestaltet bzw. er-findet die asläqāš auch neue Texte aus dem Stegreif, die ebenfalls mit der aktuellen Situation übereinstimmen.
76 Auf Trauerzeremonien is es desweiteren auch gewöhnlich, dass ein vergrößertes Foto bzw. Bild des Verstorbenen (vgl.
Bekele 1990: 83) entweder von der asläqaš oder abwechselnd von der trauernden Familienangehörigen und Verwandten
hochgehalten und dabei geweint wird. Im Falle einer verstorbenen Persönlichkeit wird außerdem insbesondere in ländli-
chen Gegenden eine spezielle Zeremonie für sein Begräbnis veranstaltet. Diese betrifft männliche Trauernde (Freunde,
Verwandte, Familienangehörige), die ihre Gewähre mitbringen und sie am Tag der Beerdigung in die Luft schießen. Den
Leichnahm begleiten sie, indem sie auf Pferden Reitern, die ebenfalls für diesen Anlaß besonders speziell bekleidet wer-
den, um die Feier so schön wie möglich zu Ehren des Verstorbenen zu gestalten (vgl. auch ausführliche Beschreibung be-
züglich der Trauerzeremonie bei den Agäw/Zentrales Hochland Äthiopiens; Ayen, Engida, Alene 1988 26-30. 77
Zum Schlagen des Brustkorbes machen vor allem nahestehende Verwandte und Bekannte einschließlich der trauernden
Familie den Oberkörper bis zum Busen frei und schlagen den nackten Brustkorb stundenlang (d.h. auf jeden Fall bis der Verstorbene seine letzte Ruhestätte gefunden hat) mit beiden Handflächen.
78 Auf vielen Trauerzeremonien der amārā ist zu beobachten, dass insbesondere trauernde Familienangehörige ihren Brust-
korb stundenlang bis zur Bewußtlosigkeit und totalen Erschöpfung schlagen. Das Zufügen von einem solchen physischen
Schaden kann unter Umständen auch zu chronischen Erkrankungen wie z.B. Brustkrebs, Herzkrankheit bzw. einer infekti-
ösen Hautentzündung führen (vgl. Ayen, Engida, Alene 1988: 31). Jedoch bemerkt man während des Trauerns nicht, wel-
che Nebenwirkungen diese Handlung hervorruft, da in dem Augenblick die Trauer so stark ist, dass man sich in einer Art Trance befindet. Erst nach der Beerdigung, wenn sich die Trauernden ausruhen, ist der Schmerz langsam zu spüren.
Das stundenlange Schlagen des Brustkorbes und im Zusammenhang damit die Bestellung einer asläqāš für die Ausschmü-
ckung einer Trauerzeremonie ist aus diesem Grund heutzutage offiziell verboten (vgl. Bekele 1990:86). Dennoch wird die-se Tradition in verschiedenen ländlichen Gegenden Äthiopiens noch praktiziert.
Unabhängig von dem läqsõ-Gesang, der in der Regel im Wechsel zwischen der asläqāš und den
täqäbayõč ausgeführt wird, weinen auch Angehörige des Verstorbenen, ohne am Gesang teilzuneh-
men. Das typische an diesem Lamentieren ist, dass es in kurzen Text- und Melodiephrasen erfolgt79,
die in der Regel jeweils zweimal wiederholt werden. Im folgenden Textbeispiel ist dies zu beobach-
ten:
Text: Klagegesang
Originalschrift Umschrift Übersetzung
እናቴ እናቴ እናቴ እናቴ
ənātē ənātē
ənātē ənātē
Meine Mutter,meine Mutter!
Meine Mutter, meine Mutter!
ምን ብለሽኘ ነበር?
ምን ብለሽኘ ነበር?
mən bläšəñ näbär?
mən bläšəñ näbär?
Was hattest du mir versprochen?
Was hattest du mir versprochen?
ኩራቴ ኩራቴ kurātē, kurātē Mein Stolz, mein Stolz.
ኩራቴ ኩራቴ kurātē, kurātē Mein Stolz, mein Stolz.
Bei einem solchen Lamentieren, sind Frauen eher in der Lage spontan eine Melodiezeile zu erfinden,
während Männer meist zu einem Sprechgesang neigen (Bekele 1987: 32-35). Läqsõ-Gesänge bzw.
Lamenti sind in vielen Gemeinschaften Äthiopiens bekannt.
1.4.1.12. Besessenheitsritus und -gesänge
Bessessenheitsriten werden in vielen Kulturen Äthiopiens praktiziert. Darüberhinaus sind sie in ande-
ren afrikanischen Ländern wie beispielsweise Ägypten und Sudan üblich. Der Besessenheitsritus in
Äthiopien ist unmittelbar mit den Begriffen žār {ዛር}, awäliyā {አወልያ} und qalləččā80 {ቃልቻ}
verknüpft. Musikethnologische Forschungen (Simon 1983: 284, Jabés 1983: 34) belegen, dass vor
allem der äthiopische Begriff žār sich von Sudan bis weit nach Unterägypten verbreitet hat.
Der žār-Ritus hat in Äthiopien unterschiedlichen Anlass und Umstände, unter denen er stattfindet.
Diese sind u.a. Krankenheilungsritus, genannt būdā masläqäq {ቡዳ ማስለቀቅ}, Geisterbeschwörun-
gen im Zusammenhang mit schwarzer Magie tənqõlā {ጥንቆላ}, Einzel- oder Gruppentherapien oder
es kann sich auch um eine einfache Sucht zur Besessenheit (Simon 1983: 285) handeln.
In Äthiopien gab bzw. gibt es in verschiedenen Regionen angesehene und anerkannte vom žār-Geist
besessene traditionelle Heiler wie u.a. den sogenannten tāyē aus Nažarēt, yänažərētū yätayē
kärama {የናዝሬቱ የታዬ ከራማ}, und die atētē dulā aus Arūssī, yä'arusīwā atētē dulā81 {የአሩሲዋ አቴቴ ዱላ}, zu denen Menschenmassen aus weitentfernten Gegenden ununterbrochen strömen, um
Heilung für ihre Krankheiten zu erwirken. In solchen Orten finden therapeutische Riten statt, die ent-
weder in Einzel- oder in Gruppensitzungen ausgeführt werden.
Das Musikbeispiel Nr. 73 (s. auch Text auf S. 44) gehört zur Gruppe der sozialen Riten82. Faktisch
handelt es sich um eine bloße Belustigung einer besessenheitssüchtigen83 Frau. Simon (1983: 286)
beschreibt, dass solche "Besessenheitssüchtige sich damit als diskriminierte soziale Gruppe einen
Freiraum gegenüber dem gesellschaftlich dominierenden Teil" schaffen.
79
Beobachtung einer Klagezeremonie in Addīs Abäbā/1997. 80
Soweit bekannt deuten alle drei Begriffe auf dieselbe Bedeutung, nämlich den Besessenheitsritus hin. Auch ein Gistesbe-
sessener wird als balä žār, balä awäliyā oder qalləččā bezeichnet (Admassu 1997). 81
Es ist unklar, ob diese Krankenheiler heute noch leben oder nicht. 82
In seinem Artikel beschreibt Simon (1983: 286) u.a. ausführlich Inhalt und Form von sozialen Riten. 83
Vgl. hierzu auch Simon (1983: 286).
Bevor die eigentliche rituelle Zeremonie beginnt, werden in der Regel wichtige Vorbereitungen ge-
troffen. Und zwar begibt sich die Frau als erstes in ein für diesen Zweck vorbereitetes Zimmer84 und
setzt sich auf eine Matratze, die auf dem Boden liegt. Danach wird sie mit çāt {ጫት}, einem leicht
stimulierenden Rauschmittel zum Kauen, aräqē {አረቄ}, traditionell hausgebrannter Dattelschnaps
und Zigaretten versorgt, die sie kettenweise raucht85. Zeitgleich wird frischer Kaffee geröstet, gemah-
len, gekocht und serviert.
Unmittelbar zur gesamten Zeremonie gehören Sandelholz, sändäl {ሰንደል}, und eine spezielle Weih-
rauchsorte86, genannt kärbē {ከርቤ}, die während der žār-Sitzung ununterbrochen verwendet werden.
Die Frau singt87 typische Besessenheitslieder, genannt mänžumā88 {መንዙማ}, deren Melodien frei
variiert werden können.
Nach einer Weile wird der Moment erreicht, in dem die Frau Verbindung mit dem žār-Geist89 auf-
nimmt. Nun verändert sich allmählich ihre Verhaltensweise, erkennbar an ihrer Körperbewegung90,
und sie fungiert von diesem Augenblick an als Medium zwischen dem žār-Geist und den Teilnehmern
der Zeremonie.
Hin und wieder unterbricht die Besessene ihren Gesang, um sich mit den Teilnehmern zu unterhalten.
Es werden verschiedene Themen angesprochen, die einerseits auf Wahrsagungen, Voraussagen, Pro-
phezeiungen oder kultischen Verehrungen von göttlichen Wesen der Besessenen, und andererseits auf
Orakelbefragungen und Anbetungen der Teilnehmer basieren. Es werden verborgene Gefühle, Prob-
leme, Geschehnisse und besondere Wünsche geäußert, auch solche, die im normalen Leben tabu sein
könnten (vgl. Simon 1983: 291). All diese Probleme werden seitens des žār-Geistes gelöst. Wäh-
rend der Unterhaltung ruft die Frau in bestimmten Intervallen beschwörende Formeln dazwischen und
verehrt so die Namen von muslimischen, christilischen und äthiopischen žār-Geistern (ebd.) wie z.B.
Allāh {አላህ}, adāl {አዳል}, ənātē momīnā {እናቴ ሞሚና} und qədūs abalafā {ቅዱስ አባላፋ}.
Text zu Nr. 73 Besessenheitslied
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a እ ə (Redundanz)
2 a1 እ ə (Redundanz)
3 a2 እ ə (Redundanz)
4 b ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል አዳል
tolõ bälə tolõ bälə tolõ
bälə adalə
Sei schnell, sei schnell,
sei schnell adālə91!
5 a3 እ ə (Redundanz)
6 c አንት ገልድመኝ አዳል antə gälədmäñ adalə Bekleide mich adālə,
7 c1 ገልድመኝ አዳል gälədmäñ adalə Bekleide mich adālə,
8 a4 እ ə (Redundanz)
9 d እናቴ ሞሚና እ ənatē mõmēnā ə Meine Mutter momīnā,
84
In den Häusern mancher Gläubigen gibt es ein relativ kleines Kultzimmer, das ausschließlich solchen žār-Sitzungen dient.
Sonst darf das Zimmer in der Regel auch nicht betreten werden. Typisch in solchen Sitzungen ist ferner die Tatsache, dass
das Zimmer verdunkelt wird, so dass die Besessene schlecht bzw. kaum sichtbar ist. Der Grund ist jedoch unbekannt (For-schungsreise/Addīs Abäbā 1997).
85
Zu bemerken sei hier, dass die Frau sonst im normalen Alltag keine Zigarette raucht und somit nicht süchtig ist. Das Rau-chen von Zigaretten gehört jedoch nicht zu jeder žār-Sitzung (vgl. hierzu auch Simon 1983:291).
86
Diese Weihrauchsorte wird insbesondere für žār-Sitzungen bevorzugt. 87
Die Handlung wird als žəyärā {ዝየራ} bezeichnet. 88
Bezüglich des musikalischen Ablaufes jedoch gibt es in diesem Fall keine Temposteigerungen, wie es in anderen žār-
Gesängen (z.B. bei Gruppentherapien oder bei mehrtägigen žār-Sitzungen) der Fall ist. Außerdem werden hier auch keine Musikinstrumente verwendet.
89 Zu diesem, besonderen und wichtigen Augenblick spricht man auch žār wärädä "der Geist ist heruntergekommen".
90 Sitzend bewegt die Besessene ihren Oberkörper entweder kreisförmig oder schaukelnd nach vorn und hinten. Hin und
wieder schüttelt sie ihren Kopf ebenfalls kreisförmig. Alle Bewegungen scheinen unkontrolliert zu sein. 91
Name des žār-Geistes. Auch der Name momīnā gehört dazu.
10 a5 እ ə (Redundanz)
11 e አንተ ብትል እኔን አድዬ antä bətələ ənēn adəyē du hast mich gebraucht adəyē,
12 e1 እኔ ብል አንተን ənē bələ antänə sowie ich dich gebraucht habe.
13 e2 እሩቅ አገር ሆነህ ərūq agär honähə Von weit entferntem Land aus
14 e3 ብታደላድል bətadäladələ regierst du92.
15 e4 አድዬ የኔ ተላላ ልንገርህ መላ
adəyē yänē tälalā
lənəgärəhə mälā
adəyē mein gutmütiger,
lass mich dir einen Ratschlag geben.
In dieser Musizierform gibt es sowohl fest- als auch freimetrische Gesänge. Die meisten festmetrisier-
ten žār-Gesänge werden in Form eines Wechselgesanges ausgeführt. Sie haben in der Regel einen
bestimmten Text- und Melodieverlauf und sie werden oft von Musikinstrumenten wie die Trommel
dəbbē {ድቤ} und die Flöte wašənt {ዋሸንት} begleitet.
Die freimetrisierten žār-Gesänge dagegen müssen keinen festen Text- und Melodieverlauf besitzen.
Sie werden solistisch dargestellt und von keinem Musikinstrument begleitet, wie in dem hier angege-
benen Musikbeispiel. Aus dem melodischen Verlauf dieses Gesanges ist ersichtlich, dass jede Ge-
sangszeile, bedingt durch ausgedehnte Variationsbildungen, deutlich verschiedenartige Strukturen
entstehen. Beispielsweise ermöglicht der Einsatz der Redundanzsilbe ə (s. Gz. 1,2,3,5,7,9 und 10) der
Sängerin eine noch größere Variationsfreiheit. Außerdem verschafft sie sich - wie es für die meisten
traditionellen Gesänge der amārā typisch ist - Zeit, sich den weiteren Gesangstext auszudenken. Verse
müssen sich nicht reimen. Sie können sich aber reimen wie es z.B. in den Gesangszeilen 12 und 13,
Silbe nə, oder 15, Silbe lā, zu erkennen ist.
Anfang und Ende des Gesanges ist dem jeweiligen Sänger bzw. Sängerin überlassen und hängt von
der gegebenen Situation ab. Dies gilt sowohl für die fest- als auch für die freimetrischen žār-Gesänge.
1.4.1.13. Arbeitsgesänge
Arbeitsgesänge yäsərā žäfänõč {ዘፈኖች}sind in vielen äthiopischen Kulturen verbreitet. Sie dienen
zum Anspornen bei der Ausführung einer Einzel- oder Gruppentätigkeiten, um ein positives Ergebnis
zu bewirken. Bei den amārā erklingen Arbeitsgesänge aus unterschiedlichen Anlässen wie beispiels-
weise allgemeine landwirtschaftliche Tätigkeiten wie Dreschen, Pflügen und Sammeln des Erntegutes,
Bauarbeiten wie z.B. Häuser- und Straßenbau.
Sie beinhalten verschiedene melodische und rhythmische Strukturen, so dass sie, außer ihren Textin-
halten und Funkitionen, durch keine besonderen Merkmale von anderen traditionellen Gesängen zu
differenzieren sind. Sie werden als Solo oder in Form von Wechselgesängen (zwischen awrāğ und
täqäbayõč), oder als einstimmiger Gruppengesang ausgeführt.
In dieser Gesangsart sind keine Instrumentalbegleitungen bekannt. Das folgende Lied, das sich aus
kurzen, wiederkehrenden Melodiezeilen zusammensetzt, ist eines der bekannten Arbeitsgesänge:
Text zum Arbeitsgesang lägešõ wäqätā
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a ለጌሾ ወቀጣ lägešõ wäqäta Zum Zerstampfen von gešõ93
2 a ማንም ሰው አልወጣ manəm säwu alwäta erschien keiner,
3 a ለመጠጡ ጊዜ lämätätu giže aber zum Trinken
4 a ከየጎሬው ወጣ käyägõrew wäta kam jeder aus seimen Versteck heraus.
92
Der žār-Geist ist damit gemeint. 93
Rhamnus prinoides (siehe Misgana 1958: 101).
Abb. 17: transkribiert aus dem Gedächtnis
Dieses Arbeitslied wird beim Zerstampfen von gešõ
gesungen, das für die Herstellung von dem insbeson-
dere im Zentralen Hochland Athiopiens traditionell
hergestellten Bier, tällā {ጠላ} und dem Honigwein,
täğ {ጠጅ} verwendet wird. Dies geschieht bei der
Vorbereitung eines großen Festes, z.B. eines Hoch-
zeitsfestes. So bittet man Nachbarn, Verwandte oder
Bekannte, einige Wochen vor dem eigentlichen Fest
beim sogenannten gešõ wäqätā "Zerstampfen von
gešõ" zu helfen. Am vereinbarten Tag finden sich
alle freiwilligen Helfer im Haus der betreffenden
Person zusammen.
Das Zerstampfen wird in der Regel von einem Paar ausgeführt, das nach einer Weile von einem ande-
ren abgelöst wird. Als Arbeitsmaterial wird ein sogenanntes Stampfholz, žänäžänā {ዘነዘና}, benutzt.
Das gešõ, das zunächst in einen großen hölzernen Behälter, muqäççā {ሙቀጫ}, eingefüllt wird, muss
nun von dem jeweiligen Paar bis zur Erschöpfung zerkleinert werden. Während dessen singt die be-
obachtende Gruppe das im Notenbeispiel dargestellte Lied und klatscht dabei.
1.4.1.14. Kinderlieder
Bei den amārā ist eine geringe Anzahl von Kinderliedern yäləğõč žäfänõč {የልጆች ዘፈኖች} bekannt,
die entweder an eine bestimmte Funkition94 gebunden sind, oder nur als spielerischer Gesang existie-
ren. Jedoch besteht heutzutage die Gefahr des Vergessens, da sie sehr wenig oder kaum gesungen
werden. Eine Studie in den amārā-Gebieten im Jahre 1997 ergab, dass ein Großteil der befragten Kin-
der die traditionellen Kinderlieder kaum kennt. Sie neigen eher zu modernen, mit europäischen Mu-
sikinstrumenten begleiteten kommerzielle Gesänge, die sie auch gerne vorsingen wollen. Die Melo-
dien und vor allem die Rhythmen, u.a. Reggae und Pop, dieser Lieder gehören zu dem neuen Trend,
der aktuellen Mode auf dem äthiopischen Musikmarkt. Dadurch wird der Umgang mit dem traditionel-
len Repertoire sehr stark beeinflusst.
Ein typisches Merkmal der Kinderlieder besteht darin, dass sie einfache, zum Teil auch redundante
Textinhalte95 besitzen. Die Melodien sind in zyklischer Form aufgebaut und können beliebig oft wie-
derholt werden. Zu den Gesängen wird meistens geklatscht, wobei das Klatschen stets auf die schwere
Zeit fällt. Alle Lieder besitzen ein festes Metrum.
Im Folgenden ist ein Beispiel in Betracht zu nehmen, das in der Regel im Wechsel zwischen zwei
Gruppen oder einem Paar gesungen wird:
94
Als Beispiel wäre das Lied əmbuçē gälā {እምቡጬ ገላ} zu nennen. Bei diesem Lied tanzen jeweils zwei Kinder, die
zunächst miteinander ihre Hände in Kreuzform halten und im Kreis links oder rechts herum hüpfen. Dabei strecken sie die
Hände und beugen ihren Körper nach hinten. Der Rest der Gruppe singt und klatscht. Danach kommt das nächste Paar und so wird weitergesungen und getanzt.
95 Manche Kinderlieder haben teilweise sogar sinnlose englische und italienische Texte (entweder Wortgruppen oder einzelne
Wörter) verkoppelt mit amārischen Texten zum Inhalt. Die Entstehung bzw. der Ursprung dieser Texte ist unklar.
Text zu ətemetē yälõmī šətā
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a እቴሜቴ ətēmetē ətemetē96
b የሎሚ ሸታ yälõmī šətā Zitronenduft.
2 a ያ ሰውዬ ya säwuyē Was hat der Mann
b1 ምን አለሽ ማታ mən aläšə mātā gestern Abend zu dir gesagt?
3 a ምንም ምንም mənəm mənəm Nichts, nichts,
b ምንም አላለኝ mənəm alaläñə nichts hat er gesagt.
4 a ትዳሩን ፈቶ tədarūn fättõ97 Er wollte sich scheiden lassen
b1 ልውሰድሽ አለኝ ləwsädəš aläñə und mich mitnehmen.
5 a አይወስድሽም aywäsədəšəm Er lässt sich nicht scheiden
b ትዳሩን ፈቶ tədarūn fätõ und nimmt dich auch nicht mit.
6 a ምሎልሻል məlõlšal Er schwört es dir
b1 ጋሻ ጦር ደፍቶ gašā tõr däfətõ bei einem Speer und einem Schild.
7 a ማላ ማላ mallā98 mallā Schwur, Schwur,
b የጎበዝ ማላ yägobäž mallā Heldenschwur,
8 a ፉት ይላታል fūt yəlatāl trinkt er
b1 እንደ ጉሽ ጠላ əndä gūš tällā wie Bier.
2. Abschnitt
9 c ከቤቴ በላይ käbetē bälay Auf meinem Hausdach
d ቁራ ሰፍሮ ቁራ ሰፍሮ qūrā säfrõ qūrā säfrõ saß ein Rabe, saß ein Rabe.
10 c የለችም ብሎ yäläčəm bəlõ Er dachte, ich sei nicht da,
d ሄዶ በሮ ሄዶ በሮ hedõ bärrõ hedõ bärrõ und flog weg, flog weg.
11 c እኔን ያብረኝ ənēn yabräñə Es tut mir leid,
d ያክንፈኝ ያክንፈኝ yakənfäñə yakənfäñə dass er wegflog, dass er wegflog.
12 c የዝሆን ሀሞት yäžəhõn hamõt Ich trinke
d ያስጠጣኝ yastätañəyastätañə Elefantengalle, Elefantengalle.
13 c የዝሆን ሀሞት yäžəhõn hamõt Eine Elefantengalle
d መራራ ነው መራራ ነው märarā näwu , märarā näwu ist sauer, ist sauer.
14 c የጎበዝ ልቡ yägobäž ləbū Ein Heldenmut ist groß
d ተራራ ነው ተራራ ነው tärarā näwu tärarā näwu wie ein Berg, wie ein Berg.
15 c ተራራ ሄጄ tärarā heğē Als ich vom Berg
d ስመለስ ስመለስ səmäläsəsəmäläsə heimkehrte, heimkehrte.
16 c አህያ ሞቶ ahəyā mõtõ Ein Esel starb und
d ጅብ ሲያለቅስ ጅብ ሲያለቅስ
ğəb siyaläqəsə ğəb siyaläqəsə eine Hyäne heulte, eine Hyäne heulte.
17 c ቁንጫ ሞታ qunəcā mõtā Ein Floh starb und
d ሲቀደስ ሲቀደሰ siqädäsə siqädäsə eine Totenmesse fand statt, fand statt.
18 c አይጥ ለሰርግዋ ayət läsärgwā Die Hochzeit der Maus
d ሲደገስ ሲደገስ sidägäsəsidägäsə gefeiert, gefeiert.
19 c እባብ አንገቱን əbāb angätūn Eine Schlange
d ሲነቀስ ሲነቀስ sinäqäsə sinäqäsə ließ sich am Hals tätowieren, tätowieren.
Das Lied besteht aus zwei rhythmisch und melodisch verschiedenartig aufgebaute Teile. Zunächst
findet im ersten und langsamen Teil eine Art Dialog zwischen den zwei Gruppen statt. Die erste
Gruppe singt Gesangszeile 1 und die zweite Gesangszeile 2 ...usw. Dabei stellen sich beide Gruppen
händchenhaltend gegenüber und machen ein Paar Schritte vorwärts. In gleicher Weise bewegt sich die
andere Gruppe, wenn sie an der Reihe ist.
96
weiblicher Name 97
Vollständiges Wort lautet fätətõ. Im Gesang wird die Silbe tə verschmolzen. 98
Vollständiges Wort lautet mähāllā. Daraus wird im Gesang mallā.
Im Gegensatz zum ersten Gesangsteil, wird im zweiten geklatscht. Hier bewegen sich die Gruppen
nicht wie im ersten Teil, sondern sie bleiben stehen, bis der erste Gesangsteil wieder beginnt.
Abb. 18: vgl. 0345:011/7c transkribiert aus dem Gedächtnis
1.4.1.15. Politische Gesänge
In der äthiopischen Geschichte fanden politische Gesänge yäpolätikā žäfänõč {የፓለቲካ ዘፈኖች}
große Anerkennung und Verwendung überwiegend erst nach dem Ausbruch der Februarrevolution im
Jahre 1974 und nach der Machtübernahme des sozialistischen Regimes. Eshete (1982: 18) beschreibt
einerseits die langjährige Rückentwicklung der Kunst und Kultur während des kaiserlichen Regimes
(ca. 1920-1974) und andererseits den Aufstieg bzw. Aufschwung dieser nach der Februarrevolution:
"Following the popular revolutionary outburst of February 1974 against the archaic and oppressive
feudal monarchy, the liberation was not only political and economic but cultural. The police state and
the most suffocating censorship practised by the regime affected all branches of culture: literature,
theatre, painting, music, the media, etc., in a leviathan manner, so that while all progressist ideas
remained buried and progressist language stifled, supersition and witchcraft flourished. Culture was
thus used as an instrument for the glorification and perpetuation of the regime".
Die Kunst wurde also ausschließlich für den Ruhm und das ewige Bestehen des kaiserlischen Regimes
ausgenutzt99.
Die neu errungene Freiheit dagegen, drückte sich u.a. durch typische Marschgesänge100, Dichtungen,
Presseartikel und Malereien aus, die im Allgemeinen die Unterdrückung und die Menschenverachtung
des kaiserlichen Regimes zum Inhalt hatten101. Es sind u.a. Lieder wie:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
ኢትዮeያ ትቅደም ityopəyā təqədäm Äthiopien vorwärts!
እልል በይ ሐገሬ ələl bäy agärē Schrei ələl, mein Land!
ያለምንም ደም yalämənəm däm Ohne Blutvergießen!
ተነሳ ተራመድ tänäsā täramäd Steh auf 102 und lauf!
ሕብረሰባዊት ኢትዮeያ həbräsäbawīt ityopəyā Sozialistisches Äthiopien!
መሬት ለአራሹ märēt lä'ārašū Land für die Bauern!
Überall im Land kam es in kürzester Zeit zu einer Flut von politischen Gesängen103, die aus den ver-
schiedenen Bevölkerungsschichten (z.B. Bauern, Arbeiter, Jugend und Frauen) stammten. Sie wurden
vor allem während der Revolution als wichtiges Propagandamittel benutzt und intensiv über die Medi-
en, Rundfunk und Fernsehen, gesendet, so dass andere Musizierformen, wie z.B. Liebeslieder ganz
oder teilweise vernachlässigt und verdrängt wurden. Über die Bedeutung und weitere Entwicklung
polititischer Lieder während dieser Zeit schreibt Eshete (1987: 27) folgendes:
"...in music, the radical transformation was to be seen most vividly in the content of the songs. As far as
tunes or musical composition were concerned, the revolution had not developed sufficiently to penetrate
the creative spirit of our composers, and with very few exceptions, revolutionary songs, frequently sung
by vocalist from the last regime, were adapted to tunes and dances prevalent in pre-revolutionary songs
that remained entirely traditional".
Eines der aus den ersten Revolutionsjahren am meisten gesungenen und bekannten politischen Lieder
ist das Lied tänäsā täramäd:
Text zum Lied tänäsā täramäd
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a ተነሳ ተራመድ tänäsā täramäd Steh auf und maschiere!
2 b ክንድህን አበርታ kəndəhən abärtā Werde stark!
3 a ለአገር ብልፅግና lāgär104 bəlsəgənā Für die Entwicklung unseres Landes
4 c ለወገን መከታ läwägän mäkätā und für den Stolz deines Volkes.
5 d ተነሳ ተራመድ tänäsa täramäd Steh auf und maschiere!
6 e ክንድህን አበርታ kəndəhən abärtā Werde stark!
7 f ለአገር ብልፅግና lāgär bəlsəgənā Für die Entwicklung unseres Landes
8 g ለወገን መከታ läwägän mäkätā und für den Stolz deines Volkes.
99
Diese Denkweise wurde jedoch wenige Jahre später auch von der sozialistischen Diktatur, sogenannt därg {ደርግ}, über-
nommen, die ebenfalls Kunst und Kultur für ihren Ruhm, ihre Machterhaltung und dadurch auch ihr ewiges Bestehen
ausgenutzt und alle anderen Gegner, die nicht ihre Regeln befolgten, mit Gewalt unterdrückt und Gegenaktionen brutal niedergeschlagen hat.
100
Die meisten Gesänge waren typische Marschgesänge. Es gab aber auch diverse andere Gesangsformen mit differenzierten
rhythmischen Abläufen. 101
Diese Freiheit hielt jedoch nur wenige Jahre aufrecht. 102
männlich 103
Schätzungsweise wurden innerhalb von wenigen Jahren über 1000 politische Gesänge (ein Großteil davon in amarəñā-
Sprache) neu erfunden (siehe Eshete 1987: 26). 104
Vollständiges Wort lautet lähagär.
2. Abschnitt
9 h ሀ ሁ hā - hū (Redundanz)
i ኢትዮeያ ትቅደም ityõpyā təqdäm Äthiopien vorwärts!
10 h ሀ ሁ hā - hū (Redundanz)
i ኢትዮeያ ትቅደም ityõpyā təqdäm Äthiopien vorwärts!
i1 ኢትዮeያ ትቅደም ityõpyā təqdäm Äthiopien vorwärts!
3. Abschnitt
11 i እንበል ሀሌሉያ ታላቅ የም|ራች
ənbäl halēlūjā
talaq yäməsərač
Lasst uns halēlūjā sagen
für die große Sensation.
12 i1 ከብዙ እስር ዘመን ኢትዮeያ ተፈታች
käbəžu əsər žämän
ityõpya täfätač
Nach langer Gefangenschaft
ist Äthiopien frei.
13 i ኢትዮeያችን ትቅደም ብለን እንገ|ግ|
itõpyačən təqədäm
bəlän əngäsgəsə
Nach dem Motto Äthiopien vorwärts
maschieren wir weiter,
14 i2 ለትውልድ እንዲተርፍ የያዝነው ጥንስስ
lätəwləd ənditärəf
yäyažənäw tənəsəsə
so dass die nächste Generation erfährt,
was wir heute begonnen haben.
Abb. 19: tänäsā täramäd; transkribiert aus dem Gedächtnis
1.4.1.16. Hochzeitslieder
In der Musikkultur der amārā gibt es eine ganze Reihe von Hochzeitsgesängen yäsärg žäfänõč
{የ\ርግ ዘፈኖች}, die sowohl funktional an die einzelnen Abschnitte der Zeremonie gebunden sind
als auch reine Unterhaltungslieder. Sie werden ausführlich im Kapitel 3 behandelt.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Formen von Wechselgesängen sind auch in den Hochzeitsge-
sängen zu finden. Die Art der Beteiligung des Publikums an den Gesängen gilt ebenfalls für die Hoch-
zeitsgesänge.
Die Teilnahme eines jeden Menschen an einer Hochzeitszeremonie der amārā ist wichtig, um eine
gute Hochzeitsatmosphäre zu schaffen und die Brautleute und deren Gäste zu unterhalten. Jeder
Mensch kann sich mit Tanzen, Trillern, Singen oder mit Instrumentenspiel in diesem Fall die auf der
zu Hochzeitsfeiern häufig verwendeten Trommel käbärõ beteiligen, d.h. der gesamte Verlauf basiert
auf einer freiwilligen Beteiligung eines jeden Menschen. Es ist möglich, entweder nur als Zuschauer
den gesanglichen Verlauf zu beobachten, oder als unmittelbarer Teilnehmer etwas zum Gesang beizu-
tragen. Kubik (1983: 316f.) bezeichnet diese zwei Verhaltensweisen zum einen als ein bewegungloses
Dabeisein aber innerliches Mitschwingen und zum anderen als eine nach außen gerichtete motorische
Partizipation.
Es ist ferner typisch, dass jeder Mensch ohne Berücksichtigung seines Alters und Geschlechts an allen
Musikaufführungen bzw. -veranstaltungen teilnehmen kann105 (vgl. Blacking 1967: 32, 191,194). So
können auch Hochzeitslieder von allen Beteiligten der Hochzeitszeremonie gesungen werden. Es ist
auch selbstverständlich, dass fast jeder Teilnehmende, bedingt durch die mündliche Überlieferung,
einen großen Teil des Hochzeitsrepertoires auswendig kennt.
1.4.2. Teil 2: Religiöse Gemeinschafts- und Sologesänge
Im Gegensatz zum žäfän {ዘፈን}, steht der Begriff žēmā {ዜማ}, "Melodie", ausschließlich für religiöse
Gesänge als Oberbegriff. Hierzu zählen:
- Messegesang yäqədassē žēmā የቅዳሴ ዜማ - religiöser Chorgesang yäbētä kəhənät mäžmūr የቤተ ክህነት መዝሙር und
- Preisgesänge yäməsganā žäfänõč የም|ጋና ዘፈኖች
1.4.2.1. Messegesang
Die Geschichte des Kirchengesangs yäqədassē žēmā {የቅዳሴ ዜማ} reicht bis in das 6. Jahrhundert
zurück. In diesem Zeitraum wurde die gesamte Liturgie der Kirche; d.h. sowohl der Gesang als auch
der religiöse Tanz šəbšäbā {ሽብሸባ} von St. Yared (ca. 505-572), dem sogenannten Vater der Kir-
chenmusik, eingeführt. Ein Großteil seiner musikalischen Werke entstand in der Zeit zwischen 558
und 572 unserer Zeit (YMS 1991: 12f.). Hierzu gehört auch das heute noch geltende Notationssytem
der Kirchenmusik.
St. Yared wurde vor allem durch die drei bekannten klassischen Gesangsformen yäžēmā səltoč {የዜማ ስልቶች} bekannt, die als gə'əž{ግዕዝ}, əžəl {ዕዝል} und ararāy {አራራይ} bezeichnet werden. Jede
Gesangsform weist ihre eigenen ästhetischen, musikalischen und funktionalen Merkmale auf
(Shelemay 1989: 169). Die gə'əž-Gesangsform wird in tiefen, die əžəl in mittleren und die ararāy-
Gesangsform in hohen Lagen vorgetragen. Außerdem wird jede Gesangsform zu bestimmten Jahres-
zeiten und Feierlichkeiten gesungen (Gebreyesus, Ermias 1993).
Es ist zu vermerken, dass keine festen Regeln für tonale Dimensionen wie tief, mittel oder hoch beste-
hen (Günther 1970: 411) Kebede (1971: 52) beschreibt dies wie folgt:
105
Die freiwillige Teilnahme an Musikveranstaltungen ohne alters und geschlechtsspezifische Beschränkung ist in der Regel
auch für viele Musikkulturen Äthiopiens typisch. Daneben gibt aber auch streng differenzierte, typische Männer-, Frau-
en- oder Kindergesänge, die nur die Menschen einbezieht, die diese Voraussetzungen erfüllen. Auch bei den amārā gibt
es einige Männer-und Frauengesänge. Diese sind jedoch zahlenmäßig sehr wenig. Die Differenzierung betrifft auch man-
che Hochzeitslieder wie z.B. hay lõgā (typischer Männerlied), əne alsätəm ləğēn (typischer Frauengesang) usw. Trotz ih-
res typischen Charakters als Frauen- oder Männer-gesänge, können die Lieder während eines Wechselgesanges oft von beiden Geschlechtern gesungen werden.
"A singer with a wofram (bass) voice can sing phrases in araray silt in a relatively different range
from a young deacon with an unchanged voice. Since the divisions of tones into octaves, and octaves
into tones an half-tones, is not at all known to Ethiopian traditional theory and performance of music,
the ideas of high and low (Ethiopian Kecin-Wofram) inherent in the three different voices in a group
performance each commence singing in diverse pitches-appropriate for individual voices - and
consequently create heterophony".
Da absolute Tonhöhen also kaum wahrgenommen werden, müssen die drei Gesangsformen eher nach
ihren typischen Intervallverwandtschaften, ihren Oktavregistern, ihren Aufführungsarten und ihren
psychologischen Auswirkungen betrachtet werden (Kebede 1971: 49). Das Meistern der Gesänge er-
folgt lediglich durch langjährige und intensive Erfahrungen und individuelle Fähigkeiten der jeweili-
gen Person.
Im Folgenden sind drei Musikbeispiele angeführt, die von ein und demselben Sänger vorgetragen
worden sind. Es werden dabei die verschiedenen Tonlagen der drei Gesangsformen präsentiert. Haupt-
sächlich soll der Melodieverlauf beobachtet werden:
Abb.20: Gesang: halēlūjā in gə'əž-Stil vgl. 0345.017/2
Der Gesang bewegt sich in der zweiten Version der təžətā-qəñət (s. Abschnitt 1.3.1., Abb. 9, qəñət-
Tonreihe təžətā Version b), deren Tonreihe in der ersten Zeile angegeben ist. Der Tonumfang er-
streckt sich von dem Ton d bis zu dem Ton a' in der mittleren Lage. Der größte Teil der Melodie
bewegt sich im tieferen Bereich, wobei es sich um die Töne fis, gis und a handelt, die insbesonde-
re in den Zeilen 2 und 3 stark vertreten sind. Der Gesang endet in dem zitierten Ausschnitt auf dem
Ton fis, dem Ausgangston der Tonreihe. Der Text ist in der alten äthiopischen gə'əž-Kirchensprache
verfasst und beinhaltet Teile der äthiopischen Kirchengeschichte. Hier erscheint zuerst die Anrufung
halēlūjā, die häufig als Einführung benutzt wird. Der weitere Text ist nur den Kirchendienern ver-
ständlich. Der Gesang wird im Stehen vorgetragen und erfordert die Utensilien Gebetsstock mäqwä-
miā {መÌሚያ} und die Stabrassel sənāsəl {ፅናፅል}, die jeweils in der rechten Hand gehalten wird
und entweder von oben nach unten oder von links nach rechts geschwungen wird.
Abb. 21: Gesang: halēlūjā in əžəl-Stil, vgl. 0345.017/3
Dieser Gesang ist ebenfalls in der təžətā-qəñət (s. Abschnitt 1.3.1., Abb. 9, qəñət-Tonreihe təžətā Ver-
sion a) ausgeführt worden, wobei es sich hier um die mittlere Tonlage handelt. Der Tonvorrat dehnt
sich von dem Ton f' bis zu dem Ton c" aus. Die vielfach eingesetzen Töne sind c', d', f', g'
und a'. Dies ist vor allem in den Zeilen 1, 2 und ab Mitte der Zeile 5 erkennbar. Im Vergleich dazu
kommen die tiefen Töne wie f, g und a weniger vor.
Abb. 22: Gesang: halēlūjā in ararāy-Stil, vgl. 0345.017/4
Im Gegensatz zu den zwei vorhergehenden Gesängen, bewegt sich der Sänger in diesem Gesang ein-
deutig in einer höheren Tonlage. Als Besonderheit ist jedoch zu bemerken, dass der Melodieverlauf
zwei verschiedene Tonreihen hervorbringt. Es handelt sich zwar um eine und dieselbe Tonreihe, und
zwar die təžətā, aber es sind zwei Tonreihen-Varianten vertreten (s. Zeile 1). Einerseits kann der Ton
g' in der ersten Variante und andererseits der Ton c" in der zweiten Variante als Ausgangston für
die Bildung der Tonreihe fungieren. Der Melodieverlauf jedoch neigt mehr zu der 1. Tonreihen-
Variante, und zwar deshalb, weil der Ausgangston g' eine deutlichere Funktion als Zentralton auf-
weist als den Ton c". Außerdem endet der Gesang mit dem Ton g'.
Trotz allem bleibt die Frage offen, ob es sich hier um tonale Differenzierungen handelt, die im weltli-
chen Musikbereich nicht bekannt sind, oder ob es zu den Gesangsregeln, d.h. der Gebrauch von zwei
Tonreihenvarianten innerhalb eines Stückes, dieser Musizierpraxis gehört. Daher bedarf ein solches
Phänomen einer detaillierten Forschung.
In der äthiopisch-orthodoxen Kirche finden zahlreiche Feierlichkeiten statt, die als Hauptfeier, abəy
bä'āl {አብይ በዓል} und kleinere Feier nəūs bä'āl {ንዑስ በዓል} bezeichnet werden. Zu den verschie-
denen Festen gehören auch passende Hymnen und Gesänge, deren Melodien sehr melismenreich sind.
1.4.2.2. Religiöser Chorgesang
Zu dieser Gruppe zählen religiöse Chorgesänge yäbētä kəhənät mäžmūr {የቤተ ክህነት መዝሙር},
die insbesondere von jugendlichen Diakonen (weibliche und männliche) zu Hauptfeierlichkeiten wie
z.B. mäsqäl {መስቀል} und təmqät {ጥምቀት} neben den Messegesängen gestaltet werden. Die Be-
sonderheit solcher Chorgesänge besteht darin, dass sie meistens aus nur zwei sich reimenden Verszei-
len bestehen, die beliebig oft wiederholt werden können. Dabei spielt die Trommel käbärõ {ከበሮ} als
Begleitinstrument eine wichtige Rolle. Es wird dazu geklatscht. Im folgenden Musikbeispiel ist ein
solcher, zyklisch angelegter Chorgesang in der Kirchensprache gə'əž zu verfolgen. Allerdings ist er
nicht von einer Gruppe, sondern von einem Priester solistisch dargestellt worden, um den Melodiever-
lauf genau zu demonstrieren.
Text zum Chorgesang
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Verszeile
1 a እምሰማያት ወረደ əmsämayāt wärädä Gekommen vom Himmel.
2 b ወእም ማርያም ተወልደ ተወልደ
wä'əm marəyam
täwäldä täwäldä
Geboren von Maria.
3 a እምሰማያት ወረደ əmsämayāt wärädä Gekommen vom Himmel.
4 b ወእም ማርያም ተወልደ ተወልደ
wä'əm marəyam
täwäldä täwäldä
Geboren von Maria, geboren.
2. Verszeile
5 c ከመ ይሁን ቤዛ kämä yəhun bēžā Starb,
6 c1 ከመ ይሁን ቤዛ kämä yəhun bēžā starb,
7 d ለሁሉ ዓለም lähulū alämə für die Welt
8 e ለብሰ |ጋ ማርያም läbäsä səga mārəyamə bekleidet in Marias Fleisch106.
106
Der gesamte Inhalt bezieht sich auf Jesus Christus.
Abb. 23: 0345.017/6e Transkription g2 höher
Typisch bei religiösen Chorgesängen ist, dass der Gesang aus Teilen in einem langsamen und einem
schnellen Tempo besteht, wobei der langsame Teil stets mit der 1. und der schnellere mit der 2. Vers-
zeile verknüpft ist107. Die Trommel käbärõ wird während des langsamen Tempos entweder sehr leise
oder gar nicht geschlagen. Auch das Klatschen fehlt. Stattdessen schwenken die am Gesang Beteilig-
ten beide Hände nach links und rechts, um den sogenannten Kirchentanz šəbəšäbā zu tanzen. Beim
schnelleren Tempo dagegen wird die Trommel in einem regelmäßigen Rhythmus kräftiger geschlagen
und es wird geklatscht.
Andererseits ist es aber auch möglich, dass der Gesang in unverändertem Tempo gestaltet wird, wobei
sich die zwei Gesangsteile eben durch die typischen Körperbewegungen (d.h. entweder nur Tanzen
oder tanzend Klatschen), die Gesangsweisen und Trommelschläge (kräftiger oder leiser) voneinander
differenzieren.
1.4.2.3. Preisgesänge
Auf der anderen Seite gibt es religiöse Preisgesänge yäməsganā žäfänõč {የም|ጋና ዘፈኖች}, die
auf der äthiopischen Kastenleier108 bägänā {በገና} begleitet werden. Die bägänā wird heutzutage
nicht mehr unmittelbar in der Kiche gespielt, sondern nur zur Begleitung von solchen Preisgesän-
gen109 außerhalb der Kirche und zwar vor allem während der langen Fastenzeit zu Ostern. Bägänā-
Gesänge bestehen meistens aus zyklisch angelegten Melodien. Im Folgenden ist ein Gesangstext ange-
führt. Im Verlauf des Gesanges werden zwei typische melodische Formeln a-b bzw. a-b1 ständig wie-
derholt. Es bestehen jedoch vielfältige variative Freiheiten in den melodischen Formeln a-b, die ent-
sprechend mit a1, b2, b3 und b4 bezeichnet sind.
107
Es werden entweder beide oder nur die erste Verszeile zweimal wiederholt. Das Musikbeispeil entspricht somit der zwei-ten Gesangsvariante.
108
Der Begriff Kastenleier ist meines Erachtens der passende Begriff für die äthiopische bägänā. Die Bezeichnung Harfe, die
in den Abhandlungen über äthiopische Musik zu finden ist, ist irreführend, da die Harfe eine Konstruktion und Spielwei-
se aufweist, von dem die bägänā völlig abweicht. 109
Ausführliche Beschreibung siehe Kimberlin 1978: 17.
Text zu Nr. 79 abūnä žäbäsämayāt
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a አባታችን abātačən Du, unser Vater
b በሰማዮች ላይ ያለህ bäsämayõč lay yalähə im Himmel!
2 a ተለይቶ täläyətõ Besonders
b1 ይመስገን ክቡር |ምህ yəmasgän kəbūr səməhə soll dein Name gepriesen werden.
3 a መንግ|ትህም mängəstəhəm Dein Reich ist es,
b2 የምንፈልጋት ከጥንቱ yämənfäləgat kətəntū wovon wir stets träumen.
4 a በልጅነት bäləğənät Im jungen Alter
b3 ትምጣ ትሰጠን ዳዊቱ təmtā təsätän dawītū gib uns die Bibel.
5 a ፈቃድህም fəqadəhəm Deine Erlaubnis
b ይህ እንዲደረግ ይሁን yəhə əndidäräg yəhūnə soll dies ermöglichen.
6 a በሰማይም bäsämayəm Im Himmel
b1 ሞተን ተነስተን ክደን motän tänästän kədänə sterben, erwachen und üben wir Verrat.
7 a እንድንኖር əndənənõr Damit wir leben
b ም|ጋናህ ምግብ ሆኖን
məsganah məgəb honõnə durch deinen Segen
8 a ዛሬም በምድር žarem bämdər auch heute auf Erden
b1 በ|ጋ ሕይወት ሳለን bäsəga həyəwõt salänə wo wir mit Leib und Seele leben.
9 a ምግባችንን məgbačənən Unser Brot
b በየቀኑ አውቅህ ሰጠን bäyäqänu awəqäh sətänə gib uns täglich.
10 a ይቅር በለን yəqər bälän Vergib uns,
b1 የበደልንህም ቢኖር yäbädälənəhəm binõrə falls wir dir wehgetan haben.
11 a ወንድማችን wändəmačən Was unser Bruder
b የበደለንን ነገር yäbädälänən nägärə uns angetan hat,
12 a እንደአቅማችን ənədaqəmačən nach unserer Möglichkeit,
b1 እኛም እንድንል ይቅር əñam ənədənəl yəqərə vergeben wir genauso.
13 a በገሀነም bägähanäm In der Hölle
b በክፉ ሁሉ መዓት bäkəfū hullū mä'ātə unter all den bösen Dingen
14 a አትጣለን atətalän lass uns nicht im Stich!
b1 አድነን እነጂ ከሞት adənän ənğī kämõtə Rette uns vor dem Tod!
Das Lied wird in der təžətā-qəñət gesungen, deren Tonreihe G-A-H-d-e ist. Laut Instrumental-
stimmung verläuft jedoch die Tonreihe nicht aufwärts mit den typischen Intervallfolgen g2 (G-A), g2
(A-H), k3 (H-d) und g2 (d-e), sondern in diesem Fall ist der tiefste Ton der Ton d und der höchste
der Ton h also g2, g2, g6 (H-d) und g2 (d-e).
Abb. 24 (s. Nr.79)
Das Lied beginnt zunächst mit einem Instrumental-
vorspiel. Danach fängt der Sänger in Begleitung mit
der bägänā zu singen an. Aufgrund des zyklischen
Charakters des Liedes wiederholen sich die Melodie-
zeilen,
wobei jede Zeile in zwei Teile und zwar a und b und
a und b1, oder bei Variationen a und b2 und a und
b3 gegliedert ist. Dies ist anhand des folgenden No-
tenbeispiels ersichtlich, in dem die typischen Ge-
sangszeilen dargestellt sind:
Was das Instrumentalvorspiel anbelangt, so wird des-
sen Länge vom Spieler bestimmt. Im Allgemeinen
dienen solche Instrumentalvorspiele dem Sänger, Be-
denkzeit für das Singen und für den Liedtext zu ge-
winnen. Aus demselben Grunde kommen auch In-
strumentalzwischenspiele vor.
Im vorliegenden Beispiel verlaufen Instrumental- und Vokalteil heterophon. Der Vokalteil ist abhän-
gig von der Instrumentalbegleitung, so dass er an keiner Stelle von dem Instrument unbegleitet auftritt.
An einer bestimmten Stelle wird die Gesangspause durch die bägänā ergänzt. Dies passiert jeweils am
Ende der 1. melodischen Formel einer Zeile, die von einer Achtel- und einer ¼ Pausen gefolgt wird.
Manchmal werden in der Instrumentalbegleitung die Gestaltelemente mehr variiert als im Vokalteil
vorgegeben. Kimberlin (1978: 18) schreibt darüber folgendes:
"Bägäna and voice perform together, or bägäna may play alone, but the voice is always accompanied
by the instrument".
Das gesungene Lied ist ein Preislied. Die Liedtexte der Preislieder sind oft sehr lang und haben kein
festgesetztes Ende. Sie werden entweder direkt aus der Bibel oder aus Gedichtsammlungen yäqənē
mäsāhəft {የቅኔ መጻሕፍት} entnommen. Aber der Sänger kann auch seine eigenen Texte erfinden,
z.B. Geschichten erzählen, einen Menschen beschreiben, Situationen schildern oder über die Liebe
berichten (Kimberlin 1978: 17). Dies geschieht alles im Rahmen des religiösen Anliegens.
1.4.2.4. Zusammenfassung zu traditionellen Gesängen der Amārā
1. Ihrer Form nach werden Wechselgesänge, einstimmige Gemeinschaftsgesänge und Sologesänge
unterschieden. Die Wechselgesänge können weiter nach Ruf-, Strophen-, Refrain- und Zeilen-
wechselgesang gegliedert werden.
2. Es gibt Gesänge in Zeremonien und Gesänge, die durch den Tagesablauf, den Arbeitsprozess,
bestimmte Personengruppen und ihren Alltag geprägt werden. Gesänge in Zeremonien können
entweder handlungsgebunden sein, z.B. anasgäbām särgäñā (s. Nr. 9) und bər ambār säbäräləwõ
(s. Nr. 20), oder aber unabhängig von zeremoniellen Handlungen erscheinen, z.B. wäläbē wäläbē
(s. Nr. 61) und hõy mälā näš (s. Nr. 26) aus dem Hochzeitsrepertoire.
3. In den Gesängen kann der Text durch feste Vorgaben beschränkt sein wie beispielsweise im būhē-
Gesang der Knaben, aber es gibt ebenso freizügige Textbehandlungen, Textersetzungen und Um-
formulierungen aus verschiedenen aktuellen oder lokalgeschichtlichen Gründen, z.B. in den
ažmārī-Liedern (s. Nr. 76). Allerdings hat der größte Teil der Gesänge feste Textvorgaben.
4. Es gibt Gesänge mit festgelegten, z.B. ančī alälā mudāy (s. Nr. 8) und abäğäš yäñā ləğ (s. Nr. 2),
oder frei handhabbaren Melodien, z.B. əngūrgurõ (s. Nr. 75) und žār-Gesänge (s. Nr. 73). Außer-
dem existieren freimetrische, z.B. lalibälā-Gesänge (s. Nr. 77) und fest metrisierte Gesänge, z.B.
politische Gesänge, Wiegen- und Kinderlieder mit unveränderlichem und veränderbarem Tempo.
Die meisten Gesänge sind jedoch mit festen Melodiebewegungen und festen Metren verbunden,
deren Tempi unveränderlich bleiben.
5. Zu der geringen Anzahl von geschlechts- und altersspezifischen Musizierformen gehören u.a. der
typische mäsqäl-Gesang der Männer (s. Nr. 81), der ənqutātāšə-Gesang der Mädchen (s. Nr. 80)
und das buhē-Lied der Knaben bzw. erwachsener Männer (s. Nr. 78), die in der Tradition weitge-
hend in dieser Form praktiziert werden.
6. Die Gesänge mancher Musizierpraktiken weisen in einigen Details ähnliche Strukturen auf, wie
z.B. die Wechselgesangsform, die Gliederungen zwischen awrāğ und täkäbayõč oder auch einzel-
ne melodische Formeln, aber sie unterscheiden sich in ihren kontextualen Funktionen voneinan-
der, z.B. das zum Neujahr gesungene Lied, abäbayē hõy (s. Nr. 80) und das zum Hochzeitsfest ge-
sungene Lied mīžēwu šəttõ amtā (s. Nr. 48).
7. Andererseits gibt es Musizierpraktiken mit völlig eigenständigen Strukturen. Ein Beispiel ist der
typische Marschrhythmus eines Großteils politischer Gesänge. Dies ist auf einen Fremdeinfluss
zurückzuführen. Im Gegensatz dazu gibt es Musizierpraktiken, die ihre ursprüngliche Form hin-
sichtlich ihres Gesangstextes, ihrer Melodie und ihres Rhythmus' - bis heute beibehalten haben.
Hierzu zählen vor allem religiöse Gesänge wie z.B. Messen, Chöre und Preisgesänge, die mit
bägänā-Begleitung dargestellt werden.
8. Typisch für alle Musizierpraktiken einschließlich des traditionellen Hochzeitsrepertoires ist, dass
ihre Gesangsdauer unbestimmt ist und der gesamte Gesangsablauf von den gegebenen Umständen
und der aktuellen Situation abhängt.
9. Ein weiteres Merkmal ist, dass Feiertage wie ənqutātāšə, buhē und mäsqäl historisch einen religi-
ösen Hintergrund besitzen, aber die zu diesen Anlässen gesungenen Lieder zum größten Teil welt-
liche Lieder sind (Kebede 1971: 73).
10. Unterhaltungsgesänge sind insgesamt nur in einer geringen Anzahl vertreten. Dagegen sind die zu
zeremoniellen Anlässen und Feiertagen aufgeführten Gesänge in der Mehrzahl. Jedoch sind bis
auf Hochzeits-, Bessesenheits-, Messe- und politische Gesänge alle anderen Musizierpraktiken
nicht unmittelbar an eine konkrete Handlung gebunden.
11. Eine allgemeine Erscheinung der Gesänge besteht darin, dass eine große Anzahl im Wechsel zwi-
schen awrāğ und täqäbayõč vorgetragen wird und zwar zum größten Teil in Form von Ruf-
Wechselgesängen und diese unmittelbar durch Klatschen, Tanzen, Trillern und traditionelle Mu-
sikinstrumente wie kərār, masīnqõ, bägänā, wašənt und käbärõ begleitet werden. Nur die Hirten-
lieder werden ausschließlich in Form von Instrumentalstrücken (die Flöte wašənt) dargestellt. In
der folgenden Tabelle ist zu sehen, welche typischen und weitgehend gebräuchlichen Methoden
der Gesangsbegleitung in den verschiedenen Musizierpraktiken erscheinen.
Tab. A: Methoden der Gesangsbegleitung
Gesang begleitet durch
Klatschen
Ololygen
(Frauen)
verschiedene
Tanztypen
Musikinstrumente
ohne
Instr.
ganz
ohne
Begleit.
weltliche Gesänge:
1 Hochzeitsgesänge x x x käbärõ, masinqõ, kərar x
2 Neujahrslieder x x käbärõ
3 mäsqäl-Fest x
4 būhē-Fest x Stöcke als Perkussionsinstr.
5 Dreikönigsfest x x x käbärõ, masinqõ x
6 Heldengesänge x x Körperbewegung masinqõ, käbärõ, kərar x x
7 sanfte Sologesänge x
8 ažmārī-Gesänge
- bei Solodarstellung
- Gesang mit Beglei-
tung
x
x
əskəstā
masinqõ, kərar
masinqõ, kərar
9 lalibälā-Gesänge x
10 Wiegenlieder x
11 Hirtenlieder wašənt
12 Klagelieder x x Körperbewegung x
13 Arbeitslieder x x əskəstā x
14 Kinderlieder x x x
15 politische Lieder x trad. u. europ. Musikinstr. x x
16 Besessenheitsgesänge x Körperbewegung dəbbē, wašənt, masinqõ x x
geistliche Gesänge:
17 Messegesang x šəbšäbā käbärõ x x
18 Religiöser Chorgesang x x šəbšäbā käbärõ
19 Religiöse Preisgesänge bägänā
Die zusammengestellten Merkmale aller vorgestellten Musizierpraktiken werden im Folgenden tabel-
larisch veranschaulicht:
Tab. B: Merkmale der Musizierpraktiken Äthiopiens
Wechselgesänge
Gruppenge-
sang ganz
oder teilw.
Solo-
gesang
in Zeremonien
Unterhal-
tung
Text
Melodie
Metrum
Tempo
Ruf-Wechselg.
Strophen-/Refrain-
Wechselg.
Zeilen-Wech-
selg.
handlungs-gebunden
nicht handlungs-
gebunden
bschränkt unbe-schränkt
frei fest frei fest verän-der-
lich
unver-änder-
lich
weltliche Gesänge:
1 Hochzeitsgesänge x x x x x x x x x x x x x x
2 Neujahrslieder x x x x x x x x
3 Feier der Auffindung des
wahren Kreuzes x x x x x x x
4 būhē-Fest x x x x x x x x
5 Dreikönigsfest x x x x x x x x x x x x
6 Heldengesänge x x x x x x x x x x
7 sanfte Sologesänge x x x x x x x
8 ažmārī-Gesänge x x x x x x x x x x x x x x
9 lalibälā-Gesänge x x x x x x
10 Hirtenlieder x x x Instr. Instr. x x x x x
11 Wiegenlieder x x x x x x
12 Klagelieder x x x x x x x x x x
13 Besessenheitsgesänge x x x x x x x x x x x x x
14 Arbeitslieder x x x x x x x x x x x x x
15 Kinderlieder x x x x x x
16 politische Lieder x x x x x x
geistliche Gesänge:
17 Messegesang x x x x x x x x x
18 Religiöser Chorgesang x x x x x x
19 Religiöse Preisgesänge x x x x x x x
2 . H O C H Z E I T S B R Ä U C H E D E R A M Ā R Ā
Die Ehe ist eine Gemeinschaft, bestehend aus einem Weib und einem Mann, die sich durch ihre Liebe zu
einem Leib und einer Seele vereint haben und auch so bis zu ihrem Tode gemeinsam leben. In der Religi-
onsgeschichte (1. Mose 1: 27-28; 2: 18 und 22-24) fing der Bund der Ehe mit Adam und Eva an. Über die
Ehe sprach der Apostel Petrus (Epheser 5: 28-32; Mose 1. Mose 2:24) folgendes:
" So sollten auch Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich
selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlas-
sen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß 110 ".
Der Ehebund, der in fast allen Kulturen Äthiopiens durch die Eltern bestimmt wird (Wegayehu 1987: 1),
wird als heilig betrachtet, geschätzt und respektiert. Die Gesetze bezüglich der Ehe deuten daraufhin, dass
die Ehe eine sehr wichtige soziale Institution ist. Die Ehe kann man nach Äthiopischem Gesetz nicht will-
kürlich und einfach schließen und nicht willkürlich scheiden bzw. vernichten (Addis Zemen 1988).
Die gesetzlichen Voraussetzungen vor einer Eheschließung sind wie folgt aufgelistet:
1. Beide Ehekandidaten müssen das gesetzliche Alter erreichen111, um eine Ehe abzuschlie-
ßen. Laut Gesetz ist somit das minimale Alter für Männer 18 und für Frauen 15 Jahre112.
2. Die Heiratswilligen dürfen in keiner Weise verwandt sein113.
3. Zwischen dem Paar darf keine ungeschiedene Ehe (wenn ein Eheleben zuvor existiert hat)
vorhanden sein114, weil auf eine gesetzlich noch geltende Ehe keine zweite bzw. neue Ehe
geschlossen werden darf115.
4. Beide Ehekandidaten haben das Recht, frei zu entscheiden, ob sie die Ehe miteinander ein-
gehen oder nicht116.
5. Die Heiratswilligen müssen gesund sein117.
110
In der Bibel wird an mehreren Stellen u.a. von der Heiligkeit der Ehe und von Eheleuten, die durch Gott gesegnet sind und
daher nur durch den Tod des einen oder anderen Partners getrennt werden, berichtet. Diese sind u.a. 1. Mose 1:27-28; 2: 18 und 22-24, Matthäus 19: 4-6, Römer 7: 1-3 und Hebräer 13: 4.
111
Artikel 581 des Äthiopischen Gesetzbuches. 112
Die Bestimmung des gesetzlichen Alters ist notwendig, damit keine frühzeitigen Eheschließungen stattfinden. Dies wird je-
doch nicht überall in Äthiopien angenommen. Es bestehen viele Hindernisse, die diese Gesetze nicht praktisch durchsetzen lassen. Die Probleme bestehen darin, dass
a) wenige oder keine Polizeikräfte und Staatsanwälte in den ländlichen Teilen Äthiopiens zur Verfügung stehen. Auch die
Anwesenheit solcher Institutionen hat wenig Wirkung, wenn die Mehrheit des Volkes die Tradition einer frühzeitigen Ehe weiterhin pflegt und fördert und
b) die Erfassung von Geburtsdaten für ganz Äthiopien bislang nicht möglicht geworden ist. Vor allem in dörflichen Gebieten
ist das richtige Alter eines Menschen kaum bekannt. Dies ist auch teilweise in den städtischen Zentren der Fall. Der Grund
liegt darin, dass für die Erfassung solcher Daten keine hinreichenden Institutionen vorhanden sind bzw. über vorhandene Insti-
tutionen wenig aufgeklärt wird. Daher fehlen schriftliche Dokumente. In den Städten werden in geringem Maße Geburtsur-
kunden in Kirchen und Rathäusern ausgestellt. Daher wissen nur Eltern, wie alt ihre Kinder sind (Addis Zemen 1988- hier äthiopischer Kalender/1996 u.Z.).
113
Artikel 582 und 583 des Äthiopischen Gesetzbuches. 114
Im Gegensatz zu der christlichen Religion ist im Islam dieses Gesetz nicht vorhanden, da muslimische Männer mehrere Frau-en heiraten dürfen.
115
Artikel 585 des Äthiopischen Gesetzbuches. 116
Im Gegensatz zu den Städten wird in den ländlichen Gebieten in der Regel eine Eheschließung nicht von den Ehekandidaten,
sondern von deren Eltern entschieden. Insbesondere werden Frauen sehr benachteiligt und haben kaum etwas zu sagen, was
eine Ehe anbelangt. Alle Hochzeitsvorbereitungen werden von den Eltern des Heiratswilligens geplant. Das Paar begegnet
sich meistens am Hochzeitstag zum ersten Mal. Gefallen oder Nichtgefallen steht überhaupt nicht zur Diskussion.
Es gibt auch Fälle, dass Kinder entweder schon vor der Geburt bzw. unmittelbar danach versprochen werden. Eine werdende
Mutter, die vermutlich ein Mädchen zur Welt bringt, gibt ihr Wort bz.w ihr Versprechen schon vor der Geburt ihres Kindes.
Dies bedeutet, falls es ein Mädchen ist, hat dieses Mädchen ein bereits vorgeplantes Eheleben vor sich, von dem sie wahr-scheinlich nie geträumt hat (siehe auch Artikel 586 Äthiopisches Gesetzbuch).
6. Das Paar muss straffrei sein118.
7. Das Paar darf keine Geschlechtskrankheit haben und muss auch in der Lage sein, Ge-
schlechtsverkehr auszuüben119.
2.1. VERSCHIEDENE FORMEN DER EHESCHLIEßUNG
In Äthiopien gibt es je nach dem Ort, der ethnischen Zusammengehörigkeit, der Religion und der Traditi-
on unterschiedliche Arten von Eheschließungen. Davon sind jedoch nur drei Formen120 von dem äthiopi-
schen Gesetz anerkannt und weitverbreitet. Diese sind:
- Standesamtliche Eheschließung {የበሔራዊ ጋብቻ} bəhērāwī gabəččā
- religiöse Eheschließung und {የሃይማኖት ጋብቻ} yähaymanõt gabəččā
- traditionelle Eheschließung {የባሕል ጋብቻ} yäləmād gabəččā
Bevor die standesamtliche Eheschließung ausführlich erläutert wird, sind einige wichtige Punkte im Vo-
raus klarzustellen, die mit dieser Eheschließungsform im Zusammenhang stehen:
Das Volks-Ehrenbuch yähəžəb yäkəbər mäžəgäb {የህዝብ የክብር መዝገብ} ist ein sogenanntes gol-
denes Buch, das man in den verschiedenen In- und Auslandsinstitutionen Äthiopiens (in Städten, Dörfern,
Gemeinden, Rathäusern, Ministerien, Konsulaten121, auf Schiffen122 usw.) findet. In diesem Buch wer-
den gemeldete Informationen bezüglich Geburt, Tod und Eheschließung eingetragen. Diese Informationen
werden der in der Nähe befindlichen Institution zugeschickt, um dann sofort im Buch eingetragen zu wer-
den123.
Das Buch enthält insbesondere ausführliche Informationen über Geburt, Tod und Eheschließung eines
Menschen. Die Eintragungen erfolgen ordnungsgemäß und basieren auf gesetzlichen Bestimmungen. Bei
Unstimmigkeiten bzw. späteren Problemen wird dieses Buch als ein wichtiger Beweis verwendet.
Die Eintragungen sind meistens unumstritten, solange kein Gegenbeweis vorliegt, der auch gerichtlich
bestätigt ist. Bei zweifelhaften Fällen in Bezug auf Geburtsdaten, Todestag oder Eheschließungsdatum
bzw. in allen hiermit zusammenhängenden Fällen wird in diesem Buch nachgeschaut.
Für die Bearbeitung dieses Buches, die Eintragungen und die damit verbundenen Arbeiten und Prozeduren
werden Beamte eingestellt. Diese tragen die Verantwortung für die jeweiligen Institutionen, die solche
Eintragungen aufbewahren. Sie genießen den höchsten Rang und sind die Entscheidungsträger124. Ihre
Aufgabe ist es zu prüfen, ob die Eintragungen ordnungsgemäß erfolgen und auch dafür zu sorgen, dass
diese Dokumente gut aufbewahrt werden. Ferner kontrollieren sie, dass Kunden die nötigen Informationen
aus dem jeweiligen Buch erhalten, die jedoch nur in Kopien ausgehändigt werden dürfen usw125.
Inhalt und Form der Eintragungen erfolgen nach bestimmten Kriterien. Jede Form von Eintragung muss
mit einer Unterschrift und einem Datum des jeweiligen Bearbeiters bestätigt werden. Jedes Eintragungs-
blatt muss entweder in zwei (für Todesfälle) oder in drei Kopien (für Geburts- und Eheschließungsdaten)
vorliegen. Diese Kopien werden dann auch als Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunde anerkannt. Neben der
117
Artikel 614 des Äthiopischen Gesetzbuches. 118
Artikel 369 des Äthiopischen Gesetzbuches. 119
Artikel 590 des Äthiopischen Gesetzbuches. 120
Artikel 577 des Äthiopischen Gesetzbuches. 121
Artikel 57 des Äthiopischen Gesetzbuches. 122
Artikel 58 des Äthiopischen Gesetzbuches. 123
Artikel 59 und 74 des Äthiopischen Gesetzbuches. 124
Artikel 48 Nr. 1 und Artikel 56 Nr. 1 des Äthiopischen Gesetzbuches. 125
Artikel 59 und 60 des Äthiopischen Gesetzbuches.
Unterschrift des Bearbeiters, müssen die Unterschrift/ten der Kunden vorhanden sein. In den Eintragungen
sind Abkürzungen bzw. unleserliches Schreiben nicht erlaubt, da sie sonst ihre Gültigkeit verlieren. Jedes
Buch hat sein eigenes Zeichen bzw. Stempel126.
Für die Bücher gelten folgende Bestimmungen:
1. Die Bücher bestehen aus mehreren Seiten. Es werden nur bestimmte Personen zugelassen, diese Bücher
aufzubewahren. Der Name des einzelnen Bearbeiters mäžgäb yāz {የመዘገብ ያ™} ist daran zu erkennen,
dass er auf die erste Seite geschrieben und mit einer Unterschrift bestätigt wird127.
2. Die Eintragungen erfolgen in Kopien. Danach bekommt der Kunde eine Kopie für seine Unterlagen128.
3. Jedes Volksbuch ist nach einer bestimmten Wohngegend (Bezirk, Gemeinde, Strassen usw.) gekenn-
zeichnet; d.h. jedes Buch ist zuständig für einen bestimmten Ortsteil. Volksbücher, die in Konsulaten auf-
bewahrt werden, werden nach dem Ort, wo sie gegründet sind, gekennzeichnet129.
Bei einer Eheschließung sind folgene Eintragungen nötig:
- Name, Geburtstag und Geburtsort der Ehekandidaten
- Name, Geburtstag und Geburtsort der Trauzeugen
- Name, Geburtstag und Geburtsort der Eltern des Heiratswilligens.
2.1.1. Standesamtliche Eheschließung
Diese Eheschließungsform, genannt bəhērawī gabəččā {በሔራዊ ጋብቻ}, hat keinen langen historischen
Hintergrund wie z.B. traditionelle oder die religiöse Eheschließungen yäləmād gabəččā {የልማድ ጋብቻ}
oder yähaymanõt gabəččā {የሃይማኖት ጋብቻ}. Sie hat sich erst mit der modernen Gesellschaft
entwickelt. Daher wird ein solcher Ehebund vorwiegend in den städtischen Zentren vorgenommen (Weg-
ayehu 1987: 4).
Für die Schließung einer standesamtlichen Ehe werden die folgenden Voraussetzungen benötigt:
Die Heiratswilligen müssen Ledigkeitsbescheinigungen nachweisen, mit denen sie zu einer Antragstellung
beim zuständigen Standesamt zugelassen werden. Dieser Antrag muss spätestens eine Woche vor dem
Hochzeitstag gestellt werden130.
Zur Bestätigung fragt der Standesbeamte das Paar, ob es bereit ist, den Ehebund zu schließen. Danach
fordert er von den Ehekandidaten, Trauzeugen vorzubereiten, die mit ihren Unterschriften im Volksbuch
bezeugen müssen, dass der Ehebund unproblematisch geschlossen werden kann131.
Danach wird der Termin des Hochzeitstages vereinbart. Die Ehe wird an diesem Tag in Anwesenheit der
Trauzeugen (jeweils zwei für jeden Heiratskandidaten), Angehörigen des Brautpaares und dem Standesbe-
amten legal geschlossen132.
Zwischen der standesamtlichen Eheschließung und anderen Eheschließungsformen bestehen einige Unter-
schiede.
Das Besondere einer standesamtlichen Eheschließung besteht darin, dass solange die Heiratswilligen einen
Ehebund schließen wollen und sie die hierfür benötigten Voraussetzungen erfüllt haben, heiraten dürfen.
Bei einer religiösen Eheschließung hingegen müssen sie der gleichen Religionsgemeinschaft angehören.
Bei unterschiedlichen Konfessionen wie beispielsweise zwischen Angehörigen des christlichen und mos-
126
Artikel 79, 80-81, 90-95 und 77-78 des Äthiopischen Gesetzbuches. 127
Artikel 79 des Äthiopischen Gesetzbuches. 128
Artikel 90-95 des Äthiopischen Gesetzbuches. 129
Artikel 77-78 des Äthiopischen Gesetzbuches. 130
Artikel 599 des Äthiopischen Gesetzbuches. 131
Artikel 604 des Äthiopischen Gesetzbuches. 132
Artikel 603 des Äthiopischen Gesetzbuches.
lemischen Glaubens, kann der Ehebund nicht vollzogen werden. Es sei denn, das Paar einigt sich auf eine
Religion seiner Wahl, so dass einer von beiden seine Konfession ändern muss. Auch in der traditionellen
Form der Eheschließung bestehen ähnliche Probleme.
All diese Diskrepanzen tauchen bei einer standesamtlichen Eheschließung jedoch nicht auf. Die Heirats-
willigen können sowohl mit unterschiedlichen als auch mit gleichen Konfessionen heiraten. Auch unter-
schiedliche Nationalitäten sind erlaubt. Es kommt nur darauf an, ob das Paar vollständig mit dem Heiraten
einverstanden ist. Alle Eheschließungen werden demnach je nach den geltenden Gesetzen und Regeln
durch den zuständigen Standesbeamten vollzogen.
Die standesamtliche Eheschließung kann entweder nur in den zuständigen Standesämtern oder in Insti-
tuttionen stattfinden, die hierfür das volle Recht besitzen bzw. nur für solche Tätigkeiten bestimmt sind.
Unabhängig von den bislang erklärten Eheschließungsformen, gibt es diverse andere Formen, die in den
ländlichen Gegenden praktiziert werden. Diese beruhen entweder auf Religion oder auf Sitten und Bräu-
chen der jeweiligen Gegend.
In vielen städtischen Zentren und insbesondere in der äthiopischen Hauptstadt Addīs Abäbā, ist zu be-
obachten, dass ein christliches Ehepaar unmittelbar nach der Vollendung einer standesamtlichen Ehe noch
den religiösen Ehebund, genannt sərə'ātä täklīl {|ርዓተ ተክሊል} vollzieht. Damit hat es zwei Ehe-
schließungsformen wahrgenommen. Für diesen Schritt gibt es zwei Hauptgründe:
a) Der Grund für die standesamtliche Eheschließung besteht darin, dass das Paar diese mit der Entwick-
lung der modernen Gesellschaft zusammenhängenden Eheschließungsform als einen wichtigen
und zuverlässigen Schritt akzeptiert, da die Eheurkunde überall (vor allem international) ihre volle Gültig-
keit besitzt und auch gesetzlich verankert ist. Außerdem ist es ein Zeichen für die Akzeptanz der moder-
nen Gesellschaft.
b) Mit der Schließung der religiösen Ehe andererseits geht das Paar seine religiösen Verpflichtungen ein.
Es kommt allerdings darauf an, wie gläubig das Paar ist. Mit dem religiösen Ehebund schenkt es dem zu-
künftigen Eheleben mehr Achtung und Respekt.
2.1.2. Religiöse Eheschließung
Allgemeines
Diese Form der Eheschließung yähaymanõt gabəččā {የሃይማኖት ጋብቻ} ist rein religiös und wird aus-
schließlich im Rahmen der Kirche durchgeführt. Sie beruht auf den hierfür geltenden Regeln und den er-
forderlichen Voraussetzungen, die das verlobte Paar erfüllen soll. Sie besitzt eine weitzurückreichende
Geschichte.
In Äthiopien werden weitgehend muslimische und christliche Religionen praktiziert, wobei jede Religi-
onsgemeinschaft ihre eigenen Regeln und Vorgehensweisen hat. Daher weichen auch die Formen der Ehe-
schließungen voneinander ab. Das Äthiopische Gesetzbuch (Artikel 579) erläutert, dass eine religiöse
Eheschließung im Allgemeinen nur dann wirksam sein kann, wenn das verlobte Paar dieselbe Religion
hat.
Daher müssen neben den gesetzlichen Voraussetzungen, die für alle Eheschließungsformen gelten, bei den
religiösen Eheschließungen zusätzlich die religiösen Regeln beachtet werden.
Ansonsten sind bei einer religiösen Eheschließung verschiedene Nationalitäten, unterschiedliche ethnische
und traditionelle Herkünfte unerheblich, nur die Einigkeit in der Religion ist entscheidend. Religiöse Ehe-
schließungen werden je nach dem, welchen Glauben das Paar hat, entweder in einer Kirche oder vor ei-
nem moslemischen Gericht šäri'ā {ሼሪያ} vollzogen. Auch Scheidungen können nur durch Erlaubnis die-
ser Institutionen in Kraft treten.
Im Folgenden soll die christliche Form der Eheschließung bei den amārā ausführlich beschrieben werden.
Vorher müssen jedoch die Begriffe täklīl {ተክሊል}, məstīrä täklīl {ም|ጢረ ተክሊል} und qədūs
qūrbān {ቅሱስ ቁርባን} näher erläutert werden:
2.1.2.1. Die Christlich-Orthodoxe Eheschließung
Das Wort täklīl stammt aus dem hebräischen Wort miklõl {ሚክሎል} was soviel bedeutet wie "er/sie wurde
zugedeckt133". Miklõl bedeutet ferner "Ehrenkleidung" und "prachtvolles Geschenk". Das Verb täkällälä
{ተከለለ}, wovon das Wort täklīl auch hergeleitet wird, bedeutet "er wurde angezogen"; "er bekam die Eh-
renkleidung".
Der Begriff täklīl weist auch auf eine königliche Hochzeitszeremonie bzw. eine gesetzliche Eheschließung
hin, die von einem Geistlichen vollzogen wird, und meint eine Ehe, die nicht zerbrechen darf und
darüberhinaus auch ein Eheversprechen beinhaltet, das als qāl kidān134 {ቃል ኪዳን} bezeichnet wird.
Dabei spielte die täklīl-Krone eine wichtige Rolle. Geschichtlich betrachtet gehörten die täklīl-Kronen
früheren äthiopischen Herrschern wie z.B. Kaiser Tewodrõs (1855-1868) und Kaiser Mənilīk (1865-1908),
deren Nachfolgern bzw. Vorherrschern. Nach ihrem Tod wurden die Kronen den verschiedenen Kirchen
übergeben, so dass heutzutage eine Kirche mindestens eine Krone zur Verfügung hat. Gegenwärtig sind in
den historischen Kirchen von Aksūm {አክሱም}, Region Təgrāy, und Lalibälā {ላሊበላ}, Region Wällõ,
uralte Kronen zu bewundern.
Die Bezeichnung täklīl gilt nur im Zusammenhang mit einer religiösen Hochzeitszeremonie135. Zu der
täklīl-Zeremonie gehört auch der kabbā {ከባ}. Der kabbā ist ein geschmücktes weißes Gewand, das den
Brautleuten während der Zeremonie über ihre Hochzeitsbekleidung um die Schultern gelegt wird. Die
täklīl-Zeremonie ist etwas Heiliges und gilt als Zeichen einer ehrenvollen Heirat (Nigussie 1996)136.
2.1.2.2. Das täklīl-Geheimnis
Das Wort für diese Art der Eheschließung bezieht sich auf das Geheimnis der Ehe məstīrä täklīl
{ም|ጢረ ተክሊል} bzw. auf die Art und Weise der religiösen Eheschließung. Diese Ehe findet statt,
damit das Brautpaar seine Eheverpflichtungen einhält und für die Ewigkeit ein Fleisch und eine Seele
bleibt. Diese Zeremonie wird von einem Kirchendiener, z.B. von einem Priester geleitet.
133
wahrscheinlich das Brautpaar 134
Es ist in der Bibel nachzulesen, dass es die Ehschließungsform durch täklīl-Zeremonien bereits zur Zeit des alten Testaments gab (vgl. Psalm: 45).
135
Das Wort täklīl darf nicht mit den Bezeichnungen aklīl {አክሊል} und žäwəd {ዘውድ} verwechselt werden. Alle drei Begriffe
weisen zwar auf ein und dieselbe Krone hin, aber je nach ihrem Gebrauch tragen sie unterschiedliche Bezeichnungen. Der
Begriff täklīl ist ausschließlich mit einer religiösen Hochzeit in einer Kirche verbunden.
Das Wort aklīl ist nur im Zusammenhang mit religiösen Verehrungen zu verwenden. Bei einer solchen Zeremonie bekommen
Diakone und Geistliche, die ihre religiöse Schulung abgeschlossen haben, die aklīl -Krone auf ihre Köpfe gesetzt. aklīl ist wie die Hochzeitszeremonie auch mit einer religiösen Zeremonie in der Kirche verbunden.
Der Begriff žäwəd dagegen wird für die Weihe von Königen verwendet, die zum Kaiser gekrönt werden.
All diese Kronen, die von früheren Königen hinterlassen wurden und zu verschiedenen Zeiten den jeweiligen Kirchen überge-
ben wurden, sind heutzutage Kircheneigentum. Sowohl früher als auch heute dienen diese Kronen auschließlich religiösen Zwecken.
136 Dass die täklīl-Krone ausschließlich religiösen Handlungen dient, ist in der Bibel u.a. 2. Mose 29: 6 und 25: 1 nachzulesen.
Ferner geht man in den Erzählungen zur äthiopischen Geschichte davon aus, dass die für kaiserliche Krönungen verwendete
žäwəd "Krone" in den jeweiligen Kaiserpalästen aufbewahrt und nur zum Zwecke königlicher Zeremonien verwendet wurden.
Verschiedene äthiopische Kaiser haben auch die žäwədõč (Plural zu žäwəd) mit wertvollen Steinen und Verzierungen aus-schmücken lassen. All diese Kronen befinden sich heute in den ältesten und historisch bedeutsamsten Kirchen des Landes.
2.1.2.3. Der heilige Korban
Zur täklīl-Zeremonie gehört auch den sogenannten qədūs qūrbān {ቅዱስ ቁርባን}. Literarisch bedeutet
dieses Wort "Opfergabe", "guter Weizen und Wein", "etwas Besonderes", "Unsichtbares", "Unantastbares", "et-
was Heiliges137".
Den Qūrbān gibt es allerdings nicht nur im Zusammenhang mit einer Eheschließungzeremonie, sondern
auch in vielen anderen religiösen Zeremonien wie z.B. Messen, Gebeten und Taufen. Eine Ehe, die neben
einem täklīl zusätzlich noch mit einem qədūs qūrbān geschlossen wird, muss mehr geachtet und geschätzt
werden. Die äthiopische Zeitschrift für Gesetze (1959: 379-389) erläutert, dass derjenige, der Gottes
Fleisch und Blut ohne psyschiche Vorbereitung, Verstand und Glaube zu sich nimmt, ein Verbrechen
begeht. Daher muss er vor seiner Akzeptanz des Fleisches und Blutes Gottes, genannt səgā wädämū {|ጋ ወደሙ} vollkommen darauf eingestellt und damit einverstanden sein. Dies deutet daraufhin, dass die
qūrbān-Zeremonie ein besonders heiliger Vorgang ist.
Nach einer Eheschließung mit einer täklīl-Zeremonie und einer anschließenden qūrbān-Zeremonie, darf
das Paar sich nicht scheiden lassen. Es ist bis zum Tode nur füreinander bestimmt. Im Falle, dass ein Part-
ner stirbt, heiratet laut Regel der/die Witwer/Witwe nicht mehr wieder (Misginna 1958: 49).
2.1.2.5. Voraussetzungen für eine täklīl-Feier
Die Voraussetzung für eine täklīl-Feier ist, dass die Brautleute sich zum Christentum bekennen und auch
(in der Regel als Kind) bereits getauft worden sind. Es gab zwar bis vor kurzer Zeit keine Taufurkunden,
die eine vorgenommene Taufe bestätigen können, aber es kommt bei den amārā kaum vor, dass ein
Mensch ohne eine Religion (gewöhnlich entweder Islam oder Christentum)138 bleibt und demzufolge
auch einfach ungetauft aufwächst. Jedes getaufte Kind bekommt nach einer stattgefundenen Taufzeremo-
nie in einer Kirche einen christlichen Taufnahmen, der als yäkərəstənā səm {የክር|ትና |ም} bezeich-
net wird. Die Taufnamen139 des heiratenden Paares werden der Kirche bei der Anmeldung bekannt gege-
ben, so dass die Hochzeitsmesse mit den angegebenen Taufnamen gehalten werden kann. Die Messe hält
ein Pfarrer, begleitet von einer Gruppe singender Diakone, die im Durchschnitt ca. 3-4 Stunden dauert140.
Die Voraussetzungen für eine täklīl-Zeremonie bestehen darin, dass die Ehekandidaten
a) Jungfrauen dəngəl {ድንግል} sein müssen, die zum ersten Mal im Leben heiraten
b) sich zum Christentum bekennen und ihre Religion respektieren und
c) sich entschieden haben müssen, ihr bevorstehendes gemeinsames Leben in voller Harmonie und Treue
zu gestalten.
Die Eheschließungsprozedur für eine täklīl-Zeremonie fängt damit an, dass entweder die Heiratswilligen
oder deren Eltern in die Kirche gehen und sich über die täklīl-Ehe mit ihrem Seelsorger yänəsəhā abāt
{የንስሀ አባት} oder einem hierfür zuständigen Geistlichen beraten lassen.
Wenn sie eine positive Antwort bekommen, wird der oberste Kirchendiener um Erlaubnis gebeten und
anschließend ein Termin festgelegt.
Am Hochzeitstag erscheinen die Brautleute in Begleitung ihrer Verwandten, Bekannten und Freunde in
der Kirche, um die religiöse Heiratszeremonie zu vollziehen.
137
Siehe ausführliche Beschreibung unter den folgenden Angaben in der Bibel: 1.Korinther 11: 23-30, 10: 14-20; 3. Mose: 1-9;
Markus 7: 10; Matthäus 26: 28; Apostel 2: 42 und 20: 7. 138
Die amārā bekennen sich entweder zum Islam oder zum Christentum. Die Religion des Islam verbreitete sich ca. zwischen
dem 6. und 7. Jahrhundert, während das Christentum zum ersten Mal im 4. Jahrhundert nach Christus während des axumiti-
schen Reiches eingeführt wurde. Die muslimische Religion ist insbesondere in den Region Wällõ (Zentraläthiopien) und Harär (Südostäthiopien) weit verbreitet.
139
Die Brautleute (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991) hatten die Taufnahmen wälätä marəyām für die Braut und wäldä giorgīs für den Bräutigam. Es werden bei Taufen nur religiöse Namen vergeben.
140
Bei der Hochzeitsfeier in Addīs Abäbā/1991 dauerte die Hochzeitsmesse vier Stunden.
Vor Beginn der Zeremonie, schließt das Brautpaar einen Ehevertrag ab, der sowohl von beiden Ehehpart-
nern als auch von den Trauzeugen unterschrieben werden muss. Danach bekommen die Brautleute jeweils
eine aus Gold oder Silber hergestellte Krone aklīl {አክሊል}. Kurz darauf wird eine Hochzeitsmesse ge-
halten. Zum Schluss werden die Brautleute einzeln aufgefordert, das Eheversprechen im Namen des Va-
ters und des Sohnes und des heiligen Geistes zu geben. Dabei legen sie die jeweils rechte Hand auf einer
Bibel übereinander. Ist der Bräutigam an der Reihe, so wird seine Hand auf die Hand der Braut gelegt. Is
die Braut an der Reihe, ist es umgekehrt. Der Priester liest kurze Abschnitte aus der Bibel vor141 (Haile
1996), die von Bräutigam und Braut wiederholt werden müssen. Das Eheversprechen beinhaltet, dass die
Brautleute sich für immer gegenseitig lieben, achten und helfen sollen und zwar bis der Tod sie scheidet
(Ayen, Engida, Alene 1988: 16; Wegayehu 1987: 3). Der Originaltext, der zuerst von dem zuständigen
Priester vorgelesen und jeweils vom Bräutigam und danach von der Braut wiederholt wird, lautet wie
folgt:
Text Eheversprechen bei einer religiösen Heirat: 1.Bräutigam: Taufname: hailä gäbrə'ēl {`ይለ ገበርኤል}142
Originalschrift Umschrift Übersetzung
እኔ `ይለ ገበርኤል ənē hailä gäbrə'ēl Ich hailägäbərə'el
አ|ራተ ማርያምን asratä marəyāmən habe asratä marəyām
የሕግ ሚስት ትሆነኝ ዘንድ yähəg mīst təhonäñə žändə als meine gesetztliche Ehefrau
ወድጄ ተቀብያታለሁ wädəğē täqäbəyatalähu liebend akzeptiert.
ስለዚህም səläžihəm Deshalb,
ከዛሬ ጀምሮ käžarē ğämərõ werde ich ihr ab heute
በ|ራዋ ሁሉ bäsərawa hullū in all ihren Beschäftigungen
በተቻለኝ እረዳታለሁ bätäčaläñə ərädatalähu so gut wie möglich helfen.
በሕመà እና በጤናዋ bähəmämwa ənā bätēnawā In Krankheit und Gesundheit,
በደስተታ እነና በሐዘ• ጊዜ bädäsətā ənā bähažänwā gižē in Freude oder Not,
ከስዋ ጋር እሆናለሁ kärsswa gār əhõnalähu werde ich bei ihr sein.
መከነች ሰነፈች በማለት mäkänäč, sänäfäč bämalät Zeugungsunfähig, faul
ይህንን በመሳሰለው ምክንያት ሁሉ
yəhənən bämäsasäläwu
məkənəyat hullū
durch diese
und ähnliche Gründe
በልዑል እግዚአብሄር ትዕዛዝ bälə'ūl əgəžiabəhēr tə'əžāž mit Gottes Befehl
ከእርስዋ በሞት እስክለይ kärsswa bämõt əskläy bis der Tod uns scheidet,
አልተዋትም alətäwatəm werde ich sie nicht verachten,
ወደጄ ተቀብያታለሁና wädəğē täqäbəyatalähunā da ich sie liebend akzeptiert habe.
ስለዚህም በእግዚአብሄ እና səläžihəm bä'əgəžiabəher ənā Deshalb vor Gott und
በተቀደሰችው bätäqädäsäčəwu dem heiligen
በኦርቶዶክሳዊት bäortodokəsawīt orthodoxen
ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ፊት bētä kərəsətiyan guba'ē fītə Kirchenrat
በመሃላ ቃሌን እሰጣለሁ bämähallā qalēn əsätalähu lege ich meinen Eid ab.
Text Eheversprechen bei einer religiösen Heirat: 1. Braut: Taufname: asratä marəyām {አ|ራተ ማርያም}
Originalschrift Umschrift Übersetzung
እኔ አ|ራተ ማርያም ənē asratä marəyām Ich asratä marəyām
`ይለ ገበርኤልን hailä gäbrə'ēlən habe hailägäbərə'el
የሕግ ባል የሆነኝ ዘንድ yähəg bāl yəhonäñə žändə als meinen gesetztlichen Ehemann
ወድጄ ተቀብዬዋለሁ wädəğē täqäbəyewalähu liebend akzeptiert.
ስለዚህም səläžihəm Deshalb,
ከዛሬ ጀምሮ käžarē ğämərõ werde ich ihn ab heute
በ|ራው ሁሉ bäsərawu hullū in all seine Beschäftigungen
በተቻለኝ እረዳዋለሁ bätäčaläñə ərädawalähu so gut wie möglich helfen.
በሕመሙ እና በጤናው bähəmämu ənā bätēnawu In Krankheit und Gesundheit,
141
Unter anderem aus Korinther, Epheser und Paulus (siehe Bibel). 142
Beobachtung/Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991
በደስታው እና በሐዘኑ ጊዜ bädäsətawu ənā bähažänū gižē in Freude oder Not,
ከእርሱ ጋር እሆናለሁ kärssū gār əhõnalähu werde ich bei ihm sein.
በልዑል እግዚአብሄር ትዕዛዝ bälə'ūl əgəžiabəhēr tə'əžāž Mit Gottes Befehl
ከእርሱ በሞት እስክለይ kärssū bämot əskläy dəräs bis der Tod uns scheidet,
ከእርስዋ ጋር እሆናለሁ kärssū gār əhõnalähu werde ich mit ihm bleiben
እታዘዘዋለሁም ətažäžäwalähūm und ihm gehorsam sein.
ስለዚህም በእግዚአብሄ እና səläžihəm bä'əgəžiabəhēr ənā Deshalb vor Gott und
በተቀደሰችው bätäqädäsäčəwu dem heiligen
በኦርቶዶክሳዊት bäortodokəsawit orthodoxen
ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ፊት bētä kərəsətiyan guba'ē fītə Kirchenrat
በመሃላ ቃሌን እሰጣለሁ bämähallā qalēn əsätalähu lege ich meinen Eid ab.
Danach werden die zuvor mit Weihwasser täbäl {ጠበል} eingeweihten und gesegneten Eheringe den
Brautleuten gereicht, so dass sie sich diese gegenseitig anstecken können (Haile 1996).
Mit den aufgesetzen Kronen und in den Gewändern bewegt sich das Brautpaar zuerst zum Altar tabõt
{ታቦት}, wo es für eine Weile niederkniet und betet. Hinterher verlässt es die Kirche begleitet von einer
trillernden und klatschenden Menschenmenge. Am Ausgang werden die Kronen und Gewänder der Kirche
wieder abgegeben143.
Es fällt auf, dass heutzutage immer mehr jüngere Paare kirchlich getraut werden. Dieser Schritt hängt je-
doch in den meisten Fällen nicht mit einer religiösen Überzeugung zusammen, sondern er wird nur aus
Spaß an der attraktiven Show gemacht. Die Buntheit der kirchlichen Zeremonie lockt immer mehr Paare
an und zwar vor allem junge Leute. Wenn Probleme im Eheleben auftauchen und demzufolge eine Schei-
dung notwendig ist, lässt sich das Paar einfach scheiden und es besteht auch weiterhin die Möglichkeit
sich entweder durch das Standesamt trauen zu lassen, oder einen Ehevertrag innerhalb von Familien zu
unterschreiben.
2.1.2.6. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen täklīl- und qūrbān-Zeremonien
Während der täklīl-Zeremonie wird den Brautleuten auch die damit zusammenhängende qūrbān-
Zeremonie angeboten. Sie werden aber nicht gezwungen das səgā wädämū anzunehmen. Sie können sich
entschließen den qūrbān auf einem späteren Zeitpunkt (z.B. beim Erreichen eines hohen Alters) zu ver-
schieben.
Es muss hierbei beachtet werden, dass die täklīl-Feier nur am Hochzeitstag stattfindet, während die
qūrbān-Feier entweder am gleichen Tag oder beliebig später vollzogen wird.
Ein Brautpaar, das die zuvor geschilderten Voraussetzungen nicht erfüllt, wird zwar nicht zu einer täklīl-
Feier zugelassen, aber es kann eine qūrbān-Zeremonie abhalten lassen. Zuvor muss es aber in einer der
erwähnten Formen der Eheschließung verheiratet worden sein. Somit kann es entweder unmittelbar nach
dem Hochzeitstag oder zu einem späteren Zeitpunkt den qūrbān annehmen.
Das Heiraten durch eine täklīl-Zeremonie ist zwar die Grundlage eines heiligen Eheversprechens, aber
vollkommen wird die Ehe erst dann, wenn das Brautpaar dazu auch das Fleisch und Blut akkzeptiert. Aber
da ein täklīl nur für Jungfrauen erlaubt ist, können die nicht jungfräulichen Paare mä'āsäbān {መአሰባን},
die in irgendeiner Form eine Ehe geschlossen haben, ihre Sünde hati'āt {`ጢአት} dadurch bereinigen,
indem sie das Fleisch und Blut annehmen. Danach wird der Ehebund als heilig anerkannt.
Demnach besteht zwischen einer mit täklīl- und einer durch qūrbān-Zeremonie Ehe kein großer Unter-
schied. Desweiteren bedeuten beide Zeremonien, dass der Ehebund der von dem jeweiligen Ehepaar auf
Erden geschlossen wird, im himmlischen Leben genauso heilig bleibt.
143
Beobachtung/Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991
2.1.3. Traditionelle Eheschließung
Die traditionelle Eheschließungsform yäləmād bzw. yäbahəlawī gabəččā {የባሕላዊ ጋብቻ} ist die älteste
der bislang erläuterten Eheschließungsformen. Sie soll mit der Entstehung und Entwicklung der Mensch-
heit verbunden sein. Auch heute werden traditionelle Hochzeiten nicht nur in Äthiopien, sondern in der
ganzen Welt je nach den kulturellen Vorstellungen der jeweiligen Volksgemeinschaft bzw. Gemeinschaft
gefeiert, obwohl sie sich in der Geschichte in ihrer Art und Weise bzw. ihrer Form verändert haben.
Das Äthiopische Gesetzbuch (Artikel 580) beschreibt, dass ein sittlicher bzw. traditioneller Ehebund dann
als abgeschlossen gilt, wenn entweder die Heiratswilligen aus derselben Gemeinschaft stammen und nach
den Regeln dieser Tradition heiraten, oder wenn sie unterschiedliche ethnische Abstammungen haben,
jedoch die Sitten und Bräuche einer der zwei Ehtnien als Grundlage verwenden, um eine dauerhafte eheli-
che Beziehung einzugehen.
Dies bedeutet, dass einer der Heiratskandidaten die Sitten und Bräuche des anderen Partners akzeptieren
und damit auch leben muss.
In Äthiopien beobachtet man solche Ehen mehr in den städtischen Zentren, wo die Kulturen u.a. durch
Heirat vermischt werden. Dagegen herrschen in abgelegenen Dörfern strikte Regeln bei einer Eheschlie-
ßung. Dies bedeutet, dass hier zum größten Teil nur Paare aus derselben kulturellen Gemeinschaft zur
Heirat zugelassen144 werden.
Traditionelle Ehen werden nicht nur in den ländlichen Gegenden geschlossen, sondern auch in Städten wie
beispielsweise Addīs Abäbā. Hier leben unterschiedliche Gemeinschaften zusammen, die zu verschiede-
nen Zeiten aus verschiedenen Gründen ihre Geburtsorte verlassen und sich in der Stadt sesshaft gemacht
haben. Es werden daher verschiedene Kulturen reflektiert. Diese Menschen gewöhnen sich im Laufe der
Zeit an die städtische Kultur und Lebensweise. Sie werden auch durch die Situation direkt oder indirekt
gezwungen sich an das städtische Leben anzupassen und allmählich die Sitten und Bräuche, die Sprache
usw. anzunehmen. Sie werden also von der städtischen Kultur so beeinflusst, dass sie sogar nach und nach
ihre ursprüngliche Tradition verdrängen und die neue Mischkultur akkzeptieren.
Dagegen gibt es auch solche Gemeinschaften in der Stadt, die trotz des städtischen Lebenseinflusses den
Zusammenhalt und die Pflege ihrer Tradition aufrechterhalten und sie auch weiter pflegen. Solche Ge-
meinschaften leben meistens zusammen in einem Stadteil wie z.B. die doržē.
Allgemein dominiert jedoch die städtische Kultur insoweit, dass der überwiegende Bevölkerungsteil die
allgemeinen Sitten und Bräuche der Stadt akkzeptiert und verwendet.
Daher sind viele Hochzeiten zu beobachten, die die städtische Tradition als Grundlage haben, unabhängig
davon, ob das Paar aus derselben oder aus unterschiedlichen ehtnischen Gemeinschaften stammt.
So sind außer den standesamtlichen und religiösen Heiratsformen alle anderen als traditionelle bzw. als
sittliche Eheschließungsformen zu bezeichnen.
Institutionen, die für traditionelle Heiratsformen zuständig sind, sind soziale Institutionen, sogenannte
mahəbärawī taqwamāt {ማሕበራዊ ተÌማት}, deren Entscheidung vom Volk akzeptiert wird. Diese sind
unter anderem Häuptlinge yägõsā märiwõč {የጎœ}, ältere und angesehene Männer aus der Gemeinschaft,
yä'akababī šəmaglewõč {የአካባቢ ሽማግሌዎች}, Eltern der Heiratskandidaten bzw. Familienoberhäupter,
sogenannte yäbäte žämäd gūba'ē {የቤተ ዘመድ ጉባኤ} usw.
144
Teilnehmende Beobachtung bei der šinašha-Gemeinschaft (ehemals šanqəllā); Region Goğām/1994
2.1.3.1. Tradtioneller Ehevertrag der 80 Silbertaler
Außerdem exisitert noch eine Form der traditionellen Eheschließung, die als yäsämanəyā gabəččā
{የሰማንያ ጋብቻ} bezeichnet und mit einem sogenannten yäsämaniyā-Vertrag "Ehevertrag der 80 Silberta-
ler" abgeschlossen wird.
Das Wort sämanəyā bezieht sich auf die Zahl 80. Bei einer solchen Eheschließung wird der Ehevertrag als
yäsämanəyā wəl {የሰማንያ ውል} bezeichnet. Dieser nach rechtmäßigen Vorschriften vorbereiteter Ehe-
vertrag wird von dem heiratenden Paar und den Trauzeugen unterschreiben. Das Paar gibt dabei auch sein
Versprechen, qalä mähallā {ቃለ መሐላ}. Der Ehevertrag und das Eheversprechen dienen als Schutz vor
einer Scheidung.
Eine derartige Eheschließung wird vorwiegend in ländlichen amārā-Gebieten durchgeführt. Hier stehen
kaum Standesämter zur Verfügung. Aufgrund dessen werden traditionelle Eheschließungenformen weiter-
gepflegt. So wie städtische Ehen von einem Standesamt abgeschlossen werden, werden ländliche Ehen
dieser Art u.a. von einem Dorfobersten oder respektierten und ältesten Gemeinde- bzw. Familienmitglie-
dern geschlossen.
Es gibt drei Formen, diese Art Ehe zu schließen. Diese sind:
1. Eine Eheschließung, die von zwei volljährigen bzw. Erwachsenen geschlossen wird.
2. Eine frühzeitige Ehe. In diesem Fall werden insbesondere Mädchen mit frühem Alter verheiratet. Es
werden sogar vor der Geburt eines Kindes bzw. während einer Schwangerschaft Versprechungen ge-
macht (wenn dein Kind ein Mädchen wird, so versprich mir, dass du es
mit meinem Sohn vermählst), die auch ernsthaft gemeint sind und eingehalten werden. Dies
wird gemacht, um eine enge Beziehung durch die Heirat mit der anderen Familie herzustellen. Dafür
wird der Vertrag rechtzeitig abgeschlossen (Mekuria 1997).
3. Die dritte Form ist eine sogenannte Entfürhungsehe yätäläfā gabəččā {የጠለፋ ጋብቻ}. Wenn ein
Mann in eine Frau verliebt ist, sie jedoch nicht heiraten darf (z.B. durch Verweigerung ihrer Eltern),
plant er eine Entführung mit seinen engsten Freunden. Diese Handlung ist gegen das Gesetz, aber wenn
es schon passiert ist, müssen die Eltern ihre Zustimmung geben. Durch eine Ältestengemeinde wird
dann der Ehevertrag geschlossen (Wegayehu 1987: 2f).
Der historische Zusammenhang der Zahl sämanəyā {ሰማንያ} mit einer Ehe besteht darin, dass falls die
Braut oder der Bräutigam im zukünftigen Leben den Eid bricht und die eheliche Beziehung nicht einhält
bzw. diese zur Scheidung bringt, einst 80 Maria Theresia Silberthaler145, genannt tägära bərr {ጠገራ ብረ}, als Strafe zahlen musste. Deshalb wird auch der Ehevertrag als yäsämanəyā wəl {የሰማንያ ውል}
bezeichnet. Diese Summe war für die damalige Zeit unvorstellbar. Aufgrund der hohen Strafsumme wur-
den Ehen aufrechterhalten. Die Strafe wird auch im Ehevertrag notiert und vom Brautpaar unterschrieben
(Mekuria 1997; Gebreyesus 1997).
Nach welchen Kriterien und Voraussetzungen ein solcher Ehevertrag heutzutage geschlossen wird und
welche Strafen dafür gelten, ist nicht bekannt.
2.1.3.2. Eheschließung als Dienstmädchen und Ehefrau zugleich
Das Wort gäräd {ገረድ} bedeutet "Dienstmädchen". Dieses Wort wird in Äthiopien heutzutage nicht mehr
benutzt, da es beleidigend wirkt. Die Dienstmädchen werden als säratäña {\ራተኛ}, Arbeiter, bezeich-
net. Gärädõč (Plural zu gäräd) gehören zu den untersten Schichten der Gesellschaft, die auch am schlech-
testen bezahlt werden oder nur für Hungerlöhne arbeiten. Sie sind zumeist Analphabeten, die ihren Le-
145
Der Maria-Theresia-Silbertaler war von Anfang des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunders in Äthiopien im Verkehr.
bensunterhalt außschließlich durch Hausarbeiten wie Kochen, Wäschewaschen, Reinigen u.a. bei ver-
schiedenen Familien finanzieren.
In den Städten arbeiten im zunehmenden Maße viele junge Mädchen und Frauen als gäräd bzw. säratäñā,
die vor allem wegen der Arbeitsuche ihre ländlichen Wohnorte verlassen haben.
Bezogen auf die Tradition in əndärta (Region Təgrāy) beschreibt Misginna (1958: 49) den Ehebund mit
einer gäräd als die niedrigste Stufe. Für eine solche Eheschließung wird ein einfacher Ehevertrag abge-
schlossen, der nur auf dem Gemeinschaftsleben der beiden Heiratskandidaten beruht. Er wird vorher von
einer Kommission angefertigt und dann von den Ehekanditaten und den Kommissionmitgliedern unter-
zeichnet, die im Falle eines Problems zwischen dem Ehepaar als Zeugen auftreten können, falls der eine
oder andere im Unrecht oder im Recht ist. Misginna (1958: 49) erklärt über die Rechte und Pflichten der
Verheirateten:
"The husband is obliged to pay his wife a certain sum of money annually (30, 50 or even 100 Ethiopian dol-
lars) as well as to provide the means for her living and her clothing. The husband can dissolve the marriage
and send his wife away at any time; also the wife has the right to leave at her will, but at the end of the peri-
od for which her husband has paid her allowance".
Diese Art der Eheschließung deutet daraufhin, dass die Ehefrau allgemein ihrem Ehemann untergeordnet
ist und daher auch begrenzte Rechte besitzt. Sie wird während ihres Ehelebens von ihrem Ehemann, der
zugleich ihr Herr ist, eher als Dienstmädchen betrachtet. Als Ehefrau genießt sie daher weniger Respekt.
Diese Heiratsform wird überwiegend in ländlichen Gebieten gehandhabt.
Des Weiteren werden Kinder, die aus einer solchen Ehe stammen, in der Gesellschaft weniger akzeptiert
und respektiert. Dies ist ähnlich in vielen Kulturen Äthiopiens wie beispielsweise in əndärta:
"In case of devorce the children remain with the mother till three years old, but the father has to provide
them with food and clothing. Sometimes the age of the child is not considered but the strength; he may leave
his mother's home when he is able to lift a fixed quantity of flax. The older children can make a choice
between their mother and fahter; if they choose the mother's side, the father ist not obliged to maintain
them" (Misginna 1958: 49).
Eine solche Eheschließungsform wird zwischen einem Mann und einer Frau entweder mündlich oder
schriftlich geschlossen. Die Frau, die einen Vertrag mit einem Mann abschließt, spielt eine Doppelrolle im
gemeinsamen Leben. Und zwar dient sie ihrem Mann sowohl als Ehefrau als auch als Dienstmädchen. Die
Beziehung hat somit zweilei Seiten; d.h. die Frau ist weder eine vollständig anerkannte Ehefrau noch führt
sie ihre Tätigkeit ausschließlich als Dienstmädchen aus. Gesetzlich ist eine solche Beziehung anerkannt.
Als Dienstmädchen erhält die Frau monatlich oder jährlich ein im Voraus vereinbartes Gehalt. Außerdem
bekommt sie einmal im Jahr neue Kleidung. Anderenfalls hat sie als Ehefrau nicht das Recht auf das Ei-
gentum ihres Mannes. Auch bei einer Scheidung bekommt sie nichts, außer dem zuvor vereinbarten Ge-
halt. Diese Form von Eheschließung ist heutzutage selten (Haile 1996; Mekuria 1997; Gebreyesus; 1997,
Wegayehu 1987: 2).
Außer den bereits genannten Arten von Eheschließungen gibt es bei den amārā noch weitere Formen die
z. B. solche Leute betreffen, deren Ehe bereits geschieden ist und nun eine zweite, dritte oder vierte Ehe
schließen. Solche Eheschließungsformen sind im Gegensatz zu anderen zahlenmäßig sehr gering.
2.1.3.3. Scheinehen und außereheliche Beziehungen
Bei einer solchen Beziehung yäçən gäräd gabəččā {የጭን ገረድ ጋብቻ} handelt es sich um eine Frau, die
zum größten Teil nur zur sexuellen Befriedigung ausgesucht wird. Hier handelt es sich um eine alte Form
von Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die vor allem während des feudal-bürgerlichen Re-
gimes in Äthiopien praktiziert wurde.
Zu jener Zeit wurde eine schöne Frau als Begleiterin ausgesucht, die ihrem Herrn bei seiner Reise sowohl
zum Kochen als auch zur sexuellen Belustigung diente. Sie musste während der Reise dafür sorgen, dass
ihr Herr gutes Essen bekommt. Das Essen musste ausschließlich sie vorbereiten, weil er befürchtete, dass
er eventuell von einem Feind vergiftet werden konnte. Sie musste ihm selbst das Essen servieren und auch
füttern. Daneben musste sie ihn auch sexuell zu Willen sein. Eine Frau, die diese Aufgaben erfüllt, wird
als yäçən gäräd bezeichnet. Das Wort çən bedeutet Oberschenkel und weist auf eine sexuelle Beziehung
hin. Das letzte Wort gäräd dagegen bezieht sich auf die Tätigkeiten als Dienstmädchen.
Die Frau wird von ihren Herren mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht und sie muss überall mit ihm
auftreten. Sie wird auch als Beschützer ihres Herrn bezeichnet. Diese Beziehungsform hat allerdings mit
einer Ehe nichts zu tun (Haile 1996). In solchen Fällen sind die Männer meistens schon verheiratet. Mit
anderen Worten ist die Frau eine Nebenfrau.
2.1.4. Materielle und finanzielle Unterstützung der Hochzeit
In vielen amārā-Gebieten heiratet man nicht, sondern man wird verheiratet. Dabei spielen Eltern eine
große Rolle. Sie entscheiden mit wem und wann ihre Kinder heiraten sollen. Ein wichtiges Problem be-
steht darin, dass man sowohl volljährige als auch nicht volljährige Kinder verheiratet. Im letzteren Fall
heiraten im Durchschnit Mädchen unter 15 und Junge unter 18 Jahren. Die Gründe dafür sind:
1. Der große Wunsch von Eltern mit einer angesehenen und reichen Familie rechtzeitig eine gute und
feste Beziehung eben durch Verheiraten ihrer Kinder einzugehen.
2. Freude und Respekt durch das Verheiraten ihrer Kinder zu genießen, und zwar vor ihrem Tod (Birara
1980: 4).
3. Der Wunsch durch eine übertriebene Hochzeitsfeier den Ruhm seitens der Bevölkerung entgegenzu-
nehmen. Bei dieser Angelegenheit soll man erwähnen, dass eine solche Ausgabe sowohl für die Eltern
als auch für das Brautpaar von keinem Nutzen ist, da man nach der Hochzeit beginnt die finanziellen
Probleme zu spüren.
Es kommt u.a. vor, dass Eltern für solche Zwecke ihr Hab und Gut mitunter sogar ihre Zugtiere, verkau-
fen, die eigentlich ihre Existenz bedeuten. Am Ende geraten sie in einer Sackgasse, so dass sie gezwungen
sind, in städtischen Zentren einzuwandern, um nach Arbeit zu suchen (Birara 1980: 2-5).
Es wäre jedoch vom Vorteil, wenn für das zukünftige Leben des Brautpaars etwas investiert wird, mit dem
es das neue Eheleben anfangen kann, statt das gesamte Geld an einem Tag aus dem Fenster rauszuwerfen.
Das Ausmaß der Feiern unterscheidet sich von Familie zur Familie; d.h. er hängt von dem ökonomischen
Stand der jeweiligen Familie ab. Da jedoch jeder Betroffene versucht die Grenzen seiner Kapazität zu
überschreiten, geriet er anschließend in finanzieller Not.
Ein weiteres Problem ist der Konkurenz, der viele Familien ebenfalls in den finanziellen Ruin treibt. Man
versucht sich gegenseitig herauszufordern.
Der Ruhm, der durch eine solch maßlose Hochzeit erlangt wird, wird auch am Hochzeitstag mit traditio-
nellen Lobgesängen für die feiernde Familie ausgedruckt. Die Texte sind u.a. im Folgenden zu betrachten:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
ከፍ በል ጌታዬ ሰው አይርገጥህ
käfə bälə getayē
säwu ayərgätəhə
Sei geschätzt mein Herr,
lass dich nicht zertreten!
ጥንትም ያባትህ ነው ከላይ መሆንህ
təntəm yabatəhə
kälayə mähonəhə
Es ist seit deinem Vater146 bekannt,
dass du an der Spitze bist.
የቅድመ አያቶችህ ረድኤት ካንተ ቢያደርግህ
yäqədmä ayatõčəhə rädə'ēt
kantä biyadärgəhə
Das Segen deiner Vorfahren
ist in Dir-
አጠገበው ሁሉን ሸኘው እንጀራህ
atägäbäwu hulūn
šäñäwu ənğärahə
Dein Brot sättigte allen
und machte sie zufrieden...usw.
Diese Verse werden für den Veranstalter der Hochzeit (z.B. der Vater der Braut) gesungen. Im Gegensatz
dazu werden Frauen (z.B. die Mutter der Braut) wie folgt verherrlicht:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
እንጀራው ተጋግሮ ከድምድሙ ደርስዋል
ənğärawu tägagrõ
kädəmədəmū därswal
Das gebackene Brot
ist im Korb aufeinander gestapelt.
እንክዋን ከድምድሙ ቢደርስ ከሰማይ
ənkwan kädəmədəmū
bidärs käsämayə
Nicht nur stapeln,
es kann sich sogar bis zum Himmel häufen.
የኔማ.....* ጉዳዩዋ ነው ወይ
yänema.....*
gudayuwa näwu wäyə
Für meine....*
ist es nichts Neues...usw.
* = Hier wird der Name der Frau (z.B. die Brautmutter) erwähnt.
4. Die Angst vor einer bösen Nachrede, wenn das Kind das erwünschte Alter überschreitet ohne verheira-
tet zu werden.
All diese Handlungen sind selbstverständlich mit negativen Konsequenzen verbunden, die vor allem die
Frauen betreffen. Normalerweise bleibt eine jung verheiratete Frau bis sie geschlechtsreif ist von ihrem
Ehemann unberührt. Sie betrachtet ihn sogar wie ihren älteren Bruder. Gemeinsam mit ihrem Ehemann
wohnt sie bei ihrer Schwiegereltern und wächst auch dort auf. Seitens beider Familien wird darauf geach-
tet, dass keine intime Beziehungen bzw. kein Geschlechtsverkehr zwischen beiden stattfindet, bevor das
entsprechende Alter erreicht ist. Dies wird auch im dem Ehevertrag festgelegt. Dennoch gibt es Fälle, bei
denen die Männer diesen Moment nicht mit Geduld abwarten können und ihre Frauen zum Geschlechts-
verkehr zwingen oder mitunter auch vergewaltigen. Dadurch erleidet das Opfer körperliche und seelische
Schäden (Birara 1980: 6f.).
Ein weiteres Problem besteht darin, dass ein Ehepaar sich gewöhnlich erst nach dem Heiraten näher ken-
nenlernt. Die pysischen und psychischen Vorbereitungen auf ein Eheleben fehlen völlig. Es kommt vor,
dass man sich nicht gegenseitig versteht und liebt. Dies führt zu Scheidungen und weiteren sozialen Prob-
lemen.
Der heutzutage in den städtischen Zentren praktizierte Hochzeitsbrauch hat zwei Gesichter, die einerseits
mit europäischen Einflüssen und andererseits mit dem Erhalt der ursprünglichen Tradition in Verbindung
steht147.
Soziale Umwälzungen haben die traditionelle Art und Weise einer Hochzeitsfeier, zum Teil sowohl inner-
lich als auch äußerlich verändert. Ein Beispiel dafür, ist die freie Auswahl des Lebenspartners (bezogen
auf die Braut), die zu früheren Zeiten nicht möglich war.
Heutzutage dürfen jedoch die meisten in der Stadt lebenden amārā-Frauen über den künftigen Lebens-
partner selbst entscheiden. Eine ähnliche Untersuchung diesbezüglich hat Vogels (1988: 30) bei den
146
Das Wort bezieht sich auf die Vorfahren, der gepriesenen Person. 147
Beobachtungen in Addīs Abäbā/1991 und 1997, Bahr Dār, Gondär, und Mäqälē/1997
Dagaaba Frauen in Nordwestghana gemacht. Er berichtet, dass den jungen Frauen ein Mitspracherecht
bei der traditionellen Eheanbahnung zusteht, die
"...weder allein durch Heiratsvermittler noch ausschließlich durch Absprache der betreffenden Väter zu-
stande kommt."
Jedoch ist die Freiheit bei der Partnerwahl für die Dagaaba Frauen nicht durch soziale Veränderungen wie
bei den amārā-Frauen hervorgerufen worden, sondern sie gehört zu ihrer Tradition.
So wie es in vielen modernen Gesellschaften (z.B. Europa) üblich ist, kann also ein Großteil der in der
Stadt lebenden amārā-Frauen ihre Männer vor ihrer Hochzeit treffen und mitunter sogar auch mit ihnen
zusammen wohnen. Allerdings hängt diese Freiheit mit der Einstellung der Brauteltern zusammen, die die
moderne Gesellschaft akzeptiert haben und sich nicht mehr den strengen Bräuchen unterordnen.
Die Vorbereitung eines Hochzeitsfestes nimmt viel Geld, Energie und Zeit in Anspruch. Diese Ausgaben
sind für die betreffenden Familien nicht ohne Folgen. Jedoch werden insbesondere in den ländlichen Ge-
genden solche Familien finanziell und materiell von ihren Nachbarn, Verwandten und Bekannten unter-
stützt. Sie bringen am Hochzeitstag u.a. Essen und Gestränke148 zu dem Veranstaltungsort mit. Es gibt
auch Spenden wie Getreide und Vieh, die vor der Hochzeitsfeier an den Veranstalter übergeben werden.
Heutzutage beobachtet man in zunehmendem Maße, dass am Hochzeitstag auch Geld gesammelt wird,
was bis vor kurzem in der Tradition der amārā ungewöhnlich war. Für diese Aktion werden zwei freiwil-
lige Leute aus der engeren Verwandtschaft ausgesucht, die sich die Aufgaben so teilen, dass der eine das
Geld sammelt und der andere den Namen des Spenders und die gespendete Summe in einer Liste einträgt
(wenn die Möglichkeit dazu besteht). Die Erstellung einer solchen Liste ist sehr wichtig für die Brautleute,
die anschließend das Geld erhalten, da sie wissen müssen, von wem sie unterstützt wurden, um sich später
bei ähnlichen Gelegenheiten zu revanchieren149. Es werden keine festen Summen festgelegt und das
Spenden ist auch keine Pflicht.
Eine solche Aktion lässt vermuten, dass viele Menschen heutzutage nicht mehr in der Lage sind, materiel-
le Hilfe wie z.B. Getreide oder Vieh zu leisten, da dies mit der Zeit unerschwinglich geworden ist. Auf-
grund dessen spendet man eine geringe Summe, die die wirtschaftliche Lage nicht belastet. All die bislang
erwähnten Spendenarten werden als Hochzeitsgeschenk betrachtet (Mekuria 1997).
Im Gegensatz dazu gehören Geldspenden zu Hochzeiten oder anderen großen Veranstaltungen bei den
Təgrāy zur Tradition. Dem Gastgeber stehen Verwandte, Nachbarn und Bekannte fast ausschließlich mit
finanziellen Mitteln zur Seite. Dafür wird am Hochzeitstag ein Korb in der Mitte des Zeltes oder an einem
sichtbaren Platz hingestellt150. Neben privaten Spenden, gibt es auch Zuwendungen von Wohltätigkeits-
organisationen, genannt ədər {እድር}.
148
Auch in der harärē Tradition ist es üblich, zu Hochzeiten Essen und Getränke in Form von Geschenken mitzubringen. Die gegenseitige Hilfe ist eine Selbstständlichkeit (Ali 1994).
149
Beobachtung/Hochzeitsfeier in Bahər Dār/Goğā m/ 150
Beobachtung einer Hochzeitsfeier in Mäqälē/Təgrāy Region.
2.2. VORHOCHZEITSBRÄUCHE
In der Tradition der amārā gibt es außer dem eigentlichen Hochzeitstag sogenannte Vorhochzeitsbräuche,
die bestimmte Bedeutungen haben. Sie beinhalten folgende Aktivitäten, die für das Zustandekommen der
Vermählung eine ausschlaggebende Rolle spielen. Diese sind:
a) Schicken von Gesandten - šəmagəlē mälāk {ሽማግሌ መላክ} und
b) Zeremonie des Überreichens von Hochzeitsgeschenken - tilõš {ጥሎሽ}
2.2.1. Schicken von Gesandten
Es gehört zur Tradition, dass Eltern durch die Heirat ihrer Kinder eine noch engere Beziehung miteinander
eingehen wollen151 (Gebreyesus 1997; Mekuria 1997). Dabei handelt es sich nicht nur um eine freiwilli-
ge Entscheidung des/r Heiratskandidaten, sondern an erster Stelle auch um das Aufrechterhalten des ent-
weder bereits zwischen beiden Familien existierenden Verhältnisses oder der Wunsch sich durch die Ver-
mählung der Kinder kennenzulernen (Gebreyesus 1997; Mekuria 1997). Daher ist die Einwilligung der
Eltern von wichtiger Bedeutung (Ayen, Engeda, Alene 1988: 9; Kebede 1971: 74; Misginna 1958: 50;
Gebreyesus 1997, Mekuria 1997). Murphy (1994: 139), die im Jahre 1966 die äthiopischen Hochlandpro-
vinzen sechs Monate lang zu Fuß bereiste, beschreibt ähnliches:
"Eine Heirat ohne Zustimmung der Eltern würde den schwerwiegenden Fluch der Enterbung nach sich zie-
hen, da durch eine Heirat in erster Linie Familien miteinander verbunden werden sollen und erst in zweiter
Linie Individuen".
Auch Misginna schildert (1958: 50) hinsichtlich der Tradition in əndärtā:
"Parents who think that a good family relationship will be established may ask a family to give its daug-
hter's hand in marriage to their son. In such cases marriage bonds are much respected and lasting".
Wenn die Eltern eines jungen Mannes eine zukünftige Ehefrau für ihren Sohn ausgesucht haben, so über-
prüfen152 sie zuerst,
- ob die Heiratskandidatin gut erzogen wurde
- ob der Status ihrer Eltern dem Wunsch der anderen Familie entspricht
- ob sie schon verheiratet war (Misginna 1958: 50) und,
- ob sie als Hausfrau eine gute Arbeit leisten kann (Misginna 1958: 50).
Dabei wird verlangt, dass sie alle Haushaltstätigkeiten153 beherrscht und als balämuyā {ባለሙያ} be-
zeichnet wird. Denn eine untätige bzw. faule Frau, wird als galämõtā {ጋለሞታ} bezeichnet und dies kann
zur Folge haben, dass sie zu ihren Eltern zurückgeschickt wird und zwar mit anschließender Scheidung
(Mekuria 1997).
Wenn die Überprüfung ein gutes Ergebnisses hat, entscheiden sich die Eltern des Mannes Gesandte,
šəmaglewõč {ሽማግሌዎች} (Plural zu šəmaglē), zu der Brautfamilie zu schicken. Eine Gruppe von diesen
Gesandten besteht gewöhnlich aus zwei bis vier älteren und respektierten Männern aus dem Bekannt-
151
Dies ist auch der Fall in vielen Orten und Traditionen Äthiopiens. 152
Im Gegensatz zu ländlichen Gegenden, geschieht eine solche Überprüfung in den Städten heutzutage sehr selten. Diese Aufga-be wird von Leuten übernommen, die beide Familien gut kennen.
153 Als junges Mädchen lernt sie all diese Tätigkeiten von ihrer Mutter, die verpflichtet ist ihrer Tochter die wichtigsten Haushalts-
arbeiten u.a. Kochen, Wäschewaschen, Nähen und Kindererziehen beizubringen mit dem Ziel, dass sie eines Tages als eine verheiratete Frau selbstständig arbeitet.
schafts- und/oder Verwandtschaftskreis der Eltern des Mannes. Ihre Aufgabe besteht darin, die Brauteltern
um Erlaubnis zu bitten, deren Tochter für die Heirat freizugeben.
An einem, seitens der Eltern des Mannes bestimmten Tages werden die Brauteltern überraschend besucht.
Nach der Begrüßung beider Parteien, findet gewöhnlich ein Dialog zwischen dem Brautvater und den
Gesandten wie folgt statt:
F/A154 Originalschrift Umschrift Übersetzung
BV ምንድን ነው የመጣችሁበት ጉዳይ
məndənäwu yämätačəhubät
gudayə
Was ist der Grund Ihres Daseins?
GS ለጋብቻ አማላጅነት ለመጠየቅ እነዲያው እሺ ቢሉን
lägabəččā amalağənät lənətäyəq
əndäwu əšī bälūn
Um Ihren Erlaubnis zwecks einer
Heirat zu bitten in der Hoffnung,
dass Sie uns nicht enttäuschen.
BV የማነው ልጅ? yämanäwu ləğə Wessen Sohn ist er?
GS የእገሌ yä'əgälē155 ........
BV እስቲ ከዘመድ ከአዝማድ ልማከር
əstī käžämäd ažəmād ləmakär Dann werde ich mich mit meinen
Verwandten darüber beraten.
Die Eltern der Heiratskandidatin lassen sich meistens nach einem Heiratsantrag etwas Zeit, um sich mit
ihren engsten Verwandten über die Sachlage zu beraten (Wegayehu 1987: 7; Misginna 1958: 51; Ayen
Engida, Alene 1988: 10; Mekuria 1997; Gebreyesus 1997). Aufgrund dessen wird ein weiterer Termin
vereinbart, an dem die Brautfamilie bekanntgibt, ob sie mit der Heirat einverstanden ist oder nicht.
Aus der Gruppe der Gesandten wird in der Zwischenzeit ein Verantwortlicher, ein sogenannter yänägär
abāt {የነገር አባት} gewählt, der im Namen der Gruppe spricht und auch alle Pflichten bis zur definitiven
Heirat erledigt.
An dem ausgemachten Tag werden die Gesandten bei ihrer Ankunft herzlich begrüßt. Danach werden
weitere Details besprochen. Der Brautvater stellt die Fragen angesichts der weiteren ehelichen Zukunft
seiner Tochter wie folgt:
F/A Originalschrift Umschrift Übersetzung
BV ምን መተደዳደሪያ አላት mənə mätädadäria alāt? Was für Lebensunterhalt bekommt sie156 ?
GS ይህንን ያህል መሬት ይህንን ያህል ከብት
yəhənə yahələ märät
yəhənə yahələ käbtə
Soviel Land und/oder soviel Vieh157.
BV ጋብቻውን ተስማምቼበታለሁ ዝምድናችንም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ይሆናል
gabəččawun täsmamčebät-
alähu
žəmdənačənəm kämäčewum
gižē yätäbäqä yəhõnāl
Mit der Heirat
bin ich einverstanden und
unser Verhältnis
wird von nun an enger.
BV = Brautvater; GS = Gesandte
Die Gesandten sind gegenüber der Brautfamilie verpflichtet, den künftigen Ehemann ihrer Tochter genau
zu beschreiben. Unter anderem geht es um
- seinen sozialen Status158 und seine Erziehung (Gebre Hiwot 1993; Wegayehu 1987: 6; Gebreyesus
1997; Mekuria 1997).
Es gehört desweiteren auch zur Tradition, die Familienwurzeln beiderseits bis zu sieben Generationen
zurückzuverfolgen, um sicher zu gehen, dass die Heiratskandidaten nicht miteinander verwandt sind
154
F/A = Frage/Antwort GS = Gesandte; BV = Brautvater 155
An dieser Stelle wird der Name der Eltern des Heiratskandidaten genannt. 156
die Braut 157
Es wird genau erläutert, wieviel Land und/oder Vieh dem Paar zur Verfügung stehen wird. 158
In Bezug auf die Tradition in Təgrāy beschreibt Misgana (1958: 50):
"Parents always seek their equal in social status. Crafts men are never allowed to have marital relations with other persons outside their own social class".
(Wegayehu 1987: 7; Ayen, Engeda, Alene 1988: 9; Mekuria 1997). Diese Handlung ist fast in der gesam-
ten Hochlandtradition in gleicher Art und Weise verbürgt. Misginna (1958: 50) schreibt folgendes:
"As everywhere in Christian Ethiopia there is no marriage possible between close relatives - the nearest re-
lationship allowed is seven generations (i.e. in the region Təgrāy)... If it is discovered that the kindred
between already married people is closer than five generations, they have to part."
Anders als bei den amārā, werden Verhandlungen für eine bevorstehende Heirat in əndärtā nicht nur zwi-
schen den šəmaglewõč und dem Vater des Mädchens durchgeführt, sondern der Vater des Bräutigams und
dessen Beichtvater nehmen auch daran teil. Hierzu berichtet Misginna (ebd: 51):
"The party accompanying the father, called šmaglätat159, will act as negotiators and witnesses in the ag-
reement of the betrothal. A reception party is followed by negotiations. After the negotiations are con-
cluded, the father of the boy and his party are assured that their request is granted, the girl's father
saying, "The girl is now yours." Then the boy's father kisses the feet of the girl's parents. This is consi-
dered as a binding act for both families".
Auch bei den harärē {ሐረሬ} gehört es zur Tradition, vor einer Heirat Gesandte zu den Brauteltern zu
schicken, die ähnliche Aufgaben erfüllen sollen, wie die šəmaglewõč in der amārā-Tradition. Bei einer
Zusammenkunft mit den Gesandten spielt vorwiegend der Brautvater sowie seine männlichen Verwandten
und Freunde die Hauptrolle. Das Schicken von Gesandten bei den harärē verläuft folgendermaßen:
Am frühen Morgen werden die Gesandten im Haus der Brauteltern erwartet. Bei den Gesandten handelt es
sich in diesem Fall um männliche Begleiter des Bräutigams, sogenannte arūž mälāq {አሩዝ መላቅ}. Au-
ßerdem gehören auch der Vater, die Onkel und ältere Brüder des Bräutigams zu der Gruppe der Gesand-
ten. Falls jedoch der Vater verstorben ist oder er aus bestimmten Gründen, z.B. Krankheit, zu diesem ent-
scheidenden Moment nicht erscheinen kann, werden die anderen, männlichen Familienmitglieder ge-
schickt.
Im Haus der Braut erwartet der Brautvater mit seinen Freunden, Bekannten und Verwandten (ebenfalls
nur Männer) in einem für diesen Empfang eingerichteten Zimmer die Gäste160.
Die Ankunft der erwarteten Gäste wird von einer trillernden Frauenmenge begrüßt, die außerhalb des
Hauses auf diesen Moment wartet. Die Gesandten bringen eine Kaupflanze çāt {ጫት} und Süßigkeiten
wie Bonbons und Kekse halāwā {ሐላዋ} mit.
Nach der Begrüßungszeremonie wird zunächst ein Gebet fatāh {ፋታህ} gesprochen und anschließend
gefrühstückt. Danach besprechen beide Gruppen die bevorstehende Hochzeit.
Zunächst erwähnen die Gesandten den Grund ihres Kommens. Auf beiden Seiten werden vor dem Beginn
der Verhandlungen zwei Männer gewählt, die je eine Seite vertreten, so dass sich nicht jeder zu Wort mel-
det. Die Vertreter erledigen somit die Heiratsvereinbarungen nach Sitte und Brauch, die auf den Wün-
schen beider Väter basieren.
Der Sprecher seitens des Bräutigams erwähnt den Grund des Besuches und sagt: "Wir sind gekommen, um
ihre Tochter mit unserem Sohn zu vermählen". Dabei wird der Name des Heiratskandidaten erwähnt.
In der Zwischenzeit wird die sich im Nebenzimmer aufhaltende Braut von zwei Freunden ihres Vaters
gefragt, ob sie mit einer Heirat einverstanden ist161. Nach ihrem Einverständnis wird der Heiratsantrag
seitens ihres Vater mit dem Wort rähäbū {ረ,ቡ}, "wir akzeptieren", gebilligt. Ihr Vater befiehlt daraufhin
Parfüm atīr {አጢር} aus einem Nebenzimmer zu holen, das er dann auf jeden Gast aufträgt. Mit diesem
traditionellen Akt bestätigt er die Heirat und seine Zustimmung.
159
Šəmaglätat = Gesandte; ältere Leute 160
Es ist typisch für die harärē, dass man sowohl für solche als auch für andere Anlässe wie z.B. für die Zeremonie des çāt-Kauens auf einem mit Teppichen bedeckten Boden sitzt.
161
In einer Tradition wie die der harärē, in der eine Frau wenige Rechte besitzt, ist die Frage, ob die Braut mit einer Heirat ein-
verstanden ist oder nicht, symbolisch gemeint, da in den meisten Fällen eine Frau nur einen von ihren Eltern gewählten Mann heiraten muss. Dabei ist es unwichtig, ob sie damit einverstanden ist oder nicht.
Die danach folgenden Gespräche und Verhandlungen zwischen beiden Familien werden in arabischer
Sprache niedergeschrieben. Dafür wird eine Person ausgesucht, die sich in dieser Schrift und Sprache gut
auskennt und die dazugehörigen wichtigen Formalitäten bezüglich eines Ehebundes beherrscht. Das Nie-
derschreiben der Ehevereinbarungen geschieht vor allen anwesenden Gästen. Es werden Gesetze und ent-
sprechende Texte aus dem Koran qur'ān {ቁርዓን} gelesen, die den Ehevereinbarungen hinzugefügt wer-
den. Dabei hält der Vortragende die Hand vom Vater des Bräutigams. Außerdem müssen beide Seiten
jeweils drei Zeugen haben, die den gesamten Ablauf verfolgen und am Ende auch die schriftliche Verein-
barung gemeinsam mit den beiden Vätern unterschreiben sollen. Damit wird die Vereinbarung erledigt.
Am Ende bedankt sich der Vater des Bräutigams bei allen Gästen durch Händeschütteln und gegenseitigen
Handkuss162. Danach wird noch einmal das Gebet gesprochen und anschließend verabschieden sich die
Gäste (Ali 1994).
Hinsichtlich der Aufrechterhaltung ihrer Gemeinschaft, achten die harärē sehr darauf, dass möglichst
keine Eheschließungen außerhalb ihrer Stammesgemeinschaft und vor allem außerhalb ihres Glaubens
(Islam) stattfinden163.
Seit der Aufhebung des langherrschenden feudalen Gesellschaftssystems in Äthiopien im Jahre 1974/75
ist zwar die Aufgabe der Mittelsmänner bei den amārā die gleiche geblieben, aber vor allem in den städti-
schen Zentren wird nicht mehr ernsthaft nach der Stammesangehörigkeit, dem Familienstatus oder der -
wurzel gefragt Diese Tatsache hängt mit:
der freien Entscheidung eines zukünftigen Ehepartners, insbesondere im Hinblick auf die Frau,
die weniger Rechte als ihr männlicher Partner hat, und
der zunehmenden Selbständigkeit eines Paares, die mit der selbständigen Entscheidung zur Ehe-
schließung verbunden ist,
zusammen.
Bezüglich des Alters für eine Heirat, werden in vielen dörflichen Gebieten Äthiopiens heute noch Mäd-
chen zwischen 9 und 12 und Jungen zwischen 16 und 20 Jahren verheiratet (Ayen, Engeda, Alene 1988:
9). Insbesondere Mädchen werden meist symbolisch verheiratet, bis sie ein reifes Alter erreichen. Sie
wohnen und wachsen unter anderem bei ihren Schwiegereltern auf, so dass sie gleichzeitig auch ihren
Ehemann mit der Zeit kennenlernen.
In əndärtā werden als Kind verheiratete bzw. zu einer bevorstehenden Heirat kandidierende Mädchen wie
folgt behandelt:
"If a girl is young, she is sometimes taken to the boy's house. This arrangement is called uquba164, pro-
tection. The idea behind this arrangement is that the girl will be able to get acquainted with the family and
her husband-to-be. The girl will not share the bed of the boy. Instead she will sleep with her future
mother-in-law. She will stay there until her father deems it wise to call her" (Misginna 1958: 51).
162
Das gegenseitige Küssen der Hand ist auch in anderen Traditionen Äthiopiens eine Form der Begrüßung oder des Abschieds. Vor allem wird es bei den muslimischen Volksgemeinschaften praktiziert.
163
Eine Tochter bzw. ein Sohn, die/der diese Stammesregeln bricht, wird von den Eltern verflucht und nicht mehr als Kind aner-
kannt. Anisa Ali (1994), mit der ich mehrere persönliche Gepräche über die Harärē Tradition geführt habe, erzählte mir ein-
mal über ihre beiden älteren Schwestern, die als junge Mädchen von den Eltern gewählte Männer zwangsweise heiraten soll-
ten. Am Hochzeitstag jedoch, stellte sich heraus, dass die ältere Braut einen Tag vor ihrer Hochzeit heimlich aus Harär geflo-
hen ist. Die Eltern erkannten erst am Hochzeitstag, dass die eine Braut nicht mehr anwesend ist. Mit großer Enttäuschung
mussten sie den einen Mann wegschicken. (Es war und ist heute noch eine Schande für die Brauteltern geblieben. Damit wur-de auch ihr Ruhm und Ansehen gegenüber dem Stamm ruiniert).
Die andere Schwester sollte aber gegen ihren Willen heiraten. Die geflohene Schwester fing in Addīs Abäbā mit einem neuen
Leben an und später heiratete sie den Mann ihrer Wahl, der allerdings nicht zu ihrem Stamm gehört. Außerdem ist er ein
Christ. Da sie sich in ihrem Heimatland nicht wohlfühlte, verließ sie mit ihrem Ehemann das Land und ließ sich in England
nieder. Heute ist sie Mutter von zwei Söhnen und führt ein fröhliches Leben mit ihrer Familie, obwohl sie von ihren Eltern für
ihre Sünde auf immer verflucht wurde. 164
Uquba = Beschützung
2.2.2. Zeremonie des Überreichens von Hochzeitsgeschenken
Nach Beendigung der wiederholten Verhandlungen zwischen den Familien der Heiratskandidaten, wird
erneut ein Tag vereinbart, an dem die Feier zum qāl masäriā {ቃል ማ\ሪያ} bzw. fətəmətəm
{ፈጥምጥም} stattfindet. Das Wort qāl masär {ቃል ማ\ር} bedeutet "eine Versprechung geltend machen".
Es wird aus dem Begriff qāl kīdān, Liebesbund/Eid, hergeleitet. Der Begriff fətəmətəm stammt aus dem
Verb mäfätatäm {መፈጣጠም}, sich verbinden, und besitzt den gleichen Inhalt wie qāl masär. Heutzutage
benutzt man den Begriff qäläbät bzw. yäqäläbät bä'āl {የቀለበት በዓል}, Verlobungsfeier, zur Markierung
dieses Tages, der in der Regel unabhängig von dem Hochzeitstag gefeiert wird. In beiden Häusern wird
groß gefeiert, gesungen und getanzt.
Die Heiratskandidaten, die von all den bislang erläuterten Verhandlungen nichts und/oder kaum etwas
wissen, werden erst einige Tage vor der Verlobungsfeier jeweils von ihren Eltern über ihre geplante Heirat
informiert. Der Sohn bekommt traditionsgemäß vom Vater den folgenden Satz vermittelt:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
ልጄ እግርህ ለእርካብ እጅህ ለዛብ ስለደረሰ ልድርህ አስቤአለሁ
ləğē əgərəh lä'ərkāb, əğəh
läžāb səlädäräsä lədərəh
asəbē'alähu
Mein Sohn, du hast jetzt das Alter erreicht, in
dem dein Fuß den Steigbügel und deine Hand
die Zügel erreichen können. Daher bist du für
die Heirat reif.
Dagegen übermitteln die Eltern ihrer Tochter den folgenden Satz:
Originalschrift Umschrift Übersetzung
ልጄ ለአቅመ ሄዋን ስለደረስሽ ሶስት ጉልቻ |ሪ
ləğē lä'aqmä hewān səlädäräsəš
sõst guləğğa sərī
Mein Kind, da du jetzt das volljährige
Alter erreicht hast, musst du deine Herd-
steine errichten.
Bis zum Verlobungstag darf das Paar sich nicht sehen. Der Bräutigem ist an diesem Tag traditionsgemäß
verpflichtet, außer für seine Verlobte, genannt əççõña {እጮኛ} auch Geschenke für seine künftigen
Schwiegereltern mitzubringen (Ayen, Engida, Alene 1988:11). Die Geschenke werden zuvor von einer
Kommission bestimmt und müssen dem ökonomischen Stand der gebenden Familie entsprechen. Es kann
jedoch vorkommen, dass seitens der Brautfamilie zu viele Abgaben verlangt werden. Wenn solche Prob-
leme auftauchen, so müssen sich die šəmaglewõč durchsetzen und die Brautfamilie davon überzeugen,
dass die Familie des Bräutigams aus bestimmten Gründen nur eine bestimmte Höhe der Kosten für die
Hochzeitsgeschenke tragen kann (Sharije 1993, Ali 1994).
Zum Beispiel bekommen Brauteltern in Mänž {መንዝ}, Region Šäwā {ሸዋ} u.a. entweder eine zuvor fest-
gelegte Anzahl von Vieh (z.B. Ochsen, Ziegen und Schafe), oder eine bestimmte Menge Getreide und
Geld (Ayen, Engida, Alene 1988: 11; Yeshigeta 1997; Gebreyesus 1997; Shariye 1994). Es kann sich aber
auch ausschließlich um Kleidung handeln, wobei der Vater die sogenannte yä'abāt ləbs {የአባት ልብስ},
Vaterbekleidung, und zwar ein großes, traditionelles Baumwolltuch, das gegen Kälte schützt, das als gābī
{ጋቢ} bezeichnet wird, bekommt und die Mutter eine yä'ənāt ləbs {የእናት ልብስ}, Mütterbekleidung,
erhält und zwar ein ähnliches Baumwolltuch, das etwas dünner als das gābī ist und kūtā {ኪታ} genannt
wird. Die Braut bekommt u.a. ein Armband, eine Kette, einen Ring, Ohrringe, eine Fußkette, ein mühe-
voll per Handarbeit besticktes Gewand, genannt kabbā {ካባ} und traditionelle Bauwollkleider mit farbi-
gen Bordüren und passenden Tüchern, genannt nätälā {ነጠላ}.
Auch in əndärtā bekommen außer der Braut auch ihre Eltern Geschenke. Andererseits jedoch müssen
auch sie Abgaben, wie z.B. Getreide und Vieh an die Familie des Bräutigams, leisten. Erst nach der ge-
genseitigen Geschenkabgabe wird der Hochzeitstag endgültig festgelegt. Den Termin des Hochzeitstages
legt der Brautvater fest. Dieser Termin hängt vom Alter des Mädchens ab, da die meisten Mädchen im
frühen Alter zur Heirat versprochen werden und daher abgewartet werden soll, bis sie ein reifes bzw. voll-
jähriges Alter erreichen. Bis zum Hochzeitstag lernen sich die Verlobten und deren Familien besser ken-
nen (Misginna 1958:51).
Kurz nach der Ankunft des Bräutigams und seinen Begleitern, findet wieder ein symbolisches Frage-
Antwort-Spiel165 zwischen dem Brautvater und den Gesandten insbesondere mit dem Fürsprecher, ge-
nannt yänägär abāt {የነገር አባት}, wie folgt statt:
F/A Originalschrift Umschrift Übersetzung
BV እንክዋን ደህና መጣችሁ ምነው ቆማች“ል?
ənkwan dähəna mätačəhu
mənäwu qomačəhwal
Herzlich Willkommen !
Warum steht ihr da?
GS አባት እና እናት እንድትሆኑን እኛም ልጅ እንድንሆን
abāt ənā ənāt əndətəhonūn
əñam ləğə əndənəhõn
ləğačəhun läləğačən
In der Annahme, dass Sie unser Vater
und unsere Mutter werden und dass
wir zu Ihren Kindern werden.
Ihr Kind für unser Kind166.
BV እጃችሁ ከምን? əğačəhu kämən Was habt ihr in der Hand167 ?
GS ከወርቅ እንክብል ከሸማ ጥቅል
käwärq ənkəbələ
käšäma təqələ
Etwas aus Gold
und Baumwolle168.
BV በሉዋ ጣል ጣል አርጉበት bälu'a talə talə argubät Na, dann zeigt uns mal die Geschenke.
Alle mitgebrachten Geschenke werden vor einem versammelten Publikum ausgestellt und genau nachge-
zählt. Danach tauchen typische Streitigkeiten auf, die auf fehlende bzw. mangelhafte Geschenke verwei-
sen169. Dabei geht es darum, dass z.B.
die Brautangehörigen mit dem einen oder anderen Geschenk nicht einverstanden sind, weil es an-
scheinend von zu geringer Qualität ist, um der Braut als Geschenk präsentiert zu werden. Man
verlangt dann dafür einen entsprechenden Ersatz (z.B. Geld).
irgendein Geschenk oder mehrere Geschenke noch fehlen oder nicht mitgebracht worden sind, die
von dem Bräutigam entweder sofort (ohne Strafe) oder später (mit Geldstrafe) ersetzt werden
müssen usw.170.
Früher waren diese Auseinandersetzungen so ernst gemeint, dass durch die Nichterfüllung des einen oder
des anderen Geschenkes die Verwandtschaft der Braut so weit ging, sie nicht freizugeben. Gegenwärtig
sind diese Konflikte zwar immer noch vorhanden, aber sie finden nur deshalb statt, weil sie zum Brauch-
tum gehören.
Seitens des Bräutigams verspricht ein Verwandter, Bekannter oder ein enger Freund im Namen des Bräu-
tigams bzw. seiner Eltern, dass er die fehlenden Sachen entweder direkt besorgt oder in Form von Geld
ersetzt (Mekuria 1997), so dass sie zu einem späteren Zeitpunkt erbracht werden können. Nachdem das
versammelte Publikum und die Gäste zu einer Übereinstimmung gekommen sind, beginnt die Zeremonie
des Ringetauschens, wobei die Brautleute vor einer Gruppe von älteren Leuten ihr Eheversprechen geben.
Im Gegensatz zu der ländlichen Tradition wird die Übergabe von Hochzeitsgeschenken in den Städten
mittels der mīžewõč (Plural zu mīžē)171 des Bräutigams oder seiner Eltern gemacht. Diese Übergabe ge-
165
Im Gegensatz zu der amārā Tradition, findet sich bei den agäw in der Region Goğām ein ähnlicher Dialog am Hochzeitstag.
Dieser Dialog wird zwischen den mizēwõč des Bräutigams und den für diesen Zweck ausgewählten älteren Leuten aus dem
Verwandschaftskreis der Braut geführt (Ayen, Engida, Alene 1988: 16). 166
Mit anderen Worten bedeutet es: "Wir bitten um Erlaubnis ihre Tochter mit unserem Sohn zu vermählen". 167
Der Brautvater fragt nach den Hochzeitsgeschenken für seine Tochter. 168
Bezieht sich auf Schmuckstücke u.a. Armband, Ring und Kette aus Gold oder Silber und traditionelle Baumwollbekleidungen. 169
Dieser Akt ist auch für viele andere äthiopische Kulturen typisch. 170
Für die Hochzeitsfeier /1991/ dauerte der Streit zwischen den Begleitern des Bräutigams und der Angehörigen der Braut mehr
als vier Stunden. Obwohl sie genügend Geschenke zur Verfügung stellten, wurden im zunehmenden Maß mehr Sachen gefor-
dert, die nicht dabei waren. D.h. man versuchte extra nach den Sachen zu fragen, die nicht vorhanden waren. Am Ende haben
die Gesandten versprochen, dass die fehlenden Sachen in Zukunft erfüllt werden. Jedoch waren alle Streitigkeiten nur als Symbol gedacht und daher nicht ernsthaft gemeint.
schieht gewöhnlich am Vorabend des Hochzeitstages172. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass
entweder ein Paar Monate bzw. Tage zuvor eine Verlobungsfeier organisiert hat oder dass alle Feiern ge-
meinsam am Hochzeitstag zelebriert werden, da es sonst sowohl für beide Elternteile als auch für das ver-
lobte Paar, vor allem wenn es sich selbst finanziert, geldmäßig nicht zu verkraften wäre.
Der Unterschied zwischen den ländlichen und den städtischen Hochzeitszeremonien besteht darin, dass
sich die Heiratskandidaten in den ländlichen Gebieten an dem gesamten Verlauf der Hochzeitsvorberei-
tung wenig beteiligen. Die Verantwortung wird vorwiegend von ihren Eltern und nahestehenden Ver-
wandten übernommen. Auch die Festlegung eines Hochzeitstages wird den Eltern überlassen, die den
Termin unabhängig von Ernte- und Fastenzeiten vereinbaren.
Auf der anderen Seite ist ein Heiratswilliger in städtischen Gegenden, insbesondere in Addīs Abäbā, neben
seinen Eltern unmittelbar beteiligt, was die Verantwortung bzw. Entscheidungen seines Hochzeitsfestes
anbelangt. Es kommt jedoch auch vor, dass er der alleinig Entscheidende ist, wenn
er nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Es kann beispielsweise sein, dass seine Eltern in einer an-
deren Region leben und er aus verschiedenen Gründen, wie Ausbildungs- bzw. Arbeitsaufenthalt,
in die Stadt eingewandert und auch dort ständig wohnhaft,
seine Eltern verstorben sind und er auch keine nahestehende Verwandtschaft hat und
er ökonomisch unabhängig ist, so dass er alleine entscheiden kann, was für ihn und seine zukünf-
tige Frau am besten geeignet ist.
Trotz dieser Tatsache schickt er Mittelsmänner zu den Eltern seiner Verlobten, weil es zum Brauch gehört.
Auch ihre Hochzeitsgeschenke finanziert er in der Regel selbst173. Die Abgabe der Hochzeitsgeschenke
richtet sich oft nur an seine Verlobte. Die Geschenke beinhalten das Hochzeitskleid yämušərā ləbs
{የሙሸራ ልብስ}, andere Bekleidungen, die für weitere Nachfeiern geeignet sind und Schmuckstücke174
(Misginna 1958: 51). Diese werden ebenfalls am Vorabend der Hochzeit von den mīžewõč und anderen
Freunden des Bräutigams175 mitgebracht.
An der Abgabezeremonie von Hochzeitsgeschenken nehmen in der Regel die Brauteltern und die Braut
selbst nicht teil. Der Grund dafür ist unbekannt.
Während der Abgabezeremonie treten ebenso wie in den ländlichen Gegenden Streitigkeiten zwischen
beiden Gruppen auf.
Im Gegensatz zu der gesamten təlõš-Zeremonie der amārā, findet die ähnliche žägän-Zeremonie {ዘገን}
bei den harärē nicht am Vorabend des Hochzeitstages statt, sondern in der Regel ca. ein Jahr vor dem
Hochzeitstag. Die Geschenke werden, ebenfalls wie bei den amārā, von den Begleitern des Bräutigams,
hier arūž mälāq {አሩዝ መላቅ} genannt, mitgebracht. Jedoch findet das öffentliche Vorzeigen von Hoch-
zeitseschenken zum größten Teil nicht statt. Der Grund hierfür liegt darin, dass durch unterschiedliche
Qualitäten von Geschenken in verschiedenen Familien, im Lauf der Zeit eine Art Konkurrenz hervorgetre-
ten ist, die innerhalb der Gemeinschaft keinen guten Eindruck machte (Ali 1994).
Bei den amārā wird dagegen die Tradition des Vorzeigens einzelner Hochzeitsgeschenke und die daraus
resultierende Beurteilung dieser heute noch praktiziert. Nach Beendigung der Abgabe-zeremonie hält dann
ein älterer Verwandter wie z.B. ein Onkel oder ein Großvater oder eine Verwandte wie z.B. eine Tante
oder eine Großmutter eine Rede bzw. ein Schlußwort, wobei er/sie sich für die überreichten Geschenke
bedankt, die abwesenden Heiratskandidaten segnet und alles Gute im bevorstehenden gemeinsamen Ehe-
171
Der mīžē [engl. = best man] ist ein enger Freund des Bräutigams, der bei der Ausrichtung der Hochzeit eine wichtige Rolle
spielt. Nach der Hochzeit besteht ein noch tieferes Verbundenheitsgefühl zwischen dem mīžē und dem Bräutigam. Dieses Ge-fühl ist zwischen der Braut und ihren Brautjungfrauen, die auch mīžē genannt werden, genauso.
172
Hochzeitsfeier Addīs Abäbā,1991. 173
Manchmal kommt es auch vor, dass die Braut ihre Geschenke, die zum təlõš präsentiert werden, zum Teil selbst kauft. Aber alle Geschenke werden symbolisch so dargestellt, als ob sie sie vom Bräutigam geschenkt bekommen hat.
174 Zumeist handelt es sich dabei um Goldschmuck. Bei armen Familien wird auch Silber verschenkt.
175
Es ist eine Gruppe, die ausschließlich aus Männern besteht. Frauen spielen dabei überhaupt keine Rolle.
leben wünscht176. Danach werden die Gäste zum Abendessen eingeladen. Zum Schluss singen und tan-
zen sie für einen Augenblick und verabschieden sich (Ayen, Engida, Alene 1988: 12).
Vorhochzeitsbräuche sind allerdings nicht nur bei den amārā bekannt, sondern u.a. auch bei den harärē,
orõmõ, gurāgē, təgrāy, agäw usw. Zu den Vorhochzeitsbräuchen der harärē zählen außer der genannten
žägän-Zeremonie, die mit dem Übergeben von Hochzeitsgeschenken verknüpft ist, auch noch soganannte
kūšā {ኩሻ} und nīkā-Feierlichkeiten {ኒካ}. Das Wort kūšā bezieht sich auf die Wahl der zukünftigen
Ehefrau und auf die gesamte diesbezügliche Handlung; d.h. auf die Verlobung177. Die Rolle des Wählens
wird nur von Männern vollzogen (Ali 1994)178. Nīkā ist die religiöse Form des Heiratens (Wegayehu
1987: 1).
Kūšā ist eine einfache Zeremonie, die ohne große Vorbereitung stattfindet. Die Gesandten des Bräutigams
bringen an einem zuvor vereinbarten Tag den Ehering, çāt179 und Süßigkeiten, wie zum Beispiel Kekse
und Bonbons, für die Braut mit. Dort werden sie von ihren engsten Verwandten, Bekannten und Nachbarn
erwartet. Die Geschenke und çāt werden gleich an die anwesenden Gäste verteilt. Dies symbolisiert die
Bekanntmachung der Verlobung.
Anschließend gibt es die žägän-Zeremonie. Hier richten sich die Hochzeitsgeschenke nur an die aružīt
{አሩዚት} die Braut.
Die nächste Feierlichkeit, die zu den Vorhochzeitsbräuchen der harärē gehört, ist die sogenannte nīkā, die
religiöse Verlobungsfeier, die von älteren Leuten aus dem Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreisen
beider Elternteile ausgeführt wird. Alle Vereinbarungen, die innerhalb einer nīkā abgeschlossen werden,
haben ihre volle Anerkennung vor dem šärīā {ሸሪያ}, das muslimische Gericht (Ali 1994).
Zu einer nīkā gehört unbedingt das məhrī180 {ምሕሪ}. Es ist ein sicheres Eigentum, das der Ehefrau auf
alle Fälle beim Heiraten zusteht, egal ob später entweder eine Scheidung zustande kommt oder ihr Ehe-
mann stirbt. Vor ungefähr 30 Jahren zählte unter anderem ein Stück Land181 zum məhrī. Heutzutage
allerdings bekommt die Ehefrau entweder Geld in Höhe von ca. 2.000 - 3.000 bərr {ብር}182, oder ein
Haus von ihrem Ehemann.
Die Vorhochzeitsbräuche in der Tradition der harärē wurden früher (vor ca. 30 Jahren) getrennt gefeiert.
Heute werden jedoch alle drei Hochzeitszeremonien und zwar kūšā, žägän und nīkā in vielen Familien an
einem Tag begangen, um Geld zu sparen. Dies hängt vor allem mit zunehmenden wirtschaftlichen Prob-
lemen der Bevölkerung zusammen. Dennoch herrscht stets eine Art Konkurrenz zwischen Familien hin-
sichtlich des Feierns einer Hochzeit. Die eine versucht die andere mit größeren und noch attraktiveren
Hochzeitsfeiern herauszufordern. Daher versucht man mit allen Mitteln ein großes Fest vorzubereiten und
viele Gäste einzuladen.
176
In diesem Fall war es eine ältere Dame aus dem Verwandtschaftskreis der Braut (mütterlicherseits), die das Schlußwort hielt
(Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991). 177
Amārische Bezeichnung, maçät {ማጨት} "sich eine Lebenspartnerin/Ehefrau aussuchen". 178
Auch bei den amārā spielt der Mann eine wichtige Rolle bei der Wahl seiner zukünftigen Ehefrau. 179
Çāt ist eine Pflanze, die zum größten Teil in der Region Harär wächst. Die Blätter dieser Pflanze werden gekaut und dienen somit als Rauschmittel.
180 Über die Verteilung von Eigentum (Erbschaft und Hinterlassenschaft des Ehemannes) bei einem məhrī ist im Koran unter Sure
4 "Die Weiber" ausführlich geschrieben. 181
Dies war vor ca. 30 Jahren bei den harärē möglich, aber heutzutage gibt es kein Stück Land, das als məhrī zu vergeben ist, da
durch die von 1974-1993 herrschende sozialistische Regierung das Privateigentum von Grund und Boden verboten wurde und aufgrund dessen seit dieser Zeit bei den harärē das Vergeben von Land an die Braut nicht mehr vollzogen wird.
182
die äthiopische Währung
2.3. DER HOCHZEITSTAG
In der amārā-Tradition ist der Hochzeitstag einer der wichtigsten Tage im Leben eines jeden Menschen.
Für das heiratende Paar beginnt er mit dem Anziehen der Hochzeitskleidung. Eine Hochzeitsfeier wird in
der Regel durchgehend vom frühen Morgen, ca. 8°° Uhr, bis zum späten Abend, ca. 2°° Uhr gefeiert.
Zu dem gesamten Hochzeitsvorgang werden traditionelle Lieder gesungen. Ein Teil dieser Gesänge ist mit
den verschiedenen Phasen der Hochzeit funktional verbunden, während der andere Teil zu nicht funkti-
onsgebundenen Liedern zählt. Diese sind Gesänge, die zu jeder Phase einer Hochzeit vorgetragen werden
können. Dazu kommen Unterhaltungsgesänge, die aus dem Alltag bekannt sind.
Fast das gesamte Hochzeitsrepertoire wird im Wechsel zwischen dem awrāğ und den täqäbayõč gesungen
und von der Trommel käbärõ {ከበሮ} sowie Klatschen, Trillern und Tanzen begleitet.
In diesem Abschnitt werden ausschließlich funktionsgebundene Hochzeitsgesänge angeführt. Funktions-
gebundene Hochzeitsgesänge sind solche, die zu bestimmten Phasen einer Hochzeit gesungen
werden und sich u.a. auf die Braut, den Bräutigam (oder bezogen auf beide als ein Brautpaar), die
mīžēwõč des Paares, die Hochzeitsgäste und/oder die Brauteltern beziehen. An der Gesamtheit des amāri-
schen Hochzeitsrepertoires ist festzustellen, dass ein Großteil der Gesänge sich auf die Braut bezieht, sie
bewundern, trösten und ermutigen. Dagegen gibt es wenige Lieder, die vom Textinhalt und Titel her direkt
für den Bräutigam gesungen werden.
Zu den funktionsgebundenen Gesängen zählen die folgenden:
Tab. C: Funktionsgebundene traditionelle Hochzeitsgesänge der amārā
Nr. Titel/Originalschrift Umschrift Übersetzung Gesangsinhalt bezogen auf
Braut Bräutigam Begleiter Ho.-gäste Brauteltern
3 አጀባዬ ağäbayē (Redundanz) x
30 እንዳላይሸ əndalayəš Dass ich dich nicht sehe! x
19 ብቅ በይ ከÙዳ bəqə bäy kägwadā Komm aus aus dem Nebenzimmer x x
4 አሁን ደመቅሽ አበባዬ ahūn dämäkəš abäbayē Jetzt strahlst Du meine Blume x x
18 ባልንጀሬ balənğärē Meine Freundin x
7 አም…ል ሸገኑ amərwāl šägänū Deine Umgebung ist schön x
33 እኔ አልሰጥም ልጄን ənē aləsätəm ləğēnə Ich gebe mein Kind nicht weg x
32 እኔ አልሰጥም እቴን ənē alsätəm ətēnə Ich gebe meine Schwester nicht weg x
9 አነናስገበባም \ርገኛ anasgäbām särgäñā Wir lassen keinen Hochzeitsgast hinein x x
24 ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz) x
48 ሚዜው ሸቶ አምጣ mīžēw šəttõ amtā Mīžē bring mal das Perfüm x
27 ይቺ ናት ወይ ሚዜሽ? yəčī nāt wäy mīžešə Ist sie deine Brautjungfrau x x
51 ሙሸሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne Dich x
16 አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten x
47 መሄድዋ ነው mähēdwā näw Sie geht x
62 ወንድምዬ wändəməyē Mein Bruder x
71 ይዝዋት በረረ yəžwāt bärärä Er nahm sie und flog weg x
41 እየበሉ እየጠጡ ዝም əyäbälū əyätätu žəmə Man trinkt und isst, aber man schweigt x
63 የቤተ ዘመዱ yäbätä žämädū Die Verwandtschaft x x x x
40 እቴ ሸንኮሬ ətē šänkõrē Schwester šänkore x
70 የዛሬ ዓመት yäžarē amätə Heut in einem Jahr x x
20 ብር አምባር bər ambār Silbernes Armband x x
42 ኬላው ተሰበረ kēlāw täsäbärä Das Tor ist entzwei x x
1 አበባው በአበባው ላይ abäbāw babäbaw lay Blumen über Blumen x
38 እስቲ አምጣው የደሙን ሸማ əstī amtaw yädämūn šämā Das Bluttuch x
72 ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz) x
37 እስቲ ሸልሙን əstī šäləmūn Bitte beschenken Sie uns x x
50 ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläč Die Braut gewöhnt sich x
Die in Spalte 1 angegebenen Nummern beziehen sich auf die Notationsnummern (siehe auch Repertoireliste, Kapitel 3).
Die in der Liste angeführten Hochzeitsgesänge werden im Folgenden parallel mit dem gesamten Verlauf
einer Hochzeitsfeier183 beschrieben:
2.3.1. Verabschiedung der Braut
Zunächst wird die Braut in ihrem Elternhaus mit Hilfe ihrer weiblichen mīžēwõč angekleidet. Von diesem
Moment an bedrückt sie der Gedanke an den Abschied vom gewohnten Elternhaus ganz besonders. Die
Trennung von den Geschwistern, mit denen sie ihre Kindheit verbracht hat, das Verlassen der Wohnge-
gend und das bevorstehende Eheleben machen sie unruhig.
Mit Ausnahme der Hochzeitskleidung und der dazugehörigen Schmuckstücke, die die Braut an diesem
Morgen anlegt, werden alle anderen Geschenke, die am Vorabend seitens des Bräutigams übersandt wor-
den waren, in Koffer gepackt und zum Abtransport in die neue Wohnung zurechtgelegt.
Beim Anziehen ihrer Kleidung im Nebenzimmer, werden z.B. folgende Lieder gesungen, die auch im
Haus des Bräutigams parallel verlaufen:
Text zu Nr. 3 ağäbayē
Gz. mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አጀባዬ ağäbayē Meine Schöne184,
b T %, əhä (Redundanz)
2 c A አጀባ ሆ•ል ደጅሽ ağäba honwāl däğəšə deine Umgebung sieht schön aus.
d በየት ልይሽ? bäjät ləyəšə Wie kann ich dich sehen?
3 a T አጀባዬ ağäbayē Meine Schöne,
b A %, əhä (Redundanz)
4 c T አጀባ ሆ•ል ደጅሽ ağäba honwāl däğəšə deine Umgebung sieht schön aus.
d በየት ልይሽ? bäjät ləyəšə Wie kann ich dich sehen?
2. Abschnitt
5 e A ደጅሽ däğəsə Deine Umgebung
d1 T በየት ልይሽ? bäjät ləyəšə Wie kann ich dich sehen?
6 e A ደጅሽ däğəsə Deine Umgebung
d1 T በየት ልይሽ? bäjät ləyəšə Wie kann ich dich sehen?
183
Zu beachten ist, dass die Beschreibung einer Hochzeitsfeier in diesem Fall vorwiegend den Verlauf einer städtischen Hoch-
zeitsfeier zeigt (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā 1991). Einige Handlungen weichen von Hochzeitsfeiern in ländlichen amārā-
Gebieten ab. Diese abweichenden Handlungen werden im weiteren Text berücksichtigt und zum Vergleich dargestellt. Im
Großen und Ganzen jedoch sind die wichtigsten Vorgänge einer Hochzeitsfeier im Zusammenhang mit dem Hochzeitsreper-toire und den Körperbewegungen gleich.
184
die Braut
Text zu Nr. 30 əndalayəš185
Gz. mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A እንዳላይሽ əndalayəš Ich kann dich186 nicht sehen.
b T %, əhä (Redundanz)
2 c A እንዳላይሽ əndalayəšə Ich kann dich nicht sehen.
d ወርቁን ጋረዱት እናትሽ wärqūn garädūt ənatəšə Deine Mutter hat dich mit Gold abgedeckt.
3 a T እንዳላይሽ əndalayəš Ich kann dich nicht sehen.
b A %, əhä (Redundanz)
4 c T እንዳላይሽ əndalayəšə Ich kann dich nicht sehen.
d ወርቁን ጋረዱት እናትሽ wärqūn garädūt ənatəšə Deine Mutter hat dich mit Gold abgedeckt.
Nach einer Weile wird das folgende Lied gesungen, dessen Inhalt die Braut auffordert endlich aus dem
Nebenzimmer, wo sie angekleidet wurde, herrauszukommen.
Text zu Nr. 19 bəq bäy kägwādā
Gz. mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እስቲ ብቅ በይ ከÙዳ əstī bəq bäy kägwadā Komm mal aus dem Nebenzimmer!
b ብቅ በይ ከÙዳ bəqə bay kägwādā Komm aus dem Nebenzimmer187!
2 a T እስቲ ብቅ በይ ከÙዳ əstī bəqə bäy kägwadā Komm mal aus dem Nebenzimmer!
b ብቅ በይ ከÙዳ bəqə bay kägwādā Komm aus dem Nebenzimmer!
2. Abschnitt
3 c A ብቅ በይ bəq bäy Komm
d T ከÙዳ kägwādā aus dem Nebenzimmer!
4 c1 A ብቅ በይ bəqə bäy Komm
d T ከÙዳ kägwādā aus dem Nebenzimmer!
In den ländlichen Gebieten, wo vorwiegend ein großer Raum als Wohn-, Ess- und Schlafzimmer verwen-
det wird, wird in einem solchen Fall für die Braut in einer Ecke des Raumes ein kleiner Bereich durch
einen Vorhang abgeteilt, damit sie sich dort in Ruhe ankleiden lässt. Es kommt aber auch vor, dass ihr ein
Nachbarhaus zur Verfügung gestellt wird.
Wenn die Braut kurze Zeit später das Nebenzimmer verlässt und sich in einen größeren Vorraum bzw. in
das Wohnzimmer begibt, wo sie auf den Bräutigam warten soll188, werden folgende Lieder gesungen:
Text zu Nr. 4 ahūn dämäkəš abäbayē
Gz. mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አሁን ደመቅሽ አበባዬ ahūn dämäqəš abäbayē Jetzt strahlst du meine Blume189.
b ደመቅሽ አበባዬ dämäqəš abäbayē Du strahlst meine Blume.
2 a1 T አሁን ደመቅሽ አበባዬ ahūn dämäqəš abäbayē Jetzt strahlst du meine Blume.
b1 ደመቅሽ አበባዬ dämäqəš abäbayē Du strahlst meine Blume.
185
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 186
die Braut 187
Das Musikbeispiel wurde im Haus des Bräutigams aufgenommen. Somit richtet es sichl an den Bräutigam. Der Textinhalt
variiert sich zwischen den Silben bäy, wenn der Gesang sich an die Braut richtet und bäl, wenn der Gesang sich an dem Bräu-tigam richtet.
188
Hochzeitsfeier in Bahər Dār/Goğām 1997. 189
Die Braut wird als Blume bezeichnet. Dasselbe Lied kann auch für den Bräutigam gesungen werden, wenn er sich nach dem Anziehen seiner Hochzeitskleidung sehen läßt.
3 a2 A አሁን ደመቅሽ የእኛ አበባ
ahūn dämäqəš yäña ləğə Jetzt strahlst du meine Blume.
b ደመቅሽ የእኛ አበባ dämäqəš abäbayē Du strahlst meine Blume.
4 a3 T አሁን ደመቅሽ የእኛ አበባ
ahūn dämäqəš abäbayē Jetzt strahlst du meine Blume.
b1 ደመቅሽ የእኛ አበባ dämäqəš abäbayē Du strahlst meine Blume.
2. Abschnitt
5 c A ደመቅሽ dämäqəš Du strahlst
d T አበባዬ yäñā ləğə meine Blume.
6 c A ደመቅሽ dämäqəš Du strahlst
d T አበባዬ yäñā ləğə meine Blume
Von ihren engen Freundinen und mīžēwõč wird sie mit dem folgenden Gesang getröstet:
Text zu Nr. 18 bālənğärē
Gz. mF A/
T
Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ባልንጀሬ bālənəğärē Meine Freundin190
b አይበልሽ ከፋ ayəbäləš käfā sei nicht traurig,
b አይበልሽ ከፋ ayəbäləš käfā sei nicht traurig.
2 c ሁሉም ያገባል በየወረፋ hulūm yagaləbäyäwäräfā Jeder wird mit dem Heiraten dran
sein.
3 a T ባልንጀሬ bālənəğärē Meine Freundin
b አይበልሽ ከፋ ayəbäləš käfā sei nicht traurig,
b አይበልሽ ከፋ ayəbäləš käfā sei nicht traurig.
4 c ሁሉም ያገባል በየወረፋ hulūm yagäbālə bäyäwäräfā Jeder wird mit dem Heiraten dran
sein.
2. Abschnitt
5 a1 A ባልንጀሬ bālənəğärē Meine Freundin,
a2 መሄድ አይቀሬ ነው mähēd ayəqärē näwu man muß gehen.
6 1 T ባልንጀሬ balənəğärē Meine Freundin,
d A ወደ ሶስት ጉልቻ wädä sõst guləčā zu den Herdsteinen.
7 1 T ባልንጀሬ balənəğärē Meine Freundin,
a2 A አይበሉም ዘላለም aybälūm žälaläm man kann nicht immer essen
8 1 T ባልንጀሬ bālənəğärē meine Freundin,
d A የእናትን እንጎቻ yänatən əngõčā das Brot der Mutter.
Ein ähnliches Lied, das zu diesem Augenblick paßt, ist das folgende:
Text zu Nr. 7 amrwāl šägänū
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
b አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
c አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
2 a መደሰቻችን mädäsäčaèčn Unser Freudentag
b ዛሬ ነው ቀኑ žarē näwu qänū ist heute,
c ዛሬ ነው ቀኑ žarē näwu qänū ist heute.
3 a T አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
b አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
c አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
190 die Braut
4 a መደሰቻችን mädäsäčačən Unser Freudentag
b ዛሬ ነው ቀኑ žarē näwu qänū ist heute,
c ዛሬ ነው ቀኑ žarē näwu qänū ist heute.
2. Abschnitt
5 d A አይዞሽ ሙሽሪት ayəžošə mušərît Laß dich trösten unsere Braut
e አይበልሽ ከፋ ayəbäləšə käfa sei nicht traurig.
f አይበልሽ ከፋ ayəbäləšə käfa sei nicht traurig.
6 d ሁሉም ያገባል hulūm yagäbal Alle heiraten
e1 በየወረፋ bäyäwäräfā der Reihe nach,
f1 በየወረፋ bäyäwäräfā der Reihe nach
Auch ihren Familienangehörigen, vorwiegend älteren Damen aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft und
Nachbarschaft einschließlich der Brautmutter, die sich mit dem folgenden Lied ausdrücken, fällt der Ab-
schied sehr schwer.
Text zu Nr. 33 ənē aləsäÓəm ləğēnə
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እኔ አልሰጥም ልጄን ənē alsätəm ləğēnə Ich gebe mein Kind191 nicht weg
b ወርቅ አምባሬን wärq ambarenə mein goldenes Armband.
2 a T እኔ አልሰጥም ልጄን ənē alsätəm ləğēnə Ich gebe mein Kind nicht weg
b ወርቅ አምባሬን wärq ambarenə mein goldenes Armband.
2. Abschnitt
3 c A ልጄን ləğēnə Mein Kind
d T ወርቅ አምባሬን wärq ambarenə mein goldenes Armband.
4 c1 A ልጄን ləğēnə Mein Kind
d T ወርቅ አምባሬን wärq ambarenə mein goldenes Armband.
Geschwister, gleichaltrige Freundinnen und Verwandte der Braut singen den folgenden Text, dessen me-
lodische und rhythmische Struktur mit dem vorhergehenden Gesang vollkommen identisch ist:
Text zu Nr. 32 ənē aləsätəm ətēnə
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እኔ አልሰጥም እቴን ənē alsätəm192 ətēnə Ich gebe meine Schwester nicht weg,
b አብሮ አደጌን abrõ adägänə mit der ich aufgewachsen bin.
2 a T እኔ አልሰጥም እቴን ənē alsätəm ətēnə Ich gebe meine Schwester nicht weg,
b አብሮ አደጌን abrõ adägänə mit der ich aufgewachsen bin.
2. Abschnitt
3 c A እቴን ətēnə Meine Schwester
d T አብሮ አደጌን abrõ adägänə mit der ich aufgewachsen bin.
4 c1 A እቴን ətēnə Meine Schwester
d T አብሮ አደጌን abrõ adägänə mit der ich aufgewachsen bin
191 die Braut 192 Das vollständige Wort lautet əhətēnə. Die Silbe hə wird im Gesang unbetont bzw. mit den nachfolgenden Silben verschmol-
zen.
2.3.2. Empfang des Bräutigams
Zum vereinbarten Termin kommt der Bräutigam begleitet von seinen mīžēwoč und anderen Hochzeitsgäs-
ten ins Haus der Brauteltern. Bei seiner Ankunft193 wird gewöhnlich seitens der Angehörigen der Braut
das folgende Lied gesungen:
Text zu Nr. 9 anasgäbām särgäñā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አናሰገባም \ርገኛ ansəgäbām särgäñā Wir lassen keinen Hochzeitsgast herein.
b እደጅ ይተኛ ədäğ yətäñā Er soll draußen schlafen.
2 a T አናሰገባም \ርገኛ ansəgäbām särgäñā Wir lassen keinen Hochzeitsgast herein.
b እደጅ ይተኛ ədäğ yətäñā Er soll draußen schlafen.
2. Abschnitt
3 c A \ርገኛ särgäñā Hochzeitsgast
d T እደጅ ይተኛ ədäğ yətäñā soll draußen schlafen.
4 c A \ርገኛ särgäñā Hochzeitsgast
d T እደጅ ይተኛ ədäğ yətäñā soll draußen schlafen.
Im gleichen Augenblick versucht die singende Gruppe dem Bräutigam und seiner Begleitung den Eingang
zu versperren, so dass sie keine Möglichkeit haben, das Haus zu betreten. Textinhalte wie beispielsweise
wir lassen keinen Hochzeitsgast hinein sind symbolisch gemeint. Mit diesen Liedern möchte man ausdrü-
cken, dass man die Braut nur widerwillig weggibt und, dass die Trennung von ihr auch schwer sein wird.
Während die Angehörigen der Braut dieses Lied singen und gleichzeitig versuchen, den Eingang zu ver-
sperren, müssen die Begleiter des Bräutigams sich bemühen, diesen Weg so frei zu halten, dass der Bräu-
tigam ins Haus eintreten kann und zu der Braut gelangt. Dabei singen vor allem seine männlichen Beglei-
ter das folgende Lied mit dem Titel hay lõgā194 {ሀይ ሎጋ} das auch an diese und andere typische Phasen
der Hochzeit funktional gebunden ist.
Text zu Nr. 24
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ሀይ ሎጋ ሀይ ሎጋዬ ሆ hay lõgā, hay logayē hõ (Redundanz)
2 b T ሀይ ሎጋ hay lõgā
c A እህም əhəm
b1 T ሀይ ሎጋ ሆ hay lõgā hõ
193 Die Ankunft eines Bräutigams variiert von Hochzeitsfeier zur Hochzeitsfeier. Wenn eine kirchliche Heiratszeremonie geplant
ist, kommt der Bräutigam meistens ca. gegen 10:00 Uhr, damit genügend Zeit für die religiöse Heiratszeremonie (im Durch-
schnitt 2-3 Stunden) zur Verfügung steht und die Brautleute anschließend rechtzeitig zu einem Mittagsessen (gewöhnlich in das
Haus der Brauteltern) zurückkommen können.
Wird jedoch eine kirchliche Heiratszeremonie nicht vorgeplant, so kommt der Bräutigam ca. zwischen 12-13 Uhr zum Mit-
tagsessesn. Nachdem er die Braut aus dem Vorraum geholt hat, begeben sich beide in eine große Zelthalle dās {ዳስ} wo ein
großes Mittagsbüffet und viele eingeladene Hochzeitsgäste auf sie warten (Beobachtung/ Hochzeitsfeiern/Addîs Abäbā 1991
und 1997; Bahər Dãr/Region Goğām 1997). 194
Man kann diesen Gesangsteil nicht übersetzen. Es besteht aus einer Gruppe von Redundanzen, die jedoch während des Singens
mit einer wichtigen Funktion verbunden sind (vor allem mit der Begleitung des Bräutigams) und als Symbol für den männli-
chen Gesang überhaupt stehen. Dennoch können auch Frauen an diesem Gesang teilnehmen, indem sie ihn mit Ololygen (Tril-ler), Händeklatschen und gesanglicher Begleitung ausschmücken.
2. Abschnitt
3 d A %ረ ጎበዝ ärä gobäž (Redundanz)
e T እህም ነው əhəm näwu
4 d1 A %ረ ጎበዝ ärä gobäž
e T እህም ነው əhəm näwu
Dieser Gesang ist ein typischer Männergesang. Er wird meistens nur in Verbindung mit dem Bräutigam
gesungen195. Er kann aber auch zu bestimmten Momenten der Hochzeitsfeier gesungen werden. Außer-
dem wird er allgemein als Kampf- bzw. Kriegslied gesungen.
In der Regel wird dieses Lied entweder auf dem Schlachtfeld gesungen, um die Soldaten zum Kampf zu
animieren, oder nach einem errungenen Sieg auf dem Weg nach Hause. Ferner wird es auch zu großen
Staatsfeierlichkeiten vorgetragen, an denen Helden verehrt werden, die für ihr Vaterland gekämpft haben.
In dem Moment, wo der Bräutigam und seine Begleitung den Raum betreten, in dem die Braut sitzt, wird
das folgende Lied gesungen, das an dem männlichen mižēwõč gerichtet ist:
Text zu Nr. 48 mīžēw šəttõ amtā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A %ረ ሚዜው ሸቶ አምጣ ärä mīžēw šəttõ amtā Oh, Du Begleiter196, hol ein Parfüm
her!
b ሚዜው ሸቶ አምጣ mīžēw šəttõ amtā Begleiter, bring ein Parfüm her!
2 a T %ረ ሚዜው ሸቶ አምጣ ärä mīžēw šəttõ amtā Oh, du Begleiter, hol ein Parfüm her!
b ሚዜው ሸቶ አምጣ mīžēw šəttõ amā Begleiter, bring ein Parfüm her!
2. Abschnitt
3 c A ሚዜው mīžēw Du Begleiter,
d T ሸቶ አምጣ šəttõ amā hol ein Parfüm her!
4 c1 A ሚዜው mīžēw Du Begleiter,
d T ሸቶ አምጣ šəttõ amā hol ein Parfüm her!
Dieser Wechselgesang wird gewöhnlich von Frauen gesungen. Die Begleiter des Bräutigams werden in
diesem Moment seitens der Brautangehörigen gesanglich aufgefordert, Parfüm auf die Gäste zu träufeln.
Das Parfüm müssen sie für diesen besonderen Augenblick rechtzeitig besorgen und mitbringen. Allerdings
verteilen sie das Parfüm erst dann an die Gäste, wenn dieses Lied gesungen wird. Ferner werden sie mit
weiteren Textstrophen beschimpft, wenn
- sie nicht sofort auf die gesangliche Aufforderung reagieren
- sie ein scheinbar billiges Parfüm mitgebracht haben und
- das zur Verfügung stehende Parfüm nicht ausreicht.
Der erweiterte Gesangsteil aus dem Lied ärä mīžēw šəttõ amta ist wie folgt zu betrachten:
195
Begleitet von einem kräftigen Händeklatschen und Ololygen, kam der Bräutigam mit seinen männlichen Begleitern und Gästen
gegen 10°° Uhr am Haus der Brauteltern an. Dort sangen alle anwesenden Hochzeitsgäste und versuchten traditionsgemäß,
dem Bräutigam und seinen Gästen den Eingang ins Haus zu versperren. Nun müssen die Ankömmlinge ihrerseits versuchen
diesen Weg, wenn nötig auch mit Gewalt, z.B. durch Schubsen, für den Bräutigam frei zu machen. Diese Aktion muss in der Regel vor allem von den mižēwõč durchgeführt werden.
Die gesamte Handlung wurde beiderseits von Gesängen begleitet. Die Braut wurde mit Hilfe ihrer Begleiterinnen mižēwõč
angezogen und ins Wohnzimmer geschickt, wo sie sitzend auf dem Bräutigam wartete. Dieser Moment war der eindruckvolls-
te, da insbesondere der Bräutigam seiner zukünftigen Frau in ihrem festlichen Kleid, schön geschmückt und geschminkt be-
gegnete. Bei der Begegnung wurde der Gesang lauter. Alle Anwesenden klatschten und sangen mit großer Begeisterung. Der
Bräutigam küßte als Begrüßung seine Braut auf die Stirn. Danach wurde für eine Weile weitergesungen. Am Ende verließ das
Brautpaar in Begleitung seiner Gäste das Haus in Richtung Kirche, um zunächst dort die religiöse Trauung durchzuführen (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991).
196
der Begleiter des Bräutigams
Text zu Nr. 49 mīžēw dəhā näwu
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A %ረ ሚዜው ድሀ ነው ärä mīžēw dəhā näwu Oh! Der Begleiter ist arm.
b ሽቶው ውሀ ነው šəttõw wuhā näwu Das Parfüm ist Wasser.
2 a T %ረ ሚዜው ድሀ ነው ärä mīžēw dəhā näwu Oh! Der Begleiter ist arm.
b ሽቶው ውሀ ነው šəttõw wuhā näwu Das Parfüm ist Wasser.
2. Abschnitt
3 c A ሚዜው mīžēw Der Begleiter
d T ድሀ ነው dəhā näwu ist arm.
4 c1 A ሽቶው šəttõw Das Parfüm
d T ውሀ ነው wuhā näwu ist Wasser.
Nachdem diese Handlung beendet wird, fangen die Begleiter des Bräutigams an, die Brautjungfrauen mit
dem folgenden Gesang zu ärgern (symbolisch gedacht), indem sie in dem folgenden Textinhalt andeuten,
dass die Brautjungfrauen für die Begleitung der Braut eigentlich nicht geeignet wären.
Text zu Nr. 27 yəčī nat wäy mīžēšə (s. Takt 1- 22)
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ይቺ ናት ወይ ሚዜሸ? yəčī nat wäy mīžēšə Soll sie deine197 Brautjungfrau sein?
b አፈርኩልሽ afärkuləšə Ich schäme mich.
2 a T ይቺ ናት ወይ ሚዜሸ? yəčī nat wäy mīžēšə Ist sie deine Brautjungfrau sein?
b አፈርኩልሽ afärkuləšə Ich schäme mich.
2. Abschnitt
3 c A ሚዜሽ? mīžēšə Deine Brautjungfrau?
d T አፈርኩልሽ afärkuləšə Ich schäme mich.
4 c A ሚዜሽ? mīžēšə Deine Brautjungfrau?
d T አፈርኩልሽ afärkuləšə Ich schäme mich.
Beim Gesang dieses Liedes wird die Braut symbolisch gefragt, ob sie nicht den Fehler begangen hat, sol-
che passive Brautjungfrauen als Begleiterinnen gewählt zu haben (s. Zeilen 1. und 2.). Indirekt will man
mit dem Gesang andeuten, dass die Brautjungfrauen sich am Gesang, Tanz, Klatschen oder Trillern nicht
aktiv beteiligen. Sinn und Zweck des Gesanges besteht also darin, die Brautjungfrauen zu einer energi-
schen Beteiligung am gesamten Geschehen aufzufordern. Im Gegensatz hierzu wird in den weiteren Ge-
sangszeilen (s. Zeilen 3. und 4.) der Bräutigam gelobt, sich solche aktiven Begleiter ausgesucht zu haben.
Text zu Nr. 27 yəčī nāt wäy mīžēšə (s. ab Takt 22)
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 e A ይሄ ነው ወይ ሚዜህ? yəhē näw wäy mīžēhə Ist er dein Begleiter198?
f ውይ ታድለህ wəy tadəlähə Oh, ich beneide Dich.
2 a T ይሄ ነው ወይ ሚዜህ? yəhe näw wäy mīžēhə Ist er dein Begleiter?
b ውይ ታድለህ wəy tadəlähə Oh, ich beneide Dich.
197
die Braut wird gefragt 198
Die Frage richtet sich an den Bräutigam.
2. Abschnitt
3 c1 A ሚዜህ? mīžēhə Dein Begleiter?
d1 T ውይ ታድለህ wəy tadəlähə Oh, ich beneide Dich.
4 c A ሚዜህ? mīžēhə Dein Begleiter?
d1 T ውይ ታድለህ wəy tadəlähə Oh, ich beneide Dich.
Parallel zu dem Gesang der männlichen Begleiter wird dasselbe Lied von den Brautjungfrauen gesungen.
Dabei ändert sich nur der Textinhalt. Im Übrigen bleibt die Melodie die gleiche.
Dadurch versucht also jeder Teilnehmer, seine eigene Gesangsgruppe mit kräftigem Klatschen, Trillern
und lautem Singen zu unterstützen, so dass der Gesang der anderen Gruppe weniger zu hören ist als der
eigene. An beiden Gesängen können zwar Männer und Frauen beliebig teilnehmen. Aber in der Regel
entstehen spontan eine Männer- und eine Frauengruppe, in denen die aktiven und in diesem Augenblick
im Mittelpunkt stehenden Personen die männlichen und weiblichen Begleiter der Brautleute sind, da der
Gesangsinhalt sie unmittelbar betrifft. Mit anderen Worten wird in diesem Moment die gegenseitige Her-
ausforderung gesucht, die die Hochzeitsstimmung stimulieren soll.
Während des gesanglichen Geschehens und der gegenseitigen Herausforderung zwischen der männlichen
und der weiblichen Gruppe beobachten und genießen die Brautleute sitzend den Verlauf für einen kurzen
Augenblick.
Beim Verlassen des Hauses singen Freunde, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn der Braut folgendes:
Text zu Nr. 51 mušərīt ləmäğī 199
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
b ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
2 a ከእናትሽ ከአባትሽ känatəš kabatəšə Mehr als deine Mutter und dein Vater,
b1 ባልሽን ውደጂ baləšən wudäğī verehre deinen Ehemann.
c ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
3 a T ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
b ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
4 a ከእናትሽ ከአባትሽ känatəš kabatəšə Mehr als deine Mutter und dein Vater,
b1 ባልሽን ውደጂ baləšən wudäğī verehre deinen Ehemann.
c ሙሽሪት ልመጂ mušərīt ləmäğī Braut gewöhne dich.
Dieses Trostlied ist zugleich ein Abschiedslied. Es wird u.a. auch gesungen, während die Braut auf die
Ankunft des Bräutigams und seiner Begleiter wartet. Weitere Abschiedslieder sind die folgenden:
Text zu Nr. 16 atšäñwatəm wäy?
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr200 sie nicht hinausbeglei-
ten?
b T አሀሀ ahā hā (Redundanz)
2 a1 A አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht heimbegleiten?
c መሄድዋ አይደለም ወይ? mähēdwā ayədäläm wäy Sie geht doch fort?
3 a T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
b A አሀሀ ahā hā (Redundanz)
4 a1 T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
c mähēdwā ayədäläm wäy Sie geht doch fort?
199
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 200
betrifft alle an der Hochzeitsfeier beteiligten Menschen; hinausbegleitet wird die Braut
2. Abschnitt
5 d A መሄድሽ መሄድሽ mähēdəš mähēdəš Dass du gehst, dass du gehst,
d1 መሄድሽ ይወራል mähēdəš yəwäral dass du gehst, redet man.
6 a T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
b A አሀሀ ahā hā (Redundanz)
7 a1 T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
c መሄድዋ አይደለም ወይ? mähēdwā aydäläm wäy Sie geht doch fort?
8 d A ልቤ ከአንቺ ጋራ ləbē kančī garā Mein Herz mit dir
እንደ ንብ ይበራል əndänəb yəbärāl fliegt wie eine Biene.
9 a T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
b A አሀሀ ahā hā (Redundanz)
10 a1 T አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?
c መሄድዋ አይደለም ወይ? mähēdwā ayədäläm wäy Sie geht doch fort?
Text zu Nr. 47 mähēdwā näwu201
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A መሄድዋ ነው mähēdwa näwu Sie geht.
b መሰነናበa ነው mäsänabätwa näwu Sie verabschiedet sich.
c ችላው ምንድን ነው? čəlāwu mənədən näwu Warum schweigt man?
2 a T መሄድዋ ነው mähēdwa näwu Sie geht.
b መሰነናበa ነው mäsänabätwa näwu Sie verabschiedet sich.
c ችላው ምንድን ነው? čəlāwu mənədən näwu Warum schweigt man?
An den Bräutigam wird der folgende Inhalt seitens der Brautfamilie durch einen Gesang vermittelt:
Text zu Nr. 62 wändəməyē
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ወንድምዬ wändəməyē Bruder,
b T %, əhä (Redundanz)
2 c A ወንድም አበባ wändəm abäbā Bruder Blume,
d ይዘህ በጊዜ ግባ yəžähə bägiže gəbā bring sie zeitig nach Hause.
3 a T ወንድምዬ wändəməyē Bruder,
b A %, əhä (Redundanz)
4 c T ወንድም አበባ wändəm abäbā Bruder Blume
d ይዘህ በጊዜ ግባ yəžähə bägiže gəbā bring sie zeitig nach Hause.
2. Abschnitt
5 d1 A ይዘህ yəžähə Bring sie
d2 T በጊዜ ግባ bägiže gəbā zeitig nach Hause.
6 d1 A ይዘህ yəžähə Bring sie
d2 T በጊዜ ግባ bägiže gəbā zeitig nach Hause.
201
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt.
Text zu Nr. 71 yəžwat bärärä
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ይዝዋት ይዝዋት በረረ yəžwat,yəžwat bärärä Er nahm sie, er nahm sie und lief davon.
a1 ይዝዋት በረረ yəžwat bärärä Er nahm sie und lief davon.
2 a T ይዝዋት ይዝዋት በረረ yəžwat,yəžwat bärärä Er nahm sie, er nahm sie und lief davon.
a1 ይዝዋት በረረ yəžwāt bärärä Er nahm sie und lief davon.
3 a2 A ይቀሙኛል እያለ yəqämuñal əyalälä "Sie nehmen sie mir weg", sagte er.
a1 ይዝዋት በረረ yəžwāt bärärä Er nahm sie und lief davon.
4 a T ይቀሙኛል እያለ yəqämuñal əyalälä Er nahm sie, er nahm sie und lief davon.
a1 ይዝዋት በረረ yəžwat bärärä Er nahm sie und lief davon.
2. Abschnitt
5 b A ይዝዋት yəžwāt Er nahm sie
c T በረረ bärärä und lief davon.
6 b A ይዝዋት yəžwāt Er nahm sie
c T በረረ bärärä und lief davon.
Bei der Vorbereitung im Hause des Bräutigams werden ebenfalls ähnliche Hochzeitslieder wie z.B. əšäte
wäyənā (Nr. 35), kurāt kurāt (Nr. 44) und amõrā bäsämay siyayəh walä (Nr. 6) gesungen, bis auf solche,
die auschließlich für die Braut gesungen werden wie z.B. das Lied balənğärē (Nr. 18). Die Gesänge un-
terscheiden sich nur darin, dass sie an eine männliche Person gerichtet vorgetragen werden und dadurch
nur einige textinhaltliche Veränderungen hervorrufen202. Die melodischen und rhythmischen Strukturen
und die Körperbewegungen bleiben dabei ungefähr gleich.
2.3.3. Das Festmahl
Bei einer Hochzeitsfeier werden beiderseits im Durchschnitt 200-500 Gäste eingeladen203. Für die Unter-
bringung der Gäste wird gewöhnlich eine große Zelthalle, genannt dās {ዳስ}, bzw. ein
Zelt dənkwān {ድንክዋን} aufgebaut, das ca. eine Woche lang für die Hochzeitsfeier zur Verfügung steht.
Die Zelthalle besteht aus einer einfachen aus Holzbrettern hergestellten rechteckigen Struktur, dessen Hö-
he ca. 2,5 - 3m misst. Die Breite und Länge wird je nach der zur Verfügung stehenden und benötigten
Fläche entschieden. Danach wird das Ganze mit Zeltplanen bedeckt. Das Aufbauen von Zelten bzw. Zelt-
hallen für solche und andere Zwecke204, bei denen sich immer eine Menschenmenge ansammelt, ist eine
typische Tradition der meisten Hochlandbewohner205. Misginna (1958: 53) schreibt folgendes:
"As the houses are too small to shelter the large number of people invited, special halls (das) are built for
the marriage"
Festliches Essen206 und lokale Getränke wie tällā207 {ጠላ} und täğ208 {ጠጅ} werden in größeren Men-
gen vorbereitet. Nach dem festlichen Essen beginnen die Hochzeitsgesänge. Hochzeitsgäste, die sich
202
Beobachtungen von Hochzeitsfeiern/Addīs Abäbā/1991 und 1997. 203
Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā 1991 mit ca. 1000 Gästen und Hochzeitsfeier/Bahər Dār/Goğām 1997 mit ca. 500 Gästen; Gondär/Gondär 1997 mit ca. 400 Gästen und Mäqälē/Təgrāy 1997 mit ca. 700 Gästen.
204
Zelte bzw. Zelthallen werden u.a. auch für Trauerfeiern aufgebaut, an denen ebenfalls viele Trauergäste teilnehmen. 205
Beobachtung von Hochzeitsfeiern/Goğām, Gondär, Mäqälē und Addīs Abäbā 1997. 206
Zum festlichen Essen werden verschiedene Sorten von Soßen wie beispielsweise Hühnersoße und Fleischsoße (aus Rind- und
Lammfleisch) gekocht. Für den Anlaß werden mehrere Schafe und Ochsen geschlachtet, aus denen auch andere exotische Ge-
für eine Teilnahme am Gesang freiwillig erklären, treffen sich auf einer für diesen Anlass vorbereiteten,
freien Fläche und zwar gewöhnlich in der Mitte der Zelthalle. Andere eingeladene Hochzeitsgäste, die
zunächst sitzend der Veranstaltung folgen, werden durch verschiedene Gesänge zur Beteiligung und zum
Tanz aufgefordert. Insbesondere gehören die folgenden zwei Lieder unbedingt zu diesem Augenblick:
Text zu Nr. 41 əyäbälū əyätätū žəmə209
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A እየበሉ əyäbälū Man isst,
b እየጠጡ ዝም əyätätū žəmə trinkt, aber schweigt210.
c የጋን ወንድም yägān wänədəmə Dieser ist Bruder eines Wasserbehälters.
2 a T እየበሉ əyäbälū Man isst,
b እየጠጡ ዝም əyätätū žəmə trinkt, aber schweigt.
c የጋን ወንድም yägān wänədəmə Dieser ist Bruder eines Wasserbehälters.
In dem Moment, wo sich nach und nach eine größere Anzahl von Teilnehmern, insbesondere Mitglieder
aus der Verwandschaft beider Familien, mit Gesängen und Tänzen beschäftigen, wird auch meistens der
folgende Gesang, der von seinem Inhalt her eine aktive Beteiligung der Verwandschaft der Brautleute
fordert, gesungen:
Text zu Nr. 63 yäbētä žämädū
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ሆ የቤተ ዘመዱ hõ yäbētä žämädū Die Verwandtschaft
b T ይታያል ጉዱ yətayal gudū wird man sehen.
2 a1 A ካልተጫወታችሁ kalətäçawätačəhū Wenn ihr211 nicht mitsingt
b T ወደቤታችሁ wädäbetačəhū dann geht nach Hause212.
2. Abschnitt
3 c A ሞንàኛዬ monmwanayē (Redundanz)
c1 ሞንàኛዬ monmwanayē (Redundanz)
Auf diese Weise wird im Haus der Brauteltern bis zum Sonnenuntergang weiter gesungen und getanzt.
Im Gegensatz zu einer städtischen Hochzeitsfeier verbringt ein Brautpaar z.B. in tägulät {ተጉለት}, Regi-
on Šäwā, den Hochzeitstag ausschließlich im Hause der Brauteltern. Es wird den ganzen Tag und die gan-
ze Nacht gesungen und getanzt. Erst am folgenden Tag verlässt das Paar das Elternhaus der Braut. Für den
Transport werden zwei Maultiere vorbereitet. Das frisch verheiratete Paar wird von einer Gruppe von
Menschen, darunter die Begleiter des Bräutigams geführt, die tanzend und singend zu Fuß maschieren.
Außer durch weltliche Gesänge werden manche Hochzeitsfeier auch von religiösen Hochzeitsgesängen
und Danksagungen, genannt nəsebəhõ {ንሴብሆ}, begleitet. Zu den Gesängen gehören die kirchlichen
Musikinstrumente wie Sistrum tənasəl {ጽናጽል} und die Trommel käbärõ. All diese Handlungen haben
richte vorbereitet werden. Diese verschiedenartigen Soßen und Gerichte werden mit dem nur in Äthiopien existierenden Fla-
denbrot gegessen, das aus einer Getreidesorte hergestellt wird, die als teff bezeichnet wird und nur in Äthiopien wächst. 207
tällā is das hausgemachte Bier der Hochlandbewohner. 208
täğ ist ein alkoholisches Getränk, das durch die Gährung von mār ("Honig" mit Wasser gemischt) und gešõ "Rhamnus prino-
ides" vorbereitet und mit vielen Gewürzen aromatisiert wird (siehe auch Misgana 1958: 101). 209
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 210
die Hochzeitsgäste 211
die Hochzeitsgäste 212
Inhalt nicht wörtlich gemeint
einen biblischen Hintergrund und zwar beinhalten sie die Geschichte des Jesus Christus, der sein ers-
tes Wunder auf einer Hochzeitsfeier gezeigt hat (Mekuria 1997).
2.3.4. Der Abend des Hochzeitstages
Am Abend, gewöhnlich gegen 20°° Uhr, wird die Braut zum Haus des Bräutigams begleitet, wo ein festli-
ches Abendmal und eine geringere Anzahl von Hochzeitsgästen auf sie warten. Bei der Ankunft der Braut-
leute im Haus des Bräutigams und/oder seiner Eltern wird ein Schaf am Eingang des Hauses geschlach-
tet213. Schlachten muss der Bräutigam selbst (vgl. Ayen, Engida, Alene 1988: 18). Danach überquert das
Paar das tote Tier, bevor es das Haus betritt (Wegayehu 1987: 19). Dieser zeremonielle Vorgang ver-
spricht den Brautleuten eine gesegnete Ehe und gesunde Kinder214.
In əndärta gibt es eine ähnliche Schlachtzeremonie wie die der amārā. Misginna beschreibt (1958: 56):
"When the bridal party approaches the new home a tumultuous reception is arranged for him. A goat or
ship is slain and put on the threshold of the house. Before the bride and the bridegroom go into the house, a
bestman carries the bride on his back across and back over the slain beast three times".
Bei den agäw {አገው}, Region Goğām, dagegen findet die Schlachtzeremonie drei Tage nach der Hoch-
zeit statt. Hier wird allerdings das geschlachtete Tier nicht überquert, sondern dessen Blut wird nur vom
Bräutigam mit dem Finger geschmeckt. Die Bedeutung für diese Handlung ist unbekannt (Ayen, Engida,
Alene 1988: 18).
An der Abendveranstaltung nehmen enge Verwandte, insbesondere die Eltern und Familienangehörigen
der Braut, nicht teil. Der Grund dafür ist ebenfalls nicht bekannt.
Die Besonderheit dieser Veranstaltung besteht vor allem darin, dass ein neuer Ruf-Name für die Braut
erfunden wird, was ebenfalls von einer Zeremonie begleitet ist. Dieser Name wird yädābõ səm215 {የዳቦ |ም} "Namensbrot" genannt und er darf nur seitens der Verwandten des Bräutigams einschließlich seiner
Eltern und Geschwister benutzt werden. Somit werden verschiedene Namen von den Gästen vorgeschla-
gen. Am Ende wird dann der durch die Mehrzahl der vorhandenen Gäste gewählte Name akzeptiert. Für
diesen Anlass wird ein großes rundes Brot aus Weizenmehl, genannt dəfõ dābõ {ድፎ ዳቦ} gebacken, das
am Ende der Zeremonie in mehrere kleine Stücke geschnitten und an die Gäste verteilt wird. Es dient als
Symbol dafür, dass der neue Name anerkannt worden ist. Die Mitte des Brotes wird in eine runde Form
geschnitten und in einem dazu passenden Korb yämäsõb wärq {የመሶብ ወርቅ} verpackt216, da es traditi-
onell am nächsten Morgen an die Brauteltern geschickt wird217.
Bei den agäw gibt es auch eine ähnliche Namensgebungszeremonie, die allerdings nicht am Hochzeits-
abend, sondern nach Beendigung der Flitterwochen (ca. eine Woche später) stattfindet. Die Namensge-
bung wird hier nur der Schwiegermutter überlassen (Ayen, Engida, Alene 1988: 20).
Auch bei den təgrāy gibt es eine zeremonielle Namensgebung, die dem gleichen Zweck dienen soll. Je-
doch wird hier dafür kein Brot gebacken. Der Name wird von den Schwiegereltern der Braut vergeben218.
Dies geschieht auch nicht am Hochzeitstag, sondern einige Tage später. Nach dem die Namensgebung
213
Das Schlachten von Tieren, wie z.B. Schafe, Ziegen, Hühner und Ochsen, im eigenen Haus ist in vielen Teilen Äthiopiens
üblich. Es geschieht insbesondere an Feiertagen wie Ostern, Neujahr, und Weihnachten. Das Tier muss auf jeden Fall von ei-
nem Mann (gewöhnlich von dem Hausherrn) geschlachtet werden. Das Schlachten hat eine religiöse Bedeutung und daher ge-
schieht es bei den Christen stets im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Die gesamte Handlung heißt
mäbaräk {መባረክ} "segnen". Auch die muslimische Bevölkerung Äthiopiens schlachtet Tiere an Feiertagen im Namen Al-
lah's. 214
Beobachtung und aktive Teilnahme/Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991 215
Bei den amārā werden meistens adelige Namen wie z.B. yäših əmäbēt {የሺህ እመቤት} "Herrin tausender", ərkābəš wärq
{እርካብሽ ወርቅ} "Dein Sattel ist aus Gold". 216
Der Korb wird dafür extra gekauft. 217
Beobachtung und aktive Teilnahme/Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991 218
Es werden Namen wie dästā {ደስታ} "Freude" und yäməsərāč {የም|ራች} "Glückwunsch" von den Schwiegereltern für die Braut erfunden.
seitens der Schwiegereltern bestätigt ist, gehen die mīžēwõč des Bräutigams singend und tanzend zum
Haus der Brauteltern, um von dem neuen Namen zu berichten, mit dem ihre Tochter von diesem
Zeitpunkt an von der Familie und Verwandtschaft ihres Ehemannes gerufen werden wird (Gebreyesus
1997).
2.3.5. Der Aufenthaltsort während der Flitterwochen
Die Bezeichnung çagulā {ጫጉላ} bezieht sich auf ein Haus oder ein Zimmer innerhalb eines Hauses, wo
das Brautpaar ab der Hochzeitsnacht seine Flitterwochen verbringt (vgl. Ayen, Engida, Alene 1988: 19f.).
Für diesen besonderen Aufenthaltsort werden entweder einfache Häuser aus Bambus separat aufgebaut
oder es wird eine bestimmte Fläche innerhalb eines Zimmers mit einem Vorhang verdeckt (Wegayehu
1987: 20f.).
Zum çagulā begeben sich die Brautleute nach Beendigung der Abendveranstaltung am Hochzeitstag. In
der Regel kommt es in dieser Nacht zur ersten körperlichen Begegnung des Brautpaares, wobei traditions-
gemäß die Entjungferung der Braut stattfindet. In den ländlichen Gebieten der amārā wird erzählt, dass
der sogenannte yäsər mīžē {የስር ሚዜ}, der erste Begleiter und gleichzeitig der engste Freund des Bräu-
tigams, mit dem Brautpaar die Nacht verbringt. Seine Aufgabe besteht darin den Bräutigam im Falle, dass
er psyschich nicht in der Lage ist die Entjungferung der Braut zustande zu bringen, seine die Rolle zu
übernehmen, da am folgenden Morgen die Brauteltern über die Entjungferung ihrer Tochter unbedingt
benachrichtigt und beglückwünscht werden sollen (Wegayehu 1987: 20).
Während der Flitterwochen ruht sich das Paar aus und empfängt seine Gäste. In den Städten werden für
Flitterwochen heutzutage höchstens 3 bis 4 Tage vorgesehen. Dagegen sind es in den Dörfern ca. 8-10
Tage (Mekuria 1997). Das Brautpaar wird von Verwandten, Bekannten und Freunden besucht. Es ist vor
allem die Aufgabe der mīžēwõč, dafür zu sorgen, dass das Paar alles bekommt und absolut vergnügt ist.
Auch in der Region Təgrāy gibt es den Begriff çagulā, der dieselbe Funktion erfüllt. Misginna (1958: 57f)
berichtet folgendes:
"The first period the married couple stay together is called agula. This may extend from 10 to 15 days. Ri-
cher families can aford to make it longer. During the agula the couple must not feel lonely. It is, therefore,
a duty of the best men to entertain them. Food ist served at frequent intervals, because the apparently shy
bride eats only a small amount at every meal".
In der agäw-Tradition betrug früher die Zeitspanne in einem çagulā etwa 40 Tage. Heute sind es jedoch
nur noch 5 Tage. Diese Tatsache weist auf zunehmende wirtschaftliche Probleme dieser und anderer Ge-
meinschaften hin (Ayen, Engida, Alene 1988: 20).
Auf ihrem Weg in den çagulā werden die Brautleute gewöhnlich mit den folgenden Gesängen begleitet:
Text zu Nr. 40 ətē šänkõrē219
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ aläməšə žarē näwu žarē Dein Glück220 ist heute, heute.
b አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ aläməšə žarē näwu žarē Dein Glück ist heute, heute.
2 c T ኦሆሆ oh hõ hõ (Redundanz)
d A እቴ ሸንኮሬ ətē šänkõrē Schwester Šänkõrē221.
3 a1 T አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ aläməšə žare näwu žarē Dein Glück ist heute, heute.
219
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 220
Inhalt bezogen auf die Braut. 221
Die Braut wird mit diesem Namen bezeichnet.
b1 አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ aläməšə žare näwu žarē Dein Glück ist heute, heute.
4 a2 A በደቡብ ተሰማ ወሬ bädäbub täsäma wärē Im Süden hat man gehört,
b2 በም|ራቅ ተሰማ ወሬ bäməsraq täsäma wärē im Osten hat man gehört,
5 c T ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
d A እቴ ሸንኮሬ ətē šänkõrē Schwester Šänkõrē.
Text zu Nr. 70 yäžarē amätə222
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A የዛሬ ዓመት yäžarē amätə Heut in einem Jahr,
b T ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
2 a1 A የዛሬ ዓመት yäžarē amätə heut in einem Jahr,
c የማሚቱ እናት yämamītū ənātə Mutter von Mamītu223.
3 d የማሙሽ አባት yämamūš abātə Mamūš's 224 Vater.
e የማሙሽ አባት yämamūš abātə Mamūš's Vater.
4 a2 T የዛሬ ዓመት yäžarē amätə Heut in einem Jahr,
b1 A ኦሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
5 a1 T የዛሬ ዓመት yäžarē amätə heut in einem Jahr,
c የማሚቱ እናት yämamītū ənatə Mutter von Mamītu.
Auch in der Tradition der Harärē gibt es den Begriff çagulā, den man als arūž gār {አሩዝ ጋር} bezeich-
net. Gleich nach Beendigung ihrer Hochzeitsveranstaltung begeben sich die Brautleute in den arūž gār.
Die Braut nimmt wichtige Gegenstände, die sie während ihres Aufenhaltes dort dringend benötigt, mit.
Diese sind beispielsweise wichtige Haushaltswaren wie Teller, Tassen, Töpfe, Eimer und Körbe. Hinzu
kommen Schlafzeug wie Kopfkissen, Matratzen und Bettwäsche. All diese Sachen besorgt ihre Mutter im
Voraus.
Bei den harärē wurden früher für solche Zwecke Häuser aus Bambus in unmittelbarer Nähe der Schwie-
gereltern der Braut aufgebaut225. Während ihrer Flitterwochen werden die Brautleute von der Mutter des
Bräutigams mit Essen (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot) versorgt. Vor ca. 30 Jahren kümmerte man
sich sogar solange, bis die Braut ihr erstes Kind gebahr (ca. 1 Jahr). Es war die Pflicht der Schwiegermut-
ter, sie ununterbrochen versorgen und bedienen zu müssen. Durch diese Aktion möchte man den Eltern
der Braut beweisen, dass ihre Tochter in der neuen Umgebung gut aufgehoben ist.
Im Gegensatz zu früheren Zeiten (vor ca. 30 Jahren) verbringt heutzutage ein frisch verheiratetes Paar
wenige Wochen im arūž gār, je nach dem, was man vorher im Familienkreis abgesprochen hat. Trozdem
wird das Paar auch heute während seines Aufenthaltes im dem arūž gār von den Eltern des Bräutigams
versorgt.
Die Hochzeitsnacht ist auch bei den Harärē die Nacht, in der gewöhnlich der erste Geschlechtsverkehr
stattfindet, vor allem, wenn die Braut Jungfrau ist und ihrem Mann in dieser Nacht zum ersten Mal begeg-
net.
In den städtischen Gegenden, wo das Ehepaar sich bereits vor dem Heiraten sehr gut kennenlernt, ist der
Geschlechtsverkehr in der Hochzeitsnacht kein besonderes Thema. Das Neue dabei ist nur, dass das Paar
ab jetzt legal verheiratetet ist und von diesem Moment an auch Kinder zeugen darf. In vielen Kulturen
Äthiopiens ist es von großer Bedeutung für die Ehre eines Menschen, Kinder nur im Rahmen einer Ehe zu
gebähren. Die Geburt eines außerehelichen Kindes wird meistens als Schande betrachtet, und die Frau
wird oft von der Gesellschaft ausgestoßen.
222
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 223
Mamītu steht für die Bezeichnung eines Mädchens. 224
Mamūš steht für die Bezeichnung eines kleinen Jungen. 225
Gleich nach ihrer Ankunft im arūž gār bekommt die Braut eine kleine Portion Honig von den Tanten des Bräutigams, den sie sofort essen muss. Dies soll symbolissch bewirken, dass sie ihrem Mann auch so süß wie Honig schmecken soll.
2.4. NACHHOCHZEITSBRÄUCHE
Außer den Vorhochzeitsbräuchen und die eigentliche Hochzeitsfeier, gibt es in der amārā-Tradition weite-
re Festtage. Hauptsächlich finden drei Feiern statt, die an drei verschiedenen Tagen zelebriert werden.
Diese sind wie folgt dargestellt:
2.4.1. Glückwunsch
Die Feier zum yäməsərāč {የም|ራች} findet einen Tag nach der Hochzeit statt. Hierbei geht es um die
Beglückwünschung und Gratulation der Brauteltern, die mit der Jungfräulichkeit ihrer Tochter im Zu-
sammenhang steht. Die Botschaft erreicht das Elternhaus unmittelbar nach Sonnenaufgang (vgl. Weg-
ayehu 1987: 22; Mekuria 1997).
In ländlichen Gebieten wird dieser entscheidende Moment mit großer Sorge erwartet, denn es besteht im-
mer die Befürchtung, dass die Braut nicht Jungfrau gewesen war. Es war und ist auch heute noch in
vielen Kulturen Äthiopiens eine Schande für den Ruf der Eltern, dabei versagt zu haben, auf die Jungfräu-
lichkeit ihrer Tochter zu achten. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass ihre Tochter von ihrem Ehe-
mann zurückgewiesen wird und daher auch für sie im weiteren Leben wenige Chancen zu einer nochmali-
gen Heirat bestehen. Traditionell haben der Bräutigam und seine Eltern das Recht auf eine Rückerstattung
der Hochzeitskosten (Gebre Hiwot 1993, Ali 1994; Gebreyesus 1997, Mekuria 1997).
In den städtischen Zentren und in manchen aufgeklärten ländlichen Gegenden wie z.B. in
əndärtā (Misginna 1958: 57) und agäw wird die Jungfräulichkeit zwar respektiert, dennoch hat der Ver-
lust der Jungfräulichkeit vor einer Eheschließung keine negativen Folgen. Aber in solchen Fällen bleibt es
ein Geheimnis (Ayen, Engida, Alene 1988:20). Vor allem wird nicht spekuliert, ob die Braut bis zur
Hochzeitsnacht ihre Jungfräulichkeit bewahrt hat oder nicht. Dies ist auch der Fall in əndärtā wie Mis-
ginna (1958: 57) es wie folgt schildert
"It is interesting to note that there are no unpleasant consequences for the bride if she is found not a vir-
gin. Usually she is not sent back to her parents and no return of gifts is asked by the husband".
Andererseits kennen sich die meisten Paare schon vor ihrer Hochzeit. Sie lernen sich kennen bzw. sie le-
ben zusammen, so dass das Problem der Jungfräulichkeit nicht erheblich ist. Dies ist jedoch vorwiegend
in aufgeklärten städtischen Zentren möglich.
Dennoch findet das Ritual zum yäməsərāč bei den Brauteltern am nächsten Morgen statt. Die Begleiter
des Bräutigams nehmen entweder ein symbolisch mit roter Farbe oder mit Blut beschmiertes Tuch (Ayen,
Engida, Alene 1988: 20; Wegayehu 1987: 21) mit, um zu demonstrieren und zu beweisen, dass die Braut
bei der Entjungferung geblutet hat. In diesem Moment werden die folgenden Lieder gesungen:
Text zu Nr. 20 bər ambār
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er226 zerbrach das silberne Arm-
band227.
b ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er zerbrach das silberne Armband.
2 c T አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
d A ሸጋው ልጅዎ šägawu ləğəwõ Der Held, ihr Sohn.
3 a1 T ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er zerbrach das silberne Armband.
b1 ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er zerbrach das silberne Armband.
226
der Bräutigam 227
Symbolisiert die Jungfräulichkeit der Braut./Gesang besteht nur aus einem Abschnitt.
4 a2 A ስብርብር አረገልዎ səbərəbər arägäləwõ Er zerbrach es.
b2 እንክትክት አረገልዎ ənəkətkət arägäləwõ Er zerbrach es.
5 c T አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
d A ሸጋው ልጅዎ šägawu ləğəwõ Der hübsche, ihr Sohn.
6 a1 T ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er zerbrach das silberne Armband.
b1 ብር አምባር \በረልዎ bər ambār säbäräləwõ Er zerbrach das silberne Armband.
Text zu Nr. 42 kēlawu täsäbärä 228
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor229 ist entzwei.
b ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei.
2 a1 በእናት በአባa ቤት bänāt babātwā bēt Im Hause ihrer Mutter und ihres Vaters.
b1 ተከብሮ የኖረ täkäbrõ yänõrä wurde es bislang respektiert.
c ኬላው ተ\በረ kelawu täsäbärä Das Tor ist entzwei.
3 a2 T ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei.
b ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei.
4 a3 በእናት በአባa ቤት bänāt babātwā bēt Im Hause ihrer Mutter und ihres Vaters,
b2 ተከብሮ የኖረ täkäbrõ yänõrä war es bislang respektiert.
c ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei.
Dazu wird getanzt, geklatscht und getrillert. Die Brautangehörigen, meistens Mädchen und Frauen, singen
das folgende Lied:
Text zu Nr. 1 abäbawu babäbawu layə230
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A አበባው በአበባው ላይ abäbawu babäbawu layə Blumen über Blumen.
b አበባው በአበባው ላይ abäbawu babäbawu layə Blumen über Blumen,
2 c T አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
3 d A በአበባው ላይ babäbawu layə Blumen über Blumen.
4 a T አበባው በአበባው ላይ abäbawu babäbawu layə Blumen über Blumen.
b አበባው በአበባው ላይ abäbawu babäbawu layə Blumen über Blumen.
5 a1 A እናa ሰምተዋል ወይ? ənātwa sämtäwāl wäyə Weißt ihre Mutter231 davon?
b1 አበባው በአበባው ላይ abäbawu babäbawu layə Blumen über Blumen,
6 c T አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
7 d A በአበባው ላይ babäbawu layə Blumen über Blumen.
Text zu Nr. 38 əstī amətwu yädämūn šämā232
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A እስቲ አምጣው የደሙን ሸማ əstī amətawu yädämūn šämā Hol mal das Bluttuch233!
b እስቲ አምጣው የደሙን ሸማ əstī amətawu yädämūn šämā Hol mal das Bluttuch!
2 c አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
d እንዳንሸሽ əndanšäšə Damit wir nicht weglaufen.
228
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 229
Bezieht sich auf die Jungfräulichkeit der Braut. 230
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 231
Mutter der Braut 232
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 233
Der Gesang ist an dem Begleiter des Bräutigams gerichtet. Der hier angeführte Text entspricht der Konvention des Liedes. In
der Transkription Nr. 38 ist die Reihenfolge der melodischen Formeln aktuell anders gestaltet und nicht direkt damit zu ver-gleichen.
3 a T እስቲ አምጣው የደሙን ሻሽ əstī aməçīwu yädämūn šäšə Hol mal das Bluttuch!
b እስቲ አምጣው የደሙን ሻሽ əstī aməçīwu yädämūn šäšə Hol mal das Bluttuch!
4 c A አሆሆ o hõ hõ (Redundanz)
d T እንዳንሸሽ əndanšäšə Damit wir nicht weglaufen.
Die Begleiter des Bräutigams teilen den Brauteltern den neuen Vornamen der Braut mit, den sie am Vor-
abend zur Feier des Namensbrotes bekommen hat. Der Korb, der das große runde Brot enthält, wird mit
abgegeben. Im Brot wird gewöhnlich ein Geldschein versteckt, der von einem der anwesenden Gäste bzw.
von Verwandten der Brautfamilie gesucht wird. Derjenige, der den Schein findet, darf ihn auch behalten.
Worauf diese Handlung zurückgeht, ist unbekannt. Anschließend wird das Brot in kleinen Stücken ge-
schnitten und an die Gäste verteilt234. Hierzu wird u.a. das folgende Lied gesungen, in dem der neue Na-
me der Braut erwähnt wird235:
Text zu Nr. 72 žäbänay māryē236
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig237,
b ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig.
2 a1 |ም አወጣሁልሽ səm awätahuləš Ich gab dir den Namen:
b1 መድፈሪያሸ ወርቅ ብዬ mädfäriāš wärq bəyē mädfäriāš wärq238.
c ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig,
3 a T ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig,
b ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig.
4 a1 |ም አወጣሁልሽ səm awätahuləš Ich gab dir den Namen:
b1 መድፈሪያሸ ወርቅ ብዬ mädfäriāš wärq bəyē mädfäriāš wärq.
c ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē Neuer Honig.
Danach fängt die Frühstückszeremonie an. Anschließend fordern die Begleiter des Bräutigams traditions-
gemäß Geschenke (Wegayehu 1987: 22) durch einen Gesang, der von der Brautfamilie auch erwartet
wird. Er hat den folgenden Text zum Inhalt:
Text zu Nr. 37 (s. Takte 1-21)
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እስቲ ሸልሙን እናa əstī šäləmūn ənatwā Bitte beschenk uns Mutter239,
b ሸልሙን እናa šäləmun ənatwa beschenk uns, Mutter!
2 a T እስቲ ሸልሙን እናa əstī šäləmūn ənatwā Bitte beschenk uns Mutter,
b ሸልሙን እናa šäləmūn ənatwā beschenk uns, Mutter!
2. Abschnitt
3 c A ሸልሙን šäləmūn Beschenk uns
d T እናa ənatwā Mutter!
4 c1 A ሸልሙን šäləmūn Beschenk uns
d T እናa ənatwā Mutter!
234
Beobachtung Hochzeitsfeier/ Addīs Abäbā 1991. 235
Dieses Lied kann aber auch zu unterschiedlichen Phasen der Hochzeit beliebig gesungen werden, ohne an eine bestimmte
Funktion gebunden zu sein. 236
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 237
die Braut 238
Name der Braut (Hochzeitsfeier Addīs Abäba 1991) 239
Mutter der Braut
Die Eltern, die die Geschenke bereits vor einigen Tagen vorbereitet haben, reagieren darauf und beschen-
ken die Begleiter des Bräutigams240. Danach erfolgen weitere Strophen des bereits begonnenen funktions-
gebundenen Gesanges mit variiertem Melodieaufbau:
Text zu Nr. 37 erweiterter Gesangsteil; əstī šäləmūn (s. ab Takt 21)
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
5 a1 A ይ,ው ሸለሙን እናa yəhäwu šälämūn ənatwā Da beschenkt uns ihre Mutter241,
b ሸለሙን እናa šälämūn ənatwā beschenkt uns ihre Mutter!
6 a T ይ,ው ሸለሙን እናa yəhäwu šälämūn ənatwā Da beschenkt uns ihre Mutter,
b ሸለሙን እናa šälämūn ənatwā beschenkt uns ihre Mutter!
2. Abschnitt
7 c2 A ሸለሙን šälämūn beschenkt uns,
d T እናa ənatwā ihre Mutter!
8 c3 A ሸለሙን šälämūn beschenkt uns,
d T እናa ənatwā ihre Mutter!
Was die Art der Geschenke anbelangt, bekommen die Begleiter des Bräutigams u.a. Geld, Schnaps (Weg-
ayehu 1987: 17), Gold- oder Silberschmuck242, šämā243 usw. (Shariye 1993; Mekuria 1997).
In vielen Kulturen Äthiopiens sind solche Feiern nach Hochzeiten bekannt. Wie Misginna (1958: 57) es
beschreibt, geschieht in əndärtā die Beglückwünschung der Eltern drei Tage nach der Hochzeit:
"Three days after the marriage the best man will take the.... blood-cloth, a piece of cloth on which blood
has been wiped when the girl's hymen is broken, to the girl's parents, who will arrange a ceremony to
mark the occasion. The cloth is displayed to any visitor who cares to see it. The bridegroom is sent some
present by the parents of his wife".
Bei den harärē bringen die Begleiter des Bräutigams arūž mälāq {አሩዝ መላቅ} ebenfalls ein blutiges
Tuch und verschiedene Süßigkeiten, genannt halāwā, einen Tag nach der Hochzeit zur Beglückwün-
schung der Brauteltern. Die weitere Zeremonie verläuft allerdings anders als bei den amārā: nach der
Beglückwünschungszeremonie fangen sogenannte afõččā {አፎቻ}, Frauenmitglieder eines Vereines einer
Wohngegend, am Abend desselben Tages an, Fladenbrot ähnliche Scheiben, genannt žəhūq {ዝሑቅ} und
geräucherte Rinderpansen anqär matäb {አንቀር ማጠብ} im Haus der Brauteltern vorzubereiten, die am
folgenden Tag zum Bräutigam als eine Art Dankeschön geschickt werden sollen. Die arūž mälāq erhalten
keine Geschenke von der Brautfamilie.
240
Die sechs Begleiter des Bräutigams bekamen sechs goldene Ringe von der Mutter der Braut, auf denen als Erinnerung die
Namen der Brautleute eingraviert wurden (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991). 241
Mutter der Braut 242
Beobachtung einer Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991 243
Aus Baumwolle hergestellte und fein gesponnene traditionelle Bekleidung.
2.4.2. Die Rückkehr
Das Wort mäls bzw. məlāš {ምላሸ} bezieht sich auf die Feier, die gewöhnlich am dritten Tag nach der
Hochzeit begangen wird. Und zwar entweder an einem Montag oder einem Dienstag, da der Hochzeitstag
in der Regel ein Samstag oder ein Sonntag ist. Die Feier findet am Abend (ab ca. 19°°Uhr) statt244. Sie
symbolisiert vor allem ein Wiedersehen der Braut mit ihren Eltern und Verwandten. Daher wird das Fest
auch in ihrem Elternhaus veranstaltet, bei dem alle Verwandten und Bekannten des Brautpaares teilneh-
men. Die Besonderheit bei einer mäls-Feier besteht darin, dass die Brautleute nicht als Gast, sondern als
Gastgeber auftreten, und daher die Hochzeitsgäste bedienen und den gesamten Verlauf der Feier verfolgen
müssen. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit für beide Verwandschaftsgruppen sich kennenzulernen.
Die mäls Feier findet in den verschiedenen amārā-Gebieten nicht unbedingt am dritten Tag nach der
Hochzeit statt, sondern es wird dafür ein anderer, für die Gastgeber geeigneter Tag ausgesucht (Mekuria
1997; Gebreyesus 1997; Wegayehu 1987: 24).
Es werden bis spät in die Nacht oder auch bis zum nächsten Tag traditionelle Hochzeits- und Unterhal-
tungslieder gesungen. Ein funktional zu diesem Anlass passendes Lied ist das folgende:
Text zu Nr. 50 mušərīt lämdaläč245
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt246.
b ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt.
2 a ደጋኔን መሶቤን däganēn mäsõbēn "Meinen Bogen und Korb247
b ላኩልኝ ብላለች lakuləñ bəlaläčə schickt mir", hat sie gesagt.
a1 ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt.
3 a ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt.
b T ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt.
4 a ደጋኔን መሶቤን däganēn mäsõbēn "Meinen Bogen und Korb
b ላኩልኝ ብላለች lakuləñ bəlaläčə schickt mir", hat sie gesagt.
a1 ሙሽሪት ለምዳለች mušərīt lämdaläčə Die Braut hat sich dran gewöhnt.
2.4.3. Die Mischung
Das Wort qələqəl {ቅልቅል} und die dazu gehörende Feier beziehen sich auf die Begegnung der Brautleu-
te mit Verwandten und Bekannten beider Familien. Diese Feier findet meistens an einem Donnerstag statt.
Dieser Tag ist entweder der 7. (wenn die Hochzeit an einem Samstag stattgefunden hat) oder der 6. Tag
(wenn die Hochzeit an einem Sonntag gefeiert wurde)248. Die Kosten übernimmt die Familie des Bräuti-
gams. Es werden wiederum viele Gäste eingeladen.
In den ländlichen Gebieten, wie z.B. in Tägulät (Region Šäwā), findet eine qələqəl-Feier nach ca. 10 Ta-
gen statt. Dies hängt mit dem Aufenthalt des Brautpaares im çagulā zusammen, der nach dieser Zeit been-
det wird. Aus diesem Anlass, der bedeutet, dass der normale Alltag mit dem neuen Eheleben beginnt, wird
eine solche Feier veranstaltet.
244
Beobachtung/Hochzeitsfeiern/Addīs Abäbā/1991, Bahər Dār und Gondär 1997 245
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 246
das neue Eheleben 247
traditionelle Haushaltsutensilien 248
Es ist mir nicht bekannt, warum nur dieser Tag für die qələqəl-Feier festgelegt wird.
2.5. ALLGEMEINE HOCHZEITSGESÄNGE
So wie die funktional an verschiedene Phasen einer Hochzeitsfeier gebundenen Lieder, besingen auch
allgemeine Hochzeitsgesänge die Brautleute entweder einzeln oder als Paar. Der Gesangstext lässt sich je
nach Geschlecht (d.h. Braut/Bräutigam) unterschiedlich gestalten. Aufgrund dessen kommen Verkürzun-
gen oder Verlängerungen von Wörtern und Silben vor, die eine Melodievariation innerhalb der gegebenen
Melodiestruktur erfordern. Diese Lieder sind u.a.:
Tab. D: Allgemeine traditionelle Hochzeitsgesänge der amārā
Titel/Originalschrift Umschrift Übersetzung Gesangsinhalt bezogen auf
Braut Bräu-
tigam
Be-
gleiter
Gäste Braut
eltern
57 ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə (Redundanz) x x
6 አሞራ በሰማይ ሲያይሽ ዋለ
amõrā bäsämay
siyayəh/š walä
Der Rabe sah dich vom Himmel
herab
x x
44 ኩራት ኩራት kurāt kurāt Stolz, stolz x x
11 አርካ በሉላቸው arkā bälulačäw Sagt arkā (Redundanz) für sie x x
35 እሸቴ ወይና əšete wäynā (Redundanz) x x
21 ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ aymõlam
wägäbwā
Ihre Taille ist so dünn wie ein x
54 ንቦ አትናደፊ nəbõ atənadäfī Biene, Biene, stich nicht x x x x x
64 የÙሮዬ ጤናዳም yägwaroyē tenadām Meine Gartenpflanze x
55 ኦሆሆ ሙና ohohõ munā (Redundanz) x
12 አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz) x x
14 አሸወይና ነሽ ወይ ašäwayna näš wäy (Redundanz) x x
22 %ረ ነይ እቴ ärä näy ətē Oh! Komm meine Schwester x
69 የወይን አበባዬ yäwäyən abäbayē (Redundanz) x x
25 ሄደች አሉ hädäč alū Man erzählt, sie ist fortgegangen x
26 ሆይ መላ ነሽ hõy mälā näšə (Redundanz) x x
56 ጸጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang x
65 የኛማ ሙሸራ yäñamā mušərā Unser/e Bräutigam/Braut x x
61 ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz) x
45 ሎሚ ጣሉባት lomī talubāt Wirft Zitronen auf sie x
36 እስዋስ ሎሚ ናት əswas lomī nāt Sie ist eine Zitrone x
34 እራዶ ወሸባ əradõ wäšäbā (Redundanz) x x
31 እንደው የምሩ əndäw yämrū (Redundanz) x x
28 እልል ባሌ ኦሆ ələl bale ohõ (Redundanz) x x
68 የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäba (Redundanz) x x
67 የሺ ጋብች yäšī gabəččā (Redundanz) x
58 ሽነት šənätə (Redundanz) x
23 ጉርምርሜ gurəmrəmē* (Redundanz) * x x
10 አንቺ ቤላ ቤላ ančī bellā bellā* Du schöne, schöne* x
* = Diese Gesänge sind textlich nicht dargestellt.
Die Gesangstexte und Notationen sind im Folgenden zu betrachten:
Text zu Nr. 57 šäb əräb aläč mədərə249
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə Die Erde bebte,
b ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə die Erde bebte,
2 c T ኦሆሆ o hō hō (Redundanz)
d A አለች ምድር aläč mədərə die Erde.
3 a T ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə Die Erde bebte,
b ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə die Erde bebte,
4 c A ኦሆሆ o hō hō (Redundanz)
d T አለች ምድር aläč mədərə die Erde.
5 a A ወርቅዬ ልጅዋን ስትድር wärqəyē ləğwān sətədərə Als wärqəyē die Hochzeit
ihres Kindes250 feierte,
b A ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə die Erde bebte,
6 c T ኦሆሆ o hō hō (Redundanz)
d A አለች ምድር aläč mədərə die Erde.
Text zu Nr. 6 amōrğ bäsämay siyayəh walä
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አሞራ በሰማይ ሲያይሽ ዋለ amōrā bäsämayə siyayəhə walä Der Rabe sah dich251
vom Himmel herab.
2 a T አሞራ በሰማይ ሲያይሽ ዋለ amōrā bäsämayə siyayəhə walä Der Rabe sah dich vom
Himmel herab.
2. Abschnitt
3 b A ሲያይሽ ዋለ siyayäw walä Er sah ihn.
c T %, ähä (Redundanz)
4 b1 A ሲያይሽ ዋለ siyayäw walä Er sah ihn.
c T %, ähä (Redundanz)
5 b1 A የገነቴ yägänätē "Gänäts252
c T %, ähä (Redundanz)
6 d A ነሽ እያለ nähə yalä bist du", sagt er.
c T %, ähä (Redundanz)
Text zu Nr. 44 kurāt kurāt
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ኩራት ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt kurāt ayələhəm wäyə Bist du253 nicht stolz?
b ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt ayələhəm wäyə Bist du nicht stolz?
2 a1 T ኩራት ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt kurāt ayələhəm wäy Bist du nicht stolz?
b ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt ayələhəm wäyə Bist du nicht stolz?
3 a2 A ሚዜዎችሀ እዚህ የሉም ወይ? mižewočəh əžih yälum wäyə Sind deine Begleiter nicht da?
b ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt ayələhəm wäyə Bist du nicht stolz?
4 a1 T ኩራት ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt kurāt ayələhəm wäyə Bist du nicht stolz?
b ኩራት አይልሽም ወይ? kurāt ayələhəm wäyə äy Bist du nicht stolz?
249
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 250
Je nach der Situation bezieht sich das Wort entweder auf die Braut (als Tochter) oder auf den Bräutigam (als Sohn). In diesem
Fall betrifft es die Mutter des Bräutigams. 251
den Bräutigam 252
Name der Braut 253
der Bräutigam
2. Abschnitt
5 c A ኩራት kurāt Stolz
d T አይልሽም ወይ? ayələhəm wäyə bist Du nicht?
6 c1 A ኩራት kurāt Stolz
d T አይልሽም ወይ? ayələhəm wäyə bist Du nicht?
Text zu Nr. 11 arkā bälulačäw
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
b አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
2 a1 %ረ የትኛው ነው ärä yätəñawu näwu Wer ist denn
b1 የዓለሙ ሚዜ? yä'alämū mīžē Alämūs254 Begleiter?
c አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
3 a T አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
b አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
4 a1 %ረ የትኛው ነው ärä yätəñawu näwu Wer ist denn
b1 የዓለሙ ሚዜ? yä'alämū mīžē Alämūs Begleiter?
c አርካ በደሞዜ arkā bädämõžē (Redundanz)
2. Abschnitt
5 d A ኦሆሆ አሀሀ ኤ ለበኑ ohõhõ ahāhā ē läbänū (Redundanz)
6 d T ኦሆሆ አሀሀ ኤ ለበኑ ohõhõ ahāhā ē läbänū (Redundanz)
3. Abschnitt
7 e A ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
e1 ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
8 e |ም አወጣሁልሽ səm awätahuləšə Ich nannte dich
e2 አትጠገብ በዬ atətägäb bəyē Atətägäb.
f ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
9 e T ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
e1 ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
10 e |ም አወጣሁልሽ səm awätahuləšə Ich nannte dich
e2 አትጠገብ በዬ atəägäb bəyē Atətägäb.
f ዘበናይ ማርዬ žäbänay mārəyē (Redundanz)
Text zu Nr. 35 əšätē wäynā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እሸቴ ወይና እሸቴ ወይን ሀረግ əšätē wäyənā əšätē wäyən haräg (Redundanz)
2 a T እሸቴ ወይና እሸቴ ወይን ሀረግ əšätē wäyənā əšätē wäyən haräg (Redundanz)
2. Abschnitt
3 b A የወይን ሀረግ yäwäyən haräg (Redundanz)
c T %, ähä (Redundanz)
4 b1 A የወይን ሀረግ yäwäyən haräg (Redundanz)
c T %, ähä (Redundanz)
5 b A እናትየው ənatəyäw Die Mutter
c T %, ähä (Redundanz)
6 b1 A ባለማዕረግ balämaräg voller Würde.
c T %, ähä (Redundanz)
254
Name des Bräutigams (Hochzeitsfeier/Addīs Abäba 1997)
Text zu Nr. 21 čəbõ aymõlam wägäbwā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ aymõlam wägäbwā Sie255 hat eine schmale Taille.
b ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ aymõlam wägäbwā Sie hat eine schmale Taille.
c ማር እሸት ነው ቀለብዋ mār əšät näw qäläbwā Frischer Honig ist ihre Nahrung.
2 a1 T ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ aymõlam wägäbwā Sie hat eine schmale Taille.
b ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ aymõlam wägäbwā Sie hat eine schmale Taille.
c ማር እሸት ነው ቀለብዋ mār əšät näw qäläbwā Frischer Honig ist ihre Nahrung.
2. Abschnitt
3 d A የት ነው የምትኖሪው? yät näw yämtənorīwu Wo wohnst Du?
e ያለሸበት ቦታ? yaläšəbät botā Wo ist dein Aufenthaltsort?
f T አሀ ahā (Redundanz)
4 d1 A የት ነው የምትኖሪው? yät näw yämtənorīwu Wo wohnst Du?
e1 ያለሸበት ቦታ? yaläšəbät botā Wo ist dein Aufenthaltsort?
f T አሀ ahā (Redundanz)
5 d2 A ስቃዬን አሳየኝ səqayen asayäñə Mich quält
g ውይ ያንቺ ትዝታ wuy yanəčī təžətā deine Nostalgie.
f T አሀ ahā (Redundanz)
6 d3 A ስቃዬን አሳየኝ səqayen asayäñə Mich quält
g1 ውይ ያንቺ ትዝታ wuy yanəčīwu təžətā. deine Nostalgie.
f T አሀ ahā (Redundanz)
Text zu Nr. 54 nəbõ atənadäfī
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ንቦ ንቦ አትናደፊ nəbõ nəbõ atənadäfī Biene Biene stech nicht!
b ንቦ አትናደፊ nəbõ atənadäfī Biene stech nicht!
2 a1 T ንቦ ንቦ አትናደፊ nəbõ nəbõ atənadäfī Biene Biene stech nicht!
b ንቦ አትናደፊ nəbõ atənadäfī Biene stech nicht!
2. Abschnitt
3 c A ንቦ nəbõ Biene
4 d T አትናደፊ atənadäfī stech nicht!
1. Abschnitt
5 e A የወርቅዬ እያልሽ እለፊ
yäwärqyē əyalš əläfī Sag wärqyē's256 und flieg vorbei!
b ንቦ አትናደፊ nəbõ atənadäfī Biene stech nicht!
6 a1 T ንቦ ንቦ አትናደፊ nəbõ nəbõ atənadäfī Biene Biene stech nicht!
b ንቦ አትናደፊ nəbõ atənadäfī Biene stech nicht!
2. Abschnitt
7 c A ንቦ nəbõ Biene
d T አትናደፊ atənadäfī stech nicht!
8 c A ንቦ nəbõ Biene
d T አትናደፊ atənadäfī stech nicht!
9 c A ንቦ nəbõ Biene
d T አትናደፊ atənadäfī stech nicht!
10 c A ንቦ nəbõ Biene
d T አትናደፊ atənadäfī stech nicht!
255
die Braut 256
Mutter der Braut ( Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1997)
Text zu Nr. 64 yägwaroyē tenadām
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A የÙሮዬ ጤናዳም yägwaroyē tenadām Du tenadam meines Gartens
b አብቢ በጣም abəbī bätām wachse rasch!
2 a T የÙሮዬ ጤናዳም yägwaroyē tenadām Du tenadām meines Gartens
b አብቢ በጣም abəbī bätām gedeihe rasch!
3 a A የÙሮዬ አባሎ yägwaroyē abalõ Du abalõ meines Gartens
b አብቢ ቶሎ abəbī tõlõ wachse schnell!
4 a T የÙሮዬ አባሎ yägwaroyē abalõ Du abalõ meines Gartens
b አብቢ ቶሎ abəbī tõlõ wachse schnell!
2. Abschnitt
5 c A አባሎ abalõ abalõ
d T አብቢ ቶሎ abəbī tõlõ Gedeihe schnell!
6 c A አባሎ abālõ abalõ
d T አብቢ ቶሎ abəbī tõlõ Gedeihe schnell257!
Text zu Nr. 55 ohõ hõ mūnā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā258
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā
2. Abschnitt
2 b A ተይ ሙና ተይ ሙና täyə munā täy munā Bitte Munā, bitte Munā.
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā Ohõ hõ Munā,
3 b1 A ተይ ሙና ተይ ሙና täyə munā täy munā Bitte Munā, bitte Munā.
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā Ohõ hõ Munā,
4 b2 A ተይ ሙና ተይ ሙና täyə munā täy munā Bitte Munā, bitte Munā.
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā Ohõ hõ Munā,
5 b3 A የሙሽራው ማማር yämušəraw mamār Der Glanz des Brautpaares,
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā,
6 b3 A የጋቢው ውበት yağabiwu wubätə die Grazie der Begleiter,
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā,
7 b2 A ልቤን አደረገው ləbēn adärägäw machte mein Herz,
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā,
8 b3 A ዘረዛራ ወንፊት žäržarā wänfitə zu einem Sieb.
a T ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā ohõ hõ Munā,
3. Abschnitt
9 c A ሞንàናዬ mõnmwanayē Meine Niedliche,
c1 ሞንàናዬ mõnmwanayē meine Niedliche!
10 c2 ሞንàናዬ mõnmwanayē Meine Niedliche,
c3 ሞንàናዬ mõnmwanayē meine Niedliche!
11 d ና ገዳይ ደሞ na gäday dämõ (Redundanz)
257
Die Wörter tenadām und abalõ sind Pflanzensorten, die die Braut symbolisieren. 258
Frauenname
Text zu Nr. 12 äša gädāwõ/1. Abschnitt
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
c %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
2 a %ረ አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
c %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
3 a አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b1 የታማንብሽ yätāmānəbəšə Gerüchte werden verbreitet.
c ወጣa እንዴት ነሽ wätatwa əndēt näšə Wie geht es dir junges Mädchen?
4 a T አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
c %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
5 a አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
c %ረ አሻ ገዳዎ ärä aša gädawõ (Redundanz)
6 a አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
b1 የታማንብሽ yätāmānəbəšə Gerüchte werden verbreitet.
c ወጣa እንዴት ነሽ wätatwa əndēt näšə Wie geht es dir junges Mädchen?
2. Abschnitt
7 d A አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
e ለመንገደኛ ሰው lämängädäña säwu Für einen Reisenden
8 d1 T አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
e2 A አይሰጡም ስንቁን ayəsätūm sənqūnə packt man kein Essen ein.
9 d T አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
e A እየበላው ይሂድ əyäbälawu yəhid Er soll unterwegs
10 d1 T አሻ ገዳዎ aša gädawõ (Redundanz)
e2 A አንጀት አንጀቱን anğät anğätunə mit seinen Gedanken spielen.
Text zu Nr. 14 äšäwäyna wäynā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A አሸወይና ወይና ašäwäynā wäynā (Redundanz)
b T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
2 a1 A ወይና wäynā (Redundanz)
b1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
2. Abschnitt
3 c A አሸወይና ነሽ ወይ? ašäwäynā näšə wäyə Bist du259 mein ašwäyna?
d ትመጫለሽ ወይ? təmäçaläš wäyə Kommst du?
4 c T አሸወይና ነሽ ወይ? ašäwäynā näšə wäyə Bist du260 mein ašwäyna?
d ትመጫለሽ ወይ? təmäçaläš wäyə Kommst du?
259
die Braut 260
die Braut
Text zu Nr. 22 ärä näyə ətē
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A %ረ ነይ እቴ %ረ ነይ ärä näyə ətē ärä näyə Oh, komm Schwester, komm.
2 a T %ረ ነይ እቴ %ረ ነይ ärä näyə ətē ärä näyə Oh, komm Schwester, komm.
2. Abschnitt
3 b A %ረ ነይ %ረ ነይ ärä näyə ärä näy Oh, komm; komm.
c T %, ähä (Redundanz)
4 b1 A %ረ ነይ %ረ ነይ ärä näy ärä näy Oh, komm; komm.
c T %, ähä (Redundanz)
5 b2 A የሙሽሮች ማማር yämušərõč mamār Der Glanz der Brautleute,
c T %, ähä (Redundanz)
6 b1 A የሚዜው ውበት yämīžewu wubätə Die Grazie des Begleiters.
c T %, ähä (Redundanz)
7 b2 A %, ləbēn adärägäw macht mein Herz
c T ልቤን አደረገው ähä (Redundanz)
8 b1 A ዘርዛራ ወንፊት žäržarā wänfītə zu einem Sieb.
c T %, ähä (Redundanz)
Text zu Nr. 69 yäwäyən abäbayē261
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A የወይን አበባዬ yäwäyən abäbayē Traubenblüte262,
b T የወይና yäwäyənə Blüte,
2 a A የወይን አበባዬ yäwäyən abäbayē Traubenblüte-
b T የወይና yäwäyənə Blüte,
3 c A የወይን አበባዬ የወይን yäwäyən abäbayē yäwäyənə Traubenblüte, Blüte,
d እኛም ወደናል ይሁን əñām wädänal yəhūnə wir akzeptieren es263 auch.
4 a T የወይን አበባዬ yäwäyən abäbayē Traubenblüte,
b A የወይና yäwäyənə Blüte,
5 a T የወይን አበባዬ yäwäyən abäbayē Traubenblüte,
b A የወይና yäwäyənə Blüte,
6 c T የወይን አበባዬ የወይን yäwäyən abäbayē yäwäyənə Traubenblüte, Blüte,
d እኛም ወደናል ይሁን əñām wädänal yəhūnə wir akzeptieren es264 auch .
Text zu Nr. 25 hēdäč alū
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ሄደች አሉ hēdäč alū Sie ging
b ጋራ ጋራውን gārā gārāwunə die Berge hinauf
c ነፋሻውን näfāšawunə wo es windig ist.
2 a T ሄደች አሉ hēdäč alū Sie ging
b ጋራ ጋራውን gārā gārāwunə die Berge hinauf
c ነፋሻውን näfāšawunə wo es windig ist.
261
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 262
die Braut 263
das Heiraten ist gemeint 264
das Heiraten ist gemeint
2. Abschnitt
3 d A መሄድሽ መሄድሽ mähēdəšə mähēdəšə Dass du gehst, gehst,
e T %, ähä (Redundanz)
4 f A መሄድሽ ይወራል mähēdəšə yəwärāl gehst, erzählt man.
e T %, ähä (Redundanz)
5 d2 A ልቤ ካንቺ ጋራ ləbē kančī gārā Mein Herz mit dir
e T %, ähä (Redundanz)
6 f1 A እንደወፍ ይበራል əndä wäf ybärāl fliegt wie ein Vogel.
e T %, ähä (Redundanz)
Text zu Nr. 26 hoy mäla näš265
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alu hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg.
b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg.
2 a1 A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alū hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg.
b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg.
Text zu Nr. 56 sägurwā wärdõ wärdõ266
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
a1 ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
2 b ይጠቀለላል እንደ ዘንዶ yətäqälälāl əndä žändõ Es faltet sich wie ein Krokodil.
a2 ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
3 a T ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
a1 ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
4 b ይጠቀለላል እንደ ዘንዶ yətäqälälāl əndä žändõ Es faltet sich wie ein Krokodil.
a2 ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
Text zu Nr. 65 yäñāmā mušərā267
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā Unsere Braut,
a1 የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
b T የኛማ ሙሽራ yäñā mušərā unsere Braut268,
2 c A የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
c የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
d እፁብ ድንቅ |ራ əsūb dənq sərā etwas Wertvolles.
3 a T የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā Unsere Braut,
a1 የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
b A የኛማ ሙሽራ yäñā mušərā unsere Braut,
4 c T የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
c የኛማ ሙሽራ yäñāmā mušərā unsere Braut,
d እፁብ ድንቅ |ራ əsūb dənq sərā etwas Wertvolles.
265
Der Gesang besitzt drei Abschnitte (siehe vollständigen Gesangstext im Kapitel 3, Pkt. 3.1.3., S. 125-126) 266
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 267
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 268
Gesangszeilen 1 und 2 werden in derselben Reihenfolge wiederholt.
Text zu Nr. 61 wäläbē wäläbē269
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz)
b T ነይ መሐረቤ näy mähāräbē komm mein Taschentuch270!
2 a1 A ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz)
b1 ነይ መሐረቤ näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
3 a T ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz)
b A ነይ መሐረቤ näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
4 a1 T ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz)
b1 ነይ መሐረቤ näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
Text zu Nr. 45 lõmī talūbāt
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ሎሚ ጣሉባት በደረa lõmī talūbāt bädärätwā Werft Zitrone auf ihre271 Brust,
a1 ጣሉባት በደረa talūbāt bädärätwā werft auf ihre Brust.
a2 የጨዋ ልጅ ናት መ\ረa yäçäwa ləğ nāt mäsärätwā Ihre Wurzeln haben gesittete
Familie inne.
b ጣሉባት በደረa talūbāt bädärätwā Werft auf ihre Brust!
2 a T ሎሚ ጣሉባት በደረa lõmī talūbāt bädärätwā Werft Zitrone auf ihre Brust!
a1 ጣሉባት በደረa talūbāt bädärätwā Werft auf ihre Brust.
a2 የጨዋ ልጅ ናት መ\ረa yäçäwa ləğ nāt mäsärätwā Ihre Wurzeln haben gesittete
Familie inne.
b ጣሉባት በደረa talūbāt bädärätwā Werft auf ihre Brust.
2. Abschnitt
3 c A ጣሉባት talūbāt Werft
d T በደረa bädärätwā auf ihre Brust!
4 c A ጣሉባት talūbāt Werft
d T በደረa bädärätwā auf ihre Brust!
Text zu Nr. 36 əswās lõmī nāt
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እስዋስ ሎሚ ናት የበረሃ əswas lõmī nāt yäbärähā Sie272 ist eine Wüstenzitrone,
a1 ሎሚ ናት የበረሃ lõmī nāt yäbärähā eine Wüstenzitrone.
2 a T እስዋስ ሎሚ ናት የበረሃ əswas lõmī nāt yäbäräha Sie ist eine Wüstenzitrone,
a1 ሎሚ ናት የበረሃ lõmī nāt yäbärähā eine Wüstenzitrone.
3 a A ዘመድ የሌላት መስላ ድሃ žämäd yälēlat mäslā dəha Sie sieht arm aus, als ob sie keine
Verwandten hätte.
a1 A ሎሚ ናት የበረሃ lõmī nāt yäbärähā Sie ist eine Wüstenzitrone.
4 a T እስዋስ ሎሚ ናት የበረሃ əswas lõmī nāt yäbärähā Sie ist eine Wüstenzitrone,
a1 ሎሚ ናት የበረሃ lõmī nāt yäbärähā eine Wüstenzitrone.
269
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt. 270
symbolisiert die Braut 271
die Braut 272
die Braut
2. Abschnitt
5 b A ሎሚ ናት lõmī nāt Sie ist eine Zitrone,
c T የበረሃ yäbärähā der Wüste.
6 b A ሎሚ ናት lõmī nāt Sie ist eine Zitrone
c T የበረሃ yäbärähā der Wüste.
Text zu Nr. 34 əradõ wäšäbā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እራዶ ወሸባ ነይ ቀዘባ əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
2 a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
2. Abschnitt
3 b A ሙሽሪት ሙሽራው mūšərīt mūšərawu Braut und Bräutigam
c T እራዶ əradõ (Redundanz)
d A ወሸባ wäšäbā (Redundanz)
a T እራዶ ወሸባ ነይ ቀዘባ əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
4 b1 A እንክዋን ደስ ያላችሁ ənkwan däsə yalačəhu Herzlichen Glückwunsch!
c T እራዶ əradõ (Redundanz)
d A ወሸባ wäšäbā (Redundanz)
a T እራዶ ወሸባ ነይ ቀዘባ əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
5 b1 A ተከበረ ዛሬ täkäbärä žarē Heute wurde gefeiert
c T እራዶ əradõ (Redundanz)
d A ወሸባ wäšäbā (Redundanz)
a T እራዶ ወሸባ ነይ ቀዘባ əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
6 b1 A መልካም ጋብቻችሁ mäləkām gābəčačəhu eure Hochzeit.
c T እራዶ əradõ (Redundanz)
d A ወሸባ wäšäbā (Redundanz)
a T እራዶ ወሸባ ነይ ቀዘባ əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
Text zu Nr. 31 əndäwu yäməru273
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A እንደው የምሩ የምሩ əndäwu yäməru yäməru (Redundanz)
a1 እንደው የምሩ əndäwu yäməru (Redundanz)
2 a2 እንደው የምሩ የምሩ əndäwu yäməru yäməru (Redundanz)
a1 እንደው የምሩ əndäwu yäməru (Redundanz)
3 a3 ሙሽሪት ሙሽራው የምሩ mušərīt mušəraw yäməru Mögen die Brautleute
b በአንድ ላይ እደሩ band layə yənuru zusammen leben.
4 a T እንደው የምሩ የምሩ əndäwu yäməru yäməru (Redundanz)
a1 እንደው የምሩ əndäwu yäməru (Redundanz)
5 a2 እንደው የምሩ የምሩ əndäwu yäməru yäməru (Redundanz)
a1 እንደው የምሩ əndäwu yäməru (Redundanz)
6 a3 ሙሽሪት ሙሽራው የምሩ mušərīt mušəraw yäməru Mögen die Brautleute
b በአንድ ላይ ይኑሩ band layə yənuru zusammen leben.
273
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt.
Text zu Nr. 28 ələl balē ohõ
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
b እልል ባሌ ሆይ ələl bale hõyə (Redundanz)
2 a እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
b እልል ባሌ ሆይ ələl bale hõyə (Redundanz)
3 a እልል ባሌ ሆይ ələl balē hõyə (Redundanz)
c ትመጫለሽ ወይ? təmäčāläšə wäyə Kommst du?
4 a T እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
b እልል ባሌ ሆይ ələl bale hõyə (Redundanz)
5 a እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
b እልል ባሌ ሆይ ələl bale hõyə (Redundanz)
6 a እልል ባሌ ሆይ ələl balē hõyə (Redundanz)
c ትመጫለሽ ወይ? təmäčāläšə wäyə Kommst du?
2. Abschnitt
7 c A ሙሽሪት ሙሽራው mušərīt mušərawu Braut und Bräutigam,
እንክዋን ደስ ያላችሁ ənkwan däs yalačəhu herzlichen Glückwunsch!
8 a T እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
እልል ባሌ ሆይ ələl balē hõyə (Redundanz)
9 c1 A ተከበረ ዛሬ täkäbärä žārē Heute wurde
መልካም ጋብቻችሁ mäləkām gabəčāčəhu euer Hochzeit gefeiert.
10 a T እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz)
እልል ባሌ ሆይ ələl balē hõyə (Redundanz)
11 b A እልል ባሌ ሆይ ələl balē hõyə (Redundanz)
ትመጫለሽ ወይ? təmäčāläšə wäyə Kommst du?
Text zu Nr. 68 yäwäfē bər abäbā274
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäbā (Redundanz)
b የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäbā (Redundanz)
2 a T የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäbā (Redundanz)
b የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäbā (Redundanz)
3 a A ወፊቱ ብር አለች wäfītū bər aläčə Der Vogel fliegt
b ሙሽሮች እያለች mušəročəəyaläčə im Namen der Brautleute.
4 a T ወፊቱ ብር አለች wäfītū bər aläčə Der Vogel fliegt
b ሙሽሮች እያለች mušəročəəyaläčə im Namen der Brautleute.
274
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt.
Text zu Nr. 67 yäšī gabəččā
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1. Abschnitt
1 a A ኦሆሆ የሺ ጋብቻ o ho ho yäšī gabəčā (Redundanz)
2 a T ኦሆሆ የሺ ጋብቻ o ho ho yäšī gabəčā (Redundanz)
3 b A ይበቃታል የእናa ብቻ yəbäqatālə yänātwa bəčā Ihr reicht der Reichtum ihrer Mutter.
a T ኦሆሆ የሺ ጋብቻ o ho ho yäšī gabəčā (Redundanz)
4 c A ይበቃታል የአባa ብቻ yəbäqatālə yabātwa bəčā Ihr reicht der Reichtum275 ihres Vaters.
a T ኦሆሆ የሺ ጋብቻ o ho ho yäšī gabəčā (Redundanz)
Text zu Nr. 58 šənätə276
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሽነት šənätə (Redundanz)
b T ነይ ነይ näyə näyə Komm, komm,
2 a A ሽነት šənätə (Redundanz)
b T ነይ ነይ näyə näyə komm, komm,
3 a1 A ሽነት šənätə (Redundanz)
c የሙሽሪት እናት yämūšrīt ənātə Mutter der Braut,
ነይ ነይ näyə näyə komm, komm!
4 a T ሽነት šənätə (Redundanz)
b A ነይ ነይ näyə näyə Komm, komm,
5 a T ሽነት šənätə (Redundanz)
b A ነይ ነይ näyə näyə komm, komm,
6 a1 T ሽነት šənätə (Redundanz)
c የሙሽሪት እናት yämūšrīt ənātə Mutter der Braut,
ነይ ነይ näyə näyə komm, komm!
275
Gemeint ist die Braut. Es ist unklar ob es sich um das Reichtum, die Schönheit u.a. ihrer Eltern handelt. Im Übrigen kommt
im Anschluß des Gesanges oft das Lied bzw. der Liedteil žäbänay marəyē (siehe Nr. 4; 6. Abschnitt) als zweiten Abschnitt vor.
276
Der Gesang besteht nur aus einem Abschnitt.
3 . A N A L Y S E D E R H O C H Z E I T S L I E D E R
In der ersten Übersicht (Tab.E) ist das gesamte dokumentierte Repertoire der amārischen Hochzeitsge-
sänge dargestellt. Neben der Bezeichnung der Titel, sind vor allem die Zuordnung zu der jeweiligen qəñət-
Tonreihe, die funktionale Bindung an die Handlungen der Hochzeitszeremonie und der textinhaltliche
Bezug zu beachten.
Die meisten Hochzeitslieder können den Tonreihen təžətā und ančī hoyē länē zugeordnet werden. Nur
wenige Lieder erscheinen im qəñət-bātī, die Tonreihe ambassäl kommt gar nicht vor.
Textinhaltlich bezieht sich ca. die Hälfte aller Hochzeitsgesänge auf die Braut, gefolgt von Gesängen die
sich an das Brautpaar richten. Dem Bräutigam und seinen Begleitern sind nur einige handlungsabhängige
Lieder gewidmet. Einzelne, ebenfalls handlungsabhängige Gesänge richten sich an die Brauteltern und an
alle Anwesenden. Handlungsunabhängig können Gesänge mit textinhaltlichem Bezug auf die Hochzeits-
gäste sein.
Die zweite Übersicht (Tab. F) veranschaulicht, wie die einzelnen Hochzeitsgesänge melodisch, rhyth-
misch, metrisch und textlich aufgebaut und aufgeführt werden. Hinzu kommen die verschiedenen Wech-
selgesangsformen (Ruf-, Strophen-, Refrain- und Zeilengesänge). Die Begleitungsmethoden sind hier aus-
geschlossen, da kaum ein Hochzeitsgesang ohne irgendeine Begleitungsart wie Klatschen, Tanzen und
Trillern u.ä. dargestellt wird.
Die Angaben sollen nicht unbedingt als festgelegte Regeln betrachtet werden. Sie kennzeichnen nur die
weitgehend gebräuchliche und typische Aufführungsform im traditionellen Hochzeitsrepertoire. Bei-
spielsweise ist in allen Gesängen die freie Melodievariation erlaubt, die dem einzelnen Sänger eine gewis-
se Bewegungsmöglichkeit innerhalb der gegebenen Tonreihe, gewährt. Die grobe Melodiestruktur muss
jedoch erkennbar bleiben.
Aus der Gesamtheit des Hochzeitsrepertoires ist ersichtlich, dass hier feste Melodien, Metren und unver-
änderliche Tempi mit überwiegend beschränkten Textvorgaben typisch sind. Die unmittelbar handlungs-
gebundenen und nicht handlungsgebundenen Gesänge sind jeweils zu 50% im Repertoire vertreten.
Fast alle Hochzeitsgesänge bestehen aus Wechselgesängen. Dies ist eine allgemeine und typische Erschei-
nung für das gesamte traditionelle Musikrepertoire der amārā.
Solistisch dargestellte Gesänge gibt es nur wenige. Es sind in der Regel keine vollständigen Gesänge, mit
Ausnahme des Gesanges mušərāyē (s. Notation Nr. 53), sondern Teile dieser. Sie kommen innerhalb von
Wechselgesängen vor und zwar meistens als 2. oder 3. Abschnitt. Sie sind meistens in Strophen gegliedert
wie z.B. das Lied amrwāl šägänū (s. Notation Nr. 7).
Dagegen ist der einstimmige Chorgesang, wie z.B. in der äthiopischen Kirchenmusik üblich, im Hoch-
zeitsrepertoire der amārā kaum bzw. überhaupt nicht präsent.
Tab. E: Repertoire der amārischen Hochzeitslieder
Nr. Titel in Originalsprache Phonetische Umschrift Übersetzung qəñət-Tonreihe funktionale Bindung Text
bezo-
gen auf
Notation
vorhan-
den
1 አበባው ባበባው ላይ abäbāwū babäbāwū layə Blumen über Blumen təžətā beliebig austauschbar 1
2 አበጀሽ የማ ልጅ abäğäš yäñā ləğə Gut gemacht, unser Kind ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1
3 አጀባዬ ağäbayē (Redundanz) ančī hoyē länē gesungen während die Braut sich ihr Hochzeitskleid
anlegen und sich schminken lässt
1
4 አሁን ደመቅሽ/ህ አበባዬ ahūn dämäq/š abäbāyē Jetzt strahlst du meine Blume ančī hoyē länē gesungen nach Beendigung der Vorbereitung der
Braut; insbesondere wenn sie sich ins Wohnzimmer
begibt und auf die Ankunft des Bräutigams wartet
1
5 አልማዝ ምን ዕዳ ነው? almāž mən əda näwū Almāž, was für ein Problem? təžətā beliebig austauschbar 1
6 አሞራ በሰማይ ሲያይሽ ዋለ
amõrā bäsämay siyayəš
walä
Der Rabe sah dich vom Himmel
herab
təžətā beliebig austauschbar 1/2
7 አም…ል ሸገኑ amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön təžətā gesungen während und nach dem die Braut ihre Hoch-
zeitskleidung in ihrem Elternhaus anlegt.
1/2
8 አንቺ አለላ ሙዳይ ančī alälā mudāyə Du aus geflochtenem Korb ančī hoyē länē gesungen für die Braut beim Verlassen ihres Eltern-
hauses
1
9 አናስገባም \ርገኛ anāsgäbām sərgäñā Wir lassen keinen Hochzeitsgast
hinein
ančī hoyē länē bei Ankunft des Bräutigams im Haus der Braut 2/3
10 አንቺ ቤላ ቤላ ančī bēllā bēllā Du schöne schöne təžətā beliebig austauschbar 1
11 አርካ በሉላቸው arkā bälulāčäwu (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
12 አሻ ገዳዎ ašā gädawõ (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1
13 አሸበል ገዳዬ ašäbäl gädayē (Redundanz) bātī beliebig austauschbar 1/2
14 አሸወይና ወይና ašäwäynā wäynā (Redundanz) ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1
15 አሼ ሙናና ašē munanā (Redundanz) bātī beliebig austauschbar 1/2
16 አትሸ—ትም ወይ? atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hinausbeglei-
ten?
təžətā beim Verlassen ihres Elternhauses für die Braut ge-
sungen
1
17 በሐር አሽመው bähār ašəmäwu (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
18 ባልንጀሬ bālənğärē Meine Freundin ančī hoyē länē als Trostlied für die Braut gesungen während der
Vorhochzeitstage und am Hochzeitstag, wenn sie auf
den Bräutigam wartet
1
19 ብቅ በይ ከÙዳ bəq bäy kägwadā Komm aus dem Nebenzimmer ančī hoyē länē gesungen während die Braut sich ihr Hochzeitskleid
anlegen und sich schminken lässt
1
20 ብር አምባር bər ambār Silbernes Armband təžətā gesungen zur Beglückwünschung der Brauteltern am
folgenden Tag der Hochzeit
2
21 ችቦ አይሞላም ወገብዋ čəbõ ayəmolām wägäbwā Ihre Taille ist schmal təžətā beliebig austauschbar 1
22 %ረ ነይ እቴ ärä näy ətē Oh, komm ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1
23 ጉርምርሜ gurmrmē (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 5
24 ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 2
25 ሄደች አሉ hēdäč alū Sie ist fort, erzählt man ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1
26 ሆይ መላ ነሽ hõy mäla näš hoy, ein Ausweg bist du təžətā beliebig austauschbar 1
27 ይቺ ናት ወይ ሚዜሽ? ይሄ ነው ወይ ሚዜህ?
yəčī nāt wäy mīžēšə bzw.
yəhē näw wäy mīžēhə
Ist sie deine Begleiterin?
Ist er dein Begleiter?
ančī hoyē länē gesungen jeweils von der Gruppe der männl. Beglei-
ter und den Brautjungfrauen, um sich gegenseitig zum
Tanz und zur aktiven Beteiligung zu animieren
3
28 እልል ባሌ ኦሆ ələl balē ohõ (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
29 እማም ወሸባ əmām wäšäbā (Redundanz) bātī beliebig austauschbar 1/2
30 እንዳላይሽ əndalayəš So, dass ich dich nicht zu sehen
bekomme
ančī hoyē länē gesungen während der Vorbereitung der Braut in
ihrem Elternhaus
1
31 እንዲያው የምሩ əndäw yämərū (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
32 እኔ አልሰጥም እህቴን ənē alsätəm ətēnə Ich gebe meine Schwester nicht
weg
ančī hoyē länē gesungen bei Ankunft des Bräutigams von den
Schwestern der Braut
1
33 እኔ አልሰጥም ልጄን ənē alsätəm ləğēnə Ich gebe mein Kind nicht weg ančī hoyē länē gesungen von der Brautfamilie bzw. ihren Angehöri-
gen bei Ankunft des Bräutigams
1
34 እራዶ ወሸባ əradõ wäšäbā (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
35 እሸቴ ወይና əšätē wäynā (Redundanz) ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1/2
36 እሰዋስ ሎሚ ናት əswās lõmī nāt Sie (die Braut) ist eine Zitrone təžətā beliebig austauschbar 1
37 እስቲ ሸልሙን əstī šälmūn Bitte beschenken Sie uns ančī hoyē länē gesungen am nächsten Tag nach der Hochzeit zur
Beglückwünschung der Brauteltern
4
38 እስቲ አምጣው የደሙን ሸማ
əstī amtaw yädämūn
šämā
Bring einmal das blutige Tuch təžətā gesungen von den Brautangehörigen am der Hochzeit
folgenden Tag bei der Beglückwünschung der
Brauteltern als Antwort zu dem Lied bər ambar
3
39 እቴ ባልንጀር ətē balənğär Meine Freundin təžətā als Trostlied für die Braut gesungen während der
Vorhochzeitstage und am Hochzeitstag, wenn sie auf
den Bräutigam wartet
1
40 እቴ ሸንኮሬ ətē šänkõrē Meine Schwester šänkorē təžətā gesungen für das Brautpaar nach Beendigung der
Abendveranstaltung auf ihrem Weg ins Schlafzimmer
1
41 እየበሉ እየጠጡ ዝም əyäbälū yätätū žəmə Sie essen, trinken und sagen
nichts
təžətā gewöhnlich gesungen nach einem Mahl, z.B. Abend-
essen, um Gäste zum Gesang und Tanz aufzufordern
5
42 ኬላው ተ\በረ kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei təžətā gesungen am nächsten Tag nach der Hochzeit zur
Beglückwünschung der Brauteltern
1/2
43 ኩሉን ማን ኩዋለሽ? kulūn mān kwāläšə Wer hat dich geschminkt? ančī hoyē länē gesungen während die Braut sich ihr Hochzeitskleid
anlegen und sich schminken lässt
1
44 ኩራት ኩራት kūrāt kūrāt Stolz ! Stolz ! ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1/2
45 ሎሚ ጣሉባት lõmī talubāt Werft Zitronen auf sie təžətā beliebig austauschbar 1
46 መሄዴ ነው ማጂ mähēdē näw mağī Ich gehe nach Mağī277 təžəta beliebig austauschbar 1/2
47 መሄድዋ ነው mähēdwā näwū Sie geht ančī hoyē länē gesungen in dem Moment des Abschieds vom Eltern-
haus seitens der Angehörigen der Braut
1
48 ሚዜው ሽቶ አምጣ mīžēw šəttõ amtā Begleiter bring/gib uns Parfüm ančī hoyē länē gesungen bei der Ankunft des Bräutigams; traditions-
gemäß werden in diesem Moment ein oder mehrere
Parfüms von der Verwandtschaft der Braut erwartet,
die von den Begleitern auf die Teilnehmer gesprüht
werden
3
49 ሚዜው ድሀ ነው mīžēw dəhā näwū Der Begleiter ist arm ančī hoyē länē gesungen erst dann, wenn der/die Begleiter des Bräu-
tigams nicht schnell genug das Parfüm in die Menge
gesprüht haben
3
50 ሙሽሪት ለምዳለች mūšərīt lämdaläčə Unsere Braut hat sich gewöhnt təžətā gesungen am dritten Tag nach der Hochzeit zur mäls-
Feier
1
51 ሙሽሪት ልመጂ mūšərīt ləmäğī Braut gewöhne dich təžətā beliebig austauschbar 1
52 ሙሽሮች ማሬ ማሬ mušərõč marē marē Brautleute, Honig, Honig ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1/2
53 ሙሽራዬ mušərayē Meine Braut/mein Bräutigam təžətā gesungen als Begleitlied für das Brautpaar beim ge-
meinsamen Verlassen oder Betreten eines Hauses,
oder bei bestimmten Bewegungen wie z.B. das Eröff-
nen des Hochzeitsbuffets
1/2
54 ንቦ አትናደፊ nəbõ atənādäfī Biene, Biene, stich nicht ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1
55 ኦሆሆ ሙና ohõ hõ munā (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1
56 ፀጉ… ወርዶ ወርዶ sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar wallt herunter təžətā beliebig austauschbar 1
57 ሸብ እረብ አለች ምድር šäb əräb aläč mədərə Der Boden bebt vor Freude təžətā beliebig austauschbar 1/2
58 ሽነት šənätə (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1/2
59 ታ\ረች በጉልቻ tasäräč bäguləččā Sie wurde durch die Herdsteine
gebunden
bātī gesungen insbesondere während die Braut in ihrem
Elternhaus angekleidet wird
1
60 ተውበሻል አሉ täwūbäšāl alū Man erzählt, du bist schön təžətā beliebig austauschbar 1
61 ወለቤ ወለቤ wäläbē wäläbē (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1
62 ወንድምዬ wändəməyē Mein Bruder ančī hoyē länē gesungen beim Abholen der Braut vom Elternhaus 2
63 የቤተ ዘመዱ yäbētä žämädū Die Verwandtschaft bātī beliebig austauschbar 6
64 የÙሮዬ ጤናዳም yägwarõyē tenādām Meine Gartenpflanze təžətā beliebig austauschbar 1
65 የኛማ ሙሽራ yäñāmā mūšərā Unsere Braut/unser Bräutigam təžətā beliebig austauschbar 1/2
66 የኔ አበባ ነሽ yänē abäbā näš Du bist meine Blume təžətā beliebig austauschbar 1/2
277
Ortsnahme in der Region Käffa.
67 የሺ ጋብቻ yäšī gabəččā (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar 1
68 የወፌ ብር አበባ yäwäfē bər abäbā (Redundanz) ančī hoyē länē beliebig austauschbar 1/2
69 የወይን አበባዬ yäwäyən abäbāyē Meine Weintraubenblüte təžətā beliebig austauschbar 1
70 የዛሬ ዓመት yäžarē amätə Heut in einem Jahr təžətā gesungen für das Brautpaar nach Beendigung der
Abendveranstaltung auf ihrem Weg ins Schlafzimmer
1/2
71 ይዝዋት በረረ yəžwāt bärärä Er nimmt sie und rennt davon ančī hoyē länē gesungen beim Verlassen des Elternhauses der Braut 2
72 ዘበናይ ማርዬ žäbänay māryē (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar; es wird aber auch speziell am
folgenden Tag nach der Hochzeit; d.h. bei der Zere-
monie der Beglückwunschung der Brauteltern gesun-
gen
1
1 = Braut; 2 = Bräutigam; 3 = Begleiter des Bräutigams; 4 = Brauteltern; 5 = alle Anwesenden; 6 = Hochzeitsgäste
= Transkription nach Tonaufnahme (s. Anhang, Verzeichnis der Tonaufnahmen)
= Notation aus dem Gedächtnis (Angabe von Tonaufnahmen zum Vergleich siehe Anhang, Verzeichnis der Tonaufnahmen)
Tab. F: Melodische, ryhtmische, metrische und textliche Aufbau und Aufführung der traditionellen amārischen Hochzeitsgesänge
Wechselgesänge
Solo-
ganz oder teilweise
Während der Hochzeits-
zeremonie
Text ganz oder teilweise
Melodieabauf
ganz oder teilweise
Metrum
Tempo
Nr.
Umschrift des Titels
Ruf-
Wech-selg.
Strophen-
/Refrain-Wech-
selg.
Zeilen-
Wechselg.
handlungs-
gebunden
nicht
handlungs- gebunden
bschränkt un-
beschränkt
frei fest frei fest veränder-
lich
unver-
änderlich
1 abäbāwū babäbāwū layə x x x x x x
2 abäğäš yäñā ləğə 2. AB 1. AB x x x x x
3 ağäbayē x x x x x x
4 ahūn dämäq/š abäbāyē 2. AB 1. AB x x x x x
5 almāž mən əda näwū 1. u. 3 AB 2. AB x x x x x
6 amõrā bäsämay siyayəš walä 2. AB 1. AB x x x x x
7 amrwāl šägänū 1. AB 2. AB x x x x x
8 ančī alälā mudāyə 2. AB 1. AB x x x x x
9 anāsgäbām sərgäñā 2. AB 1. AB x x x x x
10 ančī bēlā bēlā 2. AB 1.AB x x x x x
11 arkā bälulāčäwu 1. u. 3.AB 2. AB x x x x x
12 ašā gädawõ 2. AB 1. AB x x x x x
13 ašäbäl gädayē 1. AB 2. AB x x x x x
14 ašäwäynā wäynā 1. AB 2. AB x x x x x
15 ašē munanā 2. AB 1. AB 3. AB x x x x x
16 atšäñwatəm wäy x x x x x x
17 bähār ašəmäwu 2. AB 1. AB x x x x x
18 bālənğärē 2. AB 1. AB x x x x x
19 bəq bäy kägwadā 2. AB 1. AB x x x x x
20 bər ambār 1. AB x x x x x
21 čəbõ ayəmolām wägäbwā 2. AB 1. AB x x x x x
22 ärä näy ətē 2. ,3. u. 4.
AB
1. AB x x x x x
23 gurmrmē x x x 1. AB 2. AB x x x
24 hay lõgā x x x x x x x
25 hēdäč alū 2. AB 1. AB x x x x x
26 hõy mäla näšə 1. u.3.AB 2. AB x 1. u.3.AB 2. AB x x x
27 əčī nāt wäy mīžēšə bzw.
yəhē näw wäy mīžēhə2. AB 1. AB x x x x x
28 ələl balē ohõ 1. AB 2. AB x x x x x
29 əmām wäšäbā 2. AB 1. AB x 1. AB 2. AB x x x
30 əndalayəš x x x x x x
31 əndäw yämərū 1. AB x x x x x
32 ənē alsätəm ətēnə 2. AB 1. AB x x x x x
33 ənē alsätəm ləğēnə 2. AB 1. AB x x x x x
34 əradõ wäšäbā 2. AB 1. AB x 1. AB 2. AB x x x
35 əšätē wäynā 2. AB 1. AB x x x x x
36 əswās lõmī nāt 2. AB 1. AB x x x x x
37 əstī šälmūn 2. AB 1. AB x x x x x
38 əstī amtaw yädämūn šämā x x x x x x
39 ətē balənğär x x x x x x
40 ətē šänkõrē x x x x x x
41 əyäbälū yätätū žəmə 2. AB 1. AB x x x x x
42 kēlawu täsäbärä x x x x x x
43 kulūn mān kwāläšə 2. AB 1. AB x x x x x
44 kūrāt kūrāt 2. AB 1. AB x x x x x x
45 lõmī talubāt 2. AB 1. AB x x x x x
46 mähēdē näw mağī x x x x x x
47 mähēdwā näwū 2. AB 1. AB x x 1. AB 2. AB x x x
48 mīžēw šəttõ amtā 2. AB 1. AB x x x x x
49 mīžew dəhā näwū 2. AB 1. AB x x x x x
50 mūšərīt lämdaläčə x x x x x x
51 mūšərīt ləmäğī x x x x x x
52 mušərõč marē marē 2. AB 1. AB x x x x x
53 mušərayē x x 1. AB 2. AB x x x
54 nəbõ atənādäfī 2. AB 1. AB x x x x x
55 ohõ hõ munā 2. AB 1. AB 3. AB x 1. u.2.AB 3. u.4.AB x x x
56 sägurwā wärdõ wärdõ 1. AB x x x x x
57 šäb əräb aläč mədərə 1. AB x x x x x x
58 šənätə 1. AB x x x x x
59 tasäräč bäguləččā x x x x x x
60 täwūbäšāl alū 1. AB x x x x x
61 wäläbē wäläbē 1. AB x x x x x
62 wändəməyē x x x x x x
63 yäbētä žämädū 1. AB 2.u.3. AB x x 1. AB 2.u.3. AB 1. AB 2. u. 3.
AB
1. AB 2.u.3.
AB
1. AB 2.u.3. AB
64 yägwarõyē tenādām 2. AB 1. AB x x x x x
65 yäñāmā mūšərā x x Refrain Strophen x x x
66 yänē abäbā näš 2. AB 1. AB 3. AB x 1. u.2 AB 3. AB 3. AB 1. u.2
AB
x x
67 yäšī gabəččā x x x x x x
68 yäwäfē bər abäbā x x x x x x
69 yäwäyən abäbāyē x x x x x x
70 yäžarē amätə x x x x x x
71 yəžwāt bärärä 2. AB 1. AB x x x x x
72 žäbänay mārəyē x x x x x x x
AB = Abschnitt
3.1. ANALYSE 1: ABSCHNITTE IM LIED
Das amārische Hochzeitsrepertoire ist durch Gesänge gekennzeichnet, die sich aus verschiedenen Ab-
schnitten zusammensetzen. Diese besitzten jeweils ihre eigene Struktur, Form, Melodie, Metrik, Rhyth-
mus und Tempo. Sie weisen ein bestimmtes Gestaltungskonzept und ein einheitliches Grundmodell auf,
werden als solches tradiert und haben sich über einen längeren Zeitraum in ihrer Melodik vielfältig kon-
kretisiert. Sie werden bis in die Gegenwart individuell und gebunden an lokale Besonderheiten weiter
gestaltet. Wichtig ist jedoch, dass ihre Hauptstrukturen erkennbar bleiben, trotz der Tatsache, dass Musik-
traditionen erheblichen Veränderungen unterworfen sind (Bascom 1958: 6; Kubik 1988: 16, 40).
Im Folgenden werden einige Liedbeispiele mit zwei und mehr als zwei Abschnitten analysiert:
3.1.1. Lieder mit zwei Abschnitten
Hierzu gehört z.B. das Lied hay lõgā:
Text zu Nr. 24/ 1. Abschnitt, Nr. 24; Takte 52-57
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A አሀይ ሎጋ ሀይ ሎጋዬ ና ahay lõgā, hay logayē nā (Redundanz)
2 b T ሀይ ሎጋ ahay lõgā (Redundanz)
c A ምታ mətā (Redundanz)
b1 T ሀይ ሎጋዬ ሆ hay lõgā hõ (Redundanz)
strophischer Teil (Gz. 3 und 4 nicht notiert, jedoch sind sie wichtig zur Vervollständigung der Textzeilen)
3 a1 A %ረ ሎጋው በል በለውና ärä lõgāw bäl bäläwunā Schlag, schlag Ihn!
4 b T ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz)
c1 A እህም əhəm (Redundanz)
b1 T ሀይ ሎጋ ሆ hay lõgā hõ (Redundanz)
(ab hier beginnt die Notation; s. Takt 1bis Takt 18)
5 a2 A %ረ ሎጋው ጉልበት ጉልበቱን ärä lõgāw gūlbät gūlbätūn Auf die Knie, auf die Knie!
6 b T ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz)
c1 A እህም əhəm (Redundanz)
b1 T ሀይ ሎጋ ሆ hay lõgā hõ (Redundanz)
7 a3 A %ረ ሎጋው እያነከሰ ärä lõgāw əyanäkäsä Hinkend
8 b T ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz)
c1 A እህም əhəm (Redundanz)
b1 T ሀይ ሎጋ ሆ hay lõgā hõ (Redundanz)
9 a3 A %ረ ሎጋው ይውጣው ዳገቱን ärä lõgāw yəwtaw dāgätūn soll er den Berg hochsteigen.
10 b T ሀይ ሎጋ hay lõgā (Redundanz)
c1 A እህም əhəm (Redundanz)
b1 T ሀይ ሎጋ ሆ hay lõgā hõ (Redundanz)
Generell ist zu bemerken, dass das gesamte Lied aus kurzen und langen Gesangszeilen in Verbindung mit
Anrufungen wie hay lõgā, ärä gõbäž usw. besteht. Die längsten melodischen Formeln werden vom awrāğ
gesungen. Dagegen singen die täqäbayõč ausschließlich kurze melodische Formeln, wie z.B. əhəm näw (s.
auch im 2. Abschnitt, S. 123) und hay lõgā, in den Responszeilen.
1. Abschnitt: Die ersten vier melodischen Formeln (Gz.1 und 2) fungieren als eine Gesangseinführung
und werden von einem strophischen Teil (ab. Gz. 3) gefolgt. Die Gesangszeile 3 konnte nicht transkribiert
werden, da dieser Teil kaum zu hören ist. Jedoch ist der Gesangstext, der nur gemeinsam mit den nachfol-
genden Verszeilen einen Sinn ergibt, in der Tabelle angegeben. Der gleiche Text ist aber im späteren Ge-
sangsablauf vollständig zu hören (s. Takt 106 - 128). Der aus den Notationen gewonnene Vergleich des
Gesangs (s. Notation Nr. 24b) stellt diesen von ein und demselben awrāğ gesungenen strophischen Teil
parallel dar, um einen bessere Übersicht zu ermöglichen. Anhand dieses Beispiels ist festzustellen, dass
z.B. eine Silbe, die auf eine einzelne Tonstufe fällt, an der Parallelstelle auf eine Tonverbindung aus zwei
bzw. drei Tonhöhen fällt und umgekehrt und zwei Silben, die auf eine einzelne Tonstufe fallen, an der
Parallelstelle auf zwei einzelne Tonstufen fallen und umgekehrt.
Obwohl sich der rhythmische Verlauf in den gegenübergestellten Gesangszeilen variiert, ist die metrische
Struktur und die Länge jeder Verszeile grundsätzlich gleich. Auch der Anrufungsabschnitt mit dem Ge-
sangstext ärä lõgaw jeweils am Anfang jeder Verszeile erscheint melodisch und rhythmisch variiert bis
auf die ersten drei Silben ä, rä und lõ. Die melodische Variante beginnt jeweils bei der Silbe ga, also je-
weils auf die vierte Silbe des Anrufungsabschnittes. Gebundene Silben fallen entweder auf einen oder auf
zwei Töne.
Text zu Nr. 24/ 2. Abschnitt, Takte 65-71
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 d A %ረ ጎበዝ ärä gõbäž Der Held,
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
2 d1 A %ረ ጎበዝ ärä gõbäž der Held
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
3 d2 A %ረ ወንዱ ärä wändū Das Idol
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
4 d3 A አይታሰስም ayətāsäsəm Man wischt nicht
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
5 d4 A መጣድ በአሸዋ mətād bašäwā eine Tonplatte mit Sand ab.
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
6 d4 A የጎበዝ አገር yägõbäž agär Das Land der Helden
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
7 d4 A እንዴት ነው ሸዋ?əndēt näw Šäwā wie geht es Šäwa?
e T እህም ነው əhəm näw (Redundanz)
2. Abschnitt: Im Gegensatz zum ersten Abschnitt besteht der zweite, begleitet von starker Bewegtheit der
Teilnehmenden, einem intensiven əskstā-Tanz, Klatschen und Trillern, aus relativ kurzen und gleichmäßig
verlaufenden melodischen Formeln. Desweiteren findet hier eine melodische Verzahnung zwischen awrāğ
und täqäbayõč im strophischen Teil statt; d.h. kurz vor Beendigung der melodischen Formel des awrāğ,
bauen die täqäbayõč ihre Responszeile auf und umgekehrt (s. u.a. Takte 23, 24 und 25/Notation 24). Ku-
bik (1988: 85) unterscheidet dabei zwischen Zweier- und Dreierverzahnungen. Die amārā-Gesänge kön-
nen demnach der Gruppe der Zweierverzahnung zugeordnet werden.
Der awrāğ kann sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt den Text frei nach analogen Textstruktu-
ren mit demselbem Inhalt278 gestalten. Dafür existiert auch keine vorgegebene Reihenfolge, d.h. die Stro-
phen, die gewöhnlich im 2. Abschnitt vorkommen, können auch im ersten Abschnitt gesungen werden.
Die Wörter hay und lõgā sind Redundanzen, die jedoch eine wichtigte Bedeutung im Lied haben. Solche
Redundanzen werden in manchen Abhandlungen als nonsense sylables, sinnlose Silben, darge-
stellt. Aber sie keine Unsinnsilben,
"sondern solche von höchst intensivem Kommunikationsgehalt, wenn auch auf einer nicht semantischen
Ebene" (Kubik 1988: 90).
278
Auf eine Hochzeitsfeier wird der Bräutigam als Held dargestellt. Im Gesang wird er gepriesen. Dieses Lied wird u.a. beim
Abholden der Braut von ihrem Elternhaus gesungen. Es gibt den Begleitern des Bräutigams und den anderen Hochzeitsgästen
Mut, den blockierten Eingang (traditionsgemäß wird in diesem Moment der Eingang blockiert) und die Menschenmenge mit Kraft tanzend zu durchbrechen und den Weg für den Bräutigam frei zu machen, so dass er zu seiner Braut hineingehen kann.
Beim Tanzen bewegt man den gesamten Körper auf- und abwärts, zugleich hebt man die eine Hand hoch, indem man eine
Faust macht und sich rhythmisch bewegt. Es bestehen wichtige Zählzeiten, die mit der Körperbewegung in Verbindung ste-
hen. Dies symboliziert das Halten eines Stockes, da dieser Gesang eigentlich ein Stocktanz ist. Das Heben der linken bzw. rechten Hand mit einer geballten Faust symbolisiert den Stocktanz.
Die Wichtigkeit dieser Redundanzen zeigt sich u.a. darin, dass diese als Titel und Sinnträger dieses Ge-
sanges fungieren (vgl. Teffera 1994: 57, s. Abschnitt 3.4.3.).
3.1.2. Lieder mit drei Abschnitten
Dazu gehört z.B. das Lied hõy mälā näš:
Text zu Nr. 26/ 1. Abschnitt, Takte 1 – 20
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alu hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg
2 b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg
3 a1 A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alū hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg
4 b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg
5 a2 A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alū hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg
6 b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg
7 a1 A ሆይ መላ ነሽ አሉ ሆይ መላ hõy mälā näš alū hõy mälā Du bist ein Ausweg, ein Ausweg
8 b T አለው መላ መላ aläw mälā mälā Es gibt einen Ausweg; Ausweg
1. Abschnitt: besteht aus einem Ruf-Antwort-Schema mit einem abstrakten Inhalt. Danach folgt der zwei-
te Abschnitt, der vom awrāğ solistisch dargestellt wird.
Text zu Nr. 26/ 2. Abschnitt, Takte 21 – 38
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 c እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c1 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c2 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
2 c እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c1 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c2 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
strophischer Abschnitt
3 c እድልም የለህ ədələm yälähə Du hast keine Chance.
c1 እድልም የለህ ədələm yälähə Du hast keine Chance.
c2 ተገትረው ቀሩ tägätəräw qärū Stehen geblieben
c3 እነዚህ ሚዜህ ənäzīh mīžehə sind deine Begleiter.
4 c እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c1 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
c2 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
2. Abschnitt: Dieser Gesangsabschnitt wird solistisch gestaltet. Der awrāğ singt beliebige Textvarianten
vor, die entweder unterhaltenden Charakter tragen oder aber auch funktional gebundenene Inhalte haben.
Die Redundanzen in den dreigliedrigen Gesangszeilen 1, 2 und 4 können auch in anderen Liedern gesun-
gen werden. Sie dienen als Ausschmückung des Gesanges und animieren alle am Gesang teilnehmenden
Menschen zum əskstā-Tanz. Sie kommen oft vor einer Strophe vor und können wunschgemäß wiederholt
werden. Nach Beendigung der Strophe tauchen sie desöfteren ganz oder teilweise als Schlusswendung
nochmals auf. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass es keine fixen Regeln dafür gibt, Redundanzen in
der hier angegebenen Reihenfolge bzw. überhaupt singen zu müssen. Die Entscheidung wird somit dem
jeweiligen awrāğ überlassen.
Text zu Nr. 26/ 3. Abschnitt, Takte 39 – 52
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 d A ሸበለው ገዳዬ šäbäläw gädayē Der Hübsche279,
e T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
2 d1 A እዬዬው ገዳዬ ayənamāw gädayē Der Schönäugige,
e T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
3 d2 A ሸበለው ገዳዬ šäbäläw gädayē Der Schönäugige!
e T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
3. Abschnitt: Von der Gesamtstruktur her ähnelt der dritte Abschnitt dem ersten. Man kann ihn als zweite
Einführung oder Refrain bezeichnen, der zu weiteren strophischen Abschnitten führt. Vor allem ist die
Responszeile ahā gädayē melodisch identisch mit der Responszeile im ersten Abschnitt aläw mälā mälā
(vgl. z.B. Takte 4 - 6 mit 41 - 43). Der dritte Abschnitt ist somit eine melodische Variante des ersten.
3.1.3. Lieder mit vier Abschnitten
Als Beispiel soll das Lied yänē abäbā näš:
Text zu Nr. 66 /1. Abschnitt, Takte 1 – 9
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 a A የኔ አበባ ነሽ የኔ አበባ yänē abäbā näš yänē abäbā Du280 bist meine Blume, meine Blume.
2 a T የኔ አበባ ነሽ የኔ አበባ yänē abäbā näš yänē abäbā Du bist meine Blume, meine Blume.
1. Abschnitt: ist der Refrain des Liedes, der in Form eines Zeilenwechselgesanges aufgebaut ist. Der
awrāğ singt somit eine ganze Gesangszeile vor, die unmittelbar danach von den täqäbayõč in gleicher
Weise wiederholt wird.
Text zu Nr. 66 / 2. Abschnitt, Takte 9 - 37; ab Gz. 4 strophischer Abschnitt
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 b A ደግሞ አበባ አበባ dägmõ abäbā abäbā Oh Blume, Blume,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume!
2 b1 A ደግሞ አበባ አበባ dägmõ abäbā abäbā Oh Blume, Blume,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume!
3 b2 A ደግሞ አበባ አበባ dägmõ abäbā abäbā Oh Blume, Blume,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume!
4 b A አበባው አበበ abäbaw abäbä Die Blume blüt,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume.
5 b1 A ወንዙ ሞላልሽ wänžū mõlaləšə Der Fluss ist voll,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume.
6 b2 A ተነሽ በይ ያገር ልጅ tänäš bäy yāgär ləğə Steh auf mein Lndsmann281,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume!
7 b1 A አትመላለሸ atəmälaläšə Wander nicht hin und her,
c T የኔ አበባ yänē abäbā meine Blume!
279
der Bräütigam 280
die Braut 281
weiblich
2. Abschnitt: Der awrāğ singt in den Gesangszeilen 1, 2 und 3 den gleichen Text mit variierter Melodie
(s. die melodischen Formeln b, b1 und b2). Dagegen singen die täqäbayõč nur den Text yänē abäbā und
dieselbe Melodie (s. jeweils melodische Formel c). Ab Gesangszeile 4 schreitet der awrāğ zum strophi-
schen Teil, dessen Melodiestruktur dieselbe bleibt wie in den vorangegangenen Gesangszeilen.
Tet zu Nr. 66/ 3. Abschnitt, Takte 37 - 56, ab Gz. 3 strophischer Abschnitt
Gz mF Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 d እማሙ ነይ ነይ ነይ əmamu näyə näyə näyə Redundanz - komm, komm, komm!
d1 እማሙ ነይ ነይ ነይ əmamu näyə näyə näyə Redundanz - komm, komm, komm!
d2 እማሙ ነይ ነይ ነይ əmamu näyə näyə näyə Redundanz - komm, komm, komm!
d3 እማሙ ነይ ነይ ነይ əmamu näyə näyə näy Redundanz - komm, komm, komm!
2 d እዬዬው መላ əyeyew mälā (Redundanz)
d1 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
d2 እዬዬው መላ əyēyēw mälā (Redundanz)
3 d እስክስታ አወራረድ əskstā awärarädə Den əskstā-Tanz
d1 እሱ መች ያውቅና əsū mäč yawqənā kann er nicht tanzen!
4 d2 ተርገፈገፈልሽ tärgäbägäbälätə Er schüttelt sich seinetwegen282
d3 ወገቡን ያዘና wägäbūn yažänā er fasst sich an seiner Taille.
5 d እዬዬው መላ əyēyēw mälē (Redundanz)
d1 እዬዬው መላ əyēyēw mälē (Redundanz)
d3 እዬዬው መላ əyēyēw mälē (Redundanz)
3. Abschnitt: ist ein solistischer Gesangsabschnitt des awrāğ und fängt gewöhnlich mit Redundanzen an.
Diese dienen, wie im zweiten Abschnitt, als Einführung gefolgt von einer Strophe (s. Gz. 3 und 4). Da-
nach fügt der awrāğ nochmals die drei Gesangszeilen bestehend aus Redundanzen hinzu (s. Gz. 5), die
melodisch eine Finalfunktion besitzen.
Text zu Nr. 66/ 4. Abschnitt
(Gesang nicht notiert; s. hierzu ähnlichen Abschnitt in der Notation Nr. 26/Takte 39-52)
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 e A ሸበለው ገዳዬ šäbäläw gädayē Der Hübsche,
f T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
2 e1 A አይናማው ገዳዬ ayənamāw gädayē der Schönäugige,
f T አሀ ገዳዬ ahā gädayē Redundanz)
3 e2 A አጀባው ናና ağäbaw nā nā Der Schönäugige.
f T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
4 e3 A እምሙ ገዳዬ əmmu gädayē (Redundanz)
f T አሀ ገዳዬ ahā gädayē Redundanz)
5 e A ሸበለው ገዳዬ šäbäläw gädayē Der Hübsche.
f T አሀ ገዳዬ ahā gädayē (Redundanz)
4. Abschnitt: Dieser Abschnitt wird mit neuer Melodie und neuem Text vorgetragen. Auch in dem Lied
hõy mälā näš kommt dieser Gesangsabschnitt vor. Das ist ein Hinweis darauf, dass eine Reihe von Ge-
sangsabschnitten in anderen Liedern flexibel hinzugefügt werden können, solange dieselbe Tonreihe im
Spiel ist und die jeweilige melodische Struktur mit den Vorgaben des Gesangstextes übereinstimmt.
282
der Begleiter des Bräutigam
3.1.4. Lieder mit mehr als vier Abschnitten
Hierzu gehört z.B. das Lied ahūn dämäq abäbayē:
Text zu Nr. 4/ 1. Abschnitt, Takte 1 – 29
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
a A አሁን ደመቅሽ አበባዬ ahūn dämäq abäbayē Jetzt strahlst du, meine Blume,
ደመቅሽ አበባዬ dämäq abäbayē du strahlst meine Blume.
2 a T አሁን ደመቅሽ አበባዬ ahūn dämäq abäbayē Jetzt strahlst du, meine Blume,
ደመቅሽ አበባዬ dämäq abäbayē du strahlst meine Blume.
3 a1 A አሁን ደመቅሽ የኛ ልጅ ahūn dämäqəš yäña ləğə Jetzt strahlst du, unser Kind,
ደመቅሽ የኛ ልጅ dämäqəš yäñā ləğə du strahlst unser Kind.
4 a2 T አሁን ደመቅሽ የኛ ልጅ ahūn dämäqəš yäña ləğə Jetzt strahlst du, unser Kind,
ደመቅሽ የኛ ልጅ dämäqəš yäñā ləğə du strahlst unser Kind.
1. Abschnitt: beginnt mit einem Zeilenwechselgesang, der vom awrāğ beliebig oft gesungen werden
kann. Danach folgt der zweite Abschnitt.
Text zu Nr. 4/ 2. Abschnitt, Takte 29 – 35
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
5 b A ደመቅሽ dämäkš Du strahlst,
c T የኛ ልጅ yäñā ləğə unser Kind.
6 b1 A ደመቅሽ dämäkš Du strahlst,
c T የኛ ልጅ yäñā ləğə unser Kind.
2. Abschnitt besteht ausschließlich aus kurzen melodischen Formeln, die im Wechsel gesungen werden.
Er ist eine Fortsetzung des ersten Abschnitts. Vor allem ist er textlich vom ersten Abschnitt abhängig. Die
Gesangszeilen, die ursprünglich entweder nur vom awrāğ oder nur von den täqäbayõč durchgehend ge-
staltet sind, werden im zweiten Abschnitt zwischen beiden Gruppen in Form eines Rufwechselgesangs
aufgeteilt. Die Anrufung des awrāğ wird von den täqäbayõč beantwortet. Mit anderen Worten ist dieser
Abschnitt ein Wortspiel zwischen awrāğ und täqäbayõč. Solche Text- und Melodiestrukturen kommen in
eine Reihe von Hochzeitsgesängen vor283. Als Beispiel sind jeweils die zweiten Abschnitte der Lieder
bəq bäy kägwādā (Nr. 19), nəbõ atənadäfī (Nr. 54) und yəzwāt bärärä (Nr. 71) zu nennen. Jeweils die
ersten Wörter dieser Verszeilen werden in den zweiten Abschnitten weggelassen und in Form eines Ruf-
Anwort-Gesangs gestaltet. Es kommt auch vor, dass die Abschnitte 1 und 2 vom awrāğ beliebig oft,
meistens 2 - 4 Mal, gesungen werden, bevor er zum dritten Abschnitt des jeweiligen Liedes schreitet.
Text zu Nr. 4/ 3. Abschnitt, Takte 35 – 85
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
7 d A አሸወይና ወይና ašäwäynā wäynā (Redundanz)
e T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
f A ወይና wäynā (Redundanz)
e1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
8 d A እስቲ በእጃችሁም əsti bäğacəhūm Bitte klatscht
e T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
f A ወይና wäynā (Redundanz)
e1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
283
Siehe ähnliche Melodie- und Textstrukturen in den Liedern der Gonja, die von Dauer (1983: 103-138) analysiert worden sind.
9 d A አጨብጭቡበት açäbçəbubätə mit euren Händen
e T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
f A ወይና wäynā (Redundanz)
e1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
10 d A ነገ በሚያገባው nägä bämiyagäbawu für den morgen heiratenden
e T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
f A ወይና wäynā (Redundanz)
e1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
11 d A በሳህልዬ ሞት bäsahələyē motə Sahləyə'ē284!
e T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
f A ወይና wäynā (Redundanz)
e1 T አሸወይናዬ ašäwäynayē (Redundanz)
3. Abschnitt: Der dritte Abschnitt kann sowohl ein selbstständiges Gesangsstück als auch ein Teil davon
darstellen. Damit ist gemeint, dass entweder der vollständige Abschnitt oder aber auch textliche und me-
lodische Elemente davon in anderen Liedern gesungen werden können.
Die jeweils kursiv markierten drei melodischen Formeln e-f-e1 sind zusätzliche Gesangsteile, die unmit-
telbar nach den Verszeilen (s. jeweils melodische Formel d) im Wechsel gesungen werden und somit auch
eine Schlusswendung ermöglichen. Diese Verszeilen tauchen ständig in der angegebenen Reihenfolge auf.
Text zu Nr. 4/ 4. Abschnitt, Takte 86 – 93
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
12 g A %ረ ነይ እቴ %ረ ነይ ärä näy ətē, ärä näyə Oh komm Schwester285, oh komm!
13 g T %ረ ነይ እቴ %ረ ነይ ärä näy ətē, ärä näyə Oh komm Schwester, oh komm!
Text zu Nr. 4/ 5. Abschnitt, Takte 93 – 120
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
14 h A %ረ ነይ %ረ ነይ ärä näyə ärä näyə Oh komm, oh komm!
i T %, ähä (Redundanz)
15 h1 A %ረ ነይ %ረ ነይ ärä näyəärä näyə (Redundanz)
i T %, ähä (Redundanz)
16 h2 A %ረ ነይ %ረ ነይ rä näyə ärä näyə (Redundanz)
i T %, ähä (Redundanz)
17 h2 A እንክዋን ተበልቶበት ənkwan täbältõbät von Həlinas286 Haus.
i T %, ähä (Redundanz)
18 h3 A ተጠጥቶበት tätätətõbätə Nicht nur das Essen
i T %, hä (Redundanz)
19 h2 A መንገዱ ደስ ይላል mägänū däs yəlāl und das Trinken,
i T %, ähä (Redundanz)
20 h4 A የህሊናዬ ቤት yähəlinayē bētə sogar der Anblick ist schön
i T %, ähä (Redundanz)
4. und 5. Abschnitt: Dieser besteht aus acht Takten, die jedoch auf Wunsch des awrāğ mehrmals mit
varierten, ebenfalls ähnlichen kurzen, sich reimenden Verszeilen gesungen werden können:
284
Name des Bräutigams (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991) 285
die Braut 286
Name der Braut (Hochzeitsfeier/Addīs Abäbā/1991)
vgl. 0345.016/12c
Originalschrift Umschrift Übersetzung
%ረ ነይ በቀን ärä näyə bäqän Oh! Komm am Tage,
የኔ ሰቀቀን yänē säqäqän meine Sorge!
%ረ ነይ ማታ ärä näyə mātā Oh! Komm am Abend,
የኔ ትዝታ yänē təžətā meine Nostalgie!
%ረ ነይ ጠዋት ärä näyə täwat Oh! Komm am Morgen,
የኔ መስታወት yänē mästäwāt mein Spiegel!
Im Gegensatz zum zweiten Abschnitt, in dem der awrāğ und die täqäbayõč kurze Melodieformeln in
Form eines Rufwechselgesanges vortragen, wird der vierte Abschnitt in Form eines Zeilenwechselgesan-
ges vorgetragen. Der vierte Abschnitt dient als Einführung für den fünften Abschnitt. D.h. beide Abschnit-
te sind untrennbar miteinander verbunden und werden auch nur in der gegebenen Reihenfolge gesungen.
Der vierte Abschnitt kommt nach Anschluss des fünften Abschnitts nochmals vor (s. Takte 121 - 128),
d.h. oft nach Beendigung der Strophe (s. Takte 105 - 119 im Abschnitt awrāğ) im fünften Abschnitt.
Wenn der awrāğ die Absicht hat, den zyklischen Gesang dieser zwei Abschnitte zu beenden und zum da-
rauffolgenden sechsten Abschnitt zu gelangen, kann er in der Regel den vierten Abschnitt wiederholt als
Einführung zum sechsten Abschnitt vortragen. Er hat aber auch die Möglichkeit, direkt nach Beendigung
des fünften Abschnitts zum sechsten überzugehen.
Als einen selbstständigen Gesang können die Abschnitte vier und fünf allerdings nicht auftreten, sondern
sie werden stets anderen, selbstständig gestalteten Gesängen hinzugefügt.
Im fünften Abschnitt ist auch anzumerken, dass jede Verszeile in zwei melodische Formeln unterteilt
wird, so dass aus einer ganzen Verszeile kurze Sequenzen entstehen. Wenn die dem betreffenden Ab-
schnitt zur Verfügung stehenden melodischen Formeln kurz sind, ist damit zu rechnen, dass eine litera-
risch lange Verszeile, die gewöhnlich aus 12 Silben besteht, genau in zwei Hälften geteilt wird; d.h. je-
weils in 6 Silben, um eine Übereinstimmung zwischen Melodie und Text herzustellen zu können (s. Ab-
schnitt 3.4.2., S. 152ff.). Dies ist auch eines der typischen Merkmale der traditionellen Gesänge der
amārā.
Text zu Nr. 4/ 6. Abschnitt, Takte 153 – 177
Gz mF A/T Originalschrift Umschrift Übersetzung
21 j A ሳምራዬ sāmrāyē (Redundanz)
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
22 j1 A ሳምራዬ sāmrāyē (Redundanz)
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
23 j2 A አካሌን akalēn Mein Rücken,
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
24 j3 A ወገቤን wägäbēn mein Körper
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
25 j1 A ያመኛል yamäñāl tut mir weh.
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
26 j A መቀነት mäqänät Einen Gürtel
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
27 j1 A ይለኛል yəläñāl brauche ich.
k T ሳምራ sāmrā (Redundanz)
Anhand des dargestellten Materials seien folgende Punkte zusammengefaßt:
1. Das Hochzeitsrepertoire besteht zum größten Teil aus mündlich überlieferten traditionellen Gesängen.
Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie häufig im Wechsel zwischen einem awrāğ als Leiter der Ge-
sangsgruppe und den täqäbayõč als gesangliche Begleiter dargestellt werden. Es ist wichtig, dass so-
wohl der awrāğ als auch die täqäbayõč die traditionellen Lieder so gut beherschen, dass der Wechsel-
gesang vollständig entstehen kann. Alle Abschnitte werden anhand ihrer formalen musikalischen
Merkmale von den begleitenden täqäbayõč erkannt, so dass diese ihre Responszeilen entsprechend
aufbauen können. Zum Beispiel sind die typischen Anrufungen hay lõgāw bzw. ärä lõgāw des awrāğ
(s. Nr. 24) automatisch ein Hinweis auf den ersten Abschnitt. Demnach sind die täqäbayõč aufgefor-
dert, den Gesangstext hay lõgā bzw. hay lõgā hõ zu singen.
2. Die Gesänge sind in zwei und mehr Abschnitte aufgeteilt, wobei jeweils der erste Abschnitt in Ver-
bindung mit den dazugehörigen Textzeilen meist als Einführung bzw. Refrain aufzufassen ist. Er kann
sowohl aus kurzen als auch aus langen melodischen Formeln bestehen und verschieden gegliederte
Gesangszeilen aufweisen, die entweder einen primären Text oder ausschließlich Redundanzen zum
Inhalt haben.
3. Jeweils die zweiten Abschnitte besitzen oft kurze melodische Formeln und werden entweder in Form
eines Rufwechselgesanges (s. Nr. 4), oder solistisch vom awrāğ vorgetragen (s. Nr. 26).
Der awrāğ trägt seine Melodien so variativ vor, dass diese häufig Einmaligkeit besitzen. Dies bedeu-
tet, dass er nicht verpflichtet ist, ein und dasselbe Lied beim wiederholten Singen genau wiederzuge-
ben. Von der Gesamtstruktur her jedoch, bleibt das Lied dasselbe. Für solche Gesangsformen bestehen
nur empirische Modelle, d.h. der awrāğ entnimmt den ihm bekannten variantenreichen Vorträgen
prinzipielle Regeln der Melodiegestaltung, ohne sie wörtlich zu kopieren.
Dem zweiten Abschnitten können ferner, textinhaltlich betrachtet, erweiterte Einführungsteile hinzu-
gefügt werden, die zu deren Strophenabschnitten überleiten (s. Nr. 26 und Nr. 66).
4. Jeweils die dritten Abschnitte sind im Allgemeinen so aufgebaut, dass sie einerseits den ersten Ab-
schnitten ähneln und als eine zweite variierte oder nicht variierte Einführung in dem jeweiligen Lied
fungieren. Die Responszeilen der dritten Abschnitte sind oft identisch mit denen der jeweiligen ersten
Abschnitte (vgl. Nr. mit Nr. 26 mit Nr. 66).
5. Es gibt auch Abschnitte, die zum größten Teil nur aus Redundanzen bestehen, die eine Verbindung zu
den strophischen Teilen darstellen und auch nach Beendigung nochmals als Schlussteil mit Finalfunk-
tion gesungen werden können (s. z.B. jeweils die dritten Abschnitte der Nr. 26 und 4). Diese Redun-
danzen sind auch in den vierten, fünften oder sechsten Abschnitten (s. z.B. 4 ahūn dämäq abäbayē/6.
Abschnitt) der jeweiligen Lieder oft anzutreffen.
6. Ein Gesang im Zusammenhang mit seinem Textinhalt wird schon am Anfang von den Begleitern er-
kannt. Demnach reagieren sie sofort und ergänzen oder wiederholen ihn vollständig in ihrer Respons-
zeile. Solche Gesänge können als Ruf- oder Zeilenwechselgesänge bezeichnet werden (vgl. Zinke
1992: 307f.). Es gibt aber auch andere Wechselgesange im amārischen Hochzeitsrepertoire, die in
Form von Strophen- und Refrainwechselgesang vorgetragen werden, hier jedoch nicht in als Beispiel
angegeben wurden.
7. In manchen Gesängen können Texte auf Wunsch des awrāğ an beliebigen Stellen wiederholt gesun-
gen werden (z.B. Strophentexte als Refraintexte). Wichtig ist jedoch, dass durch die freie Benutzung
von Texten die formale Melodiestruktur unverletzt bleibt. Verletzungen dieser Art kommen kaum vor,
weil durch die oral überlieferte Tradition das Repertoire im Gedächtnis gespeichert ist, so dass jeder
Mensch vorab weiß, welche Texte etwa zu welchen Liedern gehören bzw. welche Textstrukturen an
welchen Stellen im Lied passen.
8. Textinhalte sind sehr wesentlich für die traditionellen Lieder der amārā, da hauptsächlich durch sie
die Höhepunkte des jeweiligen Gesangs vorgezeichnet sind.
9. Neben dem Gesang sind das Klatschen, das Trillern und der traditionelle Schultertanz əskstā, die den
Gesang ergänzen, sehr wichtig. Diese Aufgabe wird sowohl von den unmittelbaren Begleitern als
auch von anderen Teilnehmern vollzogen, die den awrāğ so nicht mit Gesang, sondern mit Tanzen,
Klatschen und Trillern unterstützen.
3.2. DIE STRUKTUR DER MELODISCHEN FORMELN IN DEN AMĀRISCHEN HOCHZEITS-
LIEDERN
Für die traditionellen Lieder der amārā gibt es überlieferte Gestaltungprinzipien, wonach die einzelnen
melodischen Formeln eines jeden Gesanges wechselweise sowohl vom awrāğ wie auch von den
täqäbayõč aufgebaut werden. Dem neutralen Begriff "melodische Formel" sei hier wie auch im gesamten
Text der Vorzug gegeben, weil es sich in erster Linie um gesamtheitlich gedachte musikalische Sinnein-
heiten handelt, die formelhaft tradiert werden und bestimmten Austausch- und Verknüpfungsprinzipien
unterliegen.
Abb. 25
Beispiel 1
Als 1. Beispiel sei das Lied hay lõga (s. Nr. 24) näher untersucht, das von
drei awrāğõč (Plural zu awrāğ) abwechselnd mit den täqäbayõč gesun-
gen wird. Es steht in der qəñət bātī, dessen Tonreihe die in Abbildung 25
angegebenen Intervalle aufweist (vgl. auch Abschnitt 1.3.2 Tonreihentyp
b; S. 22).
Im gesamten Lied sind bestimmte melodische Formeln zu erkennen, aus denen sich die Gesangszeilen des
awrāğ und die der täqäbayõč zusammensetzen. Zunächst werden fünf aufeinanderfolgende Gesangszeilen
(A, A1, B, A2 und B1; s. Nr. 24a) in den Takten 100 bis 125 dargestellt. Die Anordnung der melodischen
Formeln, hier ein solistischer Gesangsabschnitt, erscheint folgendermaßen:
Gz mel. Formeln Gesangszeilen
1 a - b A
2 a1 - b1 A1
3 a2 - c B
4 a2 - b2 A2
5 a2 - c1 B1
Die Gesangszeilen 1, 2 und 4 sind miteinander verwandt. Sie weisen analoge melodische Formeln auf, die
hier einen eröffnenden Charakter tragen und jeweils auf dem Ton a', dem fünften Ton aus der qəñət-
Tonreihe, enden. Die Gesangszeilen 3 und 5 besitzen dagegen einen Finalcharakter und enden auf dem
Ton e'. Die Formeln a, a1 und a2 mit dem Gesangstext ärä logaw " Oh Logaw" sind typische Anrufun-
gen in diesem Lied. Sie ermöglichen den Anschluss zu den strophischen Teilen, die jeweils mit den For-
meln b, b1, c, b2 und c1 beginnt (z.B. Gz. A, Formel b - logaw tolõ nā "Logaw komm schnell!").
Ferner werden solche Anrufungen, genauso wie Redundanzen und Wortkombinationen, auch für melo-
disch erweiternde Verzierungen verwendet. Wenn der awrāğ solche Redundanzen und Wortkombinatio-
nen mehrfach singt, wird danach ein strophischer Teil erwartet. Solche Einschübe von Gesangstexten aus
Redundanzen und Wortkombinationen können beliebig oft vom jeweiligen awrāğ vorgetragen werden. Sie
sind jedoch nicht obligatorisch. Ihr Gebrauch beeinflusst das Prinzip der Strukturierung eines Liedes we-
der metrisch noch melodisch.
Die qəñət Tonstufen besitzen anhand der Notation Nr. 24a folgende Merkmale:
Tonstufe Tonhöhe Merkmale
1. h Ausgangstonstufe bzw. Grundton der qəñət; er taucht in diesem Beispiel nicht auf
2. d' - gefolgt von höheren Tonstufen (wie e' oder fis') insbesondere in den Anrufungsteilen
am Anfang jeder Gesangszeile; in den strophischen Abschnitten taucht diese Tonver-
bindung jeweils in den Zeilen 3, 4 und 5 auf
3. e' - gefolgt von höherer Tonstufe (fis') jeweils in den Anrufungsteilen und
- Schlusston mit Finalfunktion in den strophischen Abschnitten (s. Gz. 3 und 5)
4. fis' - als Halbschlusston trägt er gemeinsam mit dem Ton a' eine zentrale Funktion als eine
markante Tonverbindung (s. strophische Abschnitte/ Gz. 1, 2 und 4 und Anrufungsab-
schnitte/ Gz. 3, 4 und 5)
5. a' - als Halbschlusston trägt er gemeinsam mit dem Ton fis' eine zentrale Funktion als eine
markante Tonverbindung (s. strophische Abschnitte/ Gz. 1, 2 und 4)
(6.) (h') - einmalige Erweiterung (Anrufungsabschnitt/ Gz. 1 )
Die melodischen Formeln dieser Gesangszeilen kommen im Lied oft vor. Durch den Einsatz von Melo-
dievariationen allerdings gestaltet sie der awrāğ bei der Wiederholung anders, wobei der metrische und
der melodische Verlauf in seinen Grundzügen erhalten bleibt (s. Gegenüberstellung analoger Gesangszei-
len in der Notation Nr. 24b).
In der nachstehenden Notation (Nr. 24c) sind 7 Gesangszeilen des zweiten awrāğ in den Takten 52 bis 87
zu sehen. Die Anordnung der melodischen Formeln erscheint wie folgt:
Gz. mel. Formeln Gesangszeilen
1 a - b A
2 c-d B
3 e-b1 C
4 a1-b2 A1
5 a2-d D
6 a3-b3 A2
7 a2-d D
In Gegensatz zum ersten awrāğ (s. Nr. 24b) singt der zweite (s. Nr. 24c) auf einer niedrigeren Tonhöhen-
ebene. Er baut seine Gesangszeilen aus einem Tonvorrat (h bis fis') bestehend aus vier Tonhöhen auf
außer in der zweiten Gesangszeile, in der er den Ton a' erreicht und somit eine fünfte Tonstufe hinzufügt.
Im Gegensatz dazu hat der erste awrāğ einen Tonvorrat, der aus fünf Tonhöhen besteht und der sich von
d' bis h' erstreckt (s. Nr. 24a). Dabei neigt er melodisch, insbesondere in den Anrufungsabschnitten, von
d' aus bis zum h' aufwärts zu singen, während er in den Verszeilen vorwiegend auf den Tonhöhenebe-
nen d', e' und fis' bleibt.
Die Anrufungsteile der Notation 24c sind variativ gestaltet. Außer in den 2. und 3.Gesangszeilen, Formeln
c und e, gehören alle anderen Anrufungsabschnitte (s. Gz.1 und 4 - 7) zu der Gruppe der Formel a und
sind als a, a1, a2 und a3 gekennzeichnet. Außer den Gesangszeilen 5 und 7, die melodisch und rhythmisch
identisch sind, werden alle anderen Anrufungsabschnitte vom awrāğ variativ gestaltet.
In den Strophenabschnitten tragen die Gesangszeilen 1, 3, 4 und 6 (s. b, b1, b2 und b3) eine eröffnende
Funktion und enden jeweils auf dem Ton fis', der vierten Tonstufen der qəñət. Die Gesangszeilen 2, 5
und 7 (melodische Formel d) besitzen demgegenüber eine Finalfunktion und enden somit auf h, dem Aus-
gangston der qəñət-Tonreihe.
Im Gegensatz zu den Notationsbeispielen 24a und 24b, bestehen in der Notation 24c die ersten drei Ge-
sangszeilen ausschließlich aus Redundanzen. Erst in der 4. Zeilenhälfte beginnt der strophische Abschnitt.
Im Unterschied zum ersten awrāğ (s. Nr. 24a und 24b) sehen die Merkmale der einzelnen qəñət-Tonstufen
des zweiten awrāğ (s. Nr. 24c) so aus:
Tonstufe Tonhöhe Merkmale
1. h - Ausgangstonstufe bzw. Grundton der qəñət
- zugleich Schlusston der Zeilen mit Finalfunktion (s. Gz. 2, 5 und 7)
2. d' - gefolgt von höheren Tonstufen (e' und fis'; s. Anrufungsabschnitte in den Gz. 4, 5,
6 und 7 und Gz. 1 Anrufungs- und Versabschnitt)
- gefolgt von h'in Abwärtsbewegung (s. Gz. 2 und 7 in den Versabschnitten)
3. e' - gefolgt von höherer Tonstufe (fis'; s. Gz. 1, 2, 4, 5, 6 und 7 vor allem in den Anru-
fungs-abschnitten)
- in den Versabschnitten in Auf- und Abwärtsbewegung
4. fis' - eröffnende Funktion als Halbschlusston (s. Gz. 1, 3, 4 und 6 in den Versabschnitten)
- in den Anrufungsabschnitten in Auf- und Abwärtsbewegung
5. a' - in der Tonverbindung mit fis' nur einmal vorhanden (s. 2. Gz.)
Die Funktion der einzelnen Tonstufen wird wie folgt erläutert:
Tonstufe Funktion markante Tonverbindung relativ
festl.
relativ
frei
h - Ausgangston der qəñət
- Finalton der Gz. 2, 5 und 7mit Finalfunktion
keine x
d' vorwiegend gefolgt vor höherer Tonstufe (e' und
fis'
mit e' und fis' x
e' mit d' und fis' x
fis' Halbschlusston mit d', e' und a' x
fis'-a' nur in der 2. Gz. x
In der weiteren.Notation Nr. 24d sind Gesangsbschnitte in demselben Lied zu betrachten, die vom awrāğ
und den täqäbayõč im Wechsel vorgetragen werden. Jede Tonstufe der qəñət weist hier diese Merkmale
auf:
Ton-stufe Tonhöhe Merkmale
1. h - Ausgangstonstufe
2. d' - erscheint in Tonverbindung mit e'
3. e' - taucht an Zeilenenden in den Formeln c, c1 und c2
- erscheint in Tonverbindung mit d' (s. Formel c)
4. fis - erscheint als Anfangston in den Formeln b und d
5. a - erscheint nur in Tonverbindung mit h
(6.) (h') - taucht nicht auf
Hier wird deutlich, dass die Funktion der einzelnen Tonstufen der qəñət mit den vorherigen Notationsbei-
spielen nicht identisch ist. Beispielsweise erscheint der Ton d', dem gewöhnlich höhere Tonstufen (e'
und fis') folgen, im Beispiel 24d zwar in markanter Tonverbindung mit dem Ton e', aber nur in der
Formel c (Abschnitt täqäbayõč). Der Ton fis' kommt überhaupt nicht vor. Stattdessen taucht er eine
Oktave tiefer auf und wird als Anfangston sowohl vom awrāğ wie auch von den täqäbayõč verwendet (s.
melodische Formeln b und d). Die melodischen Formeln der Gesangszeilen 1 - 4 sind wie folgt aufgebaut:
Gz mel. Formeln Geangszeilen
1 a - b - c A
2 d - b - c B
3 a - b - c1 A2
4 d - f - c2 C
Hier wird der Versuch unternommen, die verschiedenen melodischen Erweiterungen in Verbindung mit
deren Funktionen aufzuzeigen. Dazu gehört auch die Beschreibung der einzelnen Tonstufen der qəñət im
Zusammenhang mit ihren charakteristischen Merkmalen.
Die in den Gesangszeilen 1 bis 4 angegebenen melodischen Formeln sind wie in den Beispielen 24a bis
24c ebenfalls kennzeichnend für dieses Lied. Von ihrer Strukturbildung her sind sie gleich. Diese melodi-
schen Formeln sind jeweils mit a-b-c in der ersten Gesangszeile, d-b-c in der zweiten Gesangszeile, a-b-
c1 in der 3. Gesangszeile und d-f-c2 in der vierten Gesangszeile, gekennzeichnet. Melodisch betrachtet
basieren jeweils die ersten zwei Formeln a-b, d-b und d-f auf dem Ausgangston der qəñət-Tonreihe h und
tragen damit einen Finalcharakter. Die Formeln c, c1 und c2, die von den täqäbayõč gesungen werden,
besitzen dagegen einen eröffnenden Charakter. Sie ebnen den Weg zu dem weiteren Strophenabschnitt des
awrāğ. Die Formeln b sind alle gleich bis auf die vierte Gesangszeile mit der Formel f, wo an Stelle des
üblichen Melodiemusters ähä bzw. ahā als Variante eine Interjektion mətā "schlag" in Form eines Glissa-
ndos hinzugefügt wurde287. Die jeweils zu der Gruppe c zählenden Formeln c1 und c2, sind melodische
Varianten von c. Von der Strukturbildung her sind alle angegebenen melodischen Formel im einzelnen
und die vier Gesangszeilen gleich.
Die Formeln und ihre melodischen Merkmale werden durch den Wechselgesang erzeugt. Wenn die
täqäbayõč den Gesangsteil hay lõgā bzw. (a) hay lõgā mit einer Finalfunktion vorgeben, fügt der awrāğ
den Teil ahā bzw. ähä hinzu, so dass die täqäbayõč zur darauffolgenden Gesangszeile hay logā hõ über-
gehen können. Damit ist gemeint, dass die Funktion der einzelnen melodischen Formeln untrennbar mitei-
nander verbunden ist, so dass die eine ohne die andere nicht zustande kommen kann; d.h. der awrāğ kann
seinen Gesang ohne die täqäbayõč und umgekehrt nicht vortragen.
Die Tonstufen der qəñət-Tonreihe in der Notation 24d erfüllen folgende Funktionen in der melodischen
Strukturbildung:
Tonstufe Funktion markante Tonverbindung relativ
festl.
relativ
frei
h Ausgangstonstufe mit zentraler Funktion (s. Formel a, c,
c1 und c2)
- typischer Endton der Formel a und b
mit a in den Formeln b
und d
x
d' mit e'in den Formeln c x
e' eröffnende Funktion in den Zeilenenden (s. Formel c, c1
und c2)
mit d'in den Formeln c x
fis' kommt nicht vor
fis Anfangston mit zentraler Funktion in den Formeln b und
d
x
a-h in Aufwärtsbewegung in den Formeln b und d x
h' kommt nicht vor
Im weiteren Notationsbeispiel Nr. 24e ist festzustellen, dass der Wechselgesang sowohl melodisch als
auch rhythmisch anders aufgebaut ist. Die melodischen Formeln bestehen aus kurzen Melodie- und
Textphrasen und stellen sich so dar:
Gz. mel. Formeln Gesangszeilen
1 a - b - c -b A
2 c1 - b - d - b - c2 - b A1
Hier wird der Wechselgesang des zweiten Gesangsabschnitts dargestellt, der vor den Verszeilen gesungen
wird. Die melodischen Formeln sind mit a-b-c und b (Gesangszeile A) und c1-b-d-c2 und b (Gesangszeile
A1) angegeben. Die jeweils mit einem b gekennzeichneten identischen Formeln, əhəm näw, werden von
den täqäbayõč gesungen, während die restlichen vom awrāğ ausgeführt werden. Die melodischen For-
meln des awrāğ bestehen nur aus Anrufungen wie ärä gõbäž bzw. ärä wändū und sie erscheinen jeweils
vor den Verszeilen als Eröffnungsteile. Der awrāğ variiert seine Gesangszeilen. Die Formel c1 und c2 sind
Varianten von c. Typisch ist hier der Anfangston d' mit der darauffolgenden charakteristischen Tonver-
287
An solchen Stellen wurden in der Transkription keine festen Tonhöhen notiert.
bindung e'-fis'. Die Gesangszeilen enden entweder auf dem Ton fis' (c und c1) oder a'(c2). Die me-
lodischen Formeln a und d weichen dagegen stark von der Formel c ab, obwohl fast überall der gleiche
Gesangstext vorkommt. Auffallend dabei ist, dass entweder mehrere Silben nur auf dem Ton a' gesungen
werden (vgl. Formel a), oder dass die erste Silbe auf den Ton d' und die restlichen auf dem Ton e" ver-
bleiben (vgl. Formel d).
Die Eigenschaften der einzelnen Tonstufen aus der qəñət-Tonreihe sehen somit wie folgt aus:
Tonstufe Tonhöhe Merkmale
1. h - Endton mit Finalfunktion in Formel b
2. d' - typischer Anfangston in den Formeln c, c1, d und c2
3. e' - markanter Tonverbindung mit fis'in den Formeln c, c1und c2
- in Formel d auf mehrere Silben gesungen
4. fis' - typischer Endton in den Formeln a, c und c1
fis - häufig als Anfangston gesungen jeweils in den Formeln b
5. a' - in Formel a auf mehrere Silben gesungen
a - markante Tonverbindung mit h in den Formeln b
(6.) (h') - kommt nicht vor
Die Stellung und Aufgabe der einzelnen qəñət-Tonstufen sind im Zusammenhang mit deren markanten
Tonverbindungen wiederum anders gestaltet als die, der vorhergehenden Beispielen. In der melodischen
Strukturbildung erfüllen die einzelnen Tonstufen folgende Funktionen:
Tonstufe Funktion markante Tonverbindung relativ
festl.
relativ
frei
h - Endton mit Finalfunktion in den Formeln b mit A x
d' - typischer Anfangston in den Formeln c, c1, d
und c2
keine x
e' - auf mehrere Silben in Formel d gesungen x
e'-fis' Formel c, c1 und c2 x
fis - Anfangston der Formel b x
fis' - als Endton der Formel c und c1 mit e' x
fis-a s. jeweils Formel b x
a' - auf mehreren Silben in Formel a gesungen mit fis' in Formel c2 x
a-h s. Formel b x
Im weiteren Beispiel 24f sind homogene melodische Formeln dargestellt worden, die nach den Verszeilen
im Wechsel gesungen werden. Daraus ergeben sich diese Strukturierungen:
mel. Formeln Gesangszeilen
1 a - b - c -b - c - b A
2 a1- b - c1 - b - c2 - b A1
Dieses Notationsbeispiel ist ähnlich wie die Notation 24e strukturiert. Beide Beispiele betreffen den zwei-
ten Gesangsabschnitt des Liedes. In beiden Notationen ist festzustellen, dass die melodische Formel b der
täqäbayõč stets gleichbleibend gesungen wird. Die Funktionen der einzelnen Tonstufen bleiben dieselben.
Folgende Merkmale sind aus diesen Notationsbeispielen festzuhalten:
Die melodischen Formeln des awrāğ weisen weder einen eröffnenden noch schließenden Charak-
ter auf, während alle Formel der täqäbayõč dagegen eine Finalfunktion besitzen.
awrāğ und täqäbayõč sind im Wechselgesang so stark verkettet, dass melodisch keine Lücke ent-
steht.
Die Anrufungen können sowohl vor als auch nach den Verszeilen beliebig oft vom awrāğ wieder-
holt und melodisch auch variiert werden. Es besteht keine fixierte Reihenfolge für die melodi-
schen Formeln und den Gesangstext des awrāğ, d.h. die angegebenen melodischen Bewegungen
können variativ erfolgen. Der am meisten verwendete Endton ist der Ton fis', aber es können
auch andere Tonhöhen wie e' und a' als Endton fungieren.
Als nächstes folgt die Notation 24g mit einem Wechselgesang innerhalb der Strophenabschnitte, die wie
in den vorhergehenden Notationsbeispielen, ebenfalls eine lückenlose Verkettung im Wechselgesang dar-
stellt. Die melodischen Formeln sind im Folgenden angegeben:
Gz. melodische Formeln
1 a - b - a -b - a - b - a - b
Anhand des Gesamtbildes der Notation Nr. 24 ist festzustellen, dass durch die unterschiedliche Funktion
der fünf qəñət-Tonstufen innerhalb der verschiedenen Gesangs- bzw. Melodieabschnitte auffallende
Merkmale wie z.B. die aufsteigende Tonverbindung d'-fis' (s. z.B. 24a, Formel a, a1..usw.) oder die
Tonverbindung fis-h (s. z.B. 24e; Formel b in den Gesangsabschnitten der täqäbayõč) auf.
Hinzu kommt die melodische Rollenverteilung zwischen dem awrāğ und die begleitenden täqäbayõč. Die
aufsteigende Tonverbindung d'-fis' wird im Verlauf des gesamten Liedes ausschließlich vom awrāğ
gesungen und zwar vorwiegend in den ersten Gesangsabschnitten. Eine ähnliche markante Tonverbindung
mit den Tonstufen d'-e'-fis' ist ebenfalls in den zweiten Gesangsabschnitten zu verzeichnen (s. For-
meln c, c1 und c2 des Beispiels 24e und die Formeln a und c des Abschnitts A und a1, c1 und c2 des Ab-
schnitts A1 in 24f).
Abb. 26
Beispiel 2
Als nächstes wird das Lied ahūn dämäkš abäbayē (Nr. 4) in der qəñət-
Tonreihe ančī hõyē länē, analysiert. Die Intervallfolgen der Tonreihe
sind k2-g3-k2- und ü2 (Abb. 26)
Auch in diesem Beispiel finden sich bestimmte melodische Formeln, die im Wechselgesang vom awrāğ
und den täqäbayõč gestaltet werden und gemeinsam ein Gesamtbild ergeben. Zunächst sei der erste Ab-
schnitt (s. Nr. 4a) untersucht.
Die melodischen Formeln der 4 Gesangszeilen des awrāğ und die der täqäbayõč sind wie folgt dargestellt:
Gz A/T mel. Formeln melodische Zeilen
1 A a - b A
2 a1 - b A1
1 T a2 - b A2
2 a3 - b1 A3
Der erste Abschnitt dieses Liedes wird in Form eines Zeilenwechselgesanges gestaltet, wobei der awrāğ
zunächst eine ganze Zeile vorsingt, die anschließend von den täqäbayõč in gleicher Weise wiederholt
wird.
Anhand der Notation ist ersichtlich, dass die ersten zwei melodischen Formeln a - b und a1 - b in den Tak-
ten 1 - 8 und 15 - 22 vom awrāğ und die letzten zwei melodischen Formeln a2 - b2 und a3-b1 in den Tak-
ten 8 - 15 und 22 - 29 von den täqäbayõč vorgetragen werden. Alle vier Gesangszeilen weisen allgemein
einen gleichen melodischen, rhythmischen und metrischen Verlauf auf. Die Tonveränderungen sind als
Melodievariationen zu verstehen. Demnach ist die Gesangszeile A1 (melodische Formeln a1 und b), A2
(melodische Formeln a2 und b) oder A3 (melodische Formeln a3 und b1) melodische Varianten der Ge-
sangszeile A (melodische Formeln a - b).
Es besteht sowohl für den awrāğ als auch für die täqäbayõč die Freiheit, die Gesangszeile nach den gel-
tenden musikalischen Normen melodisch und rhythmisch variiert zu singen.
Zum Beispiel sind folgende Stellen zu betrachten:
Die ersten drei Tonstufen mit den Tönen h-d'-es'(s. Gesangszeile A, Formel a) werden in den Tönen
es'-g'-as'(s. Gesangszeile A1, Formel a1), umgewandelt.
Jede Gesangszeile besteht aus 20 Tönen, wobei jeweils die erste Formel aus 12 verteilt auf 4 Takte und die
zweite Formel aus 8 Tönen verteilt auf 3 Takte besteht. Diese Gestaltung gilt allerdings nur für den ersten
Abschnitt des Liedes; d.h. die weiteren Abschnitte besitzen eine andere Gliederung (s. die verschiedenen
Gesangabschnitte in Nr. 4). In einem Gesang können also unterschiedliche Gliederungen mit verschieden
langen Formeln existieren.
Alle vier Gesangszeilen der Notation 4a sind in jeweils zwei melodische Formeln unterteilt, wobei die
erste Hälfte eine eröffnende Melodiefunktion mit Halbschlusscharakter erfüllt und somit auf dem Ton
as' (4. Ton der qəñət-Tonreihe) endet und die zweite Hälfte einen Finanlcharakter besitzt und auf dem
Ton d (Ausgangston der qəñət-Tonreihe) endet.
Die eröffnende bzw. schließende Funktion in jeder Zeile hängt auch mit dem Aufbau des Gesangstextes
zusammen. Zuerst wird die erste Hälfte des Gesangstextes ahun dämäqš abäbayē, "Jetzt strahlst du meine
Blume288", gesungen. Die zweite Hälfte der Gesangszeile beginnt mit einer Wiederholung der vorausge-
henden ersten Gesangszeilenhälfte und zwar dämäqš abäbayē, "Du strahlst meine Blume". Der Sänger be-
wundert die Braut in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte betont er seine Bewunderung noch einmal
durch die Wiederholung dieser zwei Wörter. Genauso wird die Zeile von den täqäbayõč wiederholt. Ta-
bellarisch sieht der erste Gesangsabschnitt wie folgt aus:
awrāğ a-b a1-b
täqäbayõč a2-b a3-b1
Die Merkmale der einzelnen Tonstufen der qəñət-Tonreihe sehen wie folgt aus:
Tonstufe Tonhöhe
Merkmale
1. d' - Ausgangstonstufe der qəñət.
- gefolgt von höherer (es') oder niedrigerer (as oder h) Tonstufe
- erscheint in allen Gesangszeilen als Finalton (s. Formel b und b1)
2. es' gefolgt von höherer (g' und as') oder niedrigerer Tonstufen (h)
3. g' - taucht nur zweimal auf (s. Formel a und a1) als seltene Erweiterung
- gefolgt von dem Ton es'
(4.) (g) - (kommt nicht vor)
5. as' - einmalige Erweiterung (s. Element a1)
6 as - Halbschlusston der jeweils ersten Hälfte der Gesangszeilen
- gefolgt von H (s. Formel a, a2 und a3)
(7.) (h') - (kommt nicht vor)
8. h - gefolgt von höherer Tonstufe (d') und von niedrigerer Tonstufe (as)
- typischer Anfangston der zweiten Zeilenhälften (s. Formel b, und b1)
Die Tabelle weist aus, dass der Tonvorrat sich bis zu einer Oktave erstreckt und zwar von as bis as'.
Die Funktionen der einzelnen Tonstufen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
288
Die mit Blume bezeichnete Person ist die Braut.
Tonstufe Funktion markante Tonverbindung relativ
festl.
relativ
frei
d' -Ausgangs- bzw. Grundton der qəñət und
Finalton aller vier Gesangszeilen mit h und es' x
es' - gefolgt von h
- gefolgt von d' g' und as'
mit h und g'(s. Anfang jeder
Gesangszeilen)
x
x
es'-g' - s. Formel a und a1 x
as' einmalige Erweiterung (s. Element a1) mit g' x
As Halbschlusston jeweils der ersten Hälfte
der Gesangszeilen mit h x
h - gefolgt von d'
- gefolgt von as
- Ausgangston jeweils der zweiten Hälfte
der Gesangszeilen
mit as x
x
x
h-d'-es' markante Tonverbindung in
den Formeln a, a2 und a3
x
h-d' markante Tonverbindung in
den Formeln b, und b1
x
h-a markante Tonverbindung in
den Formeln a, a2 und a3
x
Folgendes sei zusammengefasst:
Anhand der Notationen wird deutlich, dass die Tonstufen einer Tonreihe unterschiedliche Funktionen in
der melodischen Strukturbildung erfüllen und zwar je nach dem, welcher Gesangsabschnitt (z.B. ein Ref-
rain und eine Strophe) vom awrāğ gesungen wird. Diese Tonstufen müssen nicht unbedingt eine festlie-
gende Funktion in einem gegebenen Lied aufweisen, obwohl sie zum Aufbau einer qəñət unvermeidlich
sind. Ihre Funktion hängt von dem entsprechenden Abschnitt und von den individuell unterschiedlich ge-
stalteten Melodievariationen ab (vgl. auch Kubik 1988: 272). Daher kann entweder eine und dieselbe Ge-
sangszeile bzw. ein und dasselbe Lied, das von unterschiedlichen awrāğõč gesungen wird, melodisch so
variiert gestaltet werden, dass bestimmte Tonstufen, die z.B. für den ersten awrāğ im Mittelpunkt standen
und relativ festliegend gesungen wurden, von dem zweiten verhältnismäßig frei vorgetragen werden und
somit auch eine andere Funktion übernehmen. Eine variierte Melodiegestaltung kann auch von ein und
demselben awrāğ zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich gehandhabt werden (vgl. Jones 1959: 234ff).
In einem Gesang existiert die freie Melodiegestaltung für den awrāğ, der sich allerdings nur in einem ge-
wissen Rahmen bewegen darf, so dass auch die ihn begleitenden täqäbayõč den Vorgesang eben anhand
seiner Struktur erkennen und darauf ihre Responszeilen aufbauen können.
Die Freiheit von Melodievariationen wird auch in anderen Kulturen Afrikas wie beispielsweise in der
Embaire- und der Amadinda-Kultur (im Xylophonspiel - Kubik 1988: 167) in Uganda und in der Azande-
Kultur (im Harfenspiel - Kubik 1988: 217f.) in der Zentralafrikanischen Republik praktiziert. Kubik
(1988: 162) beschreibt bezüglich der ersten zwei Kulturen folgendes:
"Unter den Variationstechnicken steht vor allem dynamische Variation durch Veränderungen in der Akzentu-
ierung von bestimmten Tönen oder Tongruppen... Diese Akzentuierungen werden improvisatorisch durchge-
führt".
Die Variation in der Embaire-Musik z.B. folgt laut Kubik (1988: 167) bestimmten Prinzipien. Allerdings
darf während dessen - genauso wie in der Musik der amārā - die melodische Grundform nicht verloren
gehen. Kubik (1988: 163) weiter:
" Die Variationstechnik folgt einem Substitutionsschema, bei dem einige Töne jeweils durch andere ersetzt
werden, aber jene, die nicht ausgetauscht werden, stehen weiterhin an ihren genauen Zeilenstellen. Wo immer
die alten Töne wiederkehren, erscheinen die gleichfalls an ihren alten Stellen. Das bedeutet, es können Töne
ersetzt werden, aber der Zyklus ist nicht verschiebbar. Ebenso muss die formale Länge des Zyklus erhalten
bleiben".
3.3. ANALYSE 2: DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN AWRĀĞ UND TÄQÄBAYÕČ IN DEN A-
MARISCHEN WECHSELGESÄNGEN
In den amārischen Liedern treten bestimmte Spannungs- und Entspannungsmomente in Erscheinung, die
inbesondere von den am Gesang teilnehmenden Personen entsprechende Reaktionen erwarten lassen. Ein
Gesang (Solo- oder Wechselgesang) fängt gewöhnlich mit einer Entspannung an. Dies könnte beispiels-
weise ein Refrain sein, der im Wechselgesang zuerst vom awrāğ und nachfolgend von den ihn begleiten-
den täqäbayõč gesungen wird.
Die Spannungsmomente hängen von der Struktur eines Gesanges; d.h. von dem melodischen und textli-
chen Ablauf, ab. Die Strukturierung von Spannung und Entspannung wird durch mündliche Überlieferung
ebenso wie Melodik, Rhythmik und Text erlernt.
Ein Beispiel ist der Gesang yäbētä žämädū (s. Notation Nr. 63). Hier wird die erste Gesangszeile vom
awrāğ begonnen und von den täqäbayõč durch Hinzufügen einer zweiten Gesangszeile beendet. Die
Spannung wird im zweiten Abschnitt erreicht, in dem der awrāğ den Gesang solistisch fortsetzt. Dabei
wird er mit kräftiger werdendem Klatschen, Trillern und intensiven Tanz begleitet, bis er wieder zum ers-
ten Abschnitt zurückkehrt, womit der Moment der Entspannung wieder hergestellt wird. In dieser Form
wird dieses Lied zyklisch weitergesungen289.
Das Ende von Gesängen ist in den meisten Fällen durch häufige Wiederholungen von Textzeilen oder
Teilen davon gekennzeichnet. Der awrāğ hat das Recht, ein Lied zu beenden und mit einem weiteren neu-
en Lied anzufangen oder die Gesangsaufgabe überhaupt einem anderen zu überlassen, der ab sofort die
Leitung übernimmt.
Eine andere Variante einer Schlussbildung zeichnet sich dadurch aus, dass der awrāğ den Gesangsteil der
täqäbayõč ganz oder Teilweise mitsingt (vgl. auch Dauer 1983: 112).
Hochzeitsgesänge können von langer oder kurzer Dauer sein und sie werden auch von dem jeweiligen
awrāğ bestimmt. Dies bedeutet, dass er während des Singens die Stimmung des aktiven und passiven Pub-
likums beobachten muss, so dass er das Lied entsprechend verlängern oder eher beenden kann.
Fast das gesamte Hochzeitsrepertoire besteht aus Wechselgesängen zwischen dem awrāğ und den beglei-
tenden täqäbayõč in Form von Ruf- Refrain-, Zeilen- und/oder Strophenwechselgesängen. Der Beginn
eines jeden Gesanges im Zusammenhang mit der dazugehörigen Melodie und dem Textinhalt ist für die
täqäbayõč von wichtiger Bedeutung. Daher soll es deutlich gesungen werden. Die weiteren musikalischen
Teile des jeweiligen Gesanges sind der täqäbayõč bekannt und sie werden auch von dieser erwartet290.
Es ist während eines Gesanges durchaus möglich, dass der awrāğ nach einer Weile nicht mehr weiß, wie
er weiter zu singen hat, aus Mangel an Texten oder weiteren neuen Gesängen. In diesem Moment wird er
spontan von einer Person abgelöst, die ab sofort wiederum die Leiterrolle übernimmt, bis sie irgendwann
aus ähnlichen Gründen wieder aufhört. Der jeweilige awrāğ ist also im Großen und Ganzen der wichtigste
Stimulant, der insgesamt für die Stimmung der Hochzeitsgesellschaft sorgt.
Ein awrāğ wird bei solchen Anlässen von Anfang an nicht bestimmt, solange er kein Berufssänger ist, der
über ein großes Repertoire an Hochzeitsgesängen verfügt. Derjenige, der sich mit den Gesängen auskennt
und dementsprechend auch die Gesangstexte auswendig beherrscht, kann und darf singen. Kein Mensch
wird zum Singen bzw. zum Begleiten gezwungen. Es wird aber auch keinen Menschen geben, der den
Verlauf des Hochzeitsfestes still beobachtet.
Awrāğ und täqäbayõč haben in den amārā-Liedern bestimmte Funktionen im Verlauf eines Gesanges zu
erfüllen.
Dafür ist es notwendig, Musik und Sprache zu verstehen, in der die Gesänge aufgeführt werden. Eine Mu-
sikpraxis muss so gut erlernt werden, dass möglichst jedes aktive Mitglied der Gesellschaft mit vollem
Verständnis, d.h. Musik, Text, Tanz u.a.m., an einer Musikveranstaltung teilnehmen kann (vlg. auch Bla-
289
Vgl. auch Kubik 1988: 287 290
Es ist hierbei zu bemerken, dass in der amārā-Musik keine Mehrstimmigkeit existiert. Daher sind die Responszeilen der
täqäbayõč stets in Form eines einstimmigen Gruppengesangs gestaltet, der auf individuell unterschiedliche Stimmlagen (Frauen-, Kinder- oder Männerstimmen) basiert.
cking 1967: 33). Das Erlernen von Musik erfolgt für die amārā vom Kindesalter an und zwar durch Imi-
tieren und langjährige Erfahrungen.
Beispielsweise kann durch den gewöhnlichen Gebrauch von Melodievariationen ein und dasselbe Lied
beim wiederholten Singen, von einem oder unterschiedlichen Sängern, mit neuen Variationen ausgeführt
werden. Das bedeutet also, dass der Gesang nicht unbedingt vollkommen identisch mit dem vorherigen
sein muss, um erkannt zu werden. Von seiner Gestalt her, die grundsätzlich nicht verletzt sein darf, kann
er vom kulturerfahrenen Zuhörer erkannt werden. Im Hinblick auf die Venda-Musik beschreibt zum Bei-
spiel Blacking (1967: 29) eine ähnliche Form des Erlernens von Musik:
"It merely shows that there are unspecified principles on which the music of Venda is based, and that these
must be acquired and understood by any Venda who aspires to participate in his traditional music. He first
becomes acquainted with the accepted structures of traditional music; then he learns about the different styles
of music that are contained within his culture; finally he sees the significance of music in social life, and reali-
zes that there is a time and a place for every different musical style".
Da die amārischen Gesänge mündlich überliefert werden, muss jeder Teilnehmende mehr oder weniger in
der Lage sein, die musikalischen Regeln und das Musikrepertoire zu beherrschen und dementsprechend
beim Singen oder Begleiten eines bereits in der Tradition bekannten Liedes die geltenden Regeln in Gang
zu setzen291. Natürlich bestehen unterschiedliche Ebenen und Maße des Verstehens, die - wie Kubik
(1983:326) sie erläutert - in Relation zu
" a) individuell verschiedenen Hintergrund der Person
b) Zugehörigkeit zu verschiedenen Subkulturen
c) Zugehörigkeit zu verschiedenen Altersgruppen"
stehen.
Ein richtiges Verstehen nimmt allerdings nicht nur mit dem regionalen Abstand zwischen Kulturen ab,
sondern es sind auch zeitliche Abstände in Anspruch zu nehmen, weil Kulturen jederzeit großen Verände-
rungen unterworfen sind (Kubik 1983: 326).
In den traditionellen Wechselgesängen der amārā ist es typisch, dass entweder nur ein verkürzter Teil der
zuvor vom awrāğ dargestellten Gesangszeile, oder die ganze Zeile, der gesamte Refrain, die gesamte
Strophe oder auch nur ein einziges Wort, Redundanzen292 und Interjektionen wie z.B. ahā, ohõ, əhəm und
ähä in der Responszeile auftauchen. Da die Gesangsregeln von jedem Mitglied der Gemeinde im Rahmen
der oralen Überlieferung durch Imitieren erlernt werden, wird z.B. ein Fehler in der Responszeile automa-
tisch vom awrāğ berichtigt, ohne den jeweiligen Gesang zu unterbrechen. Die Gesangsregeln sollen aber
auch umgekehrt vom awrāğ beherrscht werden. Insgesamt herrscht ein festgefügtes System. Ähnliche
Phänome sind auch in anderen Kulturen Afrikas zu beobachten wie beispielsweise in den Kinderliedern
der Venda (Südafrika). Blacking (1967: 17, 29, 191) beschreibt das Erlernen von Musik bei Kindern wie
folgt:
"They learn music by imitating the performances of adults and other children and if they do not realize when
they are making a mistake they are soon corrected by more experienced musicians.
Venda women take their small children with them whereever they go: motherhood does not entail any with-
drawal from social life after an initial period of seclusion after parturition. Strapped to his mothers back, a
child will share all her musical experiences: he may be shaken violently as she dances to the rhythms of a
beer-song, or deafended by the sound of the drums and reed-pipes playing the national dance. These early ex-
periences of musical sound must surely accelerate the speed at which Venda children assimilate the elements
of their musical tradition. Little children all over the world clap their hands, beat some objekt, or jump up and
291
Bezüglich der Märchenlieder der Yoruba-Kultur hat auch Kubik ein ähnliches Verhältnis zwischen Vorsänger und Chor wäh-rend eines Wechselgesanges beschrieben (vlg. 1988: 271).
292 Die Responszeilen besitzen in vielen Liedern bzw. Hochzeitsliedern der amārā (vor allem die Rufwechselgesänge) keine
literarische Bedeutung an sich, da sie nur aus einer Gruppe von miteinander verketteten Silben wie ahā-hā und ohõ-hõ beste-hen (vgl. auch Kubik 1988: 272- Märchenlieder der Yoruba).
down, whether or not they hear music: Venda children have an added advantage, because they have many op-
portunities to imitate specific rhythms and thus organize their body movement".
Die Lieder der amārā bestehen aus Ruf-, Strophen- Refrain- oder Zeilenwechselgesängen. In einem Lied
bzw. einem Teil davon wird zwischen diesen vier Wechselgesangsformen unterschieden, wenn es sich
entweder nur um einen a) Ruf-, b) Strophen-, c) Refrain- oder d) Zeilenwechselgesang handelt, da inner-
halb eines Liedes eben diese verschiedenen Wechselgesangsformen vorkommen können. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, die bei der beispielhaften Darstellung nur einiger bestimmter Gesangsabschnitte
entstehen, wird nun versucht, jeden Liedtext in seiner gewöhnlichen Reihenfolge anzugeben und die da-
zugehörenden Wechselgesangsformen näher zu erläutern.
3.3.1. Rufwechselgesänge
Rufwechselgesänge sind in den amārischen Gesängen in unterschiedlichen Varianten häufig anzutreffen.
Sie werden so gestaltet, dass awrāğ und täqäbayõč in einem Lied bestimmte gestalterische Aufgaben zu-
geteilt bekommen. Diese können entweder im Refrain, oder im strophischen Teil oder im Verlauf des ge-
samten Liedes stattfinden. Z.B. kann der awrāğ seine Gesangszeile mit einem Anruf beginnen, die danach
von den täqäbayõč vollendet wird. Als Beispiel ist das Lied ašäwäynā näher zu betrachten:
Text zu Nr. 14 äšäwäyna näš wäyə
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Refrain/Rufwechselgesang
1 a A ašäwäynā wäynā (Redundanz)
b T ašäwäynayē (Redundanz)
a1 A wäynā (Redundanz)
b1 T ašäwäynayē (Redundanz)
Zeilenwechselgesang
2 c A ašäwäynā näšə wäyə Bist du ašwäyna?
təmäçaläš wäyə Kommst du?
3 c T ašäwäynā näšə wäyə Bist du ašwäyna?
təmäçaläš wäyə Kommst du?
Gesangzeile 1 bestehend aus den melodischen Formeln a-b-a1-b1 gehört zum Refrain des Liedes. Im wei-
teren Verlauf werden die strophischen Zeilen ebenso in der hier angegebenen Reihenfolge dargestellt und
unterscheiden sich ausschließlich durch ihren Text.
Es gibt auch Rufwechselgesänge, in denen der awrāğ und die täqäbayõč abwechselnd bedeutend längere
Gesangszeilen darstellen können, wie im folgenden Beispiel:
Text zu Nr. 57 šäb əräb aläč mədərə
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Rufwechselgesang
1 a A šäb əräb aläč mədərə Die Erde bebte,
b šäb əräb aläč mədərə die Erde bebte,
2 c T o hõ hõ (Redundanz)
d A aläč mədərə die Erde.
3 a T šäb əräb aläč mədərə Die Erde bebte,
b šäb əräb aläč mədərə die Erde bebte,
4 c A o hõ hõ (Redundanz)
d T aläč mədərə die Erde
Ein weiteres Beispiel ist ein Gesang, aus dem nur ein Teil des Gesangstextes, in diesem Fall nur die Re-
dundanz sāmrā, von den täqäbayõč ergänzt wird und zwar in der Regel in gleichbleibender Melodik und
Rhythmik:
Text zu Nr. 22 ärä näyə ətē
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Zeilenwechselgesang
1 a A ärä näyə ətē ärä näyə Bitte komm, bitte komm
2 a T ärä näyə ətē ärä näyə (Wiederholung)
Rufwechselgesang
3 b A samrāyē (Redundanz)
c T sāmrā (Redundanz)
4 b1 A samrāyē (Redundanz)
c T sāmrā (Redundanz)
5 b A ərāsēn Mein Kopf
c T sāmrā (Redundanz)
6 b1 A yamäñāl schmerzt.
c T sāmrā (Redundanz)
7 b A hār šāš Ein seidenes Tuch
c T sāmrā (Redundanz)
8 b1 A yəläñāl brauche ich.
c T sāmrā (Redundanz)
Die Beendigung dieses Gesangsteiles geschieht entweder durch den Übergang zu einem neuen Gesang
oder zu einem weiteren Gesangsabschnitt.
"Für eine einfache Periodenform gibt es eine Reihe von Erweiterungen. Sie bestehen aus Text- und Melo-
dievarianten des Kantors, Einfügung von kürzeren oder längeren Einschüben, sequenzierender Aneinander-
reihung auf verschiedenen Tonstufen" (Dauer 1983:110).
Solche Gesänge sind in sich geschlossen. Der awrāğ kann also beliebige Text- und Melodievarianten im
Gesang einfügen, während die täqäbayõč eine begrenzte Melodie und einen beschränkten Text ostinat
wiederholen293.
Eine andere Möglichkeit dieser Gesangsform besteht darin, dass in den Responszeilen zwar variierte Texte
aber gleichbleibende Melodie gesungen werden (s. Gesangszeilen 2 und 5). Im folgenden ist eine Stro-
phenform veranschaulicht, die im Wechsel gesungen wird:
Text zu Nr. 61 wäläbē-wäläbē Rufwechselgesang 1. und 2. Strophen
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
1.Strophe 1 a A wäläbē wäläbē (Redundanz)
b T näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
2 c A wäläbē wäläbē (Redundanz)
d näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
3 a T wäläbē wäläbē (Redundanz)
b A näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
4 c T wäläbē wäläbē (Redundanz)
d näy mähāräbē Komm mein Taschentuch!
293
Vgl. eine ähnliche Gesangsform in den Yoruba Märchenliedern (Kubik 1988: 271).
2. Strophe 5 a A yämäharäbūnə Von dem Taschentuch
b T lakīwu mälsūnə schick mir die Anwort!
6 c A yämäharäbūn Von dem Taschentuch
d lakīwu mälsūnə schick mir die Anwort!
7 a T yämäharäbūnə Von dem Taschentuch
b A lakīwu mälsūnə schick mir die Anwort!
8 c T yämäharäbūn Von dem Taschentuch
d lakīwu mälsūnə schick mir die Anwort!
Eine Strophe setzt sich aus vier Gesangszeilen zusammen294. Solche Gesangsformen sind mit einem
Haupt- (awrāğ) und Nebensatz (täqäbayõč) zu vergleichen, der lediglich als Ganzes einen Sinn ergibt.
Jeweils vier Zeilen, also eine ganze Strophe, werden in umgekehrter Reihenfolge wiederholt; d.h. die erste
Reihenfolge, awrāğ-täqäbayõč-awrāğ (s. 1. und 2. Gesangszeilen), wird bei der Wiederholung in
täqäbayõč-awrāğ-täqäbayõč (s. 3. und 4. Gesangszeilen) geändert.
Ein weiteres Beispiel ist der Gesang yäbētä žämädū, der in ähnlicher Form wie den Gesang wäläbē
wäläbē vorgetragen wird. Allerdings liegt der Unterschied zwischen beiden Gesangsformen darin, dass
das letztere Liedbeispiel nicht aus vierzeiligen Strophen besteht und in dieser Wechselrolle gestaltet wird,
sondern nur zweizeilig aufgebaut ist. Die täqäbayõč brauchen auch nicht die bereits einmal gesungene
Zeile in umgekehrter Reihenfolge zu wiederholen.
Text zu Nr. 63 yäbētä žämädū/ Rufwechselgesang
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
1 a A yäbētä žämädū Die Verwandtschaft
b T yətāyāl gūdū wird man sehen.
2 a A yämīzēw fäžāžā Ein fauler Begleiter
b T yäläwūm läžā hat keine Grazie.
Das nächste Beispiel für einen Rufwechselgesang ist das Lied əradõ wäšäbā:
Text zu Nr. 34 əradõ wäšäbā
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Refrainwechselgesang
1 a A əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
2 a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
Rufwechselgesang/1. Strophe
3 b A mūšərīt mūšərawu Braut und Bräutigam,
c T əradõ (Redundanz)
d A wäšäbā (Redundanz)
a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
4 b1 A ənkwan däsə yalačəhu herzlichen Glückwunsch!
c T əradõ (Redundanz)
d A wäšäbā (Redundanz)
a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
5 b1 A täkäbärä žarē Heute wurde gefeiert
c T əradõ (Redundanz)
d A wäšäbā (Redundanz)
a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
294
Vgl. ähnliche Strophenformen auch in den Liedern der Yoruba (Kubik 1988: 283).
6 b1 A mäləkām gābəčačəhu eure Hochzeit.
c T əradõ (Redundanz)
d A wäšäbā (Redundanz)
a T əradõ wäšäbā näyə qäžäbā (Redundanz)
In diesem Lied kommt der Rufwechselgesang im strophischen Teil vor. Im strophischen Teil singt der
awrāğ zunächst eine kurze melodische Formel vor (s. Formeln b bzw. b1), die von drei weiteren Formeln
gefolgt werden, und zwar mit der Aufteilung täqäbay-awrāğ-täqäbay (s. Formeln c-d-a).
Es gibt auch Rufwechselgesänge mit kurzen Melodieabschnitten wie im folgenden Beispiel:
Text zu Nr. 19 bəq bäy kägwādā
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Zeilenwechelgesang/1. Abschnitt
1 a A əstī bəq bäy kägwadā Komm mal aus dem Nebenzimmer!
b bəqə bay kägwādā Komm aus dem Nebenzimmer!
2 a T əstī bəqə bäy kägwadā Komm mal aus dem Nebenzimmer!
b bəqə bay kägwādā Komm aus dem Nebenzimmer!
Rufwechselgesang/ 2. Abschnitt
3 c A bəqə bay Komm,
d T kägwādā aus dem Nebenzimmer!
4 c1 A bəqə bay Komm,
d T kägwādā aus dem Nebenzimmer!
Es existieren auch ähnliche Gesänge mit fast gleicher Melodik und Metrik, wie z.B. nəbõ atnādäfī (s. Nr.
54), yägwāroyē tänādām (s. Nr. 64) und yəžwāt bärärä (s. Nr. 71). Jeweils die ersten Abschnitte dieser
Gesänge erscheinen als Zeilenwechselgesang und die zweiten als Rufwechselgesang. Die 2. Abschnitte
werden so gestaltet, dass aus den zuvor gesungenen Gesangszeilen (1. Abschnitte) jeweils die zweite Hälf-
te der Verszeile herausgenommen und im Wechsel zwichen awrāğ und täqäbayõč vorgetragen wird.
3.3.2. Strophenwechselgesänge
Die Strophenwechselgesänge werden so gestaltet, dass der awrāğ eine Strophe vorsingt und die täqäbayõč
sie wiederholen (s. auch Zinke 1992: 307-308). Die folgenden Beispiele erläutern dies näher:
Text zu Nr.18 bālənğärē
Gz. mF A/T Umschrift Übersetzung
Strophenwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A bālənəğärē Meine Freundin
b ayəbäləš käfā sei nicht traurig,
b ayəbäləš käfā sei nicht traurig.
2 c hulūm yagäbaləbäyäwäräfā Jeder wird mit dem Heiraten dran sein.
3 a T bālənəğärē Meine Freundin
b ayəbäləš käfā sei nicht traurig,
b ayəbäləš käfā sei nicht traurig.
4 c hulūm yagäbālə bäyäwäräfā Jeder wird mit dem Heiraten dran sein.
Rufwechselgesang/2. Abschnitt
5 a1 A bālənəğärē Meine Freundin,
a2 mähēd ayəqärē näw man muss gehen.
6 1 T balənəğärē Meine Freundin,
d A wädä sõst guləččā zu den Herdsteinen.
7 1 T balənəğärē Meine Freundin,
a2 A aybälūm žälaläm man kann nicht immer essen
8 1 T bālənəğärē meine Freundin,
d A yänatən əngõččā...usw. das Brot der Mutter.
Text zu Nr. 56 sägurwā wärdõ wärdõ/ Strophenwechselgesang
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
1 a A sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
a1 sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
b yətäqälälāl əndä žändõ Es faltet sich wie ein Krokodil.
a2 sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
2 a T sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
a1 sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
b yətäqälälāl əndä žändõ Es faltet sich wie ein Krokodil.
a2 sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar ist lang, ist lang.
Text zu Nr. 25 hēdäč alū
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Strophenwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A hēdäč alū Sie ging
b gārā gārāwunə die Berge hinauf,
c näfāšawunə wo es windig ist.
2 a T hēdäč alū Sie ging
b gārā gārāwunə die Berge hinauf,
c näfāšawunə wo es windig ist.
Rufwechselgesang/2. Abschnitt
3 d A mähēdəšə mähēdəšə Dass du gehst, gehst,
e T ähä (Redundanz)
4 f A mähēdəšə yəwärāl gehst, erzählt man.
e T ähä (Redundanz)
5 d2 A ləbē kančī gārā Mein Herz mit dir
e T ähä (Redundanz)
6 f1 A əndä wäf ybärāl fliegt wie ein Vogel.
e T ähä (Redundanz)
Strophenwechselgesänge erscheinen oft in Verbindung mit anderen Wechselgesangsformen. Es ist sehr
selten, dass sie allein existieren.
3.3.3. Refrainwechselgesänge
In den Refrainwechselgesängen singt der awrāğ einen Refrain vor, der von den täqäbayõč wiederholt
wird. Refrainwechselgesänge werden nicht allein, sondern stets in Verbindung mit den anderen Wechsel-
gesangsformen dargestellt:
Text zu 12 äša gädāwõ
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Refrainwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A aša gädawõ (Redundanz)
b ärä aša gädawõ (Redundanz)
c ärä aša gädawõ (Redundanz)
2 a aša gädawõ (Redundanz)
b ärä aša gädawõ (Redundanz)
c ärä aša gädawõ (Redundanz)
3 a aša gädawõ (Redundanz)
b1 yätāmānəbəšə Es werden Gerüchte verbreitet.
c wätatwa əndēt näšə Wie geht es dir junges Mädchen?
4 a T aša gädawõ (Redundanz)
b ärä aša gädawõ (Redundanz)
c ärä aša gädawõ (Redundanz)
5 a aša gädawõ (Redundanz)
b ärä aša gädawõ (Redundanz)
c ärä aša gädawõ (Redundanz)
6 a aša gädawõ (Redundanz)
b1 yätāmānəbəšə Es werden Gerüchte verbreitet.
c wätatwa əndēt näšə Wie geht es dir junges Mädchen?
Rufwechselgesang//2. Abschnitt
7 d A aša gädawõ (Redundanz)
e lämängädäña säwu Für einen Reisenden
8 d1 T aša gädawõ (Redundanz)
e2 A ayəsätūm sənqūnə packt man kein Essen ein.
9 d T aša gädawõ (Redundanz)
e A əyäbälawu yəhid Er soll unterwegs
10 d1 T aša gädawõ (Redundanz)
e2 A anğät anğätunə mit seinen Gedanken spielen.
Das zweite Beispiel mit einem Refrainwechselgesang ist das Lied amrwāl šägänū:
Text zu Nr. 7 amrwāl šägänū
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Refrainwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
b amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
c amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
2 a mädäsäčačən Unser Freudentag
b žarē näwu qänū ist heute,
c žarē näwu qänū ist heute.
3 a T amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
b amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
c amrwāl šägänū Die Umgebung ist schön.
4 a mädäsäčačən Unser Freudentag
b žarē näwu qänū ist heute,
c žarē näwu qänū ist heute.
Sologesang des awrāğ /2. Abschnitt
5 d A ayəžošə mušərīt Lass dich trösten unsere Braut
e ayəbäləšə käfa sei nicht traurig.
f ayəbäləšə käfa sei nicht traurig.
6 d hulūm yagäbal Alle heiraten
e1 bäyäwäräfā der Reihe nach,
f1 bäyäwäräfā der Reihe nach.
3.3.4. Zeilenwechselgesänge
Lieder mit Zeilenwechselgesangsformen werden so gestaltet, dass der awrāğ eine Gesangszeile im Refrain
oder in einer Strophe oder in anderen Teilen des betreffenden Liedes vorsingt, die von den täqäbayõč in
gleicher Weise wiederholt wird. Dabei kommen entweder Querreim- oder Endreimlagen vor, mitunter
auch beide. Zu der ersten Variante gehört das folgende Liedtextbeispiel:
Text zu Nr. 22 ärä näy ətē
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Zeilenwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A ärä näyə ətē ärä näyə Oh, komm, Schwester, komm!
2 a T ärä näyə ətē ärä näyə Oh, komm, Schwester, komm!
Rufwechselgesang/2. Abschnitt
3 b A ärä näyə ärä näy Oh, komm, komm!
c T ähä (Redundanz)
4 b1 A ärä näy ärä näy Oh, komm, komm!
c T ähä (Redundanz)
Das Lied gehört zu einer Gruppe von Gesängen bzw. Gesangsteilen, die kettenweise hintereinander ge-
sungen werden. Sie können aber auch unabhängig voneinander erscheinen. Es besteht dabei eine bestimm-
te Reihenfolge innerhalb dieser kettenförmigen Gesangsfolgen, die gewöhnlich von allen Singenden er-
wartet wird. Diese sind u.a. amõrā bäsämay siyayəš walä (s. Nr. 6), ärä näyə ətē (s. Nr. 22) und samrāyē
(s. Nr. 4/6. Abschnitt).
Text zu Nr. 14 ašäwäynā wäynā
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Refrain/Rufwechselgesang/ 1. Abschnitt
1 a A ašäwäynā wäynā (Redundanz)
b T ašäwäynayē (Redundanz)
a1 A wäynā (Redundanz)
b1 T ašäwäynayē (Redundanz)
Zeilenwechselgesang/2. Abschnitt
2 c A ašäwäynā näšə wäyə Bist du ašwäyna?
təmäçaläš wäyə Kommst du?
3 c T ašäwäynā näšə wäyə Bist du ašwäyna?
təmäçaläš wäyə Kommst du?
Text zu Nr. 48 mīžēw šəttõ amtā
Gz mF A/T Umschrift Übersetzung
Zeilenwechselgesang/1. Abschnitt
1 a A ärä mīžēw šəttõ amtā Oh, Begleiter295, bring ein Parfüm!
b mīžēw šəttõ amtā Begleiter, bring ein Parfüm!
2 a T ärä mīžēw šəttõ amtā Oh, Begleiter, bring ein Parfüm!
b mīžēw šəttõ amtā Begleiter, bring ein Parfüm!
Rufwechselgesang/2. Abschnitt
3 c A mīžēw Begleiter,
d T šəttõ amtā bring ein Parfüm!
4 c1 A mīžēw Begleiter,
d T šəttõ amtā bring ein Parfüm!
3.4. DER TEXT IN DEN AMARÎSCHEN LIEDERN 3.4.1. Funktion und Inhalt
Liedtexte spiegeln kulturelle, historische, politische und soziale Begebenheiten einer Gesellschaft wieder.
Merriam (1982c: 142) weist auf die Wichtigkeit von Liedtexten in afrikanischen Gesängen hin:
"The important elements in a music event are the message communicated in song, the close relationship
between linguistic and musical tone, and the expressive quality of language through music".
So spielt auch der Text in den amārā Liedern eine wesentliche Rolle (Bekele 1987: 20 und 50). Die Texte
lassen sich syllabisch ordnen. Sie bestehen neben primären Inhalten aus einer Reihe von Wiederholungen,
Redundanzwörtern, onomatopoetischen Lauten, die als Teil von Gesängen oder auch selbständig als Gan-
zes gesungen werden (Bekele 1987: 51).
Der Melodieverlauf eines Gesanges besteht entweder aus einem einzigen Abschnitt oder er ist in Zyklen
geordnet. Daher werden die jeweiligen Gesangsmelodien allein recht monoton empfunden, so dass sich
die Aufmerksamkeit des amārischen Zuhörers mehr und mehr auf die textinhaltliche Gestaltung kon-
zentriert. Der Text muss immer wieder neue und spannende Unterhaltungsmomente bieten296. Kebede
erläutert die Bedeutsamkeit von Textstrophen in den äthiopischen Gesängen:
"The Ethiopian emphasis on the study of poetry and versification becomes particularly noticeable when
we realize that tradition attaches precedence to the meaning of the song texts rather than to the accom-
panying melodies. It is the meaning that generally forms the basis of the Ethiopian aesthetic conception.
Most traditional songs for example consist of relatively repetitive melodies, while the text contain varied
stanzas, artfully interwoven with subtlety and ambiguity, which only the knowledgeable attentive listener
can translate meaningfully. It is important to understand that the aesthetic element of Ethiopian music is
traditionally governed by textual considerations".
In den Hochzeitsgesängen der amārā werden Liedtexte verwendet, die an die Hochzeitszeremonie funkti-
onal gebunden sind; d.h. sie sind mit den verschiedenen Phasen der Hochzeit, z.B. das Verlassen des elter-
lichen Hauses, Abschied, Glückwunsch usw., verknüpft. Aktuelle Geschehnisse der Hochzeitsfeier wer-
den durch die zu der jeweiligen Handlung passenden Liedtexte wiedergespiegelt.
Es wird jedoch nicht der gesamte Hochzeitsvorgang von solchen Gesängen begleitet. Es gibt auch andere
Liedkategorien (z.B. Helden- Unterhaltungs- oder Liebeslieder), die ebenfalls auf solchen Festen gesun-
295
der Begleiter des Bräutigams 296
Aber auch in melodisch variativ gestalteten Gesängen werden spannende Strophentexte erwartet und auch vom jeweilichen Sänger hinzugefügt.
gen werden können. Ein Beispiel ist das Lied hay lõgā (s. Nr. 24), das ein Heldengesang ist, der eigentlich
auf dem Schlachtfeld, um Soldaten kämpferisch zu stimmen, oder nach einem errungenen Sieg auf dem
Weg nach Hause, oder auf Staatsfeierlichkeiten, auf denen Helden geehrt werden, gesungen wird. Auf
Hochzeitsfeiern wird dieses Lied zur Begleitung des Brautpaares, insbesondere in Begleitung des Bräuti-
gams, gesungen und zwar vor allem frühmorgens, wenn der Bräutigam sein Haus verlässt, um die Braut
abzuholen und bei seiner Ankunft im Hause der Braut. Der Bräutigam wird im Gesang als Held darge-
stellt. Seine Begleiter, mižēwõè, Hochzeitsgäste und Freunde nehmen am diesem typischen Männergesang
teil. Dabei tanzen sie einen Sprungtanz, eine geballte Faust rhythmisch emporstreckend. In der Regel wird
der Tanz zu diesem Lied mit Stöcken als Requisiten ausgeführt. Solche Lieder sind also nicht den Hoch-
zeitsriten unterworfen.
Auf einer amārischen Hochzeitsfeier werden nicht nur Hochzeitsgesänge erwartet, sondern auch reine
Unterhaltungsgesänge aus völlig anderen Zusammenhängen, mit ganz anderen Funktionen und Bedeutun-
gen. Auch solche Gesänge können eine Hochzeitsfeier hervorragend ausschmücken. Es kommt vor allem
auf die Unterhaltung der Hochzeitsgäste und natürlich auch auf die Brautleute, die die Hauptfiguren dieses
besonderen Tages sind an.
Der Inhalt eines Textes steuert gewöhnlich die Gestaltung der Höhepunkte in einem Gesang. Melodische
und textliche Gestaltung stehen dabei in untrennbarem Zusammenhang. So werden auch neue aktuelle
Texte immer in ihrem Verhältnis zur Melodik eines bestimmten Gesangs konzipiert. Das Klatschen, das
Trillern und der Tanz richten sich in solchen Gesängen zum größten Teil nach den Texten. Insbesondere
werden die schrillen Ololygen ələlələləl.... zu bestimmten Momenten, z.B. beim Preisen eines Angehöri-
gen, durch die textinhaltliche Gestaltung im Gesang provoziert297.
Die Texte der amārā-Gesänge haben alle möglichen Themen des Alltags wie z.B. Reichtum und Armut,
Liebe und Hass, Krieg und Frieden, Freude und Trauer, Freiheit, Politik oder auch Erotik zum Inhalt.
Nketia (1975: 189) erklärt bezüglich der Akan-Lieder in Ghana:
"...the themes of songs tend to center around events and matters of common interest and concern to the
members of a community or the social groups within it. They may deal with everyday life or with the tradi-
tions, beliefs, and customs of the society".
Auch epische Texte sind im Repertoire der amārā-Gesänge enthalten. Solche Texte besitzen in der Regel
mehrere Verszeilen, d.h. mehr als zwei, die sich zumeist auch reimen. Als Beispiel ist ein siebenzeiliger
Text zu betrachten. Davon enden zunächst die ersten fünf Zeilen auf der Silbe wu und die letzten zwei auf
der Silbe rə.
Tz298 Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 አንበሳ ተሰብሮ ጊደር ደግፋው anəbässā täsäbərõ gidär dägəfāwu Dem verletzten Löwen hilft das Kalb.
2 ጅብ እራሱን ታሞ አህያ ሲያግመው ğəbə ərāsun tāmõ ahəya si'agmäwu Die Hyäne wird von ihren Kopf-
schmerzen durch den Esel geheilt.
3 ነብር አይኑን ታሞ ፍየል ስትመራው
näbər ayənūn tāmõ fəyäl sət-
märawu
Der blinde Tiger wird
von der Ziege geführt.
4 ምጥማጥ ሆዱን ታሞ ዶሮ ስታሸው mətmāt hõdūn tāmõ dõrõ sətašäwu Der schmerzende Bauch des Wurmes
wird von dem Huhn massiert.
5 ድንጋይ ደም አውጥቶ ውሻ ሲልሰው dəngayə däm awətətõ wəša
siləsäwu
Den blutenden Stein leckt der Hund.
297
Das Trillern muß jedoch nicht unbedingt an diesen Stellen erfolgen. Da es emotional bedingt ist bzw. nach dem Grad der An-
regung eine jeden am Gesang beteiligten Person ausgelöst wird, kann es durchaus möglich sein, dass an den eigentlich zu er-wartenden Stellen eines Liedes einfach nicht getrillert wird und es eben woanders passiert.
Trillerschreie können desweiteren zwischen dem Ende eines Refrains und dem Beginn einer Strophe und umgekehrt ausgelöst
werden, wenn der Gesang aus Refrain und Strophe besteht. 298
Tz. = Textzeile
6 %ረ ተወኝ ሀገር %ረ ተወኝ መንደር ärä täwäñə agär ärä täwäñə
mändärə
Lass mich in Ruhe, mein Land! Lass
mich in Ruhe, meine Gegend!
7 እየሰማህ አውራ እያየህ ተናገር əyäsämāhə awərā əyayähə
tänāgärə
Rede nur von dem was du gehört hast
und erzähle nur von dem was du
gesehen hast!
Wie aus der Übersetzung zu ersehen ist, deutet der Inhalt insbesondere auf Gegensätze hin. Darauf bezo-
gen kann zum Beispiel ein Löwe nicht von einem Kalb geschützt werden, weil das Kalb vom Löwen ge-
fressen werden würde, oder eine Hyäne kann sich unmöglich mit einem Esel vertragen. Sie würde eben-
falls den Esel fressen. Gemeint ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch krasse Gegensätze har-
monieren können. Enttäuscht vom menschlichen Alltag lehnt der Sänger solche schönen Geschichten ab,
er hält sie für unwahr. Dies drückt er in den letzten beiden Verszeilen aus.
Ein weiterer Liedtext berichtet über eine frustrierte Frau, deren Lebenspartner, Freund oder Ehemann, sein
Liebesverpsrechen nicht eingehalten hat:
Tz Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 አምባሰል ተሰብሮ ግሸን ደግፎታል
ambassäl täsäbrõ
gəšän dägfõtāl
Ambassäl299 stürzte,
wurde aber von dem Berg gəšän gestützt.
2 ግሸን መደገፉ ያንተ ቅንነት ነው
gəšän mädägäfū
yantä qənənät näwu
Dass gəšän Ambassäl stützt, symbolisiert
deine Freundlichkeit.
3 አምባሰል መናዱ ቃልህ መፍረሱ ነው
ambassäl mänadū
qāləh mäfräsū näwu
Der Sturz Ambassäl's symbolisiert dein nicht
eingehaltenes Versprechen.
4 ላንተ ይብላኝ እንጂ ቃልህ ለፈረሰው
lantä yəblañ ənğī
qāləh läfäräsäwu
Schade, dass du dein Wort nicht einhalten
konntest.
5 መቼ ወዳጅ ያጣል ቆሞ ከሄደ ሰው
mäčē wädāğ yatāl
qomõ kähēdä säwu
Ich werde andere Partner kennernlernen
solange ich noch lebe.
Die Frau drückt aus, dass es nicht das Ende der Welt ist, von ihrem scheinbar vertrauten Partner
verlassen zu werden. Solange sie noch lebt, kann sie, auch wie jeder anderer Mensch, irgendwann einmal
wieder einen neuen Partner kennenlernen, mit dem sie glücklich sein kann.
In den amārā-Liedern gibt es auch Texte, die entweder nicht übersetzbar sind oder deren Verszeilen
sprachlich keinen Zusammenhang bilden (s. auch Blacking 1967: 30). Solche Texte werden in den Liedern
wie jeder anderer Text als normal empfunden. Die folgenden zwei Verszeilen stammen aus einem Hoch-
zeitslied:
Tz Umschrift Übersetzung
1 yäbāhər qäräfā Zimt des Meeres,
2 yäbāhər qäräfā Zimt des Meeres,
3 mušərīt atwädəm Die Braut mag nicht
4 yämīžē kärəffāffā eine faule Brautjungfrau.
In den amārischen Hochzeitsgesängen sind die meisten Gesänge durch feststehende Liedtexte fixiert. Die-
se Liedtexte assoziieren zugleich die melodischen Strukturen. Die Stabilität der tradierten Texte ermög-
licht erst die direkte Kommunikation zwischen awrāğ und täkäbäjõč. Doch innerhalb dieser feststehenden
Liedtexte können auch sich ständig aktualisierende Verszeilen oder Teile von ihnen erscheinen, die der
erforderlichen melodischen und metrischen Struktur entsprechen. Meistens beginnen solche aktuellen
Sequenzen nach dem ersten Abschnitt, der für die Identifizierung des Gesangs notwendig ist und deshalb
299
Ortsname in der Region Wällõ.
zumeist unverändert bleibt. Die aktuellen Hinzufügungen, ihre Länge, ihre Konkretheit und ihre Intention
bestimmt jeweils der awrāğ.
3.4.2. Die Anzahl der Silben in den Gesangszeilen
Im amārischen Gesangsrepertoire werden oft solche Texte gesungen bzw. verwendet, die eine bestimmte
Anzahl von Silben pro Verszeile umfassen. Die meisten Gesänge besitzen 12 Silben pro Verszeile. Diese
Verszeilen können jeweils eine selbständige Gesangszeile bilden, wie im folgenden Beispiel:
Text zu Nrn. 47 und 16
Silbenzahlen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mä he dəš mä he dəš mä he dəš yə wä ral
at šäñ wa təm wäy mä he dwa ay dä läm wäy
Anhand dieser Verszeilen ist zu beobachten, dass es sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig gegliederte
Zeilenstrukturen gibt. Die Schraffur zeigt die jeweilige Wortbetonung im Gesprochenen an, die jedoch der
rhythmisch-melodischen Struktur untergeordnet wird. Texte mit gleicher Silbenanzahl pro Verszeile, hier
12 Silben, können diesem Gesang hinzugefügt werden.
Häufig ist es jedoch der Fall, dass diese 12-silbigen Verszeilen entweder in gleichlange (s. z.B. Notation
Nr. 70), oder unterschiedlich lange melodische Formeln einer Gesangszeile (s. z.B. Notation Nr. 32) ge-
gliedert werden:
Text zu Nrn. 70 und 32
Silbenzahlen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
yä ža rē a mä tə yä ma mī tū ə nā tə
ə nē al sä təm ə tē nə ab rõ a dä gä nə
Die gewöhnliche Endreimlage der 12-silbigen Verszeilen bleibt davon unberührt, d.h. es kann sich jeweils
die 1. und 3. oder 2. und 4. usw. melodische Formel einer Gesangszeile reimen. Allerdings treten gele-
gentlich auch Querreime innerhalb der 12-silbigen Verszeilen auf, so dass sich auch die Endsilbe einer
jeden melodischen Formel reimen kann.
Es gibt auch Gesangszeilen mit sechs Silben, die auch in zwei Textzeilen gegliedert werden müssen. Ein
Beispiel ist der Gesangteil samrāyē (s. jeweils fett markierte melodische Formeln; s. auch Notation Nr. 4;
Takte 165-175/awrāğ, Anhang II, S. 17):
Text zu Nr. 4
Silbenzahlen
1 2 3 4 5 6
wä- gä- bēn ya- mä- ñāl
mä- qä- nät yə- lä- ñāl
3.4.3. Funktion und Rolle von Redundanzsilben
In vielen Liedtexten der amārā werden Redundanzen genutzt, die trotz ihrer sprachlichen Bedeutungslo-
sigkeit, z.B. hay lõgā (Nr. 24), eine wichtige Rolle im Gesang spielen. Diese Redundanzen können sowohl
als Titel und auch als Sinnträger des gesamten Gesanges überhaupt funktioneren. Sie können besondere
Stimmungen auslösen, die die am Gesang beteiligten Personen zur einer noch intensiveren Beteiligung an
Gesang und Tanz anregen. Vor allem besitzen Gesänge mit ständig wiederkehrenden Anrufungen in Form
von Redundanzen eben diese Anrufungen als Titel.
Die Silbenstruktur der Redundanzen muss vor allem den rhythmischen Vorgaben innerhalb der Gesangs-
zeilen angepasst sein, sie ist insofern in ihrer Akzentsetzung nicht willkürlich wählbar.
Deutlich zeigt sich dieser Sachverhalt in den Gesangszeilen 1-3 (s. die ersten 6 mel. Formeln) des Gesan-
ges hay lõgā (S. 89). Die Schraffur kennzeichnet den Part der täqäbäjõč, die Kastenrahmen des Textes
enstsprechen den Gesangszeilen und die kursiven Silben die Redundanzen:
Abb. 27
ə ə ə ə ə ə ə ə
hay lõ gā, hay lo ga ye hõ
ə ə ə ə ə ə ə ə ə
hay lõ gā, ə həm, hay lo ga- -a
ə ə ə ə ə ə ə ə ə
hõ ä rä go bäž, ə həm (ə) näw
Redundanzen können in einem Lied an den folgenden Stellen vorkommen:
nach einer instrumentalen Einleitung, vor allem in den ažmārī-Gesängen (s. 3.4.5.)
nach einem Refrain. Ein Refrain kann aber auch ausschließlich aus solchen Redundanzen beste-
hen.
zwischen einer Strophe und dem folgenden Refrain.
in einem Wechselgesang zwischen awrāğ und täkäbayõč, wobei meistens die Gesangszeilen der
täkäbayõč aus Redundanzen bestehen. Dies betrifft vor allem die Rufwechselgesänge.
vor den Verszeilen und häufig in Form von Anrufungen.
3.4.4. Verkürzungen und Verlängerungen von Liedtextzeilen
Texte werden nach ihrer melodisch-rhythmischen Struktur geordnet. Aufgrund dessen kann es vorkom-
men, dass eine Verkürzung bzw. eine Verlängerung des Gesangstextes vorgenommen werden muss, um
mit der vorgegebenen melodisch-ryhthmischen Struktur in Übereinstimmung zu kommen. Beim Verkür-
zen von Textzeilen werden Vokale miteinander verschmolzen, während sie bei einer Verlängerung einge-
schoben, ausgedehnt und an den bereits vorhandenen Text angehängt werden können. Dadurch wird die
Anzahl der in einer Melodiezeile benötigten Silben vervollständigt.
3.4.4.1. Verkürzung von Liedtextzeilen durch Verschmelzung von Silben
Ein Kästschen enthält jeweils ein ganzes Wort, das nach Silben getrennt ist. Die in Klammern gesetzten
Silben werden im Gesang mit den davor bzw. danach stehenden Silben verschmolzen und daher auch
nicht gesungen.
z.B. diese Gesangszeile aus dem Lied arä näyə ətē (s. Nr. 22):
Silbenzahl 2 2 2 2 2
gesprochener Text arä näyə ətē arä näyə
gesungener Text a-rä nä-yə (ə)-tē (ä)-rä nä-yə
Silbenerkürzung * *
Ergebnis: 2 2 1 1 2
Die Silbe ə und ä (Spalte 3 und 4 in Klammern) werden beim Gesang verschmolzen.
Oder folgende Gesangszeile aus dem Lied ələl bālē ohõ (s. Nr. 28):
Silbenzahl
3 2 2 3 2 2
gesprochener Text ələlə bālē ohõ ələlə bāl ē hõyə
gesungener Text ə-lə-lə bā-lē o-hõ (ə)-lə-l(ə) bā-lē hõ-yə
Silbenerkürzung *
Ergebnis: 3 2 2 1 2 2
Die Silbe ə (Spalte 4 in Klammern) wird beim Gesang verkürzt.
3.4.4.2. Verlängerung von Liedtextzeilen durch Einschieben von Silben
Die in Klammern gesetzten Silben werden im Gesang mit den davor bzw. danach stehenden Silben ver-
längert und daher zusätzlich gesungen.
Gesangszeile aus dem Lied yäbētä žämädū (s. Nr. 63):
Silbenzahl 2 3 3 3 2
gesprochener Text ohõ yäbētä žämädū yətayāl gudū
gesungener Text o-hõ yä-bē-tä (a) žä-mä (ä)-dū yə-ta (a)-yāl gu-dū
Silbenverlängerung * * *
Ergebnis: 2 4 4 4 2
Die Silben a bzw. ä (Spalten 2, 3 und 4 in Klammern) werden beim Gesang verlängert.
b) Gesangszeile aus dem Lied yäñāmā mūšərā (s. Nr. 65):
Silbenzahl 3 3 3 3
gesprochener Text yäñāmā mūšərā yäñāmā mūšərā
gesungener Text yä-ñā(ā)-mā-(ā) mū(ū)-šə-rā yä-ñā(ā)-mā-(ā) mū(ū)-šə-rā
Silbenverlängerung * * * * * *
Ergebnis: 5 4 5 4
Die Silben a bzw. u (Spalten 1-4 in Klammern) werden beim Gesang verlängert.
3.4.5. Lieder und Liedtexte des ažmārī
Der ažmārī {አዝማሪ} ist der traditionelle Sänger, der sich gewöhnlich mit seiner einsaitigen Kasten-
Spießlaute masinqõ begleitet. Historisch betrachtet hat der äthiopische ažmārī in seinen Grundzügen Ähn-
lichkeiten mit den Troubadours, Trouvères, Minnesängern300 und Rhapsoden, die in der Musikgeschichte
des europäischen Mittelalters eine wichtige Rolle spielten (s. auch Powne 1968: 61f). Auch in anderen
afrikanischen Kulturen sind traditionelle Sänger (z.B. in Togo301) anzutreffen, die eine ähnliche Rolle wie
den äthiopischen ažmārī spielen.
Der ažmārī ist für seine spannenden Gesangstexte bekannt. Ein besonders erfahrener ažmārî kann seinen
Gesangsauftritt durch den Einsatz seines großen Textrepertoires hochinteressant machen. Er spielt eine
große Rolle durch seine aus dem Stegreif improviserten bzw. erfundenen Texte, die oft aktuelle Situatio-
nen beinhalten und daher von den Zuhörern oder Begleitern mit großem Interesse konsumiert werden. Die
Texte können auch an aktuelle Geschehnisse, z.B. die politische Situation im Lande, unmittelbar geknüpft
werden. Kimberlin (1976: 176):
"There are a number of contributing reasons. The songs are not fixed... Repetition of the exact text ist not
an important criterion as are other factors such as the meaning of the words in a song, the syllable-rhyme
scheme, level of text difficulty and the creation of a particular mood or setting".
Auch Powne (1968: 62) bestätigt die freie, improvisatorische Textvariation des ažmārī:
"His themes suit the occasion.... He sings wedding songs, eulogies of the virtues of the master of the house
or of the beauties of the lady, and epics of victories in war or conquests in love".
Unter den ažmārīwõč (Plutal zu ažmārī) gibt es welche mit Grundkenntnissen und andere mit langjährigen
Erfahrungen als Sänger und Instrumentenspieler. Davon hängt der Bekanntheitsgrad und im Zusammen-
hang damit der ökonomische Status eines ažmārī ab.
Die meisten in den städtischen Zentren (vor allem in Addîs Abäbā) lebenden ažmārīwõč, kommen ur-
sprünglich aus ländlichen Gegenden der Regionen Wällõ, Gondär, Goğām, um durch ihre Gesangskunst
ihren Unterhalt verdienen zu können. Von Erzählungen ist zu erfahren, dass sie früher als Diakone und
Sängerknaben in den Kirchen viele Jahre dienten und danach der Kirche einfach den Rücken kehrten, um
im weltlichen Gesang ihre Zukunftschancen auszuprobieren (Bekele 1987: 35). Daher wurden sie als vul-
gär und profan bezeichnet. Es konnten jedoch nicht alle ihren Berufswunsch in den Städten verwirklichen,
da die Konkurrenz sehr stark war. Dies setzt sich bis in die Gegenwart fort.
Der ažmārī hat sehr viel zur Entwicklung der Musizierformen beigetragen. Diesbezüglich erläutert Bekele
(1987: 35f.) folgendes:
"With the spread of the Azmaries musicial activities, the belief held by the people of being ashamed to sing
loudly was interrupted. These Azmaries were not welcomed by the people at first. Their dynamic change of
musical forms could be one of the reasons for this. Songs which were sung only for individual satisfaction
were changed and a sense of musical appreciation was started".
Der professionelle ažmārī singt gewöhnlich in traditionellen Kneipen. Hier unterhält er abends sein
Publikum mit seinen interessanten und spannenden Aufführungen. Durch seine Liedtexte gewinnt er ihre
Zustimmung und die nötige Bereitschaft zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Der tägliche Auftritt in täğ-
bzw. ažmārī-Häusern sichert ihnen mehr oder weniger ein relativ festes Einkommen. Außerdem bekommt
der ažmārī zusätzlich Trinkgeld von seinen Stammkunden oder er wird an manchen Tagen, insbesondere
an Feiertagen, mit großen Geldsummen honoriert.
300
Siehe ausführliche Beschreibung über die Spielmannskunst und Minnesang in Gülke 1980: 122-168. 301
Siehe die Beschreibung von Kubik über den Fo-Troubadour aus Togo (Kubik 1988:109).
Im Gegensatz zur Stadt, verdient der ažmārī auf dem Land sehr wenig Geld, so dass er das Musizieren als
einen Nebenberuf ausüben muss. Hauptberuflich sind die meisten ažmārīwõč dieser Gegenden Bauern
oder Viehzüchter. Sie treten selten solistisch auf.
Auch in den traditionellen Kneipen der ländlichen Gegenden arbeiten im Vergleich zur Stadt sehr wenige
ažmārīwõč, die auch relativ gering bezahlt werden, weil die finanzielle Kraft der auf dem Lande lebenden
Menschen sehr schwach ist. Daher musizieren diese ažmārīwõč nur bei Gelegenheit, z.B. in ihrer Freizeit
oder bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten, zumeist ohne Geld, auch wenn sie professionell
sind. Unter der Bezeichnung professionell muss nicht verstanden werden, dass der ažmārī sein
Lebensunterhalt nur durch seine Musik verdient und sie auch zum Hauptberuf gemacht hat. Dieser Begriff
muss, wie Merriam ausführt, folgendermaßen verstanden werden:
"In the Western World a "proffessional" is a person who earns his living from his special skill. This defini-
tion, however, is not applicable on a worldwide basis; many persons of the highest musical skill are paid
in ways other than monetarily, and some are not paid at all. A professional can better be defined as a per-
son who is accorded recognition by the members of his society as an outstanding performer in his special
area of expertise" (Merriam 1982c: 142).
Somit wird auch der ažmārī dann als professionell anerkannt, wenn er langjährige Erfahrungen besitzt und
von seinem Publikum hochgeschätzt wird.
Das Erlernen von Musik, sowohl das Singen als auch das Instrumentenspiel, geschieht durch Nachahmen
bekannter Vorbilder, was ebenfalls für die meisten afrikanischen Kulturen charakteristisch ist (Merriam
1982c: 141). Dies gilt ebenso für den äthiopischen ažmārī.
Die traditionellen Lieder der amārā haben keine festbestimmte Dauer. Der ažmārī kann entscheiden, wie
lange er ein Lied singt. Es kommt besonders auf den textlichen Teil und auf die Stimmung der Zuhörer
oder der unmittelbar am Gesang beteiligten Personen wie beispielsweise die täkäbayõč an, ob ein Lied
kurz oder lang sein soll. Der ažmārī, der entweder als Leiter in einem Gesang fungiert, wenn der Gesang
ein Wechselgesang ist, oder nur eine solistische Darstellung liefert, orientiert sich nach der Stimmung
seines Publikums. Er wird vom Publikum animiert, weiterhin neue Liedtexte anzubieten.
Es ist außerdem wichtig, von bestimmten Liedtexten zu reden, die in der äthiopischen Poesie als säm und
wärq, Wachs und Gold, bezeichnet werden. Solche Liedtexte tragen doppelte bzw. verschlüsselte Bedeu-
tungen in sich. In den ažmārī-Liedern geht es nicht nur um einfache Verse, sondern um diese poetische
Kunst, die großes Interesse beim Publikum wecken.
Orignalschrift Umschrift Übersetzung
የልጃገረድ አውታታ yäləjagäräd awttatta Eine unerzogene Jungfrau
አውራ መንገድ ላይ ተኝታ awra mängäd layə täñəta schläft auf der Strasse.
ተነሺ ቢልዋት ምነው tänäši biluwat mənäwu Warum rät man ihr nicht aufzustehen?
ይህ ሁሉ አለማፈር ነው yəh hulu alämafär näwu All das ist eine Unverschämtheit.
Aus der direkten Bedeutung dieses Textbeispiels erfahren wir von einer unerzogenen Jungfrau (Zeile 1),
die auf der Strasse schläft, mit anderen Worten Prostitution betreibt (Zeile 2). Man fragt sich, warum man
ihr nicht vorschlägt, von der Strasse wegzukommen (Zeile 3), weil das, was sie dort betreibt, ordinär sei
(Zeile 4).
Der wichtigste Kern des Textes steckt in der 4. Zeile und zwar vor allem in dem Wort alämafär (sich nicht
schämen). Dieses Wort wird hier in zwei Teile getrennt, so dass sich daraus zwei selbstständige Worte
ergeben. Diese sind aläm und afär. aläm ist die Welt und afär ist die Erde. Daher ist also von der verdeck-
ten Bedeutung inhaltlich folgendes zu verstehen:
Eine unerzogene Jungfrau, die auf der Strasse schläft...
warum fordert man sie nicht auf, wegzugehen (da sie so jung ist).
Die ganze Welt, d.h. alle Menschen der Welt, stirbt sowieso irgendwann und versinkt in die Erde, d.h.
jeder wird begraben. Die junge und schöne Frau soll nicht in diesem frühen Alter sterben, sondern diese
Welt noch erleben.
Genauso beschreibt Gülke (1980: 145) in seinem Buch, dass im Minnesang des europäischen Mittelalters
"nicht nur bewährte Versordnungen, sondern auch inhaltliche und interessante poetische Prägungen, in
der streng gewichtigen Hymne ebenso wie in der seelischen Dynamik und Innigkeit der Sequenz"
zu finden sind.
Die Texte des ažmārī sind mit Realismus verbunden. Dinge nennt er meistens beim Namen. Während des
Singens reagiert der ažmārī auch auf Liedexte, die vom Publikum vorgeschlagen werden. Dies gehört zur
Tradition der amārā. Solche Texte haben desöfteren Preisungen von Angehörigen, Freunden oder Ver-
wandten zum Inhalt, mit denen der Textanbieter in dem jeweiligen Augenblick zusammensitzt.
Solche Strophentexte können verschiedenen Gesängen hinzugefügt werden:
Tz Originalschrfit Umschrift Übersetzung
1 ሐብሌንም ውሰዱ hablēnəm wəsädū Nehmt meine Kette,
2 ቀለበቴን እንኩ qäläbätēn ənkū und meinen Ring
3 የአደራ ገንዘቤን ye ādärā gänžäbēn rührt aber nicht
4 *** አትንኩ *** atənkū mein Eigentum ***302 an.
Es können aber auch nicht anwesende Personen in den Liedern gepriesen und gelobt werden wie z. B.
Tz. Originalschrfit Umschrfit Übersetzung
1 እዚህ የሌለ ሰው əžīh yälēlä säw Wird ein Abwesender
2 አይነሳም ወይ? ayənäsām wäyə nicht erwähnt?
3 የኔ አካል*** yänē akāl *** Mein lieber ***,
4 አንለውም ወይ? anəläwəm wäyə Sagen wir es doch mal.
Es handelt sich dabei um Verszeilen, die zusätzlich, d.h. zwischen die traditionellen Texte, oder im Aus-
tausch zu diesen hinzugefügt werden. Zu Hochzeitsfeiern der amārā wird der ažmārīin der Regel bestellt
(Kebede 1971: 74). Es ist aber auch möglich, dass er einfach auf der Feier auftaucht und unaufgefordert
singt in der Hoffnung, dass er von dem Einen oder Anderen beschenkt wird303. Über solche besondere
Anlässe lässt er sich rechtzeitig informieren. Er weiß, wo und wann eine Hochzeitsfeier stattfindet. Er
singt und begleitet das Hochzeitspaar von Anfang bis zum Ende des Hochzeitsfestes mit seinen spannen-
den Gesängen. Manchmal kommen mehrere ažmārīwõč auf die Hochzeitsfeier und versuchen sich gegen-
seitig herauszufordern, um akzeptiert und aufgenommen zu werden. Jeder singt sein Lied nach seiner Vor-
stellung, so dass sich für die Zuhörer ein großes Durcheinander ergibt. Derjenige, der aufgibt, verabschie-
det sich rechtzeitig und geht woanders auf die Suche nach Arbeit.
Auf manchen Hochzeitsfeiern bringt der ažmārī auch eine Sängerin mit, die ihn hin und wieder ablöst. In
den meisten Fällen, ist die weibliche Sängerin, ebenfalls ažmārī genannt, zugleich die Ehefrau des ažmārī.
Während ihr Mann sie auf der masinqõ begleitet304, singt und tanzt sie und versucht die Hochzeitsgäste zu
animieren und die Aufführung attraktiver zu gestalten. Das Sängerduo könnte auch aus einer guten Be-
kanntschaft, Verwandtschaft oder Freundschaft bestehen. Manche Gruppen haben gute Gesangserfahrun-
gen, die auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückzuführen sind. Dadurch werden sie auch in zuneh-
302
An diesen Stellen wird ein Name hinzugefügt. 303
Es können aber auch mehrere ažmārīwõč auf eine solche Feier ohne irgend eine Einladung erscheinen, wobei jeder versucht
sich mit dem anderen zu konkurieren, damit er als den besseren bzw. besten Sänger gewählt wird und somit auch bleiben darf.
Je mehr er gebraucht wird, umso länger bleibt er auf der Feier. Wenn es sich herausstellt, dass er ein guter Entertainer ist, wird er für die weiteren Feierlichkeiten (z.B. mäls-wird am dritten Tag nach dem Hochzeit gefeiert) bestellt.
304 Heutzutage sieht man in zunehmendem Maße den ažmārī mit einem Akkordeon als Begleitinstrument und zwar nicht nur auf
Hochzeitsfeiern, sondern auch in traditionellen Kneipen, die als täğ- oder ažmārī-bēt bekannt sind.
mendem Maße bekannt und auf solche Feiern eingeladen. Heutzutage haben sich unzählige solcher tradi-
tionellen Gesangsgruppen in den städtischen Zentren gebildet, die nicht nur aus zwei Personen bestehen,
sondern aus 3, 4 und 5 Personen, Frauen und Männern. Die Zusammenarbeit in einer solchen Gruppe be-
steht darin, dass jedem Mitglied während des Gesanges eine Rolle zukommt. Dies betrifft sowohl den
əskəstā-Tanz als auch die Begleitung als täqäbay im Zusammenhang mit dem Klatschen und mit dem
Trillern, oder auch mit dem Instrumentenspiel, meistens kərār oder masinqõ.
Je mehr die Aufführung des ažmārī auf Interesse stößt, umso mehr Geld fließt seitens des Publikums. Es
gehört nämlich zum Brauch der amārā305, dass man bei solchen Auftritten dem Sänger bzw. Tänzer Geld
schenkt306. Es besteht jedoch kein Zwang, dies zu tun. Manchmal wird so ein Auftritt innerhalb von we-
nigen Stunden mit unglaublich viel Geld honoriert. Natürlich kommt es im Allgemeinen auf den sozialen
Status der Zuhörer an, wieviel Geld ein ažmārī oder eine Gesangsgruppe pro Auftritt verdienen kann. Auf
der anderen Seite jedoch hängt die Höhe des Honorars von der Beliebtheit und von dem Bekanntheitsgrad
des ažmārī bzw. der Gruppe ab, die ihr Publikum durch das Liedrepertoire und durch die Vielfalt ihrer
Texte anlockt.
3.5. MUSIKINSTRUMENTE
Auf vielen Hochzeitsfeiern der amārā begegnet man die Trommel käbärõ {ከበሮ} als einziges Begleitin-
strument. In manchen Fällen werden aber auch zusätzlich die Blasinstrumente əmbiltā und mäläkät auf
einem Hochzeitsfest eingesetzt.
3.5.1. Die Trommel käbärõ
Die Trommel käbärõ besitzt einen hohen sozialen Status in der amārischen Kultur und sie wird nicht nur
bei besonderen Anlässen wie zum Beispiel einer Hochzeitsfeier gespielt, sondern auch zu vielen anderen
Musikaufführungen im normalen Alltag.
Die Bezeichnung käbärõ wird aus dem Verb makbär {ማክበር} abgeleitet, was soviel bedeutet wie "ze-
lebrieren" und "ehren". Ähnliche Trommeltypen wie die amārische käbärõ finden wir auch in Ägyp-
ten und Sudan (Kebede 1982: 60). Die käbärõ ist eine große, zweifellige und geschnürte Konustrommel.
Instrumentenkundlich zählt sie zu der Familie der Felltrommeln, die in Gefäß-, Röhren- und Doppeltrom-
meln unterteilt werden (s. Ackermann 1901: 41). Davon ähnelt die Gruppe der Doppelfelltrommeln der
Bauart der äthiopischen käbärõ.
Der Gebrauch der käbärõ beschränkte sich in früheren Zeiten zum größten Teil auf die Kirche. Heutzutage
begegnet man ihr jedoch in zunehmender Weise auch in weltlichen Musikveranstaltungen der amārā.
Hergestellt wird die käbärõ zumeist aus einem konisch ausgehöhltem Baumstamm, wobei sich die Größe,
die Art und die Form des gewählten Baumstammes von Ort zu Ort unterscheiden. Die Maße betragen von
70-90 cm in der Höhe und 50-60 im Durchmesser. Allerdings kommt es vorwiegend darauf an, dass der
Baumstamm zunächst zylindrisch ist, um die Herstellung zu erleichtern.
305
Auch in der Tradition der Təgrāy gehört es zum Brauch einem/r Sänger/in oder einer Gesangsgruppe mit Geld zu beschenken
als Zeichen zur Freude am Gesang. 306
Dabei wird gewöhnlich ein Geldschein mit Speichel angefeuchtet und auf die Stirn des Sängers bzw. der Sängerin geheftet.
Der Sänger oder die Sängerin läßt sich von dieser Aktion nicht von dem jeweiligen Gesang abbringen, dennoch bleibt der
Geldschein unter strenger Beobachtung, damit dieser nicht abhanden kommt, denn es kann durchaus möglich sein, dass einige
Langfinger in der Nähe sind. Vorsichtshalber neigt der Sänger oder die Sängerin den Kopf ein wenig nach hinten, wobei im weiteren Verlauf des Gesangs der Geldschein mitunter über die Augen rutscht.
Inneres und Äußeres wird mit Eisenwerkzeugen abgeschabt und dann mit Schmirgelpapier geglättet (Ke-
bede 1982: 60). Der ausgehöhlte Korpus der käbärõ wird danach beidseitig mit Fell bezogen, das mit Le-
derriemen307 befestigt wird. Zuerst werden die quer zum Fell verlaufenden Riemen, in der Regel 2-4
Stück, um den Korpus geschlungen. Mit einem einzigen sehr langen Riemen werden dann beide Felle im
Kreuzverfahren gleichzeitig befestigt und gespannt:
Dazu werden in einer Entfernung von ca.1cm der Übertritt des Felles in regelmäßigen Abständen kleine
runde Löcher geschnitten, die sich nach dem Spannen oft weiter dehnen. Die Korpora der meisten Prozes-
sionstrommeln308 werden gewöhnlich vor der Schnürung dekorativ mit heiligen bunten Tüchern bedeckt.
Die käbärõ besitzt meistens zwei unterschiedlich große Felle, die dazu dienen, zwei verschiedene Tonhö-
hen, d.h. eine tiefe und eine hohe, zu erzeugen. Allerdings werden nur bei der Begleitung sakraler Tänze
und Gesänge beide Felle mit den Händen geschlagen, während für weltliche Gesänge nur das größere Fell
des Instruments geschlagen wird.
Für eine bevorstehende Hochzeitsfeier leiht man sich gewöhnlich eine käbärõ von einer Kirche. Vor dem
Gebrauch muss die käbärõ entweder für einige Tage in der Sonne liegen, oder über Feuer gleichmäßig
gewärmt werden, so dass durch die stärkere Spannung und Festigkeit ein guter Klang erzeugt werden
kann. Ausgeliehen wird die käbärõ meistens einige Wochen vor dem eigentlichen Hochzeitstag, da sie zur
Gesangsbegleitung schon von dieser Zeit an in den jeweiligen Häusern gebraucht wird. Unmittelbar nach
Beendigung der Hochzeitsfeier muss das Instrument an die Kirche zurückgegeben werden.
Abb. 28
Die Hauptfunktion der Trommel käbärõ ist im Allgemei-
nen die Aufrechterhaltung des metrischen Verlaufes im
Gesang. Allerdings müssen nicht alle Hochzeitslieder
unbedingt mit Trommeln begleitet werden. D.h. es können
auch Gesänge ohne sie durchgeführt werden. Beim Fehlen
der käbärõ allerdings ist das Klatschen besonders wichtig,
da es die Rolle des Trommelns, also die Aufrechterhaltung
des Metrums, zusätzlich ersetzt, obwohl ohnehin ge-
klatscht wird. Die Gesänge der amārā können somit ent-
weder mit Hilfe der käbärõ oder des Klatschens begleitet
werden. Diese Begleitmethode wird auch in vielen Kultu-
ren Afrikas angewendet (s. Merriam 1982b: 449-50, Jones
1954: 28, Zinke 1992: 109, Blacking 1967: 17).
Das stete Metrum ist für die amārischen Lieder von wich-
tiger Bedeutung. Dies gilt ebenso für viele afrikanische
Traditionen, die vor allem Trommeln benutzen.
Hornbostel (1928: 52) beschreibt auch, dass der Rhythmus309 in den afrikanischen Gesängen wichtig ist
und dass das Trommelspiel bei Gelegenheit auch durch Händeklatschen oder durch ein Xylophon ersetzt
werden kann. Am wichtigsten ist jedoch die grundlegende Metrik, aus der die afrikanischen Rhythmen
verstanden werden können.
Außerdem besteht beim käbärõ-Spiel die Freiheit des Improvisierens. Dies ist jedoch bei den amārā nicht
so entwickelt wie es in manchen anderen afrikanischen Kulturen der Fall ist. Der Unterschied liegt darin,
dass der äthiopische Trommler die käbärõ meist solistisch spielt, während es in anderen afrikanischen
Kulturen Trommeln in Sätzen zu 2, 3 oder mehr Musikern geschlagen werden, wobei jeder Trommler ein
bestimmtes rhythmisches Muster zugeteilt bekommt. Bei dem äthiopischen Trommler kommt es vor, dass
er im Gesangsverlauf dem Hauptschlagmuster rhythmische Formeln hinzufügt, um den Trommelschlag
auszuschmücken. Immer wieder kehrt er jedoch zum Hauptschlagmuster zurück. Kauffmann (1980: 413)
schreibt über die Freiheit des Improvisierens bei den afrikanischen Trommlern wie folgt:
307
ersatzweise kann auch Schnur aus Sisal verwendet werden 308
betrifft die Kirchentrommeln 309
hier ist das Metrum gemeint
"The final ingredient in African rhythmic relationsships is the role of improvisation, which is usually as-
signed to the largest and most important drum in an ensemble. The constraints on the improvising role
are much less than on the other parts, and thus it is more difficult to analyze. However, some aspects of
improvisation found in drumming ensembles can be distinguished. First of all, improvising drummer can
combine different patterns much more freely than can the other performers. He can quickly move from
one pattern to another, and thus uniquely combine his repertoire of patterns. He can also replace regular
accents with variable accents than keep changing against the regularity of the other instruments. The
drummer can also play in free rhythm, and in doing so, he often bases his rhythms upon language texts".
In einem Wechselgesang wird nicht unbedingt ein käbärõ-Spieler von vornherein bestimmt, sondern es
geschieht spontan während des Gesangs, dass sich ein Freiwilliger aus der singenden Gruppe zum Trom-
melspiel bereit erklärt. In der amārā-Tradition gibt es auch keine professionellen käbärõ-Spieler, die das
Trommeln als Beruf erlernt haben. Das Trommelschlagen beherrscht man nur durch Erfahrung. Wird ein
käbärõ-Spieler vom Trommeln müde, wird er einfach von einem anderen Beteiligten abgelöst, der das
Instrument ebenso gut bedienen kann.
Bei allen weltlichen stationären Musikveranstaltungen der amārā wird die käbärõ meistens im Sitzen mit
beiden Handflächen gespielt. Der Spieler hält sie zwischen den Knien. Manchmal steht er auch gebückt,
wenn es keine Sitzmöglichkeit gibt. Eine Hand bedient den Fellrand, die andere schlägt auf die Fellmitte.
Bei Prozessionen oder Feierlichkeiten, bei denen sich die gesamte Gesellschaft in Begleitung der Braut-
leute bewegt, werden kleinere käbärõwoč (Plural zu käbärõ) bevorzugt, die unter den Arm geklemmt
werden können. Auch in diesem Fall wird nur ein Fell geschlagen.
Dagegen wird die käbärõ bei der Begleitung religiöser Gesänge ausschließlich stehend geschlagen. Die
zweifellige käbärõ wird hier beidfellig geschlagen. Der Spieler hängt sie sich an einem Schulterriemen
oder einem zusammengeknoteten Stofftuch um. Der Trommler befindet sich zumeist in der Mitte der tan-
zenden Gruppe und bewegt sich hin und her und animiert die Gruppe zu Tanz und Gesang.
Das Spielen der käbärõ allgemein erfolgt nach bestimmten Schlagformeln und -techniken, die vom Reper-
toire abhängig sind.
Sowohl bei den religiösen als auch bei den weltlichen Gesängen hängt die Spielweise der käbärõ davon
ab, ob der Trommler Rechts- oder Linkshänder ist. Da bei der Begleitung der Kirchengesänge beide Felle
des Instruments geschlagen werden müssen, wird ein Rechtshänder das breitere Ende; d.h. den tiefen Ton,
mit dieser Hand und das kleinere Ende, d.h. den hohen Ton mit der linken bedienen. Ein Linkshänder
muss umgekehrt spielen und die Trommel umdrehen.
Bei den weltlichen Gesängen, in denen nur das große Fell benutzt wird, bedient der Trommler je nach
dem, ob er ein Links- oder Rechtshänder ist, die beiden Aufschlagstellen der käbärõ ebenfalls unterschied-
lich. Der Schlag auf die Mitte des Fells erzeugt einen dumpfen oder tiefen Ton und der Trommelrand er-
zeugt den helleren bzw. hohen Ton. Die typischen Schlagformeln beim Trommelspiel der weltlichen Ge-
sänge sind in Abbildung 29 dargestellt.
Die Noten auf der oberen Linie bezeichnen hier stärkere und tiefe dumpfe, die Noten auf der unteren Linie
schwächere und hohe helle Klänge. Am häufigsten werden die Formeln a bis f benutzt. Die Schlagformeln
a bis d bestehen aus durchgehenden, gleichmäßigen Dreiergruppen. Die Schlagformeln e und f zeigen Off-
Beat-Charakter mit folgender Zweiergruppe und gehen danach zur Dreierformel über. Die letzten zwei
Schlagformeln g und h fangen genauso wie die Formeln e und f an. Danach folgen eine Zweiergruppe und
eine Pause. Der rhythmische Verlauf dieser letzten zwei Formeln ist ganz unterschiedlich von den ersten
sechs. Zu beachten ist, dass für die Begleitung der Gesänge keine festgelegten Schlagformeln bestimmt
sind. Somit stellen diese acht Varianten das gesamte mögliche Repertoire an Schlagformeln in dreigliedri-
gen Metren dar.
Abb. 29
a Linkshänder
Der Trommler schlägt eine dieser Formeln,
die er beherrscht. Hauptsächlich verfolgt er
den Gesang und schlägt seine Trommel
gleichmäßig nach seinen bevorzugten For-
meln im Zusammenhang mit dem Klatschr-
hythmus, der ihn neben dem Gesang hilft,
die betonten und unbetonten Schläge zu kon-
trollieren. Mit Ausnahme einiger Gesänge
(z.B. hay lõgā, s. Nr. 24) sind fast alle Hoch-
zeitsliedern der amārā im dreigliedrigen
Takt.
Im folgenden Beispiel ahūn dämäkš abäbayē
(s. Nr. 4) ist der Einsatz der käbärõ, die in-
nerhalb des Gesanges von verschiedenen
Leuten gespielt wird, näher zu betrachten:
b Rechtshänder
c Linkshänder
d Rechtshänder
e Linkshänder
f Rechtshänder
g Linkshänder
h Rechtshänder
= rechte Hand = linke Hand
Im Notenbeispiel ist festzustellen, dass die Trommelschläge entweder unhörbar sind, plötzlich unterbro-
chen werden oder, dass der Trommler außerhalb des metrischen Verlaufs gerät. An bestimmten Stellen
jedoch werden sie wieder deutlich hörbar, ein Zeichen dafür, dass der jeweilige Trommler seine Schläge
unter Kontrolle hat. Das Schlagmuster, das sich unter Umständen ändern kann, sieht demnach wie folgt
aus:
oder .
In der Notation sind folgende Merkmale zu beachten:
1. Der jeweils der erste Trommelschlag und der erste Klatsch am Beginn eines Taktes fallen zusammen
und markieren somit die betonte Stelle. Diese Stelle ist in der Regel dadurch zu erkennen, dass die Trom-
mel kräftiger geschlagen wird, als die nachfolgenden zwei Schläge, die zu der Dreiergruppe gehören. Die
Rollenverteilung bei den Dreiergruppen sieht wie folgt aus:
Abb. 30: käbärõ 3er-Gruppen:
Kl. Kl. Kl. Kl.
Kl. = Klatschen
2. Abgesehen von möglichen Unterbrechnungen während des käbärõ-Schlagens wie z.B. ein totales Auf-
hören oder das Erzeugen von einem unregelmäßigen Schlagmuster, sind ausschließlich Dreiergruppen zu
hören.
Um Missverständnisse zu vermeiden, ist in der Notation nur die erste Version und zwar die Schlagformel
links-rechts-rechts verwendet worden, da eine analytische Filmaufnahme nicht stattgefunden hat, die be-
weist, wie der/die Trommler seine/ihre Hände positioniert hat. Vom Hören her wurde nur auf die hohen
und tiefen Schläge geachtet, wobei die hohen Töne stets mit der linken Hand und die tiefen Töne nur mit
der rechten Hand angegeben worden sind.
Im der Notation beginnt der erste Trommler - eine am Gesang beteiligte Person - erst im 19. Takt spontan,
die käbärõ zu bedienen. Hier erzeugt er allerdings nur einen einzigen Schlag, vermutlich aus Versehen.
Die gewöhnliche Dreiergruppe jedoch, die nur bis zum Anfang des 23. Taktes dauert, beginnt im 20. Takt,
wo der dritte käbärõ-Schlag nicht mehr zu hören ist. Dies deutet darauf hin, dass der Trommler das Met-
rum des Gesanges noch nicht vollständig aufgenommen hat. Die Zweierschläge vom 23. - 25. Takt sind
unregelmäßige Schläge und erscheinen als Gegenschläge, die zu den oben erläuterten Zweierschlägen der
Schlagformeln g und h überhaupt nicht gehören.
Ab dem 26. Takt taucht die Dreiergruppe wieder auf, aber die Schläge sind so schwach, dass sie kaum
hörbar sind. Vermutlich versucht hier der Trommler den Anschluss an den Gesang zu finden. Dabei kon-
zentriert er sich wahrscheinlich mehr auf das Hören als auf das Schlagen. Dadurch kommen auch solche
Lücken beim Trommelspiel zustande.
Von Takt 43. bis zur Hälfte des Taktes 45. wird der Trommelschlag völlig unterbrochen. Dies ist vermut-
lich ein weiterer Versuch des käbärõ-Spielers das genaue Metrum im Gesang zu verfolgen und demnach
auch den Anschluss zu finden. Im 45. Takt bedient er wieder das Instrument und zwar mit
einem Off-Beat. Dies geht bis zum Takt 54. weiter. Danach hört der erste Trommler völlig auf. Am Ende
des Taktes 63 fängt der zweite käbärõ-Spieler mit dem Schlagen an. Er benutzt die Schlagformel f (s.
Schlagformel f, S. 162), die mit einem Off-Beat beginnt und danach zur gewöhnlichen Dreiergruppe führt.
Der zweite Trommler schlägt die käbärõ bis zum 72. Takt. Im 73. Takt beginnt der dritte Trommler mit
kräftigen Schlägen und ziemlich genau das Metrum treffend das Instrument zu bedienen. Ab hier wird die
käbärõ ununterbrochen geschlagen.
Die Spieltechnik der Trommel käbärõ verlangt eine detaillierte Analyse. Dafür ist eine genaue Filmauf-
nahme wichtig, die zeigt, wie ein Trommler das Instrument bedient und mit welchen Händen die tiefen
oder hohen Töne erzeugt werden. So ist auch eine der oben erläuterten Schlagformeln zu erkennen. All
diese Voraussetzungen sind für die Notation und für die anschließende Analyse von Bedeutung. Die ge-
naue Filmaufnahme ist außerdem notwendig, um zu erkennen, mit welcher Hand der Trommler den ersten
Schlag der Dreiergruppe beginnt, die auch die schwere Zählzeit darstellt. Dies muss jedoch nicht immer
der Fall sein, so z.B. wenn der Trommler irgendwelche unregelmäßigen Schläge erzeugt, d.h. vereinzelte
Schläge oder Doppelschläge die nicht zur Dreiergruppe geordnet werden können und somit auch zu keiner
Schlagformel zählen, bevor er das erforderliche Metrum aufgreift. Nach kurzer Zeit ist zu erkennen, dass
sowohl der erste käbärõ-Schlag als auch das Klatschen auf die schwere Zählzeit fallen.
3.5.2. Die Trommeln atāmo und häbärõ
Abb. 31
Neben der Trommel käbärõ werden in weiteren Kulturen
des Zentralen Hochlands andere Trommeltypen wie z.B. die
atāmo {አታሞ} bei den gurāgē und die häbärõ {,በሮ} bei
den təgrāy sowohl auf Hochzeitsfeiern als auch auf anderen
Musikveranstaltungen verwendet.
Die gurāgē schlagen die Trommel atāmo, ein kleiner einfel-
liger Trommeltyp von ca. 35-45cm Durchmesser und 30-
50cm Höhe, auf ihren Hochzeitsfeiern. Der gewöhnlich
runde oder etwas ovale Trommelkörper dieser einfelligen
Trommel wird aus Ton in Form einer hohen Schüssel ange-
fertigt und dann auf der offenen Seite mit Schaf- oder Zie-
genfell mit einer bestimmten Technik bespannt (Abb. 31).
Meistens enthält der Klangkörper kleine Steine, zerbrochene Stücke von einem Topf aus Ton oder auch
Kerne, damit während des Spielens rasselnde Töne erzeugt werden können.
Die atāmo spielt man entweder stehend an einem Band um den Hals gehängt310 oder auch sitzend, indem
sie zwischen den Knien gehalten wird. Sie dient ausschließlich weltlichen Musizierzwecken. Bei den
gurāgē wird die atāmo vor allem während der Hochzeitszeremonien eingesetzt.
Die təgrāy dagegen verwenden in fast allen Musikveranstaltungen ihre mittelgroße Trommel von ca. 50-
65 cm Durchmesser und 60-70 cm Höhe, die als häbärõ bezeichnet wird. Von ihrer Konstruktion her ist
sie dem amārischen käbärõ ähnlich, doch dient hier die querlaufende Mittelschnürung dem Spannen und
wird erst nach dem Aufziehen der Felle angebracht (Abb. 32).
Die häbärõ wird immer an einem Band um den Hals und die Schultern getragen und mit beiden Händen
auf nur einem Fell gespielt. Deshalb müssen alle für die Gesänge der təgrāy verwendeten Trommeln so
beschaffen sein, dass man sie tragen kann. Möglicherweise ist neben der billigen und einfachen Herstel-
lung dies auch ein Grund, warum viele Trommelkörper inzwischen aus großen Blechdosen hergestellt
werden, weil so das Gewicht erheblich reduziert wird.
Abb. 32
In der Musiktradition der Təgrāy finden kaum Gruppengesänge
ohne die häbärõ statt. In der Regel treten zwei Trommler als Paar
auf, die sich mit ihrer tragbaren häbärõwõč (Plural zu häbärõ) in
der Mitte der Gruppe bewegen und die diese zu Gesang und Tanz
animieren. Die häbärõ wird zwar genauso wie die käbärõ mit
beiden Händen geschlagen, jedoch sind die Schlagmuster, die
metrischen und rhythmischen Gliederungen von denen der käbärõ
sehr unterschiedlich311.
310
Bei den gurāgē gibt es auch die Möglichkeit, die Trommel mit einer Hand zu halten und mit der anderen zu schlagen. Es sind
auch andere Schlagmuster als die der amārischen käbärõ in Gebrauch. 311
Beobachtung/Hochzeitsfeier/Mäqälē 1997
3.5.3. Die Längsflöten əmbiltā und die Längstuben mäläkät
Die Instrumente əmbiltā {እምቢልታ} und mäläkät {መለከት} werden auf manchen Hochzeitsfeiern ne-
ben der Trommel käbärõ eingesetzt, um das Brautpaar am Hochzeitstag zu begleiten und zu beglückwün-
schen. Dies ist auch typisch auf Hochzeitsfeiern der təgrāy. Es sind Sätze von offenen randgeblasenen
Längsflöten bzw. Längstuben, die zum größten Teil im Zentralen Hochland Äthiopiens in Gebrauch sind.
Die Längsflötensätze von drei312 Instrumenten sind gegenwärtig sehr viel häufiger als die archaischen
Längstuben, deren Gebrauch nicht unmittelbar beobachtet werden konnte. Beide Instrumentensätze weisen
allerdings grundsätzliche Gemeinsamkeiten in der Spieltechnik auf.
Mäläkät findet man vorwiegend in der Region Šäwā. Sie wird u.a. aus einem dickwandigen Bambusrohr
von 60 bis 80 cm Länge angefertigt und besitzt in der Regel eine trichterförmige Stürze aus Metall, oder
es wird ein Stück von einem Kürbis oder einem Kuhhorn am Ende des Rohres befestigt. Es gibt auch
mäläkätoč (Plural zu mäläkät), die durchgehend aus Metall gefertigt sind. Das Mundstück besteht aus
einem eingesetzten Metallrohr und wird beim Spielen ganz in den Mund genommen. Das Instrument wird
praktischerweise längs geblasen, doch ist diversen Darstellungen313 zu entnehmen, dass es auch eine
schräge Spielhaltung geben soll. Dies kann zweierlei Ursachen haben: Möglicherweise ist eine əmbiltā
abgebildet, der man das Aussehen einer mäläkät gegeben hat, die einst sehr viel höher im Ansehen stand.
Mäläkät und wohl eher ersatzweise əmbiltā wurden in früheren Zeiten für große Staatsfeierlichkeiten ne-
ben der großen Trommel nägarīt (Kesselpauke, s. Baumann 1978: 25) gespielt. Heutzutage findet man
beide Blasinstrumente ausschließlich im weltlichen Musikbereich. Es ist auch möglich, dass die mäläkät-
Spieler die traditionell schräge Haltung des əmbiltā-Spiels nachahmen durch eine schräge Haltung des
Kopfes. Diese Haltung ermöglicht offensichtlich eine bessere Kontrolle während des Spiels. Im Folgenden
sind zwei mäläkät-Varianten abgebildet:
Abb. 33
Variante 1: Variante 2:
Abb 34
Die randgeblasenen Längsflöten əmbiltā existieren ebenfalls in
mindestens zwei Varianten. Die erste Variante besteht aus Bam-
bus- oder Metallröhren mit einer minimalen scharfkantigen Mulde
als Anblasschneide. Das Instrument wird beim Spielen notwendi-
gerweise schräg gehalten. Die zweite Variante weist eine U-
förmige Öffnung auf, die am tiefsten Punkt straff mit Stoff umwi-
ckelt ist.
Powne (1968:32) gibt Maße und Eigenschaften für drei Instrumen-
te des Museums für Äthiopische Studien der Universität Addīs
Abäbā folgendermaßen an:
312
Sätze aus vier Instrumenten, wie sie bei Lemma (1975: 16-17) abgebildet sind, sind praktisch unsinnig, möglicherweise ist hier nur ein Spieler während des Fotografierens hinzugekommen.
313
z.B. in den Schmuckbildern der Kirche Žägē Mariām auf der Halbinsel des Tānā-Sees Žägē, in der Nähe von Bahər Dār,
Goğām; der Spieler hält das Instrument schräg in der linken Hand und steckt sich gleichzeitig den rechten Zeigefinger in das rechte Ohr
Catalogue No. Length Bore Origin Length of cut-out mouthpiece
838 95 cm 2,5 cm Gore 7,5 cm
1607 75 cm 2,25 cm Shoa 6,5 cm
837 77,5 cm 2,4 cm Gore no cut-out
Bei der zweiten Variante ist die schräge Spielhaltung nicht unbedingt erforderlich, doch wird sie meistens
beibehalten, um die Verständigung zwischen den Spielern zu erleichtern314.
Das Spielen der əmbiltā erfolgt durch Überblastechniken, die die entsprechenden Obertöne hervorbringen.
Vom technischen Grundton, der von der Länge des Instruments abhängt, erklingt zunächst die Oktave,
dann die reine Quinte über dieser Oktave, danach die reine Quarte, eventuell anschließend die große Terz.
Allerdings ist der letzte Ton sehr schwierig zu spielen, weil das vierfache Überblasen sehr viel Kraft er-
fordert. Aus ähnlichen Gründen wird auch der Grundton sehr selten - wenn überhaupt - geblasen. Dem-
nach spielen der Oktav- und der Quintton über dem Grundton eine wesentliche Rolle. Im Folgenden wird
ein Beispiel demonstriert315, das von drei əmbiltāwõč (Plural zu əmbiltā), gespielt wird, die mit I, II und
III bezeichnet sind. Die vorhandenen Tonstufen pro Instrument sind in Abbildung 35 vorangestellt.
Abb. 35
Powne (1968: 33) hat sich in seiner Studie u.a. auch mit diesem Instrument beschäftigt und dieselben Be-
obachtungen dargestellt. Die von ihm angegebene Notation mit drei əmbiltāwõč hat er in einer Zeile hin-
tereinander niedergeschrieben:
314
Auf diese Art ist es möglich, den selbst produzierten Ton besser zu hören und gleichzeitig die Kontrolle über den Gesamtklang
zu behalten. 315
Hochzeitsfilm/Addīs Abäbā 1996.
Abb. 36
Anhand der Notation Pownes resul-
tiert beim näheren Betrachten fol-
gendes Bild des praktischen Spiel-
verlaufs (Abb. 36).
Ersichtlich ist, dass alle drei
Grundtöne jeweils nur den Oktav-
ton sowie die Quinte über der Ok-
tave als Tonvorrat nutzen, so dass
die einfache und zweifache Über-
blastechnik angewendet wird.
Alle drei Grundtöne kommen in dem Musikstück nicht vor, doch stimmen die Intervallverhältnisse g2 - k3
mit dem oben angeführten Beispiel überein. Der Tonvorrat eines Satzes von drei əmbiltāwõč entspricht
meist der Tonreihe təžətā316.
Abb. 37
Die Aufgabenverteilung eines
jeden Spielers erfordert auch eine
spezielle metrische Gliederung der
einzelnen Instrumentalparts (s. I =
1. Spieler; II = 2. Spieler und III =
3. Spieler). Die Gesamtheit des
rhythmischen Zusammenhangs
kann von den Zuhörern verschie-
denartig wahrgenommen werden.
Das heißt, dass auch ein Umkippen der Akzente in diesem arbeitsteiligen Zusammenhang möglich ist.
Anhand der angegebenen Taktstriche sind die für jeden einzelnen Spieler geltenden schweren Zählzeiten
zu erkennen, die er konstant beibehält, um letztendlich ein sinnvolles Ganzes erklingen zu lassen. Die
punktierten Taktstriche weisen auf das von Powne so empfundene Metrum hin, das für alle drei Spieler als
gemeinsamer Nenner betrachtet werden kann. Hier erzeugen der zweite und der dritte Spieler abwechselnd
die schwere Zeit. Denkbar wäre aber auch die vom ersten Spieler produzierte schwere Zeit, eine Auffas-
sung von kanonischem Spiel, das in jedem Part zudem der rhythmischen Assoziation an das ostinate
Trommelspiel näher kommt:
Die Spieler bewegen sich während des Musizierens mit Blickkontakt zueinander im Kreis oder in einer
Reihe. Die Schrittfolge entspricht zumeist den metrischen Schwerpunkten eines jeden Spielers. So ist auch
die Phrasierung der Einzelstimmen leicht zu erkennen.
316
Möglicherweise ist das eine Ursache dafür, dass Hochzeitsgesänge in dieser Tonreihe sehr viel häufiger sind, als in anderen Tonreihen (siehe Repertoireliste im Abschnitt 3)
3.5.4. Der ažmārī und die Kasten-Spießlaute masinqõ
Die masinqõ {ማሲንቆ} ist bei dem ažmārī {አዝማሪ} das am meisten benutzte Instrument. Auch im eu-
ropäischen Mittelalter war die Fiedel ein wichtiges Begleitinstrument für den Gesang des Spielmannes wie
Gülke (1980: 130) es erläutert:
"Unter den Instrumenten begegnet in bildlichen Darstellungen am häufigsten die Fiedel, zweifellos das
wichtigste, am weitesten verbreitete Musikinstrument des Mittelalters, für den Spielmann besonders prak-
tikabel, weil er während des Spielens zur Not auch tanzen oder singen konnte".
Der Ursprung der masinqõ ist bis heute nicht bekannt. Mündlichen Überlieferungen zufolge steht jedoch
dieses Instrument in Verbindung mit dem Namen əžrā317 (Kebede 1982: 66).
In orientalischen Kulturen unserer Welt gibt es sowohl gezupfte als auch gestrichene Lauten. Die masinqõ
gehört in der Regel zu der letzteren Instrumentengruppe, aber sie wird auch manchmal gezupft. Und zwar
geschieht es nach Lust und Laune des ažmārī, dass er während des Singens für einen bestimmten Moment
die Saite rhythmisch mit seinem Zeigefinger zupft und gleichzeitig auf die Zarge des Korpus mit der Bo-
genspitze klopft, damit diese kombinierte Darbietung beim Begleiten des Gesangs musikalisch attraktiver
wirkt. Solche Stellen stehen meist mit dem Höhepunkt des jeweiligen Gesanges in Verbindung. Es findet
meist eine freie Text- und Melodieimprovisation statt. Diese Spielart erscheint jedoch nicht oft.
Abb 38
Die aus vier rechteckigen Holzbrettern zu einer Rhombusgestalt zusam-
mengeleimte Zarge wird mit einem aufgenagelten Ziegen- oder Schafs-
fell bespannt und rückseitig mit Holzplatten abgedeckt. Der Spieß der
masinqõ wird senkrecht durch den Kasten gesteckt, an dem herausra-
genden Teil wird zugleich die eine Saite aus gedrehtem Rosshaar
yäfäräs çərā {የፈፈስ ጭራ} befestigt.
Am mäqañā {መቃኛ}, der drehbare hölzerne Wirbel, wird die Saite
festgebunden. Der Steg bərkumā {ብርኩማ} steht in der Mitte des Re-
sonators auf der gespannten Felldecke. Die Saite läuft allerdingt nicht
wie z.B. beim kərār {ክራር} über den Steg, sondern durch ein für diesen
Zweck in den Steg gebohrtes Führungsloch.
Der ažmārī spielt die masinqõ sowohl sitzend als auch stehend, wobei
im Stehen eine Lederschnur als Tragehilfe dient.
Der Bogen, dägān {ደጋን}, der aus einem gekrümmten Holzstab und Rosshaar hergestellt wird, spielt eine
wesentliche Rolle beim Spielen. Gestrichen wird die Saite der masinqõ mit der rechten Hand, während die
Finger der linken Hand ihre Position je nach der gewünschenTonreihe auf der Saite einnehmen (vgl. Tef-
fera 1994: Abb.19).
Seine Stimmlage regelt der ažmārī durch Drehen der Stimmwirbel. Das Spiel auf der masinqõ erlernt der
ažmārī nur durch intensive praktische Übung.
317
Der Name əžrā ist in der äthiopischen Geschichte mit der masinqõ verbunden, ebenso wie die Kastenleier bägänā mit dem
Namen Dawit verknüpft ist. Man sagt əžrā bä masinqõ; Dawit bä bägänā was soviel bedeutet wie "əžrā mit masinqõ und Dawit mit bägänā". Es gibt auch epische Gesänge, die davon berichten.
4 . D E R T A N Z Z U A M Ā R I S C H E N H O C H Z E I T S L I E -D E R N U N D D I E T Ä N Z E I N Ä T H I O P I E N
4.1. TRADITIONELLE TANZWEISEN DER AMĀRĀ
Der əskəstā-Tanz {እስክስታ} spielt in den amārischen Hochzeitsliedern eine wesentliche Rolle und hängt
eng mit der Struktur der Wecheselgesänge zusammen, die zwischen awrāğ {አውራጅ} und den begleiten-
den täqäbajõč {ተቀባዮች} gestaltet werden. So steht der əskəstā-Tanz mit all seinen stilistischen und
regional typischen Variationen im Vordergrund.
Tänze, die, wie der əskəstā-Tanz, sich im allgemeinen auf die Bewegung der Schultern konzentrieren,
findet man auch in anderen afrikanischen Kulturen wie z.B. bei den Fõ in Dahomey und Togo (s. Kubik
1988: 47) und bei den ngangela-sprachigen Gemeinschaften in Ostangola (s. Kubik 1988: 48). Die Fõ
bewegen beim Tanzen insbesondere die Schultern und Schulterblätter. Kubik (1988: 47) beschreibt dies
wie folgt:
”Dies ist den Einheimischen völlig bewusst. Zusammen mit einem extremen kollaps in der Gesamt-
körperhaltung werden bei Fo-Tänzen...die Schultern und Schulterblätter in eine rasche Bewegung des Kon-
trahierens und Loslassens versetzt”.
In Ostangola werden dagegen bei den beschriebenen Gemeinschaften die Schultern nicht geschüttelt, son-
dern sie werden
“wie die Pedale eines Fahrrads gerollt” (Kubik 1988: 48).
Sowohl das intensive Schütteln als auch das Rollen der Schultern und/oder Schulterblätter werden auch
beim əskəstā-Tanz ausgeführt. Der zuletzt genannte Tanztyp wird vor allem dann getanzt, wenn der Tän-
zer von dem kräftigen Schütteln müde wird und zwar als Schlussakt zu dem begonnenen, intensiven Tanz-
abschnitt. Die Schultern werden nacheinander langsam gerollt. Hinzu kommen verschiedene Kopfbewe-
gungen und Gesten, z.B. Zwinkern und Lächeln, starke Augenbewegungen, die an den Tanzpartner ge-
richtet sind.
Die verschiedenen in Äthiopien praktizierenden Kulturen bringen auch eine große Vielfalt von traditionel-
len Tänzen bzw. Körperbewegungen, yäbahəl çəfärā {የባሕል ጭፈራ} oder yäbāhəl wəžəwažē {የባሕል ውዝዋዜ}, hervor. Diese verschiedenartigen Tanztypen unterscheiden sich regional und lokal.
Es gibt zum Beispiel in der Region Təgrāy nicht nur den Təlhit-Tanz, sondern auch den sogenannten
awərəs-Tanz, der in Tänbēn318 vorgeführt wird. Demnach ist der awərəs-Tanz in Tänbēn entscheidend
anders als der Təlhit-Tanz, der in der restlichen Region Təgrāy zu beobachten ist.
Dagegen lässt sich beispielsweise der əskəstā-Tanz der amārā durch seine spezifische Charakteristika und
seine variativen Bewegungstechniken nach Regionen aufteilen. In den vier wichtigen Regionen Šäwā,
Goğām, Wällõ und Gondär, in denen die amārā vorwiegend wohnen, konzentriert sich der əskəstā-Tanz
zwar generell auf die Bewegung der Schultern und Schulterblätter, aber es gibt feine
Unterschiede in den Bewegungsmustern, die für die erwähnten Regionen als typisch zu bezeichnen sind
und sich daher auch voneinander unterscheiden. Im Gegensatz zu den Regionen Šäwā, Wällõ und Gondär
ist der Tanztyp der Region Goğām z.B. mit einem bemerkenswerten Schütteln bzw. Vibrieren der Schul-
tern verbunden. Während dessen bleiben die Beine meist ohne Bewegung. Seinen Kopf dreht der Tänzer
seitlich und schräg und blickt nach oben. Der Kopf bleibt ebenfalls in dieser Position, bis dieser Tanzab-
schnitt beendet ist. Es scheint, als ob der Tänzer in Trance fällt. In Gondär, Wällõ und Šäwā dagegen
werden, neben dem Schütteln der Schultern, beide Füße und der Kopf nach bestimmten rhyth-
mischen Mustern bewegt. Mit den Füßen wird wechselweise gestampft und flach gesprungen.
Die Bewegungstechniken der Regionen Gondär, Wällõ und Šäwā unterscheiden sich wiederum in ihren
Feinheiten. Bei den Šäwā-amārā ist neben dem əskəstā-Tanz auch der mənğār319-Tanz bekannt, der vor
318
Kleinstadt in der Region Təgrāy.
allem zu den typischen mənğār-Gesängen getanzt wird. Bei diesem Tanztyp ist der Einsatz der Schultern
im Gegensatz zum Schütteltanz der Goğām-amārā sehr gering, aber dafür werden Beine und Hände nach
bestimmten Bewegungstechniken viel bewegt. Aber überall dort, wo die amārā leben, wird der traditionel-
le Tanz allgemein als əskəstā bezeichnet320. Außerdem werden beim əskəstā-Tanz individuelle Tanzstile
entwickelt, die jeweils von der Erfahrung und Begabung des einzelnen Tänzers abhängig sind.
Weiterhin sind die orõmõ-Völker Äthiopiens zu nennen, deren Tänze sich ebenfalls von Ort zu Ort diffe-
renzieren. Die orõmõ leben in mehreren Regionen Äthiopiens und zwar gibt es die orõmõ aus den Regio-
nen Šäwā, Harär, Wällägā, Käfā, Wällõ, Arsī, Sidamõ usw. So wie bei den amārā das Schütteln der
Schultern als allgemeines Tanzmerkmal bekannt ist, stehen bei den orõmõ generell der Stock- und der
Sprungtanz im Mittelpunkt. Aber es gibt viele Besonderheiten und Charakteristiken in diesen Stock- und
Sprungtänzen der orõmõ, die die verschiedenen Regionen repräsentieren. Für einen fremden Menschen,
der außerhalb der Kultur steht, erscheint der allgemein überall unter den orõmõ-Völkern anzutreffende
Stock- und Sprungtanz von seinen Grundzügen her gleich, aber für die orõmõ selbst sind die Tanztypen
leicht zuzuordnen.
In der Variation des əskəstā-Tanzes aus Wällõ wird außer der Körperbewegung auch ein Stock als Requi-
site, vorwiegend von männlichen Tänzern, verwendet. Dabei wird der Stock wie ein Tragholz auf die
Schultern gelegt und an den Enden mit beiden Händen festgehalten. Währenddessen schüttelt der Tänzer
die Schultern, wenn auch in beschränktem Maße. Allerdings erscheint diese Tanzweise mit Stock nicht
durchgehend im Gesang, sondern für einen kurzen Moment entweder am Anfang oder im Verlauf des
Gesangs; d.h. der Tänzer legt dann sein Stock beiseite und fängt an, den gesamten Körper zu bewegen.
Bestimmte Körperbewegungen innerhalb des əskəstā-Tanzes, wie beispielsweise der Tanzstil aus den
Gebieten Mənğār und Tägulät321, werden durch speziell hierzu gehörende Gesänge stimuliert. Jedoch
bleibt der fundamentale Tanzstil allgemein erhalten.
Im Rahmen des əskəstā-Tanzes werden durch individuelle Tanzqualitäten unterschiedliche Gefühle her-
vorgerufen, die vom Charakter und Verlauf eines Gesanges abhängen. Dabei ist an erster Stelle die
Rhythmik wichtig. Im Hinblick auf die traditionelle Musik und den Tanz in Ghana bestätigt Nketia (1965:
92) diese Aussage:
"Generally....it is rhythm that is articulated in the basic movements employed in the dance - the rhythm of a
song where this is clearly defined for the purpose of the dance, or rhythm played by melodic and non-
melodic instruments".
Nicht zuletzt trägt auch der primäre Inhalt von Gesangstexten dazu bei, den Tänzer intensiv oder gelassen
tanzen zu lassen (vgl. Nketia 1965: 99; s. auch Abschnitt 4.3., S. 178-180).
319
Ortsname in der Region Šäwā. 320
Der əskəstā-Tanz wird auch im Allgemeinen als çəfärā bzw. bahəlawī çəfärā oder bahəlawī wəžəwažē bezeichnet, der sich
auf die gesamte Handlung diesbezüglich bezieht. Der Begriff çəfärā schließt vor allem die Beteiligung an einer Musikauffüh-
rung an sich (ungeachtet in welcher Form) mit ein. Das Wort çəfärā stammt aus dem Verb mäcäfär und bedeutet = sich an ei-
ner Musikveranstaltung beteiligen, entweder mit Gesang, Tanz, Klatschen oder Trillern. Näher betrachtet ist allerdings dieses
Wot direkt mit dem traditionellen əskəstā-Tanz verbunden. Die Bezeichnung wəžəwažē stammt dagegen aus dem Verb mäwäžawäž was soviel bedeutet wie sich bewegen.
321
Ortsnamen in der Region Šäwā. Die Tänze dieser Gebiete sind jeweils Varianten des əskəstā-Tanzes, wobei hier neben der typischen Schulterbewegung zusätzliche Sprünge in Verbindung mit speziellen Handbewegungen gemacht werden.
4.2. EINIGE GRUNDLAGEN DES əskəstā-TANZES DER AMARA
Der əskəstā-Tanz lässt sich gewöhnlich in zwei grundlegende Tanzabschnitte gliedern, die durch Entspan-
nung bzw. tänzerische Einstimmung und Spannung bzw. Intensivierung charakterisiert sind. Das Phäno-
men der Spannung und Entspannung im Tanz ist auch in anderen schwarz-afrikanischen Kulturen präsent.
Zum Beispiel bezeichnet Blacking (1955: 15f) den Tanz der Nguni (Südafrika) als einen "Tension-
Relaxation; Tension-Relaxation Pattern".
Im entspannenden Abschnitt klatschen die Tänzer mit der Gruppe und setzen ihren gesamten Körper lang-
sam in Schwingung. Sie bewegen ihre Arme locker in leicht gebeugter Haltung vor dem Körper hin und
her. Der Blick folgt dieser Bewegung. Die Füße schreiten im Rhythmus auf der Stelle.
In der Regel gehört zum əskəstā-Tanz das nätälā322 {ነጠላ} ein großes Tuch aus Baumwolle mit einer
Länge von ca. 2,5 m und einer Breite von 1,5 m. Es wird einmal um die Taille des Tänzers herum festge-
bunden, so dass jeweils etwa 50 cm Stoff nach unten fällt. Allerdings bleibt das nätälā im ersten Tanzab-
schnitt zumeist unbenutzt.
Im weiteren Verlauf des Gesangs folgt der zweite intensive Tanzabschnitt. Hier wird das nätälā benutzt.
Der Tänzer hält dabei die zwei nach unten fallenden Enden des nätälā mit beiden Händen und streckt sie
nach vorn, zu den Seiten oder er setzt sie auf seine Taille. Danach schüttelt er rhythmisch seine Schultern,
wozu er den Grundschlag durch schwaches Stampfen mit einem Fuß oder durch Heben der Fersen andeu-
tet. In bestimmten Intervallen bewegt er auch den Kopf vor- und rück- bzw. seitwärts323.
In Gesängen, die mehr als zwei Abschnitte besitzen, gibt es bestimmte Stellen, wo der əskəstā-Tanz sehr
stark intensiviert wird. Je nach der Anzahl der Gesangsabschnitte im Lied und je nach dem Inhalt des hier-
zu gehörenden Textes werden die zwei Tanzabschnitte dargeboten. In solchen Fällen sind die Tanzab-
schnitte entweder dem textlichen oder dem melodischen Verlauf des jeweiligen Gesanges untergeordnet.
Was den textlichen Verlauf anbelangt, wird der intensive Tanz zumeist erst dann ausgelöst, wenn z.B. ein
Name gepriesen oder gelobt wird. Außerdem gibt es im Melodieverlauf bestimmte Abschnitte, zu denen
unbedingt getanzt werden muss, auch wenn der Text nicht unbedingt faszinierend bzw. animierend ist;
d.h. hier wird der Tanz durch die Melodik gesteuert. Solche besonderen Melodieabschnitte, die einen Tanz
aufrufen, sind allen Beteiligten erfahrungsgemäß bekannt.
Bei einem Wechselgesang, an dem viele Menschen teilnehmen, wird in der Regel ein Kreis gebildet. Die
Bildung eines Kreises geschieht jedoch nicht vor dem Gesang, sondern im Laufe des Gesanges. Der Kreis
entsteht entweder spontan, oder einer der Teilnehmer versucht eine kleine Tanzfläche in der Mitte freizu-
machen und dabei die Gruppe zu bitten, sich an der Bildung dieses Kreises zu beteiligen. So rückt jeder
zur Seite und lässt die Mitte für mögliche Tänzer und für den awrāğ frei.
Das Auf- und Abtreten in einem əskəstā-Tanz sind mit bestimmten Bewegungsmustern verbunden. Der
Auftritt von Tänzern wird meistens dadurch markiert, dass das Tanzpaar bzw. die Tanzpaare sich in die
Mitte des Kreises begeben und sich gegenüberstellen. Dabei machen sie verschiedene Bewegungen, die
entweder den ersten oder zweiten Tanzabschnitt anzeigen. Dies hängt davon ab, ob der Tanzende gleich
im ersten Tanzabschnitt mit dem intensiven Tanz beschäftigt ist, oder ob er, wie üblich, erst im 2. Tanzab-
schnitt damit beginnt. Die Art der Bewegung muss nicht immer mit dem langsamen Tanztyp beginnen. Sie
unterscheidet sich allerdings von Tänzer zu Tänzer und ist von der aktuellen Stimmung abhängig.
Beim Abtreten bewegt sich der Tänzer zumeist langsam klatschend rückwärts, bis er den Rand des Kreises
erreicht hat.
Der intensive əskəstā-Tanz bei den amārā aus Šäwā und Gondär hebt motional die schweren Zählzeiten
hervor. Dazu gehören natürlich das Klatschen und das abwechselnde Fußstampfen (siehe Blacking 1955:
16). Dagegen ist der Schultertanz der amārā aus Goğām mit einem ununterbrochenen Schütteln der Schul-
322
Das nätälā gehört zum traditionellen Tracht der amārā. Es ist ca. 2,5 m lang und 1,5 m breit. Das nätälā wird aus Baumwolle
hergestellt. Produziert wird es von traditionellen Webern mit manuellem Webstuhl. Beide Enden des nätälā werden mit ver-
schiedenen Mustern verziert. 323
Eine ähnliche Bewegung des Kopfes beim Tanz gibt es auch in der Chopi-Kultur (siehe Blacking 1955: 16).
tern verbunden, so dass der Tänzer die schwere Zählzeit oft nur durch das Fußstampfen markiert, das ihm
hilft, die Schulterbewegung innerlich zu kontrollieren und metrisch konstant zu tanzen.
Während eines əskəstā-Tanzens kann der Tänzer gemeinsam mit den täqäbayõč singen oder trillern, wenn
er dafür genügend Kraft besitzt.
Abb. 39
Bei den amārā besteht aber auch die
Möglichkeit, dass für den Tanz nicht
nur der Kreis, sondern bisweilen
auch ein Tanzareal freigemacht
wird, wo die Gruppe sich links und
rechts aufstellen kann324. Im Fol-
genden sind die zwei Varianten der
Tanzaufstellung zu betrachten (Abb.
39).
Während des Tanzens werden die Tänzer von dem Rest der Gruppe mit Klatschen, Trillern, emphatischen
Schreien, Zischen und verschiedenen Gesten angeheizt (vgl. auch Zinke 1992: 183ff; Nketia 1965: 100f.).
Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Kulturen (z.B. in Ghana), wo die meisten traditionellen Tänze der
verschiedenen Kulturen sowohl durch Instrumentalspiel, wie beispielsweise ein Trommel-Solo oder in
Gruppen als Xylophonspiel, als auch durch Gesänge, wie z.B. Solo-, Chor- oder Wechselgesang, gesteuert
werden (vgl. Zinke 1992: 179 – 296 und Nketia 1965: 92), erfolgt der əskəstā-Tanz der amārā zu Gesän-
gen; d.h. bei den amārā gibt es keine Instrumentalmusikstücke oder keine Tanzlieder an sich, die lediglich
für den Tanz bestimmt sind, sondern nur Lieder, zu denen man tanzen kann, wenn der Wunsch besteht und
wenn die Gesangsatmosphäre einen Menschen zu dieser Handlung animiert. In einer geringen Anzahl von
Liedern, die nur die Tonreihe bātī nutzen, wird ein Abschnitt, ayəfärām gammē ayəfärām, während des
Tanzes von der gesamten Gruppe vorgetragen. Dieser Abschnitt ist unmittelbar mit dem Tanz verknüpft;
d.h. der Tänzer muss hier tanzen. Es bestehen allerdings keine festen Regeln für den Einsatz dieses Ab-
schnitts in dem betreffenden Gesang. Er wird spontan von einem der am Gesang beteiligten Personen be-
gonnen. Unmittelbar danach fallen die anderen ein. Der Text dieses Abschnitts beträgt fünf Verszeilen, die
beliebig oft wiederholt werden können, solange, bis die Tänzer kräftig und intensiv tanzen. Andererseits
kann man aber auch mit diesem Abschnitt den gesamten Gesang beenden. In der Regel taucht er deshalb
auch am Ende des jeweiligen Gesanges auf und führt zum Schluss.
Um die einzelnen Tanzpositionen und Bewegungsabläufe zu verdeutlichen, sollen zunächst drei Sichtebe-
nen (I, II und III) vorgestellt werden.
Die Sichtebene I zeigt die Frontansicht. Zuerst hebt der Tänzer die linke Schulter und folgt dieser Bewe-
gung mit den Augen. Danach geht er in die Ausgangsstellung zurück und setzt fort, die rechte Schulter mit
symmetrischer Augenbewegung zu heben, worauf er die Schulter wieder senkt. Alle Positionen werden
rhythmisch akzentuiert ausgeführt, d.h. sie erfolgen eher ruckartig und weniger fließend.
Die Sichtebene II zeigt die Seitenansicht, um die parallele Kopfbewegung zu demonstrieren. Auch diese
Bewegung erfolgt ruckartig. Die stärkste Muskelspannung fällt mit dem stärksten Anziehen der Schulter
zusammen.
Die Sichtebene III beschreibt die Draufsicht, speziell das Vor- und Rückwärtsschwingen der Schulter um
die Körperachse.
324
Siehe auch analoge Tanzaufstellungen bei den Ovambo in Namibia (Zinke 1992: 183).
Die Darstellung umfasst nur die wesentlichen Momente, es gibt eine Vielzahl von Varianten und individu-
ellen Techniken. Grundsätzlich herrscht jedoch eine bestimmte metro-rhythmische Gliederung der Bewe-
gungsabläufe vor, die vor allem vom Tempo des Gesangs abhängt.
Abb. 40
z.B. :
A B C B A B C B A
2/4-Takt ə ə ə ə ə ə ə ə
Dieses Grundschema wird sehr häufig durch zusätzliche Positionen erweitert, etwa, indem der Tänzer
zwei Anspannungspositionen (C oder C) aus halber Höhe ( B oder B ) hintereinander tanzt.
Abb. 41
A B C B C B A B C B C B A
2/4-Takt ə ə ə ə
A B C B C B A B C B C B A
6/8-Takt ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Umgekehrt kann es auch zu Verkürzungen kommen, etwa in dieser Form:
Abb. 42
A B C B B C B B C B B
3/8-Takt ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
A B C B C B C B
1/4-Takt ə ə ə ə ə ə ə
In den Hochzeitsgesängen kommen vor allem Gesänge mit 3/8-Gliederung vor, so dass die deutliche Drei-
er-Teilung der Bewegung dominiert.
Aus diesen Bewegungsabläufen gestalten sich auch die für die Hochzeitsgesänge typischen Paartänze.
Dabei werden bestimmte Postionen aus verschiedenen Ebenen miteinander verknüpft. Die gelungene
Tanzphase eines Paares wird von der singenden Gruppe mit intensiverem Klatschen und Trillern hono-
riert. Gelungen heißt dabei, dass die geschickte Tanzweise beider Partner miteinander harmoniert und
damit die gesamte Atmosphäre des Festes belebt wird. Ohne die spontane Aktivität eines jeden Einzelnen
sind langanhaltende Reihen verschiedener Gesänge kaum vorstellbar, der Tanz ist daher für die Aufrecht-
erhaltung der emotionalen Tradition, in der Hochzeiten gehalten werden, unbedingt notwendig.
Beim Tanzen, ist der visuelle Kontakt in Verbindung mit Artikulationen, Gesten und Interjektionen sehr
wichtig. Es herrscht ein Tanzwettbewerb zwischen dem tanzenden Paar. So versucht der eine den
anderen Tanzpartner durch seine besonderen Bewegungstechniken, die er aus Erfahrung beherrscht, her-
auszufordern. Diese Bewegungstypen (s. Abb 44), die durch die Musik hervorgerufen werden, sind z.B.
- die Streckbewegungen des Kopfes in Vor-, Rück- und Seitwärtsrichtung; dabei werden beide
Hände auf die Taille gesetzt. Der Tanzende kann diese Tanzart sowohl stehend als auch sitzend
ausführen.
- das Schütteln der Schultern bzw. der Schulterblätter im Stehen oder Sitzen.
- der flache Sprung mit gebücktem Oberkörper. Dabei werden beide Hände ständig von hinten nach
vorne bewegt.
- das schwingende Hüpfen durch Heben der Fersen, wobei beide Hände von links nach rechts vor
dem Körper rhythmisch bewegt werden.
Durch Verknüpfung kann z.B. ein Paartanz zwischen Männern aus dieser Sequenz entstehen: Die Schul-
tern werden nicht einzeln, sondern in schneller Folge gemeinsam gehoben und nach hinten gespannt. Das
Fußstampfen wird dabei mitunter in ein "Sprungstampfen" verwandelt oder die Fersen werden stärker
aufgesetzt. Diese Tanzweise wirkt eher aggressiv und kämpferisch. In den entspannenden Phasen werden
dann die gewöhnlichen Techniken fortgesetzt oder die Schultern nur einfach einander entgegengesetzt
geschwungen.
Abb. 43
Einzeldarstellung: intensive Phase: Entspannungsphase:
Zu den häufigsten Paartanzpositionen gehören die Stellung nebeneinander und die Frontalstellung (s.
4.1.1.), z.B. folgendermaßen:
Abb.44
Der əskəstā-Tanz wird gewöhnlich paarweise ausgeführt. Aus der singenden Gruppe kann derjenige, der
sich zum Tanzen bereit erklärt, in die Mitte der singenden Gruppe rücken. Dabei lädt er einen freiwilligen
Partner aus der Gruppe zum Tanz ein. In Bezug auf den Tanz eines Frontpaares erklärt Dauer (1983: 222)
folgendes:
”Die Bezeichnung Frontpaar soll bedeuten, dass nach Zahl und Zuordnung zwar ein Paar tanzt, aber ohne
die, für den europäischen Paartanz typische Körperberührung, sondern in freier Gegenüberstellung, wie im
Fronttanz mit langen oder kurzen Frontreihen” (Dauer 1983: 222).
Das Frontpaar besteht in den amārā-Gesängen entweder aus zwei Frauen, Männern oder jeweils aus bei-
den Geschlechtern. Während eines Wechselgesanges werden meistens spontan Kreise für den Tanz gebil-
det. Diese Form des Singens und Tanzens wird auch in der Region Təgrāy praktiziert. Wenn das tanzende
Paar in die Mitte rückt, wird es von dem Rest der Gruppe mit Klatschen und Ololygen begleitet. Das Paar
begegnet sich frontal. Nach Beendigung des Tanzes geht es auseinander, stellt sich am Rande des Kreises
auf und macht somit den Platz für das/die nächste/n Paar/Paare, die wiederum in die Mitte rücken, frei. Je
lebhafter sich der Tanz entwickelt, umso weiter wird der Kreis.
Diese Tanzweise kann außerdem durch folgende Technik modifiziert werden, die recht viel Elastizität und
Körperbeherrschung verlangt (hier die Sichtebenen I und II):
Abb.45
Kopf- und Schulterbewegung kontrastieren miteinander. Zu-
gleich wird der Kopf im Augenblick der stärksten Schulterhe-
bung zu dieser hinbewegt, so dass Kinn und Schulterspitze
übereinander stehen. Die Blickrichtung ist jedoch genau in
diesem Moment umgekehrt.
Außer der gewöhnlich frontalen Stellung der Tanzpartner ist es
auch möglich, Rücken an Rücken oder hintereinander stehend
zu tanzen. Dabei gehen die Tanzpartner entweder gleichzeitig
oder entgegengesetzt in die Knie und stehen tanzend wieder auf
(Sichtebene IV = Tanzhöhe).
Diese Tanzweise ist besonders typisch für die Təgrāy. Das Paar wechselt während des Gesangs zur inten-
siven Tanzphase in diese Positionen.
Abb.46
Die Fotografien im Anhang IV zeigen Ausschnitte aus den verschiedenen Tanzpositionen.
4.3. TANZ UND KOMMUNIKATION: DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN MUSIK UND BEWE-
GUNG
Die amārischen Gesänge bzw. Hochzeitsgesänge werden nicht nur durch ihre kommunikativen und unter-
haltsamen musikalischen und textlichen Inhalte geprägt, sondern auch durch die körperliche Bewegung.
Sie stimulieren das gesamte räumliche Geschehen, das Zusammenrufen aller Beteiligten und zugleich die
Ankündigung der einzelnen zeremonialen Aufgaben. Der augenfälligste körperliche Ausdruck ist zwar der
əskəstā-Tanz, doch sind diesem auch eine Reihe anderer kommunikativer Bewegungen untergeordnet, wie
z.B. die rhythmischen Bewegungen der Beobachter, selbst auch das impulsive Hinzukommen zu einer
Gruppe von Singenden und Tanzenden. Musik und Tanz sind letztlich untrennbar miteinander verbunden.
Dieses Phänomen ist nicht nur für die amārā-Kultur, sondern für viele afrikanische Kulturen typisch (s.
Merriam 1982c: 141; Kubik 1988: 41ff). So schreibt z. B. Kubik folgendes:
”Musik und Tanz sind in Afrika südlich der Sahara durch identische kinetische Verhaltensweisen und Kon-
zeptionen miteinander verknüpft....Durch ein charakteristisches Bewegungsverhalten und spezifische motio-
nale Konzepte unterscheidet sich die afrikanische Kulturwelt von den übrigen Zonen der Erde...... Afrikani-
sche Bewegungsauffassungen und die ihnen zugrunde liegenden Erlebnisbereiche und -konzeptionen, philo-
sophischen Grundhaltungen usw. durchdringen den gesamten kinetisch-motionalen Ausdrucksbereich des
Menschen”.
In einem Gruppengesang, an dem Menschen fröhlich und ausgelassen teilnehmen, wird auch die Kenntnis
des əskəstā-Tanzes bei den amārā als einen wesentlichen Bestandteil des Gesanges betrachtet. Es können
nicht alle Menschen gleichermaßen den əskəstā-Tanz darstellen, nicht nur weil er langjähriger Erfahrung
als Tänzer bedarf, sondern weil er auch erfordert bestimmte charakterliche Voraussetzungen und sportli-
che Begabungen. Für die Körperbewegung ist es wichtig, den Melodieverlauf in Zusammenhang mit dem
Textinhalt zu verstehen, denn es wird nicht ununterbrochen getanzt, sondern nur an bestimmten Stellen im
Gesang. Kubik (1983: 315) dazu:
"In den meisten afrikanischen Kulturen ist Musik stark motional geprägt. Erfolgreiche Absorption von Bewe-
gungsmustern ist für zahlreiche Menschen Afrikas ein wichtiges Kriterium für Verstehen von Musik".
In den Gesängen der amārā setzt die Musik den Tanz voraus. Der Tänzer muss jede einzelne Tanzbewe-
gung im Zusammenhang mit der Musik kennen; d.h. er muss wissen, an welcher Stelle des Gesanges wel-
cher Tanztyp ausgeführt wird. Der Auslöser eines əskəstā-Tanzes ist auch der zu der jeweiligen Musik
gehörende Text, dessen Inhalt den Tänzer animiert, seine Körperbewegung intensiv darzustellen. Als Bei-
spiel ist der folgende Gesangstext zu sehen, das als einstimmiger Gruppengesang dargeboten wird und als
Schlussteil in vielen traditionellen Gesängen vorkommt:
Text : vgl. 0345.001/6a
Gz Originalschrift Umschrift Übersetzung
1 አይፈራም ጋሜ አይፈራም
ayəfärām gāmmē ayəfärām Er hat keine Angst gāmmē325, er hat keine Angst.
2 ወገቡ ልክ አይ\ራም wägäbū lək ayəsärām Seine Taille funktioniert nicht.
3 ወሰላ ወሰልሰላ wäsällā wäsälsällā (Redundanz)
4 አንገቱ በምን ቀላ angät bämən sällā Wodurch ist sein Hals so beweglich?
5 ነጭ ጤፍ እየበላ näcə täf əyäbälā Er isst wohl weißen tēff326.
6 አሸንፊው አሽንፋት ašänäfīw ašänäfāt Gewinn ihn327, gewinn sie328 !
325
Gammē ist eine bestimme Haarschnitt. 326
siehe Glossar 327
weiblich 328
männlich
Dieser Gesangsteil kann verschiedenen Gesängen hinzugefügt werden.
Neben dem Verständnis traditioneller Textgestaltung ist jedoch das Aufnehmen der metro-rhythmischen
Struktur eines Gesanges sehr wesentlich für die Ausführung des əskəstā-Tanzes. Kubik (1983: 316) be-
merkt:
"Falsches" Verstehen der Bewegungen provoziert.....Temposchwankungen und einen meist totalen Ver-
lust der ursprünglichen Akzentstruktur........"
Dies gilt auch für die amārische Musik. Neben der primären Körperbewegung sind auch die der Musik
zugeordneten Bewegungen beim Klatschen und Trommeln sehr wichtig, weil sie für die metrische Stabili-
tät des jeweiligen Gesanges sorgen. Rhythmische Fehler, die durch falsches Klatschen bzw. Trommeln
erzeugt werden, führen in erheblichem Maße, wie Kubik es beschreibt, zu Temposchwankungen. Dies
kann während des Gruppengesanges öfter passieren. Derjenige, der den falschen rhythmischen Verlauf
entdeckt, versucht dann durch besonders bewegungsaktives Klatschen die Gruppe in die richtige, ur-
sprüngliche Struktur zu leiten.
Für den Tanz bedeutet das die richtige Abschätzung physiologischer Möglichkeiten in einem konkreten
Tempo. Abweichungen werden in der Regel folgendermaßen korrigiert:
Abb. 47
der vom Tänzer abgeschätzte metro-rhythmische Verlauf
ə ə ə ə ə ə ə ə ə
der vom Gesang und der Trommelbegleitung realisierte metro-rhythmische Verlauf in einem höheren Tempo:
ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Bewegungskorrektur:
1.
2.
1. Der Höhepunkt der Schulterspannung fällt auf die schwere Zeit und ein Element entfällt.
2. Die synkopische Darstellung lässt die schwere Zählzeit, auch erkennbar an Fußstampfen oder
Fersenaufsetzen und höchste Schulterspannung. Auch hier wird ein Element ausgespart.
In beiden Fällen ist die rhythmische Wahrnehmung əəə usw. Diese steht bzw.
kontrapunktiert in engem Zusammenhang mit der Motorik des Trommelspiels.
4.4. TÄNZE UND BEWEGUNGSMUSTER IN AUSGEWÄHLTEN KULTUREN ÄTHIOPIENS
Die Tanzaufstellungen der verschiedenen Ethnien Äthiopiens bieten eine große Buntheit. Die traditionel-
len Tänze der verschiedenen Ethnien sind mit variativen Tanzabschnitten und Bewegungs-mustern ver-
knüpft.
Diese Tanzabschnitte besitzen verschiedene Bewegungsmuster, die fest an den melodisch-rhythmischen
und den textinhaltlichen Verlauf geknüpft sind und auch durch sie gesteuert werden. Diese Tatsache gilt
auch für viele Stammeskulturen bzw. Ethnien des Zentralen Hochlands sowie ganz Äthiopiens.
Der əskəstā -Tanz der amārā hat in vieler Hinsicht Gemeinsamkeiten mit den Tanzbewegungen anderer
Ethnien Äthiopiens. Als Beispiel sind sechs ethnische Gruppen herausgenommen worden:
4.4.1. Die Qõttū Oromo
Die qõttū oromo {ቆቱ ኦሮሞ}, die auch als östliche oromo klassifiziert werden bewohnen die Region
Harärghe. Beim Tanz aktivieren sie ihren Oberkörper und Kopf, die sie rhythmisch nach links und rechts
schwingen. Während dessen beugen sie sich vor und setzen ihre Hände auf die Knien.
4.4.2. Die Harärē
Die harärē {ሐረሬ}, ebenfalls aus der Region Harär, die auch als adärē {አደሬ} bekannt sind, zeichnen
sich durch ihre zumeist frontalen Paartänze aus, wobei sich das Tanzpaar, Frauen oder Männer oder beide
Geschlechter, mit flachen Sprüngen bzw. hüpfend bewegt. Dabei werden beide Hände beim Tanzen mit
dem großen Tuch mäqərämiā {መቅረሚያ} teilweise verdeckt (bei den Frauen).
Eine andere Tanzvariante besteht darin, dass man dicht hintereinander steht und eine Vor- und Rück-
wärtsbewegung vollführt. Die Tanzgruppe kann entweder aus einem Paar bestehen, oder es können auch
mehrere Personen daran teilnehmen und einen Kreis bilden, der auch für den Tanz der amārā typisch ist.
4.4.3. Die Wälayəttā und Dõržē
Diese Ethnien bewohnen die Region Sidamõ {ሲዳሞ}, den südlichen Teil Äthiopiens. Sie sind insbeson-
dere für ihre kreisförmigen Becken- und Hüftbewegungen im Zusammenhang mit bestimmten Hand- und
Beinaktivitäten bekannt. Dieses Bewegungsmuster betrifft vorwiegend Frauen. Außerdem gibt es Sprung-
und Stocktänze, die hauptsächlich von Männern getanzt werden. Der Beckentanz ist mit den Tanzkulturen
vieler afrikanischer Länder vergleichbar (z.B. die ngangela-sprachigen Ethnien in Ostangola; s. Kubik
1988: 48). Kubik spricht dabei von einem raschen Verdrehen der Pelvis in ihrem Mittelpunkt.
Auch ihre Tänze besitzen zwei Tanzabschnitte, die mit langsamen und schnellen Bewegungen je nach der
Struktur des Liedes verbunden sind. Der Stock- und Sprungtanz besitzt eine Ähnlichkeit mit dem der
orõmõ. Mit den amārischen Tanztypen haben sie allerdings nichts Gemeinsames.
4.4.4. Die Gurāgē
Die gurāgē {ጉራጌ} wohnen zum größten Teil in der Region Šäwā und sind in viele ethnische Cluster
unterteilt. Und zwar sind es die çhahā- {ቸሀ}, gumär- {ጉመረ} und gurā-gurāgē329 {ጉራ} die ənnämõr-
{እነሞር}, səltī- {ሰልጢ} und wälänī-gurāgē330 {ወለኒ}, soddõ- {ሶዶ} und muxär- gurāgē331
{ሙክሰር} u.a., die in der Region Šäwā anzutreffen sind. Außerden wohnt ein kleiner Teil der gurāgē in
den Regionen Arssī, die sogenannten žwāy-gurāgē332 {ዝዋይ} und in der Region Sidamõ333.
Der traditionelle gurāgē-Tanz wird allgemein als käskäšē bolālē {ከስከሴ ቦላሌ} bezeichnet (Bahiru
1996). Beim Tanzen wird bei den gurāgē fast der gesamte Körper in Schwung versetzt. Von seinen Be-
wegungstypen her hat der gurāgē-Tanz jeweils mit den Tanzarten der amārā und der qõttū etwas gemein-
sam. Er verkörpert nämlich den Schulter-, Sprung-, den Hüfttanz und zusätzlich auch verschiedene Bewe-
gungsmuster und Handlungen der Gestik und Mimik.
Wie im əskəstā-Tanz der amārā besteht der Tanz der gurāgē ebenfalls aus zwei Tanzabschnitten. Und
zwar wird zum einen der langsame Tanzabschnitt mit schwachen Bewegungen ausgeführt. Dieser langsa-
me Abschnitt markiert bei den gurāgē stets den Anfang des jeweiligen Gesanges. Er besteht in der Regel
aus einem Refrain, der vom awrāğ und den täqäbayõč im Wechsel gesungen wird.
Nach Beendigung des ersten Gesangs- und Tanzabschnittes geht man zum zweiten Abschnitt über, der
gewöhnlich in einem doppelt so schnellen Tempo stattfindet. Auch das einfache Klatschen wird durch ein
Doppelklatschen ersetzt.
Beide Gesangsabschnitte besitzen in den Gesängen der gurāgē meistens feste Metren. Bezüglich der Be-
wegungsmuster hebt der Tänzer zunächst im langsamen Tanz, 1. Abschnitt, seine Füße abwechselnd
schräg seitwärts (vgl. auch Zinke 1992: 303). Parallel zum Tanz klatscht er auch mit, so dass das Klat-
schen und das Schwingen der Beine zusammenfallen. Das Klatschen gehört somit unmittelbar zum Tanz.
Im zweiten Gesangsabschnitt streckt der Tänzer seine Beine abwechselnd vor- und rückwärts. Dabei
macht er auch kleinere und größere Sprünge. Dazu werden Schultern334 und Hüfte335 (vor allem bei den
Frauen) leicht in Schwung gesetzt. Der zweite Gesangsabschnitt der gurāgē ist mit bestimmten Tanzdar-
stellungen verbunden, die Handlungen versinnbildlichen. Zum Beispiel ist bei einem Tanz zu einem Lie-
beslied zu sehen, wie sich die Tänzerin symbolisch schminkt. Dabei stellt sie im übertragenen Sinn die
Hand als einen Spiegel vor ihr Gesicht und schminkt sich mit der anderen. Diese Handlung unterbricht sie
hin und wieder und tanzt weiter.
Solche theatralischen oder symbolischen Tanzhandlungen oder Szenendarstellungen im Laufe eines Tan-
zes sind allerdings nicht nur bei den gurāgē bekannt, sondern auch in vielen anderen Ethnien Äthiopiens
wie z.B. bei den dõržē {ዶርዜ}.
Nach Beendigung des 2. Gesangsabschnittes erscheint wieder der erste Gesangsabschnitt, wobei der Tän-
zer sofort in ein halb so schnelles Tempo fällt. Dieser Zyklus setzt sich bis zum Ende des Gesanges fort.
329
Diese Gruppe zählt zu dem zentral-westlichen gurāgē-Land. 330
Diese Gruppe gehört zu dem östlichen gurāgē-Land. 331
Diese Gruppe gehört zu dem nördlichen gurāgē-Land. 332
Diese Gruppe zählt zu Zentraläthiopien. 333
Die gogõt-gurāgē zählen zu Südäthiopien. 334
Die Schultern werden allerdings nicht geschüttelt, sondern in schnellem Tempo kontrahiert und losgelassen (siehe auch Kubik
bezüglich der Fö-Tänze 1988:47).
335 Die Hüftbewegung ist mit den Tänzen der wollamõ, dõržē und wälayətta (Süd-Äthiopien) zu vergleichen.
4.4.5. Die Təgrāy
Eine ähnliche Gesangsform mit langsamen und schnellen Tanzabschnitten im təlhīt-Tanz {ተልሒት} ist
ebenfalls bei den təgrāy anzutreffen.
Für den təlhīt-Tanz bildet man hier gleich am Anfang des Gesanges einen großen Kreis wie es auch beim
əskəstā-Tanz der amārā üblich ist. Der Unterschied der Bildung von Tanzkreisen zwischen beiden Ethnien
besteht allerdings darin, dass die təgrāy mit bestimmten Schrittfolgen und mit stets wechselnden Fußbe-
wegungen hintereinander maschieren, während die amārā um den Kreis herum stehen, klatschen, trillern
und mitsingen. Nur die Mitte des Kreises wird für die Tanzbewegung frei gemacht und dort kann jeder
Freiwillige tanzen. Bei den təgrāy kann man zusätzlich zu den Kreisbewegungen entweder mitklatschen
oder beide Hände auf seine Taille bzw. Hüfte setzen.
Die meisten Gesänge der təgrāy bestehen aus Refrain- und Strophenteilen, die sich in zyklischer Form
wiederholen. Der awrāğ gibt nach einer Weile den Tänzern mit dem Wort därəb {ደርብ}, ein Signal, was
soviel bedeutet wie verdopple. Das Wort därəb ist also ein Zeichen dafür, dass für den Tanz und für
den Wechselgesang der Höhepunkt erreicht worden ist.
Von diesem Moment an geht jeder Teilnehmer zu dem in dem təlhīt-Tanz bekannten Doppelklatsch über,
der im 1. Gesangsabschnitt bislang ein Einzelklatsch war. Dazu wird getanzt; d.h. die Schultern werden
geschüttelt wie beim əskəstā-Tanz und es wird getrillert. Dafür stehen sich die Tanzenden paarweise ge-
genüber ohne den Kreis zu verändern oder aufzulösen. Zusätzlich werden verschiedene Tanzgesten wie
z.B. besondere Kopfbewegungen seit-, vor- und rückwärts hinzufügt. Im Lauf des Tanzens trifft sich jedes
Paar mit den Schultern entweder Rücken an Rücken oder frontal (siehe 4.1.2.), indem es dabei die Schul-
tern im synchronen Rhythmus bewegt. Während des təlhīt-Tanzes gehen die Tänzer auch langsam in die
Hocke und stehen nach einer Weile intensiven Tanzens wieder auf. Dabei wird das Bewegen der Schultern
oder der Schulterblätter nicht unterbrochen.
4.4.6. Die Orõmõ
Der Stocktanz ist bei den überwiegenden orõmõ-Gruppen (d.h. aus Süd-, West- und Zentraläthiopien)
bekannt. Dieser Tanztyp ist insbesondere in der Region Šäwā anzutreffen. Je mehr man nach Süden geht;
d.h. z.B. bei den käffā- {ከፋ} oder bale-orõmõ {ባሌ}, umso weniger wird mit dem Strock getanzt.
Es gibt mehrere Unterteilungen im traditionellen Tanz der orõmõ, die als rägädā {ረገዳ}, follē {ፎሌ} und
räpissā {ረ’!ሳ} genannt werden.
Der rägädā-Tanz beschränkt sich auf den Oberkörper. Vor allem werden die Schultern und der Kopf beim
Tanz bewegt. Dabei hebt der Tänzer abwechselnd seine Füße. Dieser Tanztyp ist in den südlichen orõmõ-
Regionen anzutreffen.
Der follē-Tanz ist ein typischer Männertanz. Bei diesem Tanz wird der Stock benutzt. Dazu gehört auch
der Sprung, bei welchem die Tänzer versuchen, in bestimmten Intervallen so hoch wie möglich zu sprin-
gen. Sie tragen dabei eine gewöhnlich aus Löwenhaar hergestellte Perrücke. Der follē-Tanz ist vor allem
in den Regionen Šäwā und Wällägā zu beobachten.
Der räpissā-Tanz wird nur mit dem Kopf getanzt. Dabei wird der Kopf abwechselnd vorgestreckt und
zurückgezogen. Die Hände des Tänzers bleiben während dessen hinter dem Rücken verschränkt, bis dieser
Tanzabschnitt beendet ist. Zugleich wird mit den Füßen gestampft. Der räpissā-Tanz wird sowohl von
Frauen als auch von Männern getanzt (Bahiru 1996).
Auch der Tanz der orõmõ besitzt Spannungs- und Entspannungsmomente, die sich nach dem jeweiligen
Gesangsabschnitt richten. Die Kopfbewegungen des räpissā- und die hin und wieder erscheinende Schul-
terbewegung des rägädā-Tanztyps sind den Bewegungsmustern des əskəstā-Tanz der amārā ähnlich.
Die Tanzweisen der verschiedenen Kulturen Äthiopiens werden generell in der beschriebenen Reihenfolge
getanzt. Dennoch bestehen keine fixen Regeln, die diese Reihenfolge zwingend bestimmen. Daher können
diese Tänze entweder individuell unterschiedlich gestaltet, oder durch die zwischen einem Paar bestehen-
de visuelle Kommunikation, die sich im Laufe des Tanzes entwickelt, bestimmt werden.
Im Gruppengesang der amārā und der təgrāy bleibt der stets am Anfang entweder spontan (bei den
amārā) oder gezielt (bei den təgrāy) zu bildende Tanzkreis mit einem Tanzareal in der Mitte bis zum Ende
eines Gesanges bestehen.
Der Tanz löst in den meisten ethnischen Gesängen das Trillern aus und fordert außerdem ein kräftiges
Klatschen. Dabei wird der Tänzer zu einer intensiveren Körperbewegung angeregt.
Geräuschkomponenten wie Zischen, Rufen, Trillern, Pfeifen usw. fungieren als wichtige Begleiter eines
Gesanges. Auch in vielen afrikanischen Kulturen werden sie verwendet. Beispielsweise hat Zinke (1992:
74) in ihrer Studie bezüglich der traditionellen Gesänge und Tänze der Ovambo in Namibia, ähnliche Be-
obachtungen gemacht.
Ololygen bzw. Trillerschreie gehören unmittelbar zu den Gesängen vieler Ethnien Äthiopiens. Die Ge-
räuschkomponenten dagegen, werden meistens während des Gesanges spontan ausgelöst. Damit wird
die Freude am Gesang bekundet seine und aktive Beteiligung angezeigt. Deshalb gibt es keine festen Re-
geln für den Einsatz solcher Rufe oder Interjektionen, da sie in ein und demselben Gesang entweder an
mehreren Stellen auftauchen können, oder beim wiederholten Singen überhaupt nicht mehr stattfinden. Sie
sind situativ bedingt.
Trotz der Unterschiede der Tanztypen in den verschiedenen Ethnien Äthiopiens, kann man allgemeine
Gemeinsamkeiten jeweils unter den
a) semitischem: z.B. amārā, gurāgē, təgrāy, harärē und gafāt336
b) kuschitischen: z.B. alle orõmõ-Gruppen, kämbāta337, agäw338, qəmānt339 und konsõ340 und
c) nilotischen bzw. omotischen: z.B. wälāmõ, wälayəttā, dõržē, nu'är341, käfā342 und hamär343 feststel-
len. Diese Gemeinsamkeiten sind auf den historischen Hintergrund und die geographische Verteilung der
jeweiligen Ethnien zurückzuführen. Hinzu kommen auch Binnenwanderungen, bei denen ein mehr oder
weniger intensiver Kulturaustausch zwischen den Ethnien stattfindet.
4.5. BEEINFLUSSUNGEN VON TRADITIONELLEN TÄNZEN ÄTHIOPIENS DURCH FREMDE
KULTUREN
Heutzutage sind in den städtischen Zentren Äthiopiens viele individuell erfundene Tänze, Tanzgesten und
-bewegungen zu beobachten, die von den Tanztraditionen erheblich abweichen und von Kennern als über-
flüssig empfunden werden. Dies ist zum Beispiel das übertriebene Heben der Beine in einem əskəstā-
Tanz.
Die Tanzchoreographien sind in ihren Grundformeln zwar noch erkennbar, aber vor allem in den Theater-
häusern, wo in der Regel traditionelle Tänzer ausgebildet werden, entwickeln sich von Zeit zu Zeit neue
Tanztypen und Bewegungsformeln aus der Zusammensetzung verschiedener Elemente, die ihren Ur-
sprung in völlig unterschiedlichen Kontexten und Ethnien haben. Diese neuen Tanzweisen verdrängen die
Originaltänze in starkem Maße.
336
Die gafāt {ጋፋት} leben in einem kleinen Ort in der Region Gondär. 337
Die kämbāta leben in dem gleichnahmigen Ort Kämbāta und Hadiya {ከምባታ/ሃዲያ} Region Sidāmõ, Süd-Äthiopien. 338
Die agäw werden auch awngi genannt. Sie leben in Agäw Mədər {አገው ምድር} und Damõt {ዳሞት}, Region Goğām. 339
Die qəmānt werden den zentral-kuschitischen Völkern zugeordnet. Sie wohnen in Gondär und Chəlgā, Region Gondär. 340
Die konsõ gehören zu den tiefland-kuschiten und leben in Gardulā, Region Gämu Goffā, Süd-Äthiopien. 341
Die nu'är leben in Gambellā, Region Illubabõr {ኢሉባቦር} dicht an der Grenze Ost-Sudans. Sie gehören zu der nilotischen
Bevölkerungsgruppe Äthiopiens. 342
Die käffā werden auch als käffičõ {ከፊቾ} bezeichnet. Sie zählen zu den omotischen Völkern und leben in der Region Käffā, Südwest-Äthiopien.
343
Die zu der süd-omotischen Volksgruppe zugeordneten hamär werden auch als amār {አማር}, hamār {ሐመር}, qõkē {ቆኬ},
bannā {በና}, bešadā {በሻዳ}, kerrē {ኬሬ} und karrõ {ካሮ} bezeichnet. Sie leben in Gäläb und Hamär Bakõ
{ገለብ/ሐመርባኮ} Region Gämu Gofā, Süd-Äthiopien an der Grenze Kenyas.
Entscheidend für die Veränderungen ist neben der eklektischen Vielfalt neuer medialer Angebote auf
Großbühnen und im Fernsehen vor allem die an "zivilisierte" Muster angepasste Auftrittsästhetik der Tän-
zer. Das spontane, allein auf Empirie beruhende Tanzverhalten einer großen, gemischten Hochzeitsgesell-
schaft unterscheidet sich hauptsächlich durch seinen primär kommunikativen Aspekt von choreographisch
gestylten Auftritten vor einem anonymen Publikum. Dort sind alle Tanzabschnitte genauestens berechnet,
es gibt auch keine willkürlichen Verlängerungen durch Wiederholung und Einfügung von Abschnitten,
selbst das Bilden von Tanzpaaren ist exakt vorausbestimmt. Es werden z.B. auch Sologruppen aus zwei
Männern und einer Frau im Zentrum gebildet, die traditionell nicht so funktionieren. Die Tänzer bilden
kein Paar im traditionellen Sinne, sie stellen sich eher selbst dar, die Tänzerin fungiert de facto als "Balle-
rina". Der besondere Geist des überlieferten Paartanzes besteht hingegen in der spontanen Auswahl der
Partner, im gemeinsamen tänzerischen Wetteifern zweier allen bekannten Personen, die sonst selten Gele-
genheit haben, sich öffentlich zu nähern.
Das gilt allerdings nicht nur für den əskəstā-Tanz der amārā, sondern auch für viele andere Ethnien Äthi-
opiens, die in solchen Tanzgruppen modifiziert dargestellt werden, nur um unterschiedliche und ab-
wechlungsreiche choreographgische Aufführungen anbieten zu können. Manchmal sind in den Fernseh-
sendungen Musikveranstaltungen von verschiedenen Ensembles zu beobachten, die europäische bzw.
fremde Tanzarten in ihre traditionellen Tänze mischen. Das betrifft neben der modernen Pop-Band-
Besetzung auch die besondere Tanzkleidung und Requisiten, die aus verschiedenen dauerhaften syntheti-
schen Materialien hergestellt werden und nur noch optisch den traditionellen Vorstellungen entsprechen.
Durch die abweichende Schnittweise von Kleidern z.B. können Bewegungen eingeschränkt werden, die
wiederum die musikalische Entfaltung der Musiker beeinflusst. In einer Band mit kleiner Besetzung spielt
sich die gesamte musikalische Kommunikation zwischen den Band-Mitgliedern ab, nur gelegentlich sin-
gen auch die Tänzer mit, weil sie sich auf ihre Einsätze konzentrieren müssen. Damit entfällt ein ganz
entscheidender Moment der Stimulierung des Tanzes, etwa durch die am Rande des Kreises singenden
täkäbayõč. Der gesungene Text ist außerdem durch eine häufig verzerrte Lautsprecherwiedergabe kaum
noch zu verstehen. Somit ist auch die spontane Entwicklung neuer Texte ausgeschlossen.
Für die unterhaltsamen Tanzshows werden andererseits extreme individuelle Leistungen trainiert. Die
akrobatische Körperbeherrschung wird täglich verbessert. Der soziale Status der Tänzer nähert sich damit
auch den Vorstellungen von modernen Bühnentänzern, wohingegen das Tanzen in der Tradition nur ein
Bestandteil von vielen kulturellen Eigenaktivitäten darstellt und überhaupt nicht getrennt von Gesang und
Trommelspiel, von der Erfindung passender Verse und von gemeinschaftlichen Festen wahrgenommen
wird. Die heute professionellen Tänzer rekrutieren sich zwar auch aus ländlichen Gebieten, in denen die
traditionellen Tänze noch fest verankert sind, doch sie haben sich in kurzer Zeit dem Habitus zivilisierter
Tanzästhetik angepasst, mitunter ohne bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen. Das
betrifft vor allem äthiopische Tänzer außerhalb Äthiopiens, speziell dann, wenn sie die Gelegeheit hatten,
sich an ausländischen Tanzschulen weiterzubilden. Dadurch ist das Bild vom typischen äthiopischen Tanz,
den es an sich ohnehin nicht geben kann, im Ausland auch unrealistisch.
Solche neu erfundene Tänze, durchsetzt mit akrobatischen Einlagen und Bewegungen aus Rock und Pop,
besonders die stereotype Haltung von E-Gitarren und Mikrophonen, werden vor allem von Jugendlichen
und Kindern nachgemacht. Das Imitieren fremder Tänze und Körperbewegungen wird dann von den Er-
wachsenen in solchem Maß geduldet, dass sie nach einer gewissen Zeit als nomal erpfunden und akzep-
tiert werden. Auf diese Weise verbreiten sich ständig neue Modetänze, vor allem in der Hauptstadt Addīs
Abäbā.
In den verschiedenen Kulturen Äthiopiens gibt es auch bestimmte Tanzhandlungen, die als erzählerisch
und theatralisch zu bezeichnen sind. Diese Tänze vermitteln Alltagsinhalte durch symbolische Requisiten
und stereotype Bewegungsmuster, wie z.B. in Ernte-, Liebes-, Arbeits- und Trauertänzen. Während in der
Tradition diese Tanzhandlungen nur kurze Ausschnitte zwischen intensiven Tanzphasen darstellen, wer-
den sie auf der Folkloretanzbühne zu einem ausführlichen Ballett umgestaltet, in welchem intensive Tanz-
phasen, die traditionellen Höhepunkte des Tanzes, lediglich der Illustration dienen.
S C H L U S S B E M E R K U N G E N
Die Tabelle G zeigt zusammenfassend alle Abschnitte der Hochzeitszeremonie, deren Teilzeremonien
immer als Ganzes betrachtet werden müssen. Vorhochzeitsbräuche und Nachhochzeitsbräuche gliedern
sich in zeitlich und/oder räumlich voneinander abgesetzte Vorgänge. Der Hochzeitstag selbst ist in viele
kleinere, aber eng zusammenhängende Abschnitte gegliedert, wobei nicht alle hier aufgeführten bei jeder
Hochzeit stattfinden. So ist z.B. Abschnitt 5.d) fakultativ und betrifft nur diejenigen Paare, die eine religi-
öse Eheschließung zusätzlich anstreben. Ebenso sind die Parkzeremonie und die moderne Cocktail-Party
Elemente einer modernisierten Hochzeitsästhetik.
Wichtig ist in jedem Fall die genaue Differenzierung zwischen verschiedenen Gruppen von Akteuren in
Abhängigkeit der vorgeschriebenen Zeiträume und der zeremonialen Abschnitte. Die Brautleute stehen
zwar jederzeit im Mittelpunkt des Geschehens, auch wenn sie abwesend sind wie z.B. in 4., doch ergeben
die vielfältigen Aktivitäten eines jeden Teilnehmers und dessen festbestimmte Funktion ein Geflecht von
Zuständigkeiten und damit auch von wichtigen Koordinationsproblemen, die u.a. durch die musikalische
Gestaltung mitreguliert werden müssen.
Neben den an verschiedene Hochzeitsphasen funktional gebundenen Gesängen sind auch allgemeine
Hochzeitsgesänge exemplarisch in ihrer typischen Folge aufgelistet. Außerdem wird eine Reihe von Un-
terhaltungsgesängen, wie z.B. Liebeslieder, vorwiegend im Wechsel zwischen awrāg und täqäbayõč vor-
getragen. Sie unterliegen den gleichen kommunikativen Bedingungen wie alle traditionellen Gesänge des
Hochzeitsrepertoires. Auch Sologesänge des ažmārī bereichern in bestimmten Abschnitten das Fest.
Zur Musikpraxis zählen außerdem alle vorbereitenden und organisatorischen Handlungen, wie z.B. das
Ausleihen der Trommel käbärõ oder neuerdings das Engagieren von professionellen Folklore-Bands.
Letztere wird auch oft durch Musikkonserven ersetzt, besonders in ärmeren städtischen Familien. Das hat
zur Folge, dass die Musik vom Kassettengerät nicht immer mit den Abschnitten der Zeremonie überein-
stimmt, denn die Auswahl auf den Kassetten folgt einer anonymen Regie, in die niemand eingreifen kann.
So gebietet es die Situation, dass das Gerät entweder häufig an- und ausgeschaltet wird oder sich neben
der lautstarken Musik vom Band spontan eingeleitete und funktional erforderliche Gesänge durchsetzen
müssen. Das Ergebnis ist ein akustisches Durcheinander und die vor allem bei Jugendlichen zu beobach-
tende Undifferenziertheit in der Gestaltung von Liedfolgen bis hin zur starken Reduktion des Repertoires
auf die wenigen von Tonträgern her bekannten Lieder.
Die Dauer der Gesänge zeigt an, dass es die Kraft und das Engagement aller erfordert, sämtliche Abschnit-
te der Zeremonie musikalisch mitzugestalten. Das Repertoire an Hochzeitsgesängen ist trotz der vielen
verschiedenen Lieder darauf angwiesen, ständig durch neue Texte, durch neue Verknüpfungen von Lied-
folgen und durch den kreativen Umgang mit unterschiedlichen Wechselgesangsformen aktualisiert zu
werden.
Tab.G: Musterablauf einer traditionellen amārischen Hochzeit in Addīs Abäbā
Vor der Hochzeit
Abschnitte der
Zeremonie Zeitraum und Akteure Gesänge und Ausführung organisatorische
Praxis und Ergänzun-
gen
Dauer der
Gesänge
1. Schicken von
Gesandten im Durchschnitt ca. 1 Jahr vor der
Hochzeit344;
aus dem Verwandtschaftskreis ausge-
wählte ältere und respektierte Männer
und die Brauteltern345
keine
2. Vorbereitung auf
die Hochzeitsfeier ca. 6 Monate bis 1 Jahr vor der Hoch-
zeit;
hier nehmen Nachbarn und Verwandte
der Brauteltern an den täglichen Vorbe-
reitungsarbeiten teil
ca. 1 Monat vor der Hochzeit
beginnen die Hochzeits-
gesänge346
Wechselgesänge z.B.:
ənē alsätəm ləğēnə (33) ašäwäynā wäynā (14)
ca. 2-4 Stunden
am Tag verteilt
kūrāt kūrāt (44) yäbētä žämädū (63) nəbõ atənādäfī (54) yägwarõyē tenādām (64) yänēabäbā näš (66) čəbõ ayəmolām wägäbwā
(21)
ohõ hõ munā (55) ašā gädawõ (12) ašäbäl gädayē (13) əšätē wäynā (35)
3. Verlobungstag mit
anschließender
Feier
ca. 1 Woche - 6 Monate vor dem Tag
der Hochzeit347;
die Begleiter der Brautleute, ausge-
wählte Familienangehörige beider
Seiten, engste Freunde und Nachbarn
siehe Beschreibung zu Ab-
schnitt 2 die Trommel wird
geliehen mehrere Stun-
den zu ver-
schiedenen
Phasen
4. Zeremonie des
Überreichens von
Hochzeits-
geschenken
gewöhnlich am Vorabend der Hoch-
zeit348; Begleiter des Bräutigams
bringen die Geschenke; Brautjungfrau-
en warten im Haus, um an den Ver-
handlungen teilzunehmen; engste ältere
Verwandte der Brautfamilie fungieren
als Gutachter mit anschließender
Segnung der Zeremonie
siehe Beschreibung zu
Abschnitt 2 ein Azmari erscheint
und bietet seine
Dienste für den
nächsten Tag an
ca. 1-2 Stunden
344
In ländlichen Gebieten kann der Zeitpunkt weit zurückliegen. Die Heiratskandidatin wird in den meisten Fällen bereits als
junges Mädchen oder als kleines Kind versprochen. Deshalb findet das Schicken von Gesandten zu einem früheren Zeitpunkt statt (d.h. es kann auch 5-10 Jahren zurückliegen, weil gewartet wird, bis das Mädchen das heitratsfähige Alter erreicht hat).
345
Im Gegensatz zu anderen äthiopischen Kulturen, z.B. die harärē, haben in der amara-Tradition auch die Mütter ein gewisses
Mitspracherecht. Allerdings ist dies eher in den städtischen Zentren der Fall, in den ländlichen Gebieten ist das Mitsprache-
recht der Mütter nur symbolisch gemeint oder sehr stark eingeschränkt. 346
Es ist selbstverständlich, dass die betreffende Familie von Verwandten und Nachbarn ab ca. 1 Monat vor dem Termin besucht
wird, um an den Hochzeitsvorbereitungen teilzunehmen und mitzuhelfen. Dabei werden stets entweder vor Beginn oder nach Beendigung der täglichen Beschäftigung Hochzeitsgesänge gesungen.
347
Der Verlobungstag steht im Zusammenhang mit der standesamtlichen Eheschließung (in Großstädten) und mit der traditionel-
len Eheschließung (auf dem Land). Er muß aber nicht unbedingt getrennt gefeiert werden. Es bleibt jedem Feiernden überlas-
sen, ob er diesen Tag vor dem eingentlichen Tag der Hochzeit extra feiert oder nicht. Wenn ein Paar vor der Hochzeit die Ver-
lobung feiert, bedeutet diese mit anderen Worten, dass es von diesem Tag an ein rechtmäßiges Ehepaar ist. Die Hochzeitsfei-
er, die dann später stattfindet, ist nur ein symbolischer Akt. Die standesamtliche Eheschließung kann auch am Tag der Hoch-zeit stattfinden.
348
In den ländlichen Gegenden findet die Zeremonie des Überreichens von Hochzeitsgeschenken ein Paar Wochen bzw. Monate
statt. Hierbei handelt es sich nicht nur um Hochzeitskleidungen, sondern auch um Gegenstände, die das Brautpaar in seine Ehe miteinbringt wie Arbeitsochsen, Getreite u.a.
Tag der Hochzeit
Abschnitte der
Zeremonie Zeitraum und Akteure Gesänge und Ausführung organisatorische
Praxis und Ergänzun-
gen
Dauer der
Gesänge
5.a) Anlegen der Hoch-
zeitskleidung zw. 8 und 9°° Uhr;
Brautjungfrauen und engste Verwand-
te im Hause der Braut und Begleiter
im Hause des Bräutigams
Wechselgesänge wie z.B.
abäğäš yäñā ləğə(2) ətē balənğär (39) bālənğärē (18)
ca. 1 Stunde
əndalayəš (30) bəq bäy kägwadā (19) ahūn dämäq/š abäbāyē (4) mūšərīt ləmäğī (51) tasäräč bäguləččā (59) täwūbäšāl alū (60) kulūn mān kwāläšə(43)
šäb əräb aläč mədərə(57) lõmī talubāt (45) əswās lõmī nāt (36) sägurwā wärdõ wärdõ (56) wäläbē wäläbē (61) amrwal šägänu (7) yäšī gabəččā (67)
5.b) Vorbereitung der
Braut auf den
Abschied, sie erwar-
tet im Vorzimmer
den Bräutigam, um
mit ihm zur Kirche
zu gehen
zw. 9 und 10°° Uhr;
siehe 5a Wechselgesänge u.a.:
atšäñwatəm wäy (16) yäwäyən abäbāyē (69) mähēdwā näwū (47) mähēdē näw mağī (46) hēdäč alū (25)
ca. 1 Stunde
5.c) Ankunft des Bräuti-
gams im Elternhaus
der Braut
zw. 10 und 11°° Uhr;
Begleiter des Bräutigams; Brautjung-
frauen und Familienangehörige der
Braut
Wechselgesänge u.a.:
anāsgäbām sərgäñā (9) ənē alsätəm ləğēnə (33) mīžēw šəttõ amtā (48) əčī nāt wäy mīžēšə (27)
ca. 45 Min.
hay lõgā (24) gurmrmē (23) wändəməyē (62) yəžwāt bärärä (71)
5.d) Kirchliche Hei-
ratszeremonie ca. 11 - 12:30°° Uhr;
Diakone, Priester, ausgewählte Hoch-
zeitsgesellschaft beider Seiten
religiöse Wechsel- und ein-
stimmgie Gemeinschaftsgesän-
ge und eine
Hochzeitsmesse
die Kirchendiener
nehmen an den Ge-
sängen teil
ca. 60-90 Min
5.e) Mittagessen, von
der Brautfamilie
vorbereitet
ca. 12:30-15:30°°;
alle (die Gäste werden mitunter in
Schichten bestellt, um z.B. dem be-
grenzten Platzangebot in einem Res-
taurant zu entsprechen)
Wechselgesänge, u.a.:
yäbētä žämädū (63) mušərõč marē marē (52) ärä näy ətē (22) šənätə (58)
bestellte əmbiltā-
Spieler kommen
hinzu; ein azmari
bietet seine Dienste
als Entertainer an
ca. 2 Stunden
mušərayē (53) ələl balē ohõ (28) yäñāmā mūšərā (65) əndäw yämərū (31) amõrā bäsämay siyayəš
walä (6)
arkā bälulāèäwu (11) ašē munanā (15) bähār ašəmäwu (17) əyäbälū yätätū žəmə(41)
Abschnitte der
Zeremonie Zeitraum und Akteure Gesänge und Ausführung organisatorische
Praxis und Ergänzun-
gen
Dauer der
Gesänge
5.f) Beendigung des
Mittagessens und
Verabschiedung des
Brautpaares; würde-
volle Segnung der
Brautleute
ca. 15:30 Uhr;
Die Brautleute müssen sich von den
Eltern und älteren Verwandten der
Braut verabschieden. Sie gehen reihum
und küssen eine vorausbestimmte
Anzahl von ausgewählten älteren
Angehörigen der Braut; siehe 5.e)
Wechselgesänge, u.a.
mähēdwā näwū (47) mähēdē näw mağī (46) hēdäč alū (25) mūšərīt ləmäğī (51) mušərayē (53) bähār ašəmäwu (17) atšäñwatəm wäy (16)
parallel zur tradi-
tionellen Musikübung
können über die
gesamte Dauer der
Hochzeit kommerziel-
le MC von einer
Musikanlage abge-
spielt werden
ca.20 Min
ančī alälā mudāyə(8) wändəməyē (62) hay lõgā (24) gurmrmē (23)
5.g) Parkzeremonie349 zw. 15:30 und 17:30 Uhr;
Hauptanliegen ist es, schöne Hoch-
zeitsfotos zu machen;
ausgewählte engste Freunde und
Verwandte beider Seiten
Wechselgesänge,
siehe Beschreibung zu Ab-
schnitt 2 und 3
ca. 2 Stunden
5.h) "Coctail-Party" ca. 17.30 bis 19.00 Uhr;
als Beitrag des Brautpaares gedacht
und meistens in großen Hotels oder
Restaurants veranstaltet350; ausge-
wählte engste Freunde und Verwandte
beider Seiten
Wechselgesänge,
siehe Beschreibung zu Ab-
schnitt 2 und 3
zumeist wird hier eine
moderne Folklore-
oder Pop-Band be-
stellt
ca. 2 Stunden
5.i) Abendveranstaltung
im Haus des Bräuti-
gams
Abendessen wird gewöhnlich von den
Eltern des Bräutigams veranstaltet und
findet
ca. 19 - 0°° Uhr;
die Brauteute, Verwandte und Freunde
des Bräutigams, nur wenige, ausge-
wählte Familienangehörige und Be-
kannte der Braut
Wechselgesänge,
siehe Beschreibung zu Ab-
schnitt 2 und 3
auch hier kann eine
moderne Folklore-
oder Pop-Band be-
stellt werden
ca. 4-5 Stunden
verteilt am
Abend
5.j) Zeremonie des
Namensbrotes für
die Braut
nach dem Abendessen innerhalb der
Abendveranstaltung;
Begleiter des Bräutigams und die
Gäste
verschiedene Wechselgesänge,
speziell
žäbänay mārəyē (72)
ca. 30 Min
5.k) das Brautpaar begibt
sich in das Schlaf-
zimmer
ca. 1 - 2°° Uhr;
die Brautleute351 Wechselgesänge, speziell:
yäžarē amätə(70) ətē šänkõrē (40)
30 Min
349
Dieser Abschnitt findet nur in den städtischen Zentren statt. In den ländlichen Gebieten wird das Brautpaar nach dem Mittages-
sen verabschiedet. Die weitere Zeremonie erfolgt dann im Elternhaus des Bräutigams. Für den zumeist langen Fußweg steht
ein Pferd oder ein Maultier für die Braut zur Verfügung. Sie wird von einer großen Gruppe, zumeist von Männern, zu Fuss
begleitet, die ununterbrochen singen. Das Gesicht der Braut bleibt währenddessen durch den Schleier verdeckt. Eine andere
Variante ist die Fortsetzung der Abendveranstaltung im Haus der Braut und die Verabschiedung am nächsten Morgen. Es gibt
auch noch weitere Varianten. 350
Hier erfolgen auch das Anschneiden der Hochzeitstorte und der Brauttanz, nachempfunden den europäischen Bräuchen. 351
In den ländlichen Gebieten soll traditionsgemäß der engste Begleiter und zugleich engste Freund des Bräutigams die Nacht mit
dem Brautpaar verbringen. Im Falle des physischen Versagens des Bräutigams könne er so für ihn einspringen. Dieser Vor-
gang bleibt jedoch stets ein intimes Gehehimnis zwischen dem Bräutigam und seinem Freund. Die Entjungferung der Braut
muß unbedingt in dieser Nacht stattfinden, um am nächsten Morgen die voller Hoffnung wartenden Brauteltern zu beglück-wünschen. Vgl.0345.010/9 Interview mit Zärfu Takele aus Gojjam
Nach der Hochzeit
Abschnitte der
Zeremonie Zeitraum und Akteure Gesänge und Ausführung Dauer der Gesänge
6. Beglückwünschung
der Brauteltern am Tag nach der Hochzeit
zw. 6 und 9°° Uhr;
Begleiter des Bräutigams, Familienangehörige
der Braut
Wechselgesänge, u.a.
bər ambār (20) kēlawu täsäbärä (42) abäbāwū babäbāwū layə(1)
ca. 45 Min.
žäbänay mārəyē (72) əstī amtaw yädämūn šämā (38) əstī šälmūn (37)
7. Mäls-Feier am dritten Tag nach der Hochzeit352
Abendessen wird gewöhnlich von den Eltern der
Braut veranstaltet und findet ca. 19 - 0°° Uhr
statt;
Verwandte und Bekannte beider Familien
Wechselgesänge, u.a.
siehe auch Beschreibung zu Abschnitt
2 und 3, speziell
mūšərīt lämdaläčə (50)
ca. 4-5 Stunden
verteilt am Abend
8. Qələqəl-Feier am 6. bzw. 7. Tag nach der Hochzeit; Abendes-
sen wird gewöhnlich von den Eltern des Bräuti-
gams veranstaltet und findet
ca. 19 - 0°° Uhr;
Verwandte und Bekannte beider Familien
siehe Beschreibung zu Abschnitt 2 und
3
ca. 4-5 Stunden
verteilt am Abend
Die variantenreiche Gestaltung der Gesänge gilt insgesamt für das gesamte traditionelle Repertoire der
amārā und zwar sowohl für den awrāğ als auch für die täqäbayõč, wobei der solistisch agierende awrāğ
als Leiter des Gesanges stets die Möglichkeit hat, seine Gesangszeilen bzw. Teile von ihnen individuell
und bisweilen extravagant zu gestalten, wenn er dazu fähig ist. Die täqäbayõč dagegen treten stets in
Gruppen auf, so dass die Variationsfreiheit gegenüber dem awrāğ für sie beschränkter bleibt. Wenn jeder
täqäbay während eines Wechselgesanges seiner eigenen Melodievariation selbst bestimmen kann, käme es
zu einem melodischen Durcheinander, zu metrorhythmischen Störungen bis hin zu starken Tem-
poschwankungen. Derartige Konfusionen, die gelegentlich zu Beginn eines Gesangs oder beim Wechsel
des Abschnitts innerhalb eines Gesangs auftreten, bedürfen der sofortigen Korrektur durch den awrāğ,
ggf. durch den Trommler und durch die kollektive Gesangsleistung der gesamten Gruppe.
Der Gebrauch von Melodievariationen erfolgt immer innerhalb eines konventionellen Rahmens. Das be-
deutet, dass der awrāğ z.B. die Toleranzgrenze einer Tonreihe (qəñət) nicht überschreiten kann. Eine Aus-
nahme dabei ist die Verwendung von Tonreihenvarianten wie es z.B. die təžətā-Tonreihe anbietet (s. Ab-
schnitt 1.3.1.). Der Gebrauch von qəñət-Varianten kommt jedoch vorwiegend in den solistisch vorgetrage-
nen ažmārī-Gesängen vor und auch hier nur zu Beginn eines Gesangs. Beobachtungen und Analysen
ergaben, dass in den amārischen Hochzeitsgesängen feste Tonreihen die Norm sind und dass kein Gesang
außerhalb der vorgeschriebenen Tonreihe gesungen werden kann.
Einen Gesang erkennt man zunächst an der Melodiestruktur, z.B. an der Gliederung der Gesangszeilen in
ihre melodischen Formeln, deren Grundcharakter auch durch variative Gestaltungsmöglichkeiten nicht
verletzt werden darf. Außerdem wird ein Gesang sofort an seinen typischen Texten erkannt, die z.B. nur
für diesen Gesang bestimmt sind bzw. in einer für diesen Gesang typischen Weise den einzelnen melodi-
schen Formeln zugeordnet werden. Das betrifft auch die charakteristische Rollenverteilung zwischen
awrāğ und täqäbayõč. Die augenblickliche Identifizierung eines jeden Hochzeitsgesangs ist deshalb not-
wendig, weil die verschiedenen Wechselgesangsformen mit ihren unterschiedlichen Abschnitten und Ge-
sangszeilenstrukturen ohne diesen kommunikativen Aspekt nicht möglich sind oder aber unzulänglich
ausgeführt werden.
Die amārischen Hochzeitsgesänge brauchen bestimmte Textvorgaben, die zur Identifizierung des jeweili-
gen Gesangs notwendig sind. Es gibt Gesänge, die nur einen konkreten Text gestatten und auch nur mit
diesem gemeinsam exisiteren. Andererseits gibt es auch eine Reihe von Gesängen, die lediglich am An-
fang mit einem den jeweiligen Gesang kennzeichnenden Text verbunden ist. In den der Einführung fol-
352
In den ländlichen Gebieten kann dieser Tag zum späteren Zeitpunkt ausfallen.
genden Gesangsabschnitten, wie z.B. in bestimmten strophischen Teilen, können andere Texte hinzuge-
fügt werden, die mit der geforderten Melodiestruktur übereinstimmen.
Die primären Textinhalte sind für die traditionelle Musik der amārā von immenser Bedeutung, weil sie als
Mittelpunkt der Unterhaltung und der Kommunikation angesehen werden. Die Teilnehmer an den Hoch-
zeitsgesängen empfinden in der Regel den Gesang und damit verbundene Aktionen als selbstverständliche
Grundlage für die "eigentliche Unterhaltung", die sich in erster Linie auf die Texte bezieht und an hohe
Erwartungen geknüpft werden. Dazu zählt auch die Verwendung von variativen Textinhalten. So kann ein
Gesang von langer Dauer sein, wenn stets neue Textinhalte vom awrāg vorgetragen werden. Doch neben
den primären Textinhalten ist der Gebrauch von Redundanzen in Gestalt von Anrufungszeilen sehr stark
vertreten. Hierbei tragen die einzelnen Silben und Silbenkombinationen keine verbale Information, doch
stellen sie den kommunikativen Halt, die Identifizierbarkeit des Gesangs und die motionale Einbindung
unter den Akteuren her. Redundanzen fungieren also nicht nur als beliebige Textteile, die bei Bedarf sub-
stituiert werden können, sondern auch als Sinnträger in einem Lied und sind nicht zuletzt auch in ihrer
klanglichen Struktur bestimmt.
Der Tanz als untrennbarer Bestandteil der Hochzeitsgesänge, vor allem der əskəstā-Tanz, ist mit bestimm-
ten Bewegungsregeln verbunden, die im Verlauf eines jeden Wechselgesangs durch musikalische und
textliche Strukturen und Inhalte gesteuert werden. Intensive und entspannte Tanzphasen hängen vor allem
vom Charakter der gesanglichen Darstellung ab. So folgen intensive Tanzphasen in der Regel den kon-
zentrierten Textabschnitten im Gesang und erreichen ihren Höhepunkt z.B. auf den Gesangszeilen, die
textliche Wiederholungen und Redundanzen beinhalten. Der Tanz ist ebenso von Variantenreichtum und
Individualität gekennzeichnet wie der Gesang. Im traditionellen Paartanz kommt es darüberhinaus auf eine
gute Koordination der kontrastierenden oder der symetrischen Bewegungen an. Wie auch im Gesang exis-
tieren zahlreiche lokale Unterschiede und Tanzauffassungen, ebenso gibt es deutliche Abstufungen im
Grad der Beherrschung.
* * *
Ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit besteht in der Gesamtdokumentation der traditionellen Hoch-
zeitsgesänge und -bräuche der amārā in ihrer traditionellen Vielfalt. Es ist sicherlich Aufgabe eines jeden
Musikethnologen, noch lebende Musiktraditionen zu erforschen, Ton- und Bildmaterial zu sammeln, es zu
analysieren und letztendlich zu dokumentieren, um der nächsten Generation Mittel und Möglichkeiten
weiterzugeben, ihre musikalischen Traditionen bewusst zu bewahren.
Für mich, eine äthiopische Wissenschaftlerin, ist es selbstverständlich, dass sich meine Forschungen und
meine Bemühungen auf die Darstellung von äthiopischen Musikpraktiken konzentriert, denn sie sind sehr
wenig dokumentiert und nur punktuell analysiert worden.
Eine Ursache dafür ist die über viele Jahrzehnte hinweg schwierige soziale Situation des Landes, die eine
interne Beschäftigung mit Kulturen und Traditionen sowohl materiell als auch interessenbedingt erschwert
hat. Diese auch für andere Teile des Kontinents geltenden Selbstbeschränkungen führen nun umgekehrt
dazu, dass sich in der Zeit extremer Veränderungen in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur
der Mangel an Wissen und Kenntnissuche über traditionelle Kulturen als einschneidender Faktor der sozi-
alen Instabilität bemerkbar macht und zu zahlreichen Konfliktstoffen innerhalb verschiedener Generatio-
nen und zwischen verschiedenen Ethnien führt. Selbst die sprichwörtliche Kontinuität von Hochzeitsbräu-
chen einschließlich aller dazugehörenden künstlerischen Aktivitäten bleibt davon nicht verschont. Die
Verarmung des Repertoires und die einsetzende Einseitigkeit in der Darstellung ist nur ein Teil des unmit-
telbar wahrnehmbaren Wandels. Sehr viel folgenschwerer sind die auf diese Weise symptomatisch ange-
zeigten Veränderungen in der Ästhetik, in den Wertvorstellungen und im Selbstbewusstsein der verschie-
denen Volksgruppen. Es gab in der jahrhundertealten Geschichte Äthiopiens zwar immer schon mehr oder
weniger starke Umbrüche, doch gingen sie verhältnismäßig langsam vor sich und ließen stets Zeit zu einer
stabilisierenden Reflexion in künstlerischen Artikulationsformen und in der Aneignung neuer Traditions-
elemente, z.B. in der jüngeren Versdichtung, in den Kriegsliedern oder in den professionellen ažmārī-
Gruppen. In der Gegenwart finden solche Prozesse mit großer Geschwindigkeit statt und unter den bereits
kritischen Bedingungen materiell-technischer Abhängigkeit, die besonders zwischen den verschieden ent-
wickelten Bevölkerungen eines schwachen Agrarlandes weit über traditionell verwurzelte Anschauungen
hinausreichende Differenzen aufwerfen. Addīs Abäbā ist ein Beispiel dafür, dass vor allem die zugewan-
derten armen Städter unter dem Verlust ihrer zweifachen Wurzeln, der bäuerlichen und der ethnischen,
leiden. Der Zugewinn an modernen Entscheidungsmöglichkeiten muß z.B. mit dem Verzicht auf die tradi-
tionelle Würde einer Hochzeit beglichen werden, während sich reichere Familien den Luxus professionel-
ler musikalischer Unterstützung und anerkannter Originalität leisten können.
Ist auch die neuere Entwicklung nicht umkehrbar, so ist es doch an der Zeit, diese durchaus nicht in allen
Punkten negative Vision durch gezielte Forschungen und Veröffentlichungen, durch aktives Engagement
und durch akribische Dokumentation noch vorhandener Kulturzeugnisse zu lenken.
Über dieses individuelle Interesse hinaus aber soll diese Arbeit eine solide wissenschaftliche Basis für
weitere Studien zu äthiopischen Kulturen bilden. Gerade das Hochzeitsrepertoire der amārā bietet eine
Fülle von Anknüpfungspunkten, sei es für die Ethnographie, die Sprachwissenschaft, aber auch für syste-
matische und vor allem historische Aspekte der Musikwissenschaft. Viele Probleme konnten hier nur an-
gerissen werden, andere bedürfen in der Zukunft weiterer detaillierter Materialstudien.
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s Ackermann, Bernhard
1901 Die afrikanischen Musikinstrumente. - Direktion des Königlichen Museums für Völkerkunde
in Berlin (Hrsg.). - Bd.3/H.1 - Berlin.
Addis Zemen
1988a Yalä Idime Gabica Kähaymanot Ansar [Frühzeitige Heirat aus der Sicht der Religion; Zeitung]. - 4. Juli -
Addis Abeba - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./.
1988b Yalä Idime Gabica Khig Akuwaya [Frühzeitige Heirat aus der Sicht des Gesetzes; Zeitung]. - 11. Juli -
Addis Abeba - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./.
Aleme, Eshete (siehe auch Eshete, Aleme)
1982 The Cultural Situation of Socialist Ethiopia. - Paris.
Ayele, Birtukan
1995 Die Urbanisierung in Äthiopien: Addis Abeba als Beispiel. - Diplomarbeit. - Berlin.
Ayen, Shitu; Engida, Minyicil; Alene, Yarägal
1988 Yä Awi Hizb Bahilawi Gäsitawoc Tinatawi Sihuf (Sitten und Bräuche des Awi-Volkes). - Bahir
Dar/Gojjam 1988 - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./.
Bachem, Bele
1966 Weißgekleidetes Harar. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft 10/XIX. -
Hrsg. Hans Kramer . - S.60-67. - Oktober
Bamzai, P.N.K.
1970 Ethiopian Folk Music and Dance. - In: India Quarterly. - Vol. 1 - No. 3. Addis Abeba. - S. 23-24
Bartnicki, Andrzej/ Niecko, M. Mantel
1978 Geschichte Äthiopiens -Von den Anfängen bis zur Gegenwart. - Berlin (Teil 1 und 2)
Bascom, William
1958 Main Problems of Stability and Change in Tradition. - In: African Music. - Roodepoort 2(1958)1. - S. 6-
10.
Baumann, Max Peter
1977a Eine Feldforschungsreise nach Äthiopien. - in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Musik
des Orients 14. - Hamburg - S. 78-81
1977b Zusammenfassung der Diskussion "Tradition und mündlich überlieferter Musik". - In: Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients 14. - Hamburg - S. 61-65
1977c Geschichtsbegriff und orale Tradition. - In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Musik des Ori-
ents 14. - Hamburg - S. 7-13
1978 Ethnohistorische Quellen zur Musik Äthiopiens aus schriftlichen Zeugnissen von 1500-1800. - In: Musi-
kethnologie Sammelbände. - 2 historische Volksmusikforschungen. - Berlin - S. 18-49
1990 Methoden und Methodologie der Volksliedforschung. - In: Jahrbuch für Volksliedforschung. - O. Holzap-
fel/J. Dittmar (Hrsg.). - 35. Jahrgang Berlin - S. 26-32
1991a Towards new Directions in the Dialogue of Music Cultures. - In: Music in the Dialogue of
Cultures: Traditional Music and Cultural Policy. - Wilhelmshaven - S. 11-14
1991b Traditional Music in the Focus of Cultural Policy. - In: Music in the Dialogue of Cultures: Traditional
Music and Cultural Polica. - Wilhelmshaven - S. 22-31
Bekele, Zenebe (siehe auch Zenebe, Bekele)
1987 Music in the Horn - A Preliminary Analytical Approach to the Study of the Music of Ethiopia. - Stock-
holm.
1990 Cilancil-Tarikawi Yemusika Iyita. - Stockholm.
Bender, Wolfgang
1982 Musik aus Äthiopien. - Bayreuth
Bibel
1985 Die Bibel. - Deutsche Bibelgesellschaft (Hrsg). - Stuttgart
Bibel
1962 Mäsahif Qidus: Yäbiluyna Yähadis Kidan Mäsahift (Die Bibel: Altes und neues Testament) - United Bible
Societies (Hrsg) - Addis Abeba
Bibelwörterbuch [Yä Mäsihaf Qidus Mäzgäbä Qalat]
1972
Yä Mäsihaf Qidus Mäzgäbä Qalat [Bibelwörterbuch]. - Äthiopische Bibel-Organisation (Hrsg.) - /hier
nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1980 u.Z./.
Birara, Misige
1980a Lä Aqmä Adam Saydärsu Gabica (Heiraten im unreifen Alter). - S. 1-7 - Bahir Dar/Gojjam - /hier nach
dem äth. Kalender angegeben; ca.1988 u.Z./.
1980b Yalämätän Digis Lämasqärät Yähulacinim Tirät (Das Vermeiden von hohen Kosten für verschiedene
Feiern). - S. 8-16 - Bahir Dar/Gojjam - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1988 u.Z./.
Black Musicians
1975 Black Musician and early Ethiopian Ministrelsy. - In: The Black Perspective of Music. - Vol.3-No. 2. - S.
77-97
Blacking, John
1955 Some Notes on a Theory of African Rhythm advanced by Erich von Hornbostel. - In: African Music. -
Roodepoort 1 (1955)2. - S. 12-20.
1967 Venda Children's Songs. - Johannesburg
Budge, E.A.W
1928 A History of Ethiopia. - London
Buxton, David R.
1970 The Abyssinians. - London.
Calame-Griaule, Geneviève und Calame, Blaise
1980 Einführung in das Studium der afrikanischen Musik. - Frankfurt-Main
Chernoff, John Miller
1979 African Rhythm and African Sensibility: Aesthetics and Social Action in African Musical Idioms: Chica-
go and London: University Press
Coe, John und Gessesse, Tesfaye
1966 Masinko, Waschint und Krar. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft 10/XIX.
- Hrsg. Hans Kramer . - S. 96-101. - Oktober
Collaer, Paul/Elsner, Jürgen
1983 Nordafrika. - In: Musikgeschichte in Bildern. W. Bachmann (Hrsg.) - Bd.1/8.Lfrg. - Leipzig
Conti-Rossini, Carlo
1928 Storia d'Etiopia. - Milan
Courlander, Harold
1944 Notes from an Abyssinian Diary. - In: Musical Quarterly 30. - S.345-355
Danielou, Alain
1972 The Musical Languages of Black Africa. - In: African Music. - La Revue MUSICALE. - Paris
Dauer, Alfons
1983a Lieder der Gonja (Ghana) - In: Musik in Afrika. - A. Simon (Hrsg.). - Berlin - S. 103 - 138
1983b Stil und Technik in afrikanischem Tanz. - In: Musik in Afrika. -A. Simon (Hrsg.). - Berlin -
S. 217-233
1983c Zum Bewegungsverhalten afrikanischer Tänzer. - In: Musik in Afrika. - A. Simon (Hrsg.). -
Berlin - S. 234-242
Dlebo, Lapiso (siehe auch Lapiso, Dlebo)
1982 Yä Ityopia Räjjim Yä Hizb Ina Yä Mängist Tarik (Die lange Geschichte der äthiopischen Bevölkerung
und Regierung). - Bd.1. - Addis Abeba
Dillmann, August
1959 Grammatik der äthiopischen Sprache. - Graz
Elschek, Oskar
1991 Traditional Music and Cultural Politics. - In: Music in the Dialogue of Culture: Traditional Music
and Cultural Policy. - Wilhelmshaven - S. 32-34
Elschekova, Alica
1989 Model und Modellvariation in der slowakischen Musik. - In: Maqam, Raga, Zeilenmelodik-, Konzep-tion
und Prinzipien der Musikproduktion. - Materialien der 1. Arbeitstagung der Study Group 'maqam' beim
ITCM. - Jürgen Elsner (Hrsg.). - 28. Juni - 2. Juli 1988 Berlin. - Berlin
Elsner, Jürgen
1989 Zum maqam-Prinzip - in: Maqam - Raga - Zeilenmelodik, Konzeptionen und Prinzipien der Musikpro-
duktion - Berlin - S.7-39
1997a Zur Einheit der Musikwissenschaft, Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft - Gemeinsame
Ziele, gleiche Methoden?. - Bericht der Tagung am Musikwissenschaftlichen Institut der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz - Chr.-H. Mahling / St. Münch (Hrsg.) - in: Mainzer Studien zur Musik-
wissenschaft, Nr.36 - Tutzing - S.177-187
1997b Modernisierungen in der Musikkultur des Jemen in unserem Jahrhundert - Historical Studies on Folk and
Traditional Music - D. Stockmann / J.H. Koudal (Hrsg.) - in: Acta Ethnomusicologica Danica, Nr.8 -
Copenhagen - S.177-190
Erlmann, Veit
1998 How Beautiful is Small? Music, Globalization and the Aesthetics of the Local. - In: Yearbook for Traditi-
onal Music. - Vol. 28. - S. 12 - 21. - Kingston, Ontario
1996 The Aesthetics of the Global Imagination: Reflections on World Music in the 1990s. In: Public Culture. -
Vol 8. - S. 467 - 487
Eshete, Aleme (siehe auch Aleme, Eshete)
1982 The Cultural Situation of Socialist Ethiopia. - Paris.
Ethiopian Music Village
1993 A Summer Festival of Ethiopian Music and Crafts in Brimmingham. - Glasgow · London · Berlin · 19th
June-19th July.
Forms of Marriage
o.J. Forms of Marriage -Topic 3 - unveröffentliches Lehrmaterial der Fakultät Rechtswesen - Addis Abeba
Universität
Gebre-Hiwot, Hailu
1958 Omens in Ethiopia. - In: Ethnological Society. - Bulletin No. 8, July. - Addis Abeba - S. 23-48
Gebre-Medhin, Tsegaye
1966 Ständig bedrohte Kultur. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft 10/XIX. -
Hrsg. Hans Kramer . - S. 96-101. - Oktober.
Gessesse, Tesfaye und Coe, John
1966 Masinko, Waschint und Krar. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft 10/XIX.
- Hrsg. Hans Kramer. - S. 96-101. - Oktober
Goshu, Hailemariam (siehe auch Hailemariam, Goshu)
1969 Music through the Years. - In: Addis Reporter. - Vol. 35 - No. 25-36. - Addis Abeba - S.17-19
Gottlieb, Robert
1986 Musical Scales of the Sudan as Found among the Gumus, Berta, and Ingessana Peoples. - In: The World
of Music. - Vol. XXVIII. - No. 2. - Wilhelmshaven - S. 56-76
Griffin, Keith
1992 The Economy of Ethiopia - London
Gülke, Peter
1980 Mönche, Bürger, Minnesänger: Musik in der Gesellschaft des europäischen Mittelalters, Leipzig
Günther, Robert
1970 Gedanken und Initiativen zur Forschung der äthiopisch-orthodoxen Kirchenmusik, in: Bericht über den
internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn
1977 Zur Frage der historischen Dimension in der Musikkultur der Niloten. - in: Mitteilungen der Deutschen
Gesellschaft für Musik des Orients 14. - Hamburg - S. 28-39
Haberland, Eike
1966a Kleine Landeskunde von Äthiopien. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft
10/XIX. - Hrsg. Hans Kramer. - S. 6-14. - Oktober
1966b Dreißig Völker und zehn Sprachen. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft
10/XIX. - Hrsg. Hans Kramer . - S. 68-75. - Oktober
Hager Fikir Theatre
1985 The 50th Anniversary of Hager Fikir Theatre from 1935-1985. - Journal prepared for the 50th Anniversa-
ry. - Addis Abeba
Hailemariam, Goshu
1969 Music through the Years. - In: Addis Reporter. - Vol. 35 - No. 25-36. - Addis Abeba - S.17-19
Handbook
1971 Area Handbook for Ethiopia - Co-Authors-Irving Kaplan and others - Washington D.C.
Hannick, Christian
1980 Ethiopian rite: Music of the ...- In: The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. - Bd. 6. -
S. 272-275
Hartmann, Josef
1980 Amharische Grammatik - Bd. 3 - Wiesbaden
Heinrich, Wolfgang
1984 Ethnische Identität und nationale Integration: Eine vergleichende Betrachtung traditioneller Gesellschafts-
systeme und Handlungsorientierungen in Äthiopien. -Vorstand des Instituts (Hrsg.). - Göttingen
Helfritz, Hans
1966 Auf den Spuren der Königin von Saba. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien
Heft 10/XIX. - Hrsg. Hans Kramer . - S. 15-20 - Oktober
Hickmann, Hans
1949-51 Afrikanische Musik. - In: Musik in Geschichte und Gegenwart Bd. 1. - Kassel und Basel 1949-51 - S. 123-
132
1989 The Historical Geography of Ethiopia-From the First Century AD to 1704. - R. Pankhurst (Hrsg.). London.
Holm, Hartwig
1966 Meneliks Lager - die neue Blume. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft
10/XIX. - Hrsg. Hans Kramer . - S. 42-44. - Oktober
Hornbostel, E.M.
1928 African Negro Music. - In: Africa 1(1). - S. 30-62
1986 Tonart und Ethos: Aufsätze zur Musikethnologie und Musikpsychologie. - Ch. Kaden/Erich Stockmann
(Hrsg.). - Leipzig
Jähnichen, Gisa
1992 Extensive Ornamentierung: Notizen zu einem Entwicklungsphänomen in der Traditionellen Vietnamesi-
chen Musikpraxis. - In: Studies in Ethnomusicology. - No. 2 Oriental Music. -
Berlin - S. 2-93
1997 Studien zu traditionellen vietnamesischen Instrumentalpraktiken des hát a dao und des ca vong co - In:
Schriften und Dokumente zur Politik, Wirtschaft und Kultur Vietnams, Nr. 7 - 2 Bde. - Berlin
1995a "Sie sangen so jung..."- musikalische Erfahrungen junger Namibier im und nach dem Exil. - Berichte aus
dem ICTM-NK Deutschland. Nr.5 - Marianne Bröcker (Hrsg.) - Bamberg. - S.22-35
1995b Uunona imbeni, Namibian children songs and dances. -Hrsg. mit Herbert Zinke - Berlin/Ascherlsleben
1999 Die Chivoti der Giriama. - Berichte aus dem ICTM-NK Deutschland. Nr.6 - Marianne Bröcker (Hrsg.) -
Bamberg. - im Druck
Jungraithmayr, Hermann
1983 Funktion und Bedeutung der musikalischen Tonhöhen in afrikanischen Tonsprachen. - In: Musik in Afri-
ka. -A. Simon (Hrsg.). - Berlin - S. 66 - 71
Jones, Arthur M.
1954 African Rhythm. - In: Africa. - Vol. 24, No. 1. - January 1954. - Reissiued as a pamphlet by the Centre for
International Briefing, The Castle · Farnham · Surrey · England
1959 Studies in African Music, 2 Bände. - London
Kaplan, Irving
1971 Area Handbook for Ethiopia. - Co-Authors. - Washington D.C.
Kauffmann, Robert
1980 African Rhythm. - A Reassessment. - In: Ethnomusicology. - Middletown - S. 393-415
Kebede, Ashenafi
1967 The Krar. - In: Ethiopia Observer. - Vol. 11; No. 3. - Addis Abeba - S. 154-161
1971a The Music of Ethiopia: Its Development and Cultural Setting. - Ph.D. Dissertation. - Wesleyan Universi-
ty - Ann Arbor
1971b Zemenawi Musica: Modern Trends in Traditional Secular Music of Ethiopia. - In: The Black Perspecitve
in Music. - E. Southern (Hrsg.). - New York - S. 289-301
1975 The Azmari Poet-Musician of Ethiopia. - Musical Quarterly. Nr.61
1977a The Bowl-Lyre of Northeast Afrika. - Krar: The Devil's Instrument. - in: Ethnomusicology Vol. 21/3,
Ann Arbor · Michigan. - S. 379-395
1977b The Krar. - In: Ethiopian Observer. - Vol. 11/No. 3. - S. 154 - 161
1979/80 Musical Innovation and Acculturation in African Music. - in: African Urban Studies 6. - S. 77-88
1980 The Sacred Chant of Ethiopian Monotheistic Churches: Music in Black Jewish and Christian Communi-
ties. - In: The Black Perspective of Music. - Vol. 8/ No. 1. - New York - S. 21-34
1982 Amhara Music. - in: Musikgeschichte in Bildern. - Bd. 1/10. - W. Bachmann (Hrsg.). - Ostafrika. Leipzig
- S. 58-67
1989 Roots of Black Music: The Vocal, Instrumental and Dance Heritage of Africa and Black America. -
Florida
Kebede, Ashenafi und K. Suttner
1969 Ethiopia: The music of the coptic church. - Berlin
Kidane, Girma (siehe auch Girma, Kidane) und Wilding, Richard
1976 The Ethiopian Cultural Heritage. - Addis Abeba. - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1984 u.Z.
Kmberlin, Cynthia Tse
1978 The bägäna of Ethiopia. - In: Ethniopianist Notes. - Vol. 2 - No. 2. - Michigan - S. 13-29
1980 The Music of Ethiopia. - In: Musics of many Cultures. - Elizabeth May (Hrsg.). - Berkeley · L.A. · Lon-
don. - S. 232-252
1989 Ornaments and their Classification as a Determinant of Technical Ability and Musical Style. - In: African
Musicology. - Current Trends Bd. 1. -Jacqueline Cogdell Djedje / W. G. Carter (Hrsg.). - Los Angeles - S.
265-305
1991 What am I to be? Female, Male Neuter, Invisible... Gender Roles and Ethnomusicological Field Work in
Africa. - In: The World of Music. - Bd. 33/Nr. 2. - Berlin - S. 14-34
1993 Ethiopian Music Traditions and Transitions: Event as a catalyst for Change. - A. Euba and C. Tse Kimber-
lin (Hrsg.). - In: Intercultural Music. - Bd. 1. - Bayreuth
1993 Make Army Tanks for War, into Church Bells for Peace: Musik and other Symbols of Ethiopia in the
1990's. - Konferenzbericht. - Berlin
Kimberlin, Tse Cynthia & Kimberlin, Jerome
1984 The Morphology of the masinqo: Ethiopia's Bowed Spike Fiddle, selected Reports of Ethnomusico-logy. -
Bd. 5. - K. Nketia / Jacqueline Cogdell Djedje (Hrsg.). - California University. - Los Angeles - S. 249-262
Kimberlin, Cynthia Mei-Ling
1976 Masinqo and the Nature of Qenet. - Dissertation. - Los Angeles
Kubik, Gerhard
1982 Ostafrika: Musikgeschichte in Bildern. - W. Bachmann (Hrsg.). - Leipzig - S. 252
1983 Beziehungen zwischen Musik und Sprache in Afrika. - In: Musik in Afrika. - A. Simon (Hrsg.). - Berlin -
S. 49 - 57
1988 Zum Verstehen afrikanischer Musik. - Leipzig
1994 Theory of African Music. - Bd.1. - Wilhelmshaven
1997 Ostafrika. - in: MGG, Sachteil Bd. 7. - Kassel. - Sp. 1166 - 1175
Lah, Ronald
1980 Ethiopia. - In: The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. - Bd. 6. - S. Sadie (Hrsg.). - London
· Washington D.C. · Hongkong. - S. 267-272
Lapiso, Dlebo (siehe auch Dlebo, Lapiso)
1982 Yä Ityopia Räjjim Yä Hizb Ina Yä Mängist Tarik (Die lange Geschichte der äthiopischen Bevölkerung
und Regierung). - Bd.1. - Addis Abeba
Laurence, Picken
1957 A Note of Ethiopic Church Music. - in: Acta Musicologica. - Bd. 29/1. - Cambridge.
Lemma, Tesfaye (siehe auch Tesfaye, Lemma)
1975 Ethiopian Musical Instruments. - Addis Abeba.
Leugenberger, Hans
1966 Land der verbrannten Gesichter. - In: Das Monatsheft der Städte und Landschaften. - Äthiopien Heft
10/XIX. - Hrsg. Hans Kramer . - S. 5-6. - Oktober
Levine, Donald Nathan
1965 Wax and Gold: Tradition and Innovation in Ethiopian culture. - Chicago
1974 Greater Ethiopia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society. - Chicago
Lipsky, George A.
1962 Ethiopia: Its People, Society and its Culture. - New Heaven
Lydall, Jean und Ivo Strecker
1979 The Hamar of Southern Ethiopia. - Arbeiten aus dem Institut für Völkerkunde der Universität zu Göttin-
gen. Bd.12-14. - Hohenschäftlarn
Martin, György
1987 Charakteristik und Typen der äthiopischen Tänze. - In: Musikkulturen in Afrika. Erich Stockmann
(Hrsg.). - Berlin - S. 252-281
Mengisteab, Kidane (siehe auch Kidane, Mengisteab)
1990 Ethiopia. Failure of Landreform and Agricultural Crisis. - New York · Westpoint-Connecticut & London
Merriam, Allan P.
1964 The Anthropology of Music. - Evanston
1965 Music and Dance. - In: The African World: A Survey of social Research. - Robert A. Lystad (hrsg.). -
New York (1965). - S. 452-468
1977 Definitions of Comparative Musicology and Ethnomusicology: An Historical-Theoretical Perspective. -
In: Ethnomusicology Vol. 21. - S. 189 - 204
1982a African Music. - In: African Music in Perspective. - A. Merriam (Hrsg). - New York · London-S. 65-108
1982b African Musical Rhythm and Concepts of Time-Reckoning. - In: African Music in Perspective. -
A. Merriam (Hrsg.). - S. 443-461
1982c Traditional Music in Black Africa. - In: African Music in Perspective. - A. Merriam (Hrsg.). - S. 135-153
Meyer, Andreas
1997 Afrikanische Trommeln - West- und Zentralafrika. - Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde
Berlin, Neue Folge 65, Abteilung Musikethnologie IX. - Berlin
Misginna, Haile-Michael (siehe auch Haile-Michael, Misginna)
1958 Betrothal and Marriage Customs in Endärta. - in: Ethnological Society. - Bulletin Nr. 8. - July, Addis
Abeba - S. 49-63
Murphy, Dervla
1994 Im Land des Löwenkönigs (Übersetzung) - München
Nettl, Bruno
1964 Theory and Method in Ethnomusicology. - London
Nketia, J.H. Kwabena
1962 The Problem of Meaning in African Music. - in: Ethnomusicology Bd. 6/ Nr. 1 -
S. 1 – 7.
1964 Unity and Diversity in African Music: A Problem of Synthesis. - In: Proceedings of the First International
Congress of Africanist. - New York - S. 256 - 263
1965 The Interrelations of African Music and Dance. - in: Studia Musicologica-Academiae Scientiarum Hunga-
riacae, Budapest - S. 91-102
1966 Artistic Values in Traditional Music. - Proceedings of a Conference held in Berlin from 14th-16th July
1965. - Berlin - S. 34-48
1972 The Present State and Potential of Music Research in Africa. - In: Perspectives in Musicology:
The Inaugural Lectures of the Ph. D. Program in Music at the City University of New York. - Hrsg. Barry
S. Brook; Edward Downes; Sherman van Sokema. - New York - S. 270 - 284
1974 The Music of Africa. - 1979 ins Deutsche übersetzt von Claus Raab. - London
1975 Understanding African Music. - In: National Centre for the performing Arts. - Quarterly Journal. - Bd. 4,
Nr. 2. - Bombay
1976 The Place of Traditional Music and Dance in Contemporary African Society. - In: The World of Music. -
Bd. 18, Nr. 4. - Mainz
1982 Developing Contemporary Idioms out of Traditional Music. - In: National Centre for the Performing Arts.
- Bd. 11, Nr. 1 - S. 1-13
1987a Musik in afrikanischen Kulturen. - in: Musikkulturen in Afrika. - E. Stockmann (Hrsg.). - Berlin - S. 9-43
1987b Zur Geschichtlichkeit der Musik in Afrika. - In: Musikkulturen in Afrika. - E. Stockmann (Hrsg.). - Berlin
- S. 44 - 61
Otho, P. Rink
1964 Methodology for the Masenqo. - Addis Abeba.
Pankhurst, Richard
1982 History of Ethiopian Towns from the Middle Ages to the early 19th Century. - E. Hammerschmidt
(Hrsg.) - Äthiopische Forschungen. - Bd. 8. - Wiesbaden
Patterns of Progress
1968 Music, Dance and Drama. - Ministry of Information (Hrsg.). - Book 9. - Addis Abeba
Powne, Michael
1968 Ethiopian Music. - London
Praetorius, Franz
1972 Die amharische Sprache. - Leipzig; Berlin 1965; Halle 1879
Richter, Renate
1987 Lehrbuch der amharischen Sprache. - Leipzig
Sachs, Kurt
1959 Vergleichende Musikwissenschaft: Musik der Fremdkulturen 3; neubearbeitete Auflage. -
Bd. 2. - Heidelberg
Salama
1987 Säbatu Mistiratä Bäte Kiristian (Die sieben Kirchengeheimnisse). - Nr. 10. - Köln
Sarosi, Balint
1967 The Music of Ethiopian Peoples. - In: Studia Musicologica. - Bd. 9. - Budapest - S. 9-19
Seeger, Anthony
1986 The Role of Sound Archives in Ethnomusicology Today. - In: Ethnomusicology Vol. 30. -
S. 261 - 276
1992 Ethnomusicology and Music Law. - In: Ethnomusicology 36(3). - S. 345 - 349
1996 Ethnomusicologists, Archives, Professional Organizations, and the Shifting Ethics of Intellectual Property.
- In: Yearbook for Traditional Music. - Vol. 30. - S. 87 - 105. Kingston, Ontario
Shack, Willam Alfred
1974 The Central Ethiopians. - London
Shelemay, Kaufmann Kay
1977 The Liturgical Music of the Falasha of Ethiopia. - Michigan
1980 Historical Ethnomusicology, Reconstructing Falasha Liturgical History-In: Ethnomusicology 14. Michi-
gan
1982 The Music of the Lalibeloc: Musical Medicants in Ethiopia. - In: Journal of African Studies. - Bd. 9/ Nr. 3.
- Washington
1989 Music, Ritual and Falasha History. - Michigan
Schubert, Werner
1991 Die Landwirtschaft in Äthiopien. - Institut für Ausländische Landwirtschaft und Agrargeschichte. Nr. 1. -
Berlin
Simon, Artur
1978 Probleme, Methoden und Ziele der Ethnomusikologie. - In: Jahrbuch für musikalische Volks- und Völker-
kunde. - Köln - S. 77-79
1983 Musik in afrikanischen Besessenheitsriten. - In: Musik in Afrika. - Artur Simon (Hrsg.) -
S. 284-296
1989 Trumpet and Flute Ensembles of the Berta People in the Sudan. - in: African Musicology; Current Trends.
- Fs. für J.H. Kwabena Nketia. - Jacqueline Cogdell Djedje / W.G. Carter (Hrsg.). -Los Angeles - S.183-
217
1991 Sudan City Music. - in: Populäre Musik in Afrika. - Veit Erlmann (Hrsg.). - Berlin - S.165-180
1992 Some aspects of tonal structure in Egyptian folk music. - In: Regionale maqam-Traditionen in Geschichte
und Gegenwart. - Jürgen Elsner/Gisa Jähnichen (Hrsg.). - Bd.2 - Berlin - S.464-479
Statistisches Jahrbuch
1991-93 Statistisches Jahrbuch für das Ausland. - Statisches Bundesamt (Hrsg.). - Wiesbaden 1991-1993
Tadesse, Eshete (siehe auch Eshete, Tadesse)
1958 Preparation of täg among the Amhara of Säwa. - In: Ethnological Society. - Bulletin Nr. 8. - July, Addis
Abeba - S. 101-110
Teffera, Atsede
1988a Yäfasika bäal akäbaber bäsäqotana akababiwa (fasika-Feier in Säqota und Gegen). - Säqota/Wällo/ hier
nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./. - S. 1-7
1988b Bäsäqota Ina Akababiwa Yäminägäru Yätimqät zäfän Gitimocna Yizotawoc Qisawi Tintäna (Inhalt und
Form von Gesangstexten der Timqät-Feier in Säqota und Gegend). - Säqota/Wällo/hier nach dem äth.
Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./ - S. 8-18
Teffera, Timkehet
1994 Musik im Zentralen Hochland Äthiopiens. - Diplomarbeit Humboldt-Universität zu Berlin - Berlin
1997 Dokumentation zur Feldforschungsreise und zu den Ton-/Bildaufnahmen in Äthiopien 1997. - Völkerkun-
demuseum Berlin, Tonarchiv-Signatur: 0345./Videoarchiv-Signatur: 062. - Berlin
1999 Kinder als Musiker - Verständnis und Missverständnis theoretischer Systeme. - in: Berichte aus dem
ICTM-NK Deutschland. Nr.6 - Marianne Bröcker (Hrsg.) - Bamberg. - S. 139 - 152
Tesfaye, Nigussie
1988 Yämisraq Gojjam Mästädadir Zon Yägabica Siriat (Hochzeitstradition im östlichen Teil Gojjams). - Däbrä
Marqos/Gojjam/hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z./ - S. 1-23
Tešome, Yared
1989 Yäwag Yähazän Siriat Gitmoc (Trauertexte zu Trauerzeremonien in Wag) /hier nach dem äth. Kalender
angegeben; ca.1997 u.Z./. - S. 1-20
Tolesa, Addissu
1996 The Historical Transformation of a Folklore Genre: The Geerarsa National Literature of the Oromo in the
Context of Amhara Colonialization in Ethiopia. - Ann Arbor
Tracy, Hugh
1980 African Music Society. - In: The new GROVE Dictionary of Music and Musicians. - S. Sadie
(Hrsg.). - London - S. 153
Trimmingham, Spencer J.
1965 Islam in Ethiopia. - London
Ullendorf, Edward
1960 The Ethiopians - An Introduction to Country and People. - New York · Toronto
1968 Ethiopia and the Bible. - London
Wachsmann Klaus, Cooke, Peter
1980 Africa. - In: The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. - S. Sadie (Hrsg.).-London, S. 144-153
Wägayehu, Gäbäyähu
1987 Bahilawi Yägabica Siriat Bämec Ina Acäfär Wärädawoc (Hochzeits-tradition in Mäca und Acäfär-
Gebieten). - Bahir Dar/Gojjam /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1995 u.Z./ - S. 1-30.
Wängler, Hans-Heinrich
1983 Über die Beziehungen zwischen gesprochenen und gesungenen Tonhöhen in afrikanischen Ton-sprachen.
- In: Musik in Afrika. - A. Simon (Hrsg.). - Berlin - S. 58 - 65
Weir, Shelagh
1985 Qāt in Yemen: Consumption and Social Change. - London: British Museum Publications
Wolf, Leslau
1995 Reference Grammar of Amharic. - Wiesbaden.
Yä Ityopia Hig Mäsihet - Äthiopische Zeitschrift für Gesetze
1959 (Äthiopische Zeitschrift für Gesetze) Bd. 3. - Nr. 2. - Addis Abeba/hier nach dem äth. Kalender
angegeben; ca.1967 u.Z./. - S. 379-389
Yä Ityopia Nigussa Nägäst Mängist Yäfitiha Bhär Hig
1952 (Gesetze des äthiopischen Kaiserregiemes). - Addis Abeba/hier nach dem äth. Kalender angegeben;
ca.1960 u.Z./.
Yä Mäsihaf Qidus Mäzgäbä Qalat
1972 (Bibelwörterbuch). - Äthiopische Bibel-Organisation (Hrsg.). - Addis Abeba - /hier nach dem äth. Kalen-
der angegeben; ca.1967 u.Z./
Zemp, Hugo
1996 The/An Ethnomusicologist and the Record Busines. In: Yearbook for Traditional Music. - Vol. 28.
S. 36 - 56
Zinke, Sabine
1992 Neue Gesänge der Ovambo: Musikethnologische Analysen zu namibischen Liedern. - Berlin
1993 Zu strukturellen Gestaltungselementen in Musikbogenliedern der Ovambo- in: Studies in Ethno-
musicology, Nr. 3 - Jürgen Elsner und Gisa Jähnichen (Hrsg.) - Berlin - S. 3-32
1994 Der Musikbogen in der traditionellen Musiziertpraxis der Ovambo. - in: Berichte aus dem ITCM-NK Nr.4
. - Marianne Bröcker (Hrsg.). - Bamberg - S. 29-42
Mündliche Mitteilungen und Gespräche (Sämtliche Signaturen beziehen sich auf die Sammlung "Teffera-Äthiopien 97" im Tonarchiv des Völkerkundemu-
seums SMPK Berlin)
Abebe, Getachew
1997 ca. 36 Jahre alt, geb. in Bahər Dār/Region Goğām, wohnhaft in Addis Abäba; Bräutigam und Infor-
mant/Hochzeitsfeier am 11.5.97/Bahər Dār (vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-01; Nr. 0345.001/12, 13, 14a,
14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Adane, Gebremariam
1997 ca. 30 jähriger wašənt-Spieler, geb. und wohnhaft in Gondär, Interview:
- qəñət-Tonreihe und
Aufnahme von Hirtenliedern (Instrumentalstücke) gespielt mit der Flöte wašənt am 21.05.97 sowie am
23.05.97 in Gondär (vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-04; 0345.004/0+1 und 0+2; D-05 0345.005/7, 8, 9, 10;
Ä97 SV-06 ca. 30 Minuten, Ä97 SV-07 ca. 17 Minuten und Ä97 SV-08 ca.von 12:57 bis 30:18)
Adane, Mekwannent
1997 ca. 15 jähriger, halbproffessioneller masinqõ-Spieler und Sänger, geb. und wohnhaft in Bahər Dār/Region
Goğām; Interview am 9.5.97 in Bahər Dār:
- qəñət-Tonreihe (vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-02; 0345.002/11).
Admassu, Amarech
1997 50 jährige Frau, geb. in Gondär, wohnhaft in Addīs Abäbā. Interview am 05.05.1997 in Addīs Abäbā:
- u.a. sanfte Sologesänge/əngūrgūrõ,
- Klagelieder/läqsõ,
- Bessessenheitsritus/žār (siehe Gesangsbeipiel, Bd. II, Lied Nr. 73; S. 149 und Textbeispiel Bd. I; S. 44)
und über den Hochzeitsbrauch und die -gesänge der amārā in Gondär mit Gesängsbeispiele ohne Begleitung
(vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-02; Nr. 0345.002/8 sowie Ä97 D-10 Nr. 0345.010/02-06).
Ali, Anisa
1994 29 jährige Studentin, geb. in Harär/Region Harär; seit 1998 wohnhaft in Addīs Abäbā; Studium/ Lebens-
mitteltechnologie in Berlin von 1987 bis 1998; ethnische Zugehörigkeit harärē. Interview:
- Hochzeitsbräuche und -gesänge der harärē (vgl. u.a. S. 75, 79, 81f. und 99) ohne Aufnahme. Jedoch habe
ich von ihr eine Videoaufnahme über den Verlauf einer Hochzeitsfeier ihrer Schwester, Hayatt, und Musik-
kassetten erhalten (keine analytische Aufnahme), die mir dazu verholfen hat, eine Gegenüberstellung zwi-
schen der Kultur dieser Ethnie und der Kultur der amārā, insbesondere der Hochzeitsriten zu ermöglichen.
Amare, Bitew
1997 26 jähriger Mann; wašənt-Spieler; geb. und wohnhaft in Gondär; Interview am 23.05.97 in Gondär:
- qəñət-Tonreihe und
Aufnahme von verschiedenen Instrumentalstücken gespielt mit der Flöte wašənt (vgl. Teffera Ä97 D-05;
0345.005/11)
Asmamaw, Netsanet
1997 29 jährige Frau; geb. und wohnhaft in Gondär/Region Gondär; Kontaktperson, Informantin und Reisebe-
gleiterin während der Forschungsreise in Gondär im Jahre 1997 (siehe u.a. Asmamaw, Rahel, Amare,
Bitew, Adane, Gebremariam, Adane, Mekwannent)
Asmamaw, Rahel
1997 14 jähriges Mädchen, geb. und wohnhaft in Gondär/Region Gondär; Interview am 21.05.97 in Gondär:
- Kindergesänge
Ton- und Videoaufnahmen ohne Instrumentalbegleitung (vgl. Teffera Ä-97 D-05; 0345.005/1)
Astatke, Mulatu
1993
1997
und
1999
ca. 59 Jahre, wohnhaft in Addīs Abäbā; bekannter Äthiopischer Musiker; hat der für den Aufbau und die
Bekannmachung der traditionellen Musik Äthiopiens eine große Rolle gespielt. Heutzutage ist er allerdings
weniger im Bereich der traditionellen Musik tätig. Herr Astatke versucht durch seine Experiementen traditi-
onelle Musikinstrumente Äthiopiens mit fremden (u.a. europäische) Musikinstrumenten zu verschmelzen
und daraus völlig erneute Klangbilder zu erzeugen. Er hat für mich wichtige Kontakte in Äthiopien herge-
stellt, so dass ich von diesen Personen durch Interviews wichtige Informationen sammeln konnte.
Äthiopisches Bildungsministerium
1997 Materielle Unterstützung des Bildungsministeriums in Addīs Abäbā (Zentrale) sowie den Zweigstellen in den
Regionen Goğām, Gondär und Wällõ.
Bahiru, Dinkineš
1996 Ca. 55 jährige Frau, wohnhaft in Addīs Abäbā; ethnische Zugehörigkeit = oromõ/Region Šäwā; Interview im
Jahre 1996 in Berlin:
- Tanztypen der oromõ (siehe Abschnitt 4.4.6; S.183); keine Aufnahme.
Batuma
1997 Batuma ist die Abkürzung für Bahəlna Turisəm Ma'əkäl = Kultur- und Tourismus-Büro.
Dies ist eine der Zweigstellen des Kulturministerium, die vor einigen Jahren in den verschiedenen Gegenden
Äthiopiens Kultur- und Tourismus-Büro eröffnet haben, mit dem Ziel, die Kulturen der jeweiligen Region
zu dokumentieren (d.h. mit Hilfe von Ton- und Videoaufnahmen, Fotomate-rialien, Artikeln usw.).
3 Musikkassetten/MC über verschiedene weltliche und skrale Musik aufgenommen auf diversen Feierlich-
keiten in den Gegenden Goğām und Gondär (vgl. Teffera Ä-97 D-12; 0345.012/1-27; Ä97 D-97;
0345.013/1-7 und Ä97 D-14, 0345.014/1); ca. 200 Seiten Schriftmaterial in Kopie habe ich u.a. über fol-
gende Themen erhalten:
Ayen, Shitu; Engida, Minyicil; Alene, Yaräga
- Yä Awi Hizb Bahilawi Gäsitawoc Tinatawi Sihuf (= Sitten und Bräuche des Awi-Volkes). - Bahir
Dar/Gojjam 1988 - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1996 u.Z.;
Birara, Misige
- Lä Aqmä Adam Saydärsu Gabica (= Heiraten im unreifen Alter). - S. 1-7 - Bahir Dar/Gojjam - /hier nach
dem äth. Kalender angegeben; ca.1988 u.Z./. und
- Yalämätän Digis Lämasqärät Yähulacinim Tirät (= Das Vermeiden von hohen Kosten für verschiedene
Feiern). - S. 8-16 - Bahir Dar/Gojjam - /hier nach dem äth. Kalender angegeben; ca.1988 u.Z./.
Bei der Gelegenheit möchte ich meinen Dank an dem Leiter des Kultur und Tourismus-Büros von Bahir
Dar, Herrn Alemayehu Gebretsadik, ausrichten.
Birhan, Addisu
1997 Ca. 16 jähriger Junge; kərār-Spieler; geb. in Sabia; wohnhaft in Gondär/Region Gondär; Interview am
21.5.97 in Gondär:
- qəñət-Tonreihe
Ton- und Videoausnahmen allgemeiner weltlicher Instrumentalstücke gespielt auf der Leier kərÉr (vgl.
Teffera Ä97 D-05; 0345.005/2 und Ä97 SV-07 ca. 13 Minuten)
Berhanu Abäbaw
1997 Ca. 20 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Bahər Dār/Region Goğām; Hotelangestellter; Kontaktperson bezüg-
lich Hochzeitsfeiern in Bahər Dār (vgl. Beschreibung Abebe, Getachew)
Debissa, Alemu
1997 Ca. 38 Jahre alt, wohnhaft in Addīs Abäbā; Bräutigam/Hochzeitsfeier am 03.05.97/Addīs Abäbā; Video-
bzw. Tonaufnahmen (siehe auch Genet; vgl. Teffera Ä97 D-01; 0345.001/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und
Ä97 V8-01 ca. 14 Minuten).
Fanta, Alemayehu
1993 ca. 60 Jahre alt; wohnhaft in Addīs Abäbā; masinqõ-Lehrer an der Yared Musikschule; bägäna-Spieler;
Sänger weltlicher und sacraler Gesänge (z.B. religiöse Preislieder) in Begleitung von beiden Instrumenten;
Interview im Jahre 1993:
- Instrumentenbau und Spieltechnik der masinqõ
Fotoaufnahmen (siehe Teffera 1994); keine Tonaufnahme
Gebre-Hiwot, Lemma
1993 ca. 65 Jahre, verstorben 1996; lebte in Addīs Abäbā; war masinqo-Spieler und bekannter Sänger traditionel-
ler Gesänge u.a. Hochzeitslieder und Kriegsgesänge in Begleitung seines Instruments. In vielen Hochzeits-
feiern wurde er entweder bestellt oder seine Gesänge wurden mit Hilfe von MC auf Hochzeitsfesten gespielt.
Er hat auch das Leben des ažmārī verkörpert und war einer der Persönlichkeiten, die die traditionellen Knei-
pen in den letzten 20 Jahren durch ihre Auftritte belbt haben. Mit ihm wurde ein Interview im Jahre 1994
durchgeführt (ohne Aufnahme), die auf die Hochzeittradition der amārā beruht.
Gebreyesus, Bayru
1997 ca. 70 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Mäqälē/Region Təgrāy; Interview am 18.06.1997 in Addīs Abäbā:
- Hochzeitsbräuche der təgrāy und die der amārā mit den charakteristischen religiösen Zusammenhängen
und Bedeutungen (vgl. u.a. Abs. 2.1.3.2., S. 70f. Abs. 2.2.1., S. 74f, 76, Abs. 2.2.2., S. 79, Abs. 2.3.4., S.
96, Abs. 2.4.1., S. 99 und Abs. 2.4.2., S. 103; vgl. auch Aufnahme Teffera Ä97 D-07; Nr. 0345.007/22
sowie Ä97 D-8 Nr. 0345.008/1).
Gebreyesus, Ermias (Priester)
1996 ca. 56 Jahre alt, wohnhaft in Addīs Abäbā; Priester und Kirchenmusiklehrer an der Yared Musikschule; 1996
Interview in Addīs Abäbā:
- die äthiopische Kirchenmusikgeschichte und -theorie, vor allem über die drei wichtigen Gesangsstile der
äthiopisch-orthodoxen Kirchenmusik
- gə’əž, (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/2a),
- əžəl (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/3a) und
- araray (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/4a)
Tonaufnahme ohne Instrumentalbegleitung; (vgl. Gesamtaufnahme Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/1-5 und
Ä97 SV-11 30:00Minuten; siehe auch Abschnitt 1.4.2.1.- Abbildungen 20 - 22; S. 51-53)
Gelaw, Melaku
1993 ca. 59 jähriger kərār-Spieler und Lehrer an der Yared Musikschule, wohnhaft in Addis Abeba; Interview in
1993 in Addis Abeba:
- die Leier kərār und
- die traditionelle Musik Äthiopiens im allgemeinen
Fotoaufnahmen (siehe Teffera 1994); keine Tonaufnahme
(vgl. Beschreibung in Abschnitt 1.3, insbesondere S. 23-26).
Genet
1997 ca. 30 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Addīs Abäbā; Braut/Hochzeitsfeier am 03.05.97/Addīs Abäbā; Video-
und Tonaufnahmen (siehe auch Debissa, Alemu; vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-01; 0345.001/1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 und Ä97 V8-01 ca. 14 Minuten).
Getahun, Tirusäw (Braut/Informant/Informantin
1997 ca. 30 Jahre alt, geb. in Bahər Dār/Region Goğām, wohnhaft in Addīs Abäbā; Braut/Hochzeitsfeier am
11.5.97/Bahər Dār (siehe Abebe, Getachew).
Haile, Fekadu
1997 ca. 40 jähriger Lehrer einer Elementarschule, geb. und wohnhaft in Gondär/Region Gondär; Informant und
Reisebegleiter; Kontakte u.a. zu ažmārī bzw. traditionellen ažmārī-Häusern (vgl. Tonaufnahmen Teffera
Ä97 D-05; 0345.005/12, 13) und zu einer Wahrsagerin (vgl. Ä97 D-05; 0345.005/6) hergestellt.
Haile, Tesfaye (Kolonel)
1996 ca. 60 Jahre alt; wohnhaft in Addīs Abäbā; Interview ohne Tonaufnahme in 1996 in Addis Abeba:
- verschiedene Formen der Eheschließung im Hinblick auf die amārā Kultur (siehe Abschnitt 2.1.2.5, S. 65f.
; 2.1.3.2., S. 70f. und 2.1.3.3., S. 71).
Institute of Ethiopian Studies/Institut für äthiopische Forschungen/Addīs Abäbā-Universität
1993
1997
Nach Beendigung meiner Ausbildung im Jahre 1982 aus der Yared Musikschule war ich in diesem Institut
fünf Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig und verantwortlich für die traditionellen Musikinstru-
mente, die aus den verschiedenen Gegenden Äthiopiens gesammelt wurden. Nach fünf jähriger Tätigkeit in
1987 habe ich mit Hilfe des damaligen Institutdirektors, Dr. Tadesse Beyene, einen Studienplatz in die ehe-
malige DDR erhalten. Während meinen Forschungsaufenthalten in Äthiopien in den Jahren 1993 sowie 1997
bekam ich die nötige Unterstützung des Instituts, die Musikinstrumentensammlung zu fotografieren sowie
weitere Bilder von traditionellen Gegenständen aus der ethnographischen Sammlung aufzunehmen.
Siehe Teffera 1994 sowie die gegenwärtig vorliegende Arbeit Band 2:
S. 179-Beschreibung: S. 175-Nr. 21 und 22
S. 180-Beschreibung: S. 175-Nr. 28 und 29 und
S. 182 Beschreibung: S. 175-Nr. 37 und 38.
Die Fotomaterialien sind Privatsammlung.
Unter den Mitarbeitern, die mich unmittelbar für das Zustandekommen meiner Arbeit unterstützt haben sind
u.a.:
Herr Ahmed Zäkaria, gegenwärtig Kurator des Ethnographischen Museums
Dr. Girma Kidane, Kurator des Ethnographischen Museums von 1977 bis zu seinem Tod in 1994
Dr. Tadesse Tamrat
Dr. Tadesse Beyene
Dr. Bahru Zewdie und
Ato Degefu Leiter der Bibliothek des Instituts korrektur
Kinä, Tibebu
1996 Ca. 45 jähriger Kirchenmusiklehrer an der Yared Musikschule und Priester; wohnhaft in Addīs Abäbā; Inter-
view 1993 in Addīs Abäbā:
- äthiopisch-orthodoxe Kirchenmusik;
- die drei Gesangsstile der sakralen Musik und zwar
- gə’əž (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/6a)
- əžəl (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/6b) und
- araray (vgl. Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/6c)
Gesangsaufnahmen ohne Instrumentalbegleitung (siehe Teffera Ä97 D-17; Nr. 0345.017/6a-e; und Abschnitt
1.4.2.2.; Abbildung 23, S. 54).
MIDROC-Ethiopia
1997 MIDROC= Mohammed International Development Research and Organisation Companies
Diese in Äthiopien erst vor kurzem gegründete Investitionsgesellschaft hat meine Forschungsreise sowie
meinen Forschungsaufenthalt mit materiellen und finanziellen Mitteln unterstützt.
Sahilu Woldelioul
1991 Ca. 40 Jahre alt, geb. der Region Wällõ; wohnhaft in Addīs Abäbā; Bräutigam/Hochzeitsfeier am
5.01.1991/Addīs Abäbā (siehe Teffera, Helena)
Shambel, Mizanu
1997 13 jähriger, halb-proffessioneller masinqo-Spieler und Sänger; geb. und wohnhaft in Bahər Dār/Region
Goğām; Tonaufnahme von Unterhaltungsgesängen (Solo) am 10.5.97 in Bahər Dār (vgl. Aufnahme Teffera
Ä97 D-02; 0345.002/10, 12, 13, 14, 15, 16 und Ä97 V8-02 von 0:42:00 bis 0:54:09; Ä97 V8-02 von 0:32:36
bis 0:41:34 und von 0:42:00 bis 0:54:09 ).
Shariye
1993 Ca 70 järhiger Priester; geb. und wohnhaft in in Mänz/Region Šäwā; Interview 1993 in Addīs Abäbā:
- Hochzeitsbräuche der amārā in Mänz
keine Aufnahme
Siyoum
1997 Ca. 30 jähriger Hotelangestellter und Diakon; geb. und wohnhaft in Gondär/Region Gondär;,
Informant und Reisebegleiter; Kontakte u.a. zu Kirchen (vgl. Ton- und Videoaufnahmen auf Messegesänge
auf einem Kirchenfest in Gondär am 21.05.97 Teffera Ä97 D-03; 0345.003/0-1; Ä97 SV-06 ca. 25 Minu-
ten) hergestellt.
Takele Zerfu
1997 Ca. 38 jähriger Elementarschullehrer; geb. in Gondär und wohnhaft in Bahər Dār/Region Goğām; Interview
am 10.05.97 in Bahər Dār:
- Hochzeitstradition der amārā (vgl. Aufnahme Teffera Ä97 D-11; 0345.011/9)
Teffera, Gultu
1997 35 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Addīs Abäbā; Informant statistischer Daten u.a.
Standesamt in Addīs Abäbā und Addīs Abäbā Universität (Informationen über das äthiopische Gesetzbuch)
Teffera, Helena
1991
1993
1997
38 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Addīs Abäbā; Journalistin, Presse-Leiterin und Vorgesetzte des Executive
Büros von MIDROC-Ethiopia (siehe MIDROC); Braut/Hochzeitsfeier am 5.01.1991/ Addīs Abäbā; Materi-
elle und finanzielle Unterstützung geleistet insbesondere während der Forschungsreisen 1993 und 1997.
Tibebu, Menkir
1997 Ca. 20 Jahre alt, geb. und wohnhaft in Bahər Dār/Region Goğām; Student an dem Lehrer Colleage in Bahər
Dār; Kontaktperson bezüglich Hochzeitsfeiern in Bahər Dār (siehe auch Abebe, Getachew).
Teffera, Martha
1997 29 Jahre alt, geboren und wohnhaft in Addīs Abäbā; Informantin; Reisebegleiterin in den Regionen Goğām und Gondär vom 10.05.97 bis 25.05.97; Gesangsaufnahme in Addīs Abäbā am 5.5.97 und 27.5.97; diverse
sanfte Sologesänge ohne Instrumentalbegleitung wurden aufgenommen (vgl. Tonaufnahme unter der Signa-
tur Teffera Ä97 D-01, 0345.002/7 und D-06 0345.006/1-8; Ä97 V8-02 von 0:42:00 bis 0:54:09 )
Worke, Alemtsehay
1997 56 jährige Hausfrau, geb. in Abela/Region Sidamõ; wohnhaft in Addīs Abäbā; Kontaktehergestellt, mit de-
nen ich Interviews führen und Tonaufnahmen machen konnte (siehe z.B. Admassu, Amarech).
Yared Musikschule
1993
1997
Während meiner Forschungsaufenthalte 1993 sowie 1997 habe ich die Gelegenheit gehabt die traditionelle
Instrumentensammlung zu fotografieren und diese für meine Arbeiten als wissen-schaftliches Material zu
verwenden. (siehe Teffera 1994 sowie die gegenwärtig vorliegende Arbeit
Die Fotomaterialien sind Privatsammlungen. In diesem Augenblick danke ich insbesondere Herrn Bekele
Debre und Herrn Izra Abate für ihre unbürokratische Unterstützung.
Yeshigeta, Mekuria
1997 71 Jahre alt; geboren in Tägulät/Region Šäwā; wohnhaft in Addīs Abäbā; Interview am 26.06.1997:
- Hochzeitsbräuche der amārā aus dem Ort Tägulät/Region Šäwā mit den charakteristischen religiösen Zu-
sammenhängen und Bedeutungen (vgl. Abs. 2.1.3.1., S. 69ff., Abs. 2.2.1., S. 74ff., Abs. 2.2.2., S. 80, Abs.
2.3.3., S. 95, 97ff. und Abs. 2.4.2., S. 103; vgl. auch Aufnahmen Teffera Ä97 D-09; Nr. 0345.009/1 und Ä97
SV-12 - 30:00Minuten und SV-13 - 30:00 Minuten.
Zinke, Sabine
1992 Neue Gesänge der Ovambo: Musikethnologische Analysen zu namibischen Liedern. Diss. Berlin.
Eidesstattliche Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Berlin, den 28. Februar 1999
I
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
2. Band Anhang
I Anmerkungen zur amārischen Schrift 1
II Verzeichnis der Tonaufnahmen und Notationen 4
Nr.
1 abäbāwū babäbāwū layə [Blumen über Blumen] 8
2 abäğäš yäñā ləğə [Gut gemacht, unser Kind] 9
3 ağäbayē [Redundanz] 11
4 ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 12
4a ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 1. Abschnitt,
Gesangszeilen des awrāğ
18
4b ahūn dämäq/š abäbāyē [Jetzt strahlst du meine Blume] 2. Abschnitt,
Wechselgsangszeilen des awrāğ und der täqäbayõč
19
6 amõrā bäsämay siyayəš walä [Der Rabe sah dich vom Himmel herab] 20
7 amrwāl šägänū [Die Umgebung ist schön] 22
9 anāsgäbām sərgäñā [Wir lassen keinen Hochzeitsgast hinein] 24
11 arkā bälulāčäwu [Redundanz] 25
12 ašā gädawõ [Redundanz] 29
14 ašäwäynā wäynā [Redundanz] 31
16 atšäñwatəm wäy [Wollt ihr sie nicht hinausbegleiten?] 32
17 bähār ašəmäwu [Redundanz] 34
18 bālənğärē [Meine Freundin] 36
19 bəq bäy kägwadā [Komm aus dem Nebenzimmer] 38
20 bər ambār [Silbernes Armband] 40
21 čəbõ ayəmolām wägäbwā [Ihre Teille ist schmal] 42
22 ärä näy ətē [Oh, komm] 44
24 hay lõgā [Redundanz] 52
24a hay lõgā [Redundanz] Gegenüberstellung analoger Gesangszeilen 57
24b hay lõgā [Redundanz] Gesangsteil des 1. awrāğ 58
24c hay lõgā [Redundanz] Gesangsteil des 2. awrāğ 59
24d hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč 60
24e hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč, Gesang
vor den Verszeilen
61
24f hay lõgā [Redundanz] Wechselgesang des awrāğ und der täqäbayõč, Gesang
nach den Verszeilen
62
24g hay lõgā [Redundanz] Gesang binnen der Verszeilen, 2. Abschnitt 63
25 hēdäč alū [So ist fort, erzählt man] 64
26 65
27 Ist sie deine Begleiterin? Ist er
dein Begleiter?]
66
28 ələl balē ohõ [Redundanz] 68
30 əndalayəš [So, dass ich dich nicht zu sehen bekomme] 69
31 əndäw yämərū [Redundanz] 70
32 ənē alsätə 72
33 ənē alsätə 74
34 əradõ wäšäbā [Redundanz] 75
35 əšätē wäynā [Redundanz] 76
36 əswās lõmī nāt [Sie (die Braut) ist eine Zitrone] 81
37 əstī šälmūn [Bitte beschenken Sie uns] 83
38 əstī amtaw yädämūn šämā [Bring einmal das blutige Tuch] 85
40 ətē šänkõrē [Meine Schwester šänkõrē ] 86
41 əyäbälū yätätū žə 88
42 kēlawu täsäbärä [Das Tor ist entzwei] 89
44 kūrāt kūrāt [Stolz ! Stolz !] 90
45 lõmī talubāt [Werft Zitronen auf sie] 93
47 mähēdwā näwū [Sie geht] 94
48 mīžēw šəttõ amtā [Begleiter bring/gib uns Parfüm] 95
49 mīžew dəhā näwū [Der Begleiter ist arm] 96
II
50 mūšə 97
51 mūšərīt ləmäğī [Braut gewöhne dich] 98
54 nəbõ atənādäfī [Biene, Biene, stich nicht] 100
55 ohõ hõ munā [Redundanz] 102
56 sägurwā wärdõ wärdõ [Ihr Haar wallt herunter] 106
57 šäb əräb aläč mədə 107
58 šənätə [Redundanz] 110
61 wäläbē wäläbē [Redundanz] 111
62 wändəməyē [Mein Bruder] 112
63 yäbētä žämädū [Die Verwandtschaft] 113
64 yägwarõyē tenādām [Meine Gartenpflanze] 121
65 yäñāmā mūšərā [Unsere Braut/unser Bräutigam] 123
66 yänē abäbā näš [Du bist meine Blume] 125
67 yäšī gabəččā [Redundanz] 128
68 yäwäfē bər abäbā [Redundanz] 129
69 yäwäyən abäbāyē [Meine Weintraubenblüte] 130
70 132
71 yəžwāt bärärä [Er nimmt sie und rennt davon] 133
72 žäbänay mārəyē [Redundanz] 134
73 Besessenheitslied/Sologesang 135
74 wašənt-Instrumentalstück 137
75 təžətā-əngūrgūrõ/Sologesang 138
76 yämatəbälā wäfə/Sologesang 139
77 lalibälā-Gesang/Sologesang 141
78 hõya hõyē/Wechselgesang 142
79 abūnä-žäbäsämayāt/Sologesang 144
80 abäbāyē hoyē/Wechselgesang 146
81 əyõha abäbāyē/Wechselgesang 150
82 əyõha abäbāyē/Wechselgesang (s. Nr. 81, 2. Variante) 150
III Verzeichnis der Tonbeispiele (MC) 151
IV Glossar 155
1
I. Anmerkungen zur amārischen Schrift
Die amārische Sprache leitet sich aus der alten äthiopischen Kirchensprache gə'əž her, die vermutlich
seit dem 5. Jahrhundert v. Ch. existiert und heute noch in der äthiopischen Kirche verwendet wird.
Anhand von schriftlichen Zeugnissen wurde festgestellt, dass diese alt-äthiopische Kirchensprache
und deren Schrift in einer mordernen Form zum ersten Mal in der Region Tigray gefunden wurde und
zwar während der sogenannten axumitischen Periode. Die amarəñā-Schrift war ursprünglich eine
Konsonantenschrift, die aus einfachen Symbolen bestand, die, wie eine Zeichensprache, nicht ohne
interne Kenntnisse phonetisch umgesetzt werden konnte. Im Laufe der Zeit jedoch entwickelte sich
die Schrift dahingehend, dass zu den bereits vorhandenen Grundsymbolen sechs weitere Zusatzzei-
chen durch bestimmte Modifizierungen dieser hinzugefügt wurden (vgl. Hartmann 1980: 52).
Für ein Drittel der heutigen äthiopischen Bevölkerung ist die amarəñā-Sprache die Muttersprache.
Außerdem wird sie von vielen Ethnien bzw. in vielen Orten Äthiopiens als zweite oder dritte Sprache
verwendet (Richter 1987: 23). Heute hat sich die amarəñā-Schrift zu einer Silbenschrift entwickelt,
bei der sich jedes Symbol entweder aus einem Konsonanten + einem Vokal wie z.B. yā, nū, fõ und dē
{ያ ኑ ፎ und ዴ} oder aus einem Konsonanten +einem Hilfslaut w + einem Vokal wie z.B. fwā, qwā
und twā {Ð Ì und a} zusammensetzt (Hartmann 1980:60; Workineh 1966:21). Die heutige
amarəñā-Schrift besteht insgesamt aus sieben Vokalphonemen, die als a , ä , u , i , a , e , o bezeich-
net, in dieser systematischen Folge aufgelistet und praktisch verwendet werden (Richter 1987: 38).
Jedes einzelne Phonem besitzt ein typisches Merkmal, das eine wesentliche Rolle bei der Verände-
rung von Silben spielt. Ausgegangen von dem ersten Anfangssymbol des Syllabars (siehe vertikale
Reihe), erhalten die übrigen sechs aufeinanderfolgenden Symbole, die zu derselben Familie des Aus-
gangssymbols gehören, zusätzliche Zeichen, die verschiedene Vokale kennzeichnen und somit auch
unterschiedliche Bedeutungen tragen. Diese zusätzlichen Schriftzeichen werden durch das Anfügen
bzw. Anhängen von Strichen (- - -) oder Kringeln (o o o) an bereits vorhandene Schriftzeichen (d.h.
dem Ausgangssymbol) gebildet. Die Striche verlaufen entweder von links nach rechts oder von oben
nach unten. Es gibt keine Striche, die umgekehrt verlaufen. Die 7 Symbole werden unter den Ordnun-
gen 1. bis 7. klassifiziert und als gə'əž {ግ ዕ ዝ }, ka'əb {ካ ዕ ብ}, saləs {ሳ ልስ }, rabə' {ራብዕ }, haməs
{ሀ ምስ } sadəs {ሳ ድስ } und sabə' {ሳ ብዕ } bezeichnet. Im amārischen Syllabar gibt es weiterhin rund
26 Grundformen (Hartmann 1980:52) bzw. Anfangszeichen. Einige davon sind u.a. ha, lä, mä und rä
{ሀ ለ ሐ መ und ረ }. Diese Anfangszeichen, die der gə'əž-Ordnung (1. Ordnung) angehören, lassen
sich horizontal in die 7 Ordnungen untergliedern:
2
Die amārischen Schriftzeichen
1. gə'əž 2. ka'əb 3. saləs 4. rabə' 5. haməs 6. sadəs 7. sabə'
ha ሀ hu ሁ hi ሂ ha ሃ he ሄ hə ህ ho ሆ
lä ለ lu ሉ li ሊ la ላ le ሌ lə ል lo ሎ
ha ሐ hu ሑ hi ሒ ha ሓ he ሔ hə ሕ ho ሖ
ma መ mu ሙ mi ሚ ma ማ mሜ mə ም mo ሞ
sä ሰ su ሱ si ሲ sa ሳ se ሴ sə ስ so ሶ
rä ረ ru ሩ ri ሪ ra ራ re ሬ rə ር ro ሮ
sä \ su \# si œ! sa œ se œ@ sə | so ƒ
šä ሸ šu ሹ ši ሺ ša ሻ še ሼ šə ሽ šo ሾ
qä ቀ qu ቁ qi ቂ qa ቃ qe ቄ qə ቅ qo ቆ
bä በ bu ቡ bi ቢ ba ባ be ቤ bə ብ bo ቦ
tä ተ tu ቱ ti ቲ ta ታ te ቴ tə ት to ቶ
čä ቸ ču ቹ či ቺ ča ቻ če ቼ čə ች čo ቾ
ha ^ hu ^# hi ^! ha ` he ^@ hə ¯ ho ~
nä ነ nu ኑ ni ኒ na ና ne ኔ nə ን no ኖ
ñä ኘ ñu ኙ ñi ኚ ña ኛ ñe ኜ ñə ኝ ño ኞ
a አ u ኡ i ኢ a ኣ e ኤ ə እ o ኦ
kä ከ ku ኩ ki ኪ ka ካ ke ኬ kə ክ ko ኮ
hä , hu ,# hi ,! ha á he ,@ h < ho ó
wä ወ wu ዉ wi ዊ wa ዋ we ዌ wə ው wo ዎ
a ዐ u ዑ i ዒ a ዓ e ዔ ə ዕ o ዖ
žä ዘ žu ዙ ži ዚ ža ዛ že ዜ žə ዝ žo ዞ
żä ¢ żu ¢$ żi ¢E ża Ï że ¢& żə ™ żo Î
yä የ yu ዩ yi ዪ ya ያ ye ዬ yə ይ yo ዮ
dä ደ du ዱ di ዲ da ዳ de ዴ də ድ do ዶ
ğä ጀ ğu ጁ ği ጂ ğa ጃ ğe ጄ ğə ጅ ğo ጆ
gä ገ gu ጉ gi ጊ ga ጋ ge ጌ gə ግ go ጎ
ä ጠ u ጡ i ጢ a ጣ e ጤ ə ጥ o ጦ
çä ጨ çu ጩ çi ጪ ça ጫ çe ጬ çə ጭ ço ጮ
Þä ’ Þu ’# Þi ’! Þa Ô Þe ’@ Þə ù Þo Õ
şä ጸ şu ጹ şi ጺ şa ጻ şe ጼ şə ጽ şo ጾ
şä ፀ şu ፁ şi ፂ şa ፃ şe ፄ şə ፅ şo ፆ
fä ፈ fu ፉ fi ፊ fa ፋ fe ፌ fə ፍ fo ፎ
pä ፐ pu ፑ pi ፒ pa ፓ pe ፔ pə ፕ po ፖ
Ausführliche Beschreibungen und Erläuterungen zur Schriftsprache sind den Arbeiten von Hartmann
(1980) und Richter (1987) zu entnehmen.
4
II. Verzeichnis der Tonaufnahmen und der Notationen
Neben der grundlegenden Nummerierung entsprechend der Repertoireliste sind die Umschrift des
Titels, die Übersetzung des Titels und das Vorhandensein von Notationen ( = nach den angegebe-
nen Tonaufnahmen; = aus dem Gedächtnis mit Verweis auf vergleichbare Tonaufnahmen), sowie
die Archiv-Signaturen der Tonaufnahmen aufgeführt.
Nr. Umschrift des Titels Übersetzung Tonaufnahmen Seite
1 abäbāwū babäbāwū layə Blumen über Blumen 0345.018/6d 7
2 abäğäš yäñā ləğə Gut gemacht, unser
Kind
0345.015/1b; vgl. 0345.016/1a-c,5a-
e,10b-d,12b,14b; 0345.016/1b,14b;
0345.018/4,8
9
3 ağäbayē (---) vgl. 0345.001/1,2 11
4 ahūn dämäq/š abäbāyē Jetzt strahlst du meine
Blume
0345.018/4; vgl. 0345:001/1d,h,j, n,p,
q,r, 2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d;
0345.016/1a-c,5a-e,10b-d,12b;
0345.018/4;0345.001/ 1d,h,j,n,p,q,r,
2a,c,14b-e,l,p,q, 16b,c,18a,d
12
4a s. Nr. 4 s. Nr. 4 vgl. music ex. 4 18
4b s. Nr. 4 s. Nr. 4 vgl. music ex. 4 19
5 almāž mən əda näwū Almaz, what a problem? vgl. 0345.014/2a; vgl. also
0345.015/10f; 0345.018/16a
6 amõrā bäsämay siyayəš
walä
Der Rabe sah dich vom
Himmel herab
0345.001/3c,13b,e; 0345.014/9c;
0345.018/21,22
20
7 amrwāl šägänū Die Umgebung ist
schön
vgl. 0345.014/10, 0345.001/12e,13l;
0345.016/15a-b
23
8 ančī alälā mudāyə You beautiful basket vgl.0345.001/1d;
0345.001/1d,h,2a,c,14b-e,lp,q, 16b,c,
18a,d; 0345.015/1a,b; 0345.015/2b;
0345.018/4,8
9 anāsgäbām sərgäñā Wir lassen keinen
Hochzeitsgast hinein
vgl. 0345.014/6b,c; 0345.001/1d,h,j,n,p,
q,r,2a,c,14b-
e,l,p,q,16b,c,18a,d;0345.015/ 1b,c,d,f,
g;2b,5b,9b;0345.016/1c,5a,10c;
0345.018/4,8
25
10 ančī bēlā bēlā You beautiful, beautiful no recording available
11 arkā bälulāčäwu (---) 0345.001/1f,b; 0345.018/16 26
12 ašā gädawõ (---) vgl. 0345.011/4; 0345.014/2c;
0345.015/10c; 0345.016/2a
31
13 ašäbäl gädayē (---) vgl. 0345.001/3d;16a; 0345.001/3d,f,
g,5a,6c,8a,9b,d,f,10a,12c,h,13f;
0345.018/24; 0345.016/6b;
0345.015/13b; 0345.014/4a
14 ašäwäynā wäynā (---) vgl. 0345.001/15d; 0345.011/3b;
0345.014/9a; 0345-016/4a
34
15 ašē munanā (---) vgl. 0345.001/14b-b, 16fl; 0345.012/6a
16 atšäñwatəm wäy Wollt ihr sie nicht hin-
ausbegleiten?
vgl. 0345.0015/13c; 0345.018/5
35
5
17 bähār ašəmäwu (---) vgl. 0345.001/16c 37
18 bālənğärē Meine Freundin 0345.016/4b; 0345.016/4b 39
19 bəq bäy kägwadā Komm aus dem Neben-
zimmer
0345.001/2c; vgl. 0345.001/1d,h,j, n,p,
q,r, 2a,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d;
0345.015/5b; 0345.018/4,8;
0345.015/13d
41
20 bər ambār Silbernes Armband 0345.018/6a 43
21 čəbõ ayəmolām wägäbwā Ihre Teille ist schmal 0345.018/2; vgl. 0345.014/2d;
0345.015/10e
45
22 ärä näy ətē Oh, komm 0345.001/3a,16m,o; 0345.016/12c;
0345.018/18a
47
23 gurmrmē (---) vgl. 0345.001/3j,m, 4b; 0345.014/5b;
0345.015/4a,8a
24 hay lõgā (---) 0345.018/1; vgl. 0345.001/3k,l,4a,6b,
14a; 0345.014/5b; 0345.015/4a;
0345.016/7a; 0345.018/1a
56
24a s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 60
24b s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 61
24c s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 62
24d s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 63
24e s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 64
24f s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 65
24g s. Nr. 24 s. Nr. 24 s. Nr. 24 66
25 hēdäč alū So ist fort, erzählt man vgl. 0345.014/5a; 0345.016/6a 67
26 hõy mäla näšə hoy, ein Ausweg bist du 0345.018/7; vgl. 0345.005/2a 68
27 əčī nāt wäy mīžēšə bzw.
yəhē näw wäy mīžēhə
Ist sie deine Begleite-
rin? Ist er dein Beglei-
ter?
0345.018/8; vgl.
0345.001/1d,h,n,j,p,q,r,2a,c,14b-e,l,p,
q,16b, c,18a,d; 0345.015/1b,c,f, g, 2b,
2c, 5b,9b; 0345.016/1c,5a; 0345.018/4
70
28 ələl balē ohõ (---) vgl. 0345.015/3b; 0345.016/13b 72
29 ə mām wäšäbā (---) vgl. 0345.014/4b
30 əndalayəš So, dass ich dich nicht
zu sehen bekomme
0345.001/2c 74
31 əndäw yämərū (---) vgl. 0345.015/6a 76
32 ənē alsäəm ətēnə Ich gebe meine Schwes-
ter nicht weg
0345.018/26; vgl. also 0345.001/1d,h,
j,n,p,q,r, 2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c, 18a,d;
0345.015/1b, c,f,g; 0345.016/1c,5a-e;
0345.018/4
78
33 ənē alsäəm ləğēnə Ich gebe mein Kind
nicht weg
0345.018/25; vgl. 0345.001/1d,h,j,n,p,
q,r,2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d;
0345.015/1b,c,f,g; 0345.016/1c,5a;
0345.018/4
80
34 əradõ wäšäbā (---) vgl. 0345.018/13 82
35 əšätē wäynā (---) 0345.001/1e; vgl. 0345.001/2a;
0345.014/9b; 0345.015/2a;
0345.016/12a
84
6
36 əswās lõmī nāt Sie (die Braut) ist eine
Zitrone
vgl. 0345.014/7a; vgl. 0345.015/3a;
0345.016/13a,17
89
37 əstī šälmūn Bitte beschenken Sie
uns
0345.018/11; 0345.001/1d,h,j,n,p,q,r,
2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d
91
38 əstī amaw yädämūn
šämā
Bring einmal das blutige
Tuch
0345.018/9b 93
39 ətē balənğär Meine Freundin vgl. 0345.016/15b; 0345.016/15a
40 ətē šänkõrē Meine Schwester
šänkõrē
0345.018/6b; vgl. 0345.015/13d 94
41 əyäbälū yääū žəmə Sie essen, trinken und
sagen nichts
vgl. 0345.001/14o 96
42 kēlawu täsäbärä Das Tor ist entzwei 0345.018/6c 97
43 kulūn mān kwāläšə Wer hat dich ge-
schminkt?
vgl. 0345.015/5a,1b,1c, 1d, 1g,2b, 5b,
9b; 0345.001/1d,h,j,n, p,q, r,2a, c,14b-
e,l,p,q, 16b,c,18a,d; 0345.016/1a,b,c,
5a-e,10b-d,12b,14b; 0345.018/4
44 kūrāt kūrāt Stolz ! Stolz ! 0345.001/1k; vgl. 0345.001/15f;
0345.015/1b,1c,1d,1f,1g, 2b;
0345.015/1c, 5a; 0345.018/4
99
45 lõmī alubāt Werft Zitronen auf sie vgl. 0345.015/3a; 0345.014/7a;
0345.016/13a,17
102
46 mähēdē näw mağī Ich gehe nach Mağī vgl. 0345.016/3a,16d
47 mähēdwā näwū Sie geht vgl. 0345.014/5a; 0345.001/2d 103
48 mīžēw šəttõ amā Begleiter bring/gib uns
Parfüm
vgl. 0345.014/6c; 0345.001/1d,h,
j,n,p,q,r,2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d;
0345.015/9b; 0345.016/1c,5a-e,10b-
d,12b; 0345.018/4,8
104
49 mīžew dəhā näwū Der Begleiter ist arm vgl. 0345.014/6c; 0345.001/1d,h,j,n,
p,q,r,2a,c,14b-e,l,p,q,16b,c,18a,d;
0345.015/9b;0345.016/1c,5a-e,10b-
d,12b; 0345.018/4,8
105
50 mūšərīt lämdaläčə Unsere Braut hat sich
gewöhnt
vgl. 0345.016/3a, 16b 106
51 mūšərīt ləmäğī Braut gewöhne dich vgl. 0345.016/3a,16b 108
52 mūšəroč marē marē Bridal couple, honey,
honey
vgl. 0345.015/9a
53 mūšərayē My bride/my bride
groom
vgl. 0345.014/7d; 0345.016/8
54 nəbõ atənādäfī Biene, stich nicht 0345.001/2; vgl. 0345.001/1d,h,j,n,p,q,
r,2a 2c,14b-e,l,p,q,15e, 16b,c,18a,d;
0345.015/ 1b,c, d,g, 2b,c,5b, 9b;
0345.016/1c,5a,10c; 0345.018/4
110
55 ohõ hõ munā (---) 0345.001/3e; vgl. 0345.014/4c 112
56 sägurwā wärdõ wärdõ Ihr Haar wallt herunter] vgl. 0345.016/14a-b 116
57 šäb əräb aläč mədərə Der Boden bebt vor
Freude
0345.001/1g; vgl. 0345.015/6d 117
58 šənätə (---) vgl. 0345.014/8a 120
59 Tasäräè bägulèèã She’s tied through the
oven stone
vgl. 0345.014/8b
60 Täwûbäšãl alû It is rumored, that you
look nice
vgl. 0345.014/8c
7
61 wäläbē wäläbē (---) vgl. 0345.015/6b 121
62 wändəməyē Mein Bruder vgl. 0345.014/6a; 7a; 0345.015/1a;
0345.016/10a
122
63 yäbētä žämädū Die Verwandtschaft 0345.001/3g; vgl. 0345.015/13b 123
64 yägwarõyē enādām Meine Gartenpflanze vgl. 0345.015/1b,c,d,g,2b, c, 5b, 9b;
0345.001/1d,1h,2,15e; 0345.016/1c, 5a,
10c; 0345.018/4
132
65 yäñāmā mūšərā Unsere Braut/unser
Bräutigam
vgl. 0345.014/7b; 0345.016/9 134
66 yänē abäbā näš Du bist meine Blume 0345.018/3; vgl. 0345.014/3b 137
67 yäšī gabəččā (---) vgl. 0345.016/3b,16e 140
68 yäwäfē bər abäbā (---) vgl. 0345.08/14 141
69 yäwäyən abäbāyē Meine Weintraubenblü-
te
vgl. 0345.014/6e 142
70 yäžarē amätə Heut in einem Jahr 0345.018/5 144
71 yəžwāt bärärä Er nimmt sie und rennt
davon
vgl. 0345.015/1b,1c,d,f,g,2b,5a,9b;
0345.016/1c,5a-e,10b-d,12b;
0345.018/4,8
145
72 žäbänay mārəyē (---) 0345.018/10a 147
73 Besessenheitslied 0345.010/6, vgl. 0345.010/2,3,4,5 149
74 wašənt Instrumentalstück 0345.005/13 151
75 təžətā-əngūrgūrõ Sologesang 0345.002/7; vgl. 0345.005/2e, 7a, 11a,j 152
76 yämatəbälā wäfə Unessbarer Vogel 0345.016/19 153
77 lalibälā-Gesang Sologesang 0345.017/01 156
78 hõya hõyē Holiday Gesang vgl. 0345.011/1 157
79 abūnä-žäbäsämayāt Bägäna-Gesang 0345.018/27 160
80 abäbāyē hoyē Neujahrsgesang 0345.011/5, 6a 162
81 əyõha abäbāyē Mäsqäl-Gesang vgl.0345.010/6a, 168
82 s. Nr. 81 s. Nr. 81 s. Nr. 81 169
151
III Verzeichnis der Tonbeispiele
Die auf der beigefügten Kassette erklingenden Tonbeispiele sind chronologisch nach dem Verlauf
einer Hochzeitsfeier geordnet. Es sind sowohl funktionsgebundene als auch nicht funktionsgebundene
Gesänge angeführt.
Zu beachten ist, dass ähnliche bzw. gleiche Melodien mit unterschiedlichen Texten existieren, die
jeweils zu unterschiedlichen Phasen einer Hochzeitsfeier gesungen werden ( z.B. Nr. 4, 5 und 6).
Neben der grundlegenden Numerierung entsprechend der Repertoireliste sind der Titel in Umschrift,
die Übersetzung des Titels, die Tonreihe, die funktionale Bindung und Beschreibung der Tonaufnah-
me, die Klassifizierung der Adressaten (vgl. Legende in der Repertoireliste) und die Quelle der
Tonaufnahme angegeben. Aufgrund der praktischen Verkettung von Liedfolgen sind die Übergänge
mit aufgenommen worden.
Nr. Umschrift des
Titels
Übersetzung Tonreihe funktionale Bindung und Beschreibung
der Tonaufnahme
gerichtet
an
Quelle der
Tonaufnahme
1 bəq bäy käg-
wadā
Komm aus dem
Nebenzimmer
ančī hoyē
länē
gesungen während die Braut sich ihr
Hochzeitskleid anlegen und sich
schminken lässt;
Haus des Bräutigams Alemu Däbissa im
Vorraum, awrāğ Nr. 2: Gesänge der
jüngeren Gäste von masinqõ-Spieler,
käbärõ und Klatschen begleitet
1 0345.001/2b
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
2 amrwāl
šägänū
Die Umgebung ist
schön
təžətā gesungen während und nach dem die
Braut ihre Hochzeitskleidung in ihrem
Elternhaus anlegt.
Sänger: Tadesse Alämu
Gesang begleitet von einem modernen
Folklore-Ensemble: Baßgitarre, krar,
Schlagzeug, keyboard, masinqõ und
Klatschen
1/2 0345.014/10
1995/Addīs A.
3 əndalayəš So, dass ich dich
nicht zu sehen
bekomme
ančī hoyē
länē
als Trostlied für die Braut gesungen
während der Vorhochzeitstage und am
Hochzeitstag, wenn sie auf den Bräuti-
gam wartet
Im Haus des Bräutigams Alemu Däbissa
im Vorraum, awrāğ Nr. 2: Gesänge der
jüngeren Gäste von masinqõ-Spieler,
käbärõ und Klatschen begleitet
1 0345.001/2c
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
4 anasgäbam
sərgäñā
Wir lassen keinen
Hochzeitsgast
hinein
ančī hoyē
länē
bei Ankunft des Bräutigams im Haus
der Braut
Sänger: Tadesse Alämu
Gesang begleitet von einem modernen
Folklore-Ensemble: Baßgitarre, krar,
Schlagzeug, keyboard, masinqõ und
Klatschen
2/3 0345.014/6b
1995/Addīs A.
5 mīžew šətõ
amā
Begleiter
bring/gib uns
Parfüm
ančī hoyē
länē
gesungen bei der Ankunft des Bräuti-
gams; traditionsgemäß werden in diesem
Moment ein oder mehrere Parfüms von
der Verwandtschaft der Braut erwartet,
die von den Begleitern auf die Teilneh-
mer gesprüht werden
Sänger: Tadesse Alämu
Gesang begleitet von einem modernen
Folklore-Ensemble: Baßgitarre, krar,
Schlagzeug, keyboard, masinqõ und
Klatschen
3 0345.014/6c
1995/Addīs A.
152
6 əčī nāt wäy
mīžēšə bzw.
yəhē näw wäy
mīžēhə
Ist sie deine
Begleiterin ?
Ist er dein Beglei-
ter ?
ančī hoyē
länē
gesungen jeweils von der Gruppe der
männl. Beglei-ter und den Brautjung-
frauen, um sich gegenseitig zum Tanz
und zur aktiven Beteiligung zu animie-
ren
Im Haus der Braut, Helina Teffera,
gesungen und zwar kurz nach der An-
kunft des Bräutigams Sahilu Woldeli-
oul. Es ist der Moment, in dem die
Braut von ihrem Elternhaus abgeholt
wird;
Gesang begleitet vom Klatschen
3 0345.018/8
15.1.91/Addīs A.
7 mähedwā näw Sie geht ančī hoyē
länē
gesungen in dem Moment des Ab-
schieds vom Elternhaus seitens der
Angehörigen der Braut
Sänger: Tadesse Alämu
Gesang begleitet von einem modernen
Folklore-Ensemble: Baßgitarre, krar,
Schlagzeug, keyboard, masinqõ und
Klatschen
1 0345.014/5a
1995/Addīs A.
8 yäžarē amätə Heut in einem
Jahr
təžətā gesungen für das Brautpaar nach Been-
digung der Abendveranstaltung auf
ihrem Weg ins Schlafzimmer
Sänger: unbekannt
Gesang wurde am Hochzeitsabend
gesungen, als die Brautleute, Helina
Teffera und Sahilu Woldelioul, sich in
ihrem Schlafzimmer begaben
1/2 0345.018/5
15.1.91/Addīs A.
9 bər ambār Armband təžətā gesungen zur Beglückwünschung der
Brauteltern am folgenden Tag der
Hochzeit
Gesang wurde am folgenden Tag nach
der Hochzeit bei der Beglückwünschung
der Eltern Braut, Helina Teffera, von
den Begleitern des Bräutigams, Sahilu
Woldelioul, gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
2 0345.018/6a
15.1.91/Addīs A.
10 ətē šänkorē Meine Schwester
šänkorē
təžətā gesungen für das Brautpaar nach Been-
digung der Abendveranstaltung auf
ihrem Weg ins Schlafzimmer bzw. am
folgenden Tag nach der Hochzeit
Gesang wurde sowohl nach Beendigung
der Abendveranstaltung als auch am
folgenden Tag nach der Hochzeit bei
der Beglückwünschung der Eltern der
Braut, Helina Teffera, von den Beglei-
tern des Bräutigams, Sahilu Woldelioul,
gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
1 0345.018/6b
15.1.91/Addīs A
11 kelaw täsäbärä Das Tor ist ent-
zwei
təžətā gesungen zur Beglückwünschung der
Brauteltern am folgenden Tag der
Hochzeit
Gesang wurde am folgenden Tag nach
der Hochzeit bei der Beglückwünschung
der Eltern Braut, Helina Teffera, von
den Begleitern des Bräutigams, Sahilu
Woldelioul, gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
1/2 0345.018/6c
15.1.91/Addīs A
153
12 abäbawu
babäbawu
layə
Blumen über
Blumen
təžətā gesungen zur Beglückwünschung der
Brauteltern am folgenden Tag der
Hochzei
Gesang wurde am folgenden Tag nach
der Hochzeit bei der Beglückwünschung
der Eltern Braut, Helina Teffera, von
den Begleitern des Bräutigams, Sahilu
Woldelioul, gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
1 0345.018/6d
15.1.91/Addīs A
13 əstī amaw
yädämūn
šämā
Bring einmal das
blutige Tuch
təžətā gesungen von den Brautangehörigen am
der Hochzeit folgenden Tag bei der
Beglückwünschung der Brauteltern als
Antwort zu dem Lied bər ambār
Gesang wurde am folgenden Tag nach
der Hochzeit bei der Beglückwünschung
der Eltern Braut, Helina Teffera, von
den Begleitern des Bräutigams, Sahilu
Woldelioul, gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
3 0345.018/6e
15.1.91/Addīs A
14 əstī šälmūn Bitte beschenken
Sie uns
ančī hoyē
länē
gesungen am nächsten Tag nach der
Hochzeit zur Beglückwünschung der
Brauteltern
Gesang wurde am folgenden Tag nach
der Hochzeit bei der Beglückwünschung
der Eltern Braut, Helina Teffera, von
den Begleitern des Bräutigams, Sahilu
Woldelioul, gesungen.
Begleitung: käbäro und Klatschen
4 0345.018/11
15.1.91/Addīs A
15 kurāt kurāt Stolz ! Stolz ! ančī hoyē
länē
beliebig austauschbar
Haus des Bräutigams Alemu Däbissa im
Vorraum; awrāğ Nr. 2: esänge der jün-
geren Gäste von masinqõ-Spieler,
käbärõ und Klatschen begleitet
1/2 0345.001/2a
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
16 yäbetä žä-
mädū
Die Verwandt-
schaft
bātī beliebig austauschbar
Verabschiedung des Bräutigams Alämu
Däbissa auf der Straße, awrāğ Nr. 3:
Gesänge der jüngeren Gäste von masin-
qõ-Spieler, käbärõ und Klatschen be-
gleitet
6 0345.001/3d
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
17 hay logā hay loga [großer,
hübscher]
təžətā beliebig austauschbar
Gesang wurde im Park des Standesam-
tes (genannt mazägäğā bēt) nach Been-
digung der standesamtlichen Zeremonie
der Brautleute Helina Teffera und Sahi-
lu Woldelioul gesungen.
2 0345.018/1
15.1.91/Addīs A
18 arkā bä-
lulačäwu
(Redundanz) təžətā beliebig austauschbar
Im Haus des Bräutigams Alemu Däbissa
im Vorraum, awrāğ Nr. 2: Gesänge der
jüngeren Gäste von masinqõ-Spieler,
käbärõ und Klatschen begleitet
1/2 0345.001/1
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
19 amõrā bäsä-
may siyayəš
walä
Der Rabe sah
dich vom Himmel
herab
təžətā beliebig austauschbar
Gesang u.a. gesungen während der
Verabschiedung des Bräutigams Alämu
Däbissa auf der Straße, awrāğ Nr. 3:
Gesänge der jüngeren Gäste von masin-
qõ-Spieler, käbärõ und Klatschen be-
gleitet
1/2 0345.001/3b
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
154
20 ohõ hõ munā (Redundanz) təžətā beliebig austauschbar
Gesang u.a. gesungen während der
Verabschiedung des Bräutigams Alämu
Däbissa auf der Straße und im Picoc
Park awrāğ Nr. 3: Gesänge der jüngeren
Gäste von masinqõ-Spieler, käbärõ und
Klatschen begleitet
1 0345.001/3c
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
21 šäb əäb aläč
mədərə
Der Boden bebt
vor Freude
təžətā beliebig austauschbar
Im Haus des Bräutigams Alemu Däbissa
im Vorraum, awrāğ Nr. 2: Gesänge der
jüngeren Gäste von masinqõ-Spieler,
käbärõ und Klatschen begleitet
1/2 0345.001/1
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
22 ärä näy ətē Oh, komm ančī hoyē
länē
beliebig austauschbar
Gesang u.a. gesungen während der
Verabschiedung des Bräutigams Alämu
Däbissa auf der Straße und im Picoc
Park awrāğ Nr. 3: Gesänge der jüngeren
Gäste von masinqõ-Spieler, käbärõ und
Klatschen begleitet
1 0345.001/3a
3.5.97 Addīs A.
Kotäbe
155
V Glossar abəy bä'al {አ ብይ በ ዓ ል} [gə'əž-Sprache] Hauptfeier (siehe auch nə'us bä'al)
aççä {አ ጨ} Er suchte sich eine Verlobte aus; hergeleitet von mätäçaçät "verlobt werden",
Aus der Bibelgeschichte ist zu erfahren, dass ein verlobtes Paar wie ein bereits
verheiratetes Paar betrachtet wird und man daher auch nicht treuebrechen darf (1.
Mose 29: 21, Matthäus 1: 18-20).
Gottes Treue und Liebe zu Israel ist durch Verlobung gekennzeichnet (siehe Hosea
2: 21-22).
Bei einer Verlobung wählen Eltern für ihren Sohn/ihre Tochter die passende Ehe-
frau bzw. den passenden Ehemann. Laut Bibelgeschichte gab es bei einer Verlo-
bung drei verschiedene Geschenkarten. Diese waren:
a) Geschenke des Mannes für die Brauteltern (1. Mose 29: 18, 34: 12)
b) Geschenke des Mannes für seine zukünftige Ehefrau (1. Mose 24: 53) und
c) Geschenke der Brauteltern für ihre Tochter (Richter 1: 12-15).
Danach wird eine Verlobung durch eine Ehe abgeschlossen bzw. festgemacht.
adāl {አ ዳ ል} Name eines žār-Geistes (siehe žār; allāh, ənatē mominā, qədās abalafā)
aday abäbā {አ ደ ይ
አ በ ባ }
Blumenart ähnlich den Gänseblümchen. Sie gilt in Äthiopien als Symbol für den
Frühling und somit für eine fröhliche Zeit des Jahres.
agaw {አ ገ ው} Ort in der Region Goğām. Die vollständige Bezeichnung dieses Ortes heißt Agaw
Mədər.
Gleichzeitig bezieht sich das Wort Agaw auf eine ethnische Gruppe, die in diesem
Ort lebt.
aklīl {አ ክ ሊል} [lit.] Krone, Kopfdekoration, Geschenk; aklīl = "etwas Heiliges und Hochgeschätz-
tes".
Die Krone besteht aus verschiedenen Materialien wie beispielsweise Gold, Nickel
und Silber (3. Mose 8: 9; Hesekiel 23: 12). Bei einer kirchlichen Trauung wird sie
auf die Köpfe des Brautpaares gesetzt und gehört somit zur religiösen Trauungsze-
remonie (siehe täklīl, žäwəd).
aklīl ist ferner ein Zeichen des Respekts. Sie wird von Menschen getragen, die
etwas Besonderes geleistet haben oder einen hohen Posten innehaben oder ein-
nehmen wie z.B. Geistliche und Könige.
Von der biblischen Geschichte ist u.a. zu erfahren, dass Mose befohlen wurde,
einen goldenen Kranz um die Bundeslade herumzuwinden (siehe 2. Mose: 25:11).
Desweiteren sind folgende Stellen nachzulesen:
"Mose setzte Aron den Kopfbund auf sein Haupt und befestigte an dem Kopfbund
vorn das goldene Stirnblatt, den heiligen Reif, wie der Herr es ihm geboten hatte"
(3. Mose 8: 9).
"Die Soldaten des Statthalters beugten die Knie vor Jesus und verspotteten ihn
und sprachen: Gegrüßt seist du der Juden König. Dabei hatten sie ihm eine Dor-
nenkrone aufs Haupt gesetzt" (Matthäus 27: 29, Markus 15: 16-17).
"Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe
Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich die Krone" (2. Themoteus 4: 7-8).
Die Griechen schenkten Sportsiegern eine Blumenkrone (siehe Themoteus 4: 8).
Allāh {አ ላ ህ } muslimische Gottheit; höheres Wesen. Während der traditionellen žār-Sitzungen
wird der Name allāh stets als žār-Geist gerufen (siehe žār-, adāl, ənate mominā,
qədās abalafā)
amārā {አ ማራ} Einer der ca. 80 Stämme Äthiopiens, der überwiegend im Zentralen Hochland
ansässig sind.
amarəñā {አ ማር ኛ } Die Stammessprache der amārā.
ambassäl {አ ምባ ሰ ል} - Ortsname in der Region Wällõ;
- Bezeichnung für die dritte qəñət (siehe təžətā, bātī und anči hoye läne)
ambār {አ ምባ ር } siehe yä'əjj ambār
anči hoyē länē {አ ን ቺ
ሆዬ ለ ኔ }
lit. = Du meine Liebe;
- Bezeichnung für die vierte qəñət (siehe auch təžətā, bātī und ambassäl).
156
aräqē {አ ረ ቄ } Traditioneller hausgebrannter Dattelschnaps. Für die Herstellung dieser traditionel-
len Schnapsart sind vor allem die Menschen aus der Region Goğām sehr bekannt.
Dort gibt es sogar unterschiedliche Bezeichnungen für die verschiedenen
Schnapssorten wie z.B. dagəm, qundəft, katikalā .
araray {አ ራራይ} "etwas Trauriges"; Das Wort bezieht sich auf den dritten Gesangsstil, yäžēmā səlt,
der äthiopischen Kirchenmusik.
arūž{አ ሩዝ } [haräriña Sprache] Bräutigam
arūž mälaq {አ ሩዝ መላ ቅ } [haräriña Sprache] Begleiter/in des Bräutigams/der Braut am Hochzeitstag (siehe
mižē).
aružīt {አ ሩዚት} [haräriña Sprache] Braut
air {አ ጢር } [haräriña Sprache] Parfüm
awrāğ {አ ውራጅ} hergeleitet von mawräd "etwas herunterbringen"; Der awrāğ ist der Vorsänger im
Wechselgesang (siehe täqäbay).
awäliya {አ ወሊያ } siehe žār und qaləččā
ažmārī {አ ዝማሪ } hergeleitet von mažmär "singen"; Der ažmārī ist der traditioneller Sänger, der sich
meistens auf seine einsaitige Kasten-Spießlaute masinqõ oder Leier kərār begleitet
(siehe masinqo und kərār ).
balämõyā {ባ ለ ሞያ } eine Frau, die ihren Haushalt perfekt beherrscht (siehe galämõtā )
bātī {ባ ቲ} Ortsnahme in der Region Wällõ; bātī ist auch der Name für die zweite qəñət-təžətā
(siehe ambassäl und ančī hoyē länē ).
bägänā {በ ገ ና } Jochlaute mit kastenförmigem Resonator (laut Baumann 1978: 28 "Kastenleier"),
die heutzutage nicht nur in der Kirche gespielt wird, sondern auch zur Begleitung
von Sologesängen (z.B. religiöse Preislieder) außerhalb der Kirche verwendet
wird.
bəherawī gabəččā
{ብሔራዊ ጋ ብቻ}
"Nationale Ehe"; Es bezieht sich auf die standesamtliche Eheschließungsform, die
überwiegend in den städtischen Zentren stattfindet (siehe gabəččā , yäbahəl
gabəččā bzw. yäləmad gabəččā ).
bərkummā {ብር ኩማ}
Hölzerner Steg, der für das Anheben von Instrumentensaiten (kərār, masinqõ und
bägäna) verwendet wird.
bərr {ብር } Die äthiopische Währung.
budā masläqäq {ቡዳ
ማስ ለ ቀ ቅ }
"traditioneller Krankenheilungsritus"; Diese Art von Krankenheilungsritus, der
nicht ohne Konsequenzen für den Patienten ist, wird faß überall in Äthiopien ver-
wendet. Es gibt verschiedene, zum Teil gefährliche Methoden, einen von einem
bösen Geist besessenen Kranken, zu heilen. Manche Methoden könnten sogar
tödlich enden, da man in den meisten Fällen nicht weiß, um was für eine Krankheit
es sich handelt (siehe ənqolā).
buhē {ቡሄ } Religiöses Fest mit unbekannter Herkunft. Die Feier findet einaml jährlich im Juli
(siehe ausführliche Beschreibung in Abschnitt 1.4.1.4.).
çāt {žg} Das Rauschmittel (Catha edulis), das insbesondere in der Region Harär (Südost-
Äthiopien) wächst. Diese leicht stimulierende Droge wird stundenlang gekaut. Bei
den haräre gehört das çāt-Kauen, das meistens um die Mittagszeit stattfindet, zum
normalen Alltag. Dazu gehört eine Zeremonie, bei der viele Vorbereitungen getrof-
fen werden müssen. Während des Kauens preisen die haräre den Propheten Mo-
hammed.
çəbçäbā {ጭብጨባ } hergeleitet von dem Verb maçäbçäb "Klatschen"
dägān {ደ ጋ ን } Bezieht sich auf den Bogen, der zum Spielen der einsaitigen Kasten-Spießlaute
masinqõ verwendet wird.
däsār {ደ ሳ ር } Jocharm der Kastenleier bägänā.
157
dəfo dabõ {ድፎ ዳ ቦ } Großes rundes Brot aus Weizenmehl. Gebacken wird es vor allem zu Feiertagen
wie z.B.Ostern fasika und Weihnachten gännā.
diqalā {ዲቃላ } hergeleitet von mädäqäl "mischen"; diqalā ist ein uneheliches, rechtloses Kind.
Die Bibel ist auch gegen ein uneheliches Kind. Dies wird (u.a. in Hebräer 12: 8)
folgendermaßen beschrieben:
"Seid ihr aber ohne Züchtung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausge-
storbene und nicht Kinder."
dəbbe{ድቤ} kleine einfellige Kesseltrommel mit Schnurspannung, die vor allem bei den traditi-
onellen Besessenheitsliedern (siehe žār) u.a. als Begleitinstrument verwendet wird.
dəngəl {ድን ግ ል} Eine Frau, die von keinem Mann weiß bzw. ein Mann, der von keiner Frau weiß
(1. Mose 24: 16; 2. Mose 22: 5. Mose 22: 13-29, 1. Korinther 7: 25-38, 16-17,
Ester 2: 2-3)
dorže {ዶር ዜ } Volksgruppe, die zu einer der kleinsten ehtnischen Zweige Südäthiopiens gehört.
Sie sind zum größten Teil mit der Landwirtschaft und der Weberei beschäftigt.
fär {ፈር ጥ} "wertvoller Stein"; Ein fär wird neben Diamanten, Gold und Silber für die Deko-
ration einer Krone verwendet. Außerdem wird er auch auf Kleidungen genäht (sie-
he 2. Mose 25: 7; 28: 11).
fasikā{ፋሲካ } lit. = Freude; Osterfest. In der äthiopisch-orthodoxen Kirche gehört Ostern zu
einem der groß gefeierten religiösen Feste.
fatah {ፋታህ } [haräriña Sprache] Gebet
fəčči {ፍቺ} "Scheidung, Ehebruch"; hergeleitet von mäfatat "sich scheiden lassen"; Eine
Scheidung ist von Gott nicht erlaubt (Matthäus 19: 6, Maleachi 2: 16). Sie kann
aber wegen besonderer Härte stattfinden (Matthäus 5: 31-32; 19: 7-9; siehe weitere
Stellen u.a. 2. Mose 21.12-17; 22: 18-20; 3. Mose 24: 14-16).
fəəməəm {ፍጥምጥም} "Verlobung" (siehe yäqäläbät qän, yäqäläbät bä'āl)
gabəččā {ጋ ብቻ} "Ehe, Eheschließung". Auffassung von der Ehe:
Es wird in jeder Gesellschaft unserer Welt erlaubt, dass ein Mann und ein Weib in
Liebe ein gemeinsames Leben führen. Die Ehe wurde zuerst von Gott durchgesetzt
(mit Adam und Eva- siehe 1. Mose 2: 18-25). Er hat den Bund der Ehe und die
dazugehörigen Regeln mit seinen Worten bestätigt (siehe Hosea 2: 21; Jeremia 3:
14; Epheser 5: 23). U.a. seien folgende Stellen zitiert:
"Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden." (siehe Mat-
thäus 19: 3-6)
"Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau Willen, sondern die Frau um des
Mannes Willen (1. Mose 2: 21-22, 1. Korinther 11: 9).
"Mann und Frau werden durch die Ehe zu einem Fleisch. Darum wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen" (siehe 1.
Mose 2: 24 und 4: 1)
Ferner ist in der amarā-Tradition typisch, dass die Familienwurzeln studiert wer-
den, bevor ein verlobtes Paar sich zum Heiraten entschließt, denn eine Verwandt-
schaftsehe ist keineswegs erlaubt. Diese Tatsache ähnelt den biblischen bzw. reli-
giösen Regeln. Gott sagte zu Mose (3. Mose 18: 6-18) folgendes:
"Keiner von euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen
geschlechtlichen Umgang zu haben; ich bin der Herr.
Du sollst mit deinem Vater und deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Es
ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben.
Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben; denn damit schändest
du deinen Vater".....usw. (siehe bəherawī gabəččā, yähaymanot gabəččā und
yäləmad gabəččā)
galämõtā {ጋ ለ ሞታ} "Ehelose Frau"; In der amārā-Tradition ist die Ehe heilig. Daher wird auch eine
verheiratete Person geachtet. Insbesondere erwartet man von einer Frau, dass sie
rechtzeitig heiratet, damit die Wahl eines Ehepartners für sie in einem späteren
Alter nicht zu kompliziert wird. (siehe 1. Mose 38: 1-15).
gännā {ገ ና } "Weihnachten"
158
gäräd {ገ ረ ድ} "Magd, Knecht"; Heutzutage ist diese Bezeichnung in Äthiopien verboten. Mann
nennt sie Arbeiter säratäñā (siehe yäçən gäräd)
gēšõ {ጌ ሾ } Rhamnus prinoides (siehe Misgana 1958: 101) wird für die Herstellung von äthio-
pischem Bier ällā und äthiopischem Honigwein äjj verwendet.
gəbəżā {ግብÏ} "Festmahl"; In der jüdischen Tradition war das gemeinsame Essen, Trinken, Sin-
gen und die gemeinsame Fröhlichkeit üblich. U.a. wurden Festmähler zu Geburts-
tagen (siehe 1. Mose 40: 20), Hochzeiten (siehe 1. Mose 29: 22) usw. vorbereitet.
Eingeladene Gäste wurden bei ihrer Ankunft geküßt. Danach bekamen sie Wasser
für ihre Füße und ihr Haupt wurden mit Öl gesalbt (siehe Lukas 7: 44-46). Diese
Art von Empfang und großangelegte Festmähler gab es in Äthiopien u.a. zur Re-
gierungszeit Kaiser Meneliks II (Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts).
Auch heute wird diese Tradition vor allem in den ländlichen Gebieten Äthiopiens
gepflegt.
gə’əž{ግ ዕ ዝ } a) "Erstes bzw. Fundamentales"; bezieht sich auf den ersten Gesangsstil in der
äthiopischen Kirchenmusik.
b) Alte äthiopische Sprache, die heutzutage nur noch in der christlich-orthodoxen
Kirche gesprochen wird.
c) 1. Ordnung des amarischen Syllabars.
gurāgē {ጉራጌ } Die gurāgē gehören zu den semitsch-sprachigen Völkern Äthiopiens und leben in
der Region Šäwā. Sie sind bekannt für den Anbau der sogenannten falschen Bana-
ne ənsät, die als Hauptnahrungsmittel dient. Die ənsät-Pflanze, die zunächst einer
Bananenstaude ähnelt, hat einen dickeren Stamm und mehr gerade Blätter. Der
Stamm, die Blätterstiele sowie die Wurzeln beinhalten Kohlenhydrate. Nach einer
mühevollen und lang andauernden Prozedur wird die Pflanze zu einem Brei aus
ənsät, yä'ənsät gänfõ, oder zu einem ungesäuertes Brot, qoççõ verarbeitet.
Ferner ist das Volk der gurāgē für seine harte Arbeit und seinen Geschäftssinn
bekannt.
halawā {ሐላ ዋ } [haräriña Sprache] Süßigkeiten wie Bonbons und Kekse.
haməs {ሃ ምስ } 5. Ordnung des amarischen Syllabars.
əççoñā {እ ጮኛ } hergeleitet von maçät "sich einen bzw eine/n Lebenspartner/in aussuchen"; əççoñā
ist ein/e Verlobte/r
maçā {ማጫ} "Brautpreis"; steht im Zusammenhang mit einer Verlobung.
"Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist, und ihr beiwohnt,
so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen (2. Mose 22: 15).
ələlta {እ ልልታ} Ololygen, Triller.
əmbiltā {እ ምቢልታ} Randgeblasene Längsflöte ohne Grifflöcher aus ausgehöhltem Holz oder auch
Metall (siehe mäläkät). Sie wird in Sätzen von drei Instrumenten gespielt, die
aufeinander abgestimmt sind (siehe Abschnitt 3.5.3.)
ənğärā {እ ን ጀራ} Fermentiertes Brot aus eff , einer Getreidesorte, die insbesondere auf der äthiopi-
schen Hochebene wächst]. Es ist ein ca. 1 cm dicker Fladen von ca. 60 cm Durch-
messer. ənğärā ist das Hauptnahrungsmittel im Zentralen Hochland Äthiopiens.
ənqū {ዕ ን ቁ } "Kleinod"; Im Alten Testament wurden wertvolle Kleinode mit Gold und Silber für
die Herstellung von Kronen, Ringen, Armbändern, Ohrringen usw. verwendet
(siehe Heskiel 16: 11-12).
ənqutataš {እ ን ቁጣጣሽ } Äthiopisches Neujahrsfest, das jährlich am 11. September zelebriert wird (siehe
ausführliche Beschreibung in Abschnitt 1.4.1.1.).
ənžīrā {እ ን ዚራ} sind kleine Zusatzzeichen, die im äthiopischen Syllabar verwendet werden;
ənžīrā (Plural von ənžīr) sind auch kleine Lederstückchen, die zur Trennung der
einzelnen Saiten der bägäna benutzt werden.
əskəstā {እ ስ ክ ስ ታ} Typische Tanzform, die im Zentralen Hochland bei den amārā praktiziert wird und
sich auf die Art und Weise der Schulterbewegung bezieht.
159
əān {እ ጣን } "Weihrauch"; Ein weißes Baumharz, dessen Verbrennung einen kräftigen würzigen
Duft verbreitet. Zum Räuchern in Jerusalemer Tempeln wurde eine besondere
Weihrauchmischung verwendet, die u.a. im äthiopischen Hochland gewonnen
wurde (siehe 2. Mose 30: 34-38. SIEHE weitere Stellen in der Bibel u.a. 2. Mose
40: 26-27, 3. Mose 16: 12, 1. Könige 11: 8 usw.).
əžəl {ዕ ዝል} lit.= "etwas Getragenes"; In der äthiopisch-orthodoxen Kirchenmusik steht die
Bezeichnung əžəl für den zweiten Gesangsstil yäžēmā səlt.
ityopəyā {ኢትዮùያ } Die amarische Bezeichnung für Äthiopien.
ğəmāt {ጅማት} Eine aus Schafs- oder Ziegendarm hergestellte Saite, die für die Saiteninstrumente
kərār und bägänā verwendet wird. Für die bägänā werden heute noch Saiten aus
jjəmat hergestellt, während für die kərār zunehmend Nylon-Saiten verwendet wer-
den.
kabbā {ካ ባ } Inbesondere zu Hochzeitsfeiern anzuziehendes, durch mühevolle Handarbeit be-
sticktes Gewand. Den kabbā tragen Braut und Bräutigem sowohl bei der religiösen
Hochzeitszeremonie täklīl als auch privat zur Nachfeier mäləs (siehe mäləs) oder
zur Verlobungsfeier (siehe yäqäläbät bä'āl). Das kabbā, das man zur religiösen
Hochzeitszeremonie täklīl anlegt, ist nur Eigentum der jeweiligen Kirche und das
zu den anderen genannten Hochzeitsfeierlichkeiten anzulegende kabbā kann käuf-
lich erworben oder ausgeliehen werden (siehe täklīl, mäləs und qäläbät).
käbärõ {ከ በ ሮ } große, zweifellige, geschnürte Konustrommel, die aus einem ausgehöhltem Baum-
stamm hergestellt wird.
ka’əb {ካ ዕ ብ} 2. Ordnung des amarischen Syllabars.
kärbē {ከ ር ቤ} Weihrauchsorte, die vor allem bei žār-Sitzungen verwendet wird. Sie verströmt
einen starken und ätzenden Geruch. Warum gerade diese Sorte während žār-
Sitzungen bevorzugt wird, ist unklar.
kərār {ክ ራር } Die äthiopische Kastenleier. Die Bezeichnung stammt aus den Wörtern makrər
"spannen", yäkärärä "etwas Gespanntes"[z.B. eine Schnur]; kərə "Schnur"...usw.
(Kebede 1977:156).
Der Resonanzkörper der kərār besteht aus einem Kasten oder einer Schale, z.B.
aus einem ausgehöhlten Holzstück oder einer Metallschüssel, die mit Ziegen-,
Schaf- oder Oschsenfell bedeckt wird (siehe Abb 3 im Abschnitt 1.2.1.). An der
rechten und linken oberen Seite werden zwei Jocharme məsäsowõč unter das ge-
spannte Fell in den Resonanzkörper hineingeschoben bis sie auf dessen untere
Wandung treffen, während an den aufragenden Enden die quer verlaufende hölzer-
ne Jochstange qänbär aufsitzt, die die Jocharme verbindet (siehe məsäsõ und qäm-
bär).
Die Anzahl der Saiten variiert von Ort zu Ort und von Instrument zu Instrument.
Allgemein werden jedoch 5 bis 8 Saiten verwendet, wobei im Zentralen Hochland
nur 5 oder 6 Saiten benutzt werden. Die Saitenbefestigung und -stimmung erfolgt
entweder mit Hilfe von mäqañā oder Stoffstreifen, die mehrere Male um die qän-
bär gewickelt, festgebunden oder verknotet werden (siehe mäqañā ). In der Mitte
der gespannten Decke qõdā befindet sich der hölzerne Steg bərkummā, über den
die Saiten geführt werden (siehe qõdā und bərkummā).
konsõ {ኮ ን ሶ } Volk aus Südäthiopien an der Grenze zu der Region Sidamõ. Die konsõ sind u.a.
bekannt für ihren Handel mit Salz und Kaurimuscheln. Wegen ihres animistischen
Glaubens stellen die konsõ auf die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten Totems,
die aus Holz geschnitzt werden. Diese Totems zeigen verschiedene Symbole.
kušā {ኩሻ } [haräriña Sprache] In der haräre-Tradition bezieht sich das Wort kušā auf die
Wahl der zukünftigen Ehefrau und auf diesbezügliche Handlungen; d.h. auf die
Verlobung (siehe əççoñā, maçät, aççä, mätäçaçät).
160
maçā {ማጫ} Der Begriff maçā bezieht sich auf eine bestimmte Geldsumme und verschiedene
Geschenken, die bei einer bevorstehenden Heirat seitens der Brautfamilie verlangt
werden. Die Kosten tragen die Eltern des Bräutigams. Die Summe des Geldes bzw.
das Maß von Geschenken wird jeweils am ökonomischen Stand der gebenden
Familie gemessen. Ein übertriebenes Verlangen von Geschenken könnte eventuell
bedeuten, dass die Brautfamilie mit der Heirat des Antragstellers nicht einverstan-
den ist (Gebreyesus 1997).
mäläkät {መለ ከ ት} Längstube aus ausgehöhltem Holz oder Metall mit trichterförmigem Mundstück
und ohne Grifflöcher (siehe Abschnitt 3.5.3. əmbiltā).
mamītu {ማሚቱ} Weiblicher Name für Mädchen und/oder Babys.
mamõ {ማሞ} Männlicher Name für Babys, Jungen und auch erwachsene Männer.
mamuš {ማሙሽ } siehe mamõ
mār {ማር } "Honig"
mäbaräk {መባ ረ ክ } lit.= "segnen"; In der orthodoxen Religion Äthiopiens wird im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes gesegnet. Diese Aussageform wird u.a.
beim Schlachten eines Tieres (z.B. Schaf) oder eines großen runden Brotes dəfõ
dabõ aus Anlaß eines Feiertages verwendet (siehe mämäräk, mərəqat).
"Das Hebräische Denken sieht im gesprochenen Wort eine wirkende Macht. Seine
Wirkung hängt freilich von Art und Bedeutung der sprechenden Persönlichkeit ab.
Bestimmte Menschen sind mit besonderer Segensmacht begabt. Das kann bei
sterbenden mit der Todesnähe zusammenhängen (Jakob im 1. Mose 48), es kann
Folge einer außerordentlichen Veranlagung sein (wie bei Bileam in 4. Mose 22-
24)
mahəbärawī täqwām
{ማሕበ ራዊ ተÌም}
"Institution"
mäləs {መልስ } hergeleitet von mämäläs "antworten"; Das Wort mäləs bezieht sich auf die dem
Tag der Hochzeit folgende Nachfeier, die am dritten Tag seitens der Brautfamilie
veranstaltet wird. Diese Feier findet immer nur am Abend statt. Ziel ist das gegen-
seitige Kennenlernen der Angehörigen beider Familien.
mämäräq {መመረ ቅ } "segnen"; hergeleitet von mərəqāt "Segen"; bezieht sich auf die Handlung (siehe
mäbaräk).
masinqõ {ማሲን ቆ } Einsaitige Kasten-Spießlaute, die eine große Rolle im weltlichen Musikbereich der
amārā spielt (siehe Abschnitt 3.5.4.). Der aus vier rechteckigen Holzteilen zu einer
Kastengestalt zusammengeleimte und mit Fell überdeckte Resonanzkörper der
masinqõ wird von dem langen Spieß žäng diagonal durchbohrt. Die Saite der
masinqõ wird aus Roßhaar yäfäräs çərā hergestellt. Sie läuft vom unten herausra-
genden Ende des Spießes über den fellbespannten Resonator yädəmsə saən bis
zum drehbaren hölzerenen Wirbel mäqañā. An dem mäqaña wird dann die Saite
festgebunden.
Der Steg bərkumā steht in der Mitte des yädəmsə saən auf der gespannten Decke
qõdā. Die Saite läuft allerdings nicht über den Steg wie es bei der Kastenleier
kərār der Fall wäre, sondern durch ein für diesen Zweck in den Steg gebohrtes
Loch. Die Funktion des bərkumā ist bei beiden Instrumenten jedoch die gleiche,
nämlich das Anheben der Saiten und die Übertragung der Schwingungen auf die
Decke des Resonators.
Gespielt wird die masinqo mit einem Bogen aus Holz und Roßhaar dägan (siehe
žäng, yäfäräs çərā, yädəms saən, mäqañā, bərkumā, kərār und dägān).
mažägağā bēt {ማዘ ገ ጃ
ቤት}
"Rathaus"
mänž{መን ዝ } Ortsname in der Region Šäwā.
mänžumā {መን ዙማ} Oberbegriff für Besessenheitslieder (siehe žəyärā).
161
mäqañā {መቃኛ } hergeleitet von mäqañät "stimmen". Mäqañā ist die Bezeichnung für die hölzer-
nen Knebeln oder Wirbel, die für das Stimmen von Saiteninstrumenten wie z.B.
die Kastenleier kərār, die einsaitige Kasten-Spießlaute masinqõ und die Kastenlei-
er bägänā gebraucht werden (siehe kərār, masinqõ und bägänā).
mär'ā {መር ዓ } [gə'əž- Sprache] Hochzeit (siehe särg)
mär'āt {መር ዓ ት} [gə'əž- Sprache] Braut; Eine Frau, die zum ersten Mal heiratet (Johannes 3: 29).
Zu Ihrer Hochzeit zieht sie ein schönes Kleid an und wird von vielen Feiernden
Hochzeitgästen begleitet (siehe mušərīt). Weitere nachzulesende Stellen in der
Bibel sind u.a. Salomo 4: 1-15; 5: 9-16; 6: 4-10, Heskiel 16; Epheser 5: 25-33 usw.
mär'āwī {መር ዓ ዊ } [gə'əž- Sprache] Bräutigam; Einer, der zum ersten Mal heiratet, angetan mit ge-
schmückter Bekleidung und begleitet von vielen Feiernden bzw. Hochzeitgästen
(Matthäus 26: 1-6, siehe mušərā). Desweiteren ist nachzulesen u.a. in Jesaja 62: 5;
Matthäus 9: 15; Johannes 3: 29....usw..
mäswā'ət {መሰ ዋት} Gabe an Gott, um ihm zu danken und zu huldigen, um seine Hilfe zu erbitten, um
Schuld zu sühnen (siehe qədūs qurbān), siehe 3. Mose 1: 9, Markus 7: 10). Es gibt
u.a. sogenannte Brand-, Dank-, Sünd-, Speis- und Trank-, Einsetzungs- und Räu-
cheropfer, bei denen verschiedene Funktionen erfüllt werden (siehe u.a. Matthäus
26: 26-28; Markus 14: 22-24, Lukas 22: 19-20, 1. Korinther 11: 20 und 26, Apos-
telgeschichte 2: 42, 20: 7).
məhrī {ምህ ሪ } [haräriña Sprache] Ein bestimmtes Eigentum, das einer Frau bei einer Eheschlie-
ßung zusteht laut Heiratstradition der harärē in Südostäthiopien.
mənəžər {ምን ዝር } hergeleitet von amänžärā = Jemand, der die Ehe eines anderen bricht, indem er mit
dessen Frau eine sexuelle Beziehung eingeht. Im Alten Testament wurde ein sol-
cher Mensch zum Tode verurteilt (siehe 3. Mose 20, Korinther 6: 9-18). In der
amārā-Tradition wird dies als eine Schande betrachtet (siehe sesäñnät).
mərāt {ምራት} "Schwiegertochter"; Diese Bezeichnung gilt mər'āt nur für ihre Schwiegereltern.
Dagegen heißt sie warsā gegenüber ihren angeheirateten Schwägern und ayət ge-
genüber ihren angeheirateten Schwägerinnen.
mətād {ምጣድ} məād ist eine aus Ton hergestellte große, flache Pfanne, die traditionell zum
Backen von ənğärā verwendet wird.
miklõl {ሚክሎል} ist ein hebräisches Wort und bedeutet herrliche Kleidung; absolutes und hochge-
schätztes Geschenk (siehe Heskiel 23: 12).
məsīrä täklīl {ም|ጢረ
ተክ ሊል}
"Geheimnis des täklil" (siehe täklīl)
mižē {ሚዜ } [engl. best man]. Begleiter/in des Brautpaares am Hochzeitstag (siehe Joh. 20)
mulmūl {ሙልሙል} Brötchen, das nur zu dem sogenannten buhe-Fest gebacken wird (siehe būhē).
muqäççā {ሙቀጫ} Mörser aus Holz von mindestens 1m Höhe zum Stampfen von Getreide und Kör-
nerfrüchten
mušərā {ሙሽራ} "Bräutigam"; mušərā ist ein Mann, der in der Regel zum ersten Mal heiratet. Er
trägt geschmückte Kleidung und wird von vielen Feiernden əddəmətäñõč begleitet
(Matthäus 25: 1-6, Joh. 2: 9)
mušərīt {ሙሽ ሪ ት} "Braut"
nägarīt {ነ ጋ ሪ ት} hergeleitet von mängär "sprechen, sagen"; Die Bezeichnung nägarīt bezieht sich
auf die große Kesselpauke, die zu früheren Zeiten für staatliche Feierlichkeiten
verwendet wurde.
näälā {ነ ጠላ } Ein lose hängendes Wickeltuch mit farbigen Bordüren əlät an beiden Enden. Zu
dem näälā gehört das Kleid mit dem passenden əlät. Das Kleid nennt man
šämmā.
nə'us bä'al {ን ዑስ በ ዓ ል} [gə'əž-Sprache] kleinere Feier (siehe abəy bä'āl)
nikā {ኒ ካ } [haräriña Sprache] Religiöse Heiratsform bei den harärē in Südostäthiopien,
Region Harär.
162
oromõ {ኦ ሮሞ} Das Volk der oromõ bildet zahlenmäßig die größte Bevölkerungsgruppe Äthiopi-
ens. Es gehört zu den Kuschiten. Die oromõ leben u.a. in den Regionen Wälläga
(Westäthiopien), Šäwā (Zentraläthiopien) und Harär (Südostäthiopien). Ein Teil
der oromõ-Bevölkerung lebt von der Viehzucht. Dies betrifft vor allem die Be-
wohner der trockenen Gebiete in der Region Harär. Der größte Teil dagegen lebt
vom Ackerbau und ist somit auch seßhaft. Die aus Zentraläthiopien stammenden
oromõ bekennen sich zum Christentum, während diejenigen, die aus den Randge-
bieten Süd-, West- und Ostäthiopiens muslimischen Glaubens sind.
Desweiteren sind die oromõ bekannt für ihr sogenanntes gadā-System, ein System
von Altersklassen, das heute noch in fast allen oromõ-Gebieten weitergepflegt
wird.
qāl kidān {ቃል ኪዳ ን } bedeutet Liebesbund, Eid, ein friedliches Gesetz, das zwei Seiten wie z.B. einen
Mann und eine Frau vereint.
qäläbät {ቀ ለ በ ት} ein Ring, der aus Gold, Silber oder anderen Materialien hergestellt wird. Im Ehele-
ben tragen Mann und Frau den Ehering als Zeichen ihrer Verbundenheit.
qalləččā {ቃልቻ} siehe žār und awäliyā.
qänbär {ቀ ን በ ር } Jocharm der Saiteninstrumente kərār, bägänā und masinqõ.
qəbə'ā qədūs {ቅብዓ
ቅዱስ }
heiliges Öl zur Salbung der Gesegneten
qədūs qurbān {ቅዱስ
ቁ ር ባ ን }
"heiliges Gelöbnis"; Es ist auch ein Zeichen der Einigkeit (siehe 1. Korinther 10:
14-20, 11: 27-30).
"Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und
brach's und sprach: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu
meinem Gedächtnis."
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: "Dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blut das tut sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Ge-
dächtnis. Denn sooft ihr von diesem Brot eßt und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herren, bis er kommt"
"Wer nun unwürdig von dem Brot ißt oder aus dem Kelch des Herren trinkt, er
wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich
selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so
ißt und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der ißt und trinkt sich sel-
ber zum Gericht" (siehe Korinther 11: 23-29).
Die Bezeichnung qədus qurbān bedeutet auch Opfergabe, guter Weizen und Wein-
trauben ohne Alkohol; ein besonders kostbares Geheimnis.
Das Bibelwörterbuch erläutert den qurbān [gə'əž-Sprache] folgendermaßen:
"Das Wort, das im Alten Testament das Gott dargebrachte Opfer bezeichnet (3.
Mose 1; 4. Mose 7), leitet im frühen Judentum die in Markus 7: 11 zitierte Gelöb-
nisformel für Weihgeschenke ein. Mit dieser Formel konnte man den Tempel zum
alleinigen Erben seines Besitzes einsetzen. Das Eigentum, das mit "Korban" Gott
geweiht war, durfte nicht mehr verkauft werden; doch hatte der Besitzer bis zu
seinem Tod das Nutznießungsrecht" (siehe mäswa'ət = "Opfergabe").
qələqəl {ቅ ልቅ ል} "Mischung", hergeleitet von mäqälaqäl "mischen". Das Wort bezieht sich auf die
am der Hochzeit folgenden Donnerstag stattfindende Feier. Das Ziel dieses Festes
ist die Vorstellung der Familienangehörigen des Brautpaares (siehe mäləs)
qənē {ቅ ኔ } "Dichtung", hergeleitet von mäqqäñät "stimmen"
qəñət {ቅ ኝ ት} Eine nach bestimmten Regeln gestimmte Tonreihe, die vorwiegend im Zentralen
Hochland Äthiopiens gebräuchlich ist.
qõdā {ቆ ዳ } "Fell, Leder"; Decke des Resonanzkörpers
163
qubāt {ቁ ባ ት} Frau, die von verheirateten oder ledigen Männern als Nebenfrau zum sexuellen
Lustobjekt benutzt wird. (siehe 1. Mose 16: 1; 22: 24; Richter 8: 31; 19: 1-2; 2.
Samuel 3: 7; 5: 13). Im Alten Testament wurde der zusätzliche Kontakt zu einer
Nebenfrau erlaubt (siehe u.a. 2. Mose 21: 7-11; 5. Mose 21: 10-14). Auch im Neu-
en Testament hatten Leute wie Abraham (1. Mose 25: 6), Jakobus (1. Mose 35 :
22), Dawid (2. Samuel 5: 13), Solomon (1. Könige 11: 3) usw. Nebenfrauen (siehe
yäçən gäräd).
qur'ān{ቁ ር ዓ ን } "Koran"
rabə’{ራብዕ } 4. Ordnung des amarischen Syllabars
rähäbu {ረ ,ቡ} [haräriña Sprache] "wir akzeptieren"; Der Inhalt hängt mit einer Heirat zusam-
men.
sabə’{ሳ ብዕ } 7. Ordnung des amarischen Syllabars
sadəs {ሳ ድስ } 6. Ordnung des amarischen Syllabars
saləs {ሳ ልስ } 3. Ordnung des amarischen Syllabars
sämanya{ሰ ማን ያ } Bezieht sich einerseits auf die Zahl 80 und andererseits auf den insbesondere in
den ländlichen Gegenden Äthiopiens zwischen einem Mann und einer Frau abge-
schlossenen traditionellen Ehevertrag.
säm{ሰ ም} lit. = "Wachs"; Das Wort steht mit der oberflächlich klaren Bedeutung eines Ge-
dichtes im Zusammenhang (siehe wärq).
säratäñā {\ራተኛ } "Arbeiter"; Steht im Zusammenhang mit einem Dienstmädchen (siehe gäräd).
šämmā {ሸ ማ} Stoff, der aus gesponnener Baumwolle hergestellt wird. Daraus werden verschie-
dene Bekleidungen von traditionellen Webern und Schneidern hergestellt.
sändäl {ሰ ን ደ ል} "Sandelholz"; Ist in Äthiopien weitgehend gebräuchlich und zwar sowohl bei žār-
Sitzungen als auch bei alltäglichen traditionellen Kaffezeremonien. Das Verbren-
nen von Sandelholz hängt mit der Anbetung von höheren göttlichen Wesen zu-
sammen.
särg/mär'ā {\ር ግ /መር ዓ } "Hochzeitsfest"; Hochzeitsfest, auf dem sich sowohl Brautpaar als auch Gäste,
Begleiter bzw. Angehörige schön kleiden. In der Bibelgeschichte ist über verschie-
dene Eheschließungen, Ehen und Hochzeitsfeiern geschrieben worden (siehe 1.
Mose 29: 21-26, Könige 14, Matthäus 22: 1-4; 25: 1-13, Johannes 2: 1-11).
Eine Hochzeit ist ein mit großer Freude verbundenes Fest. Wenn der Bräutigam
die Braut nach der Hochzeit nach Hause zu sich nimmt, wird das Paar von einer
großen Menschenmenge empfangen, die für ihn singt und klatscht. Die Auferste-
hung Jesus' ähnelt dieser Handlung und wird mit großer Freude, Respekt und einer
Hochzeit verglichen (Johannes 19: 7-9; siehe Bibelwörterbuch).
"Das Himmelsreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichte-
te. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit einzuladen; doch sie
wollten nicht kommen (Matthäus 22: 1-3; siehe yäsärg ləbs, mär'ā, mär'āt, mušərā,
mušərit).
šäriā {ሼሪ ያ } "Moslemisches Gericht"
šəbšäbā {ሽ ብሸ ባ } "Kirchentanz"
sesäñənät {ሴሰ ኝ ነ ት} "sexuelle Triebhaftigkeit"; Das Bedürfnis neben der Ehefrau noch mit einer ande-
ren Frau sexuelle Beziehungen zu haben (siehe 1. Korinther 6: 9; siehe mənəžər)
164
šəmagəlē mälāk{ሽ ማግሌ
መላ ክ }
Schicken von Ältesten bzw. Gesandten zwecks Heiratsvorbereitungen; in der
amārā-Traditon wird es əlõš gennant.
Im Bibelwörterbuch ist bezüglich der Achtung der Ältesten folgendes nachzulesen:
"Die Stellung der "Ältesten" gründete ursprünglich in der Würde des Alters. In
Familie und Sippe gilt die Autorität der Ältesten. Obwohl im Grundsatz alle Fami-
lienoberhäupter den gleichen Rang hatten, übten sie im größten Verband des
Stammes der Häupter der mächstigsten Familien die Autorität aus, im Krieg als
Anführer und in Frieden durch Rechtsprechung. Sie bildete eine Art Adel."
Ferner ist anhand der Bibelgeschichte festzustellen, dass zu verschiedenen Zeiten
und Orten die Ältesten eine wichtige Rolle gespielt haben (siehe 1. Mose 50: 7, 2.
Mose 3: 16, 24: 1, 4. Mose 11Ö 24-25, 22: 7, 1. Samuel 5: 3, 1. Korinther 8: 1, 6:
1-6). Älteste genießen in vielen Traditionen Äthiopiens Respekt und Achtung. Das
Altwerden wird als Würde angesehen.
sodõm {ሰ ዶም} Das Wort kommt von einer Ortsbezeichnung. Es gab in der Geschichte des Alten
Testaments zwei kanaanitische Städte, die als sodõm und gomõrā bekannt waren
und die wegen ihrer Sünden vernichtet wurden. Vielleicht am Südostufer des Toten
Meeres gelegen, sind sie wahrscheinlich schon in der mittleren Bronzezeit durch
eine Naturkatastrophe untergegangen. Diese Städte waren ein Symbol der Ver-
ruchtheit, da die Bewohner Sodoms sogar mit den Engeln, die Lot besuchten, ge-
schlechtlichen Umgang suchten (siehe Bibelwörterbuch, siehe sodõmawəyān).
sodõmawəyān
{ሶ ዶማዊያ ን }
"Menschen aus Sodom"
sõmale {ሶ ማሌ} Die ethnische Gruppe sõmale lebt in Südostäthiopien in der Region harär und
besetzt einen Großteil dieser Region. Die sõmale zählen zu den Nomadenvölkern
und leben im heißen und trockenen Buschland. Das Volk der sõmale bekennt sich
außschließlich zum Islam. Für ihre Sozialordnung ist jedoch der sogenannte clan
von wichtiger Bedeutung.
äbäl {ጠበ ል} "Weihwasser"
ägära bərrə {ጠገ ራ
ብር }
"Maria Theresia Silbertaler"; Das Maria Theresia Silbertaler war bei Handeltrei-
benden von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 2. Weltkrieges in Äthi-
opien im Verkehr. Es wurde auch von den Einheimischen als yämar täresa bərrə
bzw. ägära bərrə bezeichnet.
äğ {ጠጅ} "Äthiopischer Honigwein" (siehe ällā)
täkällälä {ተከ ለ ለ } "er wurde verdeckt, er wurde bekleidet" (Hebräer 2: 9- siehe miklol).
täklīl {ተክ ሊል} Christlich-orthodoxe Trauungszeremonie, die in einer Kirche stattfindet.
lit. = "Eheschließung der noblen Klasse, Eheversprechen"; Diese Eheschließungs-
form findet in einer Kirche zwischen einem Bräutigam mär'āwī und einer Braut
mär'āt [jeweils gə'əž-Sprache] statt. Sie gilt dann als eine gesegnete Ehe und kann
somit nicht geschieden werden, wegen des religiösen Eheversprechens bzw. des
Eides. Diese Feierlichkeit wird als täklil bezeichnet, wegen der schönen und deko-
rativen Kleidung des Brautpaares, wegen der schönen Geschenke aus Gold und
Edelsteinen und der Blumenkrone (siehe Bibelwörterbuch, siehe məsīrä täklīl).
ällā {ጠላ } Äthiopisches Bier, vor allem hergestellt im Zentralen Hochland (siehe äjj).
täqäbay {ተቀ ባ ይ} hergeleitet von mäqäbäl "nehmen, annehmen"; Die täqäbay sind die gesanglichen
Begleiter des awrāğ in einem Wechselgesang (siehe awrāğ ).
awənt {ጣውን ት} "Widersacher, Rivale, Gegenspieler"; Wenn ein Mann zwei Frauen hat, so werden
diese Frauen in der amarəñā-Sprache awənt genannt und umgekehrt wird die
gleiche Bezeichnung für zwei Männer gegeben, die in Liebe einer Frau gehören (1.
Samuel 1: 6).
əlõš{ጥሎሽ } Die Übergabe von Geschenken am Vorabend des Hochzeitstages. Die Hochzeits-
geschenke der Braut werden vom Bräutigam oder seinen Eltern durch seine Beglei-
ter geschickt.
165
təžətā {ትዝታ} Literarisch bedeutet təžətā "Nostalgie". Mit diesem Begriff bezeichnet man ferner
die erste qəñət in der Musik der amārā (siehe batī, ančī hoyē länē und ambassäl).
ēff {ጤፍ} Eine Hirsenart, die vermutlich nur in Äthiopien wächst und als Hauptnahrungsmit-
tel insbesondere im Zentralen Hochland Äthiopiens verwendet wird. Aus eff wird
das sogenannte ənğärā hergestellt (siehe ənğärā).
ənqõlā{ጥን ቆ ላ } "Geisterbeschwörungen im Zusammenhang mit schwarzer Magie". In Äthiopien
wird diese Tradition heute noch weitgehend in vielen Orten, vor allem in dörfli-
chen Gebieten praktiziert.
wärq{ወር ቅ } lit. = "Gold"; Die Bezeichnung bezieht sich jedoch auf die versteckte bzw. ver-
deckte Bedeutung eines Gedichtes (siehe säm).
warsā {ዋ ር ሳ } Jemand, der die Ehefrau seines Bruders zu seinem Eigentum macht. In Israel wur-
de der Name desjenigen, der ohne einen Nachkommen stirbt so aufrechterhalten,
dass dessen Bruder oder ein enger Verwandter seine Ehefrau heiratete (1. Mose
25: 4-10; Rut 3: 12; 4: 12).
wašənt {ዋሽ ን ት} randgeblasene Längsflöte aus Bambus mit vier bis fünf Grifflöchern, typisches
Hirteninstrument (siehe Abschnitt 1.4.1.9.)
yä'abāt ləbs {የ አ ባ ት
ልብስ }
"Väterbekleidung"; Dabei handelt sich um ein bestimmtes Geschenk, das ein Bräu-
tigam neben anderen Geschenken, die er für die Braut besorgt, auch für den Braut-
vater mitbringen soll. Meistens ist ein solches Geschenk eine traditionelle Beklei-
dung wie beispielsweise ein gābī (siehe yä'ənāt ləbs)
yäbahəl gabəččā {የ ባ ሕል
ጋ ብቻ}
"traditionelle Eheschließungsform"; (siehe gabəččā, yäləmad gabəččā, yähayma-
not gabəččā und bəherawī gabəččā).
yä bētä kəhənät mäžmur
{የ ቤተ ክ ህ ነ ት መዝሙር }
"religiöser Chorgesang"
yäbetä žämäd guba'ē
{የ ቤተ ዘ መድ ጉ ባ ኤ}
"Familienkommission"
yäcagula bēt {የ ጫጉ ላ
ቤት}
Ein Haus oder Raum, wo ein Brautpaar seine Flitterwochen verbringt.
yäçən gäräd {የ ጭን
ገ ረ ድ}
Mätresse mit Dienstmädchenfunktion (siehe Abschnitt 2.1.3.3.)
yädabbõ səm {የ ዳ ቦ |ም} hergeleitet von dabbõ "Brot" und səm "Name". Der Brotnamen wird auf einer
Hochzeitsfeier für die Braut ausgesucht. Den neuen Namen dürfen nur die Ver-
wandten einschließlich der Eltern des Bräutigams benutzen. Ihre eigene Verwandt-
schaft und Familie benutzt weiterhin den ursprünglichen Namen.
yäfäräs çərā {የ ፈ ረ ስ
ጭራ}
"Pferdeschwanz"; Das Wort bezieht sich auf das Roßhaar, das als Saite und für den
Bogen dägān der masinqõ verwendet wird (siehe masinqõ).
yägosā märī {የ ጎ œ መሪ } "Häuptling"
yägabəččā əlät {የ ጋ ብቻ
ዕ ለ ት}
"Tag der Eheschließung"
yähaymanõt gabəččā
{የ ሐይማኖት ጋ ብቻ}
"religiöse Eheschließung"; Diese Art der Eheschließung wird sowohl in den Städ-
ten als auch in den ländlichen Gebieten praktiziert (siehe gabəččā, yäləmād
gabəččāund bəherawi gabəččā)
yähəžəb yäkəbərə
mäžəgäbə
{የ ሕዝብ የ ክ ብር መዝገ ብ}
"Volksehrenbuch"; (siehe yäkəbərə mäžgäb šūm).
yäkəbərə mäžəgäb šūm
{የ ክ ብር መዝገ ብ ሹም}
"Standesbeamter" (siehe yähəžəbə yäkəbərə mäžəgäb).
yä'agär bahəl ləbs
{የ ሀ ገ ር ባ ሕል ልብስ }
lit.= "Landestracht"; Allgemeiner Begriff für die traditionelle Bekleidung der
amārā (siehe yäbahəl ləbs, təlõš)
yä'angät habəl {የ አ ን ገ ት
ሐብል}
"Kette"; Eine Braut bekommt zu ihrer Hochzeit u.a. eine Kette aus Gold oder Sil-
ber von ihrem zukünftigen Ehemann geschenkt (siehe əlõš).
166
yäçən gäräd gabəččā
{የ ጭን ገ ረ ድ ጋ ብቻ}
Eine Beziehung bzw. eine Scheinehe, in der die Frau eine doppelte Rolle sowohl
als Dienstmädchen als auch als Ehefrau spielt (siehe gabəččā, yäləmād gabəččā,
bəherawi gabəččā und yähaymanõt gabəččā).
yä'əgər aləbõ {የ እ ግ ር
አ ልቦ }
"Fußkette"; Eine Braut bekommt zu ihrer Hochzeit u.a. eine Fußkette aus Gold
oder Silber von ihrem zukünftigen Ehemann geschenkt. Dies geschieht mehr in den
ländlichen amārā-Gegenden (siehe əlõš).
yä'əjj ambār {የ እ ጅ
አ ምባ ር }
"Armband"; Eine Braut bekommt zu ihrer Hochzeit u.a. ein Armband aus Gold
oder Silber von ihrem zukünftigen Ehemann geschenkt (siehe əlõš).
ambarõč [Plural zu ambār] werden aus verschiedenen Materialen wie beispiels-
weise Gold und Silber hergestellt. Beim Heiraten bekommt die Braut vom Bräuti-
gam ein Armband geschenkt (siehe 1. Mose 24: 22; 28: 18).
yä'ənat ləbs {የ እ ና ት
ልብስ }
"Mütterbekleidung"; Hierbei handelt sich um ein bestimmtes Geschenk, das ein
Bräutigam neben anderen Geschenken, die er für die Braut besorgt, auch für die
Mutter der Braut mitbringen soll. Meistens ist ein solches Geschenk eine traditio-
nelle Bekleidung wie beispielsweise ein kutā (siehe yä'abāt ləbs)
yäğorõ gutəččā {የ ጆሮ
ጉ ትቻ}
"Ohrring"; Eine Braut bekommt zu ihrer Hochzeit u.a. ein Paar Ohrringe aus Gold
oder Silber von ihrem zukünftigen Ehemann geschenkt (siehe əlõš).
yäkərəstənā səm
{የ ክ ር ስ ትና |ም}
"Taufname"; In der christlich-orthodoxen Kirche Äthiopiens bekommt ein Kind
bei seiner Taufe seinen religiösen Taufnamen. In der Regel werden Jungen am 40.
und Mädchen am 80. Tage nach der Geburt getauft. Am Hochzeitstag muss das
Brautpaar vor der religiösen täklīl-Zeremonie dem zuständigen Geistlichen jeweils
die Taufnamen ansagen, da es unter der Angabe dieser christlichen Namen ihr
Eheversprechen machen soll.
yäləmad gabəččā
{የ ልማድ ጋ ብቻ}
"Traditionelle Eheschließungsform"
Yälğõčžäfänoč
{የ ልጆች ዘ ፈኖች}
"Kinderlieder"
yämäsõb wärk {የ መሶ ብ
ወር ቅ }
Runder handgefertigter Korb in verschiedenen Größen
yämušəra ləbs {የ ሙሽ ራ
ልብስ }
"Hochzeitsgewand" - (siehe 2. Samuel 13: 8, Matthäus 22: 11; siehe mär'āt und
särg)
yäməsgana žäfänoč
{የ ም|ጋ ና ዘ ፈኖች}
"Preislieder"; Solche religiösen Preisgesänge werden in der christilich-orthodoxen
Tradition Äthiopiens während der langen Fastenzeit vor Ostern gesungen. Als
Begleitinstrument wird die Kastenleier bägänā benutzt.
yäməsərač {የ ም|ራች} "Glückwunsch"; Am folgenden Tag einer Hochzeitsfeier bringen in der amārā-
Tradition die männlichen Begleiter des Bräutigams mižēwõč für die Brautfamilie
eine Flasche äthiopischen Honigweins äğ oder äthiopischen Bieres ällā, ein mit
Blut beschmiertes Taschentuch usw. als Bestätigung dafür, dass die Braut eine
Jungfrau war. Die Brautfamilie wird damit beglückwünscht (siehe mižēwoč, äğ
und ällā).
yänägär abāt {የ ነ ገ ር
አ ባ ት}
hergeleitet von nägär "Angelegenheit" und abāt "Vater"; In der Tradition der
amārā wird während der gesamten Verhandlungen zwischen der
šəmagəlēwõč, eine Gruppe von Gesandten, die eine andere Familie um den Er-
laubnis bittet, ihre Tochter für eine Heirat freizugeben, und der Familie der Hei-
ratskandidatin eine verantwortliche Person aus dieser Gruppe gewählt, die als
Redner eine wichtige Rolle spielt, bis zur endgültigen Heirat (siehe šəmagəlē
mälak)
yäpolätika žäfänõč
{የ ፖለ ቲካ ዘ ፈኖች}
"politische Lieder"
yäqäläbät əlät {የ ቀ ለ በ ት
ዕ ለ ት}
"Verlobungstag"; Dieser Tag wird in der amārā-Tradition entweder gesondert
gefeiert, oder er fällt mit der Haupthochzeitsfeier zusammen (siehe yäqäläbät
bä'āl).
yäqäläbät bä'āl
{የ ቀ ለ በ ት በ ዓ ል}
"Verlobungsfeier"
167
yäqənē mäsahəft {የ ቅ ኔ
መጻ ሕፍት}
"Gedichtssammlungen"
yäqədassē žēmā {የ ቅ ዳ ሴ
ዜማ}
"Messegesang"
yäsärg žäfän {የ \ር ግ
ዘ ፈ ን }
"Hochzeitslied"
yäsərā žäfänõč {የ |ራ
ዘ ፈኖች}
"Arbeitsgesänge"
žäfän {ዘ ፈ ን } "Lied, Gesang"; žäfän ist ein Zeichen der Freude, das mit Hilfe von poetischen
Versen und Strophen und mit Begleitung von diversen Musikinstrumenten zum
Ausdruck gebracht wird.
žäfän findet u.a.
- zum Geburtstag (siehe Hiob 21: 11-12, Matthäus 14: 6)
- zur Hochzeit (siehe Jeremia 31: 4, Matthäus 11: 17)
- zu Nationalfeiertagen wie z.B. Heldenverehrungen (siehe 2. Mose 15: 20-21,
Könige 11: 34,
1. Samuel 18: 6) und
- zu religiösen Festen bzw. Feiertagen (siehe 2. Samuel 6: 14) statt.
žägän {ዘ ገ ን } [haräriña Sprache]; Das Wort bezieht sich auf die Übergabe von Hochzeitsge-
schenken in der Tradition bei den harärē in Südostäthiopien, in der Region Harär
(siehe əlõš).
žänäžänā {ዘ ነ ዘ ና } "traditionelles Haushaltsgerät der amārā"; Ein rundes, ca. 1m langes Stück Holz,
mit dem man Getreide zerstampfen kann.
žār {ዛ ር } Besessenheitsritus, der in vielen äthiopischen Kulturen praktiziert wird (siehe awä-
ləyā und qalləččā).
žār wärädä {ዛ ር ወረ ደ } Der Moment, in dem ein Besessener mit einem žār-Geist Verbindung aufnimmt
žäwəd {ዘ ውድ} "Kaiserkrone"; Eine žäwəd ist eine verehrte und hochgeschätzte Krone, die aus
Gold, Silber, Edelsteinen und Diamanten hergestellt wird und nur für die Benut-
zung königlicher Familien gedacht ist (siehe Bibelwörterbuch; siehe 2. Chronik 23:
11, Heskiel 21: 26, Ester 2: 17, Johannes 19: 2, siehe täklīl, miklõl undaklīl). In der
Bibel ist zur ehrenhaften Krone u.a. folgendes nachzulesen:
"Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel; mit Preis und
Ehre hast du ihn gekrönt" (siehe Häbräer 2: 7).
"Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre" (siehe
Hebräer 2: 7-10).
žəyärā {ዝየ ራ} " Singen von Besessenheitsliedern" (siehe mänzumā)