Frank Hirsch, Juden in Merzig zwischen Beharrung und Fortschritt. Eine kleinstädtische Gemeinde im...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Frank Hirsch, Juden in Merzig zwischen Beharrung und Fortschritt. Eine kleinstädtische Gemeinde im...
Frank Hirsch, Juden in Merzig zwischen Beharrung
und Fortschritt. Eine kleinstädtische Gemeinde im
19. Jahrhundert, Trier 2014 (Geschichte & Kultur.
Saarbrücker Reihe 4)
341 S., geb., 15,8 cm × 24 cm, 750 g, 15 Abb., 17 Tab.
978-3-89890-188-8 € 52,00
http://www.kliomedia.de/978-3-89890-188-8
Geschichte & Kultur
Band 4
Kliomedia • Trier
Herausgegeben von
Gabriele B. Clemens, Dietmar Hüser
und Clemens Zimmermann
Saarbrücker Reihe
Kliomedia • Trier 2014
Frank Hirsch
Juden in Merzig zwischen
Beharrung und Fortschritt
Eine kleinstädtische Gemeinde
im 19. Jahrhundert
Inhalt
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1 Fragestellung und Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.3 Konzeption und Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Die Kleinstadt Merzig: Ein Ort an der Peripherie im 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1 Überregionale Grenzlage und regionales Zentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2 Am Übergang zur Industriegesellschat:
Die ökonomische Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.3 Arm und reich: Lokale Elite und soziale Unterschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3 Jüdische Minderheit im ländlichen Raum: Merzigs Gesellschaft im 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.1 Eine wachsende Minderheit: Bevölkerungsentwicklung und Sozialtopographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67a Langfristige Trends: Bevölkerung und Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67b Die jüdischen Einwohner als Teil einer katholischen Kleinstadt . . . . . . . . 87c Gemeinde und Synagoge: Bezugspunkte des geistigen Lebens . . . . . . . . . 96
3.2 Vernetzung als Strategie: Geschätsbeziehungen und Heiratsverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114a Nah- und Fernbeziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116b Aufstieg durch familiäre Netzwerkbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.3 Die Attraktivität des Standortes: Ein- und Auswanderung . . . . . . . . . . . . . . . 1323.4 Der Kampf um Ressourcen:
Innerjüdische und interkonfessionelle Konlikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144a Streit und Auseinandersetzungen in der jüdischen Gemeinde . . . . . . . . . 145b Antijüdische und antisemitische Agitation?
Konlikte von Juden mit Nicht-Juden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8 Inhalt
3.5 Gesellschatliches Engagement: Teilhabe und Inklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166a Zwischen Geselligkeit und Solidarität: Das Vereinswesen . . . . . . . . . . . . 166b Zwischen Inklusionswunsch und Unterstützungszwang: Die Teilhabe
an kommunaler Verwaltung und gemeinnützigem Engagement . . . . . . . 176
4 Strategien der Wohlstandssteigerung: Juden im Zeitalter der Industrialisierung . . . . . . . . . . . . . . . . 183
4.1 Ökonomischer Aufstieg: In einer Generation zum Wohlstand . . . . . . . . . . . . 183a Steuern und Abgaben als Indikatoren steigenden Wohlstandes . . . . . . . 183b Lebensstile: Das Inventar eines jüdischen Haushalts . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.2 Allgegenwart von Armut: Eine historische Konstante im ländlichen Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.3 Tradition und Beharrung? Berufe und Einkommensquellen . . . . . . . . . . . . . . 210a Viehhandel: Dominanz und Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211b Warenhandel: Vom Hausierer zum Kaufmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221c Jenseits des Handels: Existenz in der Nische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
5 Der Kreditmarkt als Motor der lokalen Wirtschaft . . . 2455.1 Die Bedeutung des privaten Kreditmarktes
für die ländliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245a Umfang und Zweck von Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247b Aktiva und Passiva: Gläubiger und Schuldner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253c Wege des Geldes: Eine Wirtschatstopographie des Kredits . . . . . . . . . . 263
5.2 Juden als Akteure auf einem regionalen Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270a Geldleihe als Einkommensquelle: Juden als Gläubiger . . . . . . . . . . . . . . . 272b Überleben und Investieren: Juden als Schuldner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280c Zins und Sicherheit: Die Bedingungen der Kreditvergabe . . . . . . . . . . . . 286d Regionale Vernetzung als Wettbewerbsvorteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
6 Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Quellen- und Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Datenbanken/Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Ungedruckte Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Gedruckte Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Literatur vor 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Literatur nach 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
1 Einleitung
1.1 Fragestellung und Methodik
Für den Nationalökonomen Werner Sombart stellte die enge Verbindung von Juden-tum und Urbanisierung eine selbstverständliche Tatsache dar. In seiner 1911 erschie-nenen Schrit „Die Juden und das Wirtschatsleben“1 führte er den wirtschatlichen Erfolg der Juden auf deren mangelnde Bindung an konkreten Grund und Boden zu-rück. „Die Großstadt aber ist die unmittelbare Fortsetzung der Wüste – sie steht der dampfenden Scholle ebenso fern wie diese und zwingt ihren Bewohnern ein nomadi-sierendes Leben auf wie diese“,2 so Sombart weiter über die Juden. Daraus habe sich eine abstrakte Vorstellung von Geld entwickelt, die gerade im Zeitalter des Kapitalis-mus einen entscheidenden Vorsprung vor den Christen gewährleistete.3
Ohne solche stereotypischen Vorurteile charakterisierte Simone Lässig fast 100 Jah-re später die Erfolgsgeschichte der Juden: „Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gelang den Juden im deutschen Kulturbereich ein wirtschatlicher und sozialer Aufstieg, der in Europa seinesgleichen suchte. Keine andere Sozialgruppe durchlief in dieser Zeit einen derartig dramatischen und erfolgreichen Verbürgerlichungsprozess.“4 Für Sombart wie für Lässig war jüdisches Leben vor allem ein städtisches Phänomen, dessen Potentiale mit der Industrialisierung zum Durchbruch gelangten. Gleich mehrere säkulare Pro-zesse veränderten die Sozialstruktur der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts grund-legend. Zunächst wurde infolge eines weit gespannten Emanzipationsdiskurses der rechtliche Rahmen modernisiert, der den Juden schließlich eine prinzipielle Gleich-stellung mit der christlichen Mehrheitsgesellschat gewährte.5 Mit dieser Diskussion
1 Vgl. Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschatsleben, Leipzig 1911.2 Ebd., S. 415. Sombart reproduzierte in der Schrit die gängigen antisemitischen Klischees und be-diente sich auch rassenideologischer Argumente.3 Sombart spricht von der jüdischen Beteiligung am Aubau des modernen Staates und an der Kom-merzialisierung der Wirtschat. Vgl. ebd., Kap. 5 u. 6.4 Simone Lässig, Jüdische Wege ins Bürgertum. Kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19. Jahrhundert, Göttingen 2004 (Bürgertum Neue Folge. Studien zur Zivilgesellschat 1), S. 13.5 Stellvertretend für die Vielzahl an Literatur zur Emanzipation der Juden sei hier die klassische Studie von Jacob Katz genannt. Auch bei ihm stand das städtische und gebildete Judentum im Mit-
10 1 Einleitung
waren Erwartungen und Forderungen verknüpt, die die Juden formulierten und die an sie gerichtet wurden.
Modernisiert hat sich auch die religiöse Praxis. Unter dem Eindruck der Auklä-rung, der gesamtgesellschatlichen Umwälzungen und nicht zuletzt durch staatliche Eingrife in die Gemeindeautonomie begann sich das religiöse Leben der Juden aus-zudiferenzieren. Mit der Orthodoxie und dem Reformjudentum entstanden zwei sichtbare religiöse Hauptströmungen, in denen die verschiedenen Vorstellungen ihren Ausdruck fanden.6 Eng damit verbunden war das jüdische Schulwesen, das die zahl-reichen Verwerfungen und Konlikte widerspiegelte.7 Gleichzeitig zu den rechtlichen und religiösen Veränderungen und früher als bei ihren christlichen Nachbarn vollzog sich ein tief greifender Wandel der Berufsstruktur. Am bemerkenswertesten war si-cherlich die Akademisierung der Juden, die zielstrebig in die Universitäten und hö-heren Bildungseinrichtungen drängten. Besonders in den freien Berufen waren Juden stark überdurchschnittlich vertreten.8
Alle diese sozialen Modernisierungsprozesse der Juden waren zum einen Ergebnis des gesamtgesellschatlichen Wandels in der Zeit der Industrialisierung, zum anderen aber verdichteten sich hier jüdische Speziika. Prinzipiell bildeten sie die Avantgarde, das heißt sie zogen früher und zahlreicher in die Städte, nutzten konsequenter die Chan-cen durch Bildung und induzierten damit eine grundlegende Berufsumschichtung. Für Simone Lässig stand dahinter ein Verbürgerlichungsprozess, der sich auf mehreren mit-einander verbundenen Ebenen vollzog. Die sozioökonomischen, politisch-rechtlichen und soziokulturellen Sphären bildeten Elemente einer Vergesellschatung, die ein ko-härentes Kulturmodell umfasste.9 Dementsprechend wurden Juden als „Kerngruppe des deutschen Bürgertums“10 bezeichnet, die sich gerade in den wachsenden Städten
telpunkt. Vgl. Jacob Katz, Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschat. Jüdische Emanzipation 1770–1870, Frankfurt a. M. 1986.6 Vgl. Mordechai Breuer, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich 1871–1918. Sozialgeschichte einer religiösen Minderheit, Frankfurt a. M. 1986, bes. S. 61–90 u. Michael A. Meyer, Response to Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism, Detroit 1988, bes. S. 62–99.7 Aus diesem Grund widmen sich Breuer und Lässig ausführlich der jüdischen Schule. Vgl. Breuer 1986, S. 91–139 u. Lässig, Jüdische Wege, S. 115–155.8 Vgl. zu diesem hemenkomplex Monika Richarz, Der Eintritt der Juden in die akademischen Be-rufe. Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678–1848, Tübingen 1974, bes. S. 164–217.9 Lässig orientiert sich an einem Bürgerlichkeitsbegrif wie er von Wolfgang Kaschuba und Jürgen Kocka herausgearbeitet wurde. Demnach umfasst er „Lebensführungspraktiken“, die auf „Arbeit, Leis-tung und Bildung, Vernunt und Öfentlichkeit, aber auch auf Selbstrelexion, Individualisierung und Intimität“ beruhten. Vgl. Lässig, Jüdische Wege, S. 19 f. Auf den Umstand, dass das „Bürgertum“ we-sentlich heterogener autrat, als es der Begrif suggeriert, wies u. a. Hans-Ulrich Wehler hin. Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschatsgeschichte. Bd. 2: Von der Reformära bis zur industriellen und politischen „Deutschen Doppelrevolution“ 1815–1845/49, 3. Aul., München 1996, S. 174–241.10 Till van Rahden, Von der Eintracht zur Vielfalt. Juden in der Geschichte des deutschen Bürger-tums, in: Andreas Gotzmann/Rainer Liedtke/Till van Rahden (Hrsg.), Juden, Bürger, Deutsche. Zur Geschichte von Vielfalt und Diferenz 1800–1933 , Tübingen 2001 (Schritenreihe wissenschatlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 63), S. 9–31, hier S. 13.
111.1 Fragestellung und Methodik
entfalten konnte. Nicht zufällig bildeten gerade sie die am meisten verstädterte Sozi-algruppe.11 Das beeinlusste auch die Forschungsperspektiven und Einschätzungen. So attraktiv die (groß-)städtischen Juden als Verkörperung der Moderne erschienen, so rückständig mussten die Juden vom Land sein. Das bewiesen die Juden mit ihrem Wanderungsverhalten schließlich selbst: Nach der frühneuzeitlichen Vertreibung aus den Städten, zogen sie nach der gewährten Freizügigkeit im Zuge der Emanzipations-gesetzgebung umso stärker in die aufstrebenden urbanen Zentren.
Als vermeintliche „Verlierer“ der Moderne waren ländliche Juden für die For-schung nur in zweiter Linie interessant: Das platte Land bildete den Herkuntsraum vieler Zuwanderer in die Städte und diente als Vergleichsfolie für die ungleich dy-namischeren Metropolen.12 Diese bildeten die Brennpunkte bei der Durchsetzung säkularer Prozesse wie der Kapitalisierung von Wirtschat und Gesellschat, der He-rausbildung des bürokratisierten Anstaltsstaates und der Rationalisierung in Kul-tur und Wissenschat.13 Auch die neuere Forschung identiiziert gerade die Stadt als „Modernisierungsagenten“.14 In ihr verdichteten sich die Leitideen der neuen Zeit, die alle Bereiche des Lebens einem tief greifenden Wandel unterzog. Der neue Takt der Arbeit, die ansteigende soziale und geographische Mobilität, die neuen Möglichkeiten der Kommunikation, die Technisierung und Verwissenschatlichung der Welt sowie die fortschreitende Institutionalisierung von Herrschat und Recht veränderten zuerst das Gesicht der Städte.
Die vielfältigen Verlechtungen mit dem ländlichen Raum, aber auch die Moderni-sierungsleistungen in Dorf und Kleinstadt, geraten somit aus dem Fokus. Die daraus resultierenden Deizite bei der Erforschung des Land- und Kleinstadtjudentums zur Zeit der Industrialisierung verhindern eine angemessene Würdigung speziischer Ent-
11 Vgl. Usiel Oscar Schmelz, Die demographische Entwicklung der Juden in Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1933, in: Bulletin des Leo Baeck Instituts 83 (1989), S. 15–62, hier S. 20 u. 24. So lebten im Jahr 1890 33,5 Prozent der Juden und 12,1 Prozent der Gesamtbevölkerung in Städ-ten mit mehr als 100.000 Einwohnern.12 Bereits 1990 verwies Monika Richarz auf die vielen weißen Flecken in der Erforschung des Landjudentums und plädierte für eine stärkere Hinwendung. Vgl. Monika Richarz, Viehhandel und Landjuden im 19. Jahrhundert. Eine symbiotische Wirtschatsbeziehung in Südwestdeutschland, in: Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 1 (1990), S. 66–88, hier S. 74. Besonders ihr sind weitere wichtige Arbeiten zu dieser Sozialgruppe zu verdanken.13 Hans-Ulrich Wehler lehnt sich bei seinem Modernisierungsbegrif stark an Max Weber an. Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschatsgeschichte. Bd. 1: Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära 1700–1815, 3. Aul., München 1996, S. 14. Das mit der klassischen Modernisierungstheorie verbundene Fortschrittsmodell wird heute durch die Beto-nung der Paradoxien und Dialektiken diferenziert. Vgl. Nina Degele/Christian Dries, Modernisie-rungstheorie. Eine Einführung, München 2005, S. 15–33.14 Als Stadt war besonders die aufstrebende Großstadt gemeint. Sie zeichnete sich nicht nur durch ein großes Bevölkerungswachstum und die Ansiedlung von Industriebetrieben aus, sondern auch durch neue Formen der administrativen und kulturellen Durchdringung. Vgl. Dieter Schott, Stadt und Moderne. Die Stadt als Modernisierungsagent?, in: Ute Schneider/Lutz Raphael (Hrsg.), Di-mensionen der Moderne. Festschrit für Christof Dipper, Frankfurt a. M. 2008, S. 459–479.
12 1 Einleitung
wicklungen. Dabei waren sie vom allgemeinen Trend nicht völlig abgekoppelt, sondern standen mit ihm nicht zuletzt durch die expandierende Infrastruktur und zahlreiche direkte und indirekte Beziehungen in einem vielschichtigen Wechselverhältnis. Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel, der jüdischen Landbevölkerung einen eigenen Wert beizumessen und ihre Rolle auf dem schwierigen Weg in die Moderne zu analysie-ren.15 Die Dichotomie von Tradition und Moderne, wie sie dem Land auf der einen und der Stadt auf der anderen Seite als Etikett angehetet wird, soll zugunsten einer diferen-zierten Sicht auf eine sich rasch wandelnde ländliche Gesellschat aufgelöst werden.16 Die gegenseitige Beeinlussung einerseits und die eigenen Modernisierungsleistungen des ländlichen Raums andererseits fanden bisher nur unzureichend Anerkennung.
Im Mittelpunkt soll die hese stehen, dass das ländliche und kleinstädtische Ju-dentum unter dem Einluss der politischen, wirtschatlichen und sozialen Umbrüche im 19. Jahrhundert ganz eigene Wege und Strategien fand. Während sich das (groß-)städtische Judentum – wie zuvor geschildert – durch einen Verbürgerlichungspro-zess auf den industriellen Entwicklungspfad begab,17 bewegten sich seine ländlichen Glaubensgenossen in anderen Bahnen und hatten mit verschiedenartigen Herausfor-derungen zu kämpfen. Der hese von Avraham Barkai, nach der die Juden gerade zur Zeit der Industrialisierung ihre wichtigsten Eigenschaten, nämlich Anpassungsfähig-keit und wirtschatlich-soziale Disponibilität, verloren und sich in einer Zustand der Beharrung begeben hätten, soll das Gegenbild eines in den Grenzen des Denk- und Machbaren lexiblen Landjudentums entgegengestellt werden.18 Sie verstanden es, In-
15 Die Beschätigung mit dem Verhältnis des Judentums zur Moderne konzentrierte sich bisher auf die Bereiche Kultur, Bildungswesen, Religion und Emanzipation. Vgl. hierzu Andreas Gotzmann, Eigenheit und Einheit. Modernisierungsdiskurse des deutschen Judentums der Emanzipationszeit, Leiden 2002 u. Karlheinz Schneider, Judentum und Modernisierung. Ein deutsch-amerikanischer Vergleich 1870–1920, Frankfurt a. M. 2005. Mit otmals biographischem Zugang vgl. die Essaysamm-lung von Leon Botstein, Judentum und Modernität. Essays zur Rolle der Juden in der deutschen und österreichischen Kultur 1848 bis 1938, Wien 1991. Ansätze einer sozioökonomischen Perspektive im Hinblick auf das ländliche Judentum inden sich hingegen bei Arno Herzig, Die westfälischen Juden im Modernisierungsprozeß, in: Shulamit Volkov (Hg.), Deutsche Juden und die Moderne, München 1994 (Schriten des Historischen Kollegs, Kolloquien 25), S. 95–118. Die weiteren Beiträge in dem Sammelband von Shulamit Volkov drehen sich wieder um die hemen Religion und Kultur.16 Zur Problematik des Begrifes Modernisierung als Entwicklungsparadigma vgl. Hans-Ulrich Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975. Er konstatiert, dass eben auch traditionale Gesellschaten nicht nur statisch gesehen werden dürfen. Auf die Schwierigkeiten, die Moderne als Epochenbegrif zu verwenden, wies Detlev Peukert in Anlehnung an Max Weber hin. Die Janusgesichtigkeit zeige sich in der kapitalistischen Wirtschat und in der rational-bürokratischen Nationalordnung ebenso, wie in der wissenschatlich-rationalen Weltbemächtigung. Vgl. Detlev Peu-kert, Max Webers Diagnose der Moderne, Göttingen 1989, S. 64.17 Gemeint ist nicht, dass die jüdische Stadtbevölkerung direkt in Industriebetriebe integriert war. Vielmehr proitierte sie in den vor- und nachgelagerten Bereichen wie Finanzierung und Einzelhan-del. Auch die freien Berufe expandierten infolge von Urbanisierung und Kommerzialisierung.18 Barkai sieht als herausstechendes Merkmal der Juden deren Festhalten an alten Berufsstrukturen infolge des ausgeprägten Wunsches nach Selbständigkeit. Anpassungsprozesse und die Integration
131.1 Fragestellung und Methodik
novationen auf die besonderen Umstände in einer Kleinstadt und auf dem Land an-gepasst einzuführen. Nicht zuletzt begünstigt durch die expandierende Infrastruktur standen die moderne Urbanität und das Land – sofern beide sich in räumlichem Kon-text aufeinander bezogen – in einem vielschichtigen Wechselverhältnis, wodurch eine strikte Trennung beider Sphären allenfalls analytisch hergestellt werden kann, in der Realität jedoch nicht existierte. Diese Verbindungen eröfneten gerade den überaus mobilen Juden auf dem Land Kanäle, über die sie in Kontakt mit Neuerungen und innovativen Verfahren kamen.
Die Strategien der Modernisierung zeigten sich auf mehreren Ebenen und betra-fen die alltäglichen Bereiche des jüdischen Lebens. Die Veränderungen lassen sich so-wohl ansatzweise in der Synagoge und Schule, als auch in sehr viel stärkerem Maße im Berufsleben und den Kontaktzonen zur christlichen Mehrheitsgesellschat, etwa im Vereinsleben, erkennen. Auch wenn das religiöse Leben von den Auseinanderset-zungen der Orthodoxen und Reformer unbehelligt blieb und sich in traditionellen Milieus bewegte, die Sorgen der jüdischen Eltern im Bereich der Bildung besonders die religiöse Erziehung betrafen und sich auch auf dem Gebiet des Erwerbslebens viele Kontinuitäten inden lassen, verrät die Analyse des säkularen Wandels in eben jenen Komplexen eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Es mag zwar an spektakulären Entwicklungen fehlen, etwa der genannten Akademisierung oder dem fulminanten Aufstieg prominenter jüdischer Unternehmer, doch lassen sich auch fernab der Indus-triestädte signiikante Modernisierungsprozesse nachweisen. Hier von einer Vorrei-terrolle zu sprechen wäre falsch, denn Innovationen wurden auf dem Land nicht initi-iert, sondern importiert. Durch die Industrialisierung unter Druck geraten, reagierten ländliche Regionen mit einer vorsichtigen Öfnung und adaptierten als Reaktion da-rauf Neuerungen aus den wirtschatlichen Zentren.19 Neben Innovationen, das soll im Folgenden etwa am Beispiel des Kauhauses als neuer Einzelhandelsvertriebsform exempliiziert werden, lassen sich jedoch noch weitere Strategien nachweisen, die als Versuch interpretiert werden können, den Herausforderungen der Moderne zu begeg-nen. Darunter soll sowohl die Nutzung persönlicher Netzwerkverbindungen, als auch die konsequente Anwendung bewährter Methoden wie des Kreditkaufs verstanden werden.20
Diese Feststellungen und Prämissen bedürfen allerdings der methodischen Präzi-sierung und räumlichen Konkretisierung. Für die vorliegende Arbeit wurde ein mik-rohistorischer Zugang gewählt, der sich an die microstoria, wie sie sich seit den 1970er
neuer Methoden thematisiert er nicht. Vgl. Avraham Barkai, Sozialgeschichtliche Aspekte der deut-schen Judenheit in der Zeit der Industrialisierung, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte 11 (1982), S. 237–260, hier S. 256 f.19 Auf die Bedeutung von Innovationen und ihre Difusion hat bereits Joseph A. Schumpeter hinge-wiesen. Vgl. Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklen. Eine theoretische, historische und statistische Analyse des kapitalistischen Prozesses, Göttingen 1961, S. 95–110.20 An dieser Stelle sei nur auf die bei jüdischen Händlern weit verbreitete Praxis von Kreditkäufen hingewiesen. Durch den Warenverkauf auf Kredit gelang es, die Käuferbasis zu vergrößern.
14 1 Einleitung
Jahren von Italien ausgehend etabliert hat, anlehnt.21 Der Begrif der Mikrohistorie grenzt sich von der älteren Lokalgeschichte dadurch ab, dass er sehr stark die größeren Zusammenhänge im Blick behalten und sich nicht in den Besonderheiten einer Regi-on oder Stadt verlieren möchte.22 Gleichsam wie mit einem Mikroskop eröfnet sie der Forschung neue Perspektiven und rückt neue Aspekte in den Mittelpunkt, die die Ma-krohistorie von ihrem erhöhten Standpunkt aus kaum wahrnimmt.23 Als Gegen- oder Komplementärmodell zur Struktur- und Gesellschatsgeschichte konzentrierte sie sich nicht auf die Gestalter des Fortschritts und der Moderne, sondern sie wandte sich stark den „kleinen Leuten“ zu. Nicht ohne Sympathie widmeten sich die Vertreter dieses Paradigmas den „geschichtslosen“ Schichten und wählten dabei otmals einen stark biographischen Zugang24 und wiesen selbst deutliche narrative Züge auf.25 Gemein ist Mikrostudien, dass sie in überschaubaren Einheiten stattinden, was zum einen pragmatisch an der Überlieferungssituation hängt, zum anderen aber konzeptionell den Vorteil bietet, dass sich in einem Dorf oder Landstrich mittels einer hinreichend detaillierten Beschreibung die komplexen Beziehungsgelechte, Zusammenhänge und kollektive Erfahrungen ofenlegen lassen. Die Mikrohistorie versteht sich nicht als bloße Anhäufung der erreichbaren Fakten, sondern als methodische Annäherung an die historische Lebenswirklichkeit.26 Mit Schlagworten wie „Sichtbarmachung des Unsichtbaren“ oder „Detailgeschichte des Ganzen“, die das Spannungsfeld zwischen Mikro- und Makro ebene versinnbildlichen, wurde das Programm umrissen.27 Das be-
21 Beispielhat demonstrierte Carlo Ginzburg am Leben und am Schicksal des friaulischen Müllers Menocchio den Erkenntnisgewinn durch Mikrohistorie. Vgl. Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt a. M. 1979. Neben Ginzburg befassten sich auch Giovanni Levi und Hans Medick mit den Chancen und Grenzen dieses methodischen Ansatzes. Vgl. dazu zum Beispiel Hans Medick, Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900. Lokalgeschich-te als Allgemeine Geschichte, Göttingen 1996 u. Giovanni Levi, On Microhistory, in: Peter Burke (Hrsg.), New Perspectives on Historical Writing, Oxford 1992, S. 93–113.22 Norbert Franz würdigte die außeruniversitäre Geschichtsschreibung lokaler Geschichtsvereine oder Privatpersonen als wichtigen Beitrag, weist aber auch auf die engen Grenzen hin. Vgl. Norbert Franz, Lokalgeschichte, Strukturgeschichte, Mikrogeschichte. Befunde und Perspektiven komple-mentärer Ansätze der Luxemburg-Forschung, in: Hémecht. Zeitschrit für Luxemburger Geschich-te 63 (2011), S. 153–162, hier S. 153 f.23 Vgl. Giovanni Levi, he Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspective, in: Jür-gen Schlumbohm (Hrsg.), Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Komplementär oder inkommensu-rabel?, Göttingen 1998, S. 53–82, hier S. 55. Michaela Fenske sieht Mikrogeschichte nicht als Ausdruck von Regionalisierung und Provinzialisierung, sondern von methodischer Schärfe. Vgl. Michaela Fens-ke, Marktkultur in der Frühen Neuzeit. Wirtschat, Macht und Unterhaltung auf einem städtischen Jahr- und Viehmarkt, Köln 2006, S. 6.24 Vgl. Ginzburg, Käse, S. 7.25 Vgl. etwa Natalie Zemon Davis, Die wahrhatige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre, Berlin 2004. Für ihren narrativen Stil, der Quellenlücken mit erzählerischen und spekulati-ven Elementen füllte, wurde Davis zum Teil scharf kritisiert.26 Vgl. Medick, Weben und Überleben, S. 24 f.27 Zu diesen Charakterisierungen vgl. ebd. Nach einer Phase der scharfen Auseinandersetzung zwi-
151.1 Fragestellung und Methodik
dingt einen umfassenden Quellenbestand, der eine weitreichende Rekonstruktion der lokalen Gesellschat ermöglicht. Wert legen die Mikrohistoriker auf eine ausgewogene Darstellung, die neben qualitativen Beschreibungen von Lebensläufen und -geschich-ten auch quantitativ-statistische Methoden mit einbezieht.28
Nicht zufällig inden sich Ähnlichkeiten und Überschneidungen mit der Histori-schen Anthropologie und der Alltagsgeschichte, aber auch der Schule der Annales.29 In den Blick geraten nicht die Eliten und Vertreter von Fortschritt und Moderne, son-dern die abseits Stehenden und Abgehängten, die Machtlosen und stumm Gebliebe-nen.30 Landjuden erscheinen aus dieser Perspektive als doppelt benachteiligte Grup-pe: Nicht nur, dass sie als Juden rechtlich wie gesellschatlich diskriminiert waren, sie standen auch bedingt durch ihre Lebenssituation in der geographischen Peripherie ab-seits der dynamischen Regionen. Die für diese Arbeit gewählte Mikroperspektive, die sich gleichsam in Nahaufnahme den eingangs formulierten Fragestellungen nach den Zwangslagen und Handlungsspielräumen nähert, nimmt die Anregungen und theore-tischen Überlegungen der Mikrohistorie auf.
Die für die Analyse wichtige Wahl des Untersuchungsortes iel auf die Kleinstadt Merzig und den dazugehörigen Landkreis. Diese liegen im heutigen Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und Luxemburg am südlichen Ende der ehemaligen preußischen Rheinprovinz. Gleich mehrere Gründe sprechen für diese Entscheidung. Erstens wird mit einem hinreichend großen Quellenbestand die Vorbedingung für eine dichte Schilderung erfüllt. Zweitens kann durch die Nutzung von Daten, die im Rahmen des DFG-Projektes Kreditvergabe im 19. Jahrhundert. Geldleihe in privaten Netzwerken31 in eine Datenbank einlossen, auf einen immensen, gut aubereiteten
schen Vertretern der Mikrogeschichte und der historischen Sozialwissenschat, die Strukturen und große Einheiten im Blick hatte, nahm etwa homas Welskopp eine gemäßigt-vermittelnde Rolle ein und betont die gegenseitigen Synergiepotentiale. Vgl. homas Welskopp, Die Sozialgeschichte der Väter. Grenzen und Perspektiven der Historischen Sozialwissenschat, in: Geschichte und Gesell-schat 24 (1998), S. 173–198, hier S. 183.28 Vgl. Medick, Weben und Überleben, S. 25.29 Vgl. ebd., S. 24. Verwiesen sei etwa auf die Pionierstudien von Emmanuel Le Roy Ladurie, der interessanterweise in seinem Werk zum Pyrenäendorf Montaillou ebenso wie Ginzburg Inquisitions-protokolle auswertete.30 Vgl. Jürgen Schlumbohm, Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Zur Eröfnung einer Debatte, in: Jürgen Schlumbohm (Hrsg.), Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Komplementär oder inkommen-surabel?, Göttingen 1998, S. 7–32, hier S. 19 f. Schlumbohm betont in seinem Forschungsüberblick die starke Orientierung der Mikrohistoriker auf die Unterschichten.31 An der Universität des Saarlandes entstand, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemein-schat, in den Jahren 2008 bis 2011 unter der Leitung von Gabriele B. Clemens am Lehrstuhl für Neu-ere Geschichte und Landesgeschichte eine Datenbank, die alle fast 7.500 notariell beglaubigten Kre-dite von 1800 bis 1900 aufnahm. Mit Hilfe dieser Datenbank sind genaue Analysen eines örtlichen Kreditmarktes möglich, die über die bisherigen Stichproben weit hinausgehen. Neben den bloßen Kreditsummen lassen sich Aussagen über Gläubiger und Schuldner, Kreditbedingungen und Sicher-heiten, Zins und Zweck des Kredites trefen. Flankiert wird diese Datenbank beglaubigter Obligatio-nen durch eine ausgedehnte Stichprobe an unbeglaubigten einfachen Schuldscheinen, die durch eine
16 1 Einleitung
Quellenbestand zurückgegrifen werden, der bisher unerreichte Aussagen über den jüdischen Kreditmarkt im 19. Jahrhundert ermöglicht. Drittens eignet sich Merzig we-gen seiner zentralen Parameter als Untersuchungsort. Als preußische Kreisstadt mit einem ausgesprochen ländlichen Umfeld entspricht sie dem Typus der Kleinstadt. Als solche übernahm sie überörtliche Funktionen und bildete für die umliegenden Dör-fer den administrativen und ökonomischen Bezugspunkt.32 Dadurch wurden die in Merzig und den beiden benachbarten Dörfern Hilbringen und Brotdorf lebenden Ju-den greibar, da sie sich erst vermittelt durch die Verwaltungstätigkeit der städtischen Ämter und Behörden in den Akten niederschlugen. Zudem zeichnet sich gerade die Kleinstadt stets durch ihr Verhältnis zum umliegenden dörlichen Raum aus.33 Sie war als Markt-, Verwaltungs-, Verkehrs- und Kulturzentrum Mittelpunkt für das platte Land und mit diesem untrennbar verwoben.34 Damit aber bildete der Landkreis mit seinem Zentrum Merzig auch für die jüdische Bevölkerung eine Einheit, in der sich das soziale und ökonomische Leben abspielte. Eine begriliche Unterscheidung zwischen Land- und Kleinstadtjudentum, die entweder idealtypisch den beiden Dörfern oder der Stadt zugeordnet wären, wäre an dieser Stelle weder angezeigt, noch sinnvoll – die Begrife werden daher im Folgenden synonym gebraucht. Denn strukturelle und we-sensartige Unterschiede zwischen in Merzig und den nahegelegenen Dörfern lebenden Juden existierten nicht: Sie gingen den gleichen Berufen nach, beteten in derselben Synagoge, teilten ähnliche grundsätzliche Einstellungen zu Familie und Gesellschat und vollzogen im Laufe des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Entwicklung.35
Analyse der Inventare durchgeführt wurde. Das DFG-Projekt war mit dem rheinland-pfälzischen Forschungscluster „Gesellschatliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“ der Universitäten Trier und Mainz kooptiert. Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Projektes und entwickelte ausgehend vom jüdischen Kreditmarkt eine umfassendere Fragestellung.32 Vgl. Clemens Zimmermann, Die Kleinstadt in der Moderne, in: Clemens Zimmermann (Hrsg.), Kleinstadt in der Moderne (Stadt in der Geschichte 31), Ostildern 2003, S. 9–27. Zimmermann verweist einleitend auf das Verliererimage der Kleinstadt im 19. Jahrhundert und deren Idyllisierung in der modernitätskritischen Publizistik. Dabei besteht in der Forschung keineswegs Konsens über den Begrif „Kleinstadt“, der quantitative und funktionale Diferenzen umfasst. Neben den vor Ort zentralisierten Aufgaben deinierte die Internationale Statistikkonferenz von 1887 eine Kleinstadt mit einer Bevölkerung zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern. Die historische Forschung plädiert besonders für die erste Hälte des 19. Jahrhunderts für eine lexible Handhabung von quantitativen Bemessungsgrenzen und betont mehr die zentralörtliche Stellung. Sie trägt damit dem dynamischen Wachstum der Städte dieser Zeit Rechnung. Im konkreten Fall Merzig jedoch kann unmissverständ-lich von einer Kleinstadt gesprochen werden, die die quantitativen und qualitativen Kriterien erfüllt.33 Vgl. ebd., S. 23.34 Dies gilt zumindest bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Vgl. ebd.35 Eine Typologie oder genaue Deinition von „Kleinstadtjuden“ existiert nicht. Das liegt auch an der nur unscharfen Trennlinie zu den ländlichen Juden. Wenn überhaupt, dann hätte man erst zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Unterscheidung vornehmen können, da sich etwa die Neuerung des Kauhauses in Dörfern nicht fand. Es bestünde allerdings weiterhin die Frage, ob solche Merkmale ausreichen, eine analytische Kategorie zu deinieren. Es soll hier bei der pragmatischen Verwendung
171.1 Fragestellung und Methodik
Ein weiterer Aspekt, viertens, spricht für Merzig. Aus geographischer Sicht ergibt sich nämlich eine Nähe zum aufstrebenden Industrierevier an der Saar. Die Randlage zum schwerindustriellen Gebiet um Saarbrücken ermöglichte einen signiikanten Aus-tausch von Waren und Innovationen.36 So nahmen gerade die Merziger Juden Neue-rungen in ihren Berufsfeldern auf und nutzten mit dem Bau der Eisenbahn zur Mitte des 19. Jahrhunderts die sich ihnen bietenden Gelegenheiten in den weiter entfernten dynamischen Zentren. Daher wird die Verlechtung der Juden mit anderen Regionen, aber auch die Verlechtung innerhalb und außerhalb ihrer Sozialgruppe thematisiert.
Daran schließen sich methodische Überlegungen zur sozialen Netzwerkanalyse an. Diese ermöglicht einen analytisch geschärten Blick auf wirkungsmächtige Zusam-menhänge und bietet ein Instrumentarium zur Sichtbarmachung von nicht-instituti-onalisierten Beziehungen zwischen Akteuren.37 Historische Studien allerdings stoßen bei dieser Methode auf speziische Probleme. Anders als ein Sozialwissenschatler ist ein Historiker auf einen abgeschlossenen und unter Umständen lückenhaten Quellen-bestand angewiesen. Zudem hat er es mit Quellen zu tun, bei deren Produktion man zum Entstehungszeitpunkt eine netzwerkanalytische Auswertung nicht im Sinn hatte. Während ein Soziologe durch Fragebögen und standardisierte Abfragen valide Ergeb-nisse erhält, muss der Historiker besondere Vorsicht walten lassen.38 Im Fall dieser Stu-die soll in zwei Kapiteln der Erfolg und die Position der Juden in der Gesellschat im Allgemeinen und auf dem Kreditmarkt im Speziellen durch den Aubau und die Plege von Netzwerkbeziehungen erklärt werden. Dies kann jedoch nur zum Teil gelingen, da im Fall der Kreditverträge keine Informationen über das Zustandekommen eines Vor-gangs enthalten sind. Letztlich können Indizien aus weiteren Quellen ein verdichtetes Bild liefern und die Funktionsweise von Netzwerkstrukturen erklären.39
der Begrife bleiben, der es im Wesentlichen um die Gegenüberstellung der unterschiedlichen gesell-schatlichen Entwicklungspfade in der (großen) Stadt und auf dem Land geht.36 Josef Mooser wies auf den Umstand hin, dass die Kleinstädte otmals bei der Difusion von moder-nen Neuerungen eine wichtige Rolle für das agrarische Umfeld spielten. Vgl. Josef Mooser, Kleinstadt und Land im Industrialisierungsprozeß 1850 bis 1930. Das Beispiel Ostwestfalen, in: Manfred Hett-ling/Claudia Huerkamp/Paul Nolte (Hrsg.), Was ist Gesellschatsgeschichte? Positionen, hemen, Analysen, München 1991, S. 124–134, hier S. 128.37 In den vergangenen Jahren kann geradezu ein Boom der sozialen Netzwerkanalyse beobachtet werden. Dazu gehören die zahlreichen Versuche, diese eigentlich seit Jahrzehnten in den Sozialwis-senschaten etablierte Methode auch in der Geschichtswissenschat fruchtbar anzuwenden. Darunter fällt auch der zuvor genannte Forschungscluster der Universitäten Trier und Mainz. Eine methodische Einführung liefern zum Beispiel Mark Trappmann/Hans J. Hummell/Wolfgang Sodeur, Strukturana-lyse sozialer Netzwerke. Konzepte, Modelle, Methoden, Wiesbaden 2005 u. Betina Hollstein/Florian Straus (Hrsg.), Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen, Wiesbaden 2006.38 Zu diesen quellentheoretischen Überlegungen vgl. Frank Hirsch, Netzwerke in der Neueren Ge-schichte, in: Curt Wolfgang Hergenröder (Hrsg.), Gläubiger, Schuldner, Arme. Netzwerke und die Rolle des Vertrauens, Wiesbaden 2010, S. 133–142. Historische Quellen sind häuig disparat und nur lückenhat überliefert.39 Vgl. Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen. „Verlechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979. Reinhard lehnt den
18 1 Einleitung
Ein Kreditnetzwerk stellt den Historiker außerdem vor besondere Herausforderun-gen. Schon eine erste Stichprobe ofenbart die Grundstruktur des ländlichen Kredit-marktes: Ein Gläubiger vergibt einen oder mehrere Kredite an verschiedene Schuldner. Neben diese häuig anzutrefende Fächerform treten zahlreiche dyadische Verbindun-gen. Netzwerke, in denen Gläubiger anderen Gläubigern Geld leihen oder Schuldner auch als Gläubiger autreten, sich überhaupt mehrere über wenige Personen hinaus-reichende Verbindungen ergeben, sind nur selten zu inden. Ein netzwerkanalytisches Programm, das unter diesen Umständen Kennzahlen wie die Dichte, Zentralität oder Betweenness berechnen wollte, wäre weder arbeitsökonomisch noch konzeptionell sinnvoll.40
Diesen unlösbaren operationalen Problemen soll mit einem pragmatischen, den speziischen Bedingungen der Quellenlage folgenden Netzwerkbegrif begegnet wer-den. Weder soll er durch Zahlen eine vermeintliche Exaktheit suggerieren, noch soll ein rein methaphorischer Gebrauch die analytische Schärfe von interpersonellen Be-ziehungen entwerten.41 Er orientiert sich an der Prämisse, dass Verwandtschat und persönliche Beziehungen wie Freund- oder Bekanntschat, Abhängigkeiten, Verplich-tungen und Erwartungshaltungen erzeugen. Während diese Überlegungen bisher nur bei Führungseliten angestellt wurden,42 soll an einigen Beispielen und statistischen Analysen demonstriert werden, wie sich Netzwerke als strategisches Mittel auch bei gesellschatlichen Außenseitern wie den Landjuden einsetzen ließen. Ausgehend von diesen methodologischen Relexionen und den zuvor formulierten hesen sollen im Folgenden zunächst der Forschungsstand und die Quellenlage und anschließend die Konzeption dieser Arbeit erläutert werden.
1.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
Zuerst stellt die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Geschichte des ländlichen Juden-tums im 19. Jahrhundert dar. Sie greit damit ein Desiderat auf, das Monika Richarz be-reits 1992 formulierte.43 Nachdem im Zusammenhang mit der Emanzipation der Zu-
Begrif „Netzwerk“ zugunsten von „Verlechtung“ ab, bezieht sich aber ausdrücklich auf die „network analysis“ angelsächsischer Provenienz.40 Zur Methodik und Anwendung dieser Kennzahlen vgl. Trappmann/Hummell/Sodeur 2005, S. 25–70. Chancen und Vorbehalte gerade für Historiker formulierte Reinhard für Beziehungen, die auf Verwandtschat, Freundschat oder Patronage beruhten. Vgl. Reinhard 1979, S. 32–41.41 Vgl. Reinhard 1979, S. 33.42 Einen Grund dürte die Quellenlage darstellen, die für enge Elitenzirkel dichter überliefert ist als für breite Unterschichten, von denen viele Personen nicht einmal namentlich bekannt sind. Vgl. zum Beispiel ebd. und die Pionierstudie von John F. Padgett/Christopher K. Ansell, Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434, in: American Journal of Sociology 98 (1993), S. 1259–1319.43 Vgl. Monika Richarz, Die Entdeckung der Landjuden. Stand und Probleme ihrer Erforschung am Beispiel Südwestdeutschlands, in: Vorarlberger Landesarchiv (Hrsg.), Landjudentum im Süddeut-schen- und Bodenseeraum. Wissenschatliche Tagung zur Eröfnung des Jüdischen Museums Ho-
191.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
zug von Juden in die Städte stark anstieg, hatete dem ländlichen Raum das Stigma des Rückständigen an. Dementsprechend richtete sich auch der Blick der Forschung auf die dynamische Entwicklung in den urbanen Zentren. Bis dahin wohnten Juden aus dem deutschen Südwesten infolge der seit dem Mittelalter vorgenommenen Vertrei-bungen aus den Städten zu einem großen Teil auf dem Land. Neben der Erforschung der Hojuden, des Antijudaismus und einer Reihe von herausragenden Persönlichkei-ten wie der Glückel von Hameln, stand daher für diese Epoche eben auch das ländliche Judentum im Mittelpunkt des Interesses.44 Mit dem Einsetzen der Emanzipation und
henems vom 9. bis 11. April 1991, Dornbirn 1992, S. 11–21. Besonders Monika Richarz sind wichtige Arbeiten zum Landjudentum zu verdanken.44 Zur Institutionalisierung der Hojudenschat und deren Einluss an den Fürstenhöfen vgl. die Ar-beiten von Friedrich Battenberg und die bereits ältere Arbeit (Übersetzung des englischen Originals von 1950) zu Typus und Erscheinungsformen von Selma Stern, Der Hojude im Zeitalter des Absolu-tismus. Ein Beitrag zur europäischen Geschichte im 17. und 18. Jahrhundert, Tübingen 2001 (Schrif-tenreihe wissenschatlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 64). Zu den Hojuden inden sich zahlreiche Biographien zu exponierten Persönlichkeiten wie etwa Barbara Gerber, Jud Süß. Aufstieg und Fall im frühen 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Historischen Antisemitismus- und Rezeptions-forschung, Hamburg 1990. Analysiert werden in der historischen Forschung neben der Bedeutung der jüdischen Finanziers für die Modernisierung des absolutistischen Fürstenstaates auch die antijü-dischen Stereotype, die sich an den mächtigen und wohlhabenden Hojuden wie Jud Süß entluden. Fragen nach der Vernetzung der Hojuden untereinander, überhaupt nach der Deinition als sozialer Gruppe sind zu einem großen Teil noch unbeantwortet. Den biographischen Zugang wählten Histo-riker nicht nur bei den Hojuden, sondern auch bei anderen herausragenden Vertretern ihrer Religion wie Glückel von Hameln, deren Autobiographie Einblicke in die Gefühls- und Lebenswelt einer Jü-din des 17. und 18. Jahrhunderts zulässt. Vgl. dazu neuerdings neben vielen anderen Ingeborg Grolle, Die jüdische Kaufrau Glikl, 1646–1724, Bremen 2011 (Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und Selbstzeugnissen 22). Zum ländlichen Judentum liegen eine Reihe lokaler und regionaler Studien vor, die sich dem Phänomen der so genannten „Judendörfer“ oder den Bedingungen des Zusammen-lebens von Juden und Christen widmen. Vgl. dazu Utz Jeggle, Judendörfer in Württemberg, 2. Aul., Tübingen 1999 (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen 90) u. den Sammelband von Rolf Kießling (Hrsg.), Landjudentum im deutschen Südwesten während der Frü-hen Neuzeit, Berlin 1999 (Colloquia Augustana 10). Zeitlich übergreifend, aber mit Schwerpunkt in der Frühneuzeit und der Region Schwaben vgl. einen weiteren Sammelband von Ders. (Hrsg.), Juden-gemeinden in Schwaben im Kontext des Alten Reiches, Berlin 1995 (Colloquia Augustana 2). Zu den gegenseitigen Beziehungen in kleinen Gemeinden in vergleichender Perspektive vgl. Sabine Ullmann, Nachbarschat und Konkurrenz. Juden und Christen in Dörfern der Markgrafschat Burgau 1650 bis 1750, Göttingen 1999 (Veröfentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 151). Forschungen zu Juden in den Städten konzentrieren sich auf die norddeutschen urbanen Zentren und die Reichs-städte, die besonders nach dem Dreißigjährigen Krieg die starken Bevölkerungsverluste ausgleichen wollten und die Neuansiedlung von Juden zuließen. Den beiden exponierten Gruppen der Hojuden und Landjuden widmet sich der Sammelband von Sabine Hödl, Peter Rauscher und Barbara Stau-dinger. Neben Aufsätzen zur rechtlichen Lage verdienen besonders die Beiträge von Wolfgang Treue und Stefan Rohrbacher zur ländlichen Lebenswelt Beachtung. Vgl. Wolfgang Treue, Eine kleine Welt. Juden und Christen im ländlichen Hessen zu Beginn der Frühen Neuzeit, in: Sabine Hödl/Peter Rau-scher/Barbara Staudinger (Hrsg.), Hojuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit, Berlin 2004, S. 251–269 u. Stefan Rohrbacher, „Er erlaubt es uns, ihm folgen wir.“ Jüdische Frömmig-keit und religiöse Praxis im ländlichen Alltag, in: ebd., S. 271–282.
20 1 Einleitung
der Industrialisierung wandte sich die Aufmerksamkeit den dynamischen Wandlungs-prozessen zu. Neben den innerjüdischen Konlikten um die Reform der Religion,45 dem schwierigen Weg zur rechtlichen Gleichstellung46 und dem Antisemitismus und seinen Ausprägungen,47 interessierten die Historiker die Verbürgerlichungsprozesse der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts.48 Diese Formen der Modernisierung spielten sich nun aber vornehmlich in großen Städten ab, die mit ihren Bildungseinrichtungen und Medienstandorten, als Sitz von Regierung und Verwaltung, als Zentren von Pro-duktion und Handel, den Takt vorgaben und zum Ort der Veränderung wurden.
Dem für die Zeit nach 1800 im Vergleich zur Frühen Neuzeit stark gesunkenen In-teresse am ländlichen Judentum wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst durch eine Reihe von Erinnerungsliteratur entgegengesteuert. Überlebende der Shoa stellten dem Schrecken der jüngeren Vergangenheit eine mehr oder minder verklärte gute alte Zeit gegenüber, deren Zweck vor allem die Bewahrung des Gedächtnisses an die Nachwelt sein sollte. Meist autobiographisch verfasst, werden keine wissenschatlichen Analy-sen, dafür aber Anekdoten und Einblicke in das Alltagsleben geboten.49 Eine der ersten wissenschatlichen Arbeiten, wenngleich auch hier mit dem Idealbild der ländlichen Idylle, stammte von Hermann Schwab. Nach Regionen gegliedert, schildert er die Le-
45 Die im Anschluss an die auklärerischen Anstöße etwa von Moses Mendelssohn aukeimende Reformdebatte führte zu einer religiösen Diferenzierung, die in der Literatur gut aufgearbeitet ist. Neben der Vielzahl zeitgenössischer Literatur etwa von Abraham Geiger oder Zacharias Frankel bil-dete die religionsgeschichtliche Auseinandersetzung einen klassischen Bereich der historischen For-schung. An einschlägigen Arbeiten sind zum Beispiel erschienen Meyer, Response to Modernity u. Breuer, Jüdische Orthodoxie.46 Die Emanzipation stellt ein weiteres zentrales Forschungsgebiet dar. Wichtige Studien sind Katz, Ghetto u. Jacob Toury, Soziale und politische Geschichte der Juden in Deutschland 1847–1871. Zwi-schen Revolution, Reaktion und Emanzipation, Düsseldorf 1977 (Schritenreihe des Instituts für Deut-sche Geschichte Universität Tel Aviv 2). Den Vergleich zwischen der revolutionären Einführung der Gleichstellung in Frankreich mit der sich hinziehenden Debatte um die Emanzipation in Deutschland führte Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur ‚Judenfrage‘ der bürgerlichen Gesellschat, Göttingen 1975 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschat 15). Auch das Zusammen-spiel von Emanzipation und Entstehung des modernen Antisemitismus wird von Rürup analysiert.47 Im Hinblick auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik geriet der sich neu formierende Antisemitismus seit der zweiten Hälte des 19. Jahrhunderts in den Fokus der internationalen For-schung. Die Periodisierung und die Kontinuität von Antijudaismus und Antisemitismus bildeten zentrale Fragen. Die Verbindung von altem und neuem Antisemitismus betont Jacob Katz, Vom Vor-urteil bis zur Vernichtung. Der Antisemitismus 1700–1933, München 1989. Sehr viel stärker das Neue am politischen und rassischen Antisemitismus stellte Rürup heraus, der die Emanzipationszeit als Scheidelinie identiizierte. Vgl. dazu Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, passim.48 Als Ergebnis der Emanzipation setzte durch die Öfnung von Bildungseinrichtungen und Berufs-feldern ein Verbürgerlichungsprozess ein, der die Juden als soziale Gruppe insgesamt zum Exponen-ten der Moderne werden ließ. Vgl. etwa Lässig, Jüdische Wege.49 Der Wert dieser Arbeiten liegt besonders in der Darstellung von Praktiken des täglichen Lebens. Vgl. Max Dessauer, Aus unbeschwerter Zeit. Geschichten um die Juden in meinem Dorf, Frankfurt a. M. 1962; Eric Lucas, Jüdisches Leben auf dem Lande. Eine Familienchronik, Frankfurt a. M. 1994 u. Jacob Picard, Die alte Lehre. Geschichten und Anekdoten, Stuttgart 1963.
211.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
benswelten einer untergegangenen Welt mit der Charakterisierung ihrer Besonderhei-ten für den deutschen Südwesten, für Mittel- und Norddeutschland und den preußi-schen Osten.50 Systematischer widmete sich Werner Cahnman dem Landjudentum, indem er neben den sozialen und wirtschatlichen Strukturen auch eine typologische Einordnung versuchte. Demgemäß betonte er die Notwendigkeit der Berücksichti-gung der regionalen Besonderheiten und die besondere Mentalität der Landjuden, die auch nach einem Umzug in die Stadt weiterwirke.51
Einen Meilenstein in der Erforschung des ländlichen Judentums bildete die in erster Aulage 1969 erschienene Studie von Utz Jeggle zu den württembergischen Judendörfern.52 Über einen langen Zeitraum von der voremanzipatorischen Zeit bis zur Nachkriegszeit untersucht Jeggle die Judendörfer, die sich durch ihren besonders hohen jüdischen Bevölkerungsanteil auszeichneten und damit in gewisser Weise eine Ausnahmeerscheinung darstellten, die sich von den jüdischen Siedlungen im Rhein-land, in Hessen, Franken, Schwaben und Westfalen unterschied. Zu diesen Regionen und ihren Gemeinden wurden seitdem eine Reihe von Untersuchungen veröfentlicht, wie auch der lokalhistorische Zugrif wegen der regional sehr unterschiedlichen Ver-teilung und der Besonderheiten einzelner Landschaten insgesamt vorherrscht.53
Die exponierteste Vertreterin der Erforschung des deutschen Landjudentums ist zweifelsohne Monika Richarz. Nachdem sie sich in den 1970er Jahren zunächst der
50 Vgl. Hermann Schwab, Jewish Rural Communities in Germany, London 1957.51 Vgl. Werner J. Cahnman, Agenda für das Studium des Landjudentums, in: Emuna – Israel Forum Vereinigte Zeitschriten über Israel und Judentum 5–6 (1977), S. 5–10. Ausführlicher bereits früher in Werner J. Cahnman, Der Dorf- und Kleinstadtjude als Typus, in: Zeitschrit für Volkskunde 70 (1974), S. 169–193.52 Vgl. die Neuaulage Jeggle, Judendörfer, passim. Neben dem Versuch einer systematisch-analytischen Fassung der Landjuden, konzentrierte sich Jeggle vor allem auf die schwierigen Beziehungen zwischen Juden und Christen. Dabei nutzte er als Quelle auch Interviews mit ehemaligen christlichen Nachbarn.53 Nachfolgend werden einige wichtige Werke der Erforschung des ländlichen und kleinstädtischen Judentums in der Zeit der Moderne vorgestellt. Als Ergebnis eines Forschungsprojektes liegen Arbeiten zum ländlichen Oberfranken vor, vgl. dazu Klaus Guth (Hrsg.), Jüdische Landgemeinden in Ober-franken 1800–1942. Ein historisch-topographisches Handbuch, Bamberg 1988 (Landjudentum in Oberfranken 1). Zu Franken insgesamt vgl. aus demselben Jahr auch Christoph Daxelmüller, Jüdische Kultur in Franken, Würzburg 1988. Mit Westfalen beschätigte sich unter der Ägide des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold ein Sammelband mit verschiedenen Aspekten des jüdischen Lebens auf dem Land. Neben volkskundlichen Beiträgen zur Geschichte einiger westfälischer Dörfer mit jüdischer Bevölkerung, liegt der Wert besonders in der Nachzeichnung von jüdischen Lebenswegen im ländli-chen Raum. Vgl. Stefan Baumeier/Heinrich Stiewe, Die vergessenen Nachbarn. Juden auf dem Lande im östlichen Westfalen, Bielefeld 2006. Ebenfalls in Westfalen angesiedelt, aber mit Konzentration auf die Kleinstadt Lemgo und ihre Umgebung, ist ein Sammelband aus dem Jahr 1988, der neben den Fra-gen nach der Integration, der jüdischen Schule, der Erinnerungskultur und dem Nationalsozialismus, auch den wirtschatlichen Grundlagen der Landjuden nachgeht. Vgl. dazu im Besonderen den Aufsatz und allgemein den gesamten Sammelband Dieter Zoremba, Juden in Blomberg. Zur Sozial- und Wirt-schatsgeschichte kleinstädtischer Juden am Beispiel des Land- und Viehhandels 1850–1930, in: Archiv- und Museumsamt Lemgo (Hrsg.), Juden in Lemgo und Lippe. Kleinstadtleben zwischen Emanzipati-on und Deportation, Bielefeld 1988 (Forum Lemgo. Schriten zur Stadtgeschichte 3), S. 87–96.
22 1 Einleitung
Akademisierung54 der Juden im 19. Jahrhundert widmete, wandte sie sich seit den 1980er Jahren den Landjuden zu. Ihr Verdienst liegt vor allem in der systematischen Analyse und der Formulierung von Desideraten besonders in Bezug auf die wirtschat-lichen Grundlagen der Landjuden im 19. Jahrhundert.55 Durch die Nutzung neuer Quellenarten und die Erarbeitung erkenntnisleitender Fragestellungen löste sie sich von der an regionalen Gesichtspunkten orientierten Geschichtsschreibung und lieferte wichtige verallgemeinerbare Ergebnisse. So erforschte sie die Bedeutung des Viehhan-dels für die südwestdeutschen Juden und betonte die symbiotische Beziehung zu den christlichen Kleinbauern.56 Den Kulturtransfer von städtischer Wohn- und Bildungs-kultur aufs Land, der besonders durch Landjuden vorangetrieben wurde, thematisiert ein weiterer Beitrag von Monika Richarz.57 Darin spricht sie die im Vergleich zu den Christen unterschiedliche Berufsstruktur ebenso an, wie auch das große Beharrungs-vermögen in traditionellen Strukturen, die um moderne (städtische) Elemente ergänzt wurden.58 In einem Forschungsbericht monierte sie die großen Forschungslücken als Fortsetzung der Marginalisierung als vermeintlich „historische Verlierer“.59 „Der be-sondere Reiz dieser Forschung besteht darin, daß hier immer zugleich die Bewahrung von Traditionen und das Streben nach Modernität in den Blick geraten. In den Au-gen der städtischen Juden waren die Landjuden fromm, ungebildet und wirtschatlich zurückgeblieben, für die Agrarbevölkerung repräsentierten sie dagegen die moderne Kapitalwirtschat und ein städtisches Element auf dem Dorf “60, so Richarz in ihrer Einschätzung der spannungsreichen Lage der Landjuden im 19. Jahrhundert. Damit umriss sie bereits vor 20 Jahren das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsinter-esse. An anderer Stelle wies sie auf weitere ofene Fragen wie etwa die Rolle der Eisen-bahn hin, die in einem späteren Kapitel noch analysiert werden soll.61
54 Vgl. Richarz, Eintritt der Juden.55 Zuerst als Ergebnis eines von ihr durchgeführten Forschungsprojektes zu jüdischen Selbstzeugnis-sen aus den 1970er Jahren, vgl. Monika Richarz, Emancipation and Continuity. German Jews in the Rural Economy, in: Werner E. Mosse/Arnold Paucker/Reinhard Rürup (Hrsg.), Revolution and Evo-lution 1848 in German-Jewish History, Tübingen 1981 (Schritenreihe wissenschatlicher Abhandlun-gen des Leo Baeck Instituts 39), S. 95–115. Zu den Desideraten bes. S. 104 f.56 Vgl. Richarz, Viehhandel und Landjuden, passim.57 Vgl. Monika Richarz, Landjuden. Ein bürgerliches Element im Dorf ?, in: Wolfgang Jacobeit/Jo-sef Mooser/Bo Stråth (Hrsg.), Idylle oder Aubruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahrhundert. Ein europäischer Vergleich, Berlin 1990, S. 181–190.58 Vgl. ebd., S. 185. Neben der Berufsstruktur spielten hier besonders Religion und Alltagsleben eine Rolle.59 Vgl. Monika Richarz, Die Entdeckung der Landjuden. Stand und Probleme ihrer Erforschung am Beispiel Südwestdeutschlands, in: Vorarlberger Landesarchiv (Hrsg.), Landjudentum im Süddeut-schen- und Bodenseeraum. Wissenschatliche Tagung zur Eröfnung des Jüdischen Museums Hohen-ems vom 9. bis 11. April 1991, Dornbirn 1992, S. 11–21, hier S. 11.60 Ebd., S. 19.61 Vgl. Monika Richarz, Ländliches Judentum als Problem der Forschung, in: Monika Richarz/Rein-hard Rürup (Hrsg.), Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, Tübin-gen 1997 (Schritenreihe wissenschatlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 56), S. 1–8, hier S. 8.
231.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
Seit den Forschungsberichten von Richarz zu Beginn der 1990er Jahre verschwan-den einige weiße Flecken von der Karte der landjüdischen Geschichte. Ein wichtiger Beitrag war der vom Vorarlberger Landesarchiv herausgegebene Sammelband, in dem auch der letztgenannte Aufsatz von Richarz erschien.62 Darin wurde ein ganzes Pano-rama an unterschiedlichen Ansätzen ausgebreitet, die einerseits noch sehr traditionel-len Fragestellungen verhatet blieben, wie etwa der Aufarbeitung der lokalen Gemein-den oder der Darstellung der religiösen Verhältnisse, die andererseits aber auch schon neue Perspektiven einbrachten wie die Frage nach Integration, Migration und Alltags-leben.63 Der in Zusammenarbeit von Monika Richarz und Reinhard Rürup herausge-gebene Sammelband „Jüdisches Leben auf dem Lande“64 beschätigt sich mit Arbeiten zu Religion, Antisemitismus und Emanzipation. Durch neue Quellen und neue Fra-gestellungen gelang es den Autoren, wichtige Beiträge zur Geschichte der Landjuden zu leisten. So lenkte Stei Jersch-Wenzel den Blick auf die lange vernachlässigten dörf-lichen Ostjuden und ihre ökonomischen Grundlagen.65 Reinhard Rürup ordnete die ländliche Judenschat in den Emanzipationsdiskurs der südlichen deutschen Landtage ein und kontrastiert die höchst unterschiedlichen Positionen der Landtagsfraktionen in Bezug auf zentrale Fragen der Emanzipation wie Freizügigkeit und Berufswahl.66 Auch in diesen Gremien und politischen Vertretungen reproduzierte sich das gängige Urteil, das die fortschrittliche Stadt dem rückständigen Land gegenüberstellte und die Wurzel des Übels besonders im Vieh- und Hausierhandel erblickte. Manche Abgeord-nete jedoch nahmen den Wandel und die Strukturveränderungen bereits zum Beginn der Industrialisierung wahr und forderten eine rechtliche Gleichstellung.67
Claudia Ulbrich erweiterte die Perspektive beim ländlichen Judentum auf die Ge-schlechterbeziehungen im 18. Jahrhundert. Zwar liegt diese Mikrostudie außerhalb des Betrachtungszeitraums dieser Arbeit, doch lassen sich hier bereits Grundkonstanten jü-dischen Landlebens in einem lothringischen Dorf erkennen, etwa im Hinblick auf die Mobilität.68 Matthias Rohde dagegen konzentriert sich auf die erste Hälte des 19. Jahr-hunderts und widmet sich im Besonderen den wirtschatlichen Verhältnissen der rhein-hessischen Juden.69 Neben einem Analyseschwerpunkt mit der Stadt Mainz geht er aus-
62 Vgl. Richarz, Entdeckung der Landjuden, passim.63 Vgl. ebd. die Beiträge von Karl Heinz Burmeister, Falk Wiesemann, Artur Wolfers, Heiko Hau-mann oder auch Klaus Guth.64 Vgl. Richarz/Rürup, Jüdisches Leben auf dem Lande.65 Vgl. Stei Jersch-Wenzel, Ländliche Siedlungsformen und Wirtschatstätigkeit der Juden östlich der Elbe, in: Richarz/Rürup, Jüdisches Leben auf dem Lande, S. 79–90.66 Vgl. Reinhard Rürup, Die jüdische Landbevölkerung in den Emanzipationsdebatten süd- und südwestdeutscher Landtage, in: Richarz/Ders., Jüdisches Leben auf dem Lande, S. 121–138.67 Vgl. ebd., S. 128 f.68 Vgl. Claudia Ulbrich, Shulamit und Margarete. Macht, Geschlecht und Religion in einer ländli-chen Gesellschat des 18. Jahrhunderts, Wien 1999 (Aschkenas. Zeitschrit für Geschichte und Kultur der Juden Beihet 4), S. 123.69 Vgl. Matthias Rohde, Juden in Rheinhessen. Studien zur wirtschatlichen und sozialen Lage in der ersten Hälte des 19. Jahrhunderts, Tönning 2007.
24 1 Einleitung
führlich auf die Situation im ländlichen und kleinstädtischen Raum ein und schließt dort wichtige Lücken mit der Analyse der sozioökonomischen Grundbedingungen.
Die vorliegende Arbeit berührt nicht nur den hemenbereich des ländlichen und kleinstädtischen Judentums und dessen Wandlungsprozesse im Verlauf des 19. Jahr-hunderts, sondern auch regional-, wirtschats- und sozialhistorische Fragestellungen. Da der Kreditmarkt für die Merziger Juden von großer Bedeutung war und konzeptio-nell eine herausragende Rolle in der Untersuchung spielen wird, wurde auf eine Reihe wichtiger Vorarbeiten zurückgegrifen. Wichtige Ergebnisse lieferte die Forschergrup-pe um Gilles Postel-Vinay, der den französischen Kreditmarkt untersuchte. In einer frankreichweiten Studie von der Frühen Neuzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wertete er Notariatsakten systematisch aus, identiizierte dabei die beteiligten Akteure und rekonstruierte die Funktionsweise des privaten Kreditmarktes.70 Über den rein wirtschatlichen Aspekt hinaus interpretiert Laurence Fontaine den Kreditmarkt auch als Gläubiger-Schuldner-Gelecht, das Klientel- und Machtbeziehungen schafe.71 Für England trugen besonders Craig Muldrew und Margot C. Finn zum besseren Ver-ständnis von Schuldbeziehungen bei.72
In Deutschland, wo private Schuldbeziehungen erst in den letzten Jahren eine er-höhte Aufmerksamkeit genießen, lieferte besonders die Forschergruppe um Ulrich Pister wichtige Ergebnisse zum privat organisierten Kreditmarkt im 19. Jahrhundert.73 In diesem Zusammenhang entstand die Studie von Georg Fertig, der sich mit der Mobilisierung des Bodens und den daraus resultierenden Bedingungen für den Kre-ditmarkt beschätigte.74 Jürgen Schlumbohm legte als Ergebnis einer Tagung 2007
70 Vgl. Gilles Postel-Vinay, La terre et l,argent. L,agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XXe siècle, Paris 1998. Eine wichtige Rolle spielten bei ihm die Vermittler des Kredits, wie etwa die Notare, die in zahlreichen Fällen für das Zustandekommen von Kreditverträgen unverzichtbar wa-ren. Zeitlich auf die Sattelzeit verengt, wurde die Funktion des Notars im französischen Kreditmarkt untersucht von Philip T. Hofman/Gilles Postel-Vinay/Jean-Laurent Rosenthal, Révolution et évolu-tion. Les marchés du crédit notarié en France, 1780–1840, in: Annales HSS 59 (2004), S. 387–424 (in deutscher Übersetzung: Philip T. Hofman/Gilles Postel-Vinay/Jean-Laurent Rosenthal, Revolution und Evolution. Die Märkte des notariell beglaubigten Kredits in Frankreich 1780–1840, in: Gabriele B. Clemens [Hrsg.], Schuldenlast und Schuldenwert. Kreditnetzwerke in der europäischen Geschich-te 1300–1900, Trier 2008 [Trierer historische Forschungen 65], S. 131–159).71 Vgl. Laurence Fontaine, Die Bauern und die Mechanismen der Kreditvergabe, in: Clemens, Schuldenlast und Schuldenwert, S. 109–130.72 Muldrew hat für das frühneuzeitliche England Strukturen und Praktiken der Kreditvergabe he-rausgearbeitet. Vgl. Craig Muldrew, he Economy of Obligation. he Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England, Basingstoke 2001. Finn hingegen analysiert die Diskurse um Ver-schuldung und Konsumkultur in der Literatur, der Inhatierung wegen Überschuldung und den Ge-richtsverfahren wegen Kleinkrediten. Vgl. Margot C. Finn, he Character of Credit. Personal Debt in English Culture, 1740–1914, Cambridge 2003.73 Zum ländlichen Kleinkredit am Beispiel der Schweiz in der Frühneuzeit vgl. Ulrich Pister, Le petit crédit rural en Suisse aux XVIe–XVIIIe siècles, in: Annales HSS 49 (1994), S. 1339–1357.74 Vgl. Georg Fertig, Äcker, Wirte, Gaben. Ländlicher Bodenmarkt und liberale Eigentumsordnung im Westfalen des 19. Jahrhunderts, Berlin 2007 ( Jahrbuch für Wirtschatsgeschichte 11).
251.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
einen Sammelband zur sozialen Praxis des Kredits vor, der sich mit den vielschich-tigen Schuldbeziehungen nicht nur ökonomischer Art beschätigt.75 Als soziale Be-ziehungsgelechte interpretiert Carola Lipp die durch Kredit geschafenen Relationen und Alexandra Binnenkade untersucht für den Kanton Aargau ein stark miteinander verwobenes Kreditnetzwerk zwischen Juden und Christen.76 Schließlich sei auf den bereits zitierten Sammelband von Gabriele B. Clemens verwiesen, in dem sich neben den genannten Beiträgen zur französischen Kreditgeschichte thematisch breit ange-legte Aufsätze zur Herausbildung von Kreditbeziehungen inden. Neben der Frage nach den Instrumenten der Kreditsicherung im Mittelalter, sind für den Bereich des ländlichen Kredits besonders die Artikel von Christine Fertig, Johannes Bracht und Georg Fertig sowie Gabriele B. Clemens und Daniel Reupke von Bedeutung.77
Zum Untersuchungsort Merzig und der Region existieren bereits einige Vorarbei-ten, die gerade im Hinblick auf eine mikrohistorische Analyse bedeutsam sind. Wich-tige Grunddaten stammen noch aus dem 19. Jahrhundert, als besonders preußische Beamte in unterschiedlicher Funktion die neuen Gebiete der Rheinprovinz zu be-schreiben versuchten. Dazu gehören der Prümer Landrat Georg Bärsch, der den Regie-rungsbezirk Trier ausführlich einer statistischen und sozioökonomischen Betrachtung unterzog,78 und der Merziger Landrat Constantin von Briesen, der gleich zwei Bücher über seinen Wirkungskreis verfasste.79 1925 und 1958 erschienen die beiden wichtigsten
75 Vgl. Jürgen Schlumbohm (Hrsg.), Soziale Praxis des Kredits. 16.–20. Jahrhundert, Hannover 2007 (Veröfentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 238).76 Zu den Aufsätzen vgl. Carola Lipp, Aspekte der mikrohistorischen und kulturanthropologischen Kreditforschung, in: Schlumbohm, Soziale Praxis des Kredits, S. 15–36. Zur wichtigen Erkenntnis, dass Juden eben nicht nur als Gläubiger und Christen nicht nur als Schuldner autraten vgl. Alexan-dra Binnenkade, Haben oder Nicht-Haben. Jüdisch-christliche Schuldnetze im Kanton Aargau des 19. Jahrhunderts, in: Schlumbohm, Soziale Praxis des Kredits, S. 153–173.77 Über den Zusammenhang von Agrarreform, Kreditvergabe und Kreditherkunt vgl. Christine Fertig, Kreditmärkte und Kreditbeziehungen im ländlichen Westfalen (19. Jh.). Soziale Netzwerke und städtisches Kapital, in: Clemens, Schuldenlast und Schuldenwert, S. 161–175. Auch zum ländli-chen Westfalen, aber mit der Zielsetzung, Strategien der Verschuldung als Reaktionen auf sich verän-dernde wirtschatliche Rahmenbedingungen ofenzulegen, arbeiteten Johannes Bracht/Georg Fertig, Wann sich verschulden, wann sparen? Vermögensstrategien und Lebenslauf im ländlichen Westfalen des 19. Jahrhunderts, in: Clemens, Schuldenlast und Schuldenwert, S. 177–191. Schließlich beschäti-gen sich Clemens und Reupke mit den Mechanismen der Geldleihe und betonen die Rolle des No-tars, vgl. Gabriele B. Clemens/Daniel Reupke, Kreditvergabe im 19. Jahrhundert zwischen privaten Netzwerken und institutioneller Geldleihe, in: Dies., Schuldenlast und Schuldenwert, S. 211–238.78 Die Arbeit erschien in zwei Bänden. Vgl. Georg Bärsch, Beschreibung des Regierungs-Bezirks Trier. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und im Autrage der Königl. Preuß. Regierung, Teil 2: Ortschats-Verzeichniß nebst der Entfernungs-Tabelle, Trier 1846 u. Georg Bärsch, Beschreibung des Regierungs-Bezirks Trier. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und im Autrage der Königl. Preuß. Regierung, Teil 1: Die Verhältnisse des Regierungs-Bezirks in allen seinen Beziehungen, Trier 1849.79 Zum geschichtlichen Überblick von der frühesten Besiedlung bis zum Ende der französischen Zeit vgl. Constantin von Briesen, Urkundliche Geschichte des Kreises Merzig im Regierungs-Bezirke Trier, ND 1980, Saarlouis 1863. Wichtige Grunddaten lieferte er mit einer statistischen Analyse seines
26 1 Einleitung
Gesamtdarstellungen zur Merziger Geschichte durch Johann Heinrich Kell. Sowohl in breiter Perspektive mit dem gesamten Kreis,80 als auch detailliert mit der Stadt Merzig selbst,81 lieferte Kell eine Übersicht über die politische, ökonomische und kulturelle Geschichte und dient heute besonders als Grundlagenlektüre. Wilhelm Laubenthal kommt das Verdienst zu, die Synagogengemeinde Merzig in einer ersten Arbeit und anhand eine Reihe wichtiger Quellen als erster untersucht zu haben.82 Er beschreibt sowohl die sozialen Grundstrukturen, als auch ausführlich die innere Verfasstheit der Gemeinde. Er geht dabei auf die zentralen Entwicklungslinien und Akteure ein, bietet jedoch keine erkenntnisleitende Fragestellung, die über den Untersuchungsort selbst hinausweist. Einen Gesamtüberblick über die jüdische Geschichte der Saarregion lie-fert Albert Marx.83 Zeitlich und räumlich übergreifend verfolgt er keine dezidierte Fragestellung, sondern begnügt sich mit der beschreibenden Darstellung, die nichts-destotrotz in der breiten thematischen Aufarbeitung der jüdischen Geschichte ihren Wert besitzt. Pointierter und mit Blick auf die sozialen Strukturen und die durch die französische Revolution angestoßenen Wandlungsprozesse analysiert Cilli Kasper- Holtkotte die Juden der Saar-Mosel-Region.84
An diese Feststellung soll sich im Folgenden die Diskussion der Quellengrund-lagen anschließen. An erster Stelle sind die Akten des Notariats Merzig zu nennen, die, wie zuvor bereits erwähnt, die Basis des DFG-Projektes Kreditvergabe im 19. Jahr-hundert: Geldleihe in privaten Netzwerken darstellen.85 Die formularhat aufgebauten Obligationen wurden systematisch in eine Datenbank86 eingegeben, mit deren Hilfe sich zentrale Kenndaten errechnen lassen. So ermöglicht diese unter Zuhilfenahme entsprechender Sotware87 die Ermittlung wichtiger Sachverhalte, die den notariell be-
Landkreises, vgl. Constantin von Briesen, Statistik und Verwaltung des Kreises Merzig im Regierungs-Bezirke Trier von 1815–1864, Saarlouis 1867.80 Zwar von deutlich deutsch-patriotischer Gesinnung und in vielem überholt, ist es in der Gesamt-heit allerdings als Nachschlagewerk und Faktensammlung unverzichtbar. Vgl. Johann Heinrich Kell, Geschichte des Kreises Merzig. Seine politische, kulturelle und wirtschatliche Entwicklung bis zur Gegenwart, Saarbrücken 1925.81 Vgl. Johann Heinrich Kell, Geschichte der Stadt Merzig und des Merziger Landes, Merzig 1958.82 Vgl. Wilhelm Laubenthal, Die Synagogengemeinden des Kreises Merzig. Merzig, Brotdorf, Hil-bringen 1648–1942, Saarbrücken 1984.83 Vgl. Albert Marx, Die Geschichte der Juden im Saarland vom Ancien Régime bis zum Zweiten Weltkrieg, Saarbrücken 1992.84 Vgl. Cilli Kasper-Holtkotte, Juden im Aubruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum um 1800, Hannover 1996.85 Vgl. LAS Not. MZG. Die alte Signatur (587–28) des Landeshauptarchivs Koblenz, das die Akten an das Landesarchiv Saarbrücken abgab, wird nicht mehr verwendet, wird allerdings in der Literatur noch zitiert.86 Die in der Datenbank zusammengeführten und verarbeiteten Daten werden im Folgenden als Kreditdatenbank zitiert. Wird hingegen direkt Bezug auf einen einzelnen Akt genommen, wird dieser unter seiner Archivsignatur LAS Not. MZG angegeben.87 Konkret handelt es sich um das Programm Kleio, das am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen entwickelt wurde.
271.2 Juden auf dem Land: Forschungsstand und Quellenbasis
glaubigten Kreditmarkt in Merzig von 1800 bis 1900 nahezu vollständig abbilden. Be-gleitend dazu wird versucht, über die Analyse von Nachlassinventaren die einfachen, nicht beglaubigten Schuldscheine ansatzweise zu ermitteln. Da allerdings weder alle Schuldner, noch alle Gläubiger ein Inventar hinterließen, konnten hier nur Stichpro-ben erhoben werden.
Die Akten des Notariats Merzig lagern im Landesarchiv Saarbrücken (LAS), das darüber hinaus die mit Abstand meisten und wichtigsten Quellen für diese Arbeit be-reit hielt. Neben den Akten zur Armenverwaltung, dem Vereinswesen, der Verwaltung von Arbeit und Gewerbe, spielen besonders die mit preußischer Gründlichkeit erstell-ten statistischen Übersichten zur Bevölkerung und zum Steuerwesen eine bedeutende Rolle.88 Unverzichtbar sind hier die Bestände zur jüdischen Gemeinde, die sich be-sonders um die Gemeindeorganisation, das jüdische Schulwesen und den jüdischen Handel drehten.89
Nach der Kommunal- und Kreisebene, für die das Landesarchiv Saarbrücken zu-ständig ist, musste die Regierungs- und Provinzebene berücksichtigt werden, die wie-derum im Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK) archiviert wird. Dort werden die nächsthöheren Instanzen abgebildet, das heißt Diskurse, Konlikte und Eingaben von Merziger Bürgern lassen sich in diesen Behörden noch nachweisen und relektieren zentrale Prozesse im Kampf um Gleichberechtigung und Durchsetzung von Interes-sen.90 Neben diesen zwei zentralen Archiven wurden die Recherchen um Bestände des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und des Archivs des Leo Baeck Ins-tituts sowie einiger anderer Behörden ergänzt.91
88 Exemplarisch sei verwiesen auf Landesarchiv Saarbrücken, Best. Stadt Merzig Nr. 25: Gewerbebe-triebe im Umherziehen und Hausierhandel (im Folgenden zitiert als LAS MZG 25), in dem sich nicht nur wichtige Angaben zur Steuerleistung einzelner Personen inden, sondern auch wichtige Erkennt-nisse zu jüdischen Händlern.89 Vgl. etwa LAS MZG 2036: Bürgerliche Verhältnisse der Juden und deren Handelspatente. Dieser umfangreiche Akt dokumentiert einerseits die Sonderstellung der jüdischen Einwohner, die der preu-ßische Staat ihnen zuwies, andererseits führt er Angaben zur Erwerbsbevölkerung, der Besteuerung und von Konlikten zusammen.90 Interessant sind die Fälle, in denen die Oberbehörden abweichende Haltungen zu Bürgermeister und Landrat einnahmen und sich für die Belange der jüdischen Bevölkerung einsetzten. Im Fall der Frage nach der Errichtung und öfentlichen Förderung einer jüdischen Schule in Merzig lässt sich ein diferenzierter Diskurs nachzeichnen. Außerdem inden sich in Koblenz Gerichtsakten wieder, die für die unteren Instanzen wie das Friedens- und Amtsgericht Merzig als verloren gelten. Vgl. dazu Landes-hauptarchiv Koblenz: Best. 311,11, Friedensgericht Merzig (im Folgenden zitiert als LHAK 311,11).91 Hier fanden sich wichtige Angaben zum Personalwesen der örtlichen Verwaltung, statistische Er-hebungen, biographische Notizen zu einem jüdischen Kantor aus Merzig und die Personenstandsre-gister, die zum Aubau einer genealogischen Datenbank ein zentrales Instrument bei der Erforschung persönlicher und familiärer Beziehungen darstellten.
28 1 Einleitung
1.3 Konzeption und Gliederung
Der Untersuchungszeitraum umfasst im Kern die Zeit von der preußischen Inbe-sitznahme des Rheinlandes 1815 bis zur Jahrhundertwende um 1900. Neben prag-matischen Erwägungen, die sich am bereits beschriebenen Forschungsprojekt zur ländlichen Kreditvergabe orientieren, spielen besonders die langfristigen, generations-übergreifenden Entwicklungsprozesse der Merziger Juden eine Rolle, die einen derart großen Zeitraum rechtfertigen. In Ausnahmefällen, in denen Quellen zu bestimmten Bereichen, etwa Gerichtsakten, nicht mehr überliefert sind, wird auf Material außer-halb dieses Zeitraumes zurückgegrifen.92 Als Untersuchungsort dient wie bereits er-wähnt die Stadt Merzig, die um den dazugehörigen Kreis ergänzt wird. Methodisch orientiert sich die Arbeit an den administrativen Grenzen, wodurch sich zum einen durch die Nutzung des oiziellen Schritgutes ein einheitlicher Korpus,93 zum anderen aber auch ein ausgewogenes Verhältnis von arbeitsökonomisch noch zu vertretender Größe und einer hinreichend aussagekrätigen Analyseeinheit ergibt. Zudem dient sie als durchschnittliche Kleinstadt, die von der Industrialisierung weder völlig ignoriert, noch dominiert wurde, als Basis für eine Untersuchung, die agrarische und industrielle Entwicklungen gleichermaßen berücksichtigt.
Der Hauptteil gliedert sich in insgesamt vier größere Abschnitte. Gemäß dem mi-krohistorischen Ansatz steht in Kapitel 2 zunächst nicht die jüdische Gemeinde im Mittelpunkt, sondern die Gesellschat der Kleinstadt Merzig. Ausgehend von der Prä-misse, dass Merzig nicht nur einen historischen Sonderfall darstellt, sondern in ge-wisser Weise einen Typus, sollen die allgemeinen und speziischen Merkmale auch im regionalen Vergleich herausgearbeitet werden. Von Interesse ist dabei die Grenzlage Merzigs zu Frankreich (bis zur Reichsgründung) und Luxemburg, die von zahlreichen gegenseitigen Kontakten geprägt war. Letztlich dient die geographische Einordnung der Kontextualisierung in die räumlichen Zusammenhänge, die in den nachfolgenden Kapiteln im Hinblick auf die jüdische Netzwerkbildung von Bedeutung sein werden. Zudem soll dieser Abschnitt Merzig innerhalb der langfristigen wirtschatlichen Ent-wicklungen der Region verorten. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Wechsel-verhältnis zum Industrierevier an der Saar, das der Kleinstadt Impulse verlieh, zu dem aber auch enge Verlechtungen nicht zuletzt nach dem Bau der Eisenbahn bestanden. Der letzte Aspekt dieses Einführungsteils richtet den Blick auf die sozialen Umstän-de und deren langfristige Entwicklung. Die Lebensverhältnisse der Einwohner, die
92 Die vernichteten Friedens- und Amtsgerichtsakten der preußischen Zeit werden durch solche der französischen Zeit vor 1815 ersetzt.93 Zahlreiche benutzte Quellen stammen aus oizieller Hand. So spielen Landräte, Bürgermeister und andere Beamte eine wichtige Rolle im Verhältnis zwischen Juden und Behörden und zwischen Juden und Christen. Außerdem liefern gerade die Ämter wichtige statistische Daten, die sie im Auf-trag der übergeordneten Instanzen anfertigten und die sich schließlich an den Gemeindegrenzen ori-entierten. Namentlich handelt es sich dabei um das Standesamt Merzig und die beim Amtsgericht Merzig lagernden Katasterwerke.
291.3 Konzeption und Gliederung
Trends bei der Lohn- und Preisentwicklung und die Armenplege bilden den Kern dieses Abschnitts. Mit der Aufarbeitung einer lokal begrenzten Gesellschat soll der soziale Raum abgesteckt werden, in dem sich die örtlichen Juden bewegten. Es wird gleichsam eine Vergleichsfolie ausgebreitet, vor deren Hintergrund sich das jüdische Leben in Merzig mehr oder weniger konturiert abhebt.
In Kapitel 3 verengt sich die Perspektive auf die jüdische Bevölkerung Merzigs. Ausgangspunkt ist die soziale Stellung der Juden als Minderheit. Dort steht zunächst die Bevölkerungsentwicklung und der rechtliche Rahmen der so genannten Judenge-setzgebung im Zentrum der Betrachtung. Es folgt eine sozialtopographische Analyse, die die jüdischen Einwohner in Bezug zum Raum setzt. Die räumliche Verteilung soll Rückschlüsse auf das Verhältnis von der Minderheit zur Mehrheit zulassen. Schließ-lich wird das religiöse Leben in der jüdischen Gemeinde selbst thematisiert. Im Au-ßenverhältnis von großer integrativer Krat, zeigen sich im Binnenverhältnis zahlrei-che Fraktionierungen, die sich als Versuche einer Positionierung in den vielschichtigen ökonomischen Beziehungsgelechten interpretieren lassen.
Die Vernetzung der jüdischen Akteure soll im folgenden Unterkapitel untersucht werden. Die konsequente Nutzung von Heiratsbeziehungen und das weite räumliche Ausgreifen unterschied die jüdischen Bewohner von ihren christlichen Nachbarn. Es soll dabei gezeigt werden, dass der gesellschatliche Aufstieg der Merziger Juden zu einem bedeutenden Teil auf die konsequente Nutzung sozialer Netzwerke zurückzu-führen ist. In diesen Kontext passt das folgende Unterkapitel, das sich der Migration widmet. Das hohe Maß an Mobilität, das die jüdische Bevölkerung insgesamt aus-zeichnete, wird als Indikator für die Attraktivität Merzigs ausgelegt und dient der Ein-ordnung der Kleinstadt in die jüdischen Migrationsnetze der gesamten Region.
Die beiden folgenden Unterkapitel konzentrieren sich auf Konlikte und Kontakt-zonen im jüdischen Binnenverhältnis, aber auch im Außenverhältnis zur christlichen Umwelt. Die in den Quellen autauchenden Fälle dokumentieren besonders die wirt-schatlichen Interessengegensätze. Die zwischenmenschlichen Krisen aufgrund von religiösen Spannungen oder Vorurteilen spielten lediglich eine untergeordnete Rol-le. Dementsprechend stehen auch die ökonomischen Konliktlinien im Mittelpunkt der Betrachtung. Daran schließen die zahlreichen Kontaktzonen zwischen Juden und Christen an, die von der geselligen Zusammenkunt bis zur lokalpolitischen Teilhabe reichten. In Vereinen und den Verwaltungsgremien der Stadt und der Wohltätigkeits-einrichtungen arbeiteten sie zusammen und engagierten sich zu geselligen oder gesell-schatlichen Zwecken.
Stand bisher die gesellschatliche Einordnung der Merziger Juden im Fokus, kon-zentriert sich Kapitel 4 auf die wirtschatlichen Aspekte. Im ersten von drei Teilen werden allgemeine Entwicklungen rekonstruiert und Zustandsbeschreibungen des Wohlstandes anhand von Steueraukommen und Nachlassinventaren vorgenommen. Daran schließt der zweite Teil an, der sich den Bedingungen und Formen der Armut widmet und dabei die Wandlungsprozesse von Armut und ihre verschiedenen Er-scheinungsformen analysiert. Zweck ist vor allem eine ausgewogene Darstellung der
30 1 Einleitung
wirtschatlichen Situation der Merziger Juden, die – und dieser Eindruck könnte nach dem vorherigen Abschnitt entstehen – nicht nur geschätliche Erfolge und Prosperität im Laufe des 19. Jahrhunderts erlebten. Es folgt schließlich eine genaue Analyse der Berufsstruktur. Ausgehend von einigen Vorarbeiten,94 soll hier die speziische Situati-on in Merzig dargestellt und der langfristige Wandel in den jüdischen Berufssparten beschrieben werden. Die mikrohistorische Perspektive diferenziert zum einen die bis-herigen Ergebnisse der Forschung und erlaubt zum anderen eine hohe Tiefenschär-fe. Gerade durch diesen Zugang können am Fallbeispiel Merzig Entwicklungspfade nachgezeichnet werden. Vorgestellt werden zum einen mit Vieh- und Warenhandel die beiden mit Abstand wichtigsten Betätigungsfelder und zum anderen mit Nischen-beschätigungen etwa im Handwerk die Versuche in anderen als den angestammten Bereichen Fuß zu fassen.
Dem Kreditmarkt wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Damit soll ein bisher nur we-nig näher analysierter, für das jüdische Wirtschatsleben aber umso wichtigerer Bereich aufgearbeitet werden. Das Engagement der Juden im Kreditwesen wird von der Litera-tur ot betont,95 belastbare Daten zu Höhe und Bedingungen der privaten Kredite gibt es aber im Gegensatz zu institutionellen Kreditgebern kaum.96 Dabei spielte gerade der private Kredit in Verbindung mit dem Handel eine enorme Rolle bei der Generierung von Einkommen. Aber nicht nur das Forschungsinteresse rechtfertigt die vergleichs-weise ausführliche Darstellung der Kreditbeziehungen. Dazu kommt der pragmatische Grund, dass durch das bereits erwähnte Forschungsprojekt zur privaten Kreditvergabe an der Universität des Saarlandes ein geschlossener Datenbestand für die Zeit von 1800 bis 1900 zur Berechnung von zentralen Kenngrößen genutzt werden kann.
Das Kapitel zum Kreditwesen teilt sich in zwei Unterkapitel, von denen das erste zunächst auf die bedeutende Rolle des Finanzsektors für eine ländlich-kleinstädtische Ökonomie eingeht und eher allgemeine Rahmendaten zur Entwicklung des Kredit-wesens, den Akteuren und der räumlichen Dimension liefert. Im zweiten Unterkapitel
94 Wichtige demographische Daten stammen zum Beispiel von Avraham Barkai, Jüdische Minder-heit und Industrialisierung. Demographie, Berufe und Einkommen der Juden in Westdeutschland 1850–1914, Tübingen 1988 (Schritenreihe wissenschatlicher Abhandlungen des Leo Baeck Insti-tuts 46). Mit Fokus auf die akademischen und bürgerlichen Berufe vgl. Richarz, Eintritt der Juden u. Stei Jersch-Wenzel, Bevölkerungsentwicklung und Berufsstruktur, in: Michael A. Meyer (Hrsg.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 2: Emanzipation und Akkulturation 1780–1871, München 2000, S. 57–95.95 So in dem Aufsatz von Binnenkade, Haben oder Nicht-Haben, S. 153–173. Handbücher konzen-trieren sich auf den Handel und vernachlässigen die große Bedeutung der Kreditvergabe für die jüdi-sche Landbevölkerung. Der Schwerpunkt bleibt bei den großen städtischen Bankiers. Vgl. dazu etwa Monika Richarz, Beruliche und soziale Struktur, in: Michael A. Meyer (Hrsg.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 3: Umstrittene Integration 1871–1918, München 2000, S. 39–68.96 Als Standardwerk vgl. Karl Erich Born, Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1977. Ohne an dieser Stelle zu detailliert darauf einzugehen, sei hier im Hinblick auf den Untersu-chungsort auf die Merziger Sparkasse hingewiesen. Vgl. Clemens Zimmermann, 150 Jahre Sparkasse Merzig-Wadern, Merzig 2007.
311.3 Konzeption und Gliederung
stehen die jüdischen Gläubiger und Schuldner sowie die Bedingungen der Kreditver-gabe im Mittelpunkt. Der Abgleich mit den nicht-jüdischen Pendants soll eine Ein-ordnung des jüdischen Engagements im Hinblick auf den Stellenwert des Geldhandels für die jeweilige Sozialgruppe ermöglichen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Schließlich wird in Anlehnung an die zuvor angestellten netzwerk-theoretischen Überlegungen die Netzwerkbildung durch Juden als ein Faktor für den wirtschatlichen Erfolg bei der Kreditvergabe interpretiert. Das Nutzen von verwandt-schatlichen und geschätlichen Verbindungen soll an Fallbeispielen demonstriert und als Teil der jüdischen Modernisierungsstrategie angesehen werden.










































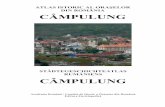
![["On the Settlement History of the Jews in the Middle Rhine Region up to the Beginning of the 16th Century."] "Zur Siedlungsgeschichte der Juden im mittleren Rheingebiet bis zum Beginn](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63356a2da1ced1126c0ac8be/on-the-settlement-history-of-the-jews-in-the-middle-rhine-region-up-to-the-beginning.jpg)





