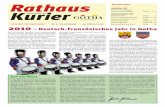Erstsprache – Herkunftssprache – Muttersprache. Sprachbiographische Zugriffe von...
-
Upload
uni-muenster -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Erstsprache – Herkunftssprache – Muttersprache. Sprachbiographische Zugriffe von...
Erstsprache – Herkunftssprache – Muttersprache. Sprachbiographische Zugriffe
von Deutsch-TürkInnen auf den Ausdruck Muttersprache
Katharina König
Spracherwerb und Sprachgebrauch sind unweigerlich mit individuellen biographischen Lebenswegen verknüpft, die wiederum in spezifische so-ziale und gesellschaftliche und Kontexte eingebettet sind. Diese lebens-geschichtliche Bedingtheit von Spracherwerb und subjektivem Sprach-erleben wird in sprachbiographischen Untersuchungen in den Blick ge-nommen. Sprachbiographische Zugänge finden sich in der Dialektologie (vgl. Macha 1991; Jürgens 2011), der Migrations- und Mehrsprachigkeits-forschung (etwa Betten 2011; Franceschini und Miecznikowski 2004a; Meng 2001), der Sprachhistoriographie (vgl. Fix 2010) ebenso wie in der Neurobiologie (vgl. Franceschini 2002) oder Patholinguistik (vgl. Top-hinke 1994). Der methodische Zugriff auf die Untersuchung von Sprach-biographien erweist sich als heterogen: Sprachbiographien können an-hand von Tagebuchaufzeichnungen (vgl. Pavlenko 2001), Sprachenport-folios (vgl. Oomen-Welke 2007), Sprachenporträts (vgl. Busch 2012) oder narrativen Äußerungen in qualitativen Interviews (Franceschini und Miecznikowski 2004b; vgl. König 2014) rekonstruiert werden (für einen methodischen Überblick siehe Pavlenko 2007). Es können allein solche subjektive Daten erhoben werden oder diese werden mit objektiven Da-ten trianguliert (vgl. Dannerer 2014). Allen Ansätzen ist jedoch das grundlegende Interesse an einer biographischen Situierung und Refle-xion von Spracherwerb und Sprachgebrauch gemein. Die jeweils erhobenen Daten werden sowohl zu Rekonstruktion des gelebten als auch zur Untersuchung des erzählten sprachlichen Lebens-weg genutzt (vgl. Tophinke 2002). Während es in ersterem Zugang da-rum geht, die sprachliche Entwicklung eines Sprechers/einer Sprecherin in seinem tatsächlichen Verlauf zu beschreiben,1 gehen andere Ansätze von der Prämisse aus, dass sprachbiographische Daten und Erinnerun-
1 Hier ist jedoch zu reflektieren, dass Angaben, die SprecherInnen über ihren ei-
genen sprachlichen Lebensweg machen, nicht immer zuverlässig sein können. Studien, die die gelebte Sprachbiographie zum Gegenstand haben, bedienen sich daher häufig einer Triangulation mit anderen Datentypen (vgl. Meng 2001; Dannerer 2014).
gen nicht direkt zugänglich sind. Wenn sprachbiographische Daten mit-hilfe narrativer Interviewverfahren erhoben werden, so sind sie entspre-chend in ihrer narrativen Verfasstheit zu analysieren (vgl. Tophinke 2002). Neben der Untersuchung erzählerischer Mittel bei der Rekon-struktion sprachbiographischer Erinnerungen (exemplarisch etwa bei Betten 2003; Schwitalla 2011) stehen auch wiederkehrende Motive oder Topoi im Zentrum des Forschungsinteresses zu erzählten Sprachbiogra-phien (vgl. Fix 2000; Franceschini 2001; Miecznikowski-Fünfschilling 2001; siehe auch Arendt 2010). Sprachbiographische Untersuchungen liegen bereits zu verschiede-nen Sprechergruppen vor.2 Die biographische Bedingtheit des Spracher-werbs von Deutsch-TürkInnen wurde bislang selten in einem dezidiert sprachbiographischen Ansatz untersucht (vgl. etwa Reich 2004), jedoch verweisen zahlreiche Studien aus dem Bereich der Migrationsforschung und Migrationslinguistik auf eine biographische Verarbeitung der je-weils spezifischen Erwerbsverläufe in dieser Sprechergruppe.
1 Deutsch-türkische Sprachbiographien
Befassten sich Untersuchungen zu deutsch-türkischer Mehrsprachigkeit in Deutschland zunächst meist mit dem so genannten „Gastarbeiter-deutsch“ der ersten Generation (vgl. Keim 1978), so wurden ab den 1990ern vermehrt kommunikative Praktiken der zweiten, in Deutsch-land geborenen und deutsch-türkisch mehrsprachig aufgewachsenen Generation in den Blick genommen (vgl. Pfaff 1991; Tertilt 1996; Dirim 1998; Hinnenkamp 2002; Auer 2003; Keim und Knöbl 2007). Ohne immer einem dezidiert sprachbiographischen Erkenntnisinteresse zu folgen, zeigen diese und weitere Studien zur zweiten Generation dennoch ein-drücklich auf, wie stark der eigene Blick auf den eigenen sprachlichen Werdegang und die subjektiven Einstellungen zu Mehrsprachigkeit die sprachliche Praxis der Deutsch-TürkInnen3 beeinflussen können. Exemplarisch seien hier etwa die Untersuchungen von Aslan (2004) und
2 Um die Spannbreite zu illustrieren, seien etwa die Studien von Betten 2010 zur
ersten und zweiten Generation von deutschsprachigen EmigrantInnen in Israel, von Treichel 2004 zur Mehrsprachigkeit von Walisern, von Franceschini 2001 zum ungesteuerten Italienischerwerb in der Deutschschweiz oder Fix und Barth 2000 zu Sprachbiographien ostdeutscher SprecherInnen nach der Wende ge-nannt.
3 Dies hat auch Einfluss auf nicht-türkischstämmige SprecherInnen. So weisen Dirim und Auer 2004 dem Türkischen ein „verstecktes Prestige“ nach, was zur Folge hat, dass auch Jugendliche ohne türkische Abstammung das Türkische erwerben.
Cindark (2010) genannt: Während die von Aslan untersuchten „Europa-türken“ oft eine klare Orientierung auf das Herkunftsland aufweisen und auf eine Trennung von Deutsch und Türkisch achten, situieren sich die „Unmündigen“ in Cindarks Studie in biographischen Marginalisierungs-erfahrungen und weisen einen größeren Anteil von deutsch-türkischen Sprachmischungen in ihrem kommunikativen Alltag auf. Relevant ist hier auch die Untersuchung Keims (2007) zu den „türkischen Power-girls“, die beispielsweise ihre Praxis des codemixings ändern, als sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Sprachgebrauch und biographische Sinngebung stehen für diese migrationsbedingt mehrsprachig aufge-wachsenen SprecherInnen also in einem engen Zusammenhang. Im vorliegenden Beitrag soll in den Blick genommen werden, wie sich ein individueller sprachbiographischer Zugriff nicht nur auf die Wahl der jeweiligen Interaktionssprache, sondern auch auf den Ge-brauch bestimmter zentraler sprachlich-kultureller Schlüsselbegriffe (vgl. Jandok 2008) auswirken kann. Exemplarisch soll dies an der Ver-wendung des Ausdrucks Muttersprache in sprachbiographischen Inter-views mit deutsch-türkisch zweisprachigen SprecherInnen thematisiert werden. Es soll untersucht werden, mit welchen Bedeutungen und Kon-notationen Muttersprache von den interviewten Personen gebraucht wird und inwiefern sich ihre jeweilige sprachbiographische Perspektive hierin widerspiegelt.
2 Zur Ambiguität des Ausdrucks Muttersprache
Selbst alltägliche Begriffe wie Muttersprache müssen hinterfragt werden, wenn man sich wissenschaftlich mit Sprache und Migration auseinandersetzt, denn auch wenn dieser Begriff recht eindeutig und harmlos klingt, ist es beinahe unmöglich, ihn zu definieren. (Peterson 2015, 6)
Der Begriff Muttersprache ist in aller Munde: Im Kontext von Sprache und Migration in Deutschland wird im öffentlichen Diskurs verhandelt, ob Eltern mit Migrationshintergrund mit ihren Kindern zu Hause Deutsch oder ihre Muttersprache sprechen sollen4 oder und in welchem Ausmaß muttersprachlicher Unterricht angeboten werden soll.5 Auch in linguistischen Studien wird der Ausdruck Muttersprache häufig genutzt: In der Spracherwerbsforschung wird die Muttersprache von der Fremd-
4 So löste etwa der Vorschlag der CSU „Wer dauerhaft hier leben will, soll dazu
angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu spre-chen.“ Ende 2014 eine kontrovers geführte Debatte aus; exemplarisch in der Dis-kussion auf Spiegel Online: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/csu-in-bayern-migranten-sollen-im-wohnzimmer-deutsch-sprechen-a-1006904.html.
5 Muttersprache meint hier eine Sprache, die nicht Deutsch ist.
und Zweitsprache unterschieden, um spezifische Erwerbskonstellatio-nen und hiervon abgeleitete Vermittlungsbedingungen beschreiben zu können. Prototypisch wird angenommen, dass Deutsch als Mutterspra-che (DaM) als erste Sprache von Lebensbeginn an natürlich und unge-steuert erworben wird und zumindest zum Zeitpunkt der Erwerbsbe-ginns von zentraler kommunikative Bedeutung für das Individuum ist (vgl. Ahrenholz 2008). Muttersprache wird hier also synonym zu dem Begriff Erstsprache verwendet. Deutsch als Zweitsprache (DaZ)6 und Deutsch als Fremdsprache (DaF)7 werden hiervon terminologisch ge-trennt.8 Nicht immer jedoch wird Muttersprache klar als zuerst erwor-bene Sprache definiert; häufig wird der Ausdruck als mehrdeutig oder missverständlich kritisiert (siehe auch Apeltauer 1997):
Der Begriff der Muttersprache ist für Sprachlehr- und -lernzusam-menhänge nicht gut geeignet, weil die Erstsprache keineswegs immer die Sprache der Mutter ist und Lernende oft andere Assoziationen mit dem Begriff Muttersprache verbinden als Wis-senschaftlerInnen. (Hufeisen und Riemer 2010, 738)
Durch die Fokussierung des dyadischen Mutter-Kind-Erwerbskontextes können andere Erwerbskonstellationen nicht adäquat berücksichtig werden (z.B. Einfluss des Vaters, der Geschwister, anderer Familienmit-glieder oder Gleichaltriger, vgl. auch Ahrenholz 2008). Des Weiteren ver-binden sich mit dem Begriff Muttersprache Konnotationen, die meist nicht explizit reflektiert werden (vgl. Doerr 2009). So verweisen etwa ver-schiedene Studien (Ahlzweig 1994; Bonfiglio 2010; Stukenbrock 2005) da-rauf, dass die Nativitätsmetaphorik diskurs- und begriffshistorisch eng mit der Idee eines einheitlichen deutschen Nationalstaates verwoben ist. Neben einer individuellen existiert somit auch eine gesellschaftlich-nor-mative Lesart des Begriffs Muttersprache:
Als Muttersprache wird die Sprache eines Individuums bezeichnet, die es mit Mitgliedern einer kulturell homogenen Gemeinschaft als Erstsprache gemeinsam hat und zu der es auf dieser Grundlage
6 DaZ wird zeitlich versetzt zur Muttersprache ungesteuert in einem deutsch-
sprachigen Land erworben. DaZ kommt also als Mittel zur Kommunikation im Alltag ein hoher Stellenwert zu. „In diesem Sinne wird Deutsch als Zweitsprache häufig mit ‚ohne Sprachunterricht’ und ‚Leben im Zielsprachenland’ in Verbin-dung gebracht.“ (Ahrenholz 2013, 4).
7 DaF wird häufig gesteuert im nicht-deutschsprachigen Ausland erworben und nimmt meist eine nur untergeordnete Rolle im kommunikativen Alltag der SprecherInnen ein. „In diesem Sinne wird Deutsch als Fremdsprache häufig mit den Begriffen ‚Fremdsprachenunterricht’ und ‚nicht zielsprachliche Lernumge-bung’ in Verbindung gebracht.“ (Ahrenholz 2013, 3).
8 Eine solche Abgrenzung kann jedoch lediglich Idealtypen beschreiben; Über-gänge oder Wechsel dieser Erwerbskonstellationen sind im Verlauf einer Sprachbiographie prinzipiell immer möglich (vgl. Schweckendiek 2002).
eine spezifische, auch affektive Bindung empfindet. (Dietrich 2004, 308)
Im Sinne des von Gogolin (2008) rekonstruierten „monolingualen Habi-tus“ kann der Ausdruck Muttersprache mitunter implizieren, dass ein Mensch über genau eine Muttersprache verfügt:
Mit dem Begriff Muttersprache konnotiert wird vielfach, Muttersprache sei das Pendant zu Vaterland, jeder Mensch besitze natürlicherweise genau eine Muttersprache und ein Vaterland. (Oomen-Welke 2003, 145)
Mit der Verwendung des Ausdrucks Muttersprache kann also eine be-stimmte Normvorstellung verbunden sein, nach der ein bilingualer oder doppelter Erstspracherwerb als abweichend gerahmt wird. Unklar ist zudem häufig, ob mit dem Terminus Muttersprache eine bestimmte Sprachbeherrschung verbunden wird bzw. welche Kennt-nisse in welchen Bereichen vorhanden sein müssen, um von „mutter-sprachlicher Kompetenz“ zu sprechen. In manchen Arbeiten wird Mut-tersprache mit der starken oder dominanten9 Sprache mehrsprachiger SprecherInnen gleichgesetzt.10 Eine Muttersprache kann demnach die Sprache sein, die man am besten beherrscht oder am liebsten oder häu-figsten nutzt. Wenn sich dieses Verhältnis jedoch im Laufe des sprachli-chen Lebenswegs verschiebt, kann es in einer solchen Lesart problema-tisch sein, Erstsprache und Muttersprache gleichzusetzen. Alltagssprachliche Verwendungen des Begriffs Muttersprache kön-nen sich von der sprachwissenschaftlichen Terminologie grundlegend unterscheiden. Boeckmann (2008) verweist in Anlehnung an die Be-funde von Brizić (2007) darauf, dass allein die fragebogengestützte Ab-frage der Muttersprache zu einem methodischen Problem werden kann, wenn die befragten Personen jeweils unterschiedliche Konzepte mit dem Ausdruck verbinden.11 Berend und Riehl (2008) zeigen auf, dass Russ-landdeutsche auch dann von Deutsch als ihrer Muttersprache sprechen, wenn sie die Sprache nicht als erste Sprache erworben haben und im All-tag nicht häufig nutzen. Hier wird Muttersprache also eher mit einem
9 Siehe Müller et al. 2011: Kapitel 4 und Meisel 2007 zum Konzept der Sprachdo-
minanz bzw. starker/schwacher Sprachen bilingual aufgewachsener Spreche-rInnen.
10 Für eine Diskussion dieser Konnotation des Ausdrucks Muttersprache vgl. Pfaff et al. 2004, siehe auch Skutnabb-Kangas und Phillipson 1989.
11 Vgl. auch Brizić 2013, 234–235.
kulturell-sprachlichem Erbe in Verbindung gebracht. Das Begriffsver-ständnis nähert sich so dem Konzept der Herkunftssprache bzw. hertiage language12 an (vgl. Wiley 2001; Doerr und Lee 2013). Die Vielschichtigkeit des Begriffs Muttersprache spiegelt sich nicht zuletzt auch in den Problemen, die bei der Abgrenzung und Definition von „muttersprachlichem Unterricht“ entstehen (vgl. Oomen-Welke 2003; Thürmann 2003). Hier stellt sich die Frage, inwiefern die mit dem Ausdruck Muttersprache verbundenen Erwerbsbedingungen überhaupt noch für die SchülerInnen zutreffend sind, für die ein „muttersprachli-cher“ Unterricht eingerichtet wird:
Wegen der unterschiedlichen sprachlichen Biographien der Kinder und Jugendlichen, die diese Unterrichtsangebote nutzen, wird die Bezeichnung Muttersprache immer fragwürdiger, denn ein beträchtlicher Anteil der Zielgruppe wächst - in Deutschland geboren - mit Deutsch und einer bzw. weiteren Familiensprachen auf. (Thürmann 2003, 163)
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass der Aus-druck Muttersprache in hohem Maße ambig ist. Das Bedeutungspoten-zial umfasst neben der zuerst erworbenen Sprache (Kriterium der Er-werbsreihenfolge), die im Alltag am häufigsten gebrauchte Sprache (Per-formanz), die Sprache, die ein Sprecher/eine Sprecherin am besten be-herrscht (Kompetenz) oder die er/sie am liebsten spricht (Präferenz) bzw. mit der er/sie eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit verbindet (Identität). Bei der Analyse sprachbiographischer Interviews ist also mit einer ähnlichen heterogenen Besetzung des Begriffs zu rechnen. Im Fol-genden soll daher der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutungs-dimensionen von Muttersprache in der Reflexion der Sprachbiographien von in Deutschland lebenden und deutsch-türkisch bilingualen Perso-nen zum Tragen kommen.
12 Fürstenau (2011, 31) kritisiert zurecht, dass der Begriff Herkunftssprache proble-
matisch ist, da die regionale Herkunft nicht immer auf die tatsächlich verwen-dete Sprache schließen lässt (wie etwa Brizić 2007 eindrücklich gezeigt hat). Zudem kann sich die Sprache einer ausgewanderten Gruppe von der im Her-kunftsland genutzten Sprache unterscheiden (siehe auch Lüttenberg 2010, 306). Anders als der deutsche Begriff Herkunft verweist das Englische heritage besser auf die hier gemeinte Funktion als kulturelles Erbe.
3 Der sprachbiographische Zugriff auf den Ausdruck Muttersprache
Die folgenden Analysen beziehen sich auf ein Korpus von zehn sprach-biographischen Interviews mit in Deutschland lebenden deutsch-tür-kisch zweisprachigen ProbandInnen.13 Zwei der untersuchten Interviews (#704, #706) stammen aus der linguistischen Audiodatenbank am Cent-rum Sprache und Interaktion der WWU Münster. Die Interviews sind von Studierenden im Rahmen von linguistischen Seminaren zu Migra-tion und Mehrsprachigkeit erhoben worden. Die weiteren Interviews sind dem „Lehrkorpus Sprachbiographien“ entnommen.14 Alle Inter-views sind anonymisiert und nach dem Gesprächsanaltischen Transkrip-tionssystem 2 (Selting et al. 2009) transkribiert worden.15 Die Gruppe der interviewten Personen kann unter Bezugnahme auf ihre soziodemographische Zusammensetzung als heterogen beschrieben werden: Die jüngsten InterviewpartnerInnen sind 16, der älteste 54 Jahre alt. Die meisten Gewährspersonen sind in Deutschland geboren, einige kamen im Kleinkindalter nach Deutschland (#704, #10, #16), andere im frühen Erwachsenenalter (#04, #11). Entsprechend sind auch die Bedin-gungen, unter denen sie die deutsche Sprache erworben haben, sehr he-terogen. Während die Sprecherin Selin Ergün (#706) angibt, Deutsch be-reits vor dem Kindergarten gesprochen zu haben, konnte der Sprecher Demir Tufan (#04) die Sprache erst nach seiner Migration nach Deutsch-land in verschiedenen Sprachkursen lernen. Für alle SprecherInnen ist jedoch gleich, dass sie sich in ihrem kommunikativen Alltag in Deutsch-land auf Türkisch und auf Deutsch verständigen. Anhand exemplari-scher Ausschnitte aus dem Interviewkorpus soll im Folgenden analysiert werden, welche Verwendungsweisen sich von Muttersprache rekonstru-ieren lassen und inwieweit diese sprachbiographisch zu verorten sind.
13 Eine tabellarische Korpusübersicht findet sich im Anhang. 14 Das „Lehrkorpus Sprachbiographien“ wurde unter der Leitung von Susanne
Günthner und Katharina König 2014–2015 am Germanistischen Institut der WWU Münster erhoben (weiterführende Informationen unter: http://www.uni-muenster.de/Germanistik/Lehrende/koenig_k/Lehrkor-pus_Sprachbiographien.html). Es umfasst leitfadengestützte Interviews, die von einer monolingual deutsch aufgewachsenen Interviewerin erhoben wur-den.
15 Im Anhang findet sich ein Überblick über die wichtigsten Transkriptionskon-ventionen.
3.1 Muttersprache als starke Erstsprache
In diesem Abschnitt soll das Schlüsselwort Muttersprache anhand von zwei Ausschnitten aus dem sprachbiographischen Interview mit 35-jäh-rigen Demir Tufan analysiert werden. Tufan ist in Ankara geboren und dort monolingual Türkisch aufgewachsen. Er kam im Alter von 26 Jahren für ein BWL-Studium nach Deutschland. Zu Beginn seines Studiums be-legte er mehrere DaF-Sprachkurse. Mittlerweile hat er das Studium ab-gebrochen und arbeitet als Kommissionierer in einem mittelständischen Unternehmen in NRW. In dem ersten Interviewausschnitt fragt die In-terviewerin den nach einer subjektiven Einschätzung seiner Sprach-kenntnisse im Türkischen und Deutschen.
Ausschnitt 1: Demir Tufan (#04; 0:16:21-0:17:19) 001 MaW gibt_s da für dich UNterschiede? 002 DeT äh zwischen den beiden SPRAchen? 003 (-) 004 gibt_s: [natür ]lich äh unterSCHIEde; 005 MAW [hm_hm,] 006 (-) 007 und zwar wo bei uns eigentlich manchmal so fachliche
WÖRter- 008 (.) 009 äh: um fachliche WÖRter geht, 010 (-) 011 würde ich sagen zum beispiel wenn wenn ich mir ein
DOku anhöre- 012 oder ANgucke- 013 und da: geht_s um medizinische THEmen, 014 und da als türke verstehe AUCH manchmal nicht so
alles (-) richtig; 015 weil da auch fachliche WÖRter benutzt werden; 016 (-) 017 MAW hm_hm, 018 DeT u::nd das ist auch SO meistens; 019 natürlich kann man ja meine mUttersprache nit mit
einer sprache verGLEIchen, 020 (-) 021 die ich SPÄter gelernt habe; 022 [meine mUt]tersprache ist natürlich (.) BESser; 023 MAW [hm_hm, ] 024 (-) 025 hm_hm, 026 DeT aber äh hören und lesen tue ich BEIdes, 027 MAW hm_hm,
Der Interviewte verwendet den Ausdruck Muttersprache in einem Kon-text, in dem er sein anfängliches Urteil, dass es Unterschiede zwischen seiner Kompetenz im Deutschen und im Türkischen gibt, illustriert und begründet. Er grenzt seine Muttersprache dabei von einer Sprache ab, die er zu einem nicht näher benannten späteren Zeitpunkt erlernt hat
(021). Die Muttersprache zeichnet sich dadurch aus, dass er sie besser beherrscht (022). Dass Tufan solche Unterschiede in seiner Kompetenz im Deutschen und im Türkischen feststellen kann, wird in der Sequenz mehrmals als „natürlich“ (004, 019, 022) gerahmt. Eine Muttersprache ist für ihn also eine Sprache, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit beherrscht wird (vgl. König 2014, 240–243 zum Selbstverständlichkeit-stopos in Sprachbiographien). Der Ausdruck wird zudem durch die Ver-wendung des Possessivums „meine“ (019, 022) personalisiert gebraucht; eine Muttersprache ist also eine Sprache, über die eine einzelne Person verfügt. Zwar benennt der Sprecher ein Beispiel, bei dem ihm sprachliche Probleme im Deutschen – vor allem auf lexikalischer Ebene („fachliche WÖRter“, 009, 015) – offenbar werden, er betont jedoch abschließend, dass er beide Sprachen rezeptiv nutzt (026). Aus diesem Sprachge-brauchsmuster folgt in seiner Darstellung jedoch nicht, dass das Deut-sche auch als Muttersprache bezeichnet werden kann. Im zweiten Ausschnitt fragt die Interviewerin den Sprecher nach ei-ner affektiven Bewertung des Deutschen und des Türkischen. Ausschnitt 2: Demir Tufan (#04; 0:36:22-0:37:35) 001 MAW ähm und in welcher sprache fühlst du dich zu
HAUse, 002 (-) 003 DeT hehe, 004 MAW hehe, 005 (-) 006 DeT gute FRAge- 007 ((stellt Tasse ab)) 008 ((räuspern)) 009 ÄH:- 010 (-) 011 ich denke weil ich auch jetzt äh manchmal DEUTSCH
träume, 012 MAW hm_hm, 013 DeT denke ich beide SPRAchen würde ich sagen; 014 MAW hm_hm, 015 (-) 016 DeT es ist äh (-) ich bin so wie gesagt DEUTSCH-= 017 =also ich spreche deutsch mehr als TÜRkisch; 018 MAW hm_hm, 019 (-) 020 DeT äh und von daher (-) würde ich sagen BEIde
sprachen;= 021 =man fühlt sich natürlich in mutterSPRAche- 022 wenn ich das äh: (.) SPREche mit jemandem, 023 MAW hm_hm, 024 DeT mit einem TÜRken; 025 (-) 026 dann ist alles einfach zu ERzählen; 027 MAW hm_hm, 028 DeT da hat man SCHWIErigkeiten manchmal deutsch; 029 also kannst du äh:: (--) manchmal findest du nicht
richtige WÖRter; 030 MAW hm_hm,
031 DeT aber auf meiner eigene MUTtersprache finde ich schon;
032 MEIStens; 033 irgendwie ANders, 034 aber ich finde ich schon richtige WÖRter; 035 MAW hm_hm, 036 [JA;] 037 DeT [JA;]
In diesem Ausschnitt wird der Ausdruck Muttersprache an einer sequen-tiellen Position verwendet, in der der Interviewte die vorherige Feststel-lung, dass er sich sowohl im Deutschen als auch im Türkischen zu Hause fühlt, relativiert. Der Sprecher stellt heraus, dass das Deutsche in seinem kommunikativen Alltag eine zentrale Position einnimmt, sowohl was die Häufigkeit des Gebrauchs (017) als auch die unterbewusste Verarbeitung der Sprache betrifft (011). Die Muttersprache (auch hier wieder persona-lisiert „auf meiner eigene MUTtersprache“, 031) wird dann relativierend als einfacher zugängliche Sprache charakterisiert, was – wie auch schon im ersten Ausschnitt – vor allem im Bereich der lexikalischen Kompetenz verortet wird. Dennoch lassen Tufans anfängliches Zögern auf die Frage der Interviewerin und die anschließende Angabe, dass er sich sowohl im Deutschen als auch im Türkischen zu Hause fühlt (013), erkennen, dass sich die Frage für ihn nicht einfach beantworten lässt und er auch dem Deutschen eine hohe affektive Bedeutung zuschreibt. Ein „zu Hause füh-len“ in einer anderen Sprache führt für den Sprecher jedoch nicht dazu, diese auch als Muttersprache einzustufen. Der Begriff Muttersprache wird von dem erst im jungen Erwachse-nenalter nach Deutschland migrierten Demir Tufan also im Sinne einer früh erworbenen Erstsprache verwendet, die auf Ebene der Sprachkom-petenz mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eine starke Sprache darstellt. Dass er im Alltag eine weitere Sprache mit hoher affektiver Be-deutung häufiger nutzt als das Türkische, steht seinem Konzept von Muttersprache jedoch nicht entgegen.
3.2 Muttersprache als von Sprachverlust bedrohte Sprache
Zeichnet sich bei dem seit neun Jahren in Deutschland lebenden Demir Tufan bereits ab, dass dem Deutschen neben seiner Erst- bzw. Mutter-sprache Türkisch eine zunehmende kommunikative Bedeutung zu-kommt, so soll in diesem Abschnitt der Frage nachgegangen werden, wie SprecherInnen, die schon längere Zeit in Deutschland leben oder in Deutschland geboren sind, den Terminus Muttersprache verwenden bzw. mit welche Topoi sie den Ausdruck verbinden. Der folgende Ausschnitt stammt aus dem sprachbiographischen In-terview mit der 40-jährigen Nazan Akgül, die im Alter von drei Jahren als Tochter eines Gastarbeiters nach Deutschland kam. Deutsch hat sie im
Kindergarten und in der Interaktion mit den überwiegend monolingual deutschen NachbarInnen erworben. Zwar nutzt sie das Türkische häufig in der Alltagskommunikation mit ihrer Familie, jedoch nimmt das Deut-sche als Umgebungssprache, in der sie vor allem während ihrer Arbeit im Einzelhandel agiert, einen zentralen kommunikativen Stellenwert ein. Vor Einsetzen des unten transkribierten Ausschnitts hat sie darüber gesprochen, dass sie Sprachmischungen vermeidet, da sie das Türkische „schön“ findet (vgl. auch die Wiederholung dieses Urteils in Z. 001). Der Ausdruck Muttersprache wird hier also in einem Kontext genutzt, in dem die Sprecherin Sprachgebrauchsmuster bewertet. Ausschnitt 3: Nazan Akgül (#704; 0:19:39-0:20:14) 001 NaA ich find_s eigentlich sehr SCHÖN;= 002 =man sollte es eigentlich (.) nicht äh verGESsen- 003 auch die eigene MUTtersprache nicht, 004 °h NE? 005 weil viele SIND leider so, 006 (-) 007 un:d äh die sind (.) so mehr eigentlich dann auch so
drauf fiXIERT- 008 dass sie dann nur noch DEUTSCH sprechen? 009 °h türkisch sehr äh eigentlich FAST verlernt haben, 010 °h äh finde ich NICHT schön, 011 man sollte schon (.) von beidem ETwas;=ne, 012 man sollte auch natürlich gar nicht so dass natürlich
dann (.) weniger DEUTSCH sprechen, 013 das auf keinen FALL, 014 °h aber man sollte auch die eigene MUTtersprache auch
nicht verlernen;=ne, 015 (1.0) 016 und da ste’ bisch würde ich auch drauf beSTEhen;
In der vorliegenden Sequenz setzt sich die Sprecherin von Personen ab, bei denen der Gebrauch des Türkischen sowohl in quantitativer („nur noch DEUTSCH“, 008) als auch in qualitativer Hinsicht („eigentlich FAST verlernt“, 009) – zum Teil bewusst gesteuert („drauf fiXIERT“, 007) – abnimmt. Im Rahmen von mehreren allgemeinen Regelformulierun-gen mit dem Indefinitpronomen man und dem Modalverb sollen (002, 011, 014) vermittelt sie ihren Anspruch, dass die Muttersprache nicht ver-lernt werden solle. Wie auch schon bei dem ersten Sprecher wird Mut-tersprache als individuelle bzw. personalisierte Entität gefasst; Akgül spricht bei beiden Verwendungen des Begriffs von der „eigenen“ Mutter-sprache (003, 014). Während dieses „Besitzverhältnis“ beim ersten Spre-cher noch als fast unbeeinflusst durch die deutsche Umgebungssprache beschrieben wurde, zeigt sich in dem vorliegenden Beispiel jedoch die Idee eines Vergessen- bzw. Verlernen-Könnens und damit der Topos ei-nes drohenden Sprachverlusts. Die personalisierte Verortung als „eigene Muttersprache“ kann die Nachdrücklichkeit des Erhalten-Sollens noch verstärken: Wenn es sich bei der Muttersprache um etwas Eigenes han-delt, stellt sich umso mehr die Frage, warum man sie aufgeben sollte.
Dennoch handelt es sich bei der Muttersprache für die Sprecherin um etwas, das man zumindest der Möglichkeit nach vollständig vergessen kann, das also nicht als ähnlich selbstverständlich wie in Ausschnitt 1 be-handelt wird. Trotz der negativen Rahmung eines möglichen Sprachverlusts („lei-der“, 005; „NICHT schön“, 010) hebt die Sprecherin nachdrücklich her-vor, dass im Umkehrschluss nicht weniger Deutsch gesprochen werden dürfe („das auf keinen FALL“, 013), sondern dass man beide Sprachen nutzen solle („von beidem ETwas“, 011). Die nicht zu vergessende Mut-tersprache wird somit in einem sprachlichen Umfeld verortet, das eine gleichwertige kommunikative Anforderung für das Deutsche hervor-bringt. In dieser spezifischen sprachbiographischen Position der Spre-cherin (das Deutsche als in ihrem kommunikativen Alltag seit ihrer frü-hen Kindheit dominanter Sprache) wird Muttersprache jedoch mit dem Topos eines möglichen Sprachverlusts in Zusammenhang gebracht. Dieser Topos wird auch von in Deutschland geborenen SprecherIn-nen der zweiten Generation verwendet. Dies geschieht in den zwei fol-genden Ausschnitten jeweils in einem Kontext, in dem auf eine vermin-derte Türkisch-Kompetenz verwiesen wird. Zunächst soll ein Ausschnitt aus dem sprachbiographischen Interview mit dem 17-jährigen Abiturien-ten Dincay Bayrak analysiert werden. Seine Mutter (#010), die im Klein-kindalter nach Deutschland kam, hat nach eigenen Angaben zunächst nur Deutsch mit ihm gesprochen; Türkisch habe sie erst zu einem späte-ren Zeitpunkt mit ihrem Sohn gebraucht. In dem folgenden Ausschnitt antwortet Dincay Bayrak auf die Frage, welche Sprache er mit welchem Familienmitglied spricht. Ausschnitt 4: Dincay Bayrak (#09; 0:10:37-0:11:50) 001 DiB äh mit meiner schwester rede ich (-) FAST nie
türkisch eigentlich, 002 weil: ich auch SIE: äh (-) halt äh- 003 (-) 004 weil ich einfach der MEInung bin- 005 dass ich äh viel mehr äh ((Uhrenpiepen)) ähm im
DEUTschen meine schwester unterstützen sollte- 006 anstatt das TÜRkische, 007 (-) 008 MAW hm_hm, 009 DiB <<:-)> was meine eltern NICHT so sehen,> 010 die DENken dann- 011 ja man sollte beides gleich gleich ähm (-)
((schnalzen)) GLEICHsetzen- 012 SAG ich mal, 013 und beides gleich gut äh (.) FORdern, 014 (-) 015 [weil das eine] ja eine MUTtersprache ist, 016 MAW [hm_hm, ] 017 DiB und auf keinen fall verGESsen sollte, 018 (-)
019 ähm kann ich auch gut so NACHvollziehen, 020 !MACH! ich auch, 021 respekTIER ich auch, 022 aber (.) ich ich DENK einfach- 023 für meine schwester ist es momentan als SCHÜlerin, 024 vielleicht von äh größerer beDEUtung- 025 wenn sie einfach besser DEUTSCH spricht, 026 (-) 027 MAW hm[_hm,] 028 DiB [und ] für MICH auch, 029 (-) 030 weil ich kei’ nicht wirklich einen großen NUTzen
darin sehe- 031 wenn ich TÜRkisch spreche mit ihr, 032 (-) 033 und mit meiner DEUTSCH’- 034 <<all> ach mit meiner DEUTschen mutter sage ich
schon;> 035 MAW he[he- ] 036 DiB [<<:-)> mit] meiner mutter rede ich auch
eigentlich NUR deutsch,> 037 MAW hm_hm, 038 DiB weil weil ich halt nicht so ah nicht so nicht so
nen guten WORTschatz habe- 039 so im TÜRkischen, 040 MAW hm_hm, 041 DiB deswegen kann ich mich nicht so gut artikuLIEren; 042 im TÜRkischen- 043 MAW hm_hm, 044 DiB und [REde] eigenlich nur- 045 MAW [hm; ] 046 DiB ich kann mich eigentlich besser AUSdrücken; 047 im DEUTschen;
Der interviewte Sprecher positioniert sich in diesem Ausschnitt in der Rolle des Sprachförderers seiner Schwester. Er stellt es als seine Aufgabe dar, vor allem Deutsch mit ihr zu sprechen, da dies die Sprache ist, von der sie in der Schule profitiert (023-025). Umgekehrt sieht er keinen sol-chen Vorteil in der Förderung des Türkischen (030-031). Deutsch und Türkisch werden hier also nicht unter emotionalen, sondern unter Ge-sichtspunkten der Nützlichkeit auf einem „sprachlichen Markt“ (vgl. Blommaert 2010) bewertet und eingeschätzt. Der Ausdruck Muttersprache sowie der Topos eines drohenden Sprachverlusts werden anschließend als Zitat der Auffassung seiner El-tern präsentiert und verarbeitet. Zwar gibt der Interviewte an, die Posi-tion seiner Eltern prinzipiell verstehen zu können, jedoch stellt er seine eigene Einschätzung mehrmals (009, 022-025) als konträr hierzu dar. Im Gegensatz zu den bisherigen Ausschnitten wird Muttersprache hier nicht personalisiert verwendet; stattdessen wird das Türkische unbestimmt als „eine MUTtersprache“ (015) gerahmt.
Als Dincay Bayrak angibt, auch mit seiner Mutter nur Deutsch zu sprechen, führt er als Begründung eine negative Einschätzung der eige-nen Türkisch-Kompetenz an. Sein Wortschatz reiche nicht aus, um sich im Türkischen adäquat auszudrücken (038-042). Die Sprache, die seine Eltern als Muttersprache bezeichnen, ist für ihn also eine Sprache, die er nicht gut beherrscht und der er in seiner derzeitigen sprachbiographi-schen Situation keinen spezifischen Nutzen zuschreiben kann. Auch in dem folgenden Ausschnitt aus dem Interview mit dem 16-jährigen in Deutschland geborenen Schüler Gökan Birol wird der Aus-druck Muttersprache auf ähnliche Weise verarbeitet: Ausschnitt 5: Gökhan Birol (#14 ; 0:04:41-0:05:35) 001 MAW also das HEIßT- 002 e_auch (-) auch ähm heute sprichst du noch dann mit
deiner familie noch TÜRkisch? 003 GöB JA; 004 (.) 005 MEIStens; 006 also ich finde schon muttersprache ist schon
WICHtig? 007 (-) 008 MAW hm_hm, 009 (-) 010 GöB äh: worum (.) ich also (.) DENke ich auch-= 011 =dass die deutsche sprache eigenlich NOCH wichtiger
(.) ist,=ne, 012 [weil wir] ja jetzt hier LEben, 013 MAW [hm_hm, ] 014 GöB [sozuSAgen,] 015 MAW [hm_hm, ] 016 GöB abe:r die muttersprache sollte man schon NICHT
vergessen; 017 (-) 018 MAW hm_hm, 019 und die mUttersprache ist für dich TÜRkisch, 020 GöB <<p> ja geNAU;> 021 MAW hm_hm, 022 (-) 023 wenn du ähm (-) das jetzt mal so verGLEICHST- 024 also so EINschätzt- 025 wie gut (-) kannst du TÜRkisch sprechen, 026 UND- 027 GöB ((langes und lautes Einatmen)) 028 also [ich kann türkisch SO gut sprechen-] 029 MAW [also wenn du jetzt zum BEIspiel- ] 030 GöB dass ich mich mit anderen türken (-) kommuniZIEren
kann, 031 MAW hm_hm, 032 (--) 033 GöB a:ber äh wenn ich bei uns in der türKEI bin, 034 und mit jemandem REde, 035 MAW hm_hm, 036 GöB he <<lachend> dann fällt denen schon AUF,> 037 dass ich nen AUSländer bin; 038 MAW hm_hm,
039 GöB sozusagen für DIE (.) [AUs]länder bin; 040 MAW [JA;]
Der Ausdruck Muttersprache wird in einem Kontext verwendet, in dem die Wahl des Türkischen als Familiensprache begründet wird. Ebenso wie Dincay Bayrak verortet aber auch Gökan Birol das Türkische als seine Muttersprache auf einem „sprachlichen Markt“, auf dem dem Deutschen eine zentralere Rolle als Interaktionssprache mit der Umgebung zu-kommt (011). Wie auch schon bei Dincay Bayrak wird Muttersprache aber nicht durch Possessiva markiert, also nicht als etwas Eigenes gerahmt.16 Auch wenn er im Folgenden durch sein Zögern (027) und dem anschlie-ßend benannten Erlebnis, in der Türkei aufgrund der Sprache als „AUS-länder“ (037) kategorisiert zu werden, seine Türkisch-Kompetenz relati-viert, gibt der Sprecher dennoch an, die Muttersprache nicht vergessen zu wollen (016).17 Die Verwendung des Begriffs Muttersprache nähert sich in den letz-ten beiden Sequenzen eher dem Konzept einer Herkunftssprache an, der nur noch eine eingeschränkte Bedeutung im eigenen Sprachrepertoire zugeschrieben wird:
Wenn von ‚Herkunftssprachen’, ‚Sprachen kulturellen Erbes’ oder – in Frankreich – von ‚langues d’origines’ gesprochen wird, so wird damit auf eine durch Herkunft und/oder Tradition begründete Verbindung mit einer Sprache Bezug genommen. […] Wie bereits am Beispiel autochthoner Sprachminderheiten dargelegt, muss eine als ‚Sprache des kulturellen Erbes’ einer Gruppe bezeichnete Sprache keineswegs Erstsprache der Angehörigen dieser Gruppe sein, dennoch kann der Wunsch bestehen, diese Sprache zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben. (Kniffka und Siebert-Ott 2012, 177–178)
In einer sprachbiographischen Konstellation, in der die Türkisch-Kompetenz bei den Interviewten zunehmend schwindet, kommt dem Begriff Muttersprache nicht mehr die Bedeutung einer ersten oder star-ken bzw. präferierten Sprache zu. Er wird vielmehr mit Konnotationen eines erhaltenswerten Erbes aufgeladen. Der Wert dieser Herkunftsspra-che auf dem „sprachlichen Markt“, in dem sich die SprecherInnen aktuell bewegen, wird allerdings gering eingeschätzt.
16 Birol nutzt lediglich ein artikelloses „muttersprache“ (006) und „die mutterspra-
che“ (016). 17 Auch hier ist der Topos wieder mit dem Indefinitpronomen man und dem Mo-
dalverb sollen als appellative Regel formuliert (vgl. Ausschnitt 3).
3.3 Deutsch als (Fast-)Muttersprache
Während in den vorhergehenden Beispielen mit dem Begriff Mutterspra-che immer das Türkische bezeichnet wurde, soll zuletzt eine Erweiterung auf das Deutsche als mögliche Muttersprache aufgezeigt werden. Hierfür werden zwei Ausschnitte aus dem sprachbiographischen Interview mit der 23-jährigen Studentin Selin Ergün herangezogen. Die Sprecherin wurde in Deutschland geboren, sprach in ihrer Familie zunächst nur Türkisch und erwarb mit Eintritt in den Kindergarten die deutsche Spra-che, die sie heute auch überwiegend mit ihren Geschwistern nutzt. Ausschnitt 6: Selin Ergün (#706; 0:04:08-0:04:54) 001 ClW und ähm: welchen STELlenwert hat für dich deine
mehrsprachigkeit? 002 (1.0) 003 SEL °h eigentlich einen HOhen; 004 hehe, 005 ähm ich äh (--) JA; 006 (-) 007 ich find_s eigentlich SUper, 008 dass ich äh: in einem Anderen land geBOren (--)
bin,18 009 und eine zweite sprache wie eine muttersprache
beHERRsche, 010 es hat natürlich seine NACHteile irgendwo- 011 weil (-) nichtsdestotrotz kann ich (.) einfach die
deutsche sprache auch nicht perFEKT beherrschen, 012 also das (.) da tauchen immer wieder fehler auf, 013 °h ich MERK das zwar-= 014 =aber (--) <<:-)> es pasSIERT einfach,> 015 ClW hm_hm, 016 SEL ähm (-) aber trotzdem finde ich wenn man
mehrsprachig AUFwächst, 017 oder mehr_mehrere sprachen KANN- 018 kann es nur von VORteil sein; 019 also ich seh da keine (-) keine proBLEme;
Die Verwendung von Muttersprache steht hier in einem globalen Kon-text, in dem die Sprecherin allgemeine Vorteile von Mehrsprachigkeit hervorhebt. Der Begriff bezieht sich hier jedoch nicht auf das Türkische, sondern wird zur vergleichenden Charakterisierung von Ergüns Deutsch-Kompetenz („wie eine muttersprache“, 009) herangezogen. Hier spiegelt sich die Idee wider, dass eine Muttersprache mit einer um-fassenden Sprachbeherrschung einhergeht.19 Ähnlich argumentiert sie auch, als sie zu einem späteren Zeitpunkt von der Interviewerin direkt
18 Diese Formulierung kann missverständlich sein; die Sprecherin meint hier, dass
sie in einem anderen Land als die Türkei geboren wurde. 19 Dass Ergün hier auch auf sprachliche Fehler verweist, kann erklären, warum das
Deutsche lediglich als einer Mutterspräche ähnlich charakterisiert wird.
danach gefragt wird, ob sie Deutsch als ihre Muttersprache bezeichnen würde: Ausschnitt 7: #706 (0:07:19-0:07:59) 001 ClW und ähm du hast ganz am anfang geSAGT- 002 °h dass äh deine muttersprache ist TÜRkisch. 003 SEL hm_hm, 004 ClW °h w:_würdest du ähm (-) SAgen-= 005 =du hast (.) NUR eine muttersprache, 006 oder würdest du deutsch ZUsätzlich als deine
mutterst’ sprache bezeichnen- 007 oder (.) WIE siehst du das, 008 (--) 009 SEL °h ähm: also ich WEIß nicht- 010 was die kriterien daFÜR sind- 011 dass man SAgen kann- 012 das ist deine MUTtersprache; 013 aber °h zumindest (.) meiner empfindung nach (.)
denke ich SCHON, 014 dass ich äh zw’ also dass deutsch AUCH eine
muttersprache von mir ist, 015 ähm aufgrund der TATsache weil ich das- 016 (-) 017 einem also ich KANN in jeder lebenslage mit
irgendwelchen (.) personen darüber REden- 018 und äh mich irgendwie <<:-)> AUSdrücken- 019 dass die mich> dann auch verSTEhen, 020 °hh da: würde ich dann SAgen- 021 dass ich äh (.) quasi (.) sowohl DEUTSCH- 022 also auch äh TÜRkisch äh- 023 dass das meine MUTtersprachen sind; 024 ClW hm_hm,
Die Sprecherin stimmt unmittelbar zu (003), als die Interviewerin reka-pituliert, dass Selin Ergün zu Beginn des Interviews das Türkische als ihre Muttersprache bezeichnet hat; auf die Frage nach dem Deutschen als Muttersprache zögert sie jedoch zunächst (008). Aus ihrer eigenen Perspektive (die sie einer möglichen wissenschaftlichen Definition von Muttersprache entgegensetzt) übernimmt sie die zweite von der Inter-viewerin formulierte Möglichkeit: Deutsch wird explizit als weitere Mut-tersprache genannt (014, 023); beide Vorkommen des Begriffs Mutter-sprache sind personalisiert („muttersprache von mir“, 014, „meine MUT-tersprachen“, 023), hier aber im Gegensatz zu Verwendungen in den bis-her betrachteten Interviewausschnitte dadurch erweitert, dass ein Indi-viduum auch mehr als eine Muttersprache haben kann. Im Gegensatz zu Ausschnitt 6 nimmt die Sprecherin nun eine positive Kompetenzein-schätzung für beide Sprachen vor.20 Muttersprache wird also auch hier
20 Kompetenz wird hier allerdings nicht im Sinne einer Sprachrichtigkeit wie in
Ausschnitt 6, sondern vielmehr als kommunikative Kompetenz interpretiert.
wieder mit Sprachbeherrschung gleichgesetzt. In einer sprachbiographi-schen Konstellation, in der die Sprecherin zunächst Türkisch, ab dem Frühkindalter dann auch die Umgebungssprache Deutsch erworben hat und dieser Mehrsprachigkeit einen hohen Stellenwert beimisst, ist es also möglich, dass auch die Zweitsprache mit dem Begriff Muttersprache bezeichnet werden kann.
4 Fazit und Diskussion
Anhand von sprachbiographischen Interviews können individuelle Er-werbsverläufe, Sprachrepertoires und Sprachgebrauchsmuster aus der lebensgeschichtlichen Perspektive der SprecherInnen selbst rekonstru-iert werden. Untersucht man deutsch-türkische Sprachbiographien, so erweisen sich die sprachlichen Lebensläufe und biographischen Sinnzu-schreibungen als in hohem Maße heterogen. Dies spiegelt sich in der Verwendung des Ausdrucks Muttersprache wider, der in den hier analy-sierten Interviewausschnitten in verschiedenen Auslegungen gebraucht wird. Meist nutzen die Interviewten den Begriff in argumentativen Zu-sammenhängen, um eine vorher getätigte Sprachbewertung oder Ein-stellungsaussage zu plausibilisieren oder zu begründen. Hierbei werden verschiedene sprachliche Topoi aufgerufen: Während ein erst vor weni-gen Jahren nach Deutschland migrierter Sprecher Muttersprache mit ei-nem selbstverständlichen Kompetenzvorsprung verbindet, zeigt sich in den sprachbiographischen Interviews von länger in Deutschland leben-denden oder in Deutschland geborenen SprecherInnen dagegen ein To-pos des drohenden und zu vermeidenden Sprachverlusts. Muttersprache wird hier als kulturell-sprachliches Erbe gerahmt, das nicht mehr not-wendigerweise mit einer hohen Sprachkompetenz verbunden wird und das unter den Bedingungen des „sprachlichen Markts“ (Blommaert 2010) in Deutschland zudem schnell in Vergessenheit geraten kann. Zum Teil bezeichnen SprecherInnen der zweiten Generation auch das Deutsche als eine ihrer Muttersprachen, sodass der Begriff seine monolinguale Konnotation verliert. Die hier exemplarisch untersuchten Verwendungen des Ausdrucks Muttersprache können sicherlich nur einen ersten Einblick in die kom-plexe sprachbiographische Situation von Deutsch-TürkInnen geben. In einer größer angelegten Studie mit SprecherInnen der zweiten Genera-tion könnte etwa untersucht werden, auf welche Bereiche des kommu-nikativen Repertoires sich die in den hier untersuchten Interviews zei-gende Herkunftssprachenideologie, also die Idee, dass die Herkunfts-sprache/heritage language beibehalten und gepflegt werden sollte (vgl.
König et al. i.Dr.), erstreckt. Ebenso kann der Nutzen, den die Spreche-rInnen dem Deutschen als Bildungssprache auf dem „sprachlichen Markt“ zuschreiben, auf dem sich die deutsch-türkisch Zweisprachigen bewegen, Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Zudem sollten auch weitere mögliche Konnotationen des Begriffs Muttersprache im öffentlichen Diskurs von Migration und Mehrspra-chigkeit thematisiert werden: Zwar gibt es zahlreiche Studien, die sich mit der diachronen Entwicklung des Begriffs Muttersprache im deut-schen Sprachraum befassen (vgl. Ahlzweig 1994; Stukenbrock 2005), es fehlen jedoch umfassende diskursanalytische Studien zum Begriff Mut-tersprache im aktuellen Migrationsdiskurs. Hier kann sich die Frage an-schließen, wie sich dieser Diskurs in der sprachbiographischen Deutung des eigenen Spracherwerbs und Sprachgebrauchs von migrationsbedingt mehrsprachig aufgewachsenen SprecherInnen niederschlägt.
Literaturverzeichnis
Ahlzweig, Claus (1994): Muttersprache – Vaterland. Die deutsche Nation und ihre Sprache. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Ahrenholz, Bernt (2008): „Erstsprache – Zweitsprache – Fremdsprache“. In: Ahrenholz, Bernt/Oomen-Welke, Ingelore (Hg.): Deutsch als Zweitsprache. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 3–16.
Ahrenholz, Bernt (2013): „Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweit-sprache. Orientierungen“. In: Oomen-Welke, Ingelore/Ahrenholz, Bernt (Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 3–10.
Apeltauer, Ernst (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachener-werbs. Eine Einführung. Berlin, München, Wien: Langenscheidt.
Arendt, Birte (2010): Niederdeutschdiskurse. Spracheinstellungen im Kon-text von Laien, Printmedien und Politik. Berlin: Erich Schmidt.
Aslan, Sema (2004): „Aspekte des kommunikativen Stils einer Gruppe weltläufiger Migranten türkischer Herkunft: Die ‚Europatürken‘“. In: Deutsche Sprache 32.4: 327–356.
Auer, Peter (2003): „‚Türkenslang‘: Ein jugendlicher Ethnolekt des Deut-schen und seine Transformationen“. In: Häcki Buhofer, Annelies (Hg.): Spracherwerb und Lebensalter. Tübingen, Basel: Francke, 255–264.
Berend, Nina/Riehl, Claudia Maria (2008): „Russland“. In: Eichinger, Ludwig M./Plewnia, Albrecht/Riehl, Claudia M. (Hg.): Handbuch
der deutschen Sprachminderheiten in Mittel- und Osteuropa. Tübin-gen: Narr, 17–58.
Betten, Anne (2003): „Style shifting in narrativ-diskursiven Interviews“. In: Barz, Irmhild (Hg.): Sprachstil – Zugänge und Anwendungen. Ulla Fix zum 60. Geburtstag. Heidelberg: Winter, 9–22.
Betten, Anne (2010): „Sprachbiographien der 2. Generation deutschspra-chiger Emigranten in Israel. Zur Auswirkung individueller Erfahrun-gen und Emotionen auf die Sprachkompetenz“. In: Zeitschrift für Li-teraturwissenschaft und Linguistik 40: 29–57.
Betten, Anne (2011): „Zusammenhänge von Sprachkompetenz, Sprach-einstellung und kultureller Identität – am Beispiel der 2. Generation deutschsprachiger Migranten in Israel“. In: Betten, Anne/Thüne, Eva-Maria (Hg.): Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien. Rom: Aracne, 53–87.
Blommaert, Jan (2010): The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Boeckmann, Klaus-Börge (2008): „Mehrsprachigkeit und Migration: Lässt sich sprachliche Assimilation wissenschaftlich rechtfertigen?“ In: Zielsprache Deutsch 35.1: 3–22.
Bonfiglio, Thomas Paul (2010): Mother tongues and nations. The inven-tion of the native speaker. Berlin, New York: de Gruyter.
Brizić, Katharina (2007): Das geheime Leben der Sprachen. Gesprochene und verschwiegene Sprachen und ihr Einfluss auf den Spracherwerb in der Migration. Münster, München: Waxmann.
Brizić, Katharina (2013): „Grenzenlose Biografien und ihr begrenzter (Bil-dungs-)Erfolg. Das Thema der sozialen Ungleichheit aus der Per-spektive eines laufenden soziolinguistischen Forschungsprojekts“. In: Deppermann, Arnulf (Hg.): Das Deutsch der Migranten. Berlin: de Gruyter, 223–242.
Busch, Brigitta (2012): „The linguistic repertoire revisited”. In: Applied Linguistics 33.5: 503–523.
Cindark, Ibrahim (2010): Migration, Sprache und Rassismus. Der kommu-nikative Sozialstil der Mannheimer „Unmündigen“ als Fallstudie für die „emanzipatorischen Migranten“. Tübingen: Narr.
Dannerer, Monika (2014): „Sprachbiographische Äußerungen und Erzäh-lerweb im Längsschnitt als Zugangswege zur Beschreibung von Zweitspracherwerb“. In: Ahrenholz, Bernt/Grommes, Patrick (Hg.): Zweitspracherwerb im Jugendalter. Berlin: de Gruyter, 295–317.
Dietrich, Rainer (2004): „Erstsprache – Muttersprache“. In: Ammon, Ul-rich/Dittmar, Norbert/Mattheier, Klaus J./Trudgill, Peter (Hg.): Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Lan-guage and Society. Berlin: de Gruyter, 305–311.
Dirim, İnci/Auer, Peter (2004): Türkisch sprechen nicht nur die Türken. Über die Unschärfebeziehung zwischen Sprache und Ethnie in Deutschland. Berlin: de Gruyter.
Dirim, İnci (1998): „Var mı lan Marmelade?“. Türkisch-deutscher Sprach-kontakt in einer Grundschulklasse. Münster, New York: Waxmann.
Doerr, Neriko Musha (2009): “Investigating ‘native speaker effects’: To-wards a new model of analyzing ‘native speaker’ ideologies.” In: Do-err, Neriko Musha (Hg.): The Native Speaker Concept. Ethnographic Investigations of Native Speaker Effects. Berlin, New York: de Gruy-ter, 15–46.
Doerr, Neriko Musha/Lee, Kiri (2013): Constructing the Heritage Lan-guage Learner. Knowledge, Power, and New Subjectivities. Boston, Berlin: de Gruyter.
Fix, Ulla (2000): „Fremdheit versus Vertrautheit. Die sprachlich-kommu-nikativen Befindlichkeiten von Sprachteilnehmern in der DDR und ihre Reaktionen auf die Destruktion der kommunikativen ‚Selbst-verständlichkeiten‘ im Alltag“. In: Fix, Ulla/Barth, Dagmar (Hg.): Sprachbiographien. Sprache und Sprachgebrauch vor und nach der Wende 1989 im Erinnern und Erleben von Zeitzeugen aus der DDR. Inhalte und Analysen narrativ-diskursiver Interviews. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 15–54.
Fix, Ulla (2010): „Sprachbiographien als Zeugnisse von Sprachgebrauch und Sprachgebrauchsgeschichte“. In: Zeitschrift für Literaturwissen-schaft und Linguistik 40: 10–28.
Fix, Ulla/Barth, Dagmar (Hg.) (2000): Sprachbiographien. Sprache und Sprachgebrauch vor und nach der Wende 1989 im Erinnern und Erle-ben von Zeitzeugen aus der DDR. Inhalte und Analysen narrativ-dis-kursiver Interviews. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Franceschini, Rita (2001): „Der ‚Adiuvant‘: Die Figur der Stützperson im sprachbiographischen Interview mehrsprachiger Sprecher“. In: Kel-ler, Thomas/Raphael, Fraddy (Hg.): Biographien im Plural. Interkul-turalität, Paare, Inszenierung. Sprache – Literatur – Gesellschaft. Straßburg: Presses Universitaires de Strassbourg, 227–238.
Franceschini, Rita (2002): „Sprachbiographien: Erzählungen über Mehr-sprachigkeit und deren Erkenntnisinteresse für die Spracherwerbs-forschung und die Neurobiologie der Mehrsprachigkeit“. In: Bulletin VALS-ASLA 76: 19–33.
Franceschini, Rita/Miecznikowski, Johanna (Hg.) (2004a): Leben mit mehreren Sprachen. Vivre avec plusieurs langues. Sprachbiographien. Biographies langagières. Frankfurt a.M.: Lang.
Franceschini, Rita/Miecznikowski, Johanna (2004b): „‚Wie bin ich zu meinen verschiedenen Sprachen gekommen?‘ Ein Vorwort“. In: Franceschini, Rita/Miecznikowski, Johanna (Hg.): Leben mit mehre-ren Sprachen. Vivre avec plusieurs langues. Sprachbiographien. Bio-graphies langagières. Frankfurt a.M.: Lang, VII–XXI.
Fürstenau, Sara (2011): „Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und Ziel schulischer Bildung“. In: Fürstenau, Sara/Gomolla, Mechtild (Hg.): Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit. Wiesbaden: VS Verlag, 25–50.
Gogolin, Ingrid (2008): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann.
Hinnenkamp, Volker (2002): „Deutsch-türkisches Code-Mixing und Fra-gen der Hybridität“. In: Hartung, Wolfdietrich/Shethar, Alissa (Hg.): Kulturen und ihre Sprachen. Die Wahrnehmung anders Spre-chender und ihr Selbstverständnis. Berlin: Trafo Verlag, 123–143.
Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (2010): „Spracherwerb und Sprachen-lernen“. In: Helbig, Gerhard/Götze, Lutz/Henrici, Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Band 1. Berlin, New York: de Gruyter, 738–753.
Jandok, Peter (2008): Das Konzept der Cultural Keywords 帮助 (Hilfe) und 支持 (Unterstützung) und seine Konsequenzen für deutsche Bildungseliten in China. In: OBST 75: 145–164.
Jürgens, Carolin (2011): „‚Plattdeutsch ist Hobbysprache‘. Der individu-elle Wandel des Sprachgebrauchs Hamburger Niederdeutschspre-cher“. In: NLK-Proceedings: 12. Norddeutsches Linguistisches Kollo-quium 12: 1–23.
Keim, Inken (1978): Gastarbeiterdeutsch. Untersuchungen zum sprachli-chen Verhalten türkischer Gastarbeiter. Tübingen: Narr.
Keim, Inken (2007): Die ‚türkischen Powergirls‘. Lebenswelt und kommu-nikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim. Tübingen: Narr.
Keim, Inken/Knöbl, Ralf (2007): „Sprachliche Varianz und sprachliche Virtuosität türkisch-stämmiger Ghetto-Jugendlicher in Mannheim.“ In: Fandrych, Christian/Salverda, Reinier (Hg.): Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen. Tübingen: Narr, 157–199.
Kniffka, Gabriele/Siebert-Ott, Gesa (2012): Deutsch als Zweitsprache. Lehren und lernen. Stuttgart: UTB.
König, Katharina (2014): Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion. Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer In-terviews mit Deutsch-Vietnamesen. Berlin: Akademie Verlag.
König, Katharina/Dailey-O’Cain, Jennifer/Liebscher, Grit (i.Dr.): “A com-parison of heritage language ideologies in interaction”. In: Journal of Sociolinguistics 19.
Lüttenberg, Dina (2010): „Mehrsprachigkeit, Familiensprache, Her-kunftssprache. Begriffsvielfalt und Perspektiven für die Sprachdi-daktik“. In: Wirkendes Wort 60: 299–315.
Macha, Jürgen (1991): Der flexible Sprecher. Untersuchungen zu Sprache und Sprachbewußtsein rheinischer Handwerksmeister. Köln: Böhlau.
Meisel, Jürgen (2007): “The weaker language in early child bilingualism. Acquiring a first language as a second language?” In: Applied Psy-cholinguistics 28.3: 495–514.
Meng, Katharina (2001): Russlanddeutsche Sprachbiographien. Untersu-chungen zur sprachlichen Integration von Aussiedlerfamilien. Tübin-gen: Narr.
Miecznikowski-Fünfschilling, Johanna (2001): „Parallelen in der Darstel-lung von Sprachkontakt und -erwerb: zwei biographische Inter-views“. In: Keller, Thomas/Raphael, Freddy (Hg.): Biographien im Plural. Interkulturalität, Paare, Inszenierung. Sprache – Literatur – Gesellschaft. Straßburg: Presses Universitaires de Strassbourg, 215–225.
Müller, Natascha/Kupisch, Tanja/Schmitz, Katrin;/Cantone, Katja (2011): Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung. Deutsch – Franzö-sisch – Italienisch. Tübingen: Narr.
Oomen-Welke, Ingelore (2003): „Muttersprachen- und Fremdsprachen-unterricht“. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Stuttgart: Francke, 145–151.
Oomen-Welke, Ingelore (2007): „‚Meine Sprachen und ich‘ Inspiration aus der Portfolio-Arbeit für DaZ in Vorbereitungsklasse und Kinder-garten“. In: Ahrenholz, Bernt (Hg.): Kinder mit Migrationshinter-grund. Spracherwerb und Fördermöglichkeiten. Freiburg: Fillibach, 115–131.
Pavlenko, Aneta (2001): “Language learning memoirs as a gendered genre”. In: Applied Linguistics 22.2: 213–240.
Pavlenko, Aneta (2007): “Autobiographic Narratives as Data in Applied Linguistics”. In: Applied Linguistics 28.2: 163–188.
Peterson, John (2015): Sprache und Migration. Heidelberg: Winter.
Pfaff, Carol W. (1991): “Turkish in contact with German. Language maintenance and loss among immigrant children in Berlin (West)”. In: International Journal of the Sociology of Language 90.1: 97–130.
Pfaff, Carol W./Aydemir, Emily/Dilmaç, Elif (2004): “Reflections on lan-guaging: self- and other evaluation of Turkish-German varieties in Berlin”. In: Dabelsteen, Christine B./Jørgensen, J. Normann (Hg.): Languaging and language practices. Copenhagen: University of Co-penhagen, 226–244.
Reich, Hans (2007): „Türkisch-deutsche Sprachbiographien – Sprachli-che Kompetenzen in Abhängigkeit von sprachlichen Sozialisations-bedingungen“. In: Eßer, Ruth/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Bau-steine für Babylon. Sprache, Kultur, Unterricht. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans Barkowski. München: Iudicium, 34–44.
Schweckendiek, Jürgen (2002): „Lernen Neuzuwanderer Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache?“ In: Deutsch als Zweitsprache 4: 14–16.
Schwitalla, Johannes (2011): „Narrative Formen von Fluchterzählungen deutschsprachiger emigrierter Juden in der Nazizeit“. In: Betten, Anne/Thüne, Eva-Maria (Hg.): Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien. Rom: Aracne, 17–51.
Selting, Margret/Auer, Peter/Barth-Weingarten, Dagmar/Bergmann, Jörg/Bergmann, Pia/Birkner, Karin et al. (2009): „Gesprächsanalyti-sches Transkriptionssystem 2 (GAT 2)“. In: Gesprächsforschung. On-line-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 10: 353–402.
Skutnabb-Kangas, Tove/Phillipson, Robert (1989): “‘Mother tongue’: the theoretical and sociopolitical construction of a concept”. In: Am-mon, Ulrich (Hg.): Status and function of languages and language varieties. Berlin, New York: de Gruyter, 450–477.
Stukenbrock, Anja (2005): Sprachnationalismus. Sprachreflexion als Me-dium kollektiver Identitätsstiftung in Deutschland (1617–1945). Ber-lin, New York: de Gruyter.
Tertilt, Hermann (1996): Turkish Power Boys. Ethnographie einer Jugend-bande. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Thürmann, Eike (2003): „Herkunftssprachenunterricht“. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Hand-buch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Stuttgart: Francke, 163–168.
Tophinke, Doris (1994): Sprachbiographie und Sprachstörung. Fallstudien zur Textproduktion bei hirnorganischen Krankheiten. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
Tophinke, Doris (2002): „Lebensgeschichte und Sprache. Zum Konzept der Sprachbiographie aus linguistischer Sicht“. In: Bulletin VALS-ASLA 76: 1–14.
Treichel, Bärbel (2004): Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehr-sprachigkeit, Autobiographisch-narrative Interviews mit Walisern zur sprachlichen Figuration von Identität und Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Lang.
Wiley, Terrence G. (2001): “On defining heritage languages and their speakers”. In: Kreeft Peyton, Joy/Ranard, Donald A./McGinnis, Scott (Hg.): Heritage Languages in America. Preserving a National Re-source. Washington: CAL, 29–36.
5 Anhang 5.1 Korpusübersicht
linguistische Audio-Datenbank (lAuDa) ID-Nummer und Aufnahmedatum
SprecherIn21 Interviewerin Dauer
#704 (11/2013) Nazan Akgül (w, 40, in der Türkei geboren, mit 3 Jahren nach Deutschland)
Carolin Zimmer (w, 22, in Deutschland gebo-ren, monolingual deutsch)
0:39:11
#706 (10/2013) Selin Ergün (w, 23, in Deutschland geboren)
Claudia Weller (w, 25, in Deutschland gebo-ren, monolingual deutsch, Kürzel ClW)
0:09:26
21 Alle Namen sind anonymisiert worden. Die jeweils in Klammern stehenden An-
gaben beziehen sich auf Geschlecht, Alter, Geburtsort und die Dauer des Aufent-halts in Deutschland.
Lehrkorpus Sprachbiographien ID-Nummer und Aufnahmedatum
SprecherIn InterviewerIn Dauer
#04 (10/2014) Demir Tufan (m, 35, in der Türkei geboren, seit 9 Jahren in Deutschland)
Marisa Wenzel (w, 26, in Deutschland gebo-ren, monolingual deutsch, Kürzel MaW)
0:43:33
#08 (10/2014) Muhammad Alcan (m, 22, in Deutschland ge-boren)
0:35:35
#09 (10/2014) Dincay Bayrak (m, 17, in Deutschland gebo-ren, Sohn von #10 und #11)
0:38:09
#10 (20/2014) Nasan Bayrak (w, 43, in der Türkei geboren, seit 1974 in Deutsch-land, Mutter von #09, Frau von #11)
0:27:55
#11 (10/2014) Gökan Bayrak (m, 43, in der Türkei geboren, seit 1995 in Deutsch-land, Vater von #09, Mann von #10)
0:10:47
#14 (12/2014) Gökhan Birol (m, 16, in Deutschland geboren)
0:30:47
#15 (12/2014) Arzu Kabaoğlu (w, 16, in Deutschland gebo-ren)
0:28:55
#16 (12/2014) Abdullah Türkoğlu (m, 54, in der Türkei gebo-ren, seit 1969 in Deutschland)
0:25:44
5.2 Transkriptionskonventionen nach GAT 2 (Selting et al. 2009)
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur [ ] Überlappungen und Simultansprechen [ ]
= schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Sprecherb-eiträge oder Segmente (latching)
Ein- und Ausatmen °h, °°hh, °°°hhh Einatmen, je nach Dauer h°, hh°°, hhh°°° Ausatmen, je nach Dauer Pausen (.) Mikropause
(-), (--), (---) kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 0.75 Sek.
(0.5) gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer Akzentuierung akZENT Fokusakzent ak!ZENT! extra starker Akzent Tonhöhenbewegung am Einheitenende ? hoch steigend , mittel steigend - gleich bleibend ; mittel fallend . tief fallend Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen <<f> > forte, laut <<p> > piano, leise <<p> > pianissimo, sehr leise <<all> > allegro, schnell Sonstige segmentale Konventionen : Dehnung, Längung, um ca. 0.2-0.5 Sek. :: Dehnung, Längung, um ca. 0.5-0.8 Sek. ::: Dehnung, Längung, um ca. 0.8-1.0 Sek Lachen haha hehe hihi silbisches Lachen ((lacht)) Beschreibung des Lachens <<:-)> soo> „smile voice“