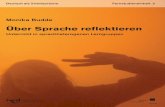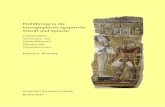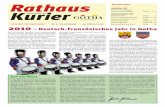Die Sprache der Septuaginta / The History of the Septuagint's ...
Kontrastiv-linguistische Analysen der koreanischen Sprache: Koreanisch - Deutsch
-
Upload
ph-karlsruhe -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Kontrastiv-linguistische Analysen der koreanischen Sprache: Koreanisch - Deutsch
Kontrastiv-linguistische Analysen der koreanischen Sprache한국어의 비교-언어학적 분석Koreanisch – Deutsch
한국어-독일어
Frank Kostrzewa
F o r s c h u n g s a r b e i t
Sprachen
Kontrastiv-linguistische Analysen der koreanischen Sprache
Koreanisch – Deutsch
한국어의 비교-언어학적 분석
한국어-독일어
Frank Kostrzewa
2
Inhaltsverzeichnis Seite I. Kausalitätsmarkierungen im Deutschen und im Koreanischen 3
II. Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Koreanischen 18
III. Konjunktionen im deutsch-koreanischen Sprachvergleich 38
IV. Präpositionen und Postpositionen im deutsch-koreanischen Sprachvergleich 47
V. Adverbien und Adverbialien im Deutschen und Koreanischen -
Schwierigkeiten des Erwerbs der deutschen Adverbien und Adverbialien
durch koreanische Lerner des Deutschen 78
VI. Der Quotativ - die indirekte Rede im Deutschen und im Koreanischen 90
VII. Onomatopöie am Beispiel des Koreanischen 103
VIII. Sprichwörter im Deutsch-Koreanischen Sprachvergleich 119
IX. Schimpf- und Tabuwörter im Deutschen, Englischen und Koreanischen 132
X. Lehnwörter und Fremdwörter im Kontext ihrer Etymologie 150
XI. Der Satz im Koreanischen 170
3
I. Kausalitätsmarkierungen im Deutschen und im Koreanischen
1.0 Einleitung
Im vorliegenden Beitrag sollen die Möglichkeiten der Kausalitätsmarkierung im Deutschen
und im Koreanischen erörtert werden.
Der Kausalzusammenhang wird von Hartung (1961, 55) als „eine spezifische Relation
zwischen zwei Sachverhalten (Erscheinungen) definiert, die dann gegeben ist, wenn der eine
Sachverhalt den anderen notwendig hervorbringt. Der Sachverhalt, der den anderen
hervorbringt, ist die Ursache, der hervorgebrachte die Wirkung“. Kausalzusammenhänge
bestehen also im Kern immer in einer Ursache-Wirkung-Beziehung.
Der Duden (1998, 791) weist darauf hin, dass der Begriff der Kausalität auf sprachliche
Äußerungen der Alltagssprache „nicht im wissenschaftlich strengen Sinn“ angewandt werden
kann. Diese Ansicht wird anhand der folgenden Beispiele belegt:
Weil der Motor kaputt war, brannte auch das Lämpchen nicht mehr.
Weil das Lämpchen nicht mehr brannte, war der Motor kaputt.
Laut Duden (ebd.) lassen sich die Unterschiede zwischen den Teilsätzen anhand der
folgenden Paraphrasen verdeutlichen:
Dass der Motor kaputt war, war der Grund dafür, dass auch das Lämpchen nicht mehr
brannte.
Dass das Lämpchen nicht mehr brannte, war ein Zeichen dafür, dass der Motor kaputt war.
Nur in dem ersten Beispielsatz stecke hinter der Konjunktion weil tatsächlich eine
Kausalbeziehung. Der zweite Fall sei als eine Art Symptombeziehung zu verstehen.
Obwohl Satzgefüge der „Symptombeziehung“ gegen die Sprachlogik im strengen Sinne
verstießen, kämen sie in der Alltagssprache relativ häufig vor.
4
Hinsichtlich der sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten der Kausalität durch Kausalsätze
im weiteren Sinne differenziert Jude (1972, 273) zwischen den folgenden fünf Satztypen:
- eigentliche Kausalsätze (Begründungssätze)
- Finalsätze (Absichtssätze)
- Konditionalsätze (Bedingungssätze)
- Konzessivsätze (Einräumungssätze)
- Konsekutivsätze (Folgesätze)
Kausalitätsmarkierende Wortklassen sind im Wesentlichen die kausalen Konjunktionen, die
Kausaladverbien und die kausalen Präpositionen. Drosdowski (1984, 376) zählt zu den
kausalen Konjunktionen die Konjunktionen denn und weil, wobei denn ausschließlich
zwischen Sätzen stehen kann (Duden 1998, 403):
Wir gingen wieder ins Haus, denn es war draußen sehr kühl geworden.
Das schlechte, weil fehlerhafte Buch. Das Buch ist schlecht, weil fehlerhaft.
Während mit denn und weil eine Begründung ausgedrückt (rein kausal) wird, wird mit wenn
auch eine Einräumung (konzessiv) markiert:
Der gute, wenn auch langsame Arbeiter …
Er arbeitet gut, wenn auch langsam.
Weil und wenn auch werden zwischen zwei Adjektive gesetzt (Duden 1998, 403).
Kausaladverbien wie darum oder folglich stehen in der Regel zwischen den Sätzen an erster
Position. Es folgen das konjugierte Verb an zweiter und das Subjekt an dritter Position:
Er will arbeiten, darum hat er sein Zimmer gekündigt.
Durch Umstellung ist eine Positionierung der Kausaladverbien an dritter Stelle möglich:
Er will arbeiten, er hat darum sein Zimmer gekündigt.
5
Weitere kausale und logische Adverbien sind u.a. deswegen, nämlich, anstandshalber,
meinethalben, demzufolge, somit etc.
Kausale und logische Adverbien gehören laut Duden (1998, 370f.) zusammen mit den
konditionalen und konsekutiven Adverbien, den konzessiven, restriktiven und adversativen
Adverbien und den interrogativ und relativisch gebrauchten Konjunktionaladverbien zur
Gruppe der Konjunktionaladverbien. Konjunktionaladverbien nehmen „eine Zwischenstellung
zwischen Adverbien und Konjunktionen ein“ (Duden 1998, 370) und setzen Gegebenheiten
oder Sachverhalte zueinander in Beziehung oder verbinden sie.
Zu den kausalen Präpositionen im weitesten Sinne rechnet der Duden (1998, 370) die
folgenden:
angesichts, anlässlich, auf, aus, behufs, bei, betreffs, bezüglich, dank, durch, für, gemäß,
halber, infolge, kraft, laut, mangels, mit, mittels(t), nach, ob, seitens, trotz, über, um, um …
willen, unbeschadet, ungeachtet, unter, vermittels(t), vermöge, von, vor, wegen, zu, zufolge,
zwecks.
Der Duden (1998, 390) weist darauf hin, dass Präpositionen wie behufs, betreffs, bezüglich,
mangels, seitens, vermittels(t) und zwecks als Papierdeutsch gelten.
Wegen und für gehören nach Drosdowski (1984, 376) zu den kausalen bzw. konsekutiven
Präpositionen im engeren Sinne:
Sie konnten wegen des Regens nicht gehen.
Er ist zum Weinen glücklich.
Im folgenden Kapitel stehen nun zunächst die kausalen Satztypen im Deutschen im
Mittelpunkt. Anschließend wird näher auf die syntaktische Struktur von Kausalsätzen mit
kausalen Konjunktionen eingegangen. Im dritten Kapitel werden die Möglichkeiten der
Kausalitätsmarkierung im Koreanischen erörtert. Hierbei findet insbesondere die Verwendung
von Kausaladverbien und kausalen Hilfspartikeln („connectors“) Berücksichtigung.
6
2.0 Kausalitätsmarkierungen im Deutschen
2.1 Eigentliche Kausalsätze
Eigentliche Kausalsätze bezeichnen den Grund der Hauptsatzhandlung auf die Fragen:
Warum? Weshalb? Weswegen? Wodurch? Als Konjunktionen werden in den eigentlichen
Kausalsätzen vornehmlich weil, da, denn und zumal verwendet.
„Da/Weil eine Baustelle eingerichtet wird, gibt es eine Umleitung. Die Tanzweisen
vermischten sich, da in jedem Saal etwas anderes gespielt wurde, zu einem wilden,
ohrenbetäubenden Lärm“.
(Duden 1998, 789)
Der eigentliche Kausalsatz kann auch durch die Konjunktion dass eingeleitet werden. Ihr
entsprechen im Hauptsatz die Korrelate darum, deswegen, deshalb. Zu den in eigentlichen
Kausalsätzen verwendeten Kausaladverbien gehören darum, deshalb, deswegen etc. Kausale
Relationen können auch durch Präpositionen wie auf, aus, infolge, um …willen, vor, wegen
etc. markiert werden.
2.2 Finalsätze
Ein Finalsatz gibt an, zu welchem Zweck sich das Geschehen im übergeordneten Satz
vollzieht. Finalsätze werden häufig durch die Konjunktionen damit und dass eingeleitet. Ein
finaler Nebensatz kann durch die Verwendung von darum, deswegen, deshalb, dazu im
Hauptsatz angekündigt werden. Konjunktionale Nebensätze lassen sich durch um + zu +
Infinitiv bzw. durch zu + Infinitiv substituieren.
2.3 Konditionalsätze
In einem Konditionalsatz wird die Bedingung genannt, unter der sich das im übergeordneten
Satz genannte Geschehen vollzieht. Konditionalsätze werden häufig durch die Konjunktionen
wenn oder falls eingeleitet. Als entsprechende Hauptsatzkorrelate können dann, als dann oder
so auftreten.
7
2.4 Konzessivsätze
Der Konzessivsatz nennt einen Gegengrund zu dem im übergeordneten Satz genannten
Sachverhalt. Konzessivsätze können durch die Konjunktionen obgleich, obwohl, obschon,
wenn auch, wennschon, wenngleich etc. eingeleitet werden. Seltener kommen die
Anschlussmittel ungeachtet und gleichwohl vor. Entsprechende Korrelate im Hauptsatz sind
trotzdem oder dennoch. Als konzessive Kausaladverbien können u.a. dennoch, allerdings und
indessen auftreten.
2.5 Konsekutivsätze
In einem Konsekutivsatz wird die Folge des im übergeordneten Satz genannten Sachverhalts
angegeben. Konsekutivsätze können durch die Konjunktionen dass, sodass, als dass, um-zu,
zu etc. eingeleitet werden.
„Es regnete stark, sodass die Wanderung recht anstrengend wurde. Sie hatte aber bald nach
der Beerdigung angefangen, die Dinge der Welt mehr und öfter nach religiösen
Gesichtspunkten zu beurteilen, sodass sie keine rechte Hilfe war und im Grunde der Aufsicht
bedurfte.“ (Duden 1998, 792)
Die Markierung eines Konsekutivsatzes ist auch durch die Verwendung konsekutiver
Konjunktionaladverbien wie also, so, folglich, infolgedessen, demnach, insofern etc. möglich.
In allen genannten Typen von Kausalsätzen können kausale Konjunktionen auftreten.
Helbig/Buscha (1987, 445) unterscheiden zwei Gruppen von Konjunktionen nach ihrem
Einfluss auf die Stellung des finiten Verbs in dem von einer Konjunktion eingeleiteten Satz,
und zwar zum einen subordinierende und zum anderen koordinierende Konjunktionen.
Hartung (1961, 42) verwendet mit derselben Bedeutung die Begriffe unterordnende und
beiordnende Konjunktionen. Koordinierende (beiordnende) Konjunktionen verbinden zwei
Hauptsätze miteinander. Das finite Verb steht in Zweitstellung hinter dem Subjekt:
Die Eltern fahren unbeschwert ab, denn die Tante sorgt für die Kinder.
8
Subordinierende (unterordnende) Konjunktionen leiten einen Nebensatz mit Endstellung des
finiten Verbs ein:
Bei solch einem Wetter bleiben wir lieber im Hotel, zumal unsere Ausrüstung nicht gut ist.
Nebensätze mit Endstellung des finiten Verbs werden von Hartung (1961, 49) als Gliedsätze
bezeichnet, die dazu gehörigen nicht-markierten Sätze als Hauptsätze. Gliedsätze sind
inhaltlich unvollständige Sätze, die nicht allein stehen können. Drosdowski (1984, 669)
betrachtet Gliedsätze als diejenigen Nebensätze, die an der Stelle eines Satzgliedes stehen.
Der konjunktionale Gliedsatz und der nicht-konjunktionale Hauptsatz bilden eine
syntagmatische Einheit. Während sich der konsekutive Gliedsatz inhaltlich aus einer
vorangehenden Handlung ergibt und daher hinter dem Hauptsatz steht, können kausale
Konjunktionalsätze dem Hauptsatz voran- oder nachgestellt werden.
3.0 Kausalitätsmarkierungen im Koreanischen
Im Koreanischen können Kausalzusammenhänge durch Kausaladverbien und sogenannte
kausale Konnektoren („connectors“; An 1980, 205) markiert werden, die aus Hilfspartikeln
bestehen. Nam/Ko (1985, 388) verwenden zur Bezeichnung der Konnektoren den
koreanischen Begriff „yongyol-omi“. Hilfspartikeln (Suffixe) spielen in einer
agglutinierenden Sprache wie dem Koreanischen eine zentrale Rolle zur Markierung von
syntaktischen Beziehungen und Funktionskategorien. Hilfspartikeln als Endungsmorpheme
können in terminale und konjunktionale Endungen untergliedert werden. Zusammen mit dem
Wortstamm bilden die terminalen und konjunktionalen Endungen die prädikativen Endungen.
Die prädikativen Endungen wiederum lassen sich in Hauptprädikate (Terminalformen) und
Nebensatzprädikate (Konjunktionalformen) unterteilen. Die erstgenannten bilden den Schluss
eines Einzelsatzes oder Satzgefüges, während letztere einen Nebensatz begrenzen und eine
überleitende Funktion besitzen.
Semantisch können die Kausalsätze im weiteren Sinne, wie im Deutschen, in eigentliche
Kausalsätze, Finalsätze, Konditionalsätze, Konzessivsätze und Konsekutivsätze differenziert
werden, wobei die Finalsätze nach Nam/Ko (1985, 388ff.) in Absichts- und Zwecksätze
gegliedert werden können. Im Folgenden werden nun die Möglichkeiten der
Kausalitätsmarkierung durch Kausaladverbien und kausale konjunktionale Hilfspartikeln
(„connectors“) im Koreanischen näher erläutert. Die koreanischen Beispiele sind zur besseren
9
Nachvollziehbarkeit für die Leserinnen und Leser in lateinischer Schreibweise wiedergegeben
und nicht in der koreanischen Hangul-Schrift.
Kausaladverbien und kausale Hilfspartikeln zur Markierung eigentlicher Kausalsätze
Kausaladverbien
kuromuro: also, darum, deshalb, deswegen, folglich
woenjahamjon: weshalb, weil
guraeso: aus diesem Grund, daher, darum, deshalb, folglich
Hilfspartikeln
-ni (kka): weil
-ki-ttaemune: weil
-toni: weil
-(u)muro: dadurch, dass, da
-killae: dadurch, dass
-kkadalke: aus dem Grund, dass
Hilfspartikeln zur Markierung von Finalsätzen
-ke: damit, um zu
-ro: um zu
-ryo: um zu
-ki-wihajo: um zu
Es existieren keine Kausaladverbien zur Markierung eines Finalsatzes.
Kausaladverbien und kausale Hilfspartikeln zur Markierung von Konditionalsätzen
Kausaladverbien
gurotchianumyon: wenn nicht
-guraeyo: nur (dann), wenn
10
Hilfspartikeln
-myon: wenn
-(k)odun: wenn
-ttaraso: demnach, demzufolge
-rado: selbst wenn
-dorado: selbst wenn
-mangjeong: obgleich
-chionjeong: wenn auch
-jindae: gesetzt den Fall
Der Hilfspartikel –myon können die Adverbien manjake oder manile zur besonderen
Betonung vorangestellt werden.
Kausaladverbien und kausale Hilfspartikeln zur Markierung von Konzessivsätzen
Kausaladverbien
-guromedobulguhago: trotzdem
Hilfspartikeln
-to: obgleich, selbst wenn
-kiro: trotz
-kodo: wenn auch
-sodo: wenn auch
-myonsodo: obgleich
-rado: selbst wenn
-dorado: selbst wenn
-(k)onul: obgleich
-ttaraso: demnach, demzufolge
-kirosoni: selbst wenn
-toe: obgleich
-na: wenn auch
-nama: wenn auch
-mangjong: obgleich
-chionjong: wenn auch
-chirado: selbst wenn
11
Bei den Hilfspartikeln –to, -rado, -na, -nama, -mangjong, -chionjong und -chirado kann das
Adverb birok zur Betonung am Anfang des markierten Satzes stehen.
Kausaladverbien und kausale Hilfspartikeln zur Markierung von Konsekutivsätzen
Kausaladverbien
-kolgoajouro: folglich
Hilfspartikeln
-torok: bis dass
-ke: so dass
-hane: soviel, soweit
-isang: insoweit
Im Koreanischen markieren die Konjunktionalformen das Prädikat eines Nebensatzes, der
einem anderen Satz nebengeordnet und in der Regel vorangestellt ist. Die Satzglieder werden
dabei nicht umgestellt, sondern die Terminalform lediglich mit der Konjunktionalform
vertauscht. Mehrere Nebensätze können ein Satzgefüge bilden, an dessen Ende ein Hauptsatz
mit terminalem Prädikat steht.
Pi-ga mani o-n-da. Kil-i maeu ji-l-da.
(Regen – NS viel komm – PS – tE Straße – NS sehr naß – PS – tE)
Es regnet viel. Die Straße ist sehr nass.
NS: Nominativsuffix
PS: Präsenssuffix
tE: terminale Endung
Pi-ga mani o-myon kil-i maeu jil-da.
(Regen – NS viel komm – K – Straße – NS sehr nass – PS – tE)
Wenn es viel regnet, wird die Straße sehr nass.
Die Straße wird sehr nass, wenn es viel regnet.
NS: Nominativsuffix
K: konjunktionale Hilfspartikel
PS: Präsenssuffix
tE: terminale Endung
12
Kanghan nunsatae-rul jesanghae-ss-ki-ttaemune uri-dul-un uri-dul-ui sop’ung-ul jongihae-ss-
ta.
(stark – Schneefall – AS – vorausseh – Prät.S – K – wir – NS – unser – Ausflug – AS –
verschieb – Prät.S – tE)
Weil man starke Schneefälle vorausgesagt hatte, mussten wir unseren Ausflug verschieben.
Wir mussten unseren Ausflug verschieben, weil man starke Schneefälle vorausgesagt hatte.
NS: Nominativsuffix
AS: Akkusativsuffix
Prät.S: Präteritumssuffix
K: konjunktionale Hilfspartikel
tE: terminale Endung
Werden Kausalsätze mit Kausaladverbien gebildet, so werden diese in der Regel nachgestellt
und leiten einen Hauptsatz ein. Zwischen dem markierten und dem unmarkierten Satz kann
ein Punkt oder Komma stehen.
Gu-nun jolsimi ilha-n-da. Guromuro gu-nun songgongha-lgos-ida.
(Er-NS fleißig arbeit-PS-tE. Darum (Ka) er-NS erfolg-wird-tE)
Er arbeitet fleißig, darum wird er Erfolg haben.
Er arbeitet fleißig, er wird darum Erfolg haben.
Gu-nun maeu sodul-oss-ta, guromedobulguhago gu-nun nomu nukke o-tta.
(Er-NS-sehr-beeil-Prät.S-tE, trotzdem-(Ka)-er-NS-zu spät komm-Prät.S-tE)
Er hat sich sehr beeilt, trotzdem kam er zu spät.
NS: Nominativsuffix
PS: Präsenssuffix
Prät.S: Präteriumssuffix
Ka: Kausaladverb
tE: terminale Endung
Es zeigt sich, dass die Gliedsätze im Koreanischen keine Satzumstellung erfahren. Vielmehr
werden die konjunktionalen Hilfspartikeln an das Verb angehängt (S + … V + K, Hauptsatz).
13
Auch die Hauptsätze mit Kausaladverbien erfahren im Koreanischen keine Umstellung. Sie
werden nach dem Muster (Ka + S + … + V) gebildet.
4.0 Ausblick/Forschungsdesiderate
Ein zentrales Forschungsdesiderat stellt trotz bestehender umfangreicher linguistischer
Vorarbeiten die detaillierte Erforschung des Erwerbs der Kausalität im Erst- sowie im Zweit-
und Fremdsprachenerwerb dar.
Dittmann (2006, 88) weist darauf hin, dass Kinder im Erstspracherwerb erste Kausalsätze
(weil …) erst dann bilden, wenn sie die Grundzüge der Temporalität beherrschen und
allmählich die Idee der Verursachung eines Ereignisses durch ein anderes entwickeln. Dies ist
ab einem Alter von durchschnittlich drei Jahren der Fall. Ab dem vierten Lebensjahr wäre
dann auch die Bildung von Finalsätzen (damit …) möglich, denn Finalität sei „eine Art in die
Zukunft gerichteter Kausalität“ (Dittmann ebd.). Der Erwerb der Konzessivität (obgleich …)
und der Irrealität setzten den Begriff der Kausalität voraus und entwickelten sich im fünften
Lebensjahr.
Cheon-Kostrzewa/Kostrzewa (1995) konnten für erwachsene koreanische Deutschlerner das
Vorkommen der folgenden kausalindizierten Formen nachweisen:
Kausale Konjunktionen
weil, damit, um … zu, wenn, obwohl
Kausaladverbien
deshalb, deswegen, trotzdem
Kausale Präpositionen
für
Die von den untersuchten Probanden am variantenreichsten verwendeten kausalindizierten
Formen waren die Konjunktionen weil und wenn. Sie wurden in den folgenden Strukturen
verwendet (Cheon-Kostrzewa/Kostrzewa 1995, 169ff.):
14
weil + S + V + …-Struktur
weil uhm ich bes … mein vater/mein vater bezahle für mei:n uh studium viel geld uh:
Dieses Beispiel zeigt eine defizitäre Leistung im Bereich der Verbkonjugation. Anstelle der
ersten Person Singular Indikativ Präsens Aktiv ich bezahle, sollte die dritte Person er bezahlt
verwendet werden, denn das angesprochene Subjekt ist mein Vater. Die fehlerhafte Verbform
wird möglicherweise dadurch verwendet, dass durch die Interviewsituation ein sehr
persönlicher Bezug des Informanten zu den thematisierten Inhalten entsteht. Daher scheint
das Zurückgreifen auf die erste Person Singular sehr intuitiv. Auch eine Übergeneralisierung
der erworbenen Verbform ich bezahle auf andere Personen ist durchaus denkbar. Der Versuch
zur Verbkonjugation wird in diesem Fall unternommen, weil der Monitor offenbar den
Einsatz einer Infinitivform verbietet.
weil + S + … + V-Struktur
weil er hat … er uh: seine beruf … seine beruf ist uh:m diligent ja weil seine beruf diligent ist.
Hier liegt der erste Fall einer offensichtlichen Selbstkorrektur der Informantin M. vor. M.
entscheidet sich zunächst für die Konstruktion weil sein(e) Beruf Dirigent ist, also eine
Aufeinanderfolge von Subjekt + Verb + Prädikativum. Diese Struktur wird jedoch
zurückgenommen und korrigiert in die Kausalstruktur weil sein Beruf Dirigent ist
umgewandelt.
weil + (S) + … + V-Struktur
weil uh: nur lesen uh ein bisschen deutsche bücher lesen und übersetzen und
Auffällig an diesem Beispiel ist das Fehlen eines Subjekts im Anschluss an den kausalen
Marker weil. Die hier wahrscheinlich intendierte Proposition in Korea liest und übersetzt man
nur bzw. in Korea haben wir/habe ich nur gelesen und übersetzt, wird syntaktisch fehlerhaft
bzw. defizitär realisiert. Unterstellt man eine beabsichtigte Allgemeinaussage, so könnte die
ansonsten fehlerhafte Infinitivform in eine korrekte Infinitivkonstruktion der Art man lernt
15
nur lesen und übersetzen überführt werden. In diesem Fall wären bestimmte Teile der
Konstruktion korrekt realisiert.
weil + (S) + V … -Struktur
weil uh: mein … mein uh:m mein interessant … interessant uh: ist über frauenforschung oder
frauenemanzipation usw.
In diesem Beispiel fällt die fehlerhafte grammatikalische Umsetzung des Subjekts auf. Eine
komplette Struktur, etwa in der reflexiven Form ich interessiere mich für, oder in der
Formulierung mein Interesse liegt im Bereich ...ist nicht auszumachen. Statt des intendierten
Subjekts Interesse wird das Adjektiv interessant subjektivisch und damit fehlerhaft
verwendet. Die Verwendung reflexiver Verbformen stellt für koreanische Lerner eine
besondere Schwierigkeit dar, die zwar registriert, aber zumeist noch nicht aufgelöst werden
kann. Strategisch begeben sich die Lerner folglich im Sinne einer Vermeidungsstrategie auf
die Suche nach einer adäquaten Substitution für die reflexive Verbform.
weil + … + V + S-Struktur
weil uh: unserer wohnheim … wohnheim leben uh: algerisch men … man + reich/und uh:
deutsche und koreani … koreani … koreanerin ich (lacht) und uh: 1 uh: verschiedene …
verschiedene … länder
Diese Äußerung wird mit einer lokalen adverbialen Bestimmung (in unserem Wohnheim)
eingeleitet. Im Anschluss an diese Struktur folgt eine Verb + Substantiv-Struktur, obwohl das
Verb in Finalposition erscheinen sollte. Die subjunktionale Verwendung von weil in der
Äußerung weil in unserem Wohnheim viele Ausländer leben scheint akzeptabler als die
konjunktionale Verwendung weil in unserem Wohnheim leben viele Ausländer, obwohl auch
die zweite Variante unter Zugrundelegung der Normen der gesprochenen Sprache möglich
erscheint.
16
weil + S + … + V2 + V1-Struktur
ja weil uh ich … uh: weil ich … uh: 2 sehr viele/verschiedene/frauen treffen/hatte getroffen
hatte ja +
In diesem Beitrag mit der syntaktischen Struktur Konjunktion (weil) + Subjekt + Vollverb +
Hilfsverb fällt die gelungene Selbstkorrektur des Informanten auf. Während das Tempus des
Plusquamperfekts zunächst fehlerhaft über eine Verwendung des Vollverbs treffen, also einer
Infinitivform des Vollverbs realisiert wird, wird durch die Selbstkorrektur und Verwendung
des Partizips getroffen, das Plusquamperfekt in adäquater Weise gebildet.
wenn + S + … + V, (dann) + S + V … -Struktur
i … wenn ich (kichert) später schlafen/ich gehe nicht an der uni/das ist … meinen rekord/ist
(hustet) niedrig
Diese Lerneräußerung dokumentiert ein latentes Wissen um die Existenz einer wenn-dann-
Struktur. Wenngleich der Marker dann nicht realisiert wird, so wird doch ein kausales Gefüge
bestehend aus Bedingung (wenn ich später schlafen) und Folge (ich gehe nicht an der uni)
aufgebaut.
wenn + S + … V, (dann) + S + V1 + … + V2-Struktur
aber benn/diese fakultelt/mir schlekt/is uh: ich/will: nach hannover gefahren
wenn + S + … + V, (dann) + S + V1 + … + (V2)-Struktur
wenn ich/unterricht/uh: (hustet) nicht teilnehme/ich kann nicht/mein noten
17
5.0 Literatur
An, D.H.: Semantics of Korean Tense Markers. Unveröffentlichte Dissertation. Georgetown
University 1980.
Cheon-Kostrzewa, B.J./Kostrzewa, F.: „Die Verwendung kausaler Strukturen bei
koreanischen Lernern des Deutschen“. In: Die Neueren Sprachen 94:2 (1995), 164-
175.
Dittmann, J.: Der Spracherwerb des Kindes – Verlauf und Störungen. München 2006.
Drosdowski, G. et al.: Duden Band 4. Mannheim 1984.
Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6. neu bearbeitete Auflage. Mannheim
1998.
Hartung, W.: Systembeziehungen der kausalen Konjunktionen in der deutschen
Gegenwartssprache. Dissertationsmanuskript. Berlin 1961.
Helbig, G./Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig 1987.
Jude, W.: Deutsche Grammatik. Braunschweig 1972.
Nam, K.S./Ko, Y.K.: P’ojun kugo munpomnon (Koreanische Grammatik). Seoul 1985.
18
II. Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Koreanischen
Im vorliegenden Artikel werden die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften von
Funktionsverbgefügen in einer kontrastiven Beschreibung und Analyse (Deutsch-
Koreanisch) untersucht. Dabei erfahren die Eigenschaften von Funktionsverbgefügen im
Koreanischen als einer agglutinierenden Sprache besondere Berücksichtigung. Schließlich
wird der Frage nach der semantischen Leistung von Funktionsverbgefügen nachgegangen.
1.0 Einleitung
Bei den Funktionsverbgefügen handelt es sich nach Winhart (2005, 1) um »feste oder
halbfeste Prädikatsausdrücke, die zwischen idiomatischen Verbindungen und Kollokationen«
anzusiedeln sind. Als zweiteilige Konstruktionen, die als verbales Gefüge eine inhaltliche
Einheit darstellen, bilden sie das Prädikat.
Während die eigentliche Bedeutung des Prädikats in die nominalen Glieder des
Funktionsverbgefüges verlagert ist, haben die Funktionsverben ihre ursprünglich konkrete
Bedeutung ihrer neuen Satzfunktion geopfert (von Polenz 1963, 11) und werden aus der
Gruppe der finiten Verben als diejenige Gruppe von Verben ausgegliedert, die das Prädikat
nicht allein ausdrücken können. Sie werden zu Hilfsverben, indem sie in einem spezifischen
Kontext mit weitgehend reduziertem konzeptuellem Gehalt erscheinen (Heidolph et al. 1981).
Winhart (2005, 1) betrachtet es für die Einstufung einer Konstruktion als
Funktionsverbgefüge als elementar, dass das Verb als »semantisch leer« bezeichnet werden
kann. Das Verb sei auf seine grammatischen Funktionen reduziert und markiere Tempus,
Numerus, Person, Modus und Genus verbi.
In der Literatur finden sich verschiedene Bezeichnungen für die Funktionsverbgefüge. So
werden sie u. a. als »nominale Umschreibungen« (Daniels 1963), »analytische
Verbalverbindungen« (Riesel 1959), »Funktionsverbformeln« (von Polenz 1963) oder auch
»Streckformen« (Schmidt 1966) bezeichnet. Winhart (2005, 2) erklärt die Entstehung des
Begriffs »Streckform« für Funktionsverbgefüge aus dem Umstand, dass »die komplexe
Verbindung durch ein einzelnes, dem Nomen zugrunde liegendes Verb ersetzt werden kann«.
Sie kritisiert den Begriff der Streckform jedoch vor dem Hintergrund, dass dieser Begriff die
Leistungen eines Funktionsverbgefüges in Relation zu dem zugrunde liegenden Verb
unterschlage. Zu diesen gehörten neben pragmatischen Unterschieden auch die Möglichkeiten
der Passivumschreibung und der Kausativierung. Wotjak/Heine (2005, 145) klassifizieren
19
Funktionsverbgefüge als Phraseologismen unterhalb der Satzebene. Bei den
Funktionsverbgefügen handele es sich um lexikalisierte, jedoch nichtidiomatische komplexe
Prädikatsausdrücke (u. a. »unter Beweis stellen«, »Verwendung finden«, »in Kontakt treten“)
bestehend aus Verb und Substantiv. Die Gesamtbedeutung sei in der Regel aus der Summe
der Einzelbedeutungen erschließbar (Frege’sches Prinzip). Van Pottelberge (2001, 455)
betrachtet die Verb-Substantiv-Verbindungen als ein sprachliches Phänomen, das sich nicht
leicht definieren und abgrenzen lässt, da es unterschiedlichen linguistischen Teilbereichen
zuzuordnen sei, u. a. der Phraseologie, der Wortbildung, der Lexikographie und der Stilistik.
Wotjak/Heine (2005, 144) stimmen den von van Pottelberge formulierten Schwierigkeiten
zwar zu, fordern jedoch von Linguisten und Lexikographen eindeutige Definitionen und
begründete Grenzziehungen. Nach Wotjak/Heine (2005, 145) teilen sich die
Funktionsverbgefüge zusammen mit den Wortidiomen und Kollokationen das Merkmal der
Abrufbarkeit als Entitäten. Anders als die Funktionsverbgefüge zeichneten sich die
Wortidiome jedoch teilweise durch die Verwendung unikaler Komponenten aus.
2.0 Funktionsverbgefüge im Deutschen
2.1 Morphologische Beschreibung
Nach Helbig/Buscha (1987, 93) lassen sich die Funktionsverbgefüge in zwei Hauptklassen
untergliedern, nämlich in eine, in der das Funktionsverb mit einer Präpositionalgruppe auftritt
und eine zweite, in der das Funktionsverb zusammen mit einem im Akkusativ stehenden
nominalen Glied auftritt. Darüber hinaus gibt es eine kleinere Menge von Funktionsverben,
die sowohl mit einer Präpositionalgruppe als auch mit einem im Akkusativ stehenden
nominalen Glied auftreten können.
Zu den Funktionsverben, die ausschließlich mit einer Präpositionalgruppe auftreten können,
gehören u. a. die folgenden:
sich befinden, bleiben, bringen, gehen, gelangen, geraten, kommen, liegen, sein, setzen,
treten, versetzen.
20
Funktionsverben, die ausschließlich mit einem nominalen Glied im Akkusativ auftreten, sind
u. a.:
anstellen, aufnehmen, ausüben, bekommen, besitzen, erfahren, erheben, erhalten, finden,
genießen, leisten, machen, treten, üben, unternehmen.
Funktionsverben, die sowohl mit einer Präpositionalgruppe als auch mit einem nominalen
Glied im Akkusativ auftreten können, sind u.a.:
führen, geben, haben, halten, nehmen, stellen.
Treten die Funktionsverben mit einer Präpositionalgruppe auf, so zumeist mit den
Präpositionen auf, aus, außer, bei, hinter, in, um, unter und zu, wobei die Präpositionen in
und zu besonders häufig auftreten. Die wesentliche Funktion der Präpositionen besteht in der
Aktionsartbezeichnung.
Die Substantive in den Funktionsverbgefügen weisen einen festen Artikelgebrauch auf. Es
steht entweder der Nullartikel oder aber der definite Artikel, der mit der vorangehenden
Präposition obligatorisch verschmolzen ist. Der Artikel steht in der Regel beim Nomen
actionis (z. B. zur Besinnung kommen, zur Ruhe kommen), und zwar vor allem in den Fällen,
in denen der Artikel mit der Präposition verschmelzen kann. Daher heißt es ins Schwitzen
kommen/bringen, zur Einsicht kommen/bringen, aber in Bewegung kommen/bringen, in
Schwung kommen/bringen etc.
Typisch für die Funktionsverbgefüge ist auch der Verlust der Pluralfähigkeit. So existiert
beispielsweise für die Sätze Diese Lösung kommt nicht in Frage und Der Student erfährt
Förderung kein entsprechendes Pluraläquivalent. Die entsprechenden Sätze *Diese Lösungen
kommen nicht in Fragen und *Der Student erfährt Förderungen sind ungrammatisch. Der
Verlust der Pluralfähigkeit ist nur in wenigen Fällen aufgehoben (vgl. Wir stellen ihm eine
Frage vs. Wir stellen ihm Fragen).
21
2.2 Syntaktische Struktur
Von Polenz (1963, 23) illustriert die zwischen den Funktionsverbgefügen und den freien
Verbindungen bestehenden Unterschiede in der syntaktischen Struktur anhand folgender
Beispielsätze:
Ich bringe das Geld zur Verteilung.
Ich bringe das Geld zur Buchhaltung.
Während im ersten Satz das Nomen Verteilung als Nomen actionis auftritt und mithin den
Vorgang »verteilt werden« bezeichnet, dient das Nomen Buchhaltung im zweiten Satz nicht
zur Vorgangsmarkierung, sondern zur Bezeichnung einer realen Größe. Die syntaktischen
Unterschiede zwischen Funktionsverbgefügen und freien Verbindungen werden bei der
Oppositionsbildung von Sätzen mit völliger lexikalischer Identität besonders augenfällig.
Das Bild kommt zur Versteigerung.
Der Maler des Bildes kommt zur Versteigerung.
Nach von Polenz (1963, 24) handelt es sich bei der syntaktischen Struktur des ersten Satzes
um die Kombination von Leitglied, Funktionsverb und Nennglied, während im zweiten Satz
ein Vollverb mit einer ergänzenden Zielgröße kombiniert wird.
Kontrovers wird in der Literatur (Heringer 1968, Engelen 1968, Helbig/Buscha 1987) die
Frage nach dem Gesamtspektrum der Funktionsverbgefüge diskutiert.
Neben den bereits erwähnten Verbindungen von Funktionsverb und Präpositionalgruppe
sowie Funktionsverb und Substantiv im Akkusativ werden gelegentlich auch Verbindungen
des Typs Funktionsverb und Substantiv im Nominativ, Funktionsverb und Substantiv im
Dativ sowie Funktionsverb und Substantiv im Genitiv zu den Funktionsverbgefügen
hinzugerechnet. Die jeweiligen Typen sollen anhand der folgenden Beispiele illustriert
werden.
Typ 1: Funktionsverb + Präpositionalgruppe
Das Verfahren kommt zur Anwendung.
22
Typ 2: Funktionsverb + Substantiv im Akkusativ
Er nimmt von dem Einspruch Kenntnis.
Typ 3: Funktionsverb + Substantiv im Nominativ
Zwischen den Delegierten besteht keine Übereinstimmung.
Typ 4: Funktionsverb + Substantiv im Dativ
Wir unterziehen den Doktoranden einer Prüfung.
Typ 5: Funktionsverb + Substantiv im Genitiv
Dieses Thema bedarf noch einer genaueren Untersuchung.
2.2.1 Ersetzbarkeit
Funktionsverbgefüge können in vielen Fällen durch entsprechende Vollverben bzw. durch
Kopula und Adjektiv ersetzt werden. Winhart (2005, 7) illustriert dies an folgenden
Oppositionspaaren:
Er brachte seine Papiere in Ordnung vs. Er ordnete seine Papiere.
Er kommt in Verlegenheit vs. Er wird verlegen.
Problemfälle, in denen eine solche Substituierung jedoch nicht möglich ist, sind nach Winhart
(ebd.) u. a. in Einklang bringen und im Wettbewerb stehen.
Es hat den Anschein, als ob teilweise durch die Funktionsverbgefüge Lücken im lexikalischen
System der deutschen Sprache geschlossen werden können.
2.2.2 Anaphorisierbarkeit
In den lexikalisierten Funktionsverbgefügen können die nominalen Bestandteile nicht durch
ein Pronomen oder ein Pronominaladverb ersetzt werden.
Er gab dem Kind Brot. (Vollverb)
Er gab es dem Kind.
23
Er gab dem Kind Antwort. (Funktionsverb)
*Er gab sie dem Kind.
Wir gehen zur Veranstaltung.
Wir gehen dorthin.
Die Sache kam zur Verhandlung.
*Die Sache kam dahin.
Auf die in der Regel nicht mögliche Anaphorisierbarkeit und Erfragbarkeit der nominalen
Bestandteile eines Funktionsverbgefüges verweist auch Detges (1996, 19) wenn er schreibt:
»Auf syntaktischer Ebene sind N(FVG) keine E der FV und aus diesem Grund weder
erfragbar noch anaphorisierbar«. Da das Nomen zusammen mit dem Verb das Prädikat bildet,
kann es nicht als Ergänzung des Verbs betrachtet werden. Somit erweist sich der Nicht-
Ergänzungsstatus des N(FVG) vor allem durch die fehlende Anaphorisierbarkeit und
Erfragbarkeit des N(FVG).
2.2.3 Erfragbarkeit
Die in lexikalisierten Funktionsverbgefügen stehenden Präpositionalgruppen und Akkusative
sind nicht unmittelbar erfragbar. Die Verbalphrasen in den folgenden Sätzen haben eine
identische syntaktische Struktur, aber unterschiedliche Funktionen:
Das Bild kommt zur Versteigerung. (*Wohin kommt es?)
Der Maler kommt zur Versteigerung. (Wohin kommt er?)
Die Maschine wurde in Gang gebracht. (= Funktionsverb) (*Wohin wurde sie gebracht?)
Er versetzte das Kind in Schrecken. (= Funktionsverb) (*Wohin versetzte er das Kind?)
Erfragbar und pronominalisierbar sind nach Winhart (2005, 28) jedoch die nicht-
lexikalisierten, akkusativischen Funktionsverbgefüge. Winhart (ebd.) präsentiert zur
Illustration die folgenden Beispiele:
24
a) Was erhob die Staatsanwaltschaft? Anklage.
b) Die Staatsanwaltschaft, die hinter der Vereinsfassade aus Hilfsbereitschaft und
Edelmut Betrüger am Werke wähnte, erhob Anklage. Die schmolz im Prozess
allerdings auf wenige Punkte zusammen.
c) Desto mehr muss man sich hüten, dort Anklage zu erheben, wo sie nicht gerechtfertigt
ist.
d) Was hegte er beim letzten Spiel? Zuerst große Hoffnung, dann große Zweifel.
e) Nach dem ersten Durchgang hegte Schwabings Trainer Jürgen Pfletschinger noch
Hoffnung. Doch sie wurde bald im Keim erstickt.
f) Heg nicht zu große Hoffnungen. Sie könnten enttäuscht werden.
(vgl. auch Heidolph et al. 1981, 442)
g) Was machte er gestern? Eine sensationelle Beobachtung.
h) Er machte gestern eine sensationelle Beobachtung. Er wird sie bald veröffentlichen.
Winhart (ebd.) hebt hervor, dass lediglich die Kombination Hoffnung hegen mit Hoffnung im
Singular problematisch sei.
Die schlechte Erfragbarkeit und Pronominalisierbarkeit lexikalisierter akkusativischer
Funktionsverbgefüge demonstriert Winhart (2005, 29) anhand folgender Beispiele:
a) Weißt du, was er von den guten Noten seiner Tochter nahm? *Absolut keine Kenntnis.
b) *Er nahm von den Noten zwar Kenntnis, aber sie erfreute ihn nicht.
c) Dieses Verfahren findet nur in der Industrie Anwendung. Was findet dieses Verfahren?
*Anwendung in der Industrie.
2.2.4 Modifizierbarkeit
Die Möglichkeiten, Substantive in Funktionsverbgefügen durch adjektivische Attribute (oder
Genitivattribute bzw. Präpositionalattribute) zu erweitern, sind deutlich eingeschränkt. Eine
nähere Bestimmung des Gefüges ist nur mit Hilfe eines Adverbs möglich.
*zum guten Ausdruck kommen
gut zum Ausdruck kommen
25
*zur schnellen Wirkung kommen
schnell zur Wirkung kommen
*Der Betriebsleiter nahm von den Beschlüssen schnelle Kenntnis.
*Er brachte die Angelegenheit zur sofortigen Sprache.
*Er kommt nicht in (eine) Frage der Wichtigkeit.
*Wir bringen ihn in Verlegenheit von Dauer.
Heringer (1968, 49) weist darauf hin, dass einige Substantive in Funktionsverbgefügen durch
Attribute erweiterbar sind.
Er stellt hohe (beachtliche, geringe) Anforderungen an seine Mitarbeiter.
Er bringt sie in große (schreckliche) Verlegenheit.
In manchen Fällen konkurrierten Adverbialbestimmungen und Attribute ohne wesentlichen
Bedeutungsunterschied miteinander (Heringer ebd.).
Wir bringen die Vorzüge zur vollen Geltung.
Wir bringen die Vorzüge voll zur Geltung.
zur vollen Wirkung kommen
voll zur Wirkung kommen
Das folgende Oppositionspaar jedoch enthält nach Helbig (1979, 279) eine semantische
Differenzierung.
in schnelle Schwingung kommen
schnell in Schwingung kommen
Einige Substantive besitzen nach Helbig (ebd.) sogar ein obligatorisches Attribut, ohne das sie
ungrammatisch wären.
*Die Versammlung nahm einen Verlauf.
Die Versammlung nahm einen ausgezeichneten Verlauf.
26
*Die Umstrukturierung nahm eine Entwicklung.
Die Umstrukturierung nahm eine günstige Entwicklung.
Helbig (ebd.) weist darauf hin, dass in diesen Sätzen eindeutig der semantische Aspekt
dominiere. Eine Ergänzung, die sich im Allgemeinen auf das Grundverb beziehe, könne für
das ganze Gefüge verwendet werden, wenn dieses semantisch eine Einheit bilde.
Winhart (2005, 9) betont, dass die Möglichkeit der Erweiterung eines Substantivs in einem
Funktionsverbgefüge durch einen Relativsatz äußerst eingeschränkt ist.
*Die Kenntnis, die er genommen hat.
Ebenso problematisch sind:
*Die Gefahr, die er gelaufen ist.
*Der Ausdruck, zu dem er die Sache gebracht hat.
2.2.5 Stellungseigenschaften
Funktionsverbgefüge mit einer Präpositionalgruppe werden grundsätzlich durch nicht und
nicht durch kein negiert. Es erfolgt also eine Satz- und keine Wortnegation.
Er setzte die Maschine nicht in Betrieb (= Funktionsverbgefüge)
*Er setzte die Maschine in keinen Betrieb.
*Er setzte die Maschine in Betrieb nicht.
Dagegen sind folgende Negationen bei Vollverben bzw. Funktionsverben ohne
Präpositionalgruppe möglich:
Er arbeitet im Betrieb nicht.
Er arbeitet nicht im Betrieb.
Er leistet der Aufforderung nicht Folge.
Er leistet der Aufforderung keine Folge.
27
Nach Winhart (2005, 11) zählt es zu den besonderen Stellungseigenschaften von
Funktionsverbgefügen, »dass Nominalisierung und Funktionsverb in Nebensatzstellung nicht
getrennt werden können und im Hauptsatz eine Satzklammer bilden«.
Helbig/Buscha (1999, 101) belegen dies anhand folgender Beispielsätze:
*Er sagt, dass das in Frage nicht kommt.
*Er sagte, dass er der Aufforderung Folge nicht leistet.
*Er nahm auf seine Freunde Rücksicht nicht.
3.0 Funktionsverbgefüge im Koreanischen
Die Funktionsverbgefüge im Koreanischen lassen sich nach der morphologischen Form des
nominalen Glieds in drei Klassen unterteilen, und zwar erstens in die Klasse der
Funktionsverben mit einem Substantiv im Akkusativ, zweitens in die Klasse der
Funktionsverben mit einem Substantiv im Nominativ und drittens in die Klasse der
Funktionsverben mit einer Suffixgruppe.
Die koreanischen Funktionsverbgefüge sollen anhand der folgenden Beispiele illustriert
werden. Die Beispiele sind zur besseren Nachvollziehbarkeit für europäische Leserinnen und
Leser in lateinischer Schreibweise wiedergegeben und nicht in der koreanischen Hangul-
Schrift.
1) Funktionsverb + Substantiv im Akkusativ1
Zanggun – un buha – ege myongryong – ul närinda.
(General + Nominativsuffix (Ns) Untergebenen + Dativsuffix (Ds) Befehl +
Akkusativsuffix (As) fällt)
→ Der General gibt dem Untergebenen einen Befehl.
2) Funktionsverb + Substantiv im Nominativ
Na – nun gu – ege uisim – i ganda.
(Ich + Ns er + Ds Verdacht + Ns gehe)
→ Ich habe ihn im Verdacht.
In der Beschreibung und Analyse der koreanischen Funktionsverbgefüge werden eine Reihe von
Kürzeln verwendet, die an dieser Stelle zusammenfassend aufgeschlüsselt sind: Ns (Nominativsuffix), Ds (Dativsuffix), As (Akkusativsuffix), Os (Ortssuffix), Hs (Honorativsuffix), Fs (Fragesuffix), Ps (Pluralsuffix).
28
3) Funktionsverb + Suffixgruppe
Whaga – nun gurin – ul gyongmä – e butchinda.
(Maler + Ns Bild + As Versteigerung + Ortssuffix (Os) festigt)
→ Der Maler bringt das Bild zur Versteigerung.
Die koreanische Sprache ist eine agglutinierende Sprache mit der Elementenfolge Subjekt –
Objekt – Verb (S-O-V). Die Satzstellung im Koreanischen ist, abgesehen von der finalen
Verbstellung, relativ frei. Grammatische Beziehungen, die im Deutschen durch Präpositionen
markiert würden, werden in der koreanischen Sprache durch Postpositionen realisiert. Die
Suffixe im Koreanischen können also zum Teil Äquivalente der deutschen Präpositionen oder
Konjunktionen darstellen. Weitere Funktionen der Suffixe bestehen in der Markierung von
Kasus und Numerus. Die Art der Suffixe ist u. a. phonologisch motiviert. So treten, wenn das
Substantiv in einem Funktionsverbgefüge auf einen Konsonanten endet, die Nominativsuffixe
i und un auf. Endet das Substantiv jedoch auf einen Vokal, so lauten die analogen Suffixe ga
und nun. Bei dem Funktionsverbgefüge vom Typ Funktionsverb + Substantiv im Akkusativ
wird der Akkusativ durch ul markiert, wenn ein Konsonant vor dem Suffix steht. Im Falle
eines Vokals steht das Suffix rul. Der Bedeutung der deutschen Präpositionen in und zu
entsprechen zwei Suffixe in der Kombination Funktionsverb + Suffixgruppe, nämlich das
Ortssuffix e mit der Bedeutung der deutschen Präposition in und das ortsverändernde Suffix
(u) ro mit der Bedeutung der deutschen Präposition zu.
Die koreanische Sprache verfügt im Gegensatz zur deutschen über keinerlei Artikel, weder
definite noch indefinite. Wie im Deutschen geht auch bei den koreanischen
Funktionsverbgefügen die Pluralfähigkeit verloren, jedoch ist feststellbar, dass die
Markierung der Pluralform ohnehin häufig unterbleibt, obwohl eine Pluralmarkierung durch
das Suffix til prinzipiell möglich ist. Lediglich nach vokalischem Auslaut bzw. nach Lateralen
und Nasalen steht statt des Suffixes til das Suffix dil. Es liegt eine komplementäre
Distribution vor. Kasusmarkierungen (ul, ege etc.) stehen in jedem Fall nach der
Numerusmarkierung. Die fehlende Pluralfähigkeit, auch der koreanischen
Funktionsverbgefüge, soll anhand der folgenden Beispiele illustriert werden.
Na – nun gamgyong – e ppazinda.
(Ich – Ns Begeisterung – Os falle)
→ Ich bin begeistert.
29
*Na – nun gamgyong – dul – e - ppazinda.
(Ich – Ns Begeisterung – Pluralsuffix – Os falle)
Im Folgenden werden die am häufigsten auftretenden koreanischen Funktionsverben,
entsprechend der Reihenfolge nach dem koreanischen Alphabet aufgeführt:
gada (gehen), gazida (haben), gonneda (überreichen, übergeben), närida (fallen), danghada
(geraten), donzida (werfen), duda (stellen, setzen), durogada (eintreten), durooda
(hereinkommen, eintreten), matta (begrüßen, empfangen), mitchida (sich ausdehnen,
erreichen), mätta (verknüpfen, verbinden), batta (bekommen), bepulda (erteilen, geben), boda
(sehen), butchida (anheften, kleben), bbazida (fallen), bbaturida (fallen lassen), soda (stehen)
etc.
3.1 Syntaktische Struktur
3.1.1 Ersetzbarkeit
Funktionsverbgefüge können im Koreanischen wie im Deutschen zumeist durch ein
entsprechendes Vollverb ersetzt werden.
Sonsäng – nim – i hagsäng – ege zilmun – ul donzinda.
(Lehrer – Honorativsuffix (Hs) – Ns Schüler – Ds Frage – As wirft.)
→ Der Lehrer stellt dem Schüler eine Frage.
Sonsäng – nim – i hagsäng – ege zilmunhanda.
(Lehrer – Hs – Ns Schüler – Ds fragt.)
→ Der Lehrer fragt den Schüler.
Da die koreanischen Verben häufig bereits eine Nominalform beinhalten, besteht ein
Unterschied zu den nominalisierten Verbformen des Deutschen. Substantive, die insgesamt
größtenteils sinokoreanischen Ursprungs sind, werden im Koreanischen mit Hilfe des Verbs
hada (tun, machen) verbalisiert.
30
Mutta (fragen)
Mur – um – ul donzida.
(Frage – Ns – As – werfen)
→ Eine Frage stellen.
Zilmunhada (fragen)
(Frage + hada)
Zilmun – ul donzida.
(Frage – As werfen)
→ Eine Frage stellen.
3.1.2 Anaphorisierbarkeit
Eine Anaphorisierbarkeit der nominalen Bestandteile eines Funktionsverbgefüges ist im
Koreanischen wie im Deutschen nicht gegeben.
Sonsäng – nim – i hagsäng – ege zilmun – ul donzinda (= Funktionsverbgefüge)
(Lehrer – Hs – Ns Schüler – Ds Frage – As wirft.)
→ Der Lehrer stellt dem Schüler eine Frage.
*Sonsäng – nim – i hagsäng – ege gugoss – ul donzinda.
(Lehrer – Hs – Ns Schüler – Ds sie – As wirft.)
Dagegen bei Verwendung eines Vollverbs:
Sonsäng – nim – i hagsäng – ege – tchäg – ul donzinda.
(Lehrer – Hs – Ns Schüler – Ds Buch As wirft.)
→ Der Lehrer gibt dem Schüler ein Buch.
Sonsäng – nim – i hagsäng – ege gugoss – ul donzinda.
(Lehrer – Hs – Ns Schüler – Ds es – As wirft.)
→ Der Lehrer gibt es dem Schüler.
31
3.1.3 Erfragbarkeit
Die in den koreanischen Funktionsverbgefügen enthaltenen Suffixgruppen und
Akkusativformen sind, wie die Präpositionalgruppen und Akkusative im Deutschen, nicht
direkt erfragbar.
Whaga – nun gurim – ul gyongmä – e butchinda. (= Funktionsverb)
(Maler – Ns Bild – As Versteigerung – Os festigt.)
→ Der Maler bringt das Bild zur Versteigerung.
*Whaga – nun gurim – ul odi – e – butchinunya?
(Maler – Ns Bild – As wohin festigt – Fragesuffix (Fs))
→ Wohin bringt der Maler das Bild?
Dagegen ist bei entsprechend vorliegenden Vollverben eine Erfragbarkeit gegeben.
Whaga – nun gurim – ul byog – e butchinda. (= Vollverb)
(Maler – Ns Bild – As Wand – Os festigt.)
→ Der Maler hängt das Bild an die Wand.
Whaga – nun gurim – ul odi – e butchi – nunya?
(Maler – Ns Bild – As wohin festigt – Fragesuffix (Fs))
→ Wohin hängt der Maler das Bild?
3.1.4 Modifizierbarkeit
Das Koreanische ist hinsichtlich der Erweiterung von Substantiven in Funktionsverbgefügen
durch adjektivische Attribute deutlich freier als das Deutsche. Neben der Erweiterung durch
adjektivische Attribute ist im Allgemeinen auch eine Erweiterung durch Adverbien gegeben.
Die Verwendung von adjektivischen Attributen einerseits und Adverbien andererseits führt im
Koreanischen zu keinem Bedeutungsunterschied.
Zasehi solmyong – ul zuda.
(genau (adv.) Erklärung geben)
32
Zasehan solmyong – ul zuda.
(genaue (adj.) Erklärung geben)
Ganghage zagug – ul zuda.
(stark (adv.) Anregung – As geben)
Ganghan zagug – ul zuda.
(stark (adj.) Anregung geben)
Einige Funktionsverbgefüge lassen sich jedoch auch im Koreanischen lediglich durch ein
Adverb modifizieren.
Bballi gyongmä – e butchida.
(schnell (adv.) Versteigerung – Os festigen)
→ Schnell zur Versteigerung kommen.
*Bbarun gyongmä – e butchinda.
(schnell (adj.) Versteigerung – Os festigen)
→ *Zur schnellen Versteigerung kommen.
Daneben gibt es einige Substantive in Funktionsverbgefügen, die ohne ihre obligatorischen
Attribute grammatisch inkorrekt wären.
Gu- nun saram – dul – ege sohun insang – ul zunda.
(er – Ns Mensch – Pluralsuffix (Ps) – Ds gut Eindruck – As gibt)
→ Er macht auf die Menschen einen guten Eindruck.
*Gu – nun saram – dul – ege insang – ul zunda.
(er – Ns Mensch – Ps – Ds Eindruck – As gibt)
→ Er macht auf die Leute Eindruck.
33
3.1.5 Stellungseigenschaften
Die Funktionsverbgefüge im Koreanischen weisen keine spezifischen Stellungseigenschaften
auf. Hinsichtlich der Negationselemente ist hervorzuheben, dass im Koreanischen eine Satz-
und keine Wortnegation existiert. Negationselemente können in Lang- oder Kurzform
auftreten und sind zudem bezüglich der Kategorien Fähigkeit und Absicht kategorisierbar.
an: Absichtsnegation, Kurzform
hazi – anihada: Absichtsnegation, Langform
mot: Fähigkeitsnegation, Kurzform
hazi – mothada: Fähigkeitsnegation, Langform
Da die Negation im Koreanischen immer vor dem Verb steht (an-Form) bzw. mit dem Verb
verschmolzen ist, besteht zwischen Sätzen mit Vollverben und solchen mit
Funktionsverbgefügen kein Stellungsunterschied. Die Stellungseigenschaften im Nebensatz
und die entsprechenden Unterschiede bei der Verwendung von Vollverben bzw.
Funktionsverbgefügen sollen anhand der folgenden Sätze illustriert werden.
Gu – nun gu – ga zilmun – ul donzi – zi ani – handa – go malhanda. (= Funktionsverb)
(er – Ns er – Ns Frage – As wirft – Ngs Ngs tut – Nebensatzsuffix sagt)
→ Er sagt, dass er keine Frage stellt.
Gu – nun gu – ga zilmun – ul an donzinda – go malhanda. (= Vollverb)
(er – Ns er – Ns Frage As Negationssuffix sagt)
→ Er sagt, dass er keine Frage stellt.
Auffällig ist bei diesen Konstruktionen, dass nicht nur die einzelnen Satzglieder, sondern auch
der Nebensatz selbst mit einem eigenen Suffix markiert wird.
34
4.0 Zur semantischen Leistung der Funktionsverbgefüge
Nach Helbig/Buscha (1987, 103) können Funktionsverbgefüge ein Geschehen als beginnend
und einen Zustand als sich verändernd oder bewirkend markieren. Häufig findet entsprechend
dieser Gliederung eine Unterteilung der Funktionsverbgefüge hinsichtlich ihrer Aktionsart
statt. Bei der Kategorie der Aktionsart handelt es sich nach Lewandowski (1984, 36) um eine
»semantische Kategorie des Verbs, die den verbalen Vorgang in seiner je besonderen Art und
Weise charakterisiert«. Die Kategorie der Aktionsart stehe der des Aspekts nahe, jedoch mit
dem Unterschied, dass sie keine Paradigmatik ausgebildet habe und auf der lexikalisch-
semantischen Ebene verbleibe. Nach Lewandowski (1984, 36 f.) bezeichnen Verben mit
unterschiedlicher Aktionsart unterschiedliche Handlungen und Vorgänge. Folgende
Aktionsarten der Verben sind nach Lewandowski (ebd.) zu unterscheiden:
inchoative/ingressive Verben (entbrennen)
iterative Verben (sticheln, streicheln)
resultative Verben (verbrennen, besteigen)
kausative Verben (tränken < trinken)
faktitive Verben (füllen < voll machen)
durative Verben (arbeiten)
Im Folgenden sollen durative, ichoative und kausative Verben des Deutschen und des
Koreanischen vorgestellt werden, die Teil eines Funktionsverbgefüges sein können.
durativ inchoativ kausativ
in Bewegung sein kommen setzen
in Gang sein kommen bringen
zur Verfügung stehen/haben bekommen stellen
gangpo-rul gazida otta zuda
(Angst) (haben) (bekommen) (geben)
zilmun-ul gazida otta donzida
(Frage) (haben) (bekommen) (werfen)
35
Von Polenz (1963, 14) demonstriert die semantische Leistung der Funktionsverbgefüge an
folgendem Beispiel:
Der Bundestag entscheidet über diese Frage.
Der Bundestag bringt diese Frage zur Entscheidung.
Im ersten Satz bezeichne das Verb entscheiden einen momentanen Vorgang, der ohne
Begrenzung oder Abstufung dargestellt sei. Das Verb bringen im zweiten Satz verweise
jedoch auf einen Vorgang von längerer Dauer. Zur Entscheidung bringen bedeute somit nicht
dasselbe wie entscheiden, sondern sei hinsichtlich seiner Bedeutung den Formen einer
Entscheidung zuführen, eine Entscheidung herbeiführen und eine Entscheidung vorbereiten
und treffen ähnlich. Dieses Beispiel belege nach von Polenz (ebd.) auch die Tatsache, dass die
Funktionsverben in den Funktionsverbgefügen keinesfalls völlig bedeutungsleer seien,
obwohl der semantische Gehalt des Funktionsverbs im Funktionsverbgefüge deutlich
reduziert sei.
Funktionsverbgefüge scheinen nach von Polenz (ebd.) auch geeignet, an den Stellen, an denen
es keine entsprechenden Vollverben gebe (z. B. zur Vernunft bringen, auf den Gedanken
bringen), die Ausdrucksmöglichkeiten einer Sprache zu bereichern.
Helbig (1979, 280) weist darauf hin, dass es durch Verwendung von Funktionsverbgefügen
auch möglich ist, die Mitteilungsperspektive in einem Satz zu verändern. Dies gelinge
dadurch, dass im Falle der Funktionsverbgefüge die bedeutungstragenden Glieder an das
Ende eines Satzes treten, mithin also in eine Position, die den vom Mitteilungsgehalt her
wichtigsten Gliedern (Rhema) zukommt. Helbig (ebd.) illustriert diesen Sachverhalt anhand
des folgenden Beispiels:
Die Landwirtschaft entwickelt sich gut.
Die Landwirtschaft nimmt eine gute Entwicklung.
Möglich ist auch eine Spitzenstellung des Substantivs im Sinne einer Topikalisierung.
Eine gute Entwicklung nimmt die Landwirtschaft.
36
5.0 Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die syntaktischen und semantischen Besonderheiten von
Funktionsverbgefügen dargestellt. Im Bereich der Syntax konnte u. a. gezeigt werden, dass
Funktionsverbgefüge in vielen Fällen durch Vollverben bzw. Kopula und Adjektive ersetzbar
sind. Eine Anaphorisierbarkeit der nominalen Bestandteile der lexikalisierten
Funktionsverbgefüge ist jedoch nicht gegeben. Zudem sind die in den lexikalisierten
Funktionsverbgefügen stehenden Präpositionalgruppen und Akkusative nicht direkt erfragbar.
Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Möglichkeiten der Modifizierung von Substantiven
in Funktionsverbgefügen durch adjektivische Attribute deutlich eingeschränkt sind. Eine
Modifikation mit Hilfe von Adverbien hingegen ist möglich. Hinsichtlich der
Stellungseigenschaften wurde hervorgehoben, dass Funktionsverbgefüge mit nicht und nicht
durch kein negiert werden. Es erfolgt also eine Satz- und keine Wortnegation.
Es wurde gezeigt, dass die Funktionsverbgefüge im Koreanischen morpho-syntaktische
Besonderheiten vor allem in der Kombination eines Funktionsverbs mit einem Suffix oder
einer Suffixgruppe aufweisen. Dies wurde als typische Besonderheit einer agglutinierenden
Sprache interpretiert. Bezüglich der Kategorien der Ersetzbarkeit, Erfragbarkeit und
Anaphorisierbarkeit waren keine wesentlichen Unterschiede zwischen koreanischen und
deutschen Funktionsverbgefügen feststellbar. Deutliche Unterschiede konnten jedoch im
Bereich der Modifizierbarkeit festgestellt werden. Hier erwies sich das Koreanische
hinsichtlich der Erweiterung von Substantiven in Funktionsverbgefügen durch adjektivische
Attribute als deutlich freier als das Deutsche. Die Negation erfolgt auch im Koreanischen als
Satz- und nicht als Wortnegation. Negationselemente können dabei in Lang- oder Kurzform
auftreten und sind zudem bezüglich der Kategorien Fähigkeit und Absicht kategorisierbar.
37
6.0 Literatur
Daniels, Karlheinz (1963): Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache.
Nominaler Ausbau des verbalen Denkkreises. Düsseldorf.
Detges, Ulrich (1996): Nominalprädikate. Tübingen (= Linguistische Arbeiten 345).
Engelen, Bernhard (1968): »Zum System der Funktionsverbgefüge«. In: Wirkendes Wort 18,
S. 289–303.
Heidolph, Karl Erich/Flämig, Walter/Motsch, Wolfgang (Hgg.) (1981): Grundzüge einer
deutschen Grammatik. Berlin.
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1987): Deutsche Grammatik – ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. Leipzig.
Heringer, Hans-Jürgen (1968): Die Opposition von »kommen« und »bringen« als
Funktionsverben. Untersuchungen zur grammatischen Wertigkeit und Aktionsart.
Düsseldorf.
Koo, John (1991): Let’s speak Korean. Seoul.
Lewandowski, Theodor (1984): Linguistisches Wörterbuch. Band 1. Köln.
Riesel, Elise (1959): Stilistik der deutschen Sprache. Moskau.
Van Pottelberge, Jeroen (2001): Verbonominale Konstruktionen, Funktionsverbgefüge. Vom
Sinn und Unsinn eines Untersuchungsgegenstandes. Heidelberg.
Von Polenz, Peter (1963): »Funktionsverben im heutigen Deutsch. Sprache in der
rationalisierten Welt«. In: Wirkendes Wort (Beiheft) 5.
Winhart, Heike (2005): Funktionsverbgefüge im Deutschen – Zur Verbindung von Verben und
Nominalisierungen. Dissertation Universität Tübingen 2002 (online-Ressource 2005).
Wotjak, Barbara/Heine, Antje (2005): »Zur Abgrenzung und Beschreibung verbonominaler
Wortverbindungen (Wortidiome, Funktionsverbgefüge, Kollokationen)«. In: Deutsch
als Fremdsprache 3, S. 143–153.
38
III. Konjunktionen im deutsch-koreanischen Sprachvergleich
1.0 Einleitung
Sprachkontrastive Untersuchungen belegen die deutlichen Unterschiede zwischen dem
deutschen und dem koreanischen Konjunktionalsystem. Während es sich bei den Junktionen2
im Deutschen entweder um eingliedrige (und, dass, ob, seit, bis), komplexe (damit, obwohl,
wenngleich), mehrteilige (so dass, insofern, es sei denn dass) oder paarige Junktionen (sowohl
- als auch, nicht nur - sondern auch, entweder - oder; vgl. Duden 2006, 627) handelt,
existieren im Koreanischen zum einen Konjunktionalformen, die als Suffixe an die
Verbalbasen, die erweiterten Stämme oder die Partizipialformen des Verbs angehängt werden
und zum anderen nominalwertige Konjunktionalformen, die im Kern aus einem Nomen oder
einem nominalwertigen Wort bestehen. Die solchermaßen generierten Bedingungsgefüge und
Abhängigkeitsverhältnisse des Nebensatzes zu seinem Folgesatz können nach Lewin (1970,
34) höchst unterschiedlicher Art sein (koordinativ, temporal, konditional, kausal, konzessiv,
adversativ, distributiv, alternativ, final, resultativ, gradativ, mutativ und stativ). Während die
Funktionen der deutschen Konjunktionen denen der koreanischen Konjunktionalformen
weitgehend ähneln, ist die Schnittmenge semantisch bedeutungsgleicher Konjunktionen
geringer. So weisen beispielsweise sowohl das Deutsche als auch das Koreanische im Bereich
der Temporalität Konjunktionalformen auf, die den Kategorien der Vorzeitigkeit und der
Nachzeitigkeit zuzuordnen sind, während die Kategorie der Gleichzeitigkeit im Deutschen
nicht vollkommen identisch ist mit der Kategorie der Abruptheit im Koreanischen (자 – (cha
(kaum)), 즈음 – (chuum (gerade als)), 대로 – (taero (sobald als)). Des Weiteren stehen
Konjunktionalformen des Deutschen, die ausschließlich einer Kategorie (z.B. konzessiv,
kausal, konditional) zuzuordnen sind, teilweise polyvalente Formen des Koreanischen
gegenüber, beispielsweise nominalwertige Konjunktionalformen, die in lokativer oder
instrumental-direktionaler Funktion auch adverbial verwendet werden können.
Diese und weitere Unterschiede zwischen den Konjunktionalsystemen des Deutschen und des
Koreanischen können im Spracherwerbsprozess zu sprachkontrastiv bedingten Fehlern
führen. So ist zum einen zu erwarten, dass Konjunktionalformen, die nur in einer der beiden
Sprachen existieren, beim Erwerb der jeweils anderen Sprache zu Fehlern führen oder aber im
Sinne einer Vermeidungsstrategie vollkommen ausgelassen werden. Gleichzeitig können auch
2 Oberbegriff für Konjunktionen und Subjunktionen (vgl. Duden Band 4: Die Grammatik. Mannheim 2006)
39
Übergeneralisierungen ähnlicher und vermeintlich sicher beherrschter Formen antizipiert
werden.
Um der Frage nachzugehen, welche Fehler im deutschen Konjunktionalsystem bei
koreanischen Lernern des Deutschen auftreten, sollen in dem vorliegenden Beitrag, basierend
auf einer Studie von Kim (1994), Schwierigkeiten fortgeschrittener koreanischer Lerner beim
Erwerb des deutschen Konjunktionalsystems beschrieben und analysiert werden. Zuvor
jedoch sollen die Konjunktionalsysteme des Deutschen und des Koreanischen dargestellt und
linguistisch differenziert werden.
2.0 Zur Differenzierung der Konjunktionen im Deutschen und im Koreanischen
Buscha (1989, 9) betrachtet Konjunktionen als „in morphologischer Hinsicht unveränderliche
Worteinheiten, die als syntaktische Verknüpfungszeichen ohne Satzgliedwert mit je
verschiedener Verknüpfungsbedeutung gebraucht werden“. Dieser Aspekt einer
unflektierbaren und nicht satzgliedfähigen Wortart wird auch von Bußmann (1983, 258)
betont, die zudem, hinsichtlich ihrer Stellungseigenschaften, zwischen echten und unechten
Konjunktionen unterscheidet. So seien echte Konjunktionen wie aber, allein, denn, oder, und,
sondern nicht vorfeldfähig, während sich unechte Konjunktionen (Konjunktionaladverbien)
satzgliedhaft wie Adverbiale verhielten und eine Inversion bewirken könnten.
Lewandowski (1985, 562) nimmt hinsichtlich der syntaktischen Kriterien eine
Unterscheidung zwischen subordinativen und koordinativen Konjunktionen vor und rechnet
zu den letzteren die kopulativen (und, sowohl … als auch), die disjunktiven (oder, entweder
… oder), die restriktiven (außer), die adversativen (aber, jedoch, sondern) und die kausalen
Konjunktionen (denn). Während subordinative (subordinierende) Konjunktionen „einen von
ihnen eingeleiteten Nebensatz in einen übergeordneten Satz, der ein Hauptsatz oder ein
Nebensatz sein kann“ (vgl. Helbig/Buscha 1986, 182) einbetten, verbinden koordinative
(koordinierende) Konjunktionen Hauptsätze, Nebensätze gleichen Grades oder Satzglieder
miteinander. Bei der Verwendung hauptsatzverbindender Konjunktionen stehe das finite Verb
hinter der Konjunktion und dem ersten Satzglied. Die Positionierung sei denn auch das
entscheidende Kriterium der Differenzierung zwischen Konjunktionen und Adverbien
(Konjunktionaladverbien).
Die differenzierteste Unterscheidung hinsichtlich der Bedeutungen und Funktionen von
Konjunktionen findet sich bei Buscha (1989, 16 ff.), der neben den von Bußmann und
Lewandowski genannten Kategorien eine Reihe weiterer Differenzierungen vornimmt und
40
zusätzlich unter anderem zwischen alternativ-konzessiv subordinierenden (ob … ob),
explikativ koordinierenden (das heißt), final subordinierenden (auf dass, damit, dass, um …
zu), instrumental subordinierenden (als dass, um … zu), irreal-konsekutiv subordinierenden
(als dass), komitativ subordinierenden (indem), konditional subordinierenden (falls, sofern,
wenn) und temporal subordinierenden (als, da, indes, seitdem) Konjunktionen unterscheidet.
Helbig/Buscha (1986) differenzieren in den jeweiligen Gruppen der subordinierenden und
koordinierenden Konjunktionen zwischen einfachen, zusammengesetzten und mehrteiligen
Konjunktionen. Zu den einfachen subordinierenden Konjunktionen rechnen Helbig/Buscha
(1986, 182) die Konjunktionen dass, weil, bevor, ehe, obwohl, als, obgleich, während, damit,
falls, indem, wenn und sobald. Zu den zusammengesetzten subordinierenden Konjunktionen
werden die Konjunktionen als dass, so dass, (an)statt dass, ohne dass, als ob, als wenn und
außer dass gerechnet. Typisch für die zusammengesetzten subordinierenden Konjunktionen
sei ihr gleichzeitiges Miteinanderauftreten und Nebeneinanderstehen und die Untrennbarkeit
der beiden Komponenten (Er erlaubt sich ein Urteil, ohne dass er die Literatur gründlich
kennt). Eine Trennung der beiden Konjunktionskomponenten sei in diesen Fällen nur durch
die Einfügung eines Korrelats möglich (Er erlaubt sich ein Urteil, ohne die Tatsache, dass er
die Literatur gründlich kennt). Mehrteilige Konjunktionen können nach Helbig/Buscha (ebd.)
sowohl in subordinierender (je … desto, wenn auch … so doch) als auch in koordinativer
Funktion (entweder … oder, nicht nur … sondern auch) auftreten.
Nach Lewin (1970, 34ff.) sind die Konjunktionalformen des Koreanischen insbesondere in
Bezug auf die Anschlusstypen zu differenzieren, die als Basen für die konjunktionalen
Endungen dienen können. Hierbei könne zwischen athematischen (Anschlusstyp 1) und
thematischen Verbalbasen (Anschlusstyp 2), den Konverbal- (Anschlusstyp 3) und den
Temporalstämmen (Anschlusstyp 4) sowie dem Präsens- (Anschlusstyp 5), dem Präterial-
(Anschlusstyp 6) und dem Futurpartizip (Anschlusstyp 7) differenziert werden. Lewin (1970,
35ff.) beschreibt die semantischen Funktionen der koreanischen Konjunktionalformen
exemplarisch anhand der temporalen, konditionalen und kausalen Marker.
I. Temporale Konjunktionalformen
Postverbal Vorzeitigkeit (der Nebensatzhandlung) 아/어 (nachdem, Konverbalstamm) 서 3-so (nachdem) 서야 3-soya (erst wenn) 고서 1-goso (als, wenn)
41
고는 1-gonun (als, nachdem) 고야 1-goya (nachdem) 면서부터 2-myonsobuto (seitdem) Nominalwertig 뒤(에) 6-dui(e) (nachdem) 후(에) 6-hu(e) (nachdem) 사이(에) 6-sai(e) (nachdem) 다음(에) 6-daum(e) (nachdem) 지 6-ji (nachdem, seitdem) 이래(로) 6-irae(ro) (seitdem) Gleichzeitigkeit 매 2-mae (als) 면서 2-mynso (während) 니(까) 2-ni(kka) (als) 더니 1,4-doni (als, retrospektiv) 때 – 7 ttae (als, wenn) 무렵(에) – 7 muroyp(e) (während) 동안(에) – 5 tongan(e) (während) 사이(에) – 5 sai (e) (während) 중에 – 5 chunge (während) 길(에) – 5 kyol(e) (während) 적(에) – 7 chok(e) (wenn, gelegentlich) 제 – 7 che (wenn, gelegentlich) 족족 – 5 chokchok (jedesmal wenn) Nachzeitigkeit 기(도)전에 – 1 ki(do)jone (bevor) Abruptheit 자 – 1 cha (kaum) 자마자 – 1 chamaja (kaum) 자말자 – 1 chamalja (kaum) 다(가) – 1 ta(ga) (kaum) 즈음 – 7 chuum (gerade als) 차 – 6 ch’a (gerade als) 참에 – 5 ch’ame (gerade als) 대로 – 5 taero (sobald als) 기가바쁘게 – 1 ki-ga pappuge (kaum)
42
II. Konditionale Konjunktionalformen
Postverbal 면 - 2 myon (wenn) 다면 – 1 tamyon (wenn, Quot.) 자면 – 1 chamyon (wenn, Opt.) 느라면 – 1 nuramyon (wenn) 느라니까 – 1 nuranikka (wenn) 느니 – 1 nuni (wenn) 거든/어든 – 1 (k)odun (wenn) 건대/언대 – 1 (k)ondae (wenn) 고는 – 1 konun (wenn) 고서는 – 1 kosunun (wenn) 고야 – 1 koya (wenn) 서야 – 3 soya (wenn) 야 – 3 ya (nur) 던들 – 1 tondul (gesetzt den Fall) Nominalwertig
들 – 6 tul (wenn) 진대 – 7 chindae (gesetzt den Fall) III. Kausale Konjunktionalformen
Postverbal
니(까) – 2 ni(kka) (weil) 느니 – 1 nuni (weil) 나니 – 1 nani (weil) 거니 – 1 koni (weil) 더니 – 1 toni (weil) 거늘 – 1 konul (weil) 매 – 2 mae (weil) 서 – 3 so (weil) 느라고 – 1 nurago (da gerade) 관대 – 1 kwandae (etwas wegen) Nominalwertig 므로 – 7 muro (dadurch dass) 고로 – 5,6 koro (weil) 기로 – 1 kiro (in Anbetracht von) 기에 – 1 kie (dadurch dass) 길래 – 1 killae (dadurch dass) 기때문(에) – 1 ki-ttaemun (e) (weil) 까닭(에) – 5,6,7 kkadalk (e) (aus dem Grunde dass)
43
바람에 – 5 parame (infolge) 걸 – 6 kyol (infolge) 나머지(에) – 5,6 namoji (e) (bedingt durch) 사이(에) – 7 sai (e) (weil) 대로 – 5,6,7 taero (entsprechend) 지라 – 5,6 chira (weil) 지니- 7 chini (weil) 즉 – 6 chuk (weil)
* Die angegebenen Ziffern beziehen sich auf den jeweiligen konjunktionalen Anschlusstyp.
Lewins Analyse zeigt, dass die postverbalen Konjunktionalformen sowohl mono- als auch
polyfunktional verwendet werden können. Dabei verweist Lewin auf die Polyfunktionalität
der Konjunktionalformen insbesondere in den temporal-kausal-konditionalen und den
konzessiv-adversativen Bereichen. So können beispielsweise die Formen 니(까) (-ni(kka))
und 서 (so) postverbal zur Markierung der Temporalität (Gleichzeitigkeit) als auch als
postverbale kausale Konjunktionalformen verwendet werden.
3.0 Schwierigkeiten koreanischer Lerner beim Erwerb der deutschen Konjunktionen
In einer empirischen fehleranalytischen Untersuchung markanter Fehler fortgeschrittener
koreanischer Deutschlerner analysierte Kim (1994) auch die Probleme dieser Lerner beim
Erwerb des deutschen Konjunktionalsystems. Dabei konnte er feststellen, dass es im Bereich
der subordinierenden Konjunktionen häufig zu Vertauschungen der finalen Konjunktion
damit mit der kausalen Konjunktion weil kommt.
Nach Buscha (1989, 56) haben die Konjunktionen damit und um … zu finale Bedeutung und
drücken aus, „dass der Sachverhalt des Nebensatzes bzw. des Infinitivs die Absicht (den
Zweck, das Ziel) des Hauptsatz-Sachverhalts darstellt“. Die Absicht sei „an ein personales
Subjekt gebunden und mit einem Willenselement verbunden, das auf die Realisierung des
Hauptsatz-Sachverhalts gerichtet ist“. Es seien zwei Varianten der Realisierung des
Finalsatzes feststellbar, bei denen das wollende Personalsubjekt und das realisierende Subjekt
identisch (Er beeilt sich, damit der den Zug noch erreicht) oder aber nicht identisch (Er stellt
mir den Ausländer vor, damit ich ihn kennenlerne) sein können.
Die Konjunktion weil hat nach Buscha (1989, 125) eindeutig kausale Bedeutung und drückt
aus, „dass der Nebensatz-Sachverhalt der Grund (die Ursache) für den Hauptsatz-Sachverhalt
ist“. Der Nebensatz stehe häufig als Nachsatz, sei aber auch als Vordersatz möglich. Im
44
Hauptsatz könnten auch Korrelate wie darum, deshalb, deswegen, aus diesem Grund auf den
Nebensatz verweisen.
Kim (1994) stellte fest, dass von den beobachteten Lernern zur Markierung eines Zwecks
oder einer Absicht statt der finalen Konjunktion damit häufig die Konjunktion weil verwendet
wird, die als Anschlussmittel für Kausalsätze fungiert.
Man lernt Fremdsprachen, weil man anderes Volk verständigen kann. → damit
Auch der umgekehrte Fall der Verwendung einer finalen Konjunktion zur Markierung eines
kausalen Bedingungsgefüges konnte von Kim (ebd.) festgestellt werden.
Ich lerne Deutsch, damit ich mich für Deutsch interessiere. → weil
Damit ich Deutschroman lesen möchte, lerne ich Deutsch. → Weil Ein häufig anzutreffender Fehler ist darüber hinaus die Vertauschung der finalen Konjunktion
damit mit der Infinitivkonstruktion um … zu, die ebenfalls zur Realisierung eines finalen
Bedingungsgefüges verwendet wird.
Aber ich will Fremdsprachen lernen, damit ich Ausländer verstehen will. → um Ausländer zu verstehen. Ich muss fließend Deutsch sprechen, um die Schüler auch gut Deutsch zu sprechen. → damit die Schüler auch gut Deutsch sprechen. Kim (1994, 79) konnte feststellen, dass eine fehlerhafte Verwendung der Konjunktion damit
insbesondere dann auftritt, wenn parallel die Modalverben sollen und können verwendet
werden, die ihrerseits bereits einen Willen, eine Absicht oder einen Wunsch markieren, so
dass die zusätzliche Markierung des Willenselements durch die finale Konjunktion damit
redundant erscheint.
Die Beobachtungen Kims stehen insgesamt in Einklang mit den Überlegungen Lewins zur
Polyfunktionalität der koreanischen Konjunktionalformen. Offenbar wird von den Lernern die
im Koreanischen bestehende Polyfunktionalität im Sinne eines Sprachentransfers auf das
zielsprachliche deutsche Konjunktionalsystem übertragen.
Eine von koreanischen Lernern häufig vermiedene Konjunktion ist die konditionale
Konjunktion wenn bei gleichzeitiger Übergeneralisierung der Wendung „es … dass“. Die
Vermeidung der Konjunktion wenn mag aus sprachkontrastiver Perspektive zunächst
überraschen, da im Koreanischen eine ganze Reihe postverbaler und nominalwertiger
Konjunktionalformen mit äquivalenter Bedeutung existieren (postverbal u.a.: 면 - myon,
45
다면 – tamyon, 자면 – chamyon, 느라면 – nuramyon, 느라니까 – nuranikka;
nominalwertig: 들 – tul). Möglicherweise wird die Konjunktion wenn von den Lernern
vornehmlich als temporale subordinierende Konjunktion, die der Markierung von
Gleichzeitigkeit oder Vorzeitigkeit dient, betrachtet. Ein weiterer Grund für die Vermeidung
der Konjunktion wenn als subordinierender konditionaler Konjunktion könnte zudem darin
bestehen, dass insbesondere die Verwendung dieser Konjunktion in irrealen
Konditionalsätzen auch eine Verwendung des Konjunktivs erforderlich macht.
Es wäre besser, dass wir Fremdsprache in ihrer Art denken. → wenn Es ist dem Körper gesund, dass man jeden Tag ein Glas Milch trinkt. → wenn
Eine im Allgemeinen von koreanischen Lernern leicht zu erwerbende Konjunktion ist
hingegen die temporale Konjunktion dann, die ihnen in eben jener Funktion aus ihrer L2
Englisch als Konjunktion then bekannt ist. Dennoch treten auch in diesem Fall Fehler auf, wie
das folgende Beispiel illustriert.
Als Deutschlehrer muss ich Deutschland und Deutsche gut verstehen, deshalb kann ich noch
besser lehren. → dann
4.0 Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden unter Einnahme einer sprachkontrastiven Perspektive die
Konjunktionalsysteme des Deutschen und des Koreanischen beschrieben und miteinander
verglichen. Dabei wurde für das Deutsche eine Differenzierung zwischen echten und
unechten sowie koordinierenden und subordinierenden Konjunktionen vorgenommen. In
Anlehnung an Lewandowski und Buscha wurde die Gruppe der subordinierenden und
koordinierenden Konjunktionen weiter ausdifferenziert (kopulativ, disjunktiv, restriktiv,
adversativ etc.).
Für das Koreanische als einer agglutinierenden Sprache konnte mit Lewin festgestellt werden,
dass die entsprechenden Konjunktionalformen an die Verbalbasen, die erweiterten Stämme
bzw. an die Partizipialformen angehängt werden. Die durch die Verwendung der
Konjunktionalformen entstehenden Nebensätze wurden als koordinativ, temporal,
konditional, kausal, konzessiv, adversativ, distributiv etc. beschrieben. Es wurden in
Anlehnung an Lewin insgesamt sieben Anschlusstypen benannt, die als Basen für
konjunktionale Endungen dienen können. Die semantischen Funktionen der
46
Konjunktionalendungen wurden anhand der temporalen, konditionalen und kausalen
Konjunktionalendungen illustriert.
Bezüglich der Schwierigkeiten koreanischer Lerner beim Erwerb des deutschen
Konjunktionalsystems konnte festgestellt werden, dass Vertauschungen finaler (damit) und
kausaler (weil) Konjunktionen auftreten. Offenbar wird in einigen Fällen die
Polyfunktionalität koreanischer Konjunktionalformen auf das deutsche Konjunktionalsystem
transferiert. Im Sinne einer Vermeidungsstrategie wurden von den beobachteten koreanischen
Lernern bestimmte Konjunktionen (z.B. die konditionale Konjunktion wenn) bei
gleichzeitiger Übergeneralisierung anderer Formen (z.B. es … dass) ausgelassen.
Konjunktionalformen, die den Lernern bereits aus dem Erwerb anderer Fremdsprachen (z.B.
then aus dem Englischen) bekannt sind, bereiten ihnen nur in wenigen Fällen
Schwierigkeiten.
5.0 Literatur
Buscha, Joachim (1989): »Lexikon deutscher Konjunktionen.« Leipzig.
Bußmann, Hadumod (1983): »Lexikon der Sprachwissenschaft.« Stuttgart.
Duden Band 4: Die Grammatik. Mannheim 2006.
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1986): »Kurze deutsche Grammatik für Ausländer.«
Leipzig.
Kim, Yong-Shin (1994): »Schwierigkeiten beim Lernen und Lehren der deutschen Sprache
durch Koreaner. Eine fehleranalytische Untersuchung bei koreanischen
Deutschlehrern an Oberschulen.« Eichstätt (unveröffentlichte Magisterarbeit).
Lewandowski, Theodor (1985): »Linguistisches Wörterbuch Band 2.« 4. Auflage Heidelberg
1985.
Lewin, Bruno (1970): »Morphologie des koreanischen Verbs.« Wiesbaden.
47
IV. Präpositionen und Postpositionen im deutsch-koreanischen Sprachvergleich
1.0 Einleitung
Ulrich (1975, 111) betrachtet Präpositionen (Verhältniswörter, Fallfügteile) als eine Wortart,
die als Bindeglied beim Zusammenfügen einzelner Wörter zu Wortgruppen fungiert. Dabei
kennzeichnen die Präpositionen die Relation der Syntagmakonstituenten zueinander und
markieren diese als lokal (auf, unter, über), temporal (während, zwischen), kausal (infolge,
unbeschadet) oder modal (einschließlich, gemäß). Die Präpositionen stellen eine nicht
flektierende und nicht satzgliedfähige Wortart dar, die zudem zahlenmäßig begrenzt ist und
mithin eine geschlossene Klasse bildet (vgl. Bußmann 1983, 401).
Zentrales Merkmal der Präpositionen ist nach Risel (2007, 79) die Eigenschaft dieser Wortart,
einen bestimmten Kasus zu verlangen und diesen zu regieren.
Präpositionen treten nach Hoberg/Hoberg (2009, 308) nicht allein, sondern zusammen mit
anderen Wörtern oder Wortgruppen auf, mit denen sie eine Präpositionalgruppe
(Präpositionalphrase, Präpositionalgefüge) bilden. Eine Präpositionalgruppe/
Präpositionalphrase besteht dabei im Kern aus einer Präposition und einer Nominalphrase, die
durch Pronominaladverbien sowie Raum- und Zeitangaben substituiert werden kann (vgl.
Lewandowski 1985, 803).
Auch in Präpositionalobjekten ist die Rektion des Präpositionalkasus nicht unmittelbar vom
Verb, sondern von der eingefügten Präposition abhängig (vgl. Lewandowski 1985, 803).
Dabei sind Präpositionalobjekte, wie Ulrich (1975, 111) betont, von Adverbialbestimmungen
zu unterscheiden.
Bußmann (1983, 401) verweist darauf, dass Präpositionen in ihrer Eigenschaft, Beziehungen
zwischen Satzelementen aufzuzeigen, den Adverbien und einigen Konjunktionen ähneln,
während die Eigenschaft der Rektion ein Alleinstellungsmerkmal der Präpositionen darstelle.
Ursprünglich aus lokalen Adverbien entstanden, zeige sich die adverbiale Herkunft der
Präpositionen zum Beispiel bei der Präposition durch, die als Präposition (durch den Park
laufen), als Präfix mit lokaler Semantik (den Park durchlaufen) und auch adverbial (durch
und durch) verwendet werden könne. Im Deutschen ist die Voranstellung der Präpositionen
vor den abhängigen Wörtern üblich, während eine nachgestellte (postpositionale)
Verwendung selten ist. Althaus et al. (1980, 548) ordnen die Präpositionen sprachtypologisch
den VO-Sprachen zu, während OV-Sprachen vorwiegend Postpositionen enthielten. Dabei
handelt es sich bei den VO-Sprachen um solche Sprachen, bei denen die Objekte auf die
48
Verben folgen (z.B. Deutsch, Englisch), während in den OV-Sprachen die Objekte den
Verben vorausgehen (z.B. Japanisch, Koreanisch). Für das Deutsche gelte, dass sich die
Postpositionen (entgegen, entlang, gegenüber) erst nach Einführung der OV-Wortstellung in
Nebensätzen am Anfang des 16. Jahrhunderts entwickelt hätten.
Die Analyse von Präpositionen und Postpositionen bedarf also neben einer synchronen auch
einer diachronen Sprachanalyse. Risel (2007, 81) weist für die Präpositionen darauf hin, dass
sprachgeschichtlich ältere Präpositionen (in, auf, ohne) einfach gebaut seien, während der
Aufbau jüngerer Präpositionen (oberhalb, abzüglich, entsprechend) oftmals komplex sei.
Sprachgeschichtlich sei festzustellen, dass Präpositionen zum Teil aus anderen Wortarten
entstanden seien. So seien beispielsweise die Präpositionen kraft und dank aus Substantiven
entstanden.
Im vorliegenden Beitrag sollen nun die Präpositionen einer flektierenden VO-Sprache
(Deutsch) mit dem System der Postpositionen in einer agglutinierenden Sprache (Koreanisch)
kontrastiv verglichen werden. Dabei soll für das Deutsche auf Stellung und Funktion
verschiedener Adpositionen sowie auf die besondere Bedeutung der gebundenen
Präpositionen (vgl. Peschel 2012) eingegangen werden. Sprachkontrastiv sollen die im
Koreanischen verwendeten affigierten Postpositionspartikeln dem deutschen
Präpositionalsystem gegenübergestellt werden. In einem weiteren Schritt soll erläutert
werden, welche Funktion die koreanischen Suffixpartikeln für die Kasusmarkierung besitzen.
In einem letzten Schritt soll auf der Basis einer empirischen Untersuchung von schriftlichen
Texten koreanischer Deutschlerner (Studierende des dritten und vierten Studienjahres der
Seouler Fremdsprachenuniversität) die Verwendung der deutschen Präpositionen in der
Interlanguage koreanischer Lerner beschrieben und analysiert werden.
2.0 Die Präpositionen im Deutschen
Nach Schröder (1986, 11) treten Präpositionen nicht als selbständige Satzglieder, sondern
vielmehr als zu einem Satzglied gehörig auf, mit dem sie durch Rektion verbunden sind.
Während die Voranstellung (Prä-Position) die im Deutschen übliche Positionierung der
Präpositionen sei, seien auch andere Positionierungen wie die Post- oder Zirkumposition
möglich. Einige Präpositionen (entgegen, entlang, entsprechend, gegenüber, gemäß, nach)
könnten sowohl als Prä- als auch als Postpositionen auftreten, während andere (gemäß,
halber, hindurch, lang, zufolge) ausschließlich eine Postpositionierung erlaubten.
Präpositionen wie um … willen oder von … aus träten in Zirkumposition auf.
49
Bußmann (1983, 401) nimmt eine ähnliche Differenzierung vor und ergänzt diese um die
Ambiposition (der Ehre wegen vs. wegen der Ehre). Bußmann (ebd.) betont, dass
Präpositionen in Präpositionalphrasen außer im adverbialen Bereich auch im verbalen Bereich
vorkommen. Adverbiale in Präpositionalphrasen könnten je nach Verbvalenz als
valenznotwendige, obligatorische (Martina wohnt in Stuttgart) oder als nicht
valenznotwendige, fakultative Adverbiale (Sie sucht ihre Lampe auf/unter/neben dem Tisch)
auftreten. Nach Schröder (1986, 11) entstehen Adverbien unter anderem durch eine feste
Verbindung von Präpositionen und Substantiven (erwartungsgemäß, umstandshalber,
jahrelang). Die durch die Verschmelzung von Präpositionen und Substantiven entstehenden
Adverbien (erwartungsgemäß) ließen sich durch den Einsatz von Substantiven wieder in
Satzglieder (gemäß seiner Erwartung) überführen, in denen das Nomen hinsichtlich seines
Kasus von der Präposition abhängig sei. In Präpositionalobjekten mit einem
valenznotwendigen Auftreten eines Objekts (glauben an, sich verlassen auf) seien die
Präpositionen weitgehend durch das Verb determiniert und semantisch leer.
Nach Bußmann (1983, 402) können Präpositionalphrasen syntaktisch auch die Funktion eines
Attributs (Der Betrug am Wähler; Der Eingang zum Theater) oder eines
Funktionsverbgefüges (in Rechnung stellen, zur Abstimmung kommen) übernehmen.
Althaus et al. (1980, 627) beschreiben die deutsche Gegenwartssprache die Tendenz,
Präpositionalgruppen zunehmend auszuklammern. Dies gelte für Präpositionalgruppen
sowohl in Umstandsangaben als auch in Präpositionalobjekten. Die Ausklammerung von
Präpositionalgruppen sei bislang von den Grammatiken nicht anerkannt gewesen. Diese
hätten lediglich die Ausklammerung von Infinitivkonstruktionen, von Glied- und
Attributsätzen sowie von Satzgliedern und Nebensätzen anerkannt. Althaus et al. (ebd.)
führen die zunehmende Tendenz der Ausklammerung von Präpositionalphrasen auf den
Einfluss der gesprochenen Sprache zurück, in der der Satzrahmen nicht so streng gehandhabt
werde und weitgespannte Bögen im Satzbau vermieden würden. Insgesamt ermögliche die
Ausklammerung eine Auflockerung des Satzbaus und eine größere Variabilität des
Satzrhythmus.
Peschel (2012) fordert, die gebundenen Präpositionen (Verb + regierte Präposition) intensiver
als bisher im Grammatikunterricht zu behandeln. Während die Wechselpräpositionen
verbunden mit der Kasusrektion im Unterricht eine besondere Rolle spielten, würden die
gebundenen Präpositionen trotz der mit dem Erwerb dieser Präpositionen verbundenen
Lernschwierigkeiten weitgehend vernachlässigt. Die Probleme von Lernern bei der
Verwendung der gebundenen Präpositionen seien aber vielfältig. So würden Präpositionen
50
teilweise fehlerhaft verwendet (*sich orientieren nach; *sich zusammensetzen in), wobei die
Ursache dieses fehlerhaften Gebrauchs häufig in einer Kontamination konkurrierender,
semantisch ähnlicher Konstruktionen bestehe. Zudem könne die Wahl eines zu kolloquialen
Stils in einer formellen Textsorte zu Problemen bei der Wahl der adäquaten Präposition
führen. Festzustellen seien auch Kasusfehler in der Folge von Präpositionen (*Diese
Erklärungen sollen dann aber (…) auf eigene Experimente beruhen) und Auslassungen von
Präpositionen (*um für Kinder wenigstens ein angenehmes Lernklima zu sorgen). Letztere
seien insbesondere dann feststellbar, wenn mehrere Präpositionen in gleich- oder
verschiedenartigen Satzgliedern unmittelbar nacheinander verwendet würden.
Eine Untersuchung Peschels (2012) zur Darstellung gebundener Präpositionen in
ausgewählten Grammatiken (Helbig/Buscha 1991, Eisenberg 2006, Duden 2009) ergab eine
Berücksichtigung der gebundenen Präpositionen insbesondere in der Dudengrammatik.
In dieser Grammatik würden die gebundenen Präpositionen gleich zu Beginn der Darstellung
der Präpositionen präsentiert und erläutert. Es erfolge der Hinweis darauf, dass gebundene
Präpositionen zusammen mit dem Verb eine feste Bedeutungseinheit bilden und nicht
austauschbar seien. Gebundene Präpositionen verlören allerdings weitgehend ihre Bedeutung.
In Eisenbergs „Grundriss der deutschen Grammatik“ (2006) würden die gebundenen
Präpositionen auch unter diachroner Perspektive betrachtet und die Frage gestellt, inwieweit
die Bedeutung gebundener Präpositionen auf eine lokale Grundbedeutung zurückzuführen sei.
Helbig/Buscha (1991) schließlich ordnen die gebundenen Präpositionen dem Satzglied
Präpositionalobjekt zu und betrachten sie ansonsten als semantisch weitgehend entleert und
lediglich von syntaktischem Fügungswert.
Peschel (2012, 52) führte für die gebundenen Präpositionen eine Kookkurrenzanalyse unter
Verwendung des Cosmas-Korpus des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim durch.
Hierbei handelt es sich um eine Sammlung digitalisierter Texte aus Zeitungen sowie aus
klassischen und zeitgenössischen Romanen. Für das Verb abmelden konnte Peschel (ebd.) ein
häufiges kookkurrentes Auftreten mit der Präposition von feststellen. Einzelne Belege fanden
sich jedoch auch für eine Kookkurrenz mit der Präposition für. Peschel (ebd.) nimmt an, dass
die Verbindung abmelden für in Analogie zu der Verbindung anmelden für entstanden sein
könnte. Für das Verb mitwirken konnte Peschel (ebd.) eine gleiche Anzahl von
Kookkurrenzen mit der Präposition an wie mit der Präposition für finden, während sich für
das Verb leiden eine leicht höhere Kookkurrenz mit der Präposition unter als mit der
Präposition an ausmachen ließ.
51
Peschel (ebd.) weist darauf hin, dass zwischen den Kookkurrenzen leiden an und leiden unter
kollokative Unterschiede bestehen. Während die Verbindung leiden unter mit beinahe jedem
negativ konnotierten Substantiv verwendet werden könne, werde die häufig auftretende
Verbindung leiden an ausschließlich im Kontext der Denotation von Krankheiten verwendet.
Für das Verb untersuchen fand Peschel (ebd.) eine deutlich höhere Kookkurrenz mit der
Präposition auf als mit der Präposition nach. Die Verwendungsunterschiede der
Verbindungen untersuchen auf und untersuchen nach seien primär textsortenbedingt mit
einem häufigen Auftreten der Verbindung untersuchen nach in naturwissenschaftlichen
Texten.
3.0 Die Postpositionen im Koreanischen
In einer agglutinierenden OV-Sprache wie dem Koreanischen können postpositionierte
Partikeln der Kasusmarkierung dienen oder aber als Postpositionspartikeln, den deutschen
Präpositionen entsprechend, verwendet werden.
Kim (1999, 14) weist darauf hin, dass die Kasusmarkierungen im Koreanischen durch das
Anhängen einer Kasuspartikel an ein Nomen vorgenommen werden. So könnten die
Kasuspartikeln -이(-i) und -가 (-ga) ausschließlich als Nominativpartikeln verwendet werden.
Die Form -께서 (-kkesO) (Honorativ) könnte als Quasi-Nominativpartikel betrachtet werden,
da sie neben der Nominativmarkierung weitere semantische und pragmatische Funktionen
erfüllt.
Nach Kim (ebd.) besitzt auch die Genitivpartikel -의 (-ui) eine adnominale Funktion. Es
erfolge jedoch zumeist eine Tilgung dieser Partikel.
Die Partikeln -에게 (-ege) und -한테 (-hante) markieren beide den Dativ, wobei die Form
에게 (-ege) zumeist in schriftlichen Texten und die Form -한테 (-hante) in gesprochener
Sprache Verwendung findet. Die Partikel -에게 (-ege) besitzt darüber hinaus in der Form -께
(-kke) die pragmatische Funktion der Honorativmarkierung.
Die Akkusativpartikeln -을 (-ul) und -를 (-rul) dienen zur Markierung eines direkten Objekts.
Neben den Kasuspartikeln existieren im Koreanischen mit den Topikpartikeln -은 ((-un)
(nach einem Auslaut)) und -는 (-nun) sowie den Delimiterpartikeln 도 (-do) und 만 (-man)
Hilfspartikeln, die eine vornehmlich diskurspragmatische Funktion besitzen.
52
Nach Kim (1999, 14) können diese Hilfspartikeln weitestgehend durch Kasuspartikeln ersetzt
werden oder aber mit diesen zusammenstehen. Eine Einschränkung bestehe lediglich darin,
dass Delimiterpartikeln grundsätzlich nicht nach der Genitivpartikel auftreten könnten.
Die folgenden Beispielsätze sollen die Verwendung der Hilfspartikeln illustrieren:
오늘만 싸게판다 .
Oneul man ssage panda.
Das Angebot gilt nur für heute.
할머니도 같이 간다.
Halmeonido gatchi ganda.
Die Oma kommt auch mit.
Bei der koreanischen Pluralpartikel 들 (-dul) handelt es sich weder um eine Kasus- noch um
eine Postpositionspartikel. Vielmehr entspricht die Pluralpartikel dem Numerusmarker im
Deutschen.
선생님은 학생들과 산책을 갔다.
Seonsaengnimun hagsaengdulgwa sanchaegul gatta.
Der Lehrer ging mit den Schülern spazieren.
Im Folgenden sollen exemplarisch anhand von Satzbeispielen einige derjenigen koreanischen
Postpositionspartikeln aufgeführt werden, die in ihrer Funktion weitgehend den deutschen
Präpositionen entsprechen. Dabei weisen die koreanischen Postpositionspartikeln keine
Abhängigkeit von einem bestimmten Kasus auf, sondern sind vornehmlich nach ihrer
Bedeutung zu differenzieren.
Deutsche Präposition: ab
Koreanische Postposition: -에서 (-eso) → Lokalpartikel
그 기차는 프랑크푸르터에서 출발한다.
Geu gichaneun peurangkeupureuteoeso chulbalhanda.
Der Zug geht ab Frankfurt.
53
Deutsche Präposition: auf
Koreanische Postposition: (-위)에 (-ui)e → Lokalpartikel (Markierung eines direkten
Kontakts)
(1)
책은책상 (위)에 놓여있다.
Chegeun chaegsanguie nohyeoitta.
Das Buch liegt auf dem Tisch.
(2)
그녀는 책을 책상(위)에 놓는다.
Geunyeoneun chaegeul chaegsanguie noneunda.
Sie legt das Buch auf den Tisch.
Deutsche Präposition: aus
Koreanische Postposition: -에서 (-eso) → Lokalpartikel (Bewegung aus einem Raum)
그는 찬장에서 선물을 꺼냈다.
Geuneun chanjangeso seonmureul kkeonetta.
Er nahm das Geschenk aus dem Schrank.
Deutsche Präposition: aus
Koreanische Postposition: -에서 (-eso) → Lokalpartikel (Herkunft)
그녀는 핀란드에서 왔다.
Geunyeoneun pinlandeueso watta.
Sie kommt aus Finnland.
Deutsche Präposition: bei
Koreanische Postposition: (근처)에 (-guncho)e → Lokalpartikel (bei = in der Nähe von)
슈타른베륵은 뮌헨 근처에 있다.
Syutareunbereugeun mueonhen gunchoe itta.
Starnberg liegt bei München.
54
Deutsche Präposition: bei
Koreanische Postposition: (집)에서 (-eso) → Lokalpartikel (bei Personennennung)
에바는 아직도 그녀의 부모님 집에서 산다.
Ebaneun ajigdo geunyeoe bumonim chibeso sanda.
Eva wohnt noch bei ihren Eltern.
Deutsche Präposition: bei
Koreanische Postposition: 에서 (-eso) → Lokalpartikel (bei Nennung von Einrichtungen,
Firmen etc.)
그는 지멘스에서 일한다.
Geuneun jimenseueso ilhanda.
Er arbeitet bei Siemens.
Deutsche Präposition: bis
Koreanische Postposition: 까지 (-kkadzi) → Lokal- (Richtungspartikel) und Temporalpartikel
(1)
그 기차는 프랑크푸르트까지 간다.
Geu kichaneun peurangkeupureuteukkadzi ganda.
Der Zug geht nur bis Frankfurt.
(2)
열 시까지 밖에서 놀아도 된다.
Yeol shikkadzi bakkeso norado doenda.
Bis zehn darfst du draußen bleiben.
55
Deutsche Präposition: entlang
Koreanische Postposition: 따라 (-ttara) → Lokalpartikel (Markierung von Parallelität)
그들은 강을따라 산책을 했다.
Geudeureun gangeulttara sanchaekeul haetta.
Sie spazierten den Fluss entlang.
Deutsche Präposition: hinter
Koreanische Postposition: 뒤에 duie → Lokalpartikel
자동차가집 뒤에 주차해있다 .
Jadongchaga chibduie juchahe itta.
Das Auto parkt hinter dem Haus.
Deutsche Präposition: in/im (Wechselpräposition)
Koreanische Postposition: (안)에 -(an)e → Lokalpartikel
신문은 거실(안)에 있다.
Shinmuneun geoshilane itta.
Die Zeitung ist im Wohnzimmer.
Deutsche Präposition: in das/ins
Koreanische Postposition: -(안)(으)로 -(an)(u)ro → Lokalpartikel (Richtungsmarkierung)
그는 거실로 간다.
Geuneun geoshillo ganda.
Er geht ins Wohnzimmer.
56
Deutsche Präposition: mit
Koreanische Postposition: -(이)와 -(i)wa und -과 –(gwa), (bei Auslaut): → Komitativpartikel
(formell)
Ohne Auslaut:
나는오늘내친구 와 영화를보러간다 .
Naneun oneul nae chinguwa yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meiner Freundin ins Kino.
Mit Auslaut:
나는 오늘 내 남동생과 영화를 보러간다.
Naneun oneul nae namdongsaenggwa yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meinem kleinen Bruder ins Kino.
Deutsche Präposition: mit
Koreanische Postposition: 하고 (-hago) → Komitativpartikel (geringerer Grad an Formalität)
Ohne Auslaut:
나는 오늘 내 친구하고 영화를 보러간다.
Naneun oneul nae chinguhago yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meiner Freundin ins Kino.
Mit Auslaut: (Form 하고 (-hago) bleibt unverändert)
나는 오늘 내 남동생하고 영화를 보러간다.
Naneun oneul nae namdongsaenghago yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meinem kleinen Bruder ins Kino.
Deutsche Präposition: mit
Koreanische Postposition: (이)랑 -(i)rang: → Komitativpartikel (informell)
Ohne Auslaut:
나는 오늘 내 친구랑 영화를 보러간다.
Naneun oneul nae chingurang yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meiner Freundin ins Kino.
57
Mit Auslaut:
나는 오늘 내 남동생이랑 영화를 보러간다.
Naneun oneul nae namdongsaengirang yeonghwareul boreoganda.
Ich gehe heute mit meinem kleinen Bruder ins Kino.
Deutsche Präposition: nach
Koreanische Postposition: (으)로 -(u)ro → Lokalpartikel (Richtungsmarkierung)
그녀는 기차를 타고 프랑크푸르트로 갔다.
Geunyeoneun kicharel tago peurangkeupureuteuro gatta.
Sie fährt mit dem Zug nach Frankfurt.
Deutsche Präposition: neben
Koreanische Postposition: 옆에 (-yeope) → Lokalpartikel
자동차가 집옆에 주차해 있다.
Jadongchaga chibyeope juchahe itta.
Das Auto parkt neben dem Haus.
Deutsche Präposition: über (Wechselpräposition)
Koreanische Postposition: 위에 (-uie) → Lokalpartikel
(1)
전등은 침대 위에 달려있다.
Jeondeungeun chimdaeuie dalyeo itta.
Die Lampe hängt über dem Bett.
(2)
나는 전등을 침대 위에 단다.
Naneun jeondeungeul chimdaeuie danda.
Ich hänge die Lampe über das Bett.
58
Deutsche Präposition: unter (Wechselpräposition)
Koreanische Postposition: 아래에 (-araee) → Lokalpartikel
(1)
개가 책상 아래에 누워있다.
Kaega chaeksang araee nuweo itta.
Der Hund liegt unter dem Tisch.
(2)
개가 책상 아래에 눕는다.
Kaega chaeksang araee numneunda.
Der Hund legt sich unter den Tisch.
Deutsche Präposition: von
Koreanische Postposition: 에서 (-eso) → Lokalpartikel (Richtungsmarkierung:
Ausgangspunkt: eine Person)
나는 지금 나의 오빠 집에서 온다.
Naneun chigeum naoe oppa chibeso onda.
Ich komme gerade von meinem Bruder.
Deutsche Präposition: von … aus
Koreanische Postposition: 에서 (-eso) → Lokalpartikel (Richtungsmarkierung: Ereignisort als
Ausgangspunkt)
모든 세미나가 베를린에서 계획된다.
Modeun seminaga bereulineso gyehoekdoenda.
Alle Seminare werden von Berlin aus organisiert.
59
Deutsche Präposition: von … bis
Koreanische Postposition: -(에서)부터 …까지 -(eso)buto … kkachi → Temporalpartikel
(Markierung eines Zeitraums)
우리는 오늘 두 시부터 열 시까지 일했다.
Urineun oneul du shibuteo yeolshikkaji ilhaetta.
Wir haben heute von zwei bis zehn Uhr gearbeitet.
Deutsche Präposition: von … bis
Koreanische Postposition: -(에서)부터 …까지 -(eso)buto … kkachi → Lokalpartikel (von
einem Ausgangsort zu einem Zielort)
서울에서부터 부산 까지는 자동차로 5시간 걸린다.
Seoulesobuto busankkachi jadongcharo 5 shigan keolinda.
Von Seoul bis Busan dauert es mit dem Auto fünf Stunden.
Deutsche Präposition: vor (Wechselpräposition)
Koreanische Postposition: 앞에 (-ape) → Lokalpartikel
(1)
자동차가 집 앞에 주차해 있다.
Jadongchaga chibape juchahe itta.
Das Auto parkt vor dem Haus.
(2)
나는 자동차를 집 앞에 주차한다.
Naneun jadongchareul chiape juchahanda.
Ich fahre das Auto vor das Haus.
60
Deutsche Präposition: zu
Koreanische Postposition: (으)로 -(u)ro → Lokalpartikel (Richtungsmarkierung in Richtung
eines Ortes)
나는 지금 비행장으로 간다.
Naneun jigeum bihaengjangeuro ganda.
Ich fahre jetzt zum Flughafen.
Deutsche Präposition: zu
Koreanische Postposition: 한테 (-hante) oder 에게 (-ege) → Lokalpartikel
(Richtungsmarkierung in Richtung einer Person)
(1)
나는 지금 내 친구한테 간다.
Naneun jigeum nae chinguhante ganda.
Ich fahre jetzt zu meiner Freundin.
(2)
나는 지금 내 친구에게 간다.
Naneun jigeum nae chinguege ganda.
Ich fahre jetzt zu meiner Freundin.
Deutsche Präposition: zwischen
Koreanische Postposition: 사이에 (-saie) → Lokalpartikel
자동차가 집 사이에 주차해 있다.
Jadongchaga chibsaie juchahe itta.
Das Auto parkt zwischen den Häusern.
61
Als Vergleichspartikeln fungieren im Koreanischen die Partikeln 만큼 ((-mankum) (so wie))
und 보다 ((-boda) (als)).
(1)
만큼 ((-mankum) (so wie))
에리카는 한스만큼 크다.
Erikaneun hanseumankum keuda.
Erika ist genauso groß wie Hans.
(2)
보다 ((-boda) (als))
에리카는 한스보다 작다.
Erikaneun hanseuboda chagda.
Erika ist kleiner als Hans.
4.0 Präpositionen in der Lernersprache koreanischer Deutschlerner
Im Rahmen einer empirischen Untersuchung von schriftlichen Texten koreanischer
Germanistikstudenten der Seouler Fremdsprachenuniversität (drittes und viertes Studienjahr)
wurde die Verwendung der deutschen Präpositionen durch koreanische Deutschlerner
überprüft. Die von den Studierenden verwendeten Präpositionen sind in der folgenden
Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben. Die Beschreibung und Klassifizierung der
Präpositionen erfolgt auf der Basis von Jochen Schröders „Lexikon deutscher Präpositionen“
(1986).
62
Präpositionen in der Interlanguage koreanischer Deutschlerner:
auf: lokal: Lokalisierung unter Bezugnahme auf eine Basisfläche
bis: temporal; vor Zeitadverbien, Uhrzeitangaben und Jahreszahlen
bei weitem: Graduierung eines Geschehens oder Sachverhalts
dank: Genitiv oder Dativ; kausal
durch: Markierung einer Kausalbeziehung
einschließlich: Genitiv; oftmals auch ohne erkennbaren Kasus; Angabe einer Menge-Teil-
Relation
für: temporal
gegen: 1. adversativ; in wenigen Fällen wie entgegen; 2. temporal (Angabe einer Zeitspanne
vor einem Zeitpunkt)
hinter: 1. lokal; 2. Sonderformen, z.B.: es faustdick hinter den Ohren haben
innerhalb: Genitiv; innerhalb von Dativ; Angabe/Markierung eines räumlichen
Lokalisationsbereichs
mit: 1. komitativ; 2. instrumental
nach: 1. Angabe eines zu erreichenden Lokalisationsbereichs (nach- oder vorangestellt); 2.
temporal
nahe: Dativ; lokale Bedeutung ; häufige Umschreibung in der Nähe von
ohne: Akkusativ; Angabe/Markierung des Nichtvorhandenseins/Fehlens von irgendetwas
oder irgendjemand
seit: Dativ; temporal
statt: Genitiv oder Dativ; Bedeutung vgl. anstatt (Stellvertretung)
trotz: konzessiv; mit Genitiv oder Dativ; entgegen einem Erwartungswert
von: Modifikation nach dem Substantiv; häufig in Verbindung mit einer Wahrnehmung oder
einer Fortbewegung ohne Direktion
während: Genitiv; temporal; bei Deverbativa
wegen: literatursprachlich mit Genitiv; umgangssprachlich häufig mit Dativ
zwischen: lokale Bedeutung; allgemeine Beziehungen: Wechselbeziehungen zwischen
verschiedenen Größen
63
Im Folgenden werden die von den Lernern verwendeten Präpositionen in ihrem
Verwendungskontext präsentiert. Dabei sind die Textproduktionen der Lerner mit einem (*)
markiert. Die linguistische Beschreibung der von den Lernern verwendeten Präpositionen
erfolgt erneut auf der Basis von Schröder (1986).
auf:
*Wir stiegen auf einen Hügel, von wo aus wir die Stadt überblicken konnten.
Bei der Präposition auf handelt es sich nach Schröder (1986, 67) um eine Lokalpräposition, in
deren Verwendungskontext der Bezugsbereich genannt wird, auf den eine Fortbewegung
gerichtet ist. Weitere Verwendungsbeispiele sind:
„Der Verkehrspolizist geht auf die Kreuzung.
Das Auto fährt auf den Marktplatz.
Er tritt auf den Flur/in den Flur.
Die Mutter sieht vom Fenster aus auf den Hof/in den Hof.
Martin Luther kam 1521 auf die Wartburg.
Im Sommer kommen viele Urlauber auf die Insel Rügen.“
Schröder (1986, 67)
bis:
*Die Kinder spielten im Garten bis es dunkel wurde.
Bei der Präposition bis handelt es sich nach Schröder (1986, 94) um eine
Temporalpräposition, die vor Zeitadverbien, Uhrzeitangaben und Jahreszahlen verwendet
wird und die Grenze einer abgelaufenen Zeitspanne angibt. Beispiele zur Illustration dieser
Verwendung sind:
„Bis heute war schönes Wetter.
Bis 19 Uhr werde ich auf dich warten.
Bis 1973 war die DDR noch nicht UNO-Mitglied.“
Schröder (1986, 94)
64
Schröder (1986, 94) weist darauf hin, dass die Präposition bis vor eigentlichen Zeitbegriffen
wie Tag, Woche, Monat oder Jahr stehen kann. In diesen Fällen wird in der Regel bis zu
verwendet. Während bis allein den Akkusativ regiert, verlangt bis zu den Dativ. Diese
Verwendung der Präposition bis kann durch folgende Beispiele illustriert werden:
„Bis (zum) Sonntag sind noch Ferien.
Bis Sonntag, den 31. August … (AKK)
Bis zum Sonntag, dem 31. August … (DAT)
Bis (zum nächsten) nächstes Jahr will er mit seiner Arbeit fertig sein.
Bis Ende August hat er noch Urlaub.“
Schröder (1986, 94)
bei weitem:
*Der Herbst ist bei weitem die schönste Jahreszeit.
Bei weitem wird nach Schröder (1986, 91) zur Graduierung eines Geschehens oder
Sachverhalts verwendet. Weitere Verwendungsbeispiele sind:
„Sie ist bei weitem die Fähigste (von allen Studenten dieser Gruppe).
Ich habe dir bei weitem (längst) noch nicht alles gesagt.
Die Romane Fontanes übertreffen seine Balladen bei weitem (um vieles).“
Schröder (1986, 91)
dank:
*Dank ihrer Hilfe konnte ich das Deutschlehrbuch verbessern.
Bei der Präposition dank handelt es sich nach Schröder (1986, 98) um eine kausale
Präposition, bei der die Präpositionalphrase eine vom Sprecher positiv beurteilte
Voraussetzung angibt. Die folgenden Beispiele illustrieren die Verwendung der Präposition
dank:
„Dank ihrem guten Zeugnis wurde sie immatrikuliert.
Dank der vorzüglichen Ausstattung entwickelte sich das Institut schnell.“
Schröder (1986, 98)
65
durch:
*Es gibt eine Lösung der Wohnungsfrage durch die neu gebauten Häuser und die
Entwicklung des Verkehrs.
Die Präposition durch wird nach Schröder (1986, 102f.) zumeist kausal verwendet. Dabei
ermöglicht das im Adverbialsubstantiv gegebene Geschehen den im Satz ausgedrückten
Sachverhalt. Die folgenden Beispiele mögen die Verwendung der Präposition durch
verdeutlichen:
„Er hatte durch übermäßiges Rauchen seiner Gesundheit geschadet.
→Indem er übermäßig geraucht hatte, …
→Weil er übermäßig geraucht hatte, …
Durch Rationalisierung kann man die Arbeitsbedingungen verbessern.
→Indem man rationalisiert, …
→Wenn man rationalisiert, …
Durch Fleiß, Beharrlichkeit und Ausdauer hatte er diese Leistungen erzielt.
Er erfuhr durch Zufall (zufällig), dass sein Freund krank war.
Durch Schaden wird man klug.“
Schröder (1986, 102f.)
einschließlich:
*Die Menschen können die vielen Tiere einschließlich der Löwen sehen.
Die Präposition einschließlich wird nach Schröder (1986, 105) zumeist mit dem Genitiv
verwendet und markiert eine Teil-Ganzes-Relation. Die Verwendung dieser Präposition kann
durch die folgenden Beispielsätze illustriert werden:
„Der Preis versteht sich einschließlich der Verpackung/des Portos.
Der neue Wagen kostet einschließlich des Zubehörs über 23000 Mark.“
Schröder (1986, 105)
66
für:
*Für die Olympischen Spiele werden die notwendigen Einrichtungen gebaut.
Die Präposition für markiert nach Schröder (1986, 110) in Verbindung mit einem Zeitbegriff
in der für-Phrase ein (verdecktes) Geschehen. Die folgenden Beispielsätze illustrieren diese
Verwendung:
„Er hob sich sein Frühstück für die Mittagspause auf.
(um es in der Mittagspause zu essen)
Er hatte eine kleine Summe für die Zukunft zurückgelegt.
(um sie in der Zukunft zu nutzen)
Sie hatte die Wanderschuhe für den Urlaub gekauft.“
Schröder (1986, 111)
gegen:
*Es ist eine unangenehme Sache, wenn die Bürger gegen ihren Staat demonstrieren.
*Die Menschen können gegen den Willen Gottes nichts bewirken.
Die Präposition gegen wird häufig adversativ und bisweilen ähnlich wie entgegen verwendet.
Die folgenden Beispiele können dies illustrieren:
„Gegen den Befehl hatte er den Posten verlassen.
Entgegen dem Befehl hatte er den Posten verlassen.
Was du da tust, ist gegen jede Abmachung.
Was du da tust, ist entgegen jeder Abmachung.“
Schröder (1986, 118)
Nach Schröder (1986, 114) kann die Präposition gegen auch temporal verwendet werden. In
diesen Fällen wird mit gegen eine Zeitspanne angegeben, die unmittelbar vor einem Zeitpunkt
oder einer als Zeitpunkt zu verstehenden Zeitspanne liegt. Von den koreanischen Lernern
wurde gegen in diesem Sinne lediglich einmal verwendet:
*Das Flugzeug landet gegen vier Uhr.
67
Weitere Beispiele wären:
„Wir kommen gegen 16 Uhr (umgangssprachlich: gegen vier) zum Kaffee.
Gegen Morgen schlief er schlecht.
Gegen Ende der langen Versammlung wurde es immer unruhiger.
gegen Mittag
gegen Abend
gegen Mitternacht
nicht: *gegen Frühe, gegen Vormittag, gegen Nachmittag, gegen Nacht, gegen Tag“
Schröder (1986, 114)
hinter:
*Brecht sagt mit diesem Gedicht, dass viele Menschen hinter diesen berühmten Menschen
stehen.
*Sie versteckt das Gefühl hinter einer Fassade.
Nach Schröder (1986, 124) kann die Präposition hinter sowohl lokal als auch in
Sonderformen verwendet werden. Mögliche Sonderformen sind:
„hinter etwas/hinter jemandem stehen (zu jemandem halten)
hinter etwas zurückbleiben/hinter jemandem zurückbleiben (z.B. in der Leistung)
hinter jemandem/hinter etwas her sein (jemanden verfolgen/begehren; etwas besitzen wollen)
jemanden hinter sich (Dativ) lassen (jemanden in der Leistung übertreffen)
sich hinter einer Ausrede/hinter jemandem verschanzen (etwas/jemandes Meinung als
Ausrede benutzen)
etwas hinter jemandes Rücken tun (etwas tun, ohne dass derjenige es weiß)
es faustdick hinter den Ohren haben (verschlagen sein)“
Schröder (1986, 124)
68
Innerhalb:
*Jedesmal wenn es klingelt, bellt der Hund innerhalb des Hauses.
Schröder (1986, 139f.) bezeichnet innerhalb als eine Präposition zur Markierung eines
räumlichen Lokalisationsbereichs. Während innerhalb allein mit dem Genitiv stehe und bei
Ortsnamen verwendet werde, werde innerhalb von zusammen mit dem Dativ verwendet.
Folgende Beispiele können zur Illustration dienen:
„Der Stadttarif gilt nur innerhalb Leipzigs/innerhalb von Leipzig.
Das Rauchen ist innerhalb dieses Betriebes verboten.
Bei Bezugnahme auf die Grenzen eines Gebietes
Gegensatz: außerhalb
Der Stadttarif gilt nur innerhalb der Stadtgrenzen.
Wird der Spieler innerhalb der Strafraummarkierung gefoult, gibt es einen Elfmeter.
Innerhalb seiner vier Wände fühlt er sich am wohlsten.“
Schröder (1986, 139f.)
mit (komitativ):
*Mit wem gingst du nach Chejudo?
mit (instrumental):
*Ich fuhr mit der Eisenbahn nach Pusan und von dort mit dem Schiff nach Chejudo.
Die Präposition mit kann nach Schröder (1986, 146-150) entweder komitativ oder aber
instrumental verwendet werden. Bei der komitativen Verwendung wird in der mit-Phrase ein
Begleiter genannt, während bei der instrumentalen Verwendung ein intentional oder nicht
intentional gebrauchter Gegenstand genannt wird. Die folgenden Beispiele mögen diese
Verwendungen illustrieren:
69
mit (komitativ):
„Inge ging (zusammen) mit ihrem Mann ins Konzert.
→Inge und ihr Mann gingen ins Konzert.
→Inge ging in Begleitung ihres Mannes ins Konzert.
Die Mutter ging mit ihrer Tochter Bärbel das erste Mal in die Schule.
→Bärbel ging in Begleitung ihrer Mutter das erste Mal in die Schule.
→Bärbel und ihre Mutter gingen (zusammen) in die Schule.“
Schröder (1986, 150)
mit (instrumental):
„→Er löste die Mutter mit einem Schraubenschlüssel, nachdem er sie mit dem Hammer
gelockert hatte.
→Sie wäscht die Buntwäsche mit der Waschmaschine.
→Sie schrieb den Artikel mit der Maschine, die Unterschrift aber mit dem Kugelschreiber.
→Zu Ehren des hohen Gastes schoss man mit Kanonen Salut.“
Schröder (1986, 146)
nach:
*Ich hoffe, dass du die Gelegenheit hast, nach Chejudo zu fahren.
*Heutzutage kommen zahlreiche Touristen nach Korea.
Nach Schröder (1986, 155) kann die Präposition nach zum einen verwendet werden, um
einen zu erreichenden Lokalisationsbereich anzugeben. Dabei stehe die Präposition nach in
der Regel vor artikellosen Ortsnamen sowie Länder-, Landschafts- und Kontinentnamen.
Beispiele hierfür sind:
„Er fuhr nach Frankfurt.
Sie wollen im Urlaub nach Thüringen.
Millionen Europäer wanderten nach Übersee aus.
Diese Autobahn führt nach Polen.
Der Mensch drang immer weiter nach Norden vor.
Die Bauarbeiter der Baikal-Amur-Magistrale arbeiteten sich immer weiter nach Osten vor.
Schröder (1986, 155)
70
Die Präposition kann nach Schröder (1986, 156) auch temporal verwendet werden. In diesem
Fall werde mit nach eine Zeitspanne wiedergegeben, die bereits vergangen sei, wenn das
Satzgeschehen stattfinde. Diese Verwendungsmöglichkeit illustrieren die folgenden Beispiele:
*Nach der Zusammenarbeit konnten die Schüler schon viel besser Deutsch sprechen.
„Nach dem Regen begann alles zu grünen.
Unser Besuch kommt erst nach dem Essen/nach Tisch.
Heinrich Heine starb 1856 nach langem schwerem Leiden.
Nach einigen Sekunden absoluter Ruhe erhielt der Künstler den wohlverdienten Beifall.
Nach ein paar Tagen kam er wieder.“
Schröder (1986, 156)
Nach kann nach Schröder (1986, 159) auch als Satzadverbiale verwendet werden. In diesem
Fall stehe nach bei Substantiven, die sich auf persönliche Meinungen oder Gefühle beziehen
und werde zumeist zusammen mit Possessivpronomen verwendet. Dies zeigen die folgenden
Beispiele:
„Meiner Meinung nach hat die Ligamannschaft gegen den Meister durchaus eine Chance.
Nach meiner Meinung hat die Ligamannschaft gegen den Meister durchaus eine Chance.
Meiner Meinung nach ist es so, dass …“
Schröder (1986, 159)
nahe:
*Der Berg ist nahe der nordkoreanischen Hauptstadt.
Bei der Präposition nahe handelt es sich nach Schröder (1986, 160) um eine
Lokalpräposition, auf die der Dativ folgt und die häufig durch in der Nähe (von) umschrieben
wird. Die folgenden Beispiele illustrieren dies:
Wir wohnten nahe dem Bahnhof.
Nahe der Elbe gestaltete man neue Grünanlagen.
Schröder (1986, 160)
71
Ohne:
*Ohne das Auto wird er nicht pünktlich ankommen.
Bei der Präposition ohne handelt es sich um eine Instrumentalpräposition, die zusammen mit
dem Akkusativ steht. Dabei werde nach Schröder (1986, 162) durch ohne auf das
Nichtvorhandensein von irgendetwas oder irgendjemand verwiesen. Die Verwendung der
Präposition ohne illustrieren die folgenden Beispiele:
„Ohne Schlüssel kannst du die Tür nicht öffnen.
(Wenn du keinen Schlüssel hast, kannst du die Tür nicht öffnen.)
Er wird nicht ohne Wagen nach Berlin fahren.
(Er wird nicht nach Berlin fahren, wenn er keinen Wagen hat/bekommt.)“
Schröder (1986, 163)
seit:
*Ich habe keine Nachricht von ihm bekommen, seit er nach Daejon umgezogen ist.
Bei der Präposition seit handelt es sich um eine Temporalpräposition, die den Dativ regiert.
Dabei geben die seit-Adverbialien nach Schröder (1986, 166f.) wieder, „dass ein Geschehen
in einer Zeitspanne verläuft, die in der Vergangenheit begonnen hat und bis zur
Sprechergegenwart reicht“. Voraussetzung für die Verwendung der Präposition seit ist das
Vorhandensein eines durativen Verbs. Die folgenden Beispiele illustrieren die Verwendung
der Präposition seit:
„Seit 1973 ist die DDR Mitglied der UNO.
Seit drei Wochen gehört Elke zu unserer Klasse.
Seit Goethe haben sich immer wieder Schriftsteller am „Faust“ versucht.
Seit vorgestern/gestern/heute.“
Schröder (1986, 167)
72
statt:
*Wenn die Eltern ihren Kindern statt ihrer Echtheit nur ihre Unechtheit zeigen, verhalten sich
die Kinder bald unnatürlich und gekünstelt.
Die Präposition statt wird zumeist zusammen mit dem Genitiv verwendet und regiert in
wenigen Fällen den Dativ:
(An)statt eines Mopeds kaufte er sich ein Motorrad.
Statt des Ministers sprach der Staatssekretär.
Schröder (1986, 169)
Die Präposition statt kann in den meisten Fällen gleichbedeutend mit anstatt verwendet
werden, das den Genitiv regiert und dabei eine Stellvertretung ausdrücken. In diesen Fällen
werde in der Präpositionalphrase der allgemein übliche oder ursprünglich geplante
Gegenstand oder die Person genannt, die einen Austausch oder eine Stellvertretung erfährt.
Anstatt eines Geschenkes lade ich dich ins Theater ein.
→Anstatt dir ein Geschenk zu machen, …
Schröder (1986, 61)
Statt oder anstatt ohne direkte Kasusanforderung erlaube die Einbettung unterschiedlicher
Adverbialien. Die Präposition habe in diesen Fällen eine eher konjunktionale Funktion.
„Anstatt vor dem Kino trafen wir uns erst im Saal.
Anstatt beim Arbeiten fand ich ihn eingeschlafen.
Anstatt mit dem Hammer schlug er mit dem Schraubenschlüssel gegen die zu fest sitzende
Mutter.
Anstatt über Goethe sprach er über Schiller.“
Schröder (1986, 61)
73
trotz:
*Der Sportmeister hat trotz der Verletzung den Tenniswettkampf gewonnen.
Die Präposition trotz wird konzessiv verwendet und regiert den Genitiv oder den Dativ. Dabei
wird auf ein Ereignis Bezug genommen, das entgegen einem Erwartungswert stattfindet (vgl.
Schröder 1986, 169). In dem trotz-Adverbial werde der objektive oder subjektive Umstand
angegeben, der die nicht erwartete Folge oder Wirkung zeige. Diese Verwendungsweise
zeigen die folgenden Beispiele:
„Bei dichtem Nebel kamen sie trotz der Markierungsbojen vom Kurs ab.
Trotz allen Fleißes erreichte die das Ziel der Klasse nicht.
Trotz dem Verbot des Schwimmmeisters ging der Nichtschwimmer in das Becken.
Mit der, aller, alle nur mit DAT
Trotzdem/trotz alledem/trotz allem gelang der Mannschaft der Sieg.“
Schröder (1986, 170)
von:
*Von diesem Berg aus kann man bis nach Seoul schauen.
Die Präposition von wird nach Schröder (1986, 200) häufig zur Markierung eines
Ausgangsbereichs (als Grenzbereich) verwendet. Die Verwendung der Präposition von stehe
in diesen Fällen in Verbindung mit einer Wahrnehmung oder einer Fortbewegung ohne
Direktion. Dies zeigen die folgenden Beispiele:
„Von diesem Turm aus kann man weit sehen. Wir gehen von hier aus zu Fuß. Von Leipzig aus fahren wir mit dem Zug.“ Schröder (1986, 200) während: *Während der Landung des Flugzeugs darf man nicht rauchen. Die Temporalpräposition während regiert den Genitiv und steht nach Schröder (1986, 217)
„kaum bei eigentlichen Zeitbegriffen“. Die Präposition verbinde sich häufig mit Deverbativa,
die eine Handlung oder ein Ereignis wiedergeben, das zeitgleich mit einem im Satz
ausgedrückten Geschehen stattfindet. Daneben finde sich die Präposition während auch bei
74
temporal begrenzten Substantiven. Die folgenden Beispiele mögen die Verwendungsweise
der Präposition während illustrieren:
„Während des Vortrags (umgangssprachlich: während dem Vortrag)/beim Vortrag ist es unhöflich zu sprechen. Während des Essens/im Verlaufe des Essens wurden mehrere Toasts ausgebracht. Er besuchte während seines Aufenthalts/bei seinem Aufenthalt/im Verlaufe seines Aufenthalts in der Stadt alle Museen.“ Schröder (1986, 217ff.) wegen: *Nun war der Schmied sehr müde wegen des Laufens. *Er konnte nicht mehr stehen vor den Augen der Elisabeth wegen seiner Müdigkeit. *Erstens habe ich fleißig arbeiten müssen. Zweitens habe ich eine Reise machen wollen, aber wegen des heißen Wetters habe ich nichts gemacht. *Wegen des starken Regens habe ich keine Reise gemacht. Die Präposition wegen wird nach Schröder (1986, 219) literatursprachlich zumeist zusammen
mit dem Genitiv, umgangssprachlich jedoch häufig zusammen mit dem Dativ verwendet.
Wegen wird vor allem verwendet, um zu markieren, dass Handlungen, Vorgänge oder
Zustände für ein Geschehen verantwortlich gemacht werden. Wegen kann in einigen Fällen
durch aufgrund ersetzt werden. Die folgenden Beispiele illustrieren die Verwendungsweise
der Präposition wegen:
„Wegen des starken Schneefalls musste der Straßenwinterdienst eingesetzt werden. Wegen seiner Krankheit konnte er die Arbeit nicht termingemäß abschließen. Wegen des starken Gewitters war er viel zu spät gekommen. Ich musste die Fahrt wegen eines Motorschadens unterbrechen. Wegen Mangel(s) an Beweisen wurde er freigesprochen.“ Schröder (1986, 241) zwischen: *Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Texten liegt darin, ob man außer dem Gebet noch etwas für die christlichen Ideen tut oder nicht. *Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Christentum und dem Buddhismus. Die Lokalpräposition zwischen wird nach Schröder (1986, 240) eingesetzt, um eine Lokalisation innerhalb von zwei oder mehr Körpern oder Flächen zu markieren. „Die Blumenbank steht zwischen Schrank und Tisch. Sie saß zwischen meinem Freund und mir.
75
Zwischen Berlin und Prag gibt es noch keine Autobahnverbindung. Zwischen der DDR, Schweden und Dänemark bestehen Fährverbindungen.“ Schröder (1986, 241) Nach Schröder (ebd.) kann eine Begrenzung auch durch Substantive im Plural oder durch Mengenbegriffe markiert sein: „Wir gingen zwischen den Buden des Weihnachtsmarktes auf und ab. Das Lesezeichen steckt zwischen den Buchseiten. Zwischen den Kiefern stehen einige Birken. Sie saß zwischen uns. Es wächst viel Unkraut zwischen der Petersilie. Sie stand zwischen ihren Schülern.“
Schröder (1986, 241) Eine weitere Verwendungsmöglichkeit der Präposition zwischen besteht nach Schröder (ebd.)
darin, Größen zueinander in Beziehung setzen zu können und Wechselwirkungen zwischen
ihnen zu markieren:
„Zwischen dir und mir/zwischen uns gibt es keine Beziehungen mehr. Der Rechtsanwalt versuchte, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Zwischen ihr und ihm/zwischen den beiden/zwischen ihnen wurden Blicke gewechselt/Meinungen ausgetauscht. Ein Elfmeterschießen hatte zwischen den beiden Mannschaften zu entscheiden. Für die Urlaubsreise musste sie zwischen Flug oder Bahnfahrt wählen.“ Schröder (1986, 241) 5.0 Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurden die Präpositionen des Deutschen und die Postpositionen des
Koreanischen einander kontrastiv gegenübergestellt. Dabei wurden die Präpositionen als eine
nicht flektierende und nicht satzgliedfähige Wortart definiert, die einen bestimmten Kasus
regiert. Das Auftreten von Präpositionen in Präpositionalphrasen und Präpositionalgefügen
wurde beschrieben und analysiert. Hinsichtlich der Etymologie von Präpositionen wurde
dafür plädiert, neben einer synchronen auch eine diachrone Perspektive einzunehmen. In
Anlehnung an Althaus et al. (1980) wurde die auf den Einfluss der gesprochenen Sprache
zurückzuführende Tendenz zur Ausklammerung von Präpositionalphrasen dargestellt. Mit
Peschel (2012) wurden die gebundenen Präpositionen als eine besondere Lernschwierigkeit
auf syntaktischer und semantischer Ebene beschrieben und festgestellt, in welchen
76
Grammatiken die Behandlung der gebundenen Präpositionen eine besondere
Berücksichtigung erfährt.
Für das Koreanische als einer agglutinierenden OV-Sprache aus der ural-altaischen
Sprachfamilie wurden die postpositionierten Partikeln als Partikeln beschrieben, die entweder
der Kasusmarkierung dienen können oder aber als Postpositionspartikeln ähnlich wie die
deutschen Präpositionen fungieren. Für die Nominativpartikeln konnte festgestellt werden,
dass neben ausschließlich als Kasuspartikeln fungierenden Partikeln auch Quasi-
Nominativpartikeln existieren, die die pragmatische Funktion der Honorativmarkierung
erfüllen. Entsprechendes gilt auch für die Dativmarkierung. Es wurde zudem darauf
hingewiesen, dass neben den Kasuspartikeln und den analog zu den deutschen Präpositionen
fungierenden Postpositionspartikeln mit den Topik- und Delimiterpartikeln Hilfspartikeln mit
weitgehend pragmatischer Funktion existieren.
Anhand von Satzbeispielen wurden exemplarisch diejenigen koreanischen
Postpositionspartikeln illustriert, die in ihrer Funktion weitegehend den deutschen
Präpositionen entsprechen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die koreanischen
Postpositionspartikeln keine Kasusabhängigkeit aufweisen, sondern vornehmlich nach ihrer
Bedeutung zu differenzieren sind.
In einem letzten Schritt wurden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von
schriftlichen Texten koreanischer Germanistikstudenten der Seouler
Fremdsprachenuniversität präsentiert. Diese Texte wurden hinsichtlich der Verwendung der
deutschen Präpositionen in der Interlanguage koreanischer Deutschlerner überprüft. Dabei
ergab sich ein Vorkommen der folgenden Präpositionen:
Auf, bis, bei weitem, dank, durch, einschließlich, für, gegen, hinter, innerhalb, mit, nach,
nahe, ohne, seit, statt, trotz, von, während, wegen, zwischen.
Diese von den Lernern verwendeten Präpositionen wurden in ihrem Verwendungskontext
präsentiert. Die linguistische Beschreibung und Analyse der verwendeten Präpositionen
erfolgte auf der Basis von Schröder (1986).
77
6.0 Literatur
Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst: Lexikon der Germanistischen
Linguistik. 2. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen 1980.
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Band 4. 8. überarbeitete
Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich
2009.
Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. 3. Durchgesehene
Auflage. Stuttgart 2006.
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. 13. durchgesehene Auflage. Leipzig 1991.
Hoberg, Ursula/Hoberg, Rudolf: Der kleine Duden - Deutsche Grammatik. 4. vollständig
überarbeitete Auflage. Mannheim 2009.
Kim, Young-Soon: „Hierarchie und Linearität im Kasuspartikelsystem des Koreanischen“. In:
Philologie im Netz 8 (1999), 10-26.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch Band 2. 4. neubearbeitete Auflage.
Heidelberg 1985.
Peschel, Corinna: „Gebundene Präpositionen - (k)ein Bereich für Wahlmöglichkeiten und
Zweifelsfälle?“ In: Der Deutschunterricht 1 (2012), 48-57.
Risel, Heinz: Grammatik kompakt. Stuttgart 2007.
Schröder, Jochen: Lexikon deutscher Präpositionen. Leipzig 1986.
Ulrich, Winfried: Wörterbuch Linguistische Grundbegriffe. 2. neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Kiel 1975.
78
V. Adverbien und Adverbialien im Deutschen und Koreanischen -
Schwierigkeiten des Erwerbs der deutschen Adverbien und Adverbialien
durch koreanische Lerner des Deutschen
1.0 Einleitung
Nach Bußmann (1983, 8) handelt es sich bei den Adverbien um diejenige Wortart, „die der
semantischen Modifizierung von Verben, Adjektiven, Adverbialen und ganzen Sätzen dient“.
Adverbien gehören zu den nicht flektierbaren Wortarten und werden zur Untergruppe der
Partikeln gerechnet. Kaltenbacher (1996, 8) geht davon aus, dass sich Adverbien als
heterogene Wortart „am besten durch ihre syntaktische Leistung“ charakterisieren lassen.
Adverbien können allein Satzglied sein, sind jedoch weder satzbildend noch flektierbar. In
dieser Hinsicht ergibt sich neben einer Affinität zu den Präpositionen und Konjunktionen
auch eine Übereinstimmung mit den Partikeln und Modalwörtern und ein
merkmalsspezifischer Kontrast zu den Wortarten der Verben, Substantive und Adjektive.
Nach Kaltenbacher (1996, 9) können Adverbien als Adverbialbestimmungen und Prädikative
Satzglieder und als Attribute Satzgliedteile repräsentieren und nehmen eine „Zwitterstellung
zwischen Autosemantika und Funktionswörtern“ ein.
Hoffmann (2007, 223) rechnet zu den Adverbien diejenigen Ausdrücke, „mit denen ein
propositionaler oder prädikativer Gehalt in integrativer Kombination spezifiziert werden
kann“. Einige Adverbien bildeten zusammen mit einem Kopulaverb den Ausdruck einer
Prädikation und leisteten dabei „einen zentralen Beitrag zum Gehalt der Prädikation“
(Hoffmann ebd.). Hinsichtlich ihrer möglichen Satzpositionen sei feststellbar, dass Adverbien,
anders als Abtönungs- oder Negationspartikeln, auch das Vorfeld eines Satzes besetzen
könnten (vgl. Hoffmann 2007, 224). Die meisten Adverbien seien zudem mithilfe von
Frageadverbien erfragbar:
temporal: jetzt, heute, damals, einst → wann?
lokal: da, hier, dahinter, drüben, links, nirgends, oben → wo?
frequentativ/iterativ: einmal, immer, oft, samstags, wieder → wie oft?
durativ: bisher, weiterhin, zeitlebens → wie lange?
final: dafür, dazu → wofür, wozu?
kausal/konditional: daher, deshalb, gegebenenfalls, sonst → weshalb? warum?
instrumental/komitativ: hiermit, damit → womit?
79
modifikativ (Art und Weise): anders, blindlings, so, gern → wie?
direktional: bergauf, dorthin, fort, querfeldein → wohin?
(Hoffmann 2007, 224)
Während „Adverbien, die der Form nach mit den Adjektiven übereinstimmen“
(Adjektivadverbien) „alle Möglichkeiten der Graduierung“ besitzen (vgl. Helbig/Buscha
1986, 136), gilt insgesamt eine eingeschränkte Graduierbarkeit der Adverbien. Gelegentlich
lasse sich eine vorgenommene Graduierung jedoch auch noch verstärken:
Der Betrieb arbeitet am allerbesten.
Weinrich (1993, 552) geht davon aus, dass zur Steigerung bzw. Nuancierung eines „Adjektivs
oder Adverbs als Applikations-Basis“ das adverbiale Applikat der Basis immer vorausgehe:
Das Wetter ist sehr gut.
Ich habe noch gestern den Rasen gemäht.
Hinsichtlich der Graduierung von Adverbien kann laut Weinrich (1993, 551) festgestellt
werden, dass diese zum Teil unregelmäßig mithilfe anderer Wortformen vorgenommen
werde.
Positivstufe Komparativstufe Superlativstufe viel/sehr mehr am meisten gern lieber am liebsten wenig weniger am wenigsten wohl wohler am wohlsten (bald) eher am ehesten oft öfter(s) (am häufigsten)
(Weinrich 1993, 551)
80
2.0 Adverbien und Adverbialien im Deutschen
Bußmann (1983, 9) bezeichnet als „Adverbale“ diejenigen „Präpositionen und Adverbien, die
sich semantisch auf das Verb beziehen (hoffen auf, gut aussehen).“ Daneben existiere die
Gruppe der Adverbialadjektive, bei denen es sich um aus Adverbien abgeleitete Adjektive
handele, die jedoch nur attributiv, nicht jedoch prädikativ zu verwenden seien (sein heutiger
Entschluss). Satzglieder, die „einen Sachverhalt hinsichtlich Zeit, Ort, Art und Weise u.a.
charakterisieren“, sind nach Bußmann (ebd.) als Adverbiale zu bezeichnen. Entsprechend der
traditionellen Grammatik sei zwischen temporalen, lokalen, modalen, kausalen, konditionalen
und konsekutiven Adverbialien zu differenzieren. Eine weitere Differenzierung der
Adverbialien ergibt sich nach Bußmann (ebd.) hinsichtlich ihrer Valenz. So sei zwischen
valenznotwendigen (obligatorischen) und valenzmöglichen (fakultativen) Adverbialien zu
differenzieren. Entsprechend der valenzgrammatischen Terminologie werde begrifflich auch
zwischen den obligatorischen Adverbialergänzungen und den fakultativen Adverbialangaben
differenziert.
Helbig/Buscha (1986) differenzieren die „aus einem, mehreren Wörtern oder einem Satz“
bestehenden Adverbialien in Temporal-, Lokal-, Modal- und Kausaladverbiale und nehmen
eine spezifischere Differenzierung insbesondere der Modal- und Kausaladverbialien vor. So
seien zu den Modaladverbialien auch die Verneinungen (Wir riefen nicht an), die Angaben
zum Ausmaß einer Handlung (Wir freuen uns sehr) und die Angaben zum Mittel (Wir fahren
mit dem Auto) zu rechnen. Zu den Kausaladverbialien gehörten u.a. auch die Angaben zum
Zweck (Wir fuhren zur Erholung nach München), die Angaben zur Folge (Du singst zum
Davonlaufen), die Angaben zur Bedingung (Bei Regen bleiben wir zu Hause) und die
Angaben zur Einräumung eines Gegengrundes (Trotz des Regens kamen wir).
Heinle (2004) beschreibt, dass die Gliederung der Adverbien traditionell entweder
vorwiegend semantisch oder aber morphosyntaktisch erfolge. So werde häufig zwischen
„reinen Adverbien im Sinne von Autosemantika“ (Heinle 2004, 28) und „verschiedenen Arten
von Pronominaladverbien (demonstrativ, interrogativ, relativ, indefinit) differenziert.
Hinsichtlich der Wortbildung seien Zusammensetzungen bestehend aus Adverbien und
anderen Wortarten möglich. So gebe es beispielsweise Zusammensetzungen von Adverbien
wie da, hier oder wo mit Präpositionen wie an, auf, aus, bei, für und mit, die zumeist eine
lokale Bedeutung hätten und demonstrativ, relativ und interrogativ verwendet werden
könnten. Diese Gruppe von Adverbien werde als Pronominaladverbien bezeichnet. Bei einer
weiteren Gruppe, den Konjunktionaladverbien (z.B. (je)doch oder gleichwohl) erfülle ein
81
Adverb in Erststellung vor dem finiten Verb die Funktion einer koordinierenden Konjunktion
(vgl. Heinle 2004, 22).
Eine noch differenziertere Gliederung der Adverbien findet sich bei Hoffmann (2007), der
zwischen den folgenden Adverbien unterscheidet:
Positions-Adverbien
Dimensions-Adverbien
Direktions-Adverbien
Präpositional-Adverbien
Tempus-Adverbien
Sequenz-Adverbien
Frequenz-Adverbien
Status-Adverbien
Modal-Adverbien
Deskriptions-Adverbien
Evaluations-Adverbien
Grad-Adverbien
Schätz-Adverbien
Intensitäts-Adverbien
Fokus-Adverbien
Argumentations-Adverbien (mit den Untergruppen der Geltungs- und Nexus-Adverbien)
Hoffmann (2007, 557) betrachtet die Positions-Adverbien da, hier und dort als diejenigen
Adverbien, die „die Position der kommunikativen Dyade schlechthin“ bezeichnen und
geeignet sind, „die ganze Gesprächssituation in ihrer leiblich-räumlichen Konfiguration“ zu
beschreiben.
Ich rufe nur mal an, um zu sehen, ob du da bist.
Ja, komm nur vorbei, ich bin bestimmt da.
(Hoffmann 2007, 557)
Im Gegensatz zu den Positions-Adverbien da und dort werde das Positions-Adverb hier
eingesetzt, „um eine Äußerung innerhalb der kommunikativen Dyade ausdrücklich beim
Sprecher zu situieren“ (Hoffmann 2007, 561). Die Dimensions- und Direktionsadverbien sind
82
nach Hoffmann (2007, 563f.) als Untergruppen der Positions-Adverbien zu klassifizieren,
wobei für die Dimensions-Adverbien eine Spezifizierung nach den „Dimensionen der
Leiblichkeit“ und eine Organisation nach Oppositionspaaren charakteristisch sei. Die
Dimensionen der Leiblichkeit würden dabei durch die Kategorien Frontalität (vorne/hinten),
Vertikalität (oben/unten), Lateralität (rechts/links) und Interiorität (innen/außen) spezifiziert.
Die Organisation in Oppositionspaaren lässt sich nach Hoffmann (2007, 563) anhand der
folgenden Beispielsätze illustrieren:
Das Haus hat vorne einen Erker und hinten einen Balkon.
Die Vorderfront ist oben mit Holz verkleidet und unten weiß getüncht.
Die Wände sind auch von innen isoliert.
Können wir mal nach oben gehen?
Bei den Präpositional-Adverbien handelt es sich nach Hoffmann (2007, 568) um
Kombinationen aus Positions-Adverbien und geläufigen Präpositionen (z.B. dahinter,
daneben), wobei letztere in der Kombination die zweite Position einnehmen. Eine
Kombination mit Präpositionen ist auch im Bereich der Direktions-Adverbien (hinauf,
herüber) möglich. Tempus-Adverbien haben nach Hoffmann (2007, 572) die „primäre
Funktion, einen Sachverhalt von der Zeit her zu determinieren“. Als Gruppen von Tempus-
Adverbien lässt sich zwischen Tempus-Adverbien im engeren Sinne (zunächst, dann,
übermorgen, vorhin), Sequenz-Adverbien (vorher, zuerst, schon) und Frequenz-Adverbien
(immer, oft, stets, zeitlebens, fortwährend etc.) differenzieren.
Status-Adverbien dienen nach Hoffmann (2007, 582) dazu, „einen Sachverhalt auf
verschiedene Aspekte der Situation einzustellen“. Der Sachverhalt erhalte dadurch im Text
einen „hinsichtlich seiner Form, Qualität, Quantität oder bezüglich seines Informationswertes
gekennzeichneten Status“ (vgl. Hoffmann ebd). Das wichtigste Adverb dieser Gruppe sei das
Rahmen-Adverb so.
Hoffmann (2007, 586) gliedert die Modal-Adverbien in Deskriptions- (umsonst, vergebens,
insgeheim) und Evaluations-Adverbien (gern, leider, hoffentlich). Während Deskriptions-
Adverbien im Wesentlichen dazu dienten, die Art und Weise eines Sachverhalts zu
differenzieren, werde durch Evaluations-Adverbien eine wertende Einstellung des Sprechers
zum Ausdruck gebracht.
83
Grad-Adverbien mit ihren Untergruppen, den Schätz- und Intensitäts-Adverbien, dienen laut
Hoffmann (2007, 590) dazu, einen Sachverhalt hinsichtlich seines quantitativen Status zu
determinieren. Dabei hätten Schätz-Adverbien (etwa, ungefähr, schätzungsweise, circa) die
Funktion, einen quantitativen Umfang zu bezeichnen, während durch Intensitäts-Adverbien
(sehr, ziemlich, ausgesprochen) in erster Linie der Ausprägungsgrad einer bestimmten
Eigenschaft markiert werde.
Fokus-Adverbien (hauptsächlich, insbesondere, verzugsweise, besonders, vornehmlich,
namentlich) haben nach Hoffmann (2007, 595) die primäre Funktion, aus einer Menge
vergleichbarer Elemente eines hervorzuheben. Sie trügen daher das Merkmal [+
AUFFÄLLIGKEIT].
Hoffmann (2007, 598) nimmt eine Differenzierung der Gruppe der Argumentations-
Adverbien, die dazu dienen, „Argumente zu Argumentationsketten zu verbinden“, in die
Untergruppen der Geltungs- (wirklich, vermutlich) und der Nexus-Adverbien (deswegen,
nämlich) vor. Während Geltungs-Adverbien entweder eine bekräftigende Funktion haben
(zweifellos, selbstredend, bekanntlich etc.) oder aber eine Einschränkung markieren könnten
(höchstwahrscheinlich, ausreichend, wohl, vielleicht etc.), dienten Nexus-Adverbien
(Konjunktional-Adverbien) dazu, „eine Feststellung so in den Argumentationsvorgang
einzubinden, dass sie zu dem voraufgehenden Kontext oder zur Situation in Beziehung gesetzt
wird“ (Hoffmann 2007, 600).
3.0 Adverbien und Adverbialien im Koreanischen
Die Adverbialformen des Koreanischen lassen sich nach Lewin (1970, 43) in eine produktive
und eine unproduktive Gruppe unterteilen. Während es sich bei den historischen Formen mit
den Endungsmorphemen -i (이) und -u (우) (gelegentlich auch -o (오)) um unproduktive,
lexikalisierte Formen handele, die nicht von jedem Verb paradigmatisch gebildet werden
könnten, seien insbesondere die Endungsmorpheme -ke (게) und -ya (야) produktiv und an
viele Verbformen anschließbar. Produktiv seien darüber hinaus die Konverbalformen -a (아)
und -o (오) sowie die koordinative Konjunktionalform -ko (고).
Die Adverbialform -i (이), die eine Formidentität mit der entsprechenden Nominalform
aufweist, kann (wenngleich unproduktiv) durch Anschluss an die konsonantischen
Verbalbasen von vielen Verben gebildet werden (vgl. Lewin ebd.).
84
Regelmäßig erfolgt die Bildung der Adverbialformen bei den folgenden Verben:
hoch (sein): 높다 (Verb: nopda) hoch: 높은 (Adjektiv: nopeun) die Höhe: 높이 (Nomen: nopi) hoch: 높이 (Adverb: nopi) tief sein: 깊다 (Verb: kipda) tief: 깊은 (Adjektiv: kipeun) die Tiefe: 깊이 (Nomen: kipi) tief: 깊이 (Adverb: kipi) gleich sein: 같다 (Verb: katta) gleichsam/gemeinsam: 같이 (Adverb: katchi) nicht da sein: 없다 (Verb: eobda) ohne: 없이 (Adverb: eobshi) viel sein: 많다 (Verb: manhda) viel: 많이 (Adverb: manhi)
Unregelmäßigkeiten in der Bildung der Adverbialformen auf -i (이) ergeben sich in folgenden
Fällen:
Liegt eine p (ㅍ, ㅂ)/w (ㅚ)-Verbalbasis vor, so wird der Schlusskonsonant vor der
Adverbialendung -i (이) getilgt:
nahe sein: 가깝 (다) (Verb: kakkabda) nahe: 가까이 (Adverb: kakkai) ≠ kakkawi
Endet die Verbalbasis auf -u (우), (으) oder -i (이) so wird der Schlussvokal vor der
Adverbialendung in vielen Fällen getilgt:
eilig sein/beschäftigt sein: 바쁘 (다): (Verb: bappeu(da)) eilig/beschäftigt: 바삐 (Adverb: bappi) → alternative Adverbform: (바쁘게: bappeuge)
85
Die l- (을) und Nullbasen sowie die ru (르)-Basen reduplizieren nach Lewin (ebd.) die
Liquide vor der Adverbialendung:
schnell sein: 빠르 (다) (Verb: bbareu(da)) schnell: 빨리 (Adverb: bballi) → alternative Adverbform (빠르게: bbareuge) verschieden sein: 다르 (다) (Verb: dareu(da)) verschieden: 달리 (Adverb: dalli) → alternative Adverbform (다르게: dareuge) Lewin (1970, 44) verweist darauf, dass die Adverbialform des Hilfsverbs 하다 (machen) 히 (hi) lautet. Dies gelte auch für kompositionelle Verbalformen. Bei der Bildung der Adverbialform werde das h (하) häufig elidiert. fleißig sein: 부지런하다 (Verb: bujireonhada) fleißig: 부지런히 (Adverb: bujireonhi) → alternative Adverbform (부지런하게: bujireonhage) Einige Verben bilden ihre Adverbialformen auf -o (오) bzw. -u (우), dabei folgt die
Adverbialendung -o (오) in der Regel auf die Stammvokale -a (아) bzw. -o (오). Auf alle
anderen Stammvokale folgt die Adverbialendung -u (우). Allerdings sind auch hier einige
Irregularitäten feststellbar:
häufig sein: 잦다 (Verb: jatta) häufig: 자주 (Adverb: jaju) Lewin (1970, 45) hält die Adverbialform -게 (-ge) für eine der produktivsten
Adverbialendungen. Dabei sei die adverbiale Form mit der gleichlautenden konjunktionalen
Form zur Bezeichnung eines Zwecks identisch. Die Adverbialform -게 (-ge) wird an die
konsonantische Verbalbasis angehängt:
machen: 하다 (Verb: hada) machend: 하게 (Adverb: hage) hoch sein: 높다 (Verb: nopda) hoch: 높게 (Adverb: nopge) nicht wissen: 모르다 (Verb: moreuda) unwissend: 모르게 (Adverb: moreuge) spät sein: 늦다 (Verb: neutta) spät: 늦게 (Adverb: neuge)
86
Als weniger produktiv gelten die Adverbialformen 야 (-ya) und 고 (-go). Während 야 (-ya) als
Adverbialform ausschließlich vor den Hilfsverben 하다 (hada) und (doeda) sowie einigen
sinokoreanischen Adverbialbildungen auftritt (vgl. Lewin 1970, 45), fungiert die Endung 고
(-go) adverbial vor Verben des Sagens und Denkens sowie vor Hilfsverben der Befindlichkeit
(vgl. Lewin ebd.).
4.0 Fehler in der Verwendung von Adverbien bei koreanischen Lernern des
Deutschen
Kim (1994) ging in einer empirischen Arbeit zum Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
durch koreanische Lerner der Frage nach, welche Fehler in den verschiedenen Bereichen der
Sprachverwendung dominieren (Verb-Rektion, Genus, Kasus, Adverbien, Pronomen,
Präpositionen, Konjunktionen etc). Bei den untersuchten Fremdsprachenlernern handelte es
sich um fortgeschrittene Lerner des Deutschen, die in ihrem Heimatland als Deutschlehrer
tätig waren und seit einer durchschnittlichen Dauer von fünf bis sieben Jahren Deutsch an
Oberschulen unterrichteten. Gegenstand der Untersuchung Kims waren die Aufsätze von 98
koreanischen Deutschlehrern, die er einer vornehmlich kontrastivlinguistischen Analyse
unterzogen hat.
Ein zentrales Problem der beobachteten koreanischen Lerner im Bereich der Adverbien
bestand in einer fehlerhaften Bedeutungszuschreibung der Modaladverbien. So verwendeten
einige der Lerner das Temporaladverb zuerst im Sinne des Modaladverbs vor allem.
Meine Note war die beste in der Schule. Deutsch ist zuerst interessant (vor allem, besonders).
Also muss Fremdsprachenlehrer zuerst gute Fremdsprache sprechen und nützen (vor allem).
Deutscher Lehrer muss zuerst Deutschkenntnisse genug haben (vor allem).
Zuerst ist die Welt heutzutage eine Familie (vor allem).
Ich möchte zum ersten Mal Deutsch gut lernen (vor allem).
Schwierigkeiten bestanden darüber hinaus auch in der Markierung von Gradangaben
(Komparativ und Superlativ) bei Adverbien, wie sich anhand der folgenden Beispiele
illustrieren lässt.
Aber wir lernen am wichtigsten Grammatik (vor allem).
Mein Hauptfach Germanistik will ich weiter besser studieren (verstärkt, intensiver).
87
Man kann heutzutage sehr leichter als früher eine Reise machen (viel).
Deutschland ist eines der Länder, nach denen ich mich am besten sehne (am meisten, sehr).
Probleme ergaben sich auch in der Verwendung des Modaladverbs sogar, dessen zentrale
Bedeutung in der Markierung eines überraschenden bzw. ungewöhnlichen Sachverhalts oder
der Überschreitung einer impliziten oder aber expliziten Grenzmarkierung besteht (Sogar
wochentags findet man dort einen Parkplatz).
Sogar manchmal regnet es zu viel.
Sprechen und sogar Hören sind am wichtigsten.
Weitere Bedeutungsverwechslungen bzw. fehlerhafte Verwendungen von Adverbien
betreffen eine Reihe weiterer Temporal- und Lokaladverbien (vorher, gestern, früher, überall
etc.).
Und heutzutage ist die Weltreise leichter als vorher (früher).
Nach der Wiedervereinigung von Deutschland interessieren sich viele Koreaner für
Deutschland viel mehr als gestern (vorher).
Früher hat Goethe gesagt: „Wer fremde Sprachen nicht kennt …“ (einmal).
Wenn Du eine Reise nach Korea machen willst, willkomme ich Dich irgendwann (jederzeit).
Am Ende letzten Augusts habe ich hier angekommen (Ende August).
Besonders in Korea ist die amerikanische Kultur überall (allgegenwärtig).
Ich möchte irgendwo reisen (irgendwohin).
Fehler im Bereich der Relativ- und Interrogativadverbien (wo, wohin, woher, wann, wie,
wieso, weshalb, weswegen, womit) konnte Kim (ebd.) in den schriftlichen Texten der
untersuchten Deutschlerner nicht feststellen, wenngleich er einen hohen Fehleranteil in
diesem Bereich in der gesprochenen Sprache vermutet (Kim 1994, 62).
88
5.0 Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag hatte die semantische und syntaktische Differenzierung von
Adverbien und Adverbialen zum Gegenstand. Die besondere semantische Leistung der
Adverbien zur Modifizierung von Verben, Adjektiven, Adverbialen und ganzen Sätzen wurde
von Bußmann (1983) hervorgehoben, während Kaltenbacher (1996) auf die syntaktischen
Leistungen der Adverbien fokussierte. In Anlehnung an Helbig/Buscha (1986) und Weinrich
(1993) wurde der Frage nach der Graduierbarkeit von Adverbien nachgegangen. Eine weitere
Ausdifferenzierung der Adverbien als Wortklasse zwischen den Syn- und Autosemantika
erfolgte mit Bezugnahme auf Heinle (2004), die u.a. zwischen Modal- und Kausaladverbien
sowie zwischen Pronominal- und Konjunktionaladverbien unterschied.
Die differenzierteste Gliederung der Adverbien fand sich bei Hoffmann (2007), der zwischen
Positions-, Dimensions-, Direktions- und Präpositionaladverbien etc. trennte.
Die koreanischen Adverbialformen ließen sich in eine produktive und eine unproduktive
Gruppe untergliedern. Dabei wurden die historischen Formen -i (이) und -u (우) (gelegentlich
auch -o (오)) als lexikalisiert und unproduktiv charakterisiert, während die an die
konsonantische Verbalbasis angehängte Adverbialform -게 (-ge) als produktive
Adverbialendung beschrieben wurde, die an eine Vielzahl von Verbalbasen angehängt werden
kann. Die Adverbialformen 야 (-ya) und 고 (-go) wurden als weniger produktiv
charakterisiert, da sie in ihrer Verwendungsweise weitergehenden Restriktionen unterliegen.
Während 야 (-ya) als Adverbialform ausschließlich vor den Hilfsverben 하다 (hada) und
(doeda) sowie einigen sinokoreanischen Adverbialbildungen auftritt (vgl. Lewin 1970, 45),
fungiert die Endung 고 (-go) adverbial lediglich vor Verben des Sagens und Denkens sowie
vor Hilfsverben der Befindlichkeit (vgl. Lewin ebd.).
Bezugnehmend auf die empirische kontrastivlinguistische Arbeit Kims (1994) wurde der
Frage nachgegangen, welche Fehler im Bereich der Adverbien bei fortgeschrittenen
koreanischen Lernern des Deutschen bestehen. Im Rahmen der von Kim vorgelegten Studie
konnte festgestellt werden, dass Fehler bei dieser Lernergruppe vornehmlich in einer
fehlerhaften Bedeutungszuschreibung von Modaladverbien bestanden. Fehler fanden sich
ebenfalls im Bereich der Temporal- und Lokaladverbien, während, zumindest in der
schriftlichen Textproduktion, keine Fehler im Bereich der Relativ- und Interrogativadverbien
feststellbar waren. Fehler im Bereich der gesprochenen Sprache wurden jedoch antizipiert.
89
6.0 Literatur
Bergenholtz, Henning/Mugdan, Jochen (1979): »Einführung in die Morphologie.« Stuttgart.
Bußmann, Hadumod (1983): »Lexikon der Sprachwissenschaft.« Stuttgart.
Heinle, Eva-Maria (2004): »Diachronische Wortbildung unter syntaktischem Aspekt: Das
Adverb.« Heidelberg.
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1986): »Kurze deutsche Grammatik für Ausländer.«
Leipzig.
Hoffmann, Ludger (Hg.) (2007): »Handbuch der deutschen Wortarten.« Berlin/New York.
Kaltenbacher, Erika (1996): »Zur sprachtypologischen Fundierung der kontrastiven
Linguistik: Wortarten.« In: Informationen Deutsch als Fremdsprache 23 (1), S. 3-23.
Kim, Yong-Shin (1994): »Schwierigkeiten beim Lernen und Lehren der deutschen Sprache
durch Koreaner. Eine fehleranalytische Untersuchung bei koreanischen
Deutschlehrern an Oberschulen.« Eichstätt (unveröffentlichte Magisterarbeit).
Lewandowski, Theodor (1984): »Linguistisches Wörterbuch, Band 1.« Heidelberg.
Lewin, Bruno: »Morphologie des koreanischen Verbs. « Wiesbaden 1970.
Weinrich, Harald (1993): »Textgrammatik der deutschen Sprache.« Mannheim.
90
VI. Der Quotativ - die indirekte Rede im Deutschen und im Koreanischen
1.0 Einleitung
Der vorliegende Beitrag thematisiert die indirekte Rede im Deutschen und im Koreanischen.
Dabei wird für das Deutsche zunächst auf Besonderheiten der Transformation von der
direkten in die indirekte Rede, beispielsweise die Verwendung von Deiktika, eingegangen.
Auch die mögliche Anpassung der Tempora wird als ein Moment dieses
Transformationsprozesses beschrieben. Des Weiteren wird die Verwendung periphrastischer
würde-Formen als Ersatz nicht eindeutiger oder ungebräuchlicher Konjunktivformen
behandelt. Eine Betrachtung der redeeinleitenden Verben und der grammatisch-lexikalischen
Konjunktivparaphrasen schließt die Beschreibung der indirekten Rede im Deutschen ab.
Bezüglich der Realisierung der indirekten Rede im Koreanischen wird auf die Verwendung
kompositioneller Konjunktionalformen und ihre möglichen Kontraktionen eingegangen.
Anhand von Beispielsätzen wird die Realisierung des Quotativs als Teil des Prädikats und des
Attributs sowie in verschiedenen Zeitstufen und Satztypen aufgezeigt. Zudem wird die
Realisierung einiger koreanischer Sätze in den verschiedenen Honorativstufen illustriert.
Eine Betrachtung der Verwendung und Funktionsweise des Evidentialitätsmarkers „ay (애)”
schließt den Beitrag ab.
2.0 Die indirekte Rede im Deutschen
Nach Bußmann (1983, 202) dient die indirekte Rede (auch: oblique Rede) der Wiedergabe
von Aussagen und Fragen sowie von Gedanken, Überlegungen und Wünschen, die mittelbar
berichtet werden. Der Unterschied zum Zitieren in der direkten Rede bestehe u.a. in dem
Vorhandensein eines Verbes des Sagens (verbum dicendi) in der indirekten Rede, das explizit
vorhanden sein oder aber nur rekonstruierbar sein könne.
Bei der Transformation der direkten in die indirekte Rede sei auch der damit verbundene
regelmäßige Wechsel der Deiktika zu beachten. So entstehe aus dem Satz „Er sagt: Ich
komme morgen dorthin“, der indirekte Satz „Er sagte gestern, er käme heute hierher.“
Lewandowski (1985, 415) betont, dass die indirekte Rede dazu diene, Gesagtes oder
Gedachtes in eine aktuelle Sprechsituation hineinzuholen. Dabei werde in der indirekten Rede
häufig nicht zwischen dem Konjunktiv I und dem Konjunktiv II unterschieden, so dass in der
geschriebenen Sprache häufig der Konjunktiv II statt des Konjunktivs I stehe (vgl. „Er hätte
es nicht gewusst, sagte er“; Lewandowski 1985, 415). In der gesprochenen Sprache dominiere
91
der Indikativ vor dem Konjunktiv II und dem Konjunktiv I. Nach Lewandowski (ebd.) ist der
Konjunktiv II aber auch geeignet, eine relativierende Distanz auszudrücken.
Ulrich (1975, 117) differenziert zwischen der direkten/wörtlichen Rede, der
indirekten/abhängigen Rede und der erlebten Rede. Während die direkte Rede der
unmittelbaren Wiedergabe einer Äußerung diene („Wohin gehst du?“ fragte er), fungiere die
indirekte Rede als mittelbares Berichten von Aussagen und Gedanken („Er versicherte, dass
alles gut gehen werde“.) Die erlebte Rede (auch: innerer Monolog) bewege sich zwischen der
direkten und der indirekten Rede und diene vornehmlich der Wiedergabe eines
Selbstgesprächs oder eines nicht verbalisierten Gedankens („Sollte er sich etwa von Eva
scheiden lassen?“).
Im kleinen Duden (2009, 134) wird darauf verwiesen, dass bei der Transformation von der
direkten in die indirekte Rede zwar eine Anpassung der Deiktika (Personen-, Orts- und
Zeitangaben) erfolgen müsse, das Tempus in einem indirekten Satz in der Regel jedoch das
gleiche bleibe wie im entsprechenden direkten Satz (Er erklärt/erklärte/hat erklärt …, dass der
nicht zurücktrete; … dass er nicht zurücktreten werde). Für die Transformation von Sätzen in
direkter Rede in den Zeitstufen Präteritum und Plusquamperfekt gelte, dass in der indirekten
Rede Tempus übergreifend auf den Konjunktiv Perfekt zurückgegriffen werde („Sie
behauptet/behauptete/hat behauptet …ich wusste nichts davon/ich habe nichts davon
gewusst/ich hatte nichts davon gewusst“ → Sie behauptet/behauptete/hat behauptet, sie habe
nichts davon gewusst). Der Konjunktiv I werde in indirekter Rede zumeist noch in offizieller
Sprache verwendet, aber auch nur sofern eindeutige, vom Indikativ unterscheidbare
Konjunktiv I-Formen vorhanden seien („Der Störfall sei sicherheitstechnisch nicht von
Bedeutung“, erklärte das Ministerium; das Personal der Anlage und die Umgebung seien nicht
gefährdet gewesen; Der kleine Duden 2009, 135). Auch das Vorhandensein von Modalverben
sowie des Verbes „wissen“ im Singular erfordere in der Regel den Konjunktiv I in der
indirekten Rede (Der Arzt sagt, ich dürfe aufstehen, solle mich aber noch schonen; man wisse
nie, ob es nicht einen Rückfall geben könne).
Die würde-Form habe sich inzwischen zu einer Art „Einheitskonjunktiv“ entwickelt (Der
kleine Duden 2009, 137). In vielen Fällen würden Formen des Konjunktivs I und II durch
periphrastische würde-Formen ersetzt. Dies gelte insbesondere in den Fällen, in denen die
Formen des Konjunktivs I und II nicht eindeutig seien. So werde statt der Konjunktivform
„das freute mich“ in der Regel die periphrastische Form „das würde mich freuen“ verwendet.
Auch ungebräuchliche Konjunktiv II-Formen würden in der Regel durch periphrastische
würde-Formen ersetzt (Der kleine Duden 2009, 138).
92
So würde statt der Konjunktiv II-Form „Ich hülfe dir, wenn ich könnte“ in der Regel die
periphrastische Form „Ich würde dir helfen, wenn ich könnte“ verwendet. Gleiches gelte auch
für die Form „Es wäre zu schön, wenn wir gewännen/gewönnen“ statt derer die
periphrastische Form „Es wäre zu schön, wenn wir gewinnen würden“ verwendet wird.
Helbig/Buscha (1987, 195) stellen fest, dass die indirekte Rede durch die Verwendung eines
Konjunktivs, einer Nebensatzform und eines redeeinleitenden Verbs formal gekennzeichnet
sei. Wenngleich keines dieser Mittel obligatorisch sei, so werde in der Regel doch zumindest
eines dieser Mittel zur Kennzeichnung der indirekten Rede verwendet.
Hinsichtlich der redeeinleitenden Verben betonen Helbig/Buscha (1987, 197) die
Abhängigkeit der indirekten Rede von einem übergeordneten Verb des Sagens. Bei diesem
Verb müsse es sich jedoch nicht zwingend um ein Verb des Sagens im engeren Sinne
handeln, da auch Verben des Fragens und des Aufforderns als redeeinleitende Verben in
Frage kämen („Er hat gefragt/wissen wollen/die Frage gestellt/um Auskunft gebeten/…, ob
…//Er hat angeordnet/befohlen/verlangt/gewünscht/gedroht/…, dass …“). Auch Verben des
Denkens und Fühlens könnten als redeeinleitende Verben fungieren („Er hat
geglaubt/gewusst/gehofft/sich vorgestellt/geahnt/ …, dass …“).
Laut Helbig/Buscha (1987, 200) existieren zusätzlich zu den aufgeführten Formen der
Redewiedergabe einige Konkurrenzformen der indirekten Rede, bei denen anstelle eines
Hauptsatzes mit redeeinleitendem Verb eine Paraphrase unter Verwendung eines Modalverbs,
eines Modalwortes, einer präpositionalen Gruppe oder eines Nebensatzes stehe. So könnten
statt des Hauptsatzes „Er sagt, er habe mich mehrmals angerufen“ die folgenden
grammatisch-lexikalischen Paraphrasen verwendet werden:
Er will mich mehrmals angerufen haben. (Modalverb)
Er hat mich angeblich mehrmals angerufen. (Modalwort)
Nach seinen Worten hat er mich mehrmals angerufen. (präpositionale Gruppe)
Wie er sagt, hat er mich mehrmals angerufen. (Nebensatz)
93
3.0 Die indirekte Rede im Koreanischen
Nach Lewin (1970, 47) ist der Bereich der indirekten Rede (des Quotativs) im Koreanischen
morphologisch durch kompositionelle Aussageweisen geprägt. In diese Kategorie gehöre
insbesondere die Aussageweise des Typs -ko (고) -hada (하다) → (sagen):
tago-hada (다고하다): heißen, dass; sollen
Im Anschluss an eine Kopulaform könne das Verb rago-hada (라고하다): (heißen, dass;
sollen) verwendet werden.
Bei der Bildung eines Kompositums zur Markierung eines Quotativs könne es durch eine
Elision von -ko (고) und -ha (하) zu den kontrahierten Verbformen tanda (단다) und randa
(란다) kommen, die in der Honorativstufe des „Panmal“ zu -tae (대) bzw. -rae (래) verkürzt
würden.
Die Form -tago (다고) könne ohne Hilfsverb auch in Terminalform verwendet werden und
besitze in diesem Fall eine interrogative Funktion. Typisch für das Vorkommen
kompositioneller Konjunktionalformen sei das Auftreten von Kontraktionen. So seien die
Konjunktionalformen der Form -chamyon (자면) und -tamyon (다면) als Kontraktionen der
Formen chago (자고) + hamyon (하면) bzw. tago (다고) + hamyon (하면) zu betrachten.
Beide Formtypen würden jedoch gleichermaßen in der Verwendung des Quotativs eingesetzt.
Hoppmann (2007, 105) beschreibt den Quotativ im Koreanischen als eine Kategorie, die
gekennzeichnet sei durch einen vollständigen Satz, der den Inhalt transportiere, das Hauptverb
dieses Satzes, das in der Regel in der zweiten Soziativstufe stehe und mit der quotativen
Konjunktionalform -ko (고) ausgestattet sei und einem Verb des Sagens, Fühlens, Denkens,
u.a.: 말하다 (malhada, sprechen), 듣다 (deuda, hören), 생각하다 (saenggakhada, denken),
물어보다 (mureoboda, fragen), 명령하다 (myeongryeonghada, befehlen), 제안하다
(jeanhada, vorschlagen), 대답하다 (daedabhada, antworten).
Hoppmann (2007, 106ff.) illustriert anhand von Beispielsätzen, dass der Quotativ als Teil des
Prädikats und des Attributs sowie in verschiedenen Satztypen (Aussagesatz, Interrogativsatz,
Propositivsatz, Imperativsatz) und Zeitstufen verwendet werden kann. In den Beispielsätzen,
die den Quotativ als Teil des Prädikats illustrieren, erfolgt jeweils eine Satzrealisierung auf
der zweiten, vierten und fünften Soziativstufe. Hierbei wird auch die Vereinfachung
kompositioneller Verbformen zu kontrahierten Formen aufgezeigt:
94
Beispielsatz 1: Der Quotativ als Teil des Prädikats
Man sagt, dass (er) erhält; es heißt, dass (er) erhält; (er) soll erhalten
Realisierung des Satzes auf der zweiten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
받는다고 한다 (baneundago handa)
받는다 한다 (baneunda handa)
받는단다 (baneundanda)
Realisierung des Satzes auf der vierten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
받는다고 해요 (baneundago haeyo)
받는대요 (baneundaeyo)
Realisierung des Satzes auf der fünften Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
받는다고 합니다 (baneundago hamnida)
받는다 합니다 (baneunda hamnida)
받는답니다 (baneundamnida)
(Hoppmann 2007, 106)
Beispielsatz 2: Der Quotativ als Teil des Prädikats
Man sagt, dass (es) da ist; es heißt, dass (es) da ist: (es) soll da sein
Realisierung des Satzes auf der zweiten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
있다고 한다 (ittago handa)
있단다 (ittanda)
95
Realisierung des Satzes auf der vierten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
있다고 해요 (ittago haeyo)
있대요 (ittaeyo)
Realisierung des Satzes auf der fünften Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
있다고 합니다 (ittago hamnida)
있답니다 (ittamnida)
(Hoppmann 2007, 106)
Beispielsatz 3: Der Quotativ als Teil des Prädikats
Sagt man, dass es schwer ist? heißt es, dass (es) schwer ist? (es) soll schwer sein?
Realisierung des Satzes auf der zweiten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
어렵다고 하느냐? (eoryeobdago haneunya?)
어렵다느냐? (eoryeobdaneunya?)
Realisierung des Satzes auf der vierten Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
어렵다고 해요? (eoryeobdago haeyo?)
어렵대요? (eoryeobdaeyo?)
Realisierung des Satzes auf der fünften Honorativstufe
Kontraktion der kompositionellen Verbformen:
어렵다고 합니까? (eoryeobdago hamnikka?)
어렵답니까? (eoryeobdamnikka?)
(Hoppmann 2007, 106)
96
Beispielsatz 1: Der Quotativ als Teil des Attributs
Die Geschichten, in denen es heißt, dass Sie ins Krankenhaus gekommen sind.
입원하셨다는 이야기 (ibweonhashyeottaneun iyagi)
입원하셨단 이야기 (ibweonhashyeottan iyagi)
Beispielsatz 2: Der Quotativ als Teil des Attributs
Die Sache, von der es heißt, dass sie merkwürdig ist.
이상하다는 것 (isanghadaneun geot)
이상하단 것 (isanghadan geot)
(Hoppmann 2007, 106)
Der Quotativ in verschiedenen Satztypen und Zeitstufen
Der Aussagesatz:
소라는 일한다고 들었습니다.
Soraneun ilhandago deureossumnida.
Ich habe gehört, dass Sora arbeitet.
소라는 일하지 않는다고 들었습니다.
Soraneun ilhaji anneundago deurossumnida.
Ich habe gehört, dass Sora nicht arbeitet.
소라는 일했다고 들었습니다.
Soraneun ilhaettago deurossumnida.
Ich habe gehört, dass Sora gearbeitet hat.
소라는 일할 것이라고 들었습니다.
Soraneun ilhal geoshirago deurossumnida.
Ich habe gehört, dass Sora arbeiten wird.
97
소라는 일하겠다고 했습니다.
Soraneun ilhagettago haessumnida.
Sora hat gesagt, dass sie arbeiten will.
Der Fragesatz:
소라도 가느냐고 물어봤습니다.
Sorado ganeunyago mureobwassumnida.
Man hat gefragt, ob Sora auch mitgeht.
소라도 갔느냐고 물어봤습니다.
Sorado ganeunyago mureobwassumnida.
Man hat gefragt, ob Sora auch mitgegangen ist.
소라도 갈것이냐고 물어봤습니다.
Sorado kalgoshinyago mureobwassumnida.
Man hat gefragt, ob Sora auch mitgehen wird.
소라도 가겠느냐고 물어봤습니다.
Sorado gagetneunyago mureobwassumnida.
Man hat gefragt, ob Sora auch mitgehen will.
그는 퇴원하느냐고 물어봤습니다.
Keuneun toeweonhaneunyago mureobwassumnida.
Man hat gefragt, ob er entlassen wird.
그는 퇴원할 것이냐고 물어봤습니다.
Keuneun toeweonhal goshinyago.
Man hat gefragt, ob er entlassen werden wird.
98
Der Propositivsatz:
그가 맥주 한 잔 하자고 합니다.
Keuga maegju han jan hajago hamnida.
Er sagt, wir wollen ein Bier trinken.
그가 육개장을 먹자고 합니다.
Keuga yukkaejangeul meogjago hamnida.
Sie sagt, wir wollen Yukkaejang essen.
Der Imperativsatz:
부모님께서 저에게 공부하라고 하십니다.
Bumonimkkeseo jeoege kongbuharago hashimnida.
Die Eltern sagen, ich soll studieren.
소라가 저에게 이 음식을 먹으라고 합니다.
Soraga jeoege i eumsigeul meogeurago hamnida.
Sora sagt, ich soll das essen.
(Hoppmann 2007, 107)
Kwon (2011) hat die Funktion und Bedeutung des Evidentialitätsmarkers „ay (애)” in der
indirekten Rede (Quotativ) im Koreanischen untersucht. Dabei versteht er unter der
quotativen Evidentialität den Modus, durch den der Sprecher Zugang zu einer Information
bekommen hat. Der Sprecher habe die Information durch eine in der Regel spezifisch
identifizierbare Person erhalten und gebe sie an einen weiteren Adressaten in der Weise ihres
vorherigen Erhalts wieder.
Während es sich bei dem Satz (내일 비가 온다/Naeil piga onda/Es regnet morgen) um eine
indikativische Äußerung ohne Evidentialitätsmarkierung handele (Kwon 2011, 25), werde in
dem Satz (내일 비가 온대/Naeil piga ondae/(Jemand sagte mir): Es regnet morgen) die
Evidentialität, d.h. der Zugang des Sprechers zu dieser Information klar markiert.
99
Die Verwendung des Evidentialitätsmarkers „ay (애)” verlange in jedem Fall, dass die Quelle
der Information eine dritte Person ist. Auf diese Quelle könne in expliziter aber auch
impliziter Weise Bezug genommen werden. Die Verwendung der ersten Person Singular
zusammen mit einem berichtenden Evidentialitätsmarker ergäbe jedoch einen unzulässigen
Satz.
So sei der Satz (철수가 너를 사랑한대/Cheolsuga neoreul saranghandae/Cheolsu sagte mir,
dass er (Cheolsu) dich liebt) korrekt und hinsichtlich der Verwendung des
Evidentialitätsmarkers (hier: 대) eindeutig, da eine dritte Person (Cheolsu) als Quelle der
Information des Sprechers benannt werden könne. Der Satz (*내가 너를 사랑한대/*Naega
neoreul saranghandae/*Ich sagte mir selbst, dass ich dich liebe) unterliege jedoch
grammatischen Restriktionen, da keine dritte Person als Informationsquelle benannt werden
kann. Für einen Satz wie (꿈속에서 내가 너를 사랑한대/Kkumsokeseo naega neoreul
saranghandae/In meinem Traum hörte ich mich sagen, dass ich dich liebe) gelte diese
Restriktion hingegen nicht. Der Sprecher beziehe sich auf ein im Traum geführtes
Selbstgespräch, von dem er dem Hörer berichte. Die Quelle der Sprecherinformation sei
gewissermaßen dessen eigene Stimme im Traum. Diese Quelle könne gegenüber dem Hörer
explizit gemacht werden oder aber auch implizit bleiben.
Kwon (2011, 28) beschreibt anhand des Satzes (농장이 경찰의 습격을 받았대/Nongjangi
kyeongchaloe seubgyeogeul badatdae/Es wird gesagt, dass der Bauernhof von der Polizei
angegriffen wird) die semantischen Eigenschaften der -ay (애)-Konstruktion. In diesem Satz
werde vom Sprecher eine Information verbreitet, ohne dass die Informationsquelle explizit
gemacht werde. Durch das Fehlen einer expliziten Informationsquelle sei auch niemand
verantwortlich für die Gültigkeit der transportierten Information. Es bleibe zudem unklar, ob
die Information vom Sprecher selbst oder aber von einer nicht genannten dritten Person
stamme.
In den beiden Sätzen (우리 왕초가 (사장이) 괜찮으면 사겠대/Uri wangchoga (sajangi)
gwaenchaneumyon sagetdae/Unser Boss sagte mir, dass er es kaufen wird, falls das in
Ordnung ist) und (김부장님이 결혼하지 말래/Kim bujangnimi kyeoreunhaji mallae/Chef
Kim sagte mir, dass ich nicht heiraten solle) werde die Quelle der Information durch das
grammatische Subjekt (unser Boss/Chef Kim) explizit gemacht. Im zweiten Satz werde
zudem durch den Evidentialitätsmarker „ay (애)” eine Imperativstruktur realisiert.
100
Der Satz (철수가 영희를 좋아한대/Cheolsuga Yeonghoireul johahandae) biete zwei
verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Dabei könne die Informationsquelle entweder eine
nicht genannte dritte Person (Man sagt, dass Cheolsu Yeonghoi mag) oder aber der genannte
Cheolsu selbst sein (Mir wurde von Cheolsu erzählt, dass er (Cheolsu) Yeonghoi mag). Nur in
letzterem Falle liege ein Quotativ im engeren Sinne vor. Bei unspezifischer
Informationsquelle bleibe auch offen, ob der transportierte Inhalt des Satzes wahr oder falsch
sei. Sei jedoch der genannte Cheolsu selbst die Informationsquelle, so könne davon
ausgegangen werden, dass der Inhalt des Satzes wahr ist.
Der Satz (엄마가 그것을 누르면 안 됀대/Eommaga keugeoseul nureumyon an dwaendae/
Meine Mutter sagte mir, dies nicht zu drücken/Meine Mutter sagte mir, dass ich dies nicht
drücken solle) sei hinsichtlich der Verwendung des Evidentialitätsmarkers „ay (애)”
unbedenklich, da eine dritte Person als Informationsquelle (die Mutter des Sprechers) genannt
werde. Der Sprecher zitiere direkt, was er von seiner Mutter gehört habe.
Der Satz (내가 그것을 누르면 안 됀대/Naega keugeoseul nureumyon an dwaendae/Ich
sagte mir selbst, dass ich dies nicht drücken solle) sei jedoch nicht akzeptabel, da hier kein
Kontext vorstellbar sei, in dem der Sprecher sich selbst zitiere. Die syntaktische und
semantische Restriktion des Satzes bestehe darin, dass als Informationsquelle auf eine dritte
Person Bezug genommen werden müsse. Die Informationsquelle dürfe in jedem Fall nicht der
Sprecher oder der Adressat der im Satz dokumentierten Äußerung sein.
Kwon (2011, 35) erläutert anhand der Sätze (비가 온다고해/Piga ondagohae/ Sie sagen, dass
es regnet) und (비가 온대/Piga ondae/Sie sagen, dass es regnet) die unterschiedlichen
Negationsmöglichkeiten dieser Sätze und ihre Bedeutungen. Während für die Konstruktion
(비가 온다고해) zwei Negationsmöglichkeiten zur Verfügung stünden, böte der Satz (비가
온대) lediglich eine Negationsmöglichkeit. Der Satz (비가 온다고해) verfüge über die zwei
potentiellen Negationsformen (비가 온다고 안 해/Piga ondago an hae/Sie sagen nicht, dass
es regnet) und (비가 안온다고 해/Piga anondago hae/Sie sagen, dass es nicht regnet). Im
Falle der Verwendung der ersten Negationsform werde lediglich die ursprüngliche Äußerung
(Sie sagen, dass es regnet) negiert, während bei der Verwendung der zweiten Negationsform
das kommentierte Ereignis selbst (Es regnet) negiert werde.
Der Satz (비가 온대) verfüge lediglich über die Negationsform (비가 안온대/Piga
anondae/Sie sagen, dass es nicht regnet), durch die ausschließlich das kommentierte Ereignis
(Es regnet) negiert werde.
101
Bezüglich des Satzes (내가 너를 사랑한다(고) 했어/Naega neoreul
saranghanda(go)haesseo/Mir wurde (von mir selbst) gesagt, dass ich dich liebe/Man sagt, dass
ich dich liebe) führt Kwon (2011, 42) aus, dass dieser im Gegensatz zu dem Satz (*내가 너를
사랑한대/*Naega neoreul saranghandae/*Ich sagte mir selbst, dass ich dich liebe) korrekt sei
und keinen grammatischen Restriktionen unterliege. Der Grund dafür liege in dem final
platzierten Element (했어), das die Vergangenheit bzw. einen Perfektaspekt markiere. Durch
diesen Marker werde ein vergangener Raum und eine vergangene Zeit evoziert, die den
Rahmen für eine subjektive Erfahrung des Sprechers schaffe. Der Satz sei daher korrekt und
unterliege keinen grammatischen Restriktionen.
4.0 Zusammenfassung und Fazit
Bezüglich der Bildung und Markierung der indirekten Rede im Deutschen konnte festgestellt
werden, dass die indirekte Rede, im Unterschied zum Zitieren, eines Verbes des Sagens
(verbum dicendi) bedarf, das explizit oder implizit vorhanden sein kann.
Der Konjunktiv I wurde als Modus der offiziellen geschriebenen Sprache beschrieben. In der
gesprochenen Sprache dominiere der Indikativ vor dem Konjunktiv II und dem Konjunktiv I.
Zudem sei eine zunehmende Dominanz periphrastischer Konjunktiv II-Formen feststellbar.
Mit Helbig/Buscha (1987) wurde auf die grammatisch-lexikalischen Paraphrasen der
indirekten Rede verwiesen, bei denen anstelle eines Hauptsatzes mit redeeinleitendem Verb
eine Paraphrase unter Verwendung eines Modalverbs, eines Modalwortes, einer
präpositionalen Gruppe oder eines Nebensatzes findet.
Hinsichtlich der Markierung der indirekten Rede (des Quotativs) im Koreanischen konnte mit
Lewin (1970) festgestellt werden, dass es sich bei den in der indirekten Rede verwendeten
Verben morphologisch um kompositionelle Verbformen handelt. Typisch bei der
Verbverwendung sei eine Kontraktion der kompositionellen Konjunktionalformen.
Mit Hoppmann (2007) konnte gezeigt werden, dass der Quotativ als Teil des Prädikats und
des Attributs sowie in verschiedenen Satztypen und Tempora realisiert werden kann.
Bezüglich der verwendeten Honorativstufe konnte festgestellt werden, dass bei der
Realisierung des Quotativs als Prädikat, das Verb zumeist in der zweiten Soziativstufe steht.
Mit Kwon (2011) wurden die Funktion und Bedeutung des Evidentialitätsmarkers „ay (애)”
thematisiert. Dieser Marker werde verwendet, um den Modus des Zugangs des Sprechers zu
einer Information zu markieren. Die semantisch-syntaktische Restriktion der Verwendung des
Evidentialitätsmarkers bestehe darin, dass ein Rückgriff auf eine dritte Person als Quelle der
102
Sprecherinformation erfolgen müsse. Auf diese Quelle könne explizit oder implizit Bezug
genommen werden.
5.0 Literatur:
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Der kleine Duden: Deutsche Grammatik. Mannheim 2009.
Der Duden. Band 4. Die Grammatik. Mannheim 2006.
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik - Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. Leipzig 1987.
Hoppmann, Dorothea: Einführung in die koreanische Sprache. Hamburg 2007.
Kwon, Iksoo: „Mental Spaces in the Korean Reportive/Quotative Evidentiality Marker -Ay.”
In: Discourse and Cognition 18 (2), 2011, 23-50.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch Band 2. Heidelberg. 4. Auflage 1985.
Lewin, Bruno: Morphologie des koreanischen Verbs. Wiesbaden 1970.
Ulrich, Winfried: Linguistische Grundbegriffe. Kiel. 2. Auflage 1975.
103
VII. Onomatopöie am Beispiel des Koreanischen
1.0 Einleitung
Bußmann (1983, 359) definiert die Onomatopöie als Lautmalerei und Schallnachahmung. Im
Prozess der lautmalenden Wortschöpfung würden neue Worte durch die Nachahmung von
Naturlauten gebildet. Dabei erfolge jedoch keine vollständige Imitation der ursprünglichen
Naturlaute. Vielmehr werde das neugebildete Wort in das phonologisch-morphologische
System der betreffenden Sprache integriert (Bußmann 1983, 360). Dies führe dann zu
unterschiedlichen Nachahmungen desselben Naturlautes in den verschiedenen Sprachen. So
bringe beispielsweise das akustische Vorbild des Hahnenschreis unterschiedliche lautmalende
Wortschöpfungen in den jeweiligen Sprachen hervor. Neben dem deutschen kikeriki und dem
schweizerdeutschen güggerügü käme es im Englischen zur Lautmalerei cock-a-doodle-doo,
im Französischen zur Realisierung cocorico und im Russischen zur onomatopoetischen
Annäherung kukareku (vgl. Bußmann 1983, 359).
Auch Lewandowski (1985, 732) sieht in der onomatopoetischen Wortbildung eine nur
„relative Affinität mit natürlichen Erscheinungen“. Ein naturgegebener Zusammenhang
zwischen dem Signifiant und dem Signifié scheine nicht zu bestehen. Die Beziehung
zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten sei auch im Bereich der Onomatopoetika als
arbiträr zu betrachten. Lewandowski (1985, 733) betont, dass das Spektrum der
Onomatopoetika von direkten Lautnachahmungen bis zur Lautsymbolik reiche. Lautmalende
Tierlaute wie wauwau, mäh-mäh, kikeriki, kuckuck oder quak-quak seien keine rein
naturalistischen Kopien des akustischen Vorbildes, sondern vielmehr symbolistische
Abstraktionen. Die auf der Basis der Existenz der Onomatopoetika formulierte Hypothese
eines semantischen Naturalismus (vgl. Lewandowski 1985, 733), in deren Kontext die
Entstehung der Sprache(n) durch die Nachahmung von Lauten erklärt wird, scheint zumindest
in ihrer starken Variante nicht länger haltbar zu sein.
Auch Linke/Nussbaumer/Portmann (2004, 23) sehen in der auch im Deutschen geringen
Anzahl klar erkennbarer Onomatopoetika einen zentralen Grund für die Zurückweisung
starker naturalistischer Positionen. Wenngleich lautmalerische Wörter wie wauwau, kuckuck
etc. ikonisch zu sein schienen, überwiege doch eindeutig ihr symbolischer Charakter. In
vielen Fällen seien onomatopoetische Ausdrücke durch symbolische Ausdrücke
substituierbar, ohne dass es in diesem Zuge zu einem Bedeutungsverlust oder einer
Bedeutungsverschiebung komme. Unter sprachhistorischer Perspektive weisen
Linke/Nussbaumer/Portmann (2004, 23) darauf hin, dass Wörter zum Teil nur unter
104
Einnahme einer synchronen Perspektive als onomatopoetisch erschienen. Die Einnahme einer
diachronen Perspektive führe jedoch in vielen Fällen dazu, vermeintliche Onomatopoetika als
vielmehr symbolische Ausdrücke zu klassifizieren.
Auch Zöllner (2004, 9) betont die Notwendigkeit einer historischen Kontextualisierung von
Onomatopoetika und hebt hervor, dass Wörter durch einen Form- und Bedeutungswandel
ihren onomatopoetischen Charakter erhalten oder aber auch verlieren können.
Onomatopoetische Formen würden phonologisiert und unterlägen damit den lautgesetzlichen
Veränderungen einer jeweiligen Sprache. Die Eigenschaften eines Sprachsystems setzten sich
letztlich auch im Bereich der Onomatopoetika durch. Bühler (1983, 199) bezeichnet die durch
das Lautsystem einer jeweiligen Einzelsprache gegebene phonetische Begrenztheit der
Onomatopoetika als „Phonemriegel“. Neu entstehende wohlgeformte Wörter und Wortfolgen
entstünden in erster Linie auf der Basis der Bildungs- und Kompositionsregeln einer Sprache.
Erst in zweiter Linie entstünde so etwas wie „der sekundäre Hauch eines Lautgemäldes“
(Bühler 1983, 202). Bühler (ebd.) differenziert zwischen erscheinungstreuen und
relationstreuen onomatopoetischen Wiedergaben und betrachtet die erscheinungstreuen
Wiedergaben als das echteste und unmittelbarste Lautmalen. Jede erscheinungstreue
Wiedergabe schließe eine relationstreue Wiedergabe ein, während dies umgekehrt nicht der
Fall sei.
Yang (2002) untersuchte Interjektionen und Onomatopoetika im deutsch-chinesischen
Sprachvergleich und differenzierte in Anlehnung an Groß (1988) zwischen lautmalenden
Wörtern sowie integrierten und eigentlichen Onomatopoetika. Während integrierte
Onomatopoetika wie Geplätscher oder Geklirr nicht oder nicht ausschließlich auf ein
Geräusch, sondern vornehmlich auf ein Objekt oder eine außerakustische Bewertung eines
Geräusches oder einer Geräuschquelle referierten, stehe bei den lautmalenden Wörtern
(piepsen, quietschen) stets die Referenz auf ein Geräusch oder auf Vorgänge und Objekte, die
im Zusammenhang mit Geräuschen stehen, im Vordergrund. Eigentliche Onomatopoetika wie
plumps oder ticktack referieren nach Yang (2002, 20) ausschließlich auf ein Geräusch und
sind über ihre Flexionslosigkeit zu definieren. Integrierte Onomatopoetika hingegen seien
ebenso wie lautmalende Wörter flektierbar.
Surhone/Timpledon/Marseken (2010, 18) verweisen auf die Bildung onomatopoetischer
Wörter in agglutinierenden oder synthetischen Sprachen. In Sprachen dieses Typs würden
onomatopoetische Wörter flexibel in eine bestehende Struktur integriert. Im Zuge der Bildung
eines neuen Wortes könne dann das Onomatopoetikum vielfach nicht länger als solches
wahrgenommen werden.
105
Yang (2002, 21) betont die starke Ähnlichkeit zwischen Onomatopoetika und Interjektionen
in phonologischer, lexikalischer, morphologischer und syntaktischer Hinsicht.
Onomatopoetische Laute könnten in Lockrufen (hüh, hott) und Interjektionen (pst, pscht, pfui,
pah, puh) enthalten sein, wobei die Gruppe der Interjektionen weiter auszudifferenzieren sei
in primäre und sekundäre Interjektionen. Der Bereich der primären Interjektionen umfasse
neben den Empfindungswörtern (ach, pfui) und den Onomatopoetika (plumps, peng) auch die
sogenannten Lock- und Scheuchwörter (put, put), während zu den sekundären Interjektionen
Ausrufe wie O Mann! zu rechnen seien.
Havlik (1981) differenziert in seinem Lexikon der Onomatopöien zwischen echten und
umschreibenden Onomatopoetika. Diese unterscheiden sich nach Havlik (1981, 38)
vornehmlich in ihrer Semantik. Während nämlich echte Onomatopoetika keinen semantischen
Gehalt und keine beschreibende Funktion besäßen, beschrieben umschreibende
Onomatopoetika stets einen Vorgang oder eine Tätigkeit. Havlik (ebd.) betrachtet die
umschreibenden Onomatopoetika nicht als direkte Lautimitationen, da sie Laute nicht direkt
ikonisieren, sondern lediglich benennen. Während es sich bei einem echten
Onomatopoetikum wie bum um eine reine Lautnachahmung handele, seien umschreibende
Onomatopoetika wie flatter, stöhn, zirp oder brems nicht ausschließlich mit den
korrespondierenden Geräuschen assoziiert. Die Lautkette bremz beispielsweise impliziere
nicht nur ein quietschendes Geräusch beim Bremsen, sondern referiere zudem auf den
eigentlichen Vorgang des Bremsens.
Havlik (1981, 38) differenziert tabellarisch folgendermaßen zwischen umschreibenden
Onomatopoetika und echten Lautimitationen:
Umschreibende Onomatopoetika vs. echte Lautimitationen nach Havlik (1981, 38):
Umschreibende Onomatopoetika Echte Lautimitationen
kreisch hieeeeh
schnarch rrrch
spitz, zisch pssssscht
rassel drr
knurr rrrgggrrrrwwww
heul buaaa
106
2.0 Funktionen von Onomatopoetika
Wrocklage (2005, 18) sieht eine der Funktionen von Geräuschimitationen in Gesprächen
darin, Unmittelbarkeit herzustellen. In Erzählungen werde der Hörer durch die Verwendung
von Onomatopoetika unmittelbar in das geschilderte Geschehen integriert. Wrocklage (ebd.)
präsentiert zur Illustration dieser Funktion der Onomatopoetika die folgenden Beispiele:
„franz is ja neulichst reingekommen das erste sofort (-) topf genommen wasser und sch sch
(= Geräusch strömenden Wassers)“.
„wir hatten vierzig bierdosen dabei glaub ich und da immer die leeren bierdosen klonk (=
Aufprall der Bierdosen auf der Straße)“.
Schwitalla (2003, 160) geht davon aus, dass Onomatopoetika in den zitierten oder ähnlichen
Fällen stellvertretend für ganze Sätze stehen, mit denen das Geräusch umschrieben werden
könnte. Die Verwendung von Onomatopoetika und die damit verbundene Verkürzung der
Sachverhaltsschilderung wirkten jedoch deutlich eindringlicher.
Lautimitationen würden aus dem Augenblick heraus geboren und seien lexikalisch nicht
fixiert. Insgesamt handele es sich bei den Onomatopoetika aber um Randphänomene der
Sprache.
Surhone/Timpledon/Marseken (2010, 18) verweisen auf die Bedeutung der Verwendung von
Onomatopoetika in der Werbung. Onomatopoetika würden in der Werbung als
mnemotechnische Stütze eingesetzt, die es dem Konsumenten erleichtere, sich an Produkte
und Produktnamen zu erinnern.
Sornig (1986) weist auf das hohe Maß der Verwendung von Onomatopoetika in Comics hin.
Lautimitationen in Comics seien in großer Zahl übersetzt, entlehnt und erfunden worden,
wobei sie oftmals gegen die phonologischen und graphischen Konventionen einer jeweiligen
Sprache verstießen. Nach Sornig (ebd.) lassen sich die Lautimitationen in Comics in drei
Kategorien einteilen, und zwar zunächst in die onomatopoetisch bzw. lautsymbolisch
gestützten Exponenten, zum zweiten in die Geräuschsignale, die aus anderen Sprachen mit
keinen oder nur geringen graphemischen oder phonologischen Änderungen übernommen
wurden und schließlich in die lexikalisierten deskriptiven Muster. Sornig rechnet zu den
onomatopoetisch bzw. lautsymbolisch gestützten Exponenten insbesondere die
Geräuschwörter (ratatat, rums, klatsch), die Tiersignale (wauwau, muh, miau) und die
107
Gefühlswörter (pah, juchu). Dieser Typus von Lautimitationen umfasse die im Deutschen
konventionalisierten Interjektionen und Onomatopoetika.
Bei der Gruppe der Geräuschsignale, die aus anderen Sprachen mit nur geringen
graphemischen oder phonologischen Änderungen übernommen wurden, handelt es sich um
Geräuschwörter wie roarr, schlurp oder slurp, Tiersignale wie arf oder har oder
Gefühlswörter wie sgrompf. Bei diesem Typus der Geräuschsignale handelt es sich also
vornehmlich um entlehnte bzw. transferierte Lautimitationen, die oftmals fremdwortartige
Eigenschaften aufweisen und gegen die orthographischen Regularitäten des Deutschen
verstoßen.
Zur dritten Gruppe der lexikalisierten deskriptiven Muster zählt Sornig Geräuschwörter wie
gähn, glitsch oder dröhn, Tiersignale wie wieher, schnaub oder zirp und Gefühlswörter wie
stöhn oder knirsch. Bei diesem dritten Typus handelt es sich nach Sornig um keine
Lautimitationen im engeren Sinne, sondern vielmehr um eine spezielle Gruppe von
Onomatopoetika mit lautimplizierender Funktion.
Burger (1980, 64) betrachtet die Onomatopoetika der dritten Gruppe als Verkürzungen bereits
vorhandener Handlungsverben (gähn-gähnen, stöhn-stöhnen, knirsch-knirschen). Von Havlik
(1981) werden die Onomatopoetika dieses Typs auch als umschreibende Onomatopoetika
bezeichnet. Ehlich (1986) hebt hervor, dass die Onomatopoetika dieses Typs oftmals von
besonderer sprachspielerischer alltagspraktischer Ironie geprägt seien und eine bedeutsame
Novität innerhalb einer Sprache darstellten.
Nach Surhone/Timpledon/Marseken (2010) werden onomatopoetische Ausdrücke auch dazu
verwendet, um beim Hörer den Eindruck einer sensorischen Wahrnehmung (Geruch, Farbe,
Form, Geräusch, Bewegung) entstehen zu lassen. Onomatopoetika dieses Typs werden von
Surhone/Timpledon/Marseken (ebd.) auch als Ideophone bezeichnet. Bei der Wortklasse der
Ideophone handelt es sich um keine grammatische Wortklasse im traditionellen Sinne,
vielmehr erfolgt die Klassifikation nach phonosemantischen Kriterien. Auffällig ist auch der
potentielle Satzcharakter von Ideophonen, von denen einige eine komplette Äußerung
denotieren können. Surhone/Timpledon/Marseken (2010) führen als Beispiele für Ideophone
die japanischen Formen shiin (als onomatopoetische Form der Beschreibung absoluter Stille)
und kirakira (als onomatopoetische Form der Beschreibung glitzernder Objekte) an. Sprachen
würden sich zum Teil deutlich hinsichtlich des Kontextes, in dem Ideophone zum Einsatz
kommen, unterscheiden. In den meisten Sprachen fänden Ideophone mit ihrer expressiven
Funktion vornehmlich in narrativen Kontexten Verwendung. Die Frequenz der Verwendung
von Ideophonen in der geschriebenen Sprache sei dagegen deutlich geringer. Ein wesentliches
108
Merkmal von Ideophonen sei quer über die Einzelsprachen hinweg die Möglichkeit, ein
Ideophon durch ein verbum dicendi einzuleiten.
3.0 Onomatopoetika im Koreanischen
Der häufige und vielfältige Gebrauch von Onomatopoetika ist ein Spezifikum der
koreanischen als auch der japanischen Sprache (vgl. Tanaka 2011). Tanaka (2011, 188)
erklärt das gehäufte Vorkommen onomatopoetischer Ausdrücke im Japanischen damit, dass
der relativ kleine Adjektiv- und Adverbwortschatz einer Ergänzung durch Onomatopoetika
bedarf. Bei den onomatopoetischen Ausdrücken im Japanischen (und dies gilt auch für das
Koreanische) existiere auch eine Reihe onomatopoetischer Ausdrücke, die keine lautliche
Imitation, sondern eine Zustandsbeschreibung darstellten. Bei der koreanischen und der
japanischen Sprache handelt es sich um agglutinierende Sprachen der ural-altaischen
Sprachfamilie, die einen etwa achtmal höheren Anteil an Onomatopoetika aufweisen als die
meisten Sprachen aus dem europäischen Kontext. So seien im Japanischen und Koreanischen
(vgl. Tanaka 2011, 188) über 2000 Onomatopoetika Gegenstand der alltäglichen
Kommunikation. Tanaka (2011, 192) sieht eine häufige Verwendung von Onomatopoetika
auch in Chat-Foren und SMS-Texten. Dort würden sie neben den sogenannten „Emoticons“
verstärkt eingesetzt. Bei den Emoticons handele es sich um ikonische Nachbildungen von
Emotionen, denen in der pseudo-mündlichen Kommunikation eine besondere
Aufmerksamkeit zukomme. Durch die Verwendung ikonischer (Emoticons) und
indexikalischer Mittel (Onomatopoetika) werde in der Kommunikation ein virtueller
Kommunikationsraum konstruiert.
Bei den im Folgenden aufgelisteten Onomatopoetika aus dem Koreanischen handelt es sich
um eine Zusammenstellung auf der Basis des koreanisch-deutschen Kleinwörterbuchs von
Kih-Seong Kuh, das im Jahre 1985 vom Institut für koreanische Kultur in Bonn
herausgegeben wurde. Das der Publikation des Wörterbuchs vorausgegangene
Wörterbuchprojekt erstreckte sich über einen Zeitraum von fünf Jahren. In das Wörterbuch
fanden circa 16500 Vokabeln auf 300 Seiten Eingang. Angeordnet sind die aufgelisteten
Onomatopoetika entsprechend dem koreanischen Hangul-Alphabet. Zur besseren
Nachvollziehbarkeit und Illustration der phonetischen Realisierung der jeweiligen
Onomatopoetika findet sich in Klammern die jeweilige romanisierte Transliteration, die vom
Verfasser auf der Basis der von Shin und Cho in ihrem Buch „Korean Conversation“ (Seoul
1993) vorgeschlagenen Romanisierung vorgenommen wurde. Die Orientierung am Hangul-
109
Alphabet bezieht sich jedoch ausschließlich auf die zunächst erfolgende Gesamtübersicht der
koreanischen Onomatopoetika. In den weiteren Klassifizierungen (Gruppen 1 bis 5; Gruppe
der Ideophone) erfolgte die Auflistung entsprechend dem lateinischen Alphabet. Die
Transliterationen wurden erneut in Anlehnung an Shin/Cho (1993) vorgenommen.
in Fetzen gerissen: 갈기갈기(galgi galgi)
unschlüssig sein: 갈팡질팡(galpang, chilpang)
gehorsam: 고분고분(gobun gobun)
fast randvoll: 그렁그렁(geureong, geureong)
voller Juckreiz: 근질근질(geunchil geunchil)
hopp, hopp: 깡총깡총, 껑충껑충(kkangchong kkangchong)
gerade und stark: 꼬장꼬장(kkochang kkochang)
festgebunden, festgefroren: 꽁꽁, 꽝꽝(kkong kkong, kkoang kkoang)
zerknittert: 꼬깃꼬깃, 꾸깃꾸깃(kkogish kkogish, kkugish kkugish)
schlummernd: 꼬박꼬박, 꾸벅꾸벅(kkobag kkobag, kkubeog kkubeog)
schwärmend: 꾸역꾸역(kkuyeog kkuyeog)
schlingend, gierig trinkend: 꼴깍꼴깍, 꿀꺽꿀꺽(kkolkkag kkolkkag, kkulkkog kkulkkog)
untereinander: 끼리끼리(kkiri kkiri)
wie lecker! : 냠냠(nyam nyam)
lumpig: 너덜너덜(nodol nodol)
langsam und träge: 느릿느릿(neurish neurish)
auf Anhieb: 다짜고짜(dajja gojja)
übereinander geschichtet: 닥지닥지(dagchi dagchi)
umhertappend: 더듬더듬(deodeum deodeum)
rollenförmig: 둘둘, 뚤뚤(dul dul, dul dul)
durchsuchend: 뒤적뒤적(duijog duijog)
durcheinander: 뒤죽박죽(duijug bagjug)
gelegentlich: 드문드문(deomun deomun)
ständig ein- und ausgehend: 들락날락(deollag nallag)
vereinzelt: 듬성듬성(deomsong deomsong)
einzeln: 따로따로(ttalo ttalo)
110
knacks/haargenau: 딱(ttag)
klingeling: 달랑달랑, 덜렁덜렁 (dallang dallang, dollong dollong)
klar und deutlich: 또박또박(ttobag ttobag)
stolzierend: 또박또박, 뚜벅뚜벅(ttobag ttobag, ttubog ttubog)
tropfenweise: 똑똑, 뚝뚝(ttog ttog, ttug ttug)
hellwach: 말똥말똥, 멀뚱멀뚱(malttong malttong, molttung molltung)
schnell steigend, wachsend: 무럭무럭(murog murog)
haufenweise steigend: 뭉게뭉게(mungge mungge)
heftig zitternd: 벌벌(bol bol)
brodelnd: 보글보글, 부글부글(bogeol bogeol, bugeol bugeol)
heftig zitternd: 부들부들, 와들와들(budeol budeol, wadeol wadeol)
in Windeseile: 부랴부랴 (burya burya)
wankend: 비틀비틀(biteol biteol)
fliehend: 비실비실(bishil bishil)
fröhlich lächelnd: 빙글빙글, 싱글싱글(binggeol binggeol, shinggeol shingeol)
heftig schwitzend: 뻘뻘(ppol ppol)
knirschend:뽀드득 뽀드득(ppodeodeog, ppodeodeog)
verstreut: 뿔뿔이(ppul ppuli)
knarrend: 삐걱삐걱(ppigog ppigog)
sacht und lautlos: 사르르(sareoreo)
zerstreut: 산산이(sansani)
heimlich: 살금살금, 슬금슬금(salgeom salgeom, seolgeom seolgeom)
schüttelnd: 살래살래, 설레설레(sallae sallae, sollae sollae)
anlächelnd: 생글생글, 싱글싱글(saengeol saengeol, shinggeol shinggeol)
etwas aufgeregt:술렁술렁(sullong sullong)
glatt, fließend: 술술(sulsul)
ohne Eile: 쉬엄쉬엄(shuiom shuiom)
unbemerkt: 슬슬(seol seol)
kränklich: 시름시름(shireom shireom)
schmunzelnd: 실실(shil shil)
111
freudig lächelnd: 싱글싱글, 벙글벙글, 싱글벙글(shingeol shingeol, bonggeol bonggeol,
shingeol beonggeol)
unruhig: 싱숭생숭(shingsung sengsung)
paarweise: 쌍쌍이(ssangssangi)
Gerüchte verbreitend: 쑥덕쑥덕(ssugdog ssugdog)
kräftig kratzend: 싹싹,쓱쓱(ssagssag sseogsseog)
muskelzuckend: 쌜룩쌜룩, 씰룩씰룩(ssellug ssellug, ssillug ssillug)
unsicher und wacklig: 아장아장(ajang ajang)
ungeduldig, nervös: 안절부절(anjol bujol)
Stückchen für Stückchen: 야금야금(yageom yageom)
trödelnd: 어물어물(eomul eomul)
immer wieder, flüchtig: 언뜻언뜻(eontteosh eontteosh)
notdürftig, grob: 얼기설기(eolgi seolgi)
ohne Prinzip herumtreibend: 엄벙덤벙(eombong deombong)
stark anhängend: 연연(yeonyeon)
heftig zitternd: 오들오들(odeol odeol)
kommend und gehend: 오락가락(orag garag)
auf und ab: 오르락내리락(oreorag nerirag)
friedlich (plaudernd): 오손도손(osondoson)
streitend: 옥신각신(ogshingagshin)
in Gruppen: 옹기종기(onggijonggi)
donnernd, krachend: 와당탕, 우당탕(wadangtang, udangtang)
zusammenstürzend: 와르르, 우루루(wareoreo, ururu)
krachend: 와지끈, 우지끈(wajikkeon, ujikkeon)
wimmelnd: 우글우글(ugeol ugeol)
zerbeult: 우글쭈글(ugeoljjugeol)
leise raschelnd: 우수수(ususu)
und so weiter: 등등 (deong deong)
heftig brennend: 이글이글(igeol igeol)
immer stärker: 점점(jom jom)
unzählig hängend: 주렁주렁(jurong jurong)
112
ununterbrochen fallend: 주럭주럭(jurog jurog)
schleppend: 질질(jil jil)
krachend, kaputtschlagend: 쨍그랑, 째그렁(jjaenggeorang, jjaegorong)
zwitschernd: 찍찍(jjig jjig)
sorgfältig: 차근차근(chageon chageon)
randvoll: 철철(chol chol)
übereinander gelegen: 첩첩이(chobchobi)
Schicht für Schicht: 층층이(cheongcheongi)
knallend, donnernd: 쾅, 쿵(kwang, kung)
laut schnarchend: 쿨쿨(kulkul)
klopfend: 탁탁, 툭툭(tagtag, tugtug)
bums: 텅(tong)
aufgeschwollen: 탕탕, 퉁퉁(tangtang, tungtung)
zügig: 팍팍(pagpag)
plötzlich aufspringend: 펄쩍, 풀쩍(poljjog, puljjog)
freudig oder zornig hüpfend: 펄펄(polpol)
in üppigen Flocken: 펑펑(pongpong)
plumps: 퐁당,풍덩(pungdang, pungdang)
atemlos: 허겁지겁(hogobjogob)
atemlos, hastig: 허둥지둥(hodungjidung)
aufflammend: 활활, 훨훨(hwalhwal, hweolhweol)
unverrichteter Dinge: 흐지부지(heojibuji)
grinsend: 히죽히죽(hijughijug)
Gruppe 1: Lautsprachliche Realisation von Tierlauten:
(Biene) summen: (벌): 잉잉, 윙윙 (ing ing, weong, weong)
(Ente) quaken: (오리): 꽉꽉(kkwag, kkwag)
(Gans) schnattern: (거위): 꽉꽉(kkwag, kkwag)
(Hahn) kikeriki: 꼬끼오(kkokkio)
(Henne) 꼬꼬댁 꼬꼬(kkokkodaeg kkokko)
113
(Hund) wauwau: 멍멍(mong mong)
(Kalb) blöken: (송아지): 음메(eumme)
(Katze) miauen: (고양이): 냐옹(nyaong)
(Krähe) krächzen: (까마귀): 까악 까악(kkaag kkaag)
(Kuckuck) kuckuck: 뻐꾹뻐꾹(ppeokkug ppeokkug)
(Kuh) muhen: (소): 음메(eumme)
(Maus) piepsen: (쥐): 찍찍(jjig jjig)
(Pferd) wiehern: (말) 히히힝(hihihing)
(Schaf) blöken: (양): 메(me)
(Schlange) zischen: 쉭쉭(shweog, shweog)
(Schwein) quiek-quiek: 꿀꿀(kkul kkul)
(Taube) gurgeln, schnattern: 꼬르륵 꼬르륵, 꾸르륵 꾸르륵(kkoreoreog kkoreoreog,
kkureoreog, kkureoreog)
(Taube) gurren: (비둘기): 구구(gugu)
(Truthahn) schnattern: (칠면조): 꽉꽉(kkwag, kkwag)
(Uhu) uhu, uhu: 부엉부엉(buong buong)
(Vögel) zwitschern: 찍찍(jjig jjig)
(Ziege) blöken: (염소): 메(me)
Gruppe 2: Außersprachliche Geräusche
heftig stöhnen: 끙끙, 낑낑(kkeung kkeung, kking kking)
heulen, weinen: 엉엉울다(ongongulda)
in sich hineinlachen: 껄껄웃다(kkolkkolutta)
keuchen: 시근시근(shigeun shigeun)
kichern: 낄낄대다(kkilkkildaeda)
knurren, brummen: 투덜거리다(tudolgorida)
kreischen: 외치다(oechida)
kreischen, schreien: 빽 소리치다(baegsorichida)
laut lachen: 하하웃다(hahautta)
laut lachen: 깔깔 (웃다) (Frau) (kkalkkal (utta))
114
laut lachen 껄껄 (웃다) (Mann) (kkolkkol (utta))
laut schnarchen: 쿨쿨(kulkul)
murmeln: 소곤거리다(sogongorida)
schluchzen: 훌쩍거리다(huljjoggorida)
Die Gruppe 3 setzt sich zu gleichen Teilen aus der Gruppe der Wassergeräusche und
der nicht-akustischen Phänomene zusammen:
platschen: 철퍽철퍽(cholpog cholpog)
plätschern: 찰랑찰랑, 철렁철렁(challang challang, chollong chollong)
plätschern: 졸졸(jol jol)
rauschen: 줄줄(jul jul)
tröpfeln, rieseln: 질끔찔끔(chilkkeum chilkkeum)
rieselnd: 보슬보슬, 부슬부슬(boseul boseul, buseul buseul)
tröpfeln (des Regens in kleinen Blasen): 방울 방울(bangul bangul)
Gruppe der nicht-akustischen Phänomene: (zur Gruppe der Ideophone
hinzuzurechnen)
flackern, flimmern: 깜빡거리다(kkamppag gorida)
flattern, zittern, sich unruhig hin und her bewegen: 펄럭거리다(pollog gorida)
grinsen: 히죽히죽(hijug hijug)
schimmern: 반짝거리다(banjjag gorida)
schlummern: 꼬박꼬박, 꾸벅꾸벅(kkobag kkobag, kkubog kkubog)
schmunzeln: 실실(shil shil)
tapsen, watscheln, unsicheres Gehen (des Babys): 아장아장 (아기) (ajang ajang)
Gruppe 4: sprachliche Geräusche
gründlich (fragen): 꼬치꼬치(kkochi kkochi)
leise flüsternd: 소곤소곤, 수군수군(sogon sogon, sugon sugon)
wispernd: 수덕수덕(sudeog sudeog)
115
Gruppe 5 der atmosphärischen Geräusche:
heulen (Wind): 휘이이(hwiii)
leise rauschen, sanft wehen: 솔솔(sol sol)
leise rauschend: 살살(sal sal)
Gruppe der Ideophone
Nach Surhone/Timpledon/Marseken (2010) onomatopoetische Ausdrücke, die beim Hörer
den Eindruck einer sensorischen Wahrnehmung (Geruch, Farbe, Form, Geräusch, Bewegung
etc.) erzeugen sollen:
Onomatopoetische Ausdrücke zur sensorischen Wahrnehmung (Bewegung):
rollend: 데굴데굴, 떼굴떼굴(degul degul, ttegul ttegul)
langsam und träge: 느릿느릿(neurit neurit)
sacht schreitend: 사뿐사뿐 (sappun sappun)
Onomatopoetische Ausdrücke zur sensorischen Wahrnehmung (Form):
geschlängelt: 구불구불(gubul gubul)
gebogen, kurvenreich: 굽이굽이(gubi gubi)
zickzack, gewunden: 꼬불꼬불, 꾸불꾸불(kkobul kkobul, kkubul kkubul)
zerbeult: 우글쭈글(ugeul jjugeul)
Onomatopoetische Ausdrücke zu sensorischen Wahrnehmung (Farbe):
rötlich: 발긋발긋, 빨긋빨긋(bageut bageut, ppalgeut ppalgeut)
rötlich: 불긋불긋, 뿔긋뿔긋(bulgeut bulgeut, ppulgeut ppulgeut)
bunt: 울긋불긋(ulgeut bulgeut)
Die Analyse der aufgelisteten Onomatopoetika aus dem Koreanischen zeigt, dass die
lautsprachlichen Realisationen von Tierlauten (Gruppe 1) den größten Anteil der
116
Onomatopoetika ausmachen. Dabei fällt auf, dass im Koreanischen einige Tiersignale, die im
Deutschen eine Differenzierung erfahren, mit derselben Lautimitation bedacht werden. So
lautet die lautsprachliche Realisierung des Quakens der Ente, des Schnatterns der Gans und
des Truthahns꽉꽉(kkwag, kkwag). Ebenso wird sowohl das Piepsen der Maus als auch das
Zwitschern des Vogels lautlich mit dem Onomatopoetikum찍찍(jjig jjig) realisiert. Auch das
Blöken des Schafs und der Ziege erfährt dieselbe lautsprachliche Realisierung 메(me).
Hinsichtlich des quantitativen Umfangs stellen die außersprachlichen Geräusche die
zweitgrößte Gruppe der Onomatopoetika im Koreanischen dar. Zu dieser Gruppe zählen
lautsprachliche Realisierungen wie 끙끙 낑낑, (kkeung kkeung, kking kking) zur Beschreibung
eines heftigen Stöhnens oder 엉엉울다(ongongulda) zur Denotation des Weinens.
Die drittgrößte Gruppe der Onomatopoetika bilden zu etwa gleichen Teilen die Gruppen der
Wassergeräusche und der nicht-akustischen Phänomene. Dabei kann die Gruppe der nicht-
akustischen Phänomene (z.B. 깜빡거리다(kkamppag gorida) oder 반짝거리다(banjjag
gorida)) zu den Ideophonen gerechnet werden, da durch ihre Verwendung beim Hörer der
Eindruck einer sensorischen Wahrnehmung entstehen kann.
Von deutlich geringerem quantitativem Umfang sind die Gruppen der sprachlichen
(수덕수덕(sudeog sudeog) = wispernd) und der atmosphärischen Geräusche (휘이이(hwiii) =
heulen des Windes).
In der Gruppe der Ideophone, die beim Hörer den Eindruck einer sensorischen
Wahrnehmung bezüglich Geruch, Farbe, Form, Geräusch oder Bewegung erzeugen können,
dominieren die onomatopoetischen Ausdrücke zur sensorischen Wahrnehmung von
Bewegung (z.B. 데굴데굴, 떼굴떼굴 = rollend), Form (z.B. 구불구불 = geschlängelt) und Farbe
(z.B. 발긋발긋 빨긋빨긋, = rötlich).
4.0 Fazit
Gegenstand des vorliegenden Beitrags waren die onomatopoetischen Ausdrücke im
Koreanischen. Es wurde festgestellt, dass es sich bei den Onomatopoetika nicht um
vollständige Imitationen ursprünglicher Naturlaute handelt, sondern um Ausdrücke, die eine
nur relative Affinität zu natürlichen Erscheinungen aufweisen. Starke naturalistische
Positionen, die in der Imitation von Naturlauten den Schlüssel für die Entstehung von Sprache
sehen, wurden zurückgewiesen.
117
Es wurde zudem für die Einnahme einer sprachhistorischen Perspektive bei der Betrachtung
von Onomatopoetika plädiert, da die Bewertung onomatopoetischer Ausdrücke bei der
Einnahme einer synchronen Perspektive anders ausfallen kann als bei Einnahme einer
diachronen Perspektive.
Mit Groß (1988) und Yang (2002) wurde zwischen lautmalenden Wörtern sowie integrierten
und eigentlichen Onomatopoetika differenziert. Während die flektierbaren lautmalenden
Wörter stets auf ein Geräusch referieren, beziehen sich die ebenfalls flektierbaren integrierten
Onomatopoetika nicht ausschließlich auf ein Geräusch, sondern auch auf außerakustische
Kategorien. Die eigentlichen Onomatopoetika sind vornehmlich über das Merkmal ihrer
Flexionslosigkeit definiert.
Hinsichtlich der Funktionen von Onomatopoetika wurde mit Wrocklage (2005) auf die
Funktion von Geräuschimitationen in Gesprächen verwiesen. Onomatopoetika dienten in
diesem Kontext dazu, Unmittelbarkeit im Gespräch herzustellen und den Hörer in das
geschilderte Geschehen zu integrieren.
Mit Surhone/Timpledon/Marseken (2010) und Sornig (1986) wurde auf die Bedeutung der
Verwendung von Onomatopoetika in der Werbung und das hohe Maß ihrer Verwendung in
Comics verwiesen. Onomatopoetische Ausdrücke, die beim Hörer den Eindruck einer
sensorischen Wahrnehmung bezüglich Geruch, Farbe, Form, Geräusch oder Bewegung
entstehen lassen können, wurden in Anlehnung an Surhone/Timpledon/Marseken (2010) als
Ideophone bezeichnet.
Bezüglich der Verwendung von Onomatopoetika im Koreanischen wurde festgestellt, dass
das Koreanische, ebenso wie das Japanische, über einen hohen Anteil onomatopoetischer
Ausdrücke verfügt. Offenbar bedarf der relativ kleine Adjektiv- und Adverbwortschatz in
diesen beiden agglutinierenden Sprachen der ural-altaischen Sprachfamilie einer Ergänzung
durch Onomatopoetika.
Hinsichtlich der Verteilung der Onomatopoetika im Koreanischen konnte festgestellt werden,
dass die lautsprachliche Realisation von Tierlauten die größte Gruppe der Onomatopoetika
ausmacht. Als zweitgrößte Gruppe folgen die Onomatopoetika zur Denotation
außersprachlicher Geräusche. Nach den quantitativ etwa gleichgroßen Gruppen der
Wassergeräusche und der nicht-akustischen Phänomene folgen im Weiteren die Gruppen der
sprachlichen Geräusche und der atmosphärischen Geräusche.
In der Gruppe der Ideophone dominieren die onomatopoetischen Ausdrücke zur sensorischen
Wahrnehmung von Bewegung, Form und Farbe.
118
5.0 Literatur:
Bühler, Karl: Sprachtheorie. Stuttgart/New York 1983.
Burger, Harald: „Interjektionen - eine Randwortart?“ In: Sitta, Horst (Hrsg.): Ansätze zu einer
pragmatischen Sprachgeschichte. Tübingen 1980, 53-69.
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Ehlich. Konrad: Interjektionen. Tübingen 1986.
Gross, Michael: Zur linguistischen Problematisierung des Onomatopoetischen. Hamburg
1988.
Havlik, Ernst: Lexikon der Onomatopöien. Die lautmalenden Wörter im Comic. Frankfurt
1981.
Kuh, Kih-Seong: Koreanisch-deutsches Kleinwörterbuch. Institut für koreanische Kultur
Bonn (Hrsg.). Bonn 1985.
Sornig, Karl: Holophrastisch-expressive Äußerungsmuster. Anhand der Onomasiologie und
Semasiologie der interjektionellen und expressiven Ausdrucks- und Darstellungsmittel
der trivial-narrativen Gattung „fumetti“. Graz 1986.
Surhone, Lambert M. /Timpledon, Miriam T. /Marseken, Susan F. (Hrsg.): Sign. Beau Bassin.
Mauritius 2010.
Tanaka, Shin: Deixis und Anaphorik: Referenzstrategien in Text, Satz und Wort.
Berlin/Boston 2011.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch. Band 2. Heidelberg 1985.
Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik. 5.
erweiterte Auflage. Tübingen 2004.
Schwitalla, Johannes: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin 2003.
Shin, Myong-Sup/Cho, Hong-Seob: Korean Conversation. Seoul 1993.
Wrocklage, Nadine: Lexikalische Kategorien: Interjektionen und Onomatopoetika. München
2005.
Yang, Chaiqin: Interjektionen und Onomatopoetika im Sprachvergleich: Deutsch versus
Chinesisch. Freiburg im Breisgau 2002 (Dissertation).
Zöllner, Philipp: Onomatopoetika verschiedener Sprachen im Vergleich. München 2004.
119
VIII. Sprichwörter im Deutsch-Koreanischen Sprachvergleich
1.0 Einleitung
Bei Sprichwörtern wie Hunde, die bellen, beißen nicht oder Morgenstund hat Gold im Mund
handelt es sich nach Althaus et al. (1980, 185) um „allgemein bekannte, festgeprägte Sätze,
die eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrücken, häufig mit End-
oder Stabreim“. Idiome könnten Teile von Sprichwörtern sein, wie das Sprichwort Wer
andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein mit seinem idiomatischen Bestandteil jemandem
eine Grube graben illustriere.
Nach Häusermann (1977) gehören Sprichwörter nicht zur Gruppe der Phraseologismen, da es
sich bei ihnen stets um selbständige, motivierbare Texte handele, die sich durch ihre
Bildlichkeit auszeichneten. Anders als Häusermann (ebd.) rechnet Burger (2007, 110) die
Sprichwörter zum Bereich der Phraseologie. Sprichwörter seien polylexikalisch, in gewissen
Grenzen fest und in unterschiedlichem Grad idiomatisch. So seien Sprichwörter mit nur einer
Lesart (Ein Unglück kommt selten allein, Geld macht nicht glücklich, Aus Schaden wird man
klug) von Sprichwörtern mit zwei Lesarten (Wie man sich bettet, so schläft man, Keine Rose
ohne Dornen, Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen
die Mäuse auf dem Tisch, Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht) zu unterscheiden.
Teilweise wiesen Sprichwörter, häufig diejenigen mit einem höheren Maß an Idiomatizität,
auch Irregularitäten in ihrer Bildung auf (Wes‘ Brot ich ess‘, des Lied ich sing, Gut Ding will
Weile haben, Eigener Herd ist Goldes wert).
Lewandowski (1985, 1044) betrachtet Sprichwörter als feste Wortverbindungen, die aus
vollständigen bzw. formal und inhaltlich abgeschlossenen Sätzen bestehen. Sprichwörter wie
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Lügen haben kurze Beine oder Ohne Fleiß kein Preis seien
ein Ausdruck von Erfahrungen, Meinungen oder Anschauungen und stellten ein Gemeingut
einer Sprachgemeinschaft dar.
Lewandowski (ebd.) sieht die Hauptfunktion eines Sprichwortes in der Stützung oder
Unterstreichung der eigenen Meinung. So könne beispielsweise eine Argumentation in einem
Sprichwort kulminieren oder durch ein solches abgeschlossen werden.
Weitere Funktionen von Sprichwörtern seien die Warnung, Überredung, Bestätigung,
Besänftigung, Überzeugung, Mahnung, Zurechtweisung, Feststellung, Charakterisierung,
Erklärung, Beschreibung, Rechtfertigung, Zusammenfassung oder aber der Trost.
120
Abzugrenzen seien Sprichwörter von sprichwörtlichen Redensarten wie etwas auf die leichte
Schulter nehmen oder jemanden am Gängelband führen, die stets syntaktisch einzubetten
seien.
Burger (1973, 54) stellt fest, dass sich Sprecher bei der Verwendung eines Sprichwortes auf
eine Volkswahrheit berufen. Im Sprichwort breche eine längst empfundene Wahrheit
blitzartig hervor. Dem Sprichwort hafte zudem eine stilistische Wirkung mit ausgeprägten
poetischen Elementen an. Gekennzeichnet seien sie zudem häufig durch Rhythmus oder
Parallelismus.
Burger (1973, 55) gliedert die Sprichwörter in zwei Gruppen, wobei zu der ersten Gruppe
diejenigen Sprichwörter gerechnet werden, deren Bedeutung sich direkt aus den
Einzelkomponenten ergibt. Hierzu gehören u.a. die folgenden:
Irren ist menschlich
Wer wagt, gewinnt
Ende gut, alles gut
Ehrlich währt am längsten
Lügen haben kurze Beine
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Zur zweiten Gruppe gehören diejenigen Sprichwörter, bei denen die allgemeine Bedeutung
durch ein Bild vermittelt wird. Auch idiomatische Elemente können Teile der Sprichwörter
dieser Gruppe sein. Der Sinn des Sprichwortes ergibt sich in diesen Fällen nicht zwingend aus
dem Bild.
Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist
Je näher der Kirche, je weiter von Gott
Mitgefangen, mitgehangen
Neue Besen kehren gut.
Burger (1973, 56) betont hinsichtlich der Merkmale von Sprichwörtern, dass diese teilweise
Anomalien aufweisen können. Zwischen den einzelnen Gliedern innerhalb eines Sprichwortes
könne zudem eine Opposition bestehen, die aber auch fehlen könne. Formal würden
Sprichwörter im Allgemeinen als Aussagen, Aufforderungen oder Fragen realisiert. Typisch
für ein Sprichwort sei, dass es sich zwar auf einen Einzelfall beziehe, von diesem Einzelfall
121
ausgehend jedoch eine Beziehung zu einer Regel herstelle, die zudem begründet werde. Auf
diese Weise werde eine gegenwärtige Situation gegen den Hintergrund allgemeiner Erfahrung
gehalten.
Wer ein Sprichwort verwende, distanziere sich von einer unmittelbar gegebenen Situation und
trete in einem Akt der Reflexion aus dieser Situation heraus. Der adäquate Gebrauch eines
Sprichwortes setze auf Seiten des Sprechers ein gewisses Maß der Bewusstheit des Sprechens
voraus, während auf Seiten des Hörers insbesondere die Fähigkeit zum Durchschauen der
Transparenz eines Sprichwortes erforderlich sei.
Burger (2007, 108) betont, dass Sprichwörter in ihrer Produktion und Rezeption ganzheitlich
als Einheiten abgerufen werden und keinerlei textlinguistischer Anpassung an einen Kontext
bedürfen. Sprichwörter seien mithin als „geschlossene Sätze“ (geschlossene Formen) zu
begreifen, die zudem auf der Hörerseite kontextfrei zu verstehen seien. Nach Burger (ebd.)
weisen Sprichwörter häufig die Form eines Allsatzes auf (Wer A sagt, muss auch B sagen,
Lügen haben kurze Beine), zudem seien sie entindexikalisiert und enthielten keine Hinweise
auf Sprecher, Ort und Zeitpunkt einer Äußerung oder eines Sachverhaltes.
Burger (2007, 109) betont in Anlehnung an Permjakov (1984) auch die interkulturelle
Dimension von Sprichwörtern. So seien über Kulturgrenzen hinaus konstante Bildungstypen
von Sprichwörtern feststellbar. So gebe es bei Völkern, die kein Eisen kennen,
selbstverständlich nicht das Sprichwort Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist,
wohl aber gebe es Ausdrücke wie Forme aus dem Lehm, solange er feucht ist oder Bereite
den Kürbis zu, solange das Feuer nicht erloschen ist. Alle diese Texte bedeuteten in der Tat
dasselbe, nämlich dass eine Sache zu tun sei, solange es noch nicht zu spät dazu ist.
Burger (2007, 111) hebt auch die enge Verwandtschaft zwischen Sprichwörtern einerseits und
Gemeinplätzen und Truisms hervor. Durch Gemeinplätze (Was man hat, das hat man, Was
sein muss, muss sein, Was zu viel ist, ist zu viel) oder Truisms (So jung kommen wir nicht
mehr zusammen, Wir sind alle nur Menschen, Man lebt nur einmal) werde dem Gemeinten,
wie auch durch ein Sprichwort, Nachdruck verliehen. Oftmals enthalte das Gesagte auch
einen Hauch von Fatalismus (Was sein muss, muss sein).
122
2.0 Sprichwörter im Deutschen und im Koreanischen
Baur/Chlosta (1996, 22) führen in ihrem Beitrag zur Sprichwortforschung und
Sprichwortdidaktik die folgenden Sprichwörter als die zentralen und frequentesten deutschen
Sprichwörter auf, von denen viele korrespondierende Sprichwörter im Koreanischen
aufweisen, die im Folgenden aufgeführt sind:
Liste deutscher Sprichwörter:
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Man ist so alt, wie man sich fühlt.
Aller Anfang ist schwer.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Doppelt hält besser.
Wie du mir, so ich dir.
Eigenlob stinkt.
Einmal ist keinmal.
Ende gut, alles gut.
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Ohne Fleiß kein Preis.
Gegensätze ziehen sich an.
Geld allein macht nicht glücklich.
Gelegenheit macht Diebe.
Über den Geschmack lässt sich nicht streiten.
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Eine Hand wäscht die andere.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Wer nicht hören will, muss fühlen.
123
Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn.
Hunde, die bellen, beißen nicht.
Irren ist menschlich.
Kleider machen Leute.
Der Klügere gibt nach.
Viele Köche verderben den Brei.
In der Kürze liegt die Würze.
Ein Küsschen in Ehren kann niemand verwehren.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Andere Länder, andere Sitten.
Den Letzten beißen die Hunde.
Was sich liebt, das neckt sich.
Lügen haben kurze Beine.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
Von nichts kommt nichts.
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert.
Probieren geht über Studieren.
Wer rastet, der rostet.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Scherben bringen Glück.
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Übung macht den Meister.
Ein Unglück kommt selten allein.
Unkraut vergeht nicht.
Wer wagt, gewinnt.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Die Zeit heilt alle Wunden.
Kommt Zeit, kommt Rat.
124
Liste der deutschen Sprichwörter und ihrer koreanischen Entsprechungen:
Wer A sagt, muss auch B sagen.
한 번 시작한 일은 끝을 맺어야 한다.
Aller Anfang ist schwer.
시작이 반이다. (eher im Sinne von: frisch gewagt ist halb gewonnen)
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
그 아버지에 그 아들.
Doppelt hält besser.
공든 탑이 무너지랴.
Wie du mir, so ich dir.
심은 대로 그둔다.
Eigenlob stinkt.
자화자찬은 듣기 거북하다.
Einmal ist keinmal.
첫 술에 배 부르랴.
Ende gut, alles gut.
끝이 좋으면 모두가 좋다.
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
시작이 반이다. (s.o.)
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
반짝이는 것이 모두 금은 아니다.
125
Eine Hand wäscht die andere.
가는 정 오는 정.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
남잡이가 제잡이.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
오늘 할 일을 내일로 미루지 말라.
Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn.
쥐 구멍에도 볕들 날 있다.
Hunde, die bellen, beißen nicht.
짓는 개가 물지 않는다.
Irren ist menschlich.
과오는 누구에게나 있는 것이다.
Kleider machen Leute.
옷이 날개다.
Der Klügere gibt nach.
현자는 다투지 않는다.
Viele Köche verderben den Brei.
사공이 많으면 배가 산으로 간다.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
길고 짧은 것은 대봐야 안다.
Andere Länder, andere Sitten.
로마에 가면 로마법을 따라야 한다.
126
Lügen haben kurze Beine.
거짓말은 다리가 짧다.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
아침 시간은 금이다.
Von nichts kommt nichts.
세상에 공짜란 없다.
Probieren geht über Studieren.
백문이 불여일견.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
침묵은 금이요, 웅변은 은이다.
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
너 자신을 알라.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
고래 싸움에 새우 등 터진다.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
길고 짧은 것은 대봐야 안다
Ein Unglück kommt selten allein.
엎친 데 덮친 격이다.
Wer wagt, gewinnt.
용감한 자가 미인을 얻는다.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus.
콩 심은데 콩나고, 팥 심은데 팥 난다.
127
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
뜻이 있는 곳에 길이 있다.
Die Zeit heilt alle Wunden.
세월이 약이다.
Die Analyse der korrespondierenden koreanischen Sprichwörter zeigt, dass einige von ihnen
direkte Übersetzungen aus dem Englischen zu sein scheinen:
Ende gut, alles gut.
끝이 좋으면 모두가 좋다.
(All is well that ends well.)
Andere Länder, andere Sitten.
로마에 가면 로마법을 따라야 한다.
(When in Rome do as the Romans do.)
Keine Nachricht ist eine gute Nachricht.
무소식이 희소식이다.
(No news is good news.)
Der Sprichwortvergleich zwischen dem Deutschen und dem Koreanischen zeigt zudem, ganz
im Sinne Permjakovs (s.o.) Annahme konstanter Bildungstypen von Sprichwörtern, dass
einige koreanische und deutsche Sprichwörter bei Unterschieden in der sprachlichen Bildung
einen weitgehend identischen Inhalt (Sinn) transportieren.
In diese Kategorie fällt beispielsweise das Sprichwort:
Viele Köche verderben den Brei.
사공이 많으면 배가 산으로 간다.
Hier lautet die wörtliche koreanische Entsprechung: „Zu viele Kapitäne/Ruderer steuern das
Schiff auf den Berg“.
128
Ähnliches gilt auch für das Sprichwort:
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
고래 싸움에 새우 등 터진다.
Hier lautet die wörtliche koreanische Entsprechung: „Wenn die Wale streiten, platzt der
Rücken der Garnelen“. Der Sinn der Sprichwörter („Die Handlungen anderer haben
Auswirkungen auf Dritte“) bleibt weitgehend erhalten.
Das Sprichwort세상에 공짜란 없다 (Auf der Welt gibt es nichts umsonst) entspricht
weitgehend den deutschen Sprichwörtern Von nichts kommt nichts bzw. Ohne Fleiß kein
Preis.
Das koreanische Sprichwort윗 물이 맑아야 아랫 물도 맑다 (Nur wenn der Oberlauf klar
ist, ist auch der Unterlauf klar) entspricht weitgehend dem deutschen Sprichwort Der Fisch
stinkt vom Kopf her.
Die koreanische Entsprechung zu dem deutschen Sprichwort Ein blindes Huhn findet auch
einmal ein Korn lautet쥐 구멍에도 볕들 날 있다 (Auch in ein Mauseloch fällt irgendwann
einmal ein Lichtstrahl). Der transportierte Sinn ist in beiden Sprichwörtern weitgehend
identisch.
Neben diesen festgestellten Korrespondenzen zwischen koreanischen und deutschen
Sprichwörtern gibt es jedoch auch eine Reihe von koreanischen Sprichwörtern zu denen eine
Entsprechung im Deutschen fehlt. In diese Gruppe fallen u.a. die folgenden Sprichwörter:
Wo die Nadel hingeht, geht auch der Faden hin.
바늘 가는 데 실 간다.
(Bedeutung: Zwei Menschen machen alles gemeinsam und sind unzertrennlich.)
Auch einen Weg von Tausend Meilen beginnt man mit einem Schritt.
천리 길도 한 걸음부터.
(Bedeutung: In vielen kleinen Schritten gelangt man zu einem großen Ziel.)
129
Worte ohne Füße gehen tausend Meilen.
발 없는 말이 천리 간다.
(Bedeutung: Gerüchte verbreiten sich schnell und lang anhaltend.)
Der hohe Baum ist dem Wind am stärksten ausgesetzt.
높은 나무가 바람 더 탄다.
(Bedeutung: Wer aus (der Masse) herausragen will, ist in Gefahr.)
Selbst das Diamantengebirge sollte man nach dem Essen genießen.
금강산도 식후경이다.
(Bedeutung: Mit leerem Magen kann man auch das Diamantengebirge nicht genießen; man
muss alles gut gestärkt tun.)
Kommt aus einem Kamin, der nicht an ist, Rauch hervor?
아니 땐 굴뚝에 연기 날까?
(Bedeutung: Keine Wirkung ohne Ursache)
Auch Affen fallen aus den Bäumen.
원숭이도 나무에서 떨어질 날 있다.
(Bedeutung: Auch der Meister macht einmal Fehler; Irren ist menschlich.)
Ein leerer Karren rattert lauter.
빈 수레가 요란하다. 빈 깡통이 요란하다.
(Bedeutung: Jemand mit einem leeren Hirn verursacht besonders viel Lärm.)
Nach dem Verlust einer Kuh repariert man den Stall.
소 잃고 외양간 고친다.
(Bedeutung: Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen.)
Sammele Staub, um einem Berg zu errichten.
티끌 모아 태산.
(Bedeutung: Sei sparsam!)
130
Wer zwei Hasen zugleich hetzt, bekommt keinen.
두 마리의 토끼를 쫓다가 한 마리도 못 잡는다.
(Bedeutung: Man sollte sich auf ein Ziel konzentrieren.)
Baur/Chlosta (1996, 125) betonen für die Sprichwörter des Deutschen, dass die traditionellen
Muster der Sprichwortverwendung allmählich in den Hintergrund zu treten scheinen.
Charakteristisch, insbesondere für den Sprichwortgebrauch in öffentlicher Sprachverwendung
in den Medien und der Werbung, sei der insgesamt spielerische Umgang mit Sprichwörtern.
Beim spielerischen Umgang mit Sprichwörtern spielten vor allem auch ihre Festigkeit und
Metaphorizität eine entscheidende Rolle. Sprichwörter würden nicht nur im historischen
Rückblick, sondern auch in ihrer aktuellen Verwendung Modifikationen erfahren. Insofern
unterscheide sich der Umgang mit Sprichwörtern nicht wesentlich vom Umgang mit anderen
Arten von Phraseologismen.
Ziel der heutigen Sprichwortforschung sollte es sein, sogenannte „Sprichwort-Minima“, also
Sammlungen allgemein bekannter Sprichwörter zu erstellen. Dies sei unter kulturellen
Gesichtspunkten auch deshalb interessant, weil die gebräuchlichsten Sprichwörter Aufschluss
darüber geben können, wie Sprecher die Welt typischerweise sehen. Baur/Chlosta (1996, 127)
gehen davon aus, dass in Sprichwörtern versprachlichte Situationen im Bewusstsein einer
Sprechergemeinschaft von besonderer Bedeutung sind. Sprichwortsammlungen könnten also
mithin Auskunft darüber geben, welche Sprichwörter zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer
Sprechergemeinschaft als wichtig gelten und wie sie gegebenenfalls modifiziert werden.
3.0 Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurden, nach einer theoretischen Einführung in den
Gegenstandsbereich der Sprichwörter, die Sprichwörter des Deutschen und des Koreanischen
miteinander verglichen. Dabei wurden die Sprichwörter, als Gegenstandsbereich der
Phraseologie, zunächst als feste Wortverbindungen charakterisiert, die aus vollständigen bzw.
formal und inhaltlich abgeschlossenen Sätzen bestehen. Die Hauptfunktion der Sprichwörter
wurde in der Unterstreichung der eigenen Meinung gesehen. Abgegrenzt wurden
Sprichwörter von sprichwörtlichen Redensarten, da letztere stets syntaktisch einzubetten
seien. In Anlehnung an Burger (1973) wurde zwischen Sprichwörtern, deren Bedeutung sich
aus den Einzelkomponenten ergibt und solchen, deren Bedeutung durch ein Bild vermittelt
wird, differenziert. Es wurde zudem betont, dass Sprichwörter zum Teil Anomalien aufweisen
131
können und gerade diese Sprichwörter einen oftmals höheren Grad an Idiomatizität besitzen.
In Anlehnung an Burger (2007) und Permjakov (1984) wurde festgestellt, dass Sprichwörtern
häufig eine interkulturelle Dimension zu eigen ist. Es seien über Kulturgrenzen hinweg
konstante Bildungstypen von Sprichwörtern feststellbar. Mit Burger (2007) wurde festgestellt,
dass Sprichwörter eine enge Verwandtschaft zu Gemeinplätzen und Truisms aufweisen. Alle
drei Bereiche der Phraseologie dienten dazu, einer Aussage Nachdruck zu verleihen.
Ein Vergleich der frequentesten deutschen Sprichwörter (nach Baur/Chlosta 1996) mit
koreanischen Sprichwörtern ergab, dass viele deutsche Sprichwörter korrespondierende
Sprichwörter im Koreanischen aufweisen. Einige koreanische Sprichwörter scheinen zudem
direkte Übersetzungen aus dem Englischen zu sein. Im Sinne Permjakows (1984) konnte
bestätigt werden, dass im Koreanischen und Deutschen ähnliche (konstante) Bildungstypen
von Sprichwörtern zu existieren scheinen. Trotz unterschiedlicher sprachlicher Realisierung
wird ein weitgehend identischer Sinn (Inhalt) transportiert.
Abschließend wurde mit Baur/Chlosta (1996) gefordert, „Sprichwort-Minima“, also
Sammlungen bekannter Sprichwörter (auch kontrastiv) anzulegen. Auf diese Weise seien
Einblicke in die typische Weltsicht von Sprechern verschiedener Sprachen und Kulturen
möglich.
4.0 Literatur:
Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst: Lexikon der germanistischen
Linguistik. Tübingen 1980.
Baur, Rupprecht S./Chlosta, Christoph: Welche Übung macht den Meister? Von der
Sprichwortforschung zur Sprichwortdidaktik“. In: Fremdsprache Deutsch 15 (1996),
17-24.
Burger, Harald: Idiomatik des Deutschen. Tübingen 1973.
Burger, Harald: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 3. neu bearbeitete
Auflage. Berlin 2007.
Häusermann, Jürg: Phraseologie. Tübingen 1977.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch, Band 3. Tübingen 1985.
Permjakov, Grigorij L’vovic: „Die Grammatik der Sprichwörterweisheit“. In: Peter Grzybek
(Hrsg.): Semiotische Studien zum Sprichwort. Simple Forms Reconsidered I. Hrsg.
von Peter Grzybek unter Mitarbeit von Wolfgang Eismann. Special Issue of: Kodikas
Code - Ars Semiotica. An International Journal of Semiotics 3/4 (1987).
132
IX. Schimpf- und Tabuwörter im Deutschen, Englischen und Koreanischen
1.0 Einleitung
Bei Schimpfwörtern (Lateinisch: maledictum - maledicta) handelt es sich um Wörter, die
durch ihre stark abwertende pejorative Bedeutung geeignet sind, andere Personen zu
beleidigen oder herabzusetzen. Während Vulgarismen durch ihre Derbheit und Obszönität
primär das Schamgefühl anderer Menschen verletzen, handelt es sich bei diskriminierenden
Schimpfwörtern um rassistische, chauvinistische, sexistische oder homophobe
Herabsetzungen. Ethnophaulismen diskriminieren ganze ethnische Gruppen und durch
blasphemische Ausdrücke werden Glaubensinhalte einer Religion verhöhnt. Als
Unterdisziplin der Linguistik beschäftigt sich die Malediktologie mit der Semantik und
Pragmatik von Schimpfwörtern.
Gelegentlich ist in Bedeutung und Verwendung von Schimpfwörtern auch die Tendenz einer
positiven Umdeutung ursprünglicher Schimpfwörter beobachtbar. So werden zum Teil
Wörter, die der Herabsetzung einer Personengruppe dienten (z.B. Hure, schwul) von dieser
ameliorisiert.
Unter Tabuwörtern versteht Bußmann (1983, 529f.) Ausdrücke, die vornehmlich dem
religiösen, abergläubischen, politischen oder sexuellen Bereich entstammen und einem
Meidungsgebot unterliegen. Ausdrücke dieser Art würden zumeist durch euphemistische
Umschreibungen ersetzt (z.B. verflixt für verhext, Potzblitz für Gottes Blitz, Gottseibeiuns für
Teufel). Lewandowski (1985, 1086) spricht im Zusammenhang der Tabuwörter auch von
Wort- und Satztabus bzw. von sprachlicher Geheimhaltung. Ein zumeist aus dem religiösen
oder intimen Bereich stammendes Wort dürfe in einer Sprachgemeinschaft nur unter
besonderen Bedingungen verwendet werden. Ein Tabuwort dürfe keineswegs leichtfertig
ausgesprochen werden.
Lewandowski (ebd.) betont, dass es sich bei Tabus keinesfalls um allgemein menschliche
Erscheinungen (Universalien) handelt. Tabus seien vielmehr an bestimmte Gemeinschaften
und Epochen gebunden und der tabuisierte Ausdruck könne auch gruppenspezifischer Art
sein. Dem Sprachtabu werde eine magische Kraft beigemessen. Das Aussprechen des
tabuisierten Wortes berge das Potential der Veränderung der Welt.
Tabus können sich mit ihrem sozialen Normcharakter auf Wörter, Dinge (z.B.
Nahrungstabus), Handlungen (z.B. Inzesttabu) und ganze Themenbereiche beziehen. Durch
die Tabubelegung werden bestimmte Themen vor dem Diskurs in einer Gemeinschaft
133
geschützt. Tabuthemen betreffen insbesondere Zustände der Körperlichkeit wie die Sexualität,
die Krankheit sowie das Altern und den Tod.
2.0 Schimpf- und Tabuwörter im Deutschen
Pinker (2007, 430) illustriert die Bedeutung und Verwendung deutscher Schimpf- und
Tabuwörter am Beispiel der speziellen Begriffe für Fäkalien. Diese vielfältigen Begriffe seien
vermutlich „gleichermaßen ekelerregend und unvermeidlich“ (Pinker ebd.). Neben den
Tabuwörtern für Fäkalien existierten auch eine Reihe formaler, euphemistischer und
dysphemistischer Begriffe. Weitere Begriffe seien ausschließlich für die Bezeichnung der
kindlichen Ausscheidungen reserviert, während andere Begriffe entweder im medizinischen
Kontext verwendet würden oder sich auf tierische bzw. landwirtschaftlich verwertbare
Fäkalien bezögen.
tabu: Scheiße, Kacke
leicht dysphemistisch: Kack, Scheiß, Schitt(e), Schiss(e), Schiet(e), Driet(e), Driss, Haufen
leicht euphemistisch: Mist, Unrat, Sauerei, Dreck
formal: Fäkalien, Exkremente, Ausscheidungen, Stuhlgang, Kot
bei Kindern: Aa, Kacka, Häufchen, Stinkerchen, Wurst, Würstchen, Bescherung, Geschäft,
groß machen, Windel voll haben
medizinisch: Stuhl, Stuhlgang, Defäkation, Darmentleerung
Tier: Fladen, Äpfel, Haufen, Kötel, Küttel, Mist
Tier, wissenschaftlich: Losung, Koprolith, Dung
Tier, landwirtschaftlich: Dünger, Dung, Mist, Guano
Mensch, landwirtschaftlich: Abtrittsdünger, Braunwasser, Klärschlamm
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 430.
Zu jedem Schimpf- oder Tabuwort bzw. jedem Standardfluch existierten jedoch eine Reihe
bereinigter und damit sozial akzeptierter Alternativen. Pinker (2007, 414f.) illustriert dies am
Beispiel der als Schimpf- bzw. Fluchwort verwendeten Ausdrücke Gott/Herrgott, Jesus/Herr
Jesus, verdammt, Sakrament, Scheiße, ficken und Arschloch:
Für Gott/Hergott:
Goddele, Gottachgott, Gottogott, meine Güte, Herrgöttchen, Herrgöttle, Herre, Herrm
134
Für Jesus/Herr Jesus:
Jesses, Jessas, je, o je, ei je, herrje, ei herrje, herrjemine
Für verdammt:
verdammich, verdummich, verdummt, verdorrich, verdorri, verdellich, verdelli, verdöllt,
tamtata
Für Sakrament:
sapperment, sakra, sakradi
Für Scheiße:
Schande, Scheibe, Scheibenkleister, Scheiß, Schiss, Schisse, Schitt, Schitte, Schiet, Schiete,
Driss, Gedriss, Driete
Für ficken:
vögeln, bügeln, fegen
Für Arschloch:
A-loch, A…, Arschgeige, Arschkeks, Armloch, Armleuchter, Gesäßloch
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 414f.
Pinker (2007, 434) bezeichnet das Verb fuck in Anlehnung an die Anthropologin Ashley
Montagu als „ein transitives Verb für die transitivste aller menschlichen Tätigkeiten.“
Transitive Verben für Sex passen in die Leerstelle der Struktur Paul [verb-te] Paula, u.a.:
ficken, bumsen, vernaschen, pimpern, vögeln, poppen, rammeln, durchnudeln, knallen.
Während diese Verben größtenteils respektlos oder abstoßend auf den Liebesakt referieren,
tun dies die bereinigten Alternativwörter und -ausdrücke in einer Form, die deutlich positiv
evaluativ ist:
Sex haben, Liebe machen, zusammen schlafen, ins Bett gehen, eine Beziehung haben,
Geschlechtsverkehr haben, intim sein, den Beischlaf vollziehen, kopulieren, koitieren
Die Analyse der Verben für Sex zeigt nach Pinker (ebd.), dass die direkten respektlosen
Varianten des Verbs fuck allesamt transitiv sind, während die sozial akzeptierteren
Alternativformen intransitiv seien. Das Wort für den Sexualpartner werde jedes Mal mit der
Präposition mit eingeleitet. Viele dieser alternativen Verben seien zudem keine
135
eigenständigen Verben, sondern Wendungen, bei denen ein Nomen oder Adjektiv mit einem
light verb wie haben, sein oder machen kombiniert werde.
Es sei der Tabustatus, der einem Wort seine emotionale Schärfe verleihe. Auf diese Weise
entstünden zahlreiche Redewendungen, die Tabuwörter enthielten. Viele der Tabuwörter und
tabuisierten Wendungen wiesen keine erkennbare Analogie mehr zu ihrem ursprünglichen
Gegenstand mehr auf und bedienten sich des Tabuworts lediglich, um eine Wirkung beim
Hörer zu erzielen.
Klugscheißer!
Das geht dich einen Scheißdreck an.
Er weiß einen Scheiß, was hier los ist.
Stell deinen Scheiß hierhin.
Sieh zu, dass du deinen Scheiß geregelt kriegst.
Das sieht scheiße aus.
Die ist dumm wie (Schiffer)scheiße.
Der baut nur Scheiße.
Was für ein Scheißwetter!
Mir geht’s scheiße.
Ohne Scheiß?
Mach keinen Scheiß!
Friss Scheiße!
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 438.
Scheißviel
Scheißegal
Scheißfreundlich
Scheißvornehm
Lass uns Shit rauchen.
Verpiss dich!
Er ist ein blöder Pisser.
Das war so was von bepisst!
Diese Pissnelke!
Ich pisse auf deinen Rat.
So ein Arsch!
136
Setz deinen Arsch in Bewegung!
Beweg deinen Arsch hier rüber!
Saftarsch!
Das geht mir am Arsch vorbei.
Die kriegt den Arsch nicht hoch.
Zieh deinen Kopf aus deinem Arsch.
Darauf kannst du deinen Arsch verwetten.
Leck mich am Arsch!
Er ist ein Arschkriecher.
Wir haben uns den Arsch aufgerissen.
Er hat seinen Arsch riskiert.
Ich hab mir den Arsch abgefroren.
Himmel, Arsch und Wolkenbruch!
Himmel, Arsch und Zwirn!
Er geht mir auf den Sack.
Sackratte!
Sackgesicht!
Sturer Sack!
Schnarchsack!
Fauler Sack!
Geiler Sack!
Blöder Sack!
Fetter Sack!
Feiger Sack!
Drecksack!
Fettsack!
Saftsack!
So ein Hirnfick!
Verfickte Scheiße!
Du bist so ein Ficker.
Fick dich!
Was für eine abgefuckte Scheiße!
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 439.
137
Nach Pinker (2007, 416) bedienen sich Schimpfwörter häufig einer bestimmten
Lautsymbolik. So enthielten obszöne Ausdrücke häufig Laute, die als schnell und grob
empfunden würden. Im Deutschen seien dies zumeist Einsilber oder Trochäen mit kurzen
Vokalen und stimmlosen Plosiven (p, t, k) oder Zischlauten (s):
Depp, Bock, Pack, Sack, Schmock, Mist, Schwanz, Titten, Trottel, Nutte, Tunte, Kacke,
schnackseln, verrecken, lecken, ficken, Bastard, Fotze, Pisse, Tusse.
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 416.
Crystal (1995, 61) beschreibt die vielfältigen Fluchwörter und Schimpftiraden in den Werken
Gargantua und Pantagruel (1532) von François Rabelais (um 1495 - 1553).
In der deutschen Übersetzung von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass von 1951 findet sich in
Kapitel XVII des Gargantua die folgende Passage:
Zum Henker!
Hol’s der Teufel!
Da schlag‘ ein Donnerwetter drein!
Potzelement!
Stockschwerenot!
Dass dir der Schorbock in die Kachel fahr‘!
Beim Galgen von Golgatha!
Heiliges Zähholz!
Sand und Sack am Bändel!
Potz Türkenblut!
Tod und Teufel!
Da fall‘ Ostern und Pfingsten auf einen Tag!
Stern und Hagel!
Mort bieu!
Bei meinem Bart!
Dass dich der Donnerstag!
O seliger Veit und Florian übereinander!
Sankt Blunzen und Kohlsuppe!
Crystal, David: Die Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt/New York 1995, 61.
138
Crystal (1995, 61) beschreibt, dass auch die Schrifttafeln im antiken Rom und Griechenland
häufig Schimpfwörter und Flüche enthalten hätten. Die mit Flüchen versehenen Schrifttafeln
seien dann eingegraben oder im tiefen Wasser versenkt worden. Eine der Tafeln hätte
folgende Inschrift getragen:
„Gute und schöne Prosperina (oder Salvia, solltest du dies vorziehen), mögest du dem Plotius
Gesundheit, Körper, Aussehen, Kraft und Fähigkeiten entreißen und sie deinem Gatten Pluto
übertragen. Stelle sicher, dass es ihm durch eigene Kraft nicht gelingt, dieser Strafe zu
entgehen. Mögest du ihn dem Quartan- und Tertianfieber sowie dem täglichen Fieber
anheimgeben, auf dass sie ihn bekriegen und bekämpfen, bis sie ihn seiner Seele beraubt
haben …
Ich gebe dir seine Ohren, Nase, Nüstern, Zunge, Lippen und Zähne, damit er von seiner Qual
nicht sprechen kann; seinen Nacken, Schultern, Arme und Finger, damit er sich selbst nicht
helfen kann …“.
Crystal, David: Die Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt/New York 1995, 61.
Verschiedentlich seien Schimpf- und Tabuwörter sogar Gegenstand gerichtlicher
Auseinandersetzungen gewesen (vgl. Crystal 1995, 61). So sei die 1959 vom Verlag Grove
Press in New York publizierte Fassung von D.H. Lawrences Lady Chatterly’s Lover
unzensiert gewesen und aufgrund der mehrmaligen Verwendung des Wortes fuck wegen
angeblicher Obszönität verboten worden. Dies habe sowohl in den USA als auch in
Großbritannien einige Prozesse nach sich gezogen, von denen einer, der im Oktober 1960 vor
dem Old Bailey stattfand mit einem Freispruch geendet habe. Daraufhin sei das Tabuwort
fuck in Literatur und Tagespresse häufiger erschienen, selbst wenn es im öffentlichen
mündlichen Gebrauch weiterhin mit einem starken Tabu belegt gewesen sei.
3.0 Schimpf- und Tabuwörter im Englischen
Swan (1980, 589) gliedert die Schimpf- und Fluchwörter des Englischen in die Bereiche
annoyance (Verärgerung), Überraschung (surprise), überraschte Frage (surprised question)
und Beleidigung (insult). Dabei differenziert er zwischen dem britischen und dem US-
amerikanischen Sprachgebrauch:
139
Annoyance:
Damn (it)!
God damn (it)! (especially US)
Hell!
God!
My God!
Jesus!
Jesus Christ!
Shit!
Fuck (it)!
GB only:
Blast (it)!
Bugger (it)!
Sod (it)!
Christ! It's raining again!
Oh, fuck! I've lost the address.
Damn it! Can't you hurry up?
Surprise:
God!
My God!
Christ!
Jesus Christ!
God damn! (especially US)
Well, I’ll be damned!
Mainly GB:
Damn me!
Fuck me!
Well, I’m buggered!
Bugger me!
Sod me!
Well, I’m damned!
140
My God! Look at those tits!
Well, I'm damned! What are you doing here?
Bugger me! There's Mrs. Smith - I thought she was on holiday.
Surprised question:
What the hell do you think you're doing?
Where the fuck are the car keys?
Insult:
prick
cunt
bastard
fucker
bugger (GB)
cunt
shit (GB)
wanker (GB)
sod (GB)
asshole (US)
You bastard!
He’s a prick
Stupid fucker!
That guy's a real asshole!
Screw the government!
Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford 1980, 589.
Beleidigungen (insults) werden nach Swan (ebd.) zumeist in der Struktur imperative verb +
object realisiert. Dabei können die Imperativformen der Funktion dienen, eine andere Person
auf beleidigende Art zu bitten sich zu entfernen:
141
Insult (imperative verb + object):
Damn …
Blast … (GB)
Sod … (GB)
Bugger … (GB)
Fuck …
Screw … (especially US)
Screw the government!
Damn that child!
Fuck you!
Insulting request to go away:
Fuck off!
Piss off!
Bugger off (GB)
Sod off! (GB)
Can I have a word with you? Fuck off!
Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford 1980, 589.
Swan (1980, 590) weist in seiner Rubrik Miscellaneous (Verschiedenes, Vermischtes) darauf
hin, dass einige, vordergründig auf den sexuellen Bereich bezogene Verben, wie fuck (up),
screw (up) und bugger (up) (GB) auch in der Bedeutung von ruin, spoil oder destroy
(ruinieren, verderben, zerstören) verwendet werden können:
You've buggered my watch!
Somebody's fucked up the TV.
Fucked and buggered can mean ‘exhausted’ (GB):
Want another game of tennis? No, I'm fucked.
Screw (especially US) can be used to mean ‘exhausted’ (GB)
Don't buy a car from that garage. They'll screw you!
Cock (up) GB, balls up (GB), fuck up and screw up can be used (as verbs) to refer to mistakes
of organization.
That bloody secretary's ballsed up my travel arrangements.
The nouns cock-up, balls-up, fuck up and screw up are used in the same sense.
142
Sorry you didn't get your invitation to the party. Mary made a balls-up.
The conference was a complete fuck-up.
Balls (GB), bullshit (US) and crap are used to mean ‘nonsense’.
Don't talk crap!
What's his new book like? A load of balls.
Bugger all and fuck all are used in British English to mean ‘nothing’.
There's fuck all in the fridge. We'll have to eat out.
Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford 1980, 590.
Swan (1980, 589) unternimmt den Versuch, die Tabuwörter des Englischen hinsichtlich des
Grades ihrer Tabuisierung zu gliedern, indem er sie in Bezug auf ihre soziale Akzeptanz bzw.
Ächtung mit einem Sternchen (*) versieht. Während ein Tabuwort mit nur einem Sternchen
nur wenige Sprachbenutzer irritieren wird, wirkt ein vier- oder fünf-Sterne-Tabuwort in der
Regel äußerst schockierend auf den Hörer:
taboo word meaning
damn* condemn to hell
blast* strike down with divine punishment
hell*
God**
Jesus***
Christ***
piss*** urine, urinate
crap*** excrement, defecate (same as shit)
arse*** (US ass) bottom, buttocks, anus
arsehole*** (US asshole) anus
balls*** testicles
bollocks*** (GB only) testicles
tits*** breasts
bastard*** illegitimate child
shit**** excrement, defecate
prick**** penis
cock**** penis
bugger**** (GB only) have anal sexual intercourse with a person or animal
143
taboo word meaning
sod**** (GB only) homosexual (abbreviation of sodomite)
fuck**** have sexual intercourse (with)
screw (especially US) have sexual intercourse (with)
come**** reach a sexual climax (orgasm)
wank**** (GB only) masturbate
cunt***** woman’s sexual organs
Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford 1980, 589.
Nach Pinker (2007, 413) können Schimpf- und Tabuwörter auch in der Form von Akronymen
auftreten. Dabei wird aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter ein neuer Ausdruck
(Initialwort) gebildet, der überwiegend in Buchstabierweise ausgesprochen wird. Einige
dieser Akronyme finden sich im Armee-Slang des Zweiten Weltkriegs:
Acronyms in army slang in World War II:
snafu: situation normal, all fucked up
tarfu: things are really fucked up
fubar: fucked up beyond all recognition
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 413.
Teilweise tritt die exzessive Verwendung von Schimpf- und Tabuwörtern auch im Kontext
bestimmter Erkrankungen, wie dem Tourette-Syndrom, auf. Die folgende Übersicht listet die
von Tourette-Patienten verwendeten Schimpf- und Tabuwörter in der Reihenfolge der
Häufigkeit ihres Auftretens auf:
fuck, shit, cunt, motherfucker, prick, dick, cocksucker, nigger, cockey, bitch, pregnant-
mother, bastard, tits, whore, doody, penis, queer, pussy, coitus, cock, ass, bowel movement,
fangu (Italian for "fuck"), homosexual, screw, fag, faggot, schmuck, blow me, wop
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York, 2007, 413.
144
4.0 Schimpf- und Tabuwörter im Koreanischen
Die Schimpf- und Tabuwörter im Koreanischen beziehen sich zum Teil auf Eigenschaften
einer Person (Intelligenz, Charakter) und bedienen sich zudem des Vergleichs der
beschimpften Person mit einem Tier (Hundesohn, Hündin). Andere Schimpfwörter sind
eindeutig sexuell motiviert und referieren auf die Geschlechtsorgane von Mann und Frau
sowie auf den Geschlechtsakt. In weiteren Schimpf- und Fluchwörtern und komplexeren
Ausdrücken wird auf Schicksalhaftes referiert, das einem Menschen mit einem schlechten
Charakter widerfahren wird.
Es finden sich im Koreanischen auch Schimpfwörter, die die politische Einstellung eines
Menschen thematisieren (linksradikal, rechtsradikal) bzw. mit denen pejorativ auf bestimmte
Nationalitäten referiert wird (Yankees).
Auf die (mangelnde) Intelligenz eines Menschen bezogen:
Dummkopf, dummes Huhn: 바보 (babo), 멍청이 (meongcheongi), 골빈놈 (golbin)
Tiervergleich:
Hundesohn: 개새끼(gaesaekki), 개자식(gaejashik)
Hündin (eine Frau, wie ein Hund): 개같은 년(gaegateun nyeon)
Sexuell motivierte Schimpfwörter:
Geschlechtsorgan des Mannes und der Frau:
Penis: 좇 (jot)
Vagina: 씹 (ssib)
Sexualakt:
좇같은 놈 (jotgateun nom)
시팔년 (씹할 년) (sipal nyeon)
Fuck you: 씨발 (놈, 년) (sipal nom); (sipal nyeon)
Fuck you: 엿 먹어라 (yeot meogeora)
Motherfucker: 니미 씹할 놈 (nimi ssibhal nom)
Prostituierte: 화냥년, 서방질할 년 (hwanyang nyeon; seobangjilhal nyeon)
145
Auf den (schlechten) Charakter eines Menschen bezogen:
Scheißkerl: 똥이나 먹어라 (ttongina meogeora)
schlechter Kerl: 나쁜 놈 (nappun nom), 나쁜 새끼 (nappun saeki), 제기랄 (jegiral), 젠장
(jenjang)
ein Mensch (ein „Kerl“), dem ein (Kains)mal auf die Stirn tätowiert ist: 경칠 놈 (gyeongchil
nom)
eine Frau wie ein Schmutzlappen: 걸레같은 년 (geolle gateun nyeon)
Schicksalhaftes, das einem schlechten Menschen widerfahren wird:
ein Mensch (ein „Kerl“), der niemals Glück haben wird; der vom Unglück verfolgt wird:
좇 같은 놈 (jotgateun nom), 불쌍놈(년) (bulssang nom; nyeon)
쌍것들 (ssanggeotdeul)
쌍놈의 새끼 (천민) (ssangnomeui saekki); (cheonmin)
제수없는 놈 (jesueomneun nom)
ein Mensch (ein „Kerl“), der urplötzlich sterben wird:
지랄한다 (jiralhanda)
지랄할 놈 (jiralhal nom)
급살맞을 놈 (geobsalmajeol nom)
ein Mensch (ein „Kerl“), der (wie) vom Blitz getroffen sterben wird:
벼락 맞아 되질 놈 (byeorag maja doijil nom)
ein Mensch (ein „Kerl“), der durch Folter (Fesselung, Vierteilung etc.) sterben wird:
주리를 틀어 죽일 놈 (jurireul teureo jugil nom)
육실할 놈 (yugshilhal nom)
사지를 찢어 죽일 놈 (sajireul jjijeo jugil nom)
능지처참할 놈 (neungjicheochamhal nom)
우라질 놈 (urajil nom)
Politisch motivierte Schimpfwörter:
Kommunist, Roter: 빨갱이새끼 (ppalgaengi saekki)
linksradikaler (roter) Zombie: 좌빨좀비(joabbal jombi)
Rechtsradikaler: 꼴통보수 (kkolteong bosu)
146
Abwertende Bezeichnungen für bestimmte Nationalitäten:
Amerikaner (Yankees): 양키(yangki)
Chinesen: 짱개, 되놈 (jjanggae, doi nom)
Japaner („mit Sandalen“): 쪽바리 (jjogbari)
Auch in der Sprache von koreanischen Schulkindern ist die Verwendung von Schimpf- und
Tabuwörtern weit verbreitet. Diese beziehen sich zum einen auf die soziale
Schichtzugehörigkeit (Bettler, Unterschichtsangehöriger) und des Weiteren auf Krankheiten
und andere körperliche Defizite (Typhuskranker, Behinderter, Unfruchtbarer, Impotenter).
Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer heterogener Schimpf- und Tabuwörter
(schmutziges Weib, Unverschämter etc.).
Bettler: 그지새끼 (geujisaekki), 거지 (geoji),
거지놈 (geoji nom)
Unterschichtsangehöriger: 쌍놈 (ssang nom), 쌍년 (ssangnyeon)
Typhuskranker: 앰병 (aembyeong)
Willst du sterben? Soll ich dich töten? 뒤질래 (dweojillae),
뒤질랜드 (dweojillaendeu),
죽어버려새끼야 (jugeobeoryeoseakkiya)
Behinderter: 장애인놈 (jangaein nom), 애자 (aeja),
애자새끼 (aejasaekki),
장애인새끼(jangaeinsaekki)
schmutziges Weib/white trash: 잡련 (jabryeon), 개잡년아 (gaejabnyeona),
쓰레기년 (sseuraegi nyeon)
Dummkopf: 멍청이 (meongcheongi)
Unverschämter, Unverschämte: 싸가지 (ssagaji)
„Kerl“ ohne Vater: 호러새끼 (horeo saekki),
호로자슥 (horojaseuk)
„Kerl“ ohne Mutter: 에미없는놈 (emiomneun nom)
Unfruchtbarer, Impotenter: 고자 (goja), 고자섹기 (gojasekki),
장애인코끼리 (jangaeinkokiri)
147
Bezüglich der Bildungsmechanismen koreanischer Schimpf- und Tabuwörter überwiegen die
Abkürzungen gegenüber den Verschmelzungen des Koreanischen mit der Fremdsprache
Englisch:
Abkürzungen:
거지같은 놈 (geojigateun nom) ->그지새끼 (geuji saekki), 거지 (geoji),
거지놈 (geoji nom), (Bettler)
쌍놈 (ssang nom), 쌍년 (ssang nyeon) ->ㅆㄴ(ss + n), (Unterschichtsangehöriger)
옘병할 놈 (aembyeong nom) -> 앰병 (aembyeong), (Typhus)
너 죽을래? (neo jugeoeullae) -> 뒤질래 (dweojillae), 뒤질랜드 (dweojillaendeu),
죽을 (jugeul)? (Willst du sterben? Soll ich dich töten?)
쓰레기 같은 년 (sseuraegi gateun nyeon) -> 잡련 (jabnyeon),
쓰레기년 (sseuraegi nyeon), (schmutziges Weib/white trash)
Verschmelzungen (Koreanisch + Fremdsprache Englisch):
뒤질랜드 (dweojillaendeu) = 뒤질 (dweojil) + 랜드 (laendeu = land)
5.0 Fazit
Während Schimpfwörter, in der Form von Vulgarismen oder Ethnophaulismen, durch ihre
pejorative Bedeutung andere Personen oder Gruppen herabsetzen und beleidigen, entstammen
Tabuwörter primär dem tabuisierten religiösen, abergläubischen, politischen oder sexuellen
Bereich und unterliegen wie die Schimpfwörter einem Meidungsgebot. Dabei scheinen die
Tabus gesellschafts- und epochengebunden zu sein und keine sprachlichen oder kulturellen
Universalien darzustellen.
Für das Deutsche konnte der Bereich der Fäkalien als ein Bereich ausgemacht werden, der
durch eine Reihe von Tabuwörtern geprägt ist, die formal, euphemistisch oder dysphemistisch
verwendet werden. Zu vielen dieser Schimpf- und Tabuwörter existieren bereinigte und
sozial akzeptierte Alternativformen.
Für den Bereich der „transitivsten aller menschlichen Tätigkeiten“ konnte mit Pinker (2007,
414f.) festgestellt werden, dass die respektlos oder abstoßend auf den Liebesakt referierenden
Verben allesamt transitive Verben sind, während die positiv evaluativen Verben intransitiv
sind. In tabuisierten Wendungen wiesen die Tabuwörter häufig keine Analogie mehr zu
148
ihrem ursprünglichen Gegenstand auf und bedienten sich des Tabuworts lediglich, um eine
bestimmte Wirkung beim Hörer zu erzielen.
Für die Auswahl und Verwendung von Schimpfwörtern muss eine bestimmte Lautsymbolik
angenommen werden. So konnte mit Pinker (2007, 416) festgestellt werden, dass obszöne
Ausdrücke häufig aus Einsilbern oder Trochäen mit kurzen und stimmlosen Plosiven oder
Zischlauten bestehen.
Für das Englische konnte mit Swan (1980, 589) festgestellt werden, dass viele der englischen
Schimpf,- Fluch- oder Tabuwörter den Bereichen annoyance (Verärgerung), Überraschung
(surprise), überraschte Frage (surprised question) und Beleidigung (insult) entstammen.
Dabei muss auch zwischen einem britischen und US-amerikanischen Sprachgebrauch
differenziert werden. Einige der vordergründig auf den sexuellen Bereich bezogenen Verben,
wie fuck (up), screw (up) und bugger (up) (GB) können auch in der Bedeutung von ruin, spoil
oder destroy (ruinieren, verderben, zerstören) verwendet werden.
Teilweise treten die Schimpf- und Tabuwörter des Englischen auch in Form von Akronymen
(Initialwörtern) auf oder sind in ihrer exzessiven Verwendung Teil eines Krankheitsbildes
(Tourette-Syndrom).
Im Koreanischen beziehen sich die Schimpf- und Tabuwörter häufig auf Eigenschaften einer
Person. Auch Vergleiche der beschimpften Person mit einem Tier sind feststellbar. Darüber
hinaus finden sich Schimpfwörter, die eindeutig dem sexuellen Bereich entstammen und auf
die Geschlechtsorgane von Mann und Frau oder den Sexualakt referieren. Gelegentlich wird
durch Schimpf- und Tabuwörter die politische Einstellung eines Menschen thematisiert oder
auf bestimmte Nationalitäten pejorativ referiert. Auch in der Sprache koreanischer
Schulkinder finden sich zahlreiche Schimpf- und Tabuwörter.
Hinsichtlich der Bildung koreanischer Schimpf- und Tabuwörter überwiegen die
Abkürzungen gegenüber den Verschmelzungen des Koreanischen mit der Fremdsprache
Englisch.
149
6.0 Literatur
Baek, Haewon Geebi: Dirty Korean. Berkeley (California) 2010.
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Crystal, David: Die Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt/New York 1995.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch Band 3. Heidelberg. 4. Auflage 1985.
Liptak, Peter & Lee, Siwoo: As much as a rat’s tail. Korean Slang. An irreverent look at
language within culture. Roseville 2009.
Pinker, Steven: Der Stoff, aus dem das Denken ist. New York 2007.
Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford 1980.
150
X. Lehnwörter und Fremdwörter im Kontext ihrer Etymologie
1.0 Einleitung
Lewandowski (1985, 627) definiert Lehnwörter (loan words, borrowed words; mots
d’emprunt) als sprachliche Zeichen, die eine Überführung von einer Sprache in eine andere
erfahren. Das solchermaßen aus einer anderen Sprache übertragene Wort werde in das eigene
Sprachsystem übernommen und eingebürgert.
Schmidt (1972, 75) betrachtet die Lehnwörter des Deutschen als ehemalige Fremdwörter, die
sich dem Deutschen in Lautgestalt, Betonung und Flexion angepasst haben.
Nach Hjelmslev (1968, 74) können Fremdwörter mithin als diejenigen Lehnwörter verstanden
werden, die „in ihrer äußeren Form fremdartig und abstehend wirken.“ Diese Fremdartigkeit
könne zum Beispiel durch einen ungewöhnlichen Silbenbau bedingt sein.
Hjelmslev (ebd.) betont zudem, dass Lehnwörter dem Laien hinsichtlich ihrer Etymologie
häufig undurchsichtig bleiben. Insbesondere die phonetisch-phonologischen Aspekte von
Lehnwörtern seien jedoch von besonderem linguistischem Interesse, da ihre Analyse „zur
Klärung phonetischer Fragen der Geber- und Empfängersprache zur Zeit der Entlehnung
beitragen“ könne (Hjelmslev 1968, 74).
Die Untersuchung von Lehnwörtern im deutschen Sprachsystem zeige, dass einige
Lehnwörter bereits vor der Lautverschiebung entlehnt worden seien. In vielen dieser früh
entlehnten Wörter blieben die Deklinationsformen der Gebersprache (z.B. Genus - Genera;
Komma - Kommata) erhalten.
Bezüglich der Klassenzugehörigkeit von Lehnwörtern stellt Bynon (1981, 220ff.) fest, dass
Lehnwörter zumeist den offenen Klassen angehören (Substantive, Verben, Adjektive).
Pronomina, Konjunktionen und Präpositionen würden hingegen in der Regel nicht oder nur
bei intensivem Sprachkontakt entlehnt.
Nach Bynon (ebd.) erweitern Lehnwörter das Lexikon der Empfängersprache und tragen
bisweilen auch zum Umbau bestehender lexikalischer Felder bei. Die präzise Trennung von
Lehnwort und Fremdwort hält Bynon (ebd.) für schwierig. Eine solche Differenzierung bleibe
zumeist auch ohne jeden praktischen Nutzen und könne allenfalls sprachpuristischen
Zwecken dienen. Bynon (1981, 628) geht davon aus, dass Sprachbenutzer die Unterscheidung
zwischen Fremd- und Lehnwörtern auf der Basis der morphologischen Struktur, der
Geläufigkeit und der Orthographie dieser Wörter treffen. Das philologische Prinzip, nach dem
für das Deutsche alle Fremdwörter aus alt- und mittelhochdeutscher Zeit als Lehnwörter, alle
151
anderen nach dem Jahre 1500 entlehnten Wörter hingegen als Fremdwörter bezeichnet
werden, ist nach Ansicht Bynons (ebd.) nicht aufrechtzuerhalten.
Bußmann (1983, 293) differenziert zwischen Lehnwörtern im engeren und im weiteren Sinne.
Während es sich bei den Lehnwörtern im engeren Sinne um Entlehnungen einer Sprache A
aus einer Sprache B handele, die sich in Lautung, Schriftbild und Flexion vollständig an die
Sprache A angeglichen hätten (z.B. Fenster aus lateinisch fenestra; Wein aus lateinisch
vinum), verwendet Bußmann (ebd.) den Begriff des Lehnworts im weiteren Sinne als genus
proximum für Lehn- und Fremdwörter. Im Kontext der Lehnwörter im weiteren Sinne
differenziert Bußmann (ebd.) zwischen lexikalischen und semantischen Entlehnungen.
Während bei den lexikalischen Entlehnungen ein Wort zusammen mit seiner Bedeutung und
einer entlehnten „Sache“ in die eigene Sprache übernommen werde (z.B. Psychologe, Sputnik
etc.), gehörten zu den semantischen Entlehnungen unter anderem die von einem
Ausgangswort formal unabhängigen Lehnschöpfungen (Zartgefühl aus französisch
délicatesse; Umwelt aus französisch milieu; Niethosen aus englisch blue jeans; Sinnbild aus
griechisch Symbol) und die Glied für Glied vorgenommenen Lehnübersetzungen (Halbwelt
aus französisch demi-monde; Gewissen aus lateinisch conscientia; Mitlaut aus lateinisch
Konsonant; Rechtschreibung aus griechisch Orthographie).
Lewandowski (1985, 624) ergänzt diese Klassifizierung um die Kategorien der
Lehnbedeutung, der Lehnbildung und der Lehnprägung. Während Lewandowski (ebd.) unter
einer Lehnbedeutung eine aus einer Gebersprache übernommene zusätzliche Bedeutung
versteht (z.B. Ente von französisch canard im Sinne der „falschen Zeitungsmeldung“), wird
die Lehnprägung als die Reproduktion lexikalischer Komplexe der Gebersprache mit den
Mitteln der integrierenden Sprache verstanden. Der Begriff der Lehnprägung umfasst dabei
sowohl die inhaltlichen als auch die formalen Aspekte des Wortmaterials.
Lewandowski (1985, 624) subsumiert die Lehnbildung unter die Lehnprägung. Bei der
Lehnprägung werde ein Wort mit den Mitteln der Nehmersprache und unter dem Einfluss der
Fremdsprache neu gebildet. Bei dem neu gebildeten Wort könne es sich um eine
Lehnübersetzung, eine Lehnübertragung oder eine Lehnschöpfung handeln.
Eggers (1965, 626) differenziert zwischen Lehnschöpfungen, Lehnsyntax, Lehnübersetzungen
und Lehnübertragungen. Die Lehnschöpfung wird von Eggers (ebd.) als die freieste Form der
Lehnbildung verstanden. Dabei werde eine Wortschöpfung auf der Basis des
fremdsprachlichen Wortmaterials vollzogen (Automobil → Kraftwagen, Cognac →
Weinbrand, Milieu → Umwelt).
152
Unter dem Terminus der Lehnsyntax versteht Eggers (1965, 626) die Nachahmung bzw.
Nachbildung fremdsprachlicher Strukturen in der integrierenden Sprache. Dabei könne es sich
beispielsweise um die Nachbildung des lateinischen Ablativus absolutus oder aber des
griechischen Dativus absolutus handeln. Insgesamt vertritt Eggers (ebd.) jedoch die Ansicht,
dass der Einfluss der fremdsprachlichen Syntax auf die integrierende Sprache eher gering ist.
Insbesondere ungewöhnliche syntaktische Konstruktionen könnten sich in der Regel auf
Dauer nicht durchsetzen.
Die Glied-für-Glied-Übersetzung und die inhaltlich-formale Reproduktion von Einheiten der
interferierenden in der integrierenden Sprache sieht Eggers (1965, 626) im Zentrum der
Lehnübersetzung (z.B. Gewissen aus lateinisch conscientia, Mitleid aus lateinisch compassio,
Ausstellung aus französisch exposition). Dabei werde im Prozess der Lehnübersetzung jedes
Morphem der Gebersprache durch das semantisch nächststehende Morphem der
Empfängersprache übersetzt.
Kessel/Reimann (2008, 197) unterscheiden im Bereich der Fremdwörter zwischen denen, die
als Ganzes aus einer anderen Sprache entlehnt wurden (z.B. Shampoo, Bluff, Garage, Creme)
und solchen, bei denen die Einzelelemente eines Wortes aus einer anderen Sprache stammen.
In letzterem Fall würden die fremdsprachlichen Elemente dann nach den Regeln der
deutschen Wortbildung zu Wörtern kombiniert. Diese Gruppe von Fremdwörtern dominiere
insbesondere im Fachwortschatz griechischen und/oder lateinischen Ursprungs (z.B.
Polykondensat, bilateral, Hypotonie), sei jedoch auch in der Gemeinsprache (z.B.
multikulturell, Television, Teleskop) anzutreffen.
Innerhalb des Regelsystems der deutschen Wortbildung seien aber auch Mischwörter
möglich, die Anteile aus deutschem und fremdsprachlichem Wortmaterial (z.B. Haarspray,
Wellness-Hotel, neongelb) enthielten.
Kessel/Reimann (2008, 198) weisen darauf hin, dass für Fremdwörter andere Phonem-
Graphem-Korrespondenzen gelten als für Lehnwörter. Fremdes Wortmaterial könne auf
unterschiedliche Weise in das deutsche Sprachsystem integriert sein. So bestehe die
einfachste Form der Übernahme von Fremdwörtern darin, sie ohne jegliche Veränderung in
Lautung und Schreibung aus der jeweiligen Herkunftssprache zu übernehmen (z.B. Computer,
Make-up). Eine solche Übernahme sei vor allem dann unproblematisch, wenn die
Fremdwörter keine fremden Laute enthielten (z.B. Chef, Christ, Shampoo). Es könnten durch
die Entlehnung aber auch Laute aufgenommen werden, die das Deutsche selbst nicht besäße.
Die Lautung erfolge dann entsprechend den Regeln der Herkunftssprache (z.B. Garage,
Loge).
153
Eine weitere Form der Übernahme von Fremdwörtern in das Deutsche bestehe in der
Ersetzung fremder Laute durch eine Lautung, die der Schreibung des Deutschen entspreche.
So könne (vgl. Kessel/Reimann 2008, 198) eine Angleichung an die Lautstruktur des
Deutschen in den Fällen stattfinden, in denen die fremdsprachlichen Grapheme deutschen
Phonemen zugeordnet werden könnten. In diesen Fällen sei von einer Leseaussprache die
Rede (z.B. Balkon ohne finalen Nasallaut; Akzentverschiebung bei Praline aus französisch
praliné).
Eine dritte Form der Übernahme fremdsprachlichen Wortmaterials bestehe darin, die fremde
Schreibung entsprechend den Regeln des deutschen Kernwortschatzes zu ersetzen. In diesen
Fällen finde eine Angleichung an die im Deutschen übliche Schreibung für bestimmte Laute
statt (z.B. Schikane aus französisch chicane; Karosse aus französisch carrosse;
(Computer)maus aus englisch mouse).
Die weitreichendste Form der Übernahme fremdsprachlichen Wortmaterials in das deutsche
Sprachsystem bestehe darin, sowohl die Lautung als auch die Schreibung den Regeln des
deutschen Kernwortschatzes anzupassen (z.B. Parfum → Parfüm; Sauce → Soße). Mit der
Anpassung an die deutsche Lautung gehe häufig auch eine Angleichung an den deutschen
Wortakzent einher.
2.0 Fremdsprachliche Transferenzen im Deutschen
Haspelmath/Tadmor (2009, 337) beschreiben in ihrem komparativen Handbuch der
Weltsprachen den fremdsprachlichen Einfluss auf das Althochdeutsche. Dabei sind
insbesondere Einflüsse griechischen und lateinischen Ursprungs feststellbar. Bezüglich der
Lehnwörter griechischen Ursprungs differenzieren Haspelmath/Tadmor (ebd.) zwischen
Wörtern griechischer und vulgärgriechischer Provenienz. Althochdeutsche Lehnwörter
griechischen Ursprungs sind u.a.:
pfanna (Pfanne)
tep (p) it (Teppich)
papir (Papier)
kuphar (Kupfer)
helfant (Elefant)
leo (Löwe)
pheffir, pheffar (Pfeffer)
154
scorp (i) o (Skorpion)
sitih (Sittich)
skuola (Schule)
astrih, estrih (Estrich)
Ein althochdeutsches Lehnwort vulgärgriechischer Herkunft ist das Wort kririhha → Kirche.
Hinsichtlich der althochdeutschen Lehnwörter lateinischer Provenienz differenzieren
Haspelmath/Tadmor (ebd.) zwischen Lehnwörtern lateinischer, vulgärlateinischer sowie spät-
und mittellateinischer Herkunft. Folgende althochdeutsche Lehnwörter sind lateinischen
Ursprungs:
ketin (n) a (Kette)
seganon (segnen)
esil (Esel)
finestra (Fenster)
flamma (Flamme)
furka (Gabel), (fork)
kasi (Käse)
kerza (Kerze)
kohhon (kochen)
kurz (kurz)
markat (Markt)
palma (Palme)
pfifon (pfeifen)
soc (Socke)
spiagal (Spiegel)
tempal (Tempel)
tisc (Tisch)
win (Wein)
ziegal (Ziegel)
155
Bei den althochdeutschen Lehnwörtern vulgärlateinischer Provenienz handelt es sich u.a. um
die folgenden:
fackala (Fackel)
isila (Insel)
mantal (Mantel)
muscula (Muschel)
Althochdeutsche Lehnwörter spätlateinischer Herkunft sind u.a.:
altari (Altar)
briaf (Brief)
pelliz (Pelz)
straza (Straße)
Aus dem Mittellateinischen stammen die althochdeutschen Lehnwörter arzat (Arzt) und
kurbiz (Kürbis).
Henne/Wiegand (1980, 584) verweisen auf den französischen Einfluss auf die deutsche
Sprache in der höfischen Zeit. Damals habe Frankreich als Vorbild auf kulturellem Gebiet
gegolten und zusammen mit den französischen Sitten seien auch zahlreiche Lehnwörter in das
Deutsche übernommen worden. Während ein Großteil dieser Wörter (z.B. Abenteuer, fein,
klar, Lanze, Melodie, Revier, Tanz, Turnier) in die deutsche Sprache integriert worden seien,
seien Lehnwörter aus dem Kontext des Rittertums bald wieder verlorengegangen. Zu diesen
entlehnten Wörtern gehören u.a. die folgenden:
bûhurt → Ritterspiel
garzûn → Page
leisieren → die Zügel freigeben
tjost → Zweikampf
Neben den französischen Transferenzen sind insbesondere auch die englischen,
niederländischen, skandinavischen und jiddischen Transferenzen im Deutschen zu beachten
(vgl. u.a. Henne/Wiegand 1980, 667ff.; Stiven 1936, 78-101; Althaus 1963, 104-156; Althaus
1965, 20-41).
156
2.1 Die englischen Transferenzen im Deutschen
Henne/Wiegand (1980, 667) weisen darauf hin, dass es sich bei den englischen Transferenzen
im Deutschen um die am besten erforschten Transferenzen handelt. Bereits im 17. und 18.
Jahrhundert habe ein reges Interesse an England eingesetzt, das sich insbesondere auf seine
politischen Institutionen sowie seine Philosophie und Dichtung konzentriert habe. In der
damaligen Zeit seien direkte Sprachkontakte jedoch selten gewesen, so dass diese
vornehmlich durch literarische Übersetzungen hergestellt worden seien. Hinsichtlich der
Entlehnungen aus dem Englischen sei eine deutliche Dominanz von Lehnprägungen
gegenüber Lehnwörtern festzustellen. Hierzu gehörten u.a.:
hero → Held
dead languages → tote Sprachen
sentimental → sentimental(isch) empfinden
popular song → Volkslied
inward form → innere Form
community weal → Gemeinwohl
self-government → Selbstverwaltung
minority → Minderheit
freedom of press → Pressefreiheit
high treason → Hochverrat
Andere Wörter der Herkunftssprache, von Henne/Wiegand (1980, 667) als „englische
Exozismen“ bezeichnet, blieben bei einem nur geringen Maß an Integration in der Form ihrer
Ursprungssprache erhalten (z.B. City, Bowle, boxen, Roastbeef, Whisky).
Im 19. Jahrhundert habe eine deutliche Intensivierung der deutsch-englischen Sprachkontakte
eingesetzt. Dabei hätten insbesondere Englands Führungsposition in der industriellen
Revolution sowie das Prestige der Gesellschaft und die Entwicklung des Pressewesens zu
einer Steigerung englischer Transferenzen (in Form von Lehnwörtern und Lehnprägungen)
ins Deutsche geführt. Die Kategorien der Industrialisierung, des Handels, der
Arbeiterbewegung, des Parlamentarismus und Rechtswesens sowie des Gesellschaftslebens
hätten den größten Zuwachs an Lehnwörtern und Lehnprägungen erfahren.
157
Industrialisierung:
steam engine → Dampfmaschine
cokes (Plural) → Koks
locomotive engine → Lokomotive
steamer → Dampfer
tramway → Tram(bahn)
Handel:
national economy → Volkswirtschaft
freedom of trade → Freihandel
cartel → Kartell
Arbeiterbewegung:
strike → Streik, Ausstand
lockout → Aussperrung
Parlamentarismus, Rechtswesen:
parliamentary → Parlamentarier
maidenspeech → Jungfernrede
voting cattle (American English) → Stimmvieh
hear hear → hört hört
King’s evidence → Kronzeuge
Gesellschaftsleben:
first-class → erstklassig
fashionable → fesch
slips → Schlips
Die gegenüber Lehnwörtern und Lehnprägungen deutlich seltener vorkommenden
Lehnübersetzungen seien verstärkt in der Kategorie des Sports und auch in der des
Pressewesens anzutreffen, u.a.:
158
Sport:
crew, team → Mannschaft
outsider → Außenseiter
goal → Tor
bicycle → Zweirad
Pressewesen:
leading article → Leitartikel
Penny-a-liner → Zeilenschinder
Review → Rundschau
Henne/Wiegand (1980, 668) konstatieren, dass ab den 1920er Jahren der Einfluss des
Amerikanischen Englisch bei gleichzeitigem Rückgang der Bedeutung des Britischen
Englisch zugenommen habe. In dieser Zeit sei die amerikanische Industrie- und
Konsumgesellschaft zum Leitbild geworden. Entsprechend hätten sich zahlreiche
Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch insbesondere in den Kategorien Wirtschaft,
Technik, Vergnügungsindustrie, Körperpflege, Essen, Wohnen, Freizeit sowie in den
Kategorien Wissenschaft, Politik und Wehrwesen durchgesetzt, u.a.:
Wirtschaft:
Boom, Marketing, Trend, Service, Supermarkt, Image
Technik:
data processing → Datenverarbeitung
weitere Wörter: Transistor, Radar
Vergnügungsindustrie:
Live-Sendung, Musical, Quiz, Striptease, Schaugeschäft
Körperpflege, Essen, Wohnen, Freizeit:
Make-up, Blazer, Minirock, Ketchup, Hobby-Raum, Swimming-Pool
159
Wissenschaft, Politik, Wehrwesen:
summit conference → Gipfelkonferenz
electronic brain → Elektronengehirn
late developer → Spätentwickler
language laboratory → Sprachlabor
2.2 Die niederländischen Transferenzen im Deutschen
Die niederländischen Einflüsse auf den deutschen Wortschatz reichen nach Henne/Wiegand
(1980, 668) vom Mittelalter bis in die Gegenwart und betreffen die Dialekte und
Sondersprachen als auch die Standardsprache. Insbesondere in den Hansestädten Bremen und
Hamburg hätte sich der niederländisch beeinflusste Fachwortschatz aus den Kategorien des
Wasserbaus und der Urbarmachung des Landes erhalten, u.a.:
dik → mittelniederländisch: dijc → mittelniederdeutsch (Deich)
sluse → mittelniederländisch: sluise → mittelniederdeutsch (Schleuse)
Auch auf den Gebieten der Seemannssprache, des Schiffbaus und der Schiffahrtstechnik sei
der Einfluss des Niederländischen unübersehbar:
afsteker → Abstecher
opklaren → aufklaren
uitkijk → Ausguck
baggeren → baggern
bui → Bö
Zudem seien auch solche Lehnwörter ins Deutsche gelangt, die zuvor bereits als
Entlehnungen aus dem Französischen, Spanischen, Portugiesischen und Italienischen in das
Niederländische übernommen worden seien (z.B. Barke, Bai, Barkasse, Brigg, Boje).
Auch in der Benennung von Handelsgütern fanden viele Bezeichnungen über das
Niederländische Eingang in die deutsche Sprache (z.B. Anschovis, Aprikose, Apfelsine,
Kattun). Ebenso gab es zahlreiche niederländische Transferenzen aus den Sondersprachen des
Geldes (z.B. Börse aus niederländisch beurs; Aktie aus niederländisch actije) und der
Gartenkunst (z.B. Krokus, Rabatte).
160
2.3 Die skandinavischen Transferenzen im Deutschen
Henne/Wiegand (1980, 669) beschreiben die zahlreichen skandinavischen Transferenzen ins
Hochdeutsche als eine Folge der deutschen Begeisterung für die nordische Mythologie und
Literatur. Der Großteil der Entlehnungen sei dabei norwegischer und dänischer Provenienz,
u.a.:
altnorwegisch: valkyrja → Walküre
altnorwegisch: nornir → Norne
altnorwegisch: vafrlogi → Waberlohe
Skalde → altnorwegisch: skald → Skalde
altnorwegisch: stafr → dänisch: stavrim → Stabreim
dänisch: ellerkonge (Elfenkönig) → Erlkönig
Bei den jüngeren Transferenzen ins Deutsche sei der Anteil der Entlehnungen aus den
Bereichen der Mythologie und der Literatur gering. Es dominierten vielmehr die
Sachentlehnungen, u.a.:
Ski, Fjord, Nordlicht, Rentier, Knäckebrot, Moped, Wehrbeauftragter (schwedisch: militie
ombudsman).
Auch skandinavische Rufnamen gehörten zu den frequenten Entlehnungen:
Birgit, Ingrid, Kerstin, Ulla, Knut, Nils, Sven Torsten.
2.4 Die jiddischen Transferenzen im Deutschen
Nach Henne/Wiegand (1980, 669) betreffen die jiddischen Transferenzen im Deutschen
vornehmlich die gesprochene und weniger die geschriebene Sprache. Althaus (1963, 1965)
fand in seiner Untersuchung der jiddisch-hessischen Sprachbeziehungen und seinen
wortgeographischen und sprachsoziologischen Studien zum jiddischen Lehnwortschatz
heraus, dass einige der jiddischen Lehnwörter aus dem Bereich des Viehhandels stammen
(z.B. Beschores → unerlaubter Gewinn; Behejme → Kuh; Katzoff → Fleischer) und andere
161
über die Gaunersprache des Rotwelschen Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden
haben, u.a.:
Kaff → kephar → Dorf
Kaffer → kaffer → Bauer
m’schuge → meschugge
mies → miess → häßlich
Mischpoke → mischpoche → Sippschaft
schmujess → Schmus
schtuss → Stuss
Tinnef → tinef → Unrat
Einige Jiddismen (u.a. dufte, kess, knorke) hätten über das Berlinerische eine überregionale
Bedeutung erlangt. Viele der jiddischen Lehnwörter seien im Ursprung Hebraismen gewesen,
die in ihrem Übergang zu den Jiddismen bereits eine Anpassung an das Deutsche erfahren
hätten. Bei einigen der jiddischen Entlehnungen habe im Deutschen eine Verballhornung und
semantische Umdeutung der vormaligen Hebraismen stattgefunden, u.a.:
Hals- und Beinbruch → hazloche un broche → Glück und Segen
zoress- und jokresszeit → Saure-Gurken-Zeit → Zeit der Leiden und der Teuerung
Wo der Bartel den Most herholt (Bartel → barsel → Brecheisen), (Most → mojess → Geld):
Wo man durch Einbruch Geld holen kann
3.0 Fremdsprachliche Transferenzen im Koreanischen
Kim-Renaud (2009, 74) stellt fest, dass die koreanische Sprache im Laufe ihrer Entwicklung
einer Reihe fremdsprachlicher Einflüsse ausgesetzt war. In erster Linie seien in diesem
Kontext die chinesischen Schriftzeichen zu nennen, die von den Koreanern aufgrund ihrer
Verehrung der chinesischen Kultur übernommen worden seien und praktische Verwendung
im Alltag fanden.
Andere Transferenzen seien jedoch aus den Sprachen der Besatzungsmächte zwangsweise
erfolgt. In diesem Zusammenhang sei insbesondere der Einfluss der Mongolen, der
Mandschus, der Japaner und Russen als auch der sprachliche Einfluss der Amerikaner zu
nennen. Besonders der Anteil der japanischen und anglo-amerikanischen Lehnwörter habe in
162
den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. In letzter Zeit sei jedoch der Einfluss der
sogenannten „Sprachreinheitsbewegung“ („language purification movement“) zunehmend
stärker geworden, deren Ziel es sei, japanische Lehnwörter zugunsten koreanischer Wörter
zurückzudrängen. Die zunehmend kritische Sicht auf das Japanische habe ihren Ursprung
natürlich nicht zuletzt in der von 1910 bis 1945 währenden Kolonialisierung Koreas durch
Japan.
Kim-Renaud (2009, 77) berichtet, dass ab dem 18. Jahrhundert der westliche Einfluss auf das
Koreanische über den Weg des Chinesischen zugenommen habe. Grund dafür sei u.a. das
wachsende Interesse an der römisch-katholischen Kirche und an den westlichen Religionen
insgesamt gewesen. Die Aussprache der sprachlichen Transferenzen dieser Zeit habe sich
jedoch von der ursprünglichen Aussprache der Wörter in der Gebersprache deutlich entfernt,
u.a.:
Vornamen:
Matthew → mat’ae 마태
Luke → nuga 누가
Paul → paoro 바오로 baul 바울
Francisco → prangjisgo 팡지고 pransisko 프란시스코
John → yohan 요한
Städte- und Ländernamen:
San Francisco → saenp’uransisuk’o 샌프란시스코
Los Angeles → rosu aenjelesu 로스앤젤러스
Washington → wosingt’on 워싱턴
France → p’urangsu 프랑스
Kim-Renaud (2009, 77) konstatiert, dass trotz partiell bestehender Ablehnungen
fremdsprachlicher Transferenzen in der koreanischen Gesellschaft, die Globalisierung auch in
der Sprachentwicklung nicht aufzuhalten sei. Heutzutage seien viele Ausdrücke des täglichen
Lebens Lehnwörter aus dem anglo-amerikanischen Raum und auch in Zeitungen werde
vermehrt auf Lehnwörter englischer Provenienz zurückgegriffen, u.a.:
163
download → daunlodu다운로드
digital story → dijit’ol sut’ori 디지털 스토리
log in → roguin 로그인
natural-looking (real) makeup → riol meik’uop 리얼 메이크업
refill → rip’il 리필
site → sait’u 싸이트
service → sobisu 써비스
search engine → soch’i enjin 서치 엔진
star zoom in → sut’ajumin 스타 줌 인
sports lens → sup’och’urenju 스포츠 렌즈
sponsor link → sup’onso ringk’u 스폰서 링크
worldwide → wolduwaidu 월드 와이드
website → wep sait’u 웹 싸이트
image maker → imiji meik’o 이미지 메이커
issue → isyu 이슈
Internet shopping → int’onet syop’ing 인터넷 쇼핑
make-up artist → meik’op at’isut’u 메이크업아티스트
total beauty salon → to’tolbyut’i sallong 토털 뷰티살롱
scrap → suk’uraep 스크랩
news ranking → nyusuraengk’ing 뉴스 랭킹
big bang → bigbaeng 빅뱅
on-offline → on op’urain 온- 오프 라인
comeback → k’ombaek 컴백
campaign → k’aemp’ein 캠패인
complex → k’omp’uleksu 컴플랙스, 콤플랙스
top → t’op 톱
focus → p’okosu 포커스
photo news (journalism) → p’ot’onyusu 포토 뉴스
font → p’ont’u 폰트
164
Dabei seien bezüglich der Adaptation westlicher Lehnwörter in der koreanischen Sprache
einige Regelhaftigkeiten erkennbar. So würden Konsonantencluster unter Verwendung des
schwachen [u]-Vokals in zwei Silben aufgebrochen und wortfinale Silben oder Konsonanten
würden durch die Verschiebung des schwachen [u]-Lautes in die initiale Position der
anschließenden Silbe besonders akzentuiert (vgl. Kim-Renaud 2009, 78).
star → su-t’a 스타
cake → k’eik, k’e-i-k’u 케잌, 케이크
Eine besondere Rolle komme auch der Adaptation von Gleitlauten aus der Gebersprache
Englisch zu. Da das Koreanische im Silbeninnern ausschließlich über den Gleitlaut [y]
verfüge, würden fremde Gleitlaute in Wörtern englischer Herkunft wie down oder sight in der
koreanischen Adaptation zu vollen Vokalen. Dadurch erhielten die betreffenden Wörter eine
zusätzliche Silbe.
download → daunlodu 다운로드
site → sait’u 싸이트
In der Nehmersprache des Koreanischen nicht existierende Laute der Gebersprache wie [f],
[v] oder [z] würden als die diesen Lauten am nächsten kommenden Approximationen
realisiert. So werde beispielsweise der initiale Frikativlaut [f] durch den aspirierten Plosivlaut
[p‘] ersetzt.
font → p’ont’u 폰트
Diese Ersetzung des Frikativlautes durch den Plosivlaut gelte jedoch nicht in allen
Lautumgebungen. Vor Diphthongen oder Vorderzungenvokalen (Merkmal: + front) werde der
Frikativlaut [f] häufig auch als eine Kombination der Laute [h] und [w] wiedergegeben.
fine flowers → hwain p’ullawo 화인 플라워
Kim-Renaud (2009, 79) vergleicht die Bedeutung des gegenwärtigen anglo-amerikanischen
Spracheinflusses mit dem Einfluss des Chinesischen in früheren Zeiten.
165
Interessant sei auch die Tendenz der lautlichen Imitation von Lehnwörtern bei der Bildung
von Neologismen. So würden die Namen von Produkten, Läden und Programmen heutzutage
in einer solchen Weise geprägt, dass sie hinsichtlich ihres Lautgehalts wie Transferenzen aus
westlichen Sprachen oder aber aus dem Japanischen erschienen (vgl. Kim-Renaud 2009, 80).
Die solchermaßen gebildeten Neologismen würden zumeist auf einen Vokal enden und
ähnelten damit häufig italienischen Wörtern. Zur Erreichung dieses Effekts würden auch eine
fehlerhafte Orthographie und die Verwendung umgangssprachlicher oder dialektaler Formen
in Kauf genommen.
Fehlerhafte Orthographie:
it catches the eye → nunettine 눈에 띠네 누네띠네
to the eye → nun-e vs. nu-ne 눈에, 누네
Verwendung umgangssprachlicher Formen:
wanna eat here or take out? → mogullae sagallae 먹을래? 사 갈래?
Verwendung dialektaler Formen:
Shall I bite/eat it or not? → mukkamakka 무까 마까 anstelle von mogulkka malkka 먹을까?
말까?
Obwohl die Form mukkamakka (무까 마까) japanisch klinge, handele es sich um eine
dialektale, umgangssprachliche Variante des Koreanischen.
Kim-Renaud (2009, 80) betont, dass sich die Bildung von Neologismen im Koreanischen
keineswegs auf die ansonsten zu diesem Zweck üblicherweise verwendeten Nomen oder
Nominalphrasen beschränkt. Vielmehr würden auch Adverbialphrasen und ganze Sätze
verwendet, die einen ausländischen Klang imitieren.
Adverbialphrase:
in a skinny manner → ppaeppaero 빼빼로
Verwendung eines ganzen Satzes:
In the month of May create your own magic with text message → owol, muntcha mesiji-ro
masul-ul 오월, 문자 메시지로 마술을
166
Kim-Renaud (2009, 81) kommt hinsichtlich der Bildung und Verwendung von Neologismen
im Koreanischen zu der Erkenntnis, dass diese im Bereich der elektronischen digitalen
Kommunikation besonders frequent seien. Sie entstammten allerdings nicht nur dem
lexikalischen Bereich, sondern seien auch syntaktischer und diskurspragmatischer Natur.
Hinsichtlich der Akzeptanz von Neologismen in der koreanischen Sprachgemeinschaft gelte,
dass diese umso größer sei, je mehr ein Wort oder eine Satzstruktur koreanisch klinge, selbst
wenn sie nicht koreanischer Provenienz seien, u.a.:
have a good day → choun haru toeseyo 좋은 하루 되세요
Koreanische Sprachpuristen drängten dennoch darauf, fremdsprachliche Transferenzen
zugunsten rein koreanischer Wörter zurückzudrängen, u.a.:
association → yonhap 연합
committee → wiwonhoe 위원회
society → hyophoe 협회
Diese Bemühung gelte vor allem den japanischen Lehnwörtern.
Bezüglich der englischen Transferenzen im Koreanischen könne festgestellt werden, dass
englische Lehnwörter zum Teil parallel zu ihren koreanischen Entsprechungen existierten,
u.a.:
character → k’aerikt’o 캐릭터anstelle von inmul 인물
tip → t’ip 팁anstelle von gwittim 귀띰
play → p’ullei 플레이 anstelle von or nori 놀이
4.0 Fazit
Lehn- und Fremdwörter stellen fremdsprachliche Transferenzen aus einer Geber- in eine
Nehmersprache dar, deren Etymologie dem Sprachbenutzer häufig unklar ist.
Während Bußmann (1983, 293) zwischen Lehnwörtern im weiteren und im engeren Sinne
differenziert, führt Lewandowski (1985, 624) die zusätzlichen Kategorien der Lehnbedeutung,
167
Lehnbildung und Lehnprägung ein. Bei Eggers (1965, 626) finden sich zudem die
ergänzenden Kategorien der Lehnschöpfung, Lehnübersetzung und -übertragung.
Das Beispiel des Deutschen illustriert die vielfältigen fremdsprachlichen Einflüsse und
Transferenzen, denen die deutsche Sprache im Laufe ihrer Geschichte ausgesetzt war. So
zeigen sich für das Althochdeutsche insbesondere zahlreiche Transferenzen griechischer und
vulgärgriechischer als auch lateinischer, vulgär- und spätlateinischer Provenienz. Für die
höfische Zeit kann ein starker französischer Einfluss auf die deutsche Sprache konstatiert
werden.
Neben den französischen Transferenzen sind insbesondere auch die englischen,
niederländischen, skandinavischen und jiddischen Transferenzen im Deutschen von
erheblicher Relevanz.
Henne/Wiegand (1980, 667) verweisen auf einen starken englischen Einfluss auf die deutsche
Sprache für das 17. und 18. Jahrhundert, der sich vornehmlich auf die Bereiche der
Philosophie und Dichtung konzentriert habe. Bezüglich der englischsprachigen Transferenzen
sei für diesen Zeitraum eine deutliche Dominanz von Lehnprägungen gegenüber Lehnwörtern
festzustellen. Für das 19. Jahrhundert konstatieren Henne/Wiegand (1980, 667) eine
Steigerung der englischen Transferenzen in den Kategorien der Industrialisierung, des
Handels, der Arbeiterbewegung, des Parlamentarismus, des Rechtswesens und des
Gesellschaftslebens. Für diese Zeit sei auch ein verstärktes Auftreten von Lehnübersetzungen
in den Kategorien des Sports und des Pressewesens feststellbar.
Im 20. Jahrhundert sei der Einfluss des Britischen Englisch zugunsten eines stärkeren
Einflusses des Amerikanischen Englisch zurückgegangen.
Nach Henne/Wiegand (1980, 668) reichen die niederländischen Einflüsse auf das Deutsche
vom Mittelalter bis in die Gegenwart und betreffen vornehmlich die Kategorien des
Wasserbaus und der Urbarmachung (in den Hansestädten) als auch der Seemannssprache, des
Schiffbaus und der Schiffahrtstechnik. Zahlreiche niederländische Entlehnungen im
Deutschen hätten auch über den Umweg des Französischen, Spanischen, Portugiesischen und
Italienischen Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Zu beachten sei insgesamt auch der
hohe Anteil niederländischer Transferenzen in den Sondersprachen des Geldes und der
Gartenkunst.
Die skandinavischen Transferenzen im Deutschen beschreiben Henne/Wiegand (1980, 669)
als eine Folge der deutschen Begeisterung für die nordische Mythologie und Literatur. Der
Großteil der Entlehnungen in diesem Bereich sei dabei norwegischer und dänischer
168
Provenienz. Bei den jüngeren skandinavischen Transferenzen dominiere der Bereich der
Sachentlehnungen. Auch skandinavische Rufnamen würden frequent entlehnt.
Henne/Wiegand (1980, 669) sehen von den jiddischen Transferenzen im Deutschen
vornehmlich die gesprochene Sprache betroffen. Einige jiddische Lehnwörter beträfen den
Bereich des Viehhandels, während andere über den Weg der Gaunersprache des Rotwelschen
Eingang in die deutsche Sprache gefunden hätten. Auch über das Berlinerische habe eine
Verbreitung des Jiddischen stattgefunden. Viele der jiddischen Lehnwörter seien im Ursprung
Hebraismen gewesen.
Nach Kim-Renaud (2009, 74) war die koreanische Sprache im Laufe ihrer Entwicklung
zahlreichen Transferenzen ausgesetzt. Hierzu gehörte insbesondere der sprachliche Einfluss
der Besatzungsmächte (Mongolen, Mandschus, Japaner, Russen). In jüngerer Zeit sei der
Anteil japanischer und anglo-amerikanischer Lehnwörter besonders signifikant. Aufgrund der
japanischen Kolonialisierung Koreas (1910-1945) habe die koreanische Gesellschaft jedoch
eine kritische Sicht auf den japanischen Spracheinfluss.
Trotz der Bemühungen der koreanischen Gesellschaft um eine Begrenzung des
fremdsprachlichen Einflusses auf die koreanische Sprache („Sprachreinheitsbewegung“) sei
die Globalisierung jedoch auch im Bereich der Sprachentwicklung nicht aufzuhalten. Viele
Lehnwörter im Koreanischen entstammten heutzutage dem anglo-amerikanischen
Sprachraum. Auch die Presse bediene sich verstärkt englischer Transferenzen. Dabei werde
im Zuge der Adaptation zumeist der Versuch unternommen, westliche Lehnwörter der
koreanischen Lautung anzupassen.
Kim-Renaud (2009, 79) beobachtet die Tendenz der lautlichen Imitation von Lehnwörtern bei
der Bildung von Neologismen. Diese würden häufig dergestalt geprägt, dass sie wie
Transferenzen aus westlichen Sprachen oder dem Japanischen erschienen. Zur Erreichung
dieses Effekts würden auch Abweichungen von der Standardsprache in Kauf genommen.
Kim-Renaud (2009, 81) stellt bezüglich der Verwendung von Neologismen und hinsichtlich
der fremdsprachlichen Transferenzen im Koreanischen eine hohe Frequenz derselben im
Bereich der digitalen Kommunikation fest. Gelegentlich existierten fremdsprachliche
Transferenzen (vornehmlich des Englischen) auch parallel zu ihren koreanischen
Entsprechungen.
169
5.0 Literatur
Althaus, Hans-Peter: „Wortgeographische und sprachsoziologische Studien zum jiddischen
Lehnwortschatz am Beispiel Kazow ‚Fleischer‘.“ In: Zeitschrift für Deutsche Sprache
(ZDS) 21 (1965), 20-41.
Althaus, Hans-Peter: „Jiddisch-hessische Sprachbeziehungen.“ In: Zeitschrift für
Mundartforschung (ZMF) 30 (1963), 104-156.
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Bynon, Theodora: Historische Linguistik. Eine Einführung. München 1981.
Eggers, Hans: Deutsche Sprachgeschichte. Band I. Berlin 1965.
Haspelmath, Martin/Tadmor, Uri (Hrsg.): Loanwords in the World’s Languages: A
Comparative Handbook. Berlin 2009.
Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst: Lexikon der Germanistischen Linguistik. Band IV.
Tübingen 1980.
Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst: Lexikon der Germanistischen Linguistik. Band III.
Tübingen 1980.
Hjelmslev, Louis: Die Sprache. Darmstadt 1968.
Kessel, Katja/Reimann, Sandra: Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. Basel/Tübingen.
2. Auflage 2008.
Kim-Renaud, Young-Key: Korean. An Essential Grammar. New York 2009.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch Band 2. Heidelberg. 4. Auflage 1985.
Schmidt, Wilhelm: Deutsche Sprachkunde. Berlin 1972.
Stiven, Agnes Bain: Englands Einfluss auf den deutschen Wortschatz. Dissertation. Marburg
1936.
170
XI. Der Satz im Koreanischen
1.0 Einleitung
Beim Koreanischen handelt es sich um eine agglutinierende Sprache der ural-altaischen
Sprachfamilie, die eine Subjekt-Objekt-Verb (S-O-V) - Struktur aufweist. Die Verben werden
von Suffixen gefolgt und können durch die Markierung von Tempus, Aspekt, Modus und
Honorativformen unterschiedliche Sprachstile denotieren. An Nomen, Pronomen und andere
nicht-verbale Wortarten (parts of speech) werden Partikeln angehängt, die ihre grammatische
Rolle im Satz markieren (vgl. Kim-Renaud, Young-Key 2009, 46).
Das Koreanische verfügt über keine Präpositionen. Ein Großteil der grammatischen
Beziehungen und anderer funktionaler Verbindungen, die im Englischen über Präpositionen
sowie subordinierende und koordinierende Konjunktionen markiert werden, werden im
Koreanischen durch postpositionale Partikeln realisiert. Durch diese Markierung mithilfe
einer Postposition kann das Subjekt auch an anderer Stelle als am Satzanfang stehen.
Der übliche koreanische Satzbau folgt dem nachstehenden Muster:
1. Zeitadverbiale
2. Ortsadverbiale
3. Subjekt-Nominalphrase
4. Dativ-Nominalphrase
5. Modale Adverbiale (Adverbiale der Art und Weise)
6. Objekt-Nominalphrase
7. Verb
(Kim-Renaud 2009, 55)
Sohn (1999) beschreibt die koreanische Sprache als eine Sprache mit einem hochentwickelten
Honorativsystem. Die Honorativformen des Koreanischen ließen sich nach dem Merkmal des
Sprachstils in sechs Typen differenzieren. Hierbei werde zwischen zwei honorativen
(deferential, polite) und vier nicht-honorativen Stilen (blunt, familiar, intimate, plain)
unterschieden.
Li und Thompson (1976, 475) beschreiben die koreanische und japanische Sprache als eine
weitgehend Topik-prominente Sprache (topic prominent language). In einer Topik-
prominenten Sprache sei die Syntax so organisiert, dass die Topik-Kommentar-Struktur
(topic-comment-articulation) eines Satzes hervorgehoben werde. Subjekt-prominente
171
Sprachen (subject prominent languages) wie das Englische hingegen wiesen in fast allen
Sätzen ein Subjekt auf. Dies sei selbst dann der Fall, wenn es in diesen Sätzen nichts gebe,
worauf das Subjekt referiere, wie dies bei der Verwendung pleonastischer Subjekte in Sätzen
wie It is raining der Fall sei.
Nach Bußmann (1983, 547f.) kann das Topik unter syntaktischem Aspekt als eine
Konstituente ohne Satzakzent verstanden werden. Bei unmarkierter Wortfolge entspreche das
Topik dem Subjekt eines Satzes, während der Rest des Satzes als Comment bezeichnet
werden könne. Das Topik lasse sich auch über einen Fragetest definieren, insofern es, im
Unterschied zum Comment, in der Frageformulierung als Interrogativpronomen erscheine.
Die Topik-Fokus-Gliederung (Topic-Comment-Articulation) entspricht nach Lewandowski
(1985, 1124) der Thema-Rhema-Gliederung. Die Thema-Rhema-Gliederung sei ein von der
Prager Schule entwickeltes Prinzip der kommunikativ-pragmatischen Gliederung eines
Satzes. Ziel der Anwendung dieses Prinzips sei es, Regularitäten der Satzgliedfolge im
Rahmen von Erfahrungskontext sowie Situations- und Sprachkontext zu erklären. Thema und
Rhema seien dabei als komplementäre Mitteilungsfunktionen zu verstehen.
Li/Thompson (1976, 475) betrachten neben dem Koreanischen und Japanischen die folgenden
Sprachen als weitgehend Topik-prominent:
Topik-prominente Sprachen (topic-prominent languages): Chinesisch, Lahu (eine tibeto-
burmesische Sprache gesprochen in China, Thailand, Myanmar und Laos), Lisu (eine tonale
tibeto-burmesische Sprache gesprochen in Yunnan im Südwesten Chinas, in Myanmar, in
Thailand und einem kleinen Teil von Indien).
Diesen Topik-prominenten Sprachen werden die folgenden Gruppen weitgehend Subjekt-
prominenter Sprachen gegenüber gestellt:
Subjekt-prominente Sprachen (subject-prominent languages): indoeuropäische Sprachen,
Niger-Kongo-Sprachen, finno-ugrische Sprachen, semitische Sprachen, Dyirbal (auch
Djirubal): eine australische Ureinwohnersprache, gesprochen im Nordosten von Queensland.
Die Sprache gehört zum kleinen dyirbalischen Zweig der Pama-Nyunga-Familie.
Als weder Subjekt- noch Topik-prominent (neither subject-prominent nor topic-prominent
languages) gelten nach Li/Thompson (ebd.) die Sprachen Tagalog und Ilocano (eine
172
austronesische Sprache, gesprochen auf den Philippinen, Lingua franca im Norden von
Luzon).
Hoeksema (1990) betrachtet das Koreanische als eine kopffinale Sprache (head-final
language). In Sprachen dieses Typs würden die zentralen Informationseinheiten bzw. der
Kopf einer größeren grammatischen Kategorie am Ende der Einheit stehen. Im Koreanischen
als einer S-O-V-Sprache sei diese Einheit das Verb bzw. die Verbalphrase. Die den Kopf
eines Satzes modifizierenden Einheiten seien als seine Konstituenten definiert. Phrasen mit
einem Kopf werden als endozentrisch bezeichnet, während Phrasen ohne klar erkennbaren
Kopf als exozentrisch bezeichnet werden. Je nach Sprache und Sprachtypus kann der Kopf
phraseninitial (head first) oder phrasenfinal (head last) auftreten oder aber variabel sein (head
variable).
Der Terminus des Kopfes wird nach Hoeksema (ebd.) im Kontext verschiedener
linguistischer Definitionen (semantisch, distributional, morphosyntaktisch, technisch) höchst
unterschiedlich interpretiert. Hoeksema (ebd.) erläutert dies am Beispiel des Kompositums
apple pie. Unter semantischer Perspektive sei der Kopf von A immer als Hyperonym von A
zu betrachten. In dem Kompositum apple pie sei pie der Kopf, da pie das Hyperonym von
apple pie sei, denn jeder apple pie sei auch ein pie. Apple, andererseits, könne nicht der Kopf
sein, da nicht jeder apple pie ein apple sei.
Unter distributionaler Perspektive sei es erforderlich, dass der Kopf von X dieselbe
Distribution aufweise wie X. So seien apple pie und pie gegeneinander austauschbar und
gehörten somit derselben Distributionsklasse an.
Morphosyntaktisch betrachtet gilt der Ort der Inflektion als der Kopf eines Kompositums. Da
apple pie seine Inflektion beim zweiten Glied erfahre (also apple pies anstelle von *apples
pie) sei pie als der Kopf des Kompositums zu betrachten.
Technisch betrachtet sei der Kopf von X der Teil, der X determiniere. In der Verbalphrase ate
the apple sei die Kategorie (ate the apple) durch das Verb ate determiniert. Dadurch könne
ate als Kopf der Phrase andere Phrasen miteinander koordinieren, die ebenfalls mit einem
Verb beginnen. Phrasen, die einen nominalen Teil enthielten, könnten jedoch nicht
koordiniert werden (vgl. peeled the apple and ate the apple vs. *ate the apple and over the
apple).
Die Platzierung des Kopfes determiniert entsprechend dem Kopfdirektionalitätsparameter
wesentlich die Richtung der Verzweigung. So sind kopfinitiale Phrasen rechts- und kopffinale
173
Phrasen linksverzweigt. In einer kopfmedialen Phrase werden Links- und Rechtsverzweigung
miteinander koordiniert.
Hoeksema (ebd.) betont, dass Sprachen in der Regel aus einer Mischung von kopfinitialen
und kopffinalen Anteilen bestehen. Reinformen existierten kaum, wenngleich das Japanische
und Koreanische weitgehend als Reinformen einer kopffinalen und linksverzweigten Sprache
gelten könnten. Die Existenz von Mischformen belegt Hoeksema (ebd.) am Beispiel des
Englischen. Hier existieren kopfinitiale, kopfmediale und kopffinale Phrasen nebeneinander:
Beispiele kopfinitialer, -finaler und -medialer Phrasen:
kopffinale Adjektivphrase (AP): too aggressive
kopffinale Adverbphrase (AdvP): quite slowly
kopfinitiale Verbphrase (VP): run fast
kopfinitiale Präpositionalphrase (PP): under pressure
kopfinitiale to-Phrase (to-P): to study
kopfmediale Adjektivphrase (AP): very happy with it
kopfmediale Verbphrase (VP): carefully clean it
Hoeksema (ebd.)
2.0 Satzmuster und Satztypen im Koreanischen
Kim-Renaud (2009, 54) betrachtet den einfachen Deklarativsatz als grundlegendes Satzmuster
im Koreanischen. Die von ihm präsentierten Beispielsätze werden auf der Basis der Phrasen-
Struktur-Grammatik (IC-Analyse) segmentiert und analysiert.
Grundlegende Satzmuster im Koreanischen:
(1)
Tongsaeng-i cha-yo.
Der jüngere Bruder/die jüngere Schwester schläft.
((tongsaeng-i) NP (choh-ayo) VP (intransitive))S
174
(2)
Sonsaegnim-i choh-ayo.
Der Lehrer/die Lehrerin ist gut.
((sonsaegnim-i) NP (choh-ayo) VP (stative))S
(3)
Saem-i yoja yeyo.
Sam ist eine Frau.
((saem-i) NP ((yoja) NP (yeyo) V (copula)) VP)S
(4)
Chung-i kogi-lul mog-oyo.
Der Mönch isst Fleisch.
((chung-i) NP ((kogi-lul) NP (mog-oyo) V (transitive)) VP)S
(5)
Sonnim-i kkoch‘-e mul-ul chu-oyo.
Der Gast gibt den Blumen Wasser.
((sonnim-i) NP ((kkoch‘-e) NP ((mul-ul) NP (chu-oyo) V (ditransitive)) VP) VP)S
Als einen einfachen Satz betrachtet Kim-Renaud (2009, 49) einen Satz, der aus einer
unabhängigen Phrase besteht, in die keine weitere Phrase eingebettet ist und dem kein
weiterer Satz folgt. Funktional betrachtet können dies sowohl Deklarativ- und Interrogativ-
als auch Imperativ- und Propositvsätze sein.
Einfache Sätze:
(1)
Inho-ka orenji-lul sa-ss-ta.
Inho-Subj. Orange-Obj. kaufen-Präteritum-Deklarativsatz
Inho kaufte Orangen. (Deklarativsatz)
175
(2)
Inho-ka orenji-lul sa-ss-ni?
Inho-Subj. Orange-Obj. kaufen-Präteritum-Interrogativsatz
Kaufte Inho Orangen? (Interrogativsatz)
(3)
Inho-ya orenji-lul sa-la.
Inho-Vokativ Orange-Obj. kaufen-Imperativsatz
Inho, kauf Orangen! (Imperativsatz)
(4)
Inho-ya orenji-lul sa-cha.
Inho-Vokativ Orange-Obj. kaufen-Propositivsatz
Inho, lass uns Orangen kaufen! (Propositivsatz)
(Kim-Renaud 2009, 49)
Zusammengesetzte Sätze:
Zwei oder mehrere Sätze können zu einem zusammengesetzten Satz verbunden werden. Ein
zusammengesetzter Satz ist ein Satz, der mehr als eine Phrase enthält. Diese Phrasen werden
mit einer koordinierenden Konjunktion oder einem Semikolon verbunden. Ein
zusammengesetzter Satz hat die folgende Struktur:
[[Insaeng-un tchalp-ko] S1 [yesurul-un kil-ta] S2] S.
Leben-Top kurz sein-Konj Kunst-Top lang sein-Deklarativ
Das Leben ist kurz und die Kunst ist lang.
(Kim-Renaud 2009, 49)
176
Komplexe Sätze:
Ein komplexer Satz ist ein Satz, der eine unabhängige Phrase und wenigstens eine abhängige
oder untergeordnete Phrase enthält.
Im Englischen beginnt ein untergeordneter Satz häufig mit einer subordinierenden
Konjunktion wie however, although, even though, because. Ein Relativsatz beginnt im
Englischen mit einem Relativpronomen wie who, which oder that.
Im Koreanischen erscheinen die Konjunktionen und modifizierenden Endungen am Ende der
subordinierten Phrase. Ein komplexer Satz im Koreanischen folgt daher der folgenden
Struktur. In dem Beispiel wird die Nominalphrase Orange von Satz 1 (welche ein Freund
verkauft) modifiziert:
[Inho-ka [[chi’in’gu-ka p’a-nun] S1 orenji] NP -lul sa-n-ta] S.
Inho-Subj Freund-Subj verkaufen-Mod Orange- Obj kaufen
Inho kauft die Orangen, die sein Freund verkauft.
(Kim-Renaud 2009, 49f.)
Lewin (1970, 34ff.) klassifiziert die Konjunktionalformen in komplexen koreanischen Sätzen
insbesondere im Hinblick auf die Anschlusstypen, die als Basen für die konjunktionalen
Endungen dienen können. Hierbei könne zwischen athematischen (Anschlusstyp 1) und
thematischen Verbalbasen (Anschlusstyp 2), den Konverbal- (Anschlusstyp 3) und den
Temporalstämmen (Anschlusstyp 4) sowie dem Präsens- (Anschlusstyp 5), dem Präterial-
(Anschlusstyp 6) und dem Futurpartizip (Anschlusstyp 7) differenziert werden. Lewin (1970,
35ff.) beschreibt die semantischen Funktionen der koreanischen Konjunktionalformen
exemplarisch anhand der temporalen, konditionalen und kausalen Marker.
I. Temporale Konjunktionalformen
Postverbal
Vorzeitigkeit (der Nebensatzhandlung)
아/어 (nachdem, Konverbalstamm)
서 3-so (nachdem)
서야 3-soya (erst wenn)
고서 1-goso (als, wenn)
고는 1-gonun (als, nachdem)
177
고야 1-goya (nachdem)
면서부터 2-myonsobuto (seitdem)
Nominalwertig
뒤(에) 6-dui(e) (nachdem)
후(에) 6-hu(e) (nachdem)
사이(에) 6-sai(e) (nachdem)
다음(에) 6-daum(e) (nachdem)
지 6-ji (nachdem, seitdem)
이래(로) 6-irae(ro) (seitdem)
Gleichzeitigkeit
매 2-mae (als)
면서 2-mynso (während)
니(까) 2-ni(kka) (als)
더니 1,4-doni (als, retrospektiv)
때 – 7 ttae (als, wenn)
무렵(에) – 7 muroyp(e) (während)
동안(에) – 5 tongan(e) (während)
사이(에) – 5 sai (e) (während)
중에 – 5 chunge (während)
길(에) – 5 kyol(e) (während)
적(에) – 7 chok(e) (wenn, gelegentlich)
제 – 7 che (wenn, gelegentlich)
족족 – 5 chokchok (jedesmal wenn)
Nachzeitigkeit
기(도)전에 – 1 ki(do)jone (bevor)
178
Abruptheit
자 – 1 cha (kaum)
자마자 – 1 chamaja (kaum)
자말자 – 1 chamalja (kaum)
다(가) – 1 ta(ga) (kaum)
즈음 – 7 chuum (gerade als)
차 – 6 ch’a (gerade als)
참에 – 5 ch’ame (gerade als)
대로 – 5 taero (sobald als)
기가바쁘게 – 1 ki-ga pappuge (kaum)
II. Konditionale Konjunktionalformen
Postverbal
면 - 2 myon (wenn)
다면 – 1 tamyon (wenn, Quot.)
자면 – 1 chamyon (wenn, Opt.)
느라면 – 1 nuramyon (wenn)
느라니까 – 1 nuranikka (wenn)
느니 – 1 nuni (wenn)
거든/어든 – 1 (k)odun (wenn)
건대/언대 – 1 (k)ondae (wenn)
고는 – 1 konun (wenn)
고서는 – 1 kosunun (wenn)
고야 – 1 koya (wenn)
서야 – 3 soya (wenn)
야 – 3 ya (nur)
던들 – 1 tondul (gesetzt den Fall)
Nominalwertig
들 – 6 tul (wenn)
진대 – 7 chindae (gesetzt den Fall)
179
III. Kausale Konjunktionalformen
Postverbal
니(까) – 2 ni(kka) (weil)
느니 – 1 nuni (weil)
나니 – 1 nani (weil)
거니 – 1 koni (weil)
더니 – 1 toni (weil)
거늘 – 1 konul (weil)
매 – 2 mae (weil)
서 – 3 so (weil)
느라고 – 1 nurago (da gerade)
관대 – 1 kwandae (etwas wegen)
Nominalwertig
므로 – 7 muro (dadurch dass)
고로 – 5,6 koro (weil)
기로 – 1 kiro (in Anbetracht von)
기에 – 1 kie (dadurch dass)
길래 – 1 killae (dadurch dass)
기때문(에) – 1 ki-ttaemun (e) (weil)
까닭(에) – 5,6,7 kkadalk (e) (aus dem Grunde dass)
바람에 – 5 parame (infolge)
걸 – 6 kyol (infolge)
나머지(에) – 5,6 namoji (e) (bedingt durch)
사이(에) – 7 sai (e) (weil)
대로 – 5,6,7 taero (entsprechend)
지라 – 5,6 chira (weil)
지니- 7 chini (weil)
즉 – 6 chuk (weil)
* Die angegebenen Ziffern beziehen sich auf den jeweiligen konjunktionalen
Anschlusstyp.
vgl. Lewin, B. (1970, 35ff.) und Kostrzewa, F./Cheon-Kostrzewa, B.J (2013, 69ff.)
180
Exemplarisch für die Verwendung der koreanischen Konjunktionalformen werden im
Folgenden die postverbal verwendeten Konjunktionen in einem satzwertigen Kontext
illustriert.
(1)
서: 선물을 사서 곱게 쌌어요.
Seo: seonmureul saseo gobge ssasseoyo.
Ich habe das Geschenk schön eingepackt, nachdem ich es gekauft hatte.
(2)
고서: 아이는 숙제를 하고서 밥을 먹었다.
goseo: aineun sukjerul hagoseo babeul mogeossta.
Nachdem es die Hausgaben gemacht hatte, hat das Kind gegessen.
(3)
고야: 아이는 숙제를 하고야 밥을 먹었다.
goya: aineun sukjerul hagoya babeul meogeossta.
Nachdem es die Hausgaben gemacht hatte, hat das Kind gegessen.
(4)
고서야: 아이는 숙제를 하고서야 밥을 먹었다.
goseoya: aineun sukjerul hagoseoya babeul meogeossta.
Das Kind hat gegessen, erst nachdem es die Hausaufgaben gemacht hatte.
(5)
면서부터:일을 시작하면서부터 그 남자는 잠을 설쳤다.
myeonseobuteo: ireul shijakha myeonseobuteo namjaneun chameul seolchyeossta.
Er schlief nicht gut, seitdem er mit der Arbeit angefangen hatte.
Kostrzewa, F./Cheon-Kostrzewa, B.J. (2013, 69ff.)
Lewin (1970) zeigt in seiner Analyse der postverbalen Konjunktionalformen, dass diese
sowohl mono- als auch polyfunktional verwendet werden können. Dabei verweist Lewin
(ebd.) auf die Polyfunktionalität der Konjunktionalformen insbesondere in den temporal-
kausal-konditionalen und den konzessiv-adversativen Bereichen. So können beispielsweise
181
die Formen 니(까) (-ni(kka)) und 서 (so) postverbal zur Markierung der Temporalität
(Gleichzeitigkeit) als auch als postverbale kausale Konjunktionalformen verwendet werden.
3.0 Fazit
Das Koreanische ist eine agglutinierende Sprache der ural-altaischen Sprachfamilie mit einer
Subjekt-Objekt-Verb-Struktur. Die Markierung von Tempus, Aspekt, Modus und Honorativ
erfolgt über Suffixe. Weitere grammatische Beziehungen und funktionale Verbindungen
werden über postpositionale Partikeln realisiert.
Die koreanische Sprache kann als eine weitgehend Topik-prominente Sprache beschrieben
werden, bei der die Topik-Kommentar-Struktur des Satzes im Zentrum steht. In Anlehnung an
Hoeksema (1990) wurde die koreanische Sprache entsprechend dem
Kopfdirektionalitätsparameter als kopffinale, linksverzweigte Sprache beschrieben. Es wurde
jedoch betont, dass Reinformen kopffinaler, linksverzweigter oder kopfinitialer,
rechtsverzweigter Sprachen selten sind. Deutlich häufiger sei das Auftreten von Mischformen.
Bei den Satzmustern des Koreanischen kann zwischen einfachen, zusammengesetzten und
komplexen Sätzen unterschieden werden. Während ein einfacher Satz aus einer einzigen
unabhängigen Phrase besteht, werden in einem zusammengesetzten Satz zwei oder mehr
Phrasen durch eine koordinierende Konjunktion miteinander verbunden. Komplexe Sätze
enthalten eine unabhängige und mindestens eine abhängige oder untergeordnete Phrase.
Konjunktionen oder modifizierende Endungen am Ende einer subordinierten Phrase
verbinden die Phrasen eines komplexen Satzes miteinander.
In Anlehnung an Lewin (1970) wurden die Konjunktionen der koreanischen Sprache,
hinsichtlich ihrer semantischen Funktionen, anhand der temporalen, konditionalen und
kausalen Marker exemplifiziert. Abschließend wurde die Verwendung der koreanischen
Konjunktionalformen am Beispiel der postverbal verwendeten Konjunktionen in einem
satzwertigen Kontext illustriert.
182
4.0 Literatur
Bußmann, Hadumod (1983): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
Hoeksema, Jack: „The Head Parameter in Morphology and Syntax”. Vortrag auf dem
holländischen Morphologie-Tag in Utrecht (Frühjahr 1990) und am Max-Planck-
Institut für Psycholinguistik in Nimwegen.
Kim-Renaud, Young-Key: Korean - An Essential Grammar. New York 2009.
Kostrzewa, Frank/Cheon-Kostrzewa, Bok Ja: „Konjunktionen im deutsch-koreanischen
Sprachvergleich - Schwierigkeiten koreanischer Lerner beim Erwerb des deutschen
Konjunktionalsystems“. In: Journal of Linguistics and Language Teaching Volume 4
(2013) Issue 2, 69-81.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch Band 3. Heidelberg. 4. Auflage 1985.
Lewin, Bruno: Morphologie des koreanischen Verbs. Wiesbaden 1970.
Li, Charles N.; Thompson, Sandra A.: "Subject and Topic: A New Typology of Language".
In: Charles N. Li. Subject and Topic. New York: Academic Press. 1976, S. 475.
Sohn, Ho Min: The Korean Language. Cambridge 1999.