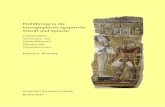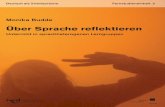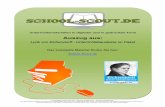Die Sprache als dargestellte Welt — Zur Lyrik von Stanisław Barańczak
Transcript of Die Sprache als dargestellte Welt — Zur Lyrik von Stanisław Barańczak
Russian Literature XVI (1984) 127-160 North-Holland
DIE SPRACHE ALS DARGESTELLTE WELT
ZUR LYRIK VON STANISZAW BAF&CZAK
WEODZIMIERZ BOLECKI
Eine Sprache sprechen, in der das Wort "Gefahr" einen erschaudern l&St, das Wort"Wahrheit"der Titel einer Zeitung ist, die Wbrter"Freiheit"und"Demokra- tie" dienstlich unterstellt dem General der Polizei; wie ist es denn geschehen,dass wir Ge- gonnen haben dies Spiel zu treiben? Diese Wortspielchen? Diese Kalauer, Versprecher, Verkehrungen des Sinns, diese linguistische Poesie?
(S.Baradczak, KiinstlicheBeatmung, 11)
Von der Poesie der "Generation 68" wird gewijhnlich in einem Atemzug gesprochen: Staniszaw Barariczak und Ryszard Krynicki (Poznari), Julian Kornhauser und Adam Zagajewski (Krakau), Jacek Bieriezin und Witold Suk- kowski (LodB), Krzysztof Karasek, Jaroslaw Markiewicz und Leszek Szaruga (Warschau). Ich nenne hier nur die allerbekanntesten Gestalten. Solange man eine einzige poetische Generation meint, erfiillt diese Bezeichnung ihre evokative Funktion mit hinlgnglicher Deutlich- keit. Zweifelhafter wird es aber, wenn man in einem Atemzug von der "Sprache", von dem "Programm", von der "Poetik" oder von der "Weltanschauung" in der Poesie dieser Generation spricht, und wenn man die Lyrik der sog. neuen Welle als ein geradezu homogenes Ph;i- nomen betrachtet, wo die einzigen Unterschiede sich auf die Namen und den jeweiligen Wohnort der Autoren beziehen. Dann erinnert das literaturkritische Spre- then in einem Atemzug an einen asthmatischen Husten.
0 304--3479/84/$3.00 0 1984 Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)
128 Wtodzimierz Bolecki
Seit den ersten Gedichtbsndern dieser Generation sind iiber 15 Jahre vergangen. Jeder von den genannten Dichtern hat nun eine unterschiedliche kiinstlerische zrfahrung hinter sich - im Bereich der Lyrik, der Ubersetzung, der Essayistik oder der Prosa. Es gibt also keine Griinde, die Dichter dieser Generation pro- grammatisch nur deswegen zu identifizieren, weil sie gemeinsam ins literarische Leben eingetreten sind. Heute ist sehr deutlich zu sehen, dass die lyrischen Schreibweisen der Dichter der "Generation 68" eher einen embarras de richesse darstellen als eine ein- heitliche Poetik oder poetische Schule. Die Gedichte von Barariczak und Karasek oder von Krynicki und Zaga- jewski unterscheiden sich doch so sehr, dass es schwer f;illt, ihnen St&dig dasselbe Etikett anzuheften. Es scheint mir, wenn wir gerade heute iiber die Dichter dieser Generation sprechen, so miissen wir die unter- schiedlichen kiinstlerischen und intellektuellen Indi- vidualitsten sehen und nicht nur, wie man es aus den Manifesten der jiingeren Jahrgsnge herauslesen kijnnte, eine ganz starke Gruppe mit dem Plattencover "Genera- tion 68".
Im Vordergrund dieser Skizze sollen die Gedichte von Staniskaw Bararlczak stehen - aber nicht als Bei- spiel der Poetik oder der Sprache der sog. neuen Wel- le, sondern als g;inzlich selbstgndige und originelle poetische Konzeption. Bevor ich aber zu den Besonder- heiten von Barariczaks Lyrik iibergehe, noch ein paar Worte iiber einige Dinge, die ihn tatszchlich mit den anderen verbinden.
Der Name "Generation 68" ist in den 70er Jahren entstanden und war - wie meist in solchen FZllen - eine retrospektive Bezeichnung. Dieser Name tritt promiscue mit dem Terminus "Neue Welle" auf, der als Imitation der franz&ischen Bezeichnung "La nouvelle vague" diepolnische Spezifik dieser Dichtergeneration und ihrer Genealogie wirksam verwischt. Die betroffe- nen Dichter selbst identifizieren sich am liebsten mit der Bezeichnung "Generation 68".' Beide Teile die- ses Terminus sind wichtig: "Generation" ist eine ge- neralisierende Bezeichnung im Gegensatz zu "Gruppe", obwohl die Dichtung der genannten Autoren zunschst mit der Strategie der Gruppenprssentation verbunden war, also mit der Posener Gruppe "Proby", mit der Krakauer Gruppe "Teraz" bzw. mit der Warschauer Muta- tion der sog. Orientacja Hybrydy. Die Wahl der Gene- rationstrategie am Anfang der 70er Jahre war ein cha- rakteristisches Moment dieser Generation: sie zeugte von der iiber die einzelne Gruppe hinausreichenden Zsthetischen Gemeinsamkeit, vor allem aber von dem
Baran"czaks dargestezlte Sprache 129
Gefiihl, dass die Generation und die Situation neue poetische Schreibweisen erforderlich machten.
Der zweite Teil des Namens "Generation 68" ist kei- neswegs so offenkundig, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Nach den Selbstaussagen der Dichter dieser Generation aus den 7Qer Jahren, wie sie im kul- turellen Bewusstsein sich festgesetzt haben, sind die Quellen ihrer Dichtung in der Geschichte der Studen- tenstreiks im Msrz 1968 zu suchen. Dieses Generations- erlebnis, das zwei Jahre sp;iter durch die Ereignisse an der Ostseekiiste verstgrkt wurde, hat die Hauptmoti- vet Themen und sprachlichen Interessen der einzelnen Dichter bestimmt. Der politische Sinn dieses Erlebnis- ses ist seit langem offenkundig und bildet den prinzi- piellen ausserliterarischen Kontext der Dichtung die- ser ganzen Generation. Ein Forscher der Nachkriegspoe- sie kann sich damit jedoch nicht begniigen. Die poeti- schen Genealogien reichen nzmlich tiefer in die Ver- gangenheit als nur bis zu den Ereignissen der Jahre 1968 und 1970, und iiberdies hat diese Vergangenheit nicht nur politischen Charakter, sie ist doch ebenso such literarische Tradition.2 Dariiber hinaus hat das Jahr 1968 fiir diese Generation such eine andere Bedeu- tung: in eben diesem Jahr sind zwei besonders wichtige erste Gedichtbznde dieser Generation erschienen (Ge- burtsakte von Ryszard Krynicki und Gesichtskorrektur von Baranczak), der zweite Gedichtband von Jaroslaw Markiewicz ("Ich bin gekommen, urn nach dem Eigennamen der Zeit zu fragen, die ich einbringe") und dariiber hinaus wurde einige Monate friiher der erste Gedicht- band von Krzysztof Karasek publiziert, Die Stunde der Habichte (1967). Interessant sind hierbei die unter- schiedlichen poetischen Kontexte, aus denen die ersten Gedichtbznde der "Generation 68" entstanden sind. Kry- nicki, Karasek und Markiewicz waren ngmlich ziemlich stark verbunden mit der Orientacja Hybrydy - und erst nach dem Buch Nieufni i zadufani (Die Misstrauischen und die Vertrauensseligen) von Barariczak, nach den Debuts von Zagajewski und Kornhauser sollte das Pro- gramm der "Generation 68" deutlich gegen das Poesie- model1 der Orientacja Hybrydy und danach gegen viele Dichter der Generation der "Wspolszesnosc" (Gegenwart) gerichtet werden. Und erst von diesem Augenblick an zeichnet sich das Schaffen der Dichter der "Generation 68" im kollektiven Bewusstsein als gemeinsame poeti- sche Schule mit einer ganz bestimmten Asthetik, Thema- tik und mit ganz bestimmten gesellschaftlichen Funk- tionen abe
Zweifellos ist eins der Themen, die das Gefiihl einer generationsm%sigen Gemeinsamkeit vermittelten,
130 Wtodzimierz BoZecki
das Interesse an der Sprache als dem hauptsgchlichen Kontext der Poesie gewesen. Die Dichter der "Genera- tion 68" haben dies in zahlreichen diskursiven Xusse- rungen zum Ausdruck gebracht, in Rezensionen, Inter- views, in Skizzen oder in Selbstaussagen. Das Interes- se an der Sprache hatte bei alledem zumindest drei ver- schiedene Bedeutungen.
Als Kritikerder gegenwsrtigen Literatur manifestier- ten sie ihren Unwillen gegeniiber den iiberkommenen Kon- ventionen der lyrischen Sprache, an der sie vor allem die Symbolik, die Abstraktheit und den selbstgeniigsa- men Asthetizismus als poetische Grundhaltung beksmpf- ten. Zweitens ist das Wort "Sprache" und die damit verbundene Wortfamilie zur Hauptquelle fiir Metaphern und Tropen sowohl in ihren Gedichten als such in ihrer literarischen Publizistik geworden. Drittens schliess- lich haben die Autoren der neuen Welle an der Sprache immer besonders hervorgehoben, eben sie sei fiir die junge Poesie der allernschste thematische Kontext - so wie es in iriiheren Zeiten der Lyrik die Malerei, die Musik, die mythologische oder historische Thematik sein konnte. Fiir die Dichter dieser Generation ist die Sprache mithin zur charakteristischsten Ebene des so- zialen Lebens geworden. In der Publizistik, in der Zei- tungssprache, im Alltags- und im Amtspolnisch haben sie die hauptsschliche Quelle ihrer poetischen Inspira- tionen entdeckt.
In der Literaturkritik hat sich dafiir die Erkl;irung eingebiirgert, Ursprung dieser Interessen sei das Haupt- schlagwort der studentischen Streiks vom M;irz 1968 ge- wesen, ntilich "die Presse liigt". Diese Erkl;irung er- scheint mir, such wenn sie zweifellos richtig ist, dennoch nicht ganz ausreichend und ich meine, es l&St sich die These nicht halten, die linguistische Thema- tik in der Poesie der "Generation 68" sei an der Wende der 60er und 70er Jahre zum erstenmal aufgetreten. In Wahrheit hat dieses Thema seit vielen Jahren im poeti- schen Bewusstsein und in der poetischen Praxis gewirkt - hierzu muss nur auf die St&mung der "linguistischen Poesie" hingewiesen werden, eine Bezeichnung, die Ja- nusz Slawiriski erfunden hat. Unbestreitbar aber hat die politische Erfahrung des Jahres 1968 grundsstzli- the Verznderungen im Schicksal des poetischen Linguis- mus hervorgerufen. Zu den biographischen Erlebnissen kam die Kenntnis der Biicher von Klemperer und Orwell hinzu, die zeigten, wie das gesellschaftliche Leben durch die Sprache manipuliert werden kannm4 Es muss hier such auf die philologische Bildung vieler Dichter der "Generation 68" hingewiesen werden. Doch sind dies schon etwas andere Kontexte. Kehren wir zur Poesie zu- riick.
Barariczaks dargesteZLte Sprache 131
In der Literatur der letzten 15, 20 Jahre spielen viele Metaphern eine Rolle, die unter Bezug auf die sprachliche und artikulatorische Terminologie gebildet sind. Man kann sie schon in den Buchtiteln finden - In einem Atemzug (Baranczak), Mit eigenen Worten (Sza- ruga) , Als Stimme (Balcerzan), Zweiter Atem (Zagajew- ski), und diese Liste liesse sich leicht urn eine grosse Anzahl von Gedichttiteln erweitern, wo die Quelle der Metaphern Wijrter sind wie "Zeichen", "Bedeutung", "Satz", "Mund" etc. Dariiber hinaus war die linguisti- sche Terminologie ein hzufiges Anzeichen fiir die The- matik von Gedichten iiber das Sprechen oder iiber das Schreiben - ich denke hier an einige Werke von Wiszawa Szymborska, Ewa Lipska, Boguskawa Latawiec, Witold Wirpsza, Edward Balcerzan, Tymoteusz Karpowicz oder Zbigniew Biedkowski. Diese Thematik gab es schon lange in der literarischen Praxis, doch war ihre Realisie- rung in den meisten Fsllen vom poetischen Linguismus weit entfernt. Es wsre sicherlich interessant, die verschiedenen Phasen dieser Thematik in der Metaphorik der polnischen Poesie nach dem Jahre 1945 zu verfol- gen. Es wiirde sich dabei wohl herausstellen, dass die Dichter der "Generation 68" als erste diese Problema- tik zum formulierten Thema ihrer Konzeption von Dich- tung gemacht haben. Und dass erst fiir sie das Schrei- ben iiber die Sprache zur erstrangigen Aufgabe der Poe- sie, und fiir die Leser ihrer Werke zum charakteris- tischsten Merkmal ihrer Werke geworden ist.
Die DarsteZZung der Sprache
Unbestreitbar enthalten die Gedichte von Staniszaw Barariczak im Kontert der ganzen "Generation 68" die am weitesten vorangetriebene linguistische Poetik. Was bedeutet bei diesen Dichtern"Darstellung der Sprache"?
Wenn ich von der Sprache als von der dargestellten Welt spreche, meine ich nur diejenigen Gedichte von Staniskaw Baraficzak, in denen die dargestellten Ele- mente sprachliche Ausdriicke und die Mechanismen ihres gesellschaftlichen Funktionierens sind und nicht nur Inhalte, die von Worten benannt werden, also nicht nur gegenstgndliche Determinanten der Textsemantik.
Unter den vielen Werken von Barariczak interessieren mich nur die Gedichte, in denen die einzelnen sprach- lichen Ausdriicke die Funktion von ganz wBrtlich ver- standenen dargestellten Gegenstznden annehmen - so wie in der darstellenden Poesie die Landschaft ein darge- stellter Gegenstand oder in der erzshlenden Poesie Er- eignisse ein dargestellter Gegenstand sind. Mit dieser Formulierung ist bereits angedeutet, dass es bei Barafi
132 i?$odzimierz Botecki
czak such zahlreiche andere Motive, Themata oder Merk- male der Textpoetik gibt.
Es reicht aber nicht aus zu sagen, dass "die Dar- stellung der Sprache" nur eines von vielen Motiven der Gedichte von Baranczak ist. Die "sprachdarstellenden" Gedichte stehen nzmlich mit Gedichten in Nachbarschaft, in denen die Sprache gleichsam transparent ist, in de- nen die Warter Dinge, Gefiihle und vor allem Werte ein- fach benennen. Neben der "Darstellung der Sprache" gibt es also such eine prszise Beschreibung von Situa- tionen, Verhaltensweisen, Haltungen von Menschen, ver- bunden mit einer moralischen Wertung der Wirklichkeit. In dieser Arbeit werde ich mich aber auf die Gedichte beschrznken, in denen Barariczak die Sprache darstellt. In der Lyrik Stanislaw Barariczaks finden wir Gedichte zum Thema von sprachlichen Ausdriicken wie "kollektiver Enthusiasmus", "In einem Atemzug", "Eine gewisse Epo- the" oder "Sic drgngeln sich vor". Der Ausgangspunkt des poetischen Stils ist hier also nicht ein Gegen- stand, ein Ereignis oder eine Situation. Die lyrischen Aktionen in diesen Gedichten Barariczaks spielen sich neben der traditionell gegenstzndlichen Seite der Welt ab - das heisst, ihr Territorium sind sprachliche Idio- meI Figuren, Verwendungen einzelner Ausdriicke und ihre Funktionen. Betrachten wir in dieser Hinsicht das Ge- dicht "Plakat" aus dem Gedichtband Morgenzeitung. Eine poetische Beschreibung der Figuren auf dem Plakat ist ersetzt durch die Aufzghlung stereotyper sprachlicher Ausdriicke: "Leicht erhobener Kopf", "aufrichtiger Blick", "den Blick geheftet auf", "Treppe des Fort- schritts", "urn einen Kopf grbsser", "iiber dem Durch- schnitt", "in perspektivischer Verkiirzung", "planmzs- sige Entwicklung", "proportional enger", "lzsst sich bequem unterbringen", "normalisiert", "gedankenvoller Gesichtsausdruck", "der Kopf ist zum Denken da", 'mit Kbpfchen". Die hier aufgezghlten Ausdriicke iibertragen keinerlei Infoxmationen iiber die Figur auf dem Plakat. Die einzige Information, die sie iibertragen, betreffen sie selbst, ihren stereotypen Charakter, das heisst, sie informieren dariiber, dass es in der Sprache Aus- driicke gibt, die nichts ausdriicken. Auf dem Plakat, das dieses Gedicht darstellen ~011, befindet sich mit- hin keine Gestalt oder Sache, sondern die Sprache selbst, oder genauer solche sprachlichen Ausdriicke, deren stereotyper Charakter jedem polnischen Mutter- sprachler sofort und unmittelbar einleuchtet. Auf die- sem sprachlichen Plakat nehmen also die Stellen von Farben, Strichen oder Gestalten WSrter, sprachliche Ausdriicke und ihre Verwendungen ein. Und in diesem Sinne werde ich weiter von der Sprache als dargestell- tern Gegenstand sprechen.
Baraficzaks dargestellte Sprache 133
In der poetischen Tradition bilden die Themen von Gedichten Repertoirs von deutlicher literarhistori- scher Markiertheit. Ihre Exponenten sind gewijhnlich einzelne Wijrter mit wiedererkennbarer stilistischer Markiertheit. Also zum Beispiel "Tugend" und "Vernunft" in der Aufklsrungspoesie, "Gott" und "Freiheit" in der romantischen Lyrik, "Arbeit" und "Schicksal" in der positivistischen Poesie, die Seele in der Lyrik der Jahrhundertwende, die Stadt, die Masse und die Maschi- ne in der Lyrik der Krakauer Avantgarde, "Friihling", "Strasse", "Wein" in den Gedichten der Skamandriten oder "Zeit", "Schlaf", "Tad" in der Poesie der 30er Jahre. Eine entsprechende thematische Rolle spielen in vielen Gedichten von Baraiiczak eine ganze Skala stereo- typer sprachlicher Ausdriicke, urn die sich die lyrische Aktion der einzelnen Gedichte konzentriert. Folgende Ausdriicke iiben bei Barariczak die Funktion traditionel- ler lexikalischer Requisiten aus: "sich zu Herzen neh- men", "mit ganzem Herzen auf seiten", "sehen wir der Wahrheit in die Augen", "was wird hier gespielt", "im Prinzip unmdglich", "sich auf die Zunge beissen", "das will mir nicht in den Kopf", "zeitweilige Begrenzun- gen", "selbst daran schuld", "Entschuldigung, kann ich hier anstehen" usw. Schon in dieser Aufzzhlung kann man die fiir Barariczak grundsztzliche Opposition zwi- schen Standardsprache und Nichtstandard- sprache wiederfinden. Die obenangefiihrten Ausdriicke sind schliesslich keine willkiirlichen Zusammenstellun- gen von WiSrtern, sondern Ausdriicke von ungewShnlich stabilisierter syntaktischer, semantischer und funktio- naler Organisation. Diese Formeln, als Gedichttitel initiieren sie einzelne Werke, enthiillen gleichsam den Vordergrund der sprachlichen Landschaft. Fiir Barariczak ist dies die sprachliche Kommunikation, die urn Wortverbindungen, Syntagmen, Idiome, Ausdriicke von profilierter stilistischer und funktionaler Mar- kiertheit konzentriert ist. Es sind dies keine Wijrter in Freiheit, sondern Wijrter, die in die Mechanismen der gesellschaftlichen Kommunikation verwickelt, oder Ausdriicke, die ein Produkt dieser Kommunikation sind. Es sind mithin WiJrter, deren lexikalische Individuali- tst durch ihre syntaktischen Kontexte oder speziellen Anwendungen verwischt worden ist.5
Dieser Ausgangspunkt von Barariczaks lyrischer Schreibweise gestattet es, das grunds5tzliche Axiom seiner Sprachphilosophie wahrzunehmen. Die Sprache als im Gedicht dargestellter Gegenstand ist fiir den Autor von Morgenzeitung weder ein Komplex von symbolischen Wijrtern, noch eine neutrale oder einfache Sprache, sie ist such keine Wiederholung literarischer Tradition
134 WCodzimierz Bo'Lecki
oder ein a priori gegebener Tr;iger transzendenter In- halte. Sie ist vielmehr eine Rede, das heisst eine deutliche Weise der Sprachverwendung in der gesell- schaftlichen Kommunikation. Exponenten der kommunika- tiven Stratifikation der Rede sind eben verschiedene Typen sprachlicher Ausdriicke, Idiome und alltagssprach- lither Formulierungen. Eben hier befindet sich das poe- tische Material, das fiir Barariczak der hauptsschliche Rohstoff seiner Poesie ist.
Liest man in dem Buch Die Misstrauischen und die Vertrauensseligen Barariczaks manche Formulierungen seines kiinstlerischen Programms, so kijnnte man den Ein- druck erhalten, sein Interesse fiir die Sprache und sein Verstgndnis der linguistischen Poesie halte sich im Grunde an das Terrain, das einige Jahre zuvor Janusz SZawiliski in seiner Abhandlung "Versuch zur Ordnung der Erfahrungent16 abgesteckt hatte. Ich sage scheint, denn in Wahrheit ist bei Baranczak zum Begri.ff der lin- guistischen Poesie ein vijllig neues Element hinzuge- kommen, das bei Slawiriski noch fehlte. Janusz SZawiri- ski hatte drei Varianten eines poetischen Verhsltnis- ses zur Sprache rekonstruiert. Erstens die Variante von Miron Biakoszewski - Demaskierung aller mijglichen nichtsystemischen Bestandteile des Sprechens, zweitens die Variante*.von Tymoteusz Karpowicz - Misstrauen ge- geniiber der Okonomie und Vieldeutigkeit der Sprache so- wie drittens die Variante von Zbigniew Bierikowski - die cberzeugung von der verschwenderischen Semantik der Sprache, die eine kommunikative Wirklichkeit ver- hindert. Barariczak dagegen verlegt das ganze Schwerge- wicht seiner Interpretation auf die Problematik einer linguistischen Manipu lie run g des Empfzngers. Baranczak re-interpretiert also SXawiiiskis Determinan- ten der Strijmung der linguistischen Poesie im Lichte der Problematik der pragmatis the n Sprachverwen- dung, und das erkenntnistheoretische Misstrauen der linguistischen Poesie wird bei Barariczak zu einem axiologischen, wertbezogenen Misstrau- en. Auf diese Weise ist fiir Baranczak in der sprach- lichen Kommunikation die Rolle des Sen-ders als Dispo- nenten der Bedeutungen und die Rolle des Empfsngers als Objekt sprachlicher Persuasio wichtiger als die systemischen Eigenschaften der Rede.
Standard- und Nichtstandard-Rede
Nach landlzufiger Anschauung sol1 Barariczaks Lyrik auf der Demaskierung der Zeitungssprache beruhen, weil im System der Massenkommunikation die Zeitung eben der Informationskanal ist, in welchem die sprachliche Ma-
Barariczaks dargesteLLte Sprache 135
nipulation des Empfsngers am weitesten getrieben wird. Barariczak ist an dieser Anschauung selbst nicht ganz unbeteiligt gewesen. Die Sprachproblematik in den Ge- dichten Barariczaks hat meiner Meinung nach noch einen weiteren Umfang. In seiner Poesie kann man namlich mindestens vier Gruppen verschieciener gedichtbilden- der Ausdriicke unterscheiden, die zur Achse der syntak- tisch-semantischen Konstruktion einzelner Werke werden kijnnen. Die erste Gruppe sind die phraseologischen Ausdriicke der Propagandasprache, also"eine be- stinunte Epoche", "Krsnze und Blumengebinde niederlegen", "die richtigen Schlussfolgerungen aus den Ereignissen ziehen", "zeitweilige Begrenzungen" oder "kollektiver Enthusiasmus".
Die zweite Gruppe der gedichtbildenden Ausdrticke sind Phraseologismen der Amts sprache, die mitden Institutionen des Effentlichen Lebens verbunden sind und zu denen man Formulierungen zahlen kann wie "leser- lich ausfiillen", oder "Nichtzutreffendes streichen", die fiir verschiedene Fragebagen typisch sind, schliess- lich der Ausdruck "aus anderen wichtigen gesellschaft- lichen Griinden", der typisch fcr die amtliche Behand- lung dieser Fragebijgen ist, und such Ausdriicke aus dem technischen und kommerziellen Gebiet: "hat normalisier- tes Ausmass", "Dorsch zweiter Frische", oder aus dem Bereich des Wohnungsmieters: "Mzngel beseitigen", "Ei- gentumswohnung", "eine Anzahlung machen" usw.
Die dritte Gruppe sind Phraseologismen der All- t ag s s pr ache, und eben sie, und nicht die beiden ersten, ist in Barariczaks Gedichten am meisten vertre- ten. Einige Beispiele: "Gesichtsausdruck", "blutunter- laufene Augen", "in einem Atemzug", "mit ganzem Herzen auf seiten", "auf eine Karte setzen", "ich h;itte nie ge- ahnt", "was sind heute fiir Waren gekommen", "das kann ma-n nicht am Telefon besprechen", "Sie dr;ingeln sich vor" usw.
Die vierte Gruppe gedichtbildender Ausdriicke sind schliesslich einzelne Wijrter, die nicht in phraseolc- gischen Verbindungen stehen und nur deutlich markiert sind, weil sie Exponenten wiedererkennbarer gesell- schaftlicher Kontexte sind. Ich meine hier Wijrter wie "wohnen", "Rednertribiine", "Plakat", "nein", "Proto- koll", oder "Weihnachtslied".
Derartige stereotype Ausdriicke werden nun zu Ele- menten der syntaktischen Entwicklung des Gedichts und zur Quelle sukzessiver semantischer Umformungen. Auf- gabe des Gedichts ist gleichsam, die sprachlichen Ste- reotypen in ihre Nicht-Standardelemente zu zerlegen. Barariczaks Gedichte beginnen also meistens mit ready- mades aus Soziolekten. Diese sind anschliessend kom-
136 WLodzimierz Bolecki
plizierten syntaktischen wortbildungsmZssigen und se- mantischen Umformungen unterzogen. Dabei sind die se- mantischen Umformungen, und nicht die phraseologische Montage, die Haupttechnik der Entwicklung der lyri- schen Ausserung. (Nota bene ist das einzige Werk, das die Montagetechnik verwendet, das zitierte Gedicht "Plakat".) Die lyrische Kunst beruht hier darauf, eine enge wechselseitige Abhsngigkeit zwischen der Entfal- tung der syntaktischen Ordnung (Verwendung einiger permanenter rhetorischer Figuren) und den semantischen Transformationen herbeizufiihren. Die Verbindungen zwi- schen Phetorik und Semantik sind hier so intensiv, dass sie den rhythmischen Bau der Gedichte entschieden in den Hintergrund dr;ingen. Nur das Enjambement (das aber zur Syntax und nicht zum Metrum gehijrt) wird deut- lich in die Poetik des einzelnen Gedichts einbezogen.
Die hauptszchliche rhetorische Figur bei der Ent- wicklung der Gedichte Barariczaks ist das Prinzip der amplificatio, das heisst der Erweiterung, de: Ergznzung und der Umformung des Anfangsthemas der Aus- serung. Der am Anfang des Gedichts stehende Phraseolo- gismus wird im Zuge der Entfaltung des Gedichts wie- derholt, wird zum Element lexikalischer Anhsufungen, Paraphrasen, Periphrasen und Vergleiche, und wird zu- gleich stzndig in das Spiel der Homonymien und Synony- mien einbezogen. Als Beispiel dafiir kann das Titelge- dicht aus dem Gedichtband In einem Atemzug dienen:
Jednym tchem, jednym nawiasemtchu zamykajacym zdanie, jednym nawiasem ieber wok61: serca zamykajacym sia jak pie86, jak niewod wokoko waskich ryb wydechu, jednym tchem zamknadwszystko izamlcn& sic we wszystkim, jednym wiotkim wiorem plomienia zestruganych z pluc osmalid Bciany wiezieri i wciagnad ich poiar za kostne kraty klatki piersiowej i w wieie tchawicy, jednym tchem, nim sic udkawisz kneblem powietrza zgestnialego od ostatniego oddechu rozstrzelanych cial i tchnienia luf goracych i obkokow z dymiacej jeszcze na betonie krwi, <...>
[In einem Atemzug, mit einer Verbindung, die den Satz schliesst 1 mit einer Verbindung der Rippen um das Herz die sich schliesst wie eine Faust, wie das Zugnetz 1 um die schmalen Fische des Ausatmens, in einem Atemzug 1 alles einschliessen und sich in allem einschliessen, mit einem 1 schm&chtiqen Flammenspan, von den Lungen ge- hobelt 1 die GefZngniswZnde versengen und ihren Brand einziehen 1 hinter die Knochengitter des Brustkorbs und
Baraviczaks dargestellte Sprache 137
in den Turm 1 der Luftrbhre, in einem Atemzug, eh du er- stickst 1 am Knebel der Luft die verdickt ist vom 1 letz- ten Atem der erschossenen K&per 1 und dem Hauch der heissen Gewehrlaufe und der Wolken 1 aus dem noch aufdem Beton dampfenden Blut, <...> ] ("In einem Atemzug")
Bei diesem Gedicht liegt die Erinnerung an die Syntax von Peipers "Aufbliihendem Poemll nahe. Alle hier ver- wendeten rhetorischen Figuren dienen in solchen Ge- dichtzeilen einer Transformation von Standardausdriic- ken in nichtstandardisierte, zum Beispiel metaphori- sierte Rede.
Neben der Poetik der Amplificatio, die sich auf se- mantische Transformationen stiitzt, kann man in Barari- czaks Gedichten eine Amplificatio unterscheiden, die auf dem Katalogisieren beruht; Wijrter kijnnen hier einfach aufgez;ihlt werden, Formulierungen hinzu- gefiigt beziehungsweise die Kompatibilitzt zwischen den einzelnen Formulierungen erweitert werden. Hierzu ein Auszug aus dem Gedicht "Schlafende":
Spijcie. Jeszcze chwila, wzniesiecie senne glowy, swoje ciezkie gkowy wzniesiecie wszyscy, ktorzy za dnia sic trudzicie wznoszeniem blagari, wiwatbw, sztandarhw, modI6w, toast6w za zdrowie, choralnych okrzykow, rak do nieba, dziekczyniefi, wznoszeniem zaialeti, naleinoici, wniosk6w, spraw do sadu, interpelacji, wkIad6w na ksiaieczke oszczednoSciowa, akt6w oskarienia, sprzeciwow, oplat, poprawek; znoszeniem
. ,. przeclwnosc1, przepisbw, nowin, upokorzefi, krzywd. Spijcie. spijcie. <...>
(“Spiqcy", Dziennik poranny)
[Schlaft. Noch ein Augenblick, 1 und ihr erhebt die schlafrigen KBpfe, eure schweren Kijpfe 1 erhebt ihr al- le die ihr tags euch mi.iht 1 mit dem Erheben von fle- hentlichen Bitten, Vivatrufen, Standarten, 1 Gebeten, Toasts zum Wohle, chorischen 1 Schreien, der Hdnde gen Himmel, Dankbezeugungen; durch das Einbringen I von Klagen, Beitragen, Antrdgen, Gerichtsprozessen, ( In- terpellationen, Betrdgen auf das Spar- 1 biichlein, An- klageerhebungen, 1 Einspriichen, Bezahlungen, Korrektu- ren; 1 durch das Ertragen 1 von Widrigkeiten, Vorschrif- ten, Nachrichten, Dembtigungen, 1 Unrecht. Schlaft. Schlaft. <...>I
("Schlafende", Morgenzeitung)
138 Wtodzimierz Bo Zecki
Diese beiden verschiedenen Typen der Amplificatio stereotyper sprachlicher Ausdriicke determinieren zwei polar unterschiedene rhetorische Strategien in Barari- czaks Poesie. Die erste Strategie beruht auf einer In- tensivierung der Rhetorik der Vieldeutigkeit, wobei die Wijrter St&dig in immer neue bedeutungsmZssige Kontexte einbezogen werden und schliesslich der Leser mit unerwarteten, kalauerhaften und metaphorischen Wortzusammenstellungen verbliifft wird.
Die zweite Strategie behandelt die Wijrter als De- terminanten gesellschaftlicher Situationen. Ihre Rhe- torik beruht nicht auf einer Multiplizierung der Be- deutungen, sondern auf ihrer Stabilisierung. Es han- delt sich dabei urn eine Rhetorik der Identifikation verschiedener Ph;inomene mit einer einzigen Grundbedeu- tuw , die unvergndert bleibt trotz vergnderlicher Si- tuationen, WiSrter oder Kontexte. Wenn die Rhetorik der Vieldeutigkeit mit einer Demaskierung verborgener Be- deutungen von Wijrtern und ihrer Verwendungen verbunden ist, so ist die Rhetorik der Identifikation darauf an- gelegt , scheinbar verschiedenartige gesellschaftliche Verhaltensweisen als Varianten einer einzigen Grund- situation aufzudecken - die Situation der gesellschaft- lichen Unterdrcckung.
Der dritte Typ sprachlicher Transformationen ist mit einzelnen Wijrtern verbunden, die nicht zu phraseo- logischen Ausdriicken gehijren. Bier verwendet Barariczak am liebsten die Technik der Paronomasie, also die Ver- bindung und Entfaltung verschiedener semantischer oder lautlicher Motive. Bin Beispiel hierfiir ist das Ge- dicht "Tkum" (Die Menge), die "tl'umi" ("drsngt") und "t3:umaczy" (iibersetzt), oder das Gedicht "Schnee" II aus dem Zyklus "Wintertagebuch":
Bezczelnie bezcielesny, bezczeszczaco czysty, brukajacy swa biela krochmalona bruk najbardziej wyboisty i najbardziej szary; kryjacy kaidq sprawke, kaidg prawde, brud i brak kaidy, dr6g bruzdy i brunatnobd grud pod pkachta gladka, sprang i sterylna; <...>
(18 12 79, "%aieg" II)
[Schamlos kdrperlos, ehrlos rein, 1 pflastert er durch sein gestdrktes Weiss noch das holperigste und grau- ste Pflaster; 1 deckt jede AffZre, jede Wahrheit, jeden 1 Schmutz und Mangel, die Furchen der Wege und das
Braun der Erdschollen 1 unter glatter, gewaschener und steriler Decke zu; <...> ]
(18.12.79, "Schnee" II)
Barariczaks dargestellte Sprache 139
An diesem Punkt der Argumentation miissen nun wich- tige Differenzierungen nachgetragen werden. Alle Grup- pen von gedichtbildenden Ausdriicken iiben nsmlich in den Gedichten Barariczaks zwei extrem unterschiedliche stilistische Funktionen aus - die Funktion der frem- den Rede sowie die Funktion der eigenen Rede.
Weil die Opposition fremde Rede -eigene Rede an die entsprechende begriffliche Opposition von Volosinov und Bachtin anklingt, ist hier eine Differenzierung erforderlich. In der russischen stilistischen Tradi- tion bewahrt das "fremde Wart" die individuellen Merk- male lebendiger, meist miindlicher Rede eines jeden der Ausserungssubjekte. In dieser Tradition ist also die "fremde Rede" der Figuren von einer stilistischen und axiologischen Integration des Autors gleichsam frei. Wenn hier in bezug auf Barariczak von fremde r Re- de gesprochen wird, dann sind Formulierungen gemeint, denen gegeniiber das Subjekt der Ausserung, der Autor, seinen Unwillen, sein Gefiihl des Andersseins oder der negativ wertenden Distanz zum Ausdruck bringt. Mit einem Wort: der Autor unterstreicht die UnmGglichkeit, sich mit einem solchen Typ von Sprache zu identifizie- ren.
In Barariczaks Gedichten treten in der Funktion fremder Rede immer propaganda- oder amtssprachliche Phraseologismen auf, w;ihrend Ausdriicke, die zur All- tagssprache gehijren, und sonstige einzelne Wijrter die Funktion der eigenen Rede des lyrischen Subjekts aus- iiben kijnnen. Ich schreibe hier "kijnnen", weil die phraseologischen Ausdriicke der Alltagssprache in Ba- rariczaks Gedichten keine permanente Funktion haben: in seinen ersten Gedichtbsnden (z.B. Gesichtskorrek- tur oder Morgenzeitung) ist die Alltagssprache eindeu- tig in die eigene Rede des Autors integriert, dagegen tritt sie in den Gedichten des Bandes Ich Weiss, dass das nicht richtig ist such in der Funktion fremder Rede auf.
Phraseologismen in der Funktion fremder Rede
Phraseologische Ausdriicke in der Funktion fremder Rede treten in iiber zwanzig Gedichten von Barariczak auf, und etwa ein Drittel davon gehijrt zum Zyklus "Richtige Schlussfolgerungen" aus dem Band Morgenzei- tuw , und zwei Drittel zum Zyklus "Bestimmte Epoche" aus dem Band Ich weiss, dass das nicht richtig ist. Zu diesen Ausdriicken gehijren sowohl Phraseologismen der Propagandasprache als such der Amtssprache. Jeder dieser Ausserungstypen ist einer jeweils anderen Transformationstechnik unterzogen, obwohl alle einer
140 Wtodzimierz BoZecki
hauptszchlichen Funktion dienen, das heisst der Blosslegung der fremden Rede.
Der erste Typ einer Blosslegung fremder Rede beruht auf der Homonymisierung synonymer Ausdriicke. Beispiel hierfiir ist das Gedicht "Sic haben Kr;inze und Blumen- gebinde niedergelegt", das wie folgt beginnt:
ZXoiyli wierice i wiazanki kwiatow; ci z choroba wiericowa, z wapnem w iylach tym, ktorzy w wapienne doky twarza w do1 padali ze zwiazanymi z tytu bukietami rgk; < > . . . ("Zkoiyli wience i wiazanki kwiatow")
[Sic haben KrZnze 1 und Blumengebinde niedergelegt; 1 die mit den Herzkranzgefgssen, mit dem Kalk in den Adern de- nen, 1 die in die Kalkgruben mit dem Gesicht in die Grube gefahren sind 1 mit den hinten gebundenen BlumenstrZussen der H&de; <...> ]
("Sic haben KrZnze und Blumengebinde niedergelegt")
In diesem Gedicht werden synonyme Ausdriicke (Krznze, Gebinde, gebundene Blumen, Blumenstrzusse usw.) in be- deutungsm%sig so andere Kontexte integriert, dass sie beginnen, die Funktion von Homonymen auszuiiben. Syno- nyme Ausdriicke, die zu gemeinsamen Bedeutungsfeldern gehijren und gemeinsame Wortfamilien bilden, nehmen hier die Bedeutungen von entlegenen, widerspriichlichen und einander sogar ausschliessenden Gegenstgndlichkei- ten an. Die kardiologische "Erkrankung der Herzkranz- gefzsse" ist gleichzeitig die Krankheit der "Kranznie- derlegung", "Kranz" bedeutet soviel wie "Blumengebin- de", aber such "die hinten gebundenen H&de"; "der Kalk in den Adern" bezeichnet das Alter derer, die die offiziellen Blumengebinde niederlegen, aber zugleich sind die "Kalkgruben" Synonym eines Massengrabes; "die Waffe der Blumengebinde und Krsnze niederlegen" heisst soviel, wie Blumen auf die Grabplatte legen, aber zu- gleich such sich ergeben, kapitulieren. Zur Funktion der sukzessiven syntaktischen Transformationen in die- sem Gedicht wird also der Zerfall der anfgnglichen se- mantischen Gemeinsamkeit der Wijrter und Wendungen. Diese Gemeinsamkeit wird hinf;illig gemacht, weil die Semantik der einzelnen Verwendungen, in denen die Ti- telphraseologismen spster im Gedicht vorkommen, sie in widerspriichliche Kontexte integriert. Die lexikalischen Beriihrungspunkte synonymer Wijrter, Ausgangspunkte von Baraliczaks Gedicht, werden gezeigt als s cheinbare und falsche Synonymie. Die einzelnen W6rter
Baraviczaks dargestellte Sprache 141
verlieren ihre bedeutungsmzssige xhnlichkeit und be- wahren nur noch ihre lautliche xhnlichkeit. Zugleich wird der eindeutige Charakter des am Anfang stehenden Stereotyps zum kommunikativen Kryptonym: das Stereotyp verbirgt n;imlich die Vielheit der widerspriichlichen und einander wechselseitig ausschliessenden Bedeutun- gen. Grundfunktion dieses Typs von Transformationen ist es, zu zeigen, dass die Stereotypen der Propagan- dasprache das Bewusstsein des Empfsngers manipulieren. Sie oktroyieren n;imlich dem Empfznger der sprachlichen Kommunikate eine Sicht der Welt als eines Rituals, einer Zeremonie, in der es keinen Ort fiir einen Kon- flikt der Einstellungen und Werte gibt. Darum beruht such die Rhetorik des Gedichts darauf, dass es mit der allerschematischsten Information beginnt, mit einem Zitat aus der Sprache der Massenmedien ("Sic legten die Kr;inze und Blumengebinde nieder"). Erst infolge des n;ichsten poetischen Verfahrens wird das am Anfang stehende Zitat gebrochen, werden die semantischen und wertbezogenen Spriinge gezeigt, die innerhalb der sprachlichen Banalitst die Dramaturgie der gesell- schaftlichen und historischen Welt zum Vorschein brin- gen. Diese poetische Strategie demaskiert die Sprache der Propaganda, eine Sprache, die eine homogenisierte, vereinfachte und verfslschte Wirklichkeit schafft. Und zugleich demaskiert sie sie als ein Konstrukt, welches der gesellschaftlichen Erfahrung des denkenden Subjekts fremd ist.
Die zweite Methode, die Fremdheit der Phraseologis- men der Propagandasprache zu zeigen, beruht auf der Kontamination eines Ausdrucks mit einem von ihm weit entfernten stilistischen Kontext, das heisst auf einer Kreuzung von einander ausschliessenden Bedeutungsfel- dern, welche den im Gedicht dargestellten Phraseolo- gismus degradieren. Zum Beispiel wird der Ausdruck "In einer Atmosph;ire des/der" in Kontexte gebracht wie "In einer AtmosphBre des Gezwitschers", "In einer Atmo- sphare der Aufrichtigkeit des Bellens", "In einer At- mosph%e des Wedelns mit der Zunge", "In einer Atmo- sph;ire der Abdichtung und des Zusammenwachsens von Hirnen und Miindern" etc.
Die Technik der Kontamination von einander aus- schliessenden Bedeutungsfeldern hat noch zwei weitere Varianten. Eine davon ist die Konfrontation dargestell- ter phraseologischer Ausdriicke mit dem Kommentar des Sprechersubjekts im Gedicht. Als Beispiele kijnnen hier Gedichte angefiihrt werden wie "Kollektiver Enthusias- mus", "Humanistische Bedingungen" oder "Die sprich- wijrtliche Baumwolle" aus dem Band Ich Weiss, dass das nicht richtig ist. Hier der Beginn von "Die sprich- wijrtliche Baumwolle":
142 W,Zodzimierz BoZecki
Przyslowiowa bawekna, ktora w my.61 wczesniejszych zakoiefi miaka sluiyC - powiedzmy sobie szczerze, bez owijania w nia - gkownie do tego, aby w nia niczego nie owijaC,
w chwili obecnej naleiy do tekstyliow szczegolnie modnych i
< > poszukiwanych, . . . ("PrzysI.owiowa bawetna")
(der Text operiert mit dem Idiom "owija6 co6 w bawelne" - w6rtl. "etwas in Baumwolle hiillen", sinngemsss "etwas [eine unangenehme Wahrheit] verhiillen, bembnteln; "mit etwas hinter dem Berg halten" - d.6.)
[Die sprichwdrtliche Baumwolle, die 1 im Sinne friiherer Annahmen 1 dienen sollte - sagen wir es offen, ohne es in sie einzuhiillen - haupts%hlich 1 zu dem Zweck, urn in sie 1 nichts 1 einzuhtillen, 11 gegenw?irtig 1 gehdrt sie zu den besonders modischen und nachgefragten Textilien, < . . . >I ("Die sprichwdrtliche BaumwolleU)
Der Phraseologismus "In Baumwolle hiillen" und die die- sen Phraseologismus kommentierende Rede bilden hier zwei polar unterschiedliche Typen sprachlicher Praxis, wobei der kommentierte Phraseologismus immer als ein Ausdruck in Anfiihrungszeichen auftritt. Das Gedicht wird hier zu einer Aussage iiber einen Ausdruck, der gewissermassen in kommunikativen Anfiihrungszeichen steht. Wenn die zuerst genannte Methode, die Fremdheit der Sprache zu zeigen, die Einzelbedeutungen des be- treffenden Phraseologismus vervielfsltigten und sich verselbstgndigen liessen, so zielt die zweite Methode darauf ab, die funktionale Eindeutigkeit des darge- stellten &sserungsstereotyps zu verstsrken. Der Aus- tausch der Kontexte, in denen ein solcher Phraseolo- gismus untergebracht ist, multipliziert n;imlich nicht die Bedeutung des Wortes, sondern stabilisiert den stereotypen Charakter seiner Semantik.
Bier nun signalisiert das lyrische Subjekt von An- fang an seine Distanz gegenijber der Propagandasprache. Das Wort "sprichwbrtlich" iibt uniibersehbar eine deik- tische Funktion aus - es zeigt, dass das sprachliche Stereotyp ein starres Produkt der Massenkommunikation ist. Das Stereotyp wird nicht mehr weiter transfor- miert, und das lyrische Subjekt stellt ihn die eige- ne Rede gegeniiber als eine Verteidigung gegen die Ba-
Baraficzaks dargestellte Sprache 143
nalitBt, gegen das Schema und gegen das Propaganda- stereotyp. Indem der spezifische Charakter der eigenen Rede des lyrischen Subjekts aktualisiert wird (Ironie, Spass, Groteske, Kalauer), werden zugleich die sprach- lichen Fabrikate der Massenkommunikation (Propaganda, Ideologie, Doktrin) verworfen.
Die dritte Variante der Technik einer Kontaminie- rung widersprcchlicher Kontexte konfrontiert die amt- lithe und offizielle Rede mit dem privaten Charakter der Ereignisse im individuellen Leben eines jeden Men- schen. Diese Variante l;isst sich am deutlichsten in Gedichten zeigen wie "Protokoll" oder "Leserlich aus- fiillen" aus dem Band Morgenzeitung. Hier ein Auszug aus "Leserlich ausftillen":
Urodzony? (tak, nie; niepotrzebne skregli6); dlaczego "tak"? (uzasadnid); gdzie, kiedy, po co, dla kogo iyje? z kim sic styka powierzchnia m6zgu, z kim jest zbieiny czestotliwo6cia pulsu? krewni za granica sk6ry? (tak, nie) dlaczego "nie"? (uzasadnid); < . . . >
[Gebcren? (ja, nein; Nichtzutreffendes 1 streichen); warum "ja"? (begrdnden); wo, / wann, wozu, fiir wen lebt er/sie? mit wem beriihrt er/sie sich 1 an der Oberfldche des Gehirns, mit wem stimmt er/sie fiberein in der Puls- frequenz? Verwandte jenseits der Grenzen / der Haut? (ja, nein) warum I "nein"? (begrtinden); <...> 1
Dieser Typ von Kontaminierung demonstriert nicht nur die wechselseitige Fremdheit der beiden Ausserungsord- nungen, des Soziolekts und des Idiolekts, der Amts- sprache und der individuellen Sprache, er zeigt such, wie die Privatsphzre des Menschen und ihre amtlichen Kategorisierungen einander ausschliessen. Fiir eine Be- schreibung der privaten Biographie verwendet, erweist sich die Amtssprache als fremd, als leere Rede und als usurpatorische, ausspionierende Sprache, welche die Grenzen ihres vorgegebenen Anwendungsbereichs St&dig verletzt. An dieser Fremdheit zeigt Barariczak, wie die Autonomie des Individuums durch eine repressive Spra- the umzingelt und bedroht wird. Die poetische Technik dient hier nicht nur dazu, die Fremdheit der Amtsspra- the zu zeigen - man kijnnte sie lingua invigilationis nennen. Sie ist such eine Verteidigung der uniiber- schreitbaren Grenzen menschlicher Privatheit.
Schliesslich gibt es noch einen weiteren Typ der Blosslegung des Fremdcharakters von in Baraliczaks Ge-
144 WLodzimierz Bolecki
dichten dargestellten sprachlichen Ausdrticken. Hier wird die eigene Sprache eines fremden Subjekts portrz- tiert, und man kann sie in Gedichten finden wie "Wir haben die richtigen Schlussfolgerungen aus den Ereig- nissen gezogen", "Wir lassen dich nicht verkommen", "Schreibt uns, was ihr davon denkt" oder "Bestimmte Epoche". Bei dieser Technik der Darstellung von Spra- the signalisiert das "wir" im Titel des Werks charak- teristischerweise immer fremde Rede. Dieser Exponent des Plurals verweist nicht so sehr auf irgendein orga- nisiertes Kollektiv oder ein kollektives Subjekt der Xusserung, als vielmehr auf den apersonalen Charakter des betreffenden Ausdrucks, darauf, dass er gerade nicht mit einem konkreten Individuum, mit einem perso- nalen Subjekt sprachlicher Kusserung verbunden ist. Das "wir" in den Gedichttiteln Barariczaks ist mithin zugleich ein E.xponent fiir die Fremdheit des angefiihr- ten phraseologischen Ausdrucks, sowie such ein Signal fiir Opposition gegeniiber dem "Sprecher-Ich" - gegen- iiber der eigenen Rede des Subjekts.
Sprachliche Portrgtierungen von Sprechweisen gehij- ren zu den schlagendsten Beispielen dafiir, wie bei Ba- rariczak die Sprache als dargestellter Gegenstand be- handelt wird. Thema solcher Gedichte ist n;imlich nicht der Inhalt einer gusserung oder eine Beschreibung der sprechenden Person, sondern Komplexe von Ausdrticken, Redeweisen oder Formulierungen, die fiir einen bestimm- ten Soziolekt typisch sind. Das Sprechersubjekt ist hier eine Leerstelle, ist lediglich ein granunatikali- scher Exponent der einzelnen Sstze. Dagegen werden zum Inhalt einer solchen xusserung Serien von Idiomen, die situationsm%sig und stilistisch markiert sind. So wird der Ausdruck "eine bestimmte Epoche" durch funk- tionale Pleonasmen ersetzt wie "in der Epoche der An- strengungen zu Ehren" oder "in der Epoche anwachsender und sich versch&fender". Die Darstellung der Sprache beruht ja darauf, dass zum Inhalt des Gedichts Frag- mente einer Rede werden, die von gegenstsndlichen Be- ziigen zur Wirklichkeit freigesetzt sind - es sind ge- wissermassen nur unausgeftillte Ausserungsrahmen. Zu- gleich treten die innertextlichen Bedeutungen dieser Ausserung ausschliesslich aus der sprachlichen Materie der einzelnen Wijrter hervor, Zum Beispiel sagt der Held des Gedichts "Eine bestimmte Epoche": "Ich werde ein Ausdriicker sein, indem ich zum Schluss die ijber- zeugung ausdriicke". Die Pointe des Gedichts beruht hier nicht nur auf dem pleonastischen Bau des Satzes, son- dern ebenso auf der verborgenen Definition, wonach es ausreicht, irgendetwas "auszudriicken" oder irgendetwas zu sagen, urn "Ausdriicker zu sein". Dadurch verliert
Baravicsaks dargestellte Sprache 145
such das Reprssentant sein, das "eine aUSerw~h~te, ein bestimmtes Kollektiv reprssentierende, mit einem kol- lektiven Vertrauensmandat ausgestattete PerSOn Sein" seinen Sinn. Der gegenstzndliche, inhaltliche Sinn des Sprechens erweist sich so als reine Sprachtstigkeit. Die Wortbedeutungen sind nsmlich nicht durch eine ge- sellschaftliche Kommunikationspraxis definiert, son- dern durch die Willkiir der Verwendung von WiJrtern. Die Verwendung fertiger Redestereotypen ersetzt so die Re- geln gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die fremde Re- de eliminiert nicht nur die aussersprachlichen gegen- stsndlichen Verweise, sondern sie eliminiert such das Subjekt als Adressaten, der die Wort- und xusserungs- bedeutungen verifizieren ki3nnte. Die Formulierung "ich werde ein Ausdriicker sein, indem ich die Uberzeugung ausdriicke" bedeutet doch, dass "ich durch die Sprache ernannt bin, derer ich mich bediene". Die Rede wird in diesem Fall zur Wirklichkeit an sich, zu einem Rede- Strom, der durch keinerlei Beziige auf einen gesell- schaftlichen Usus, auf Gesellschaftsvertrzge oder auf eine gesellschaftliche Kommunikation beschrznkt ist. Gesellschaftliche Kommunikation wird am Schluss zu einer Serie einzelner Sprechakte. Es gibt hier keinen Inhalt, es gibt nur Modalitzt und den fiir diesen So- ziolekt typischen Ritualcharakter.
Ein Zhnliches Beispiel aus demselben Gedicht ist die folgende Argumentation: "Ich mijchte hier unterstrei- then (... ), dass auf dieser Basis Perspektiven vorge- zeichnet und vorgestrichen werden, und Meinungen aus- gestrichen werden, die nicht geniigend unterstreichen, sowie durchgestrichen werden (...> die Rechnungen de- rer, die". Die Pointe dieser ganzen Phrase beruht auf der Homonymie der W6rter, die das semantische Feld des Wortes "streichen" bildet. Die Sache ist aber die, dass die Bedeutungen der einzelnen dargestellten Wbrter gleichsam logische Folgerungen sind, die aus der Se- mantik der Ausserung hervorgehen - die Tstigkeit des "Streichens", "Ausstreichens", "Durchstreichens" oder "Vorstreichens/Vorzeichnens" sind eine unmittelbare Folge der Erklzrung "ich wiirde hier unterstreichen". Baraiiczaks Gedicht stellt uns diese Logik als eine De- terminante der fremden Rede dar - eine Rede, die so- wohl der Wirklichkeit als such der Sprache, als such schliesslich den personalen Determinanten gesellschaft- lither Kommunikation entfremdet ist. Die Fremdheit der Rede beruht hier auf ihrer Usurpation, auf der Verge- waltigung des gesellschaftlichen Charakters der Ver- stsndigung. Gesellschaftlicher Charakter heisst hier soviel wie das Respektieren von Regeln, die fGr alle verbindlich w8ren.
146 WLodzimierz Bolecki
Phraseologische Ausdriicke als eigene Rede
Nach landlsufiger Anschauung ist die Darstellung fremder Rede in Baradczaks Gedichten ein typisches Merkmal seiner Poesie. Dies passt such zu der beriihm- ten Formel von dem "Misstrauen" gegeniiber der Sprache, eine Formel, die infolge des Buches Die Misstrauischen und die Vertrauensseligen zum Erkennungsmerkmal eines ganzen thematischen Blocks in der Poesie der "Genera- tion 68" geworden ist. Jedoch treten die Stereotypen phraseologischer Ausdriicke in Barariczaks Gedichten such als Komponenten eigene r Rede auf und iiben dabei eine ganz andere Funktion aus, als ich sie bis- her dargestellt habe.
Quelle der eigenen Rede in den Gedichten Barariczaks sind ngmlich ebenfalls stereotype Ausdriicke der Um- gangssprache, wie sie am zahlreichsten in Gesichts- korrektur, in dem Band In einem Atemzug sowie in dem Zyklus "Kaufkrsftige Gedichte" vertreten sind. Zum Beispiel ist das Gedicht "Ich habe mir zu Herzen ge- nommen" auf der Verwendung der folgenden Serie phra- seologischer Ausdriicke aus der Umgangssprache aufge- baut: "Sich zu Herzen nehmen", "betroffen sein", "sich einh%mern", "auswendig lernen", "sich zusammennehmen", "jemandem auf die Finger schauen", "Sackgasse", "auf frischer Tat ertappen", "Atem schdpfen", "auf sich neh- men", "aus den Augen schauen" usw. Hier ein Auszug aus diesem Gedicht:
Wzialem sobie do serca te pied litrow krwi, ktora ucieka z niego jakby chciaka przebid sic przez cienkie tynki skory, lecz wraca wciai tym samym torem ze Qlepego zaulka serdecznego palca; przej&em sig na w?asnoik ta krwiq, co chce zbiec, odkad z'iapakem pierwszy oddech na goracym uczynku kradzieiy ze gwiata i na probie ucieczki; musiakem wziaE na siebie kruche mury ciala.
Wbilem sobie do glowy te pied zmyslow, ktore rysuja wewnqtrz czaszki sucha igla dymem do dolu zawieszony poiar, wziety w dwa ognie oczu portret wyryty na goraco na mozgowej korze; wykuwatem na pamied to zbielale ostrze, odkad mi zaprzatnely glowc
Barariczaks dargestellte Sprache 147
odwrocone plomienie, co patrza mi z oczu na walace sia krokwie musiakem wziad na siebie blask, swad, iar i huk, < > . . . ("Wzi&em sobie do serca")
[Ich habe mir zu Herzen genommen die fiinf Liter Blut, 1 das aus ihm rinnt als wollte es sich durch den Putz der Haut durchschlagen 1 doch kehrtes 1 immer auf demsel- ben Geleise 1 zuriick aus der Sackgasse des Ringfingers;I ich war auf mein Eigentum betroffen von diesem Blut, das rinnen will, 1 seit ich den ersten Atem geschijpft habe 1 auf der frischen Tat 1 des Diebstahls 1 aus der Welt / und auf dem Fluchtversuch; 1 ich musste auf mich nehmen die hinfalligen Mauern des Kijrpers. Ii Ich habe mir in den Kopf gehdmmert die fiinf Sinne, die 1 mitten im SchZdel zeichnen 1 mit trockener Nadel den durch Rauch abwgrts aufgehobenen Brand, das von zwei Augen unter Feuer genommene PortrZt I das frisch auf die Hirnhaut geritzt ist; 1 ich habe auswendig gelernt diese weissgewordene Messerschgrfe, 1 seitmir den Kopf berlommen haben I die abgewandten Flammen, 1 wie sie mir I aus den Augen schauen / auf die niederstiirzenden Dach- sparren I ich musste auf mich nehmen den Feuerschein, den Rauch, den Brand und das Get&e, <:.,>I
("Ich habe mir zu Herzen genommen")
ihnlich, wie in den Beispielen mit Propagandaspra- the, sind Ausgangspunkt des lyrischen Spiels in dieser Art von Gedichten Standardausdrccke, die in den gesell- schaftlichen Sprachverwendungen lkgst eingebiirgert und stabilisiert sind. Ihr stereotyper Charakter hin- dert sie jedoch nicht daran, die Funktionen der eige- nen Rede des Sprechersubjekts auszuiiben und Komponen- ten des lyrischen Monologs zu sein, wie er in der Poe- tik des Be ke nntn i s se s organisiert ist. Baran- czak stellt hier die gesellschaftliche, alltsgliche, h;iufig banalisierte und beinahe jargonhafte Rede unter die private, persbnliche Perspektive des Sprecher-Ichs im Gedicht. Auf diese Weise tritt eine Verkderung im Charakter des sprachlichen Stereotyps ein; es erfiillt nun die Funktion einer individuellen, unwiederholbaren, feierlichen, emotions- und pathosgeszttigten Rede. Der phraseologische Ausdruck der Alltagssprache wird gleichsam aufgewertet, erh;ilt eine Modalitzt, die er zuvor nicht hatte. Hinter jedem dieser Ausdriicke ver- birgt sich nzmlich im Gedicht ein modaler Rahmen vom TYP "so fiihle, so denke, so rede ich wirklich". Auf
148 WCodzimierz BoZecki
diese Weise wird der konventionelle Charakter anonymer Phraseologismen der Umgangssprache durch die Modalitzt vertraulichen Bekenntnisses oder der Wut der Person, die im Gedicht spricht, iiberwunden. Wir haben es hier mit einem Ph;inomen zu tun, dass ich am liebsten den linguistischen Expressionismus inder Poesie der "Generation 68" nennen mbchte. Hierzu geh8- ren gleichrangig: eine ich-bezogene Einstellung, die auf einer deutlichen Gegeniiberstellung des lyrischen Subjekts und der Welt besteht, sowie eine moralistische Einstellung, die auf einer deutlichen ethischen Wer- tung der Elemente dieser dargestellten Welt im Werk be- ruht. Dass diese Einstellungen zur poetischen Tradition gehijren (Mizosz, Herbert) kann hier nicht nsher ausge- fiihrt werden.
Ohne Zweifel war der "linguistische Expressionismus" ein charakteristisches Element der friihesten Epoche Baraficzaks, vgl. die Gedichtbsnde Gesichtskorrektur und In einem Atemzug. Der rein poetische Mechanismus des Aufbaus dieser Art von Gedichten beruhte darauf, Serien von Metaphern zu schafien, die sich auf gel;iufi- ge phraseologische Ausdriicke zuriickf=hren liessen. Hier- her gehijren Metaphern wie "den Brief des Leibes ijff- nen", "den Briefumschlag der Haut aufschneiden", "die Sackgasse des Ringfingers", deren metaphorisierende Komponenten gewijhnlich aus einem einzigen semantischen Feld stammen, also z.B. aus dem semantischen Feld des Wortes "Kbrper/Leib". (Dies gilt iibrigens fiir die Poe- sie aller Vertreter der "Generation 68".) Die Spezifik dieser Art von Konstruktion beruht darauf, dass sowohl das metaphorisierte Element (das heisst der Phraseolo- gismus) als such die Quelle der Metapher partnerschaft- lich funktionieren. Auf diese Weise entstehen Meta- phern, deren beide verbundenen Elemente jeweils zur Bereicherung des Sinns beitragen. In der Funktion der eigenen Rede ist also der phraseologische Ausdruck nicht in das Spiel des Misstrauens und der Verdzchti- gungen gegeniiber der Sprache einbezogen, in das Spiel der Zwei- und Mehrdeutigkeiten widerspriichlicher Kon- texte, sondern er dient dem Aufbau metaphorischer se- mantischer Ganzheiten, deren Kraft auf einer harmoni- schen, wenngleich iiberraschenden Anpassung der jewei- ligen beiden Elemente beruht. Wenn Barariczak in den auf Propagandasprache beruhenden Gedichten die Ve r- we ndungen fertiger sprachlicher Ausdriicke ausniitzt, so verwenden die auf Phraseologismen der Alltagssprache beruhendenl Gedichte eher die semantischen Mijglich- keiten der einzelnen Wijrter und Ausdriicke.
Es handelt sich hier urn zwei verschiedene Konzeptio- nen des Darstellens von Sprache in den Gedichten von
Barariczaks dargesteZZte Sprache 149
Staniskaw Barariczak. Im Falle der Verwendung propagan- dasprachlicher Phraseologismen wird also die f remde Sprache poetisch verworfen, beiderver- wendung von alltagssprachlichen Phraseologismen wird eine eigene Sprache konstruiert, werden neue MEglichkeiten fiir die Standardbedeutungen von WC,- tern, Ausdriicken oder Idiomen gesucht.
Die Sprache als Aufzeichnung sozialer Erfahrungen
Ein etwas anderes Beispiel fiir die Verwendung phra- seologischer Stereotypen in der Funktion der eigenen Rede ist der Zyklus der "Kaufkrsftigen Gedichte" unter dem Titel "Zur Theke gelangen" aus dem Band Triptychon aus Beton, Miidigkeit und Gelee. Die Texte des Zyklus "Kaufkrsftige Gedichte" haben folgende Titel: "Sich vorw;irts bewegen", "Hauptsache Ordnung halten", "Was [fiir Ware] haben sie heute geworfen", "Engp%se, Aus- schiisse, Ersatzprodukte", "Sie dr;ingeln sich vor", "Halten Sie mir den Platz frei", "Hier kann jeder ste- hen", "Entschuldigung, wo fsngt die Schlange an", "Sa- gen Sie, wo stehen Sie eigentlich". Es handelt sich dabei gleichsam urn moderne Gelegenheitsgedichte iiber das Heldentum nationaler Aufstsnde des Alltags bezie- hungsweise des Schlangenstehens oder iiber die polni- schen Staatseisenbahnen. Ihre Spezifik beruht jedoch darauf, dass Thema dieser Gedichte nicht konkrete Si- tuationen des Anstehens, nicht konkrete in den Handel "geworfene" Waren und nicht Ereignisse in konkreten L;iden sind, driicke,
sondern spezielle situationsbezogene Aus- die im Alltagspolnisch gleichsam die Funktion
von Indexausdriicken ausiiben, also: Sie drsngen sich vor, was fiir Waren gibt es heute oder entschuldigen Sie, wer steht hier am Ende der Schlange. Baradczaks Gedicht befreit diese Ausdriicke von ihrer situations- gebundenen Konkretheit, es ist nsmlich nicht als Situa- tionsbeschreibung gebaut, sondern als Spiel der Anwen- dungen eines bestimmten Ausdrucks, zum Beispiel "Waren in den Handel werfen", "fiir etwas anstehen" oder "ir- gendwo stehen". Ein solcher Ausdruck iniziiert dann eine ganze Sammlung von Formulierungen von ghnlichem sprachlichen Bau. Auf diese Weise wird das Gedicht zum metasprachlichen Diskurs iiber Situationen, die in der Sprache aufgezeichnet sind, jedoch nicht zu einer Be- schreibung oder Erzshlung iiber konkrete aussersprach- lithe Ereignisse. Der Gelegenheitscharakter dieser Werke ist also nicht verbunden mit einem Ort, einer Zeit oder einer konkreten Ware, auf die die Helden die- ser Gedichte warten. Die Umst;inde und Gelegenheiten in diesen Werken sind n;imlich die sprachlichen Ausdriicke
150 Wtodzimierz BoZecki
selbst. Auch sie haben das Gewicht der Symbolik und ge- sellschaftlichen Reprzsentativitzt zu tragen. Verglei- the etwa das Gedicht "Was haben sie heute geworfen":
Co dzis rzucili w bkoto a co na wiatr, kogo tam z&w rzucili na kolana a kogo blotem obrzucili, na kogo to blot0 rzuca okreilone Bwiatlo a komu rzuca piaskiem w oczy, komu rzuca sic w oczy to bkoto, komu do gardla sic rzuca, a komu najwyiej na m6zg sic rzuciao, ale pozwolmy tu sobie na krotki rzut blota wstecz, wspomnijmy tradycyjna pie&5 nie rzucim ziemi skad nasz brud, przepraszam trud, trud - na darmo, nie rzucimy i dziS, rzucimy sic w te przepasd blota, w kt6ra moie rzuca dziB wreszcie jakis ochlap , przepraszam towar, chociai czy ("Co dziS rzucili")
(Der Text verwendet die Idiome "rzuci6 co8 [towar na rynek]" - etwas [eine Ware auf den Markt] werfen; "rzu- ci6 w bloto" - in den Schmutz werfen; "rzucie na wiatr" - in den Wind reden; "rzucid na kolana" - auf die Knie werfen, zwingen; "rzuci6 swiatto na ~06" - Licht auf etwas werfen; "rzucid sic do czegos" - sich auf etwas stiirzen; "rzucic ziemie" - die Heimaterde verlassen, aufgeben usw. Der Verstandlichkeit halber wird in der folgenden Gbersetzung des w6rtlichen fibertragung die sinngemgsse deutsche Version in () hinzugefiigt - d-6.)
[Was (fiir Ware) ist heute (auf den Markt) geworfen wor- den in den Schmutz und was in den Wind, wer istda.wie- der I auf die Knie geworfen und wer mit Schmutz 1 bewor- fen worden, auf wen wirft dieser Schmutz 1 ein bestimm- tes Licht und wem 1 wirft er Sand in die Augen, wem wirft (springt) 1 er sich an die Gurgel, und wem hat es sich
hdchstens 1 aufs Gehirn geworfen, doch gestattenwir uns hier / einen kurzen Dreckwurf zuriick, gedenken wir der Traditions- 1 hymne wir werfen (verlassen) die Heimat- erde nicht, von der unser 1 Dreck, Verzeihung,Tagwerk, Tagwerk riihrt - 1 umsonst, wir werfen (verlassen) sie such heute nicht, wir werfen 1 uns in den Abgrund von Schmutz, in den vielleicht 1 heute endlich irgendein 1 Miill, Verzeihung ) Warenangebotgeworfen wird, 1 obwohiob]
("Was [fiir Ware] haben sie heute geworfen")
Barariczaks dargestellte Sprache 151
Die Ausdriicke der Alltagssprache werden in den "Kaufkrzftigen Gedichten" zu wirksamen Mitteln der Evokation gesellschaftlicher Situationen, oder genauer gesagt , die Sprache treibt hier selbst aus sich jene Situationen hervor. In der Sprache selbst sind gleich- sam ganze Gruppen von Erfahrungen, Themen und Umstzn- den ausgeprsgt und gespeichert. Darum sind die "Kauf- krsftigen Gedichte" ein erstaunlicher Zielpunkt von Stanislaw Barariczaks Poetik, wenn als ihr Ausgangs- punkt das Programm des Misstrauens gegeniiber der Spra- the gelten ~011. Es stellt sich heraus, dass in diesen Gedichten gerade die Sprache selbst der einzige Trsger der Wahrheit iiber die aussersprachliche Wirklichkeit ist. Alle diese Versprecher, Kalauer, Kontaminationen, Paradoxe, Oxymora, Vieldeutigkeiten und Alogismen der Sprache werden in Barariczaks Gedichten zu Mitteln der poetischen Benennung der Welt. All das, was zu- n;ichst sprachliche Unzul%glichkeit, Alogismus und Mythologisierung zu sein scheint, ermijglicht in Barari- czaks Poesie das Aussprechen verschiedener Aspekte, Nuancen und Schattierungen der aussersprachlichen Wirklichkeit, ftir die uns genaue Namen, Benennungen oder Bezeichnungen fehlen. Hier das Gedicht "~0 stehen Sie eigentlich", das letzte Gedicht des Zyklus der "Kaufkrsftigen Gedichte:
Kobiety w Srednim wieku, staruszki, emeryci: za czym stangligcie murem pod murem tej kamienicy, w ktorej ceglanympier&ieniu tkwibrylantwitryny"PII~SO"?
za czym stoicie tym murem, tym chorem codziennej tragedii, za jakim sensem powszechnym, potrzebnym i powszednim, oprawnym w wers kolejki, ktory katwo ogarnaC pamiecia?
za jaka - dzieri wdzie6, ramie wramie-stoicie barykadg, komu te oczy zgaszone maja w oczy gwiecid przykkadem, jaki lad oslaniacie tym murem pkaskich twarzy?
za jaka mgla metna, mdla meka od czwartej rano stoicie, skazaricy pod murem stracefi oczekujacy o Qwicie, ie z mgky przybedzie ratunek, ze zdaiy,
co6 zdaiy sic zdarzyc?
za czym stoicie,co zatym wszystkim (nie, Wszystkim) stoi - nie wiem, o szare kobiety, emeryci zgarbieni moi, cignieniem niewidzialnej nadziei przyparci do muru,
niewidzialnego sensu - niewidzialnego dla mnie, lecz takie mojego;
i ja tei stoje za nim, choobym zrywal sic, szarpag,odbiegal., ja tei, wQr6d milczacego i zmeczonego choru.
152 WZodzimierz BoZecki
[Frauen im mittleren Alter, Greisinnen, Rentner: wo habt ihr eigentlich gestanden wie eine Mauer an der Mau- er dieses Mietshauses, 1 in dessen Ring aus Ziegel der Brilliant des Schaufensters "FLEISCH" steckt? 11 wo habt ihr gestanden wie eine Mauer, wie der Chor der Alltags- tragbdie, [ fiir welchen allgemeinen, ndtigen und alltag- lichen Sinn, 1 gefasst in die Verszeile der Kauferschlan- ger die sich dem Geddchtnis leicht einprdgt? 11 hinter welcher Barrikade - Tag fiir Tag, Arm in Arm steht ihr,I wem sollen diese erloschenen Augen beispielhaft in die Augen leuchten,l welche Ordnung verhiillt ihr durch die- se Mauer flacher Gesichter? II .. fur welchen triiben Nebel, ohnmachtige Qua1 steht ihr seit vier Uhr friih, 1 Verur- teilte an der Exekutionswand, die ihr im Morgengrauen wartet, I dass aus dem Nebel Rettung komme, dass sie es schafft, dass etwas schafft sich zu ereignen? 11 wofiir steht ihr, was steht hinter all dem (nein, Alldem) - ) ich Weiss nicht, o graue Frauen, ihr meine gebeugten Rentner, / die ihr durch den Druck unsichtbarer Hoff- nung in die Enge und an die Wand getrieben seid, I die Mauer des unsichtbaren Sinns - unsichtbar fiir mich, es ist aber such mein Sinn; such ich stehe dahinter, so sehr ich mich strdube, mich losreisse, wegstrebe, lauch ich bin inmitten des schweigenden und miiden Chores.]
Die Kontamination des Ausdrucks "in der Schlange stehen" mit Ausdriicken wie "wie eine Mauer dastehen", "an der Plauer stehen", "mit dem Riicken zur Wand ste- hen" usw. erfiillt also nicht nur die Funktion einer poetischen Beschreibung von Situationen, die in unse- re aussersprachlichen Erfahrung eingeschrieben sind. Sie ist ntilich such eine linguistisch vie1 reichhal- tigere "Beschreibung", als es diese Erfahrungen sind. Das Schlangestehen erweist sich als eine Me taphe r des Lebens, die situationsbezogenen Realia reproduzie- ren gesellschaftliche Relationen, und diese sind zu- gleich Determinanten der condition humaine iiberhaupt... Hier nun dringen wir zu dem interessantesten Paradox der Phraseologismen als eigener Sprache in Barariczaks Gedichten vor. Diese Stereotypen und banalisierten Aus- driicke erweisen sich ntilich als Exponenten ganzer Gruppen von Bedeutungen, sie sind gleichsam der sprach- lithe Extrakt unserer gesellschaftlichen Erfahrungen. Die Phraseologismen manifestieren hier gleichsam ihre doppelte Natur: sie sind nicht nur Gemeinplztze in der sprachlichen Kommunikation, sondern sie sind zugleich such sprachliche "Pl;itze" mit einer ausnehmend starken Kumulation von Sinngehalten und poetischen Mbglichkei- ten, Das wichtigste ist jedoch, dass die meisten von Baraficzak in diesem Gedicht verwendeten Formulierungen
Barariczaks dargestellte Sprache 153
die iibrigen nicht ausschliesst, sie nicht als Stereo- typen verhijhnt. Es erweist sich, dass die Alltagsspra- the mit allen falschen Etymologien, kiinstlichen und irrefiihrenden Zusammenstellungen von Lauten und Bedeu- tungen die unterschiedlichen Annzherungen und Unter- scheidungen, Ahnlichkeiten und Analogien in den Ansich- ten der wirklichen Welt effektiv zu beschreiben erlaubt. Dies ist nun in der Tat ein erstaunlicher Zielpunkt in der Poesie Baradczaks, sowohl im Hinblick auf das Pro- gramm des sprachlichen Misstrauens als such auf dem Hintergrund der ihm am n;ichsten stehenden poetischen Tradition, von der er ausgegangen war. Und sein Aus- gangspunkt liegt literarhistorisch in dem Moment, als Miron BiaZoszewski die Sprache als System verhEhnte, indem er die Stijrungen der sprachlichen Kommunikation blosslegte, als Witold Wirpsza auf die Widerspriichlich- keit der in der Sprache eingeschriebenen Wahrheiten verwies und als Edward Balcerzan die Mythologisierung der WiJrter und die Verfslschung der aussersprachlichen Wirklichkeit analysierte. Mit einem Wort, als die De- terminante der linguistischen Poesie darauf beruhte, wie Janusz Skawiriski schrieb, "die Sprache im Stande des Argwohns" zu zeigen. In der ersten Generation der polnischen linguistischen Poeten wurde die Sprache als ein Medium dargestellt, dem der Sprachverwender nicht trauen diirfte, doch war die Quelle dieses Misstrauens die ontologis the Natur der Sprache. Demgegenii- ber ist in der zweiten Generation der linguistischen Poeten, zu der ich Baraficzak z;ihle, das Verhgltnis zur Sprache bereits durch vallig neue Probleme bestimmt.
Rein Gedicht von Barariczak (oder der Dichter der "Generation 68") ist eine Parodie der Sprache und iiber- haupt ihrer ontologischen Natur. Statt dessen tritt die Problematik der spezifischen Sprachverwendungen auf, das heisst das Problem der sprachlichen Manipula- tion des Empfzngers. Anstelle der Sprache als eines allgemeinen Kommunikationssystems treten sprachliche Soziolekte auf, es wird das Problem der Schichtung der Sprache in verschiedene Typen gesellschaftlicherKammu- nikation gestellt. Statt der Bilder, die die Sprache als ein Gestarmnel darstellen, das die Kommunikation stijrt, taucht nun die Rede eines Subjekts auf, welche verschiedene Varianten des gesellschaftlichen Spre- chens benennt und interpretiert. Darstellungen kommu- nikativer Abnormitzten stehen somit komplementsr Dar- stellungen kommunikativer Effektivitst gegeniiber. An- ders gesagt, Barariczaks Gedichte sind in dieser Per- spektive der Versuch eines Sprechens in der Sprache iiber die Sprache, der Versuch einer deutlichen Abgrenzung der poetischen Rede als einer
154 W-todzimierz Bolecki
Metasprache von den Soziolekten der Massenkommunika- tion als Gegenstandssprachen, als Sprachverwendungen, die zum Gegenstand der Beschreibung, der Demaskierung oder der Parodie werden.
Drei Traditionen und eine weitere
Aus den angefiihrten Griinden fanden wir, dass die erste Generation der linguistischen Poeten nicht die einzige und nicht die wichtigste Tradition fiir die sprachliche Reflexion in den Gedichten der Dichter der "Generation 68" ist. Es miissen hier noch einige andere mijgliche Traditionen erw;ihnt werden. Die erste davon ist, wie mir scheint, der Futurismus mit seinem Inte- resse an der Sprache und vor allem mit seiner Faszina- tion am Zeitungsstil und seiner Anonymitzt. Es sind schliesslich die Futuristen gewesen, die als ersten im 20.Jahrhundert ihr sprachlichys Bewusstsein zum Thema ihrer Gedichte gemacht haben. Man kannte viele Ahn- lichkeiten zwischen der heftigen Attacke der Futuris- ten auf die Konventionen der jungpolnischen Lyrik einerseits und Barariczaks und seiner Kollegen Attacke auf die poetische Schreibweise der Orientacja Hybrydy aufsuchen. Mich interessiert an dieser Stelle nur ein Aspekt, der Angelegenheit: in beiden F;illen wurde das Metasprachliche, das Metapoetische oder das Metatext- lithe zum Thema einer grossen Gruppe von Werken. Wei- terhin hat der Kult der Futuristen fiir die Massenkul- tur, fiir die Zeitungssprache, der Mythos der Kunst, die man auf der Strasse finden kann, in der Zeitung, im Radio usw. die Kontexte geliefert, welche das Feld der poetischen Themen ungewEhnlich erweitert haben. Drittens schliesslich bilden die rein sprachlichen Operationen der Futuristen mit den Wortlauten, mit den Bedeutungskontexten von Ausdriicken, ihr Interesse fiir die Lexik des Alltags, fcr den Kontrast zwischen poe- tischen Requisiten und der alltagssprachlichen Kommu- nikation eine Tradition, die in der Poesie der "Gene- ration 68" lebendiger ist, als dies auf den ersten Blick scheinen mag.
Die zweite Tradition der Darstellung der Sprache mag sich noch ungewbhnlicher ausnehmen; ich meine hier den Strang im Werk von Konstanty Ildefons Galczydski, der von Edward Balcerzan "poetische Dienstleistungen fiir die BevGlkerung" genannt worden ist.' Es geht hier urn ein Model1 der lyrischen Kommunikation, das im Schaffen Galczydskis mit der Entdeckung der poetischen Energie phraseologischer Wendungen verbunden ist, mit der Imitierung fremder Sprache, mit der Verwendung fertiger sprachlicher Schablonen fiir den schnellen
BaraGczaks daygestellte Sprache 155
Kontakt mit dem Empfsnger, und schliesslich mit dem Spiel der Privatheit der eigenen Sprache und dem offi- ziellen Charakter der Zeitungssprache. Zweifellos ha- ben die Futuristen und Gazczynski hier eine Tradition der Zeitung und des sprachlichen Kitsches als Quelle fiir gedichtbildende Operationen gestiftet. Es muss be- tont werden, dass beide Traditionen vielfach in der poetischen Praxis der "Generation 68" verneint und mo- difiziert werden, doch kann man sie wohl kaum iiber- gehen.
Die dritte Tradition, an die Baranczak unmittelbar iiber das Poesiemodell der ersten Generation der Lin- guisten angekniipft hat, sind unterschiedliche Elemente der Poetik der Krakauer Avantgarde, unter anderem Pei- pers Technik des Satzes und des aufbliihenden Poems so- wie der pseudonymischen Benennung als Negation des iib- lichen Namens eines Gegenstands. Gerade hier l&St sich nun besonders deutlich die Andersartigkeit von Baranczaks Konzeption der poetischen Rede zeigen.
Ein Merkmal von Baranczaks Abgehen von der Avant- gardetradition ist die vgllige Versnderung der Funk- tion der poetischen Pseudonyme sowie der Verzicht auf die Problematik des Wortes als eines Zeichens, das der Sache nicht angemessen ist, eine Problematik, die noch BiaXoszewski und Karpowicz so sehr fasziniert hatte.
Baranczak iibernimmt Peipers Technik der pseudonymi- schen Benennung, indem er aufgebaute Periphrasen von Benennungen schafft - so sind zum Beispiel "Spinnwe- hen" - "symmetrischer Tad", "segeln von Blatt zu Blatt", "Wintermuster auf der Fensterscheibe", "die ausge- spreizten Finger der Hand", "brechender Kreis" usw., "Schsdel" - "geschlossene Anlage", "offenes Haus", "Haus des Spiels", mHaus der Begegnungen"; "Feuer" - ist der "triumphal verlorene Kampf"; "Blume" ist die "der Erde entxissene Rippe", "Ausbruch der WolfshEhle gen Himmel", usw. Prinzip von Baranczaks Konstruktio- nen ist das Fehlen der Kontinuitst zwischen den einzel- nen Periphrasen. Anders als bei Peiper entwickeln sich die Sstze bei ihm nicht als ein Zyklus von Ankniipfun- gen an friihere Formulierungen. Jede Periphrase ist da- gegen eine einmalige Umformung der Benennung, die im Titel oder am Anfang stand. Im Zuge der semantischen Entfaltung des Gedichts entfernen sich die sukzessiven Periphrasen voneinander, aber zugleich wird ihre entle- gene Lage in der Wortreihe iiberwunden durch die stsndi- ge Konfrontation mit dem Ausgangspunkt. Das zweite Merkmal dieser Periphrasen ist, dass jede Periphrase urn einen bestimmten phraseologischen Ausdruck orga- nisiert ist. Baranczaks Periphrasen beginnen also mit einem neutralen Wort, werden zu einer Serie lexikali-
156 W&odzimierz BoZecki
scher Verbindungen, die urn die Wortthemen des Gedichts konzentriert sind. Die poetische Aktion entwickelt sich hier also in einer vollig anderen Richtung als in den Gedichten, welche die Propagandasprache darstellen: in diesen Gedichten sind die phraseologischen Ausdriicke nZmlich Zielpunkt des Gedichts, das Gedicht verwickelt gleichsam neutrale Ausdriicke (SchZdel, Spinngewebe, Fensterscheibe, Feuer etc.) in die sie stabilisierenden Kontexte anderer Ausdrticke. Das ist die andere Seite der Verwendung phraseologischer Ausdriicke der Alltags- sprache in der Funktion der eigenen Pede.
Was ist nun der charakteristische und grundsstzli- the Unterschied zwischen den pseudonymischen Benennun- gen von Peiper und seinen Geighrten und der Funktion dieser Technik in Gedichten von Baranczak? Peiper und seine Kollegen waren bekanntlich am Spiel von Homony- mie und Synonymie interessiert, mit anderen Worten an einer Maximierung der Vieldeutigkeit, die in den sprachlichen MEglichkeiten eingeschrieben sind. Das ge- meinsame Merkmal dieser Periphrasen war die paratakti- sche, aui dem verborgenen Przdikat "ist" beruhende Syntax. In Peipers Gedicht ist das "Bein" zugleich der "Hymnus aus Seide jenseits der Grausamkeit aus Zucker" und das "Band". das "aus den weichen Blsttern des Schiihleins herausbliiht". Janusz Slawinski hat diese Technik die "Litanei der Pseudonyme" genannt.' Jede neue Periphrase schloss sich an die vorangegangene an und erweiterte somit die MGglichkeiten einer poetischen Benennung des im Titel genannten Gegenstands (z.B. des Beins). Demgegeniiber beziehen sich die Pseudonyme in Baranczaks Gedichten nicht nur auf die rein sprachli- then MEglichleiten von Bedeutung. In dem bereits zi- tierten Gedicht "Spinnweben" stehen die vier poeti- schen Periphrasen zwischen dem Wort "noch" und "plEtz- lich". Hier dieses Gedicht:
Pajeczyna, symetryczna 6mierE; jeszcze jest iaglem rozpietym od liicia do liicia, sitem 6witu C... > strzecha kt6ra cedzi gwiazdy w not sierpniowa < . . . > zimowym < . . . > wzorkiem na szybie; nagle: rozczapierzona daofi, kt6ra dano ci w twarz; kolo, na kt6rym tie kama%o; tarcza
Baraficzaks darhges teZlte Sprache 157
strzelnicza z twoja zgarbiona sylwetka; kregi na wodzie, w kt6rej utonalei; twoj splat sIoneczny, rozjarzony b6lem; celownik w samolocie, pikujacym nad droga, gdzie, po6r6d uchodzcow, oslaniasz g2owe rekami: szyba z siecia peknie6, gdzie byly twoje oczy < > . . . ("Pajeczyna")
[Spinnweben, symmetrischer 1 Tod; 1 ist noch ein Segel ausgespannt von Blatt zu Blatt, 1 Sieb des Morgengrau- ens 1 <.. .> 1 Dach 1 das die Sterne in der Augustnacht seiht 1 <... > 1 als winterliches 1 <... > 1 Muster auf der Fensterscheibe; 1 plotzlich: 1 gespreizte Finger der Hand, die dir ins Gesicht geschlagen hat; 1 das Rad, auf dem es dich gebrochen hat; die Schiess-\ scheibe mit deiner gebeugten Silhouette; 1 Kreise auf dem Wasser, in dem du ertrunken bist; 1 dein Sonnengeflecht, aufgewfihlt 1 von Schmerz; Zielfernrohr im Flugzeug, 1 das einen Sturzflug macht iiber dem Weg, wo du, inmitten der Flfichtlinge, den Kopf mit den Handen schiitzest: die Fensterscheibe 1 mit dem Netz der SprCnge, wo deine Augen waren 1 <...>I
("Spinnweben")
Der Wechsel der sukzessiven Periphrasen hsngt einer- seits von einem Wechsel des Gegenstands ab, anderer- seits von einem Wechsel seiner Funktion - "diese Hand kann eine Handvoll sein und kann eine Faust sein" wie wir in einem Gedicht mit diesem Titel lesen (im Band In einem Atemzug). Bezeichnend ist hier, dass das poe- tische Spiel in Konditionales geschieht. Statt der avantgardistischen Pxoblematik der in den Sprachmecha- nismen verborgenen Vieldeutigkeit fiihrt Baraficzak in die Technik der Periphrase die Problematik der Wahr- scheinlichkeit des mutmasslichen Zustandes, der in aus- sersprachlichen Handlungen verborgenen MEglichkeiten ein. Ihn interessieren also nicht lyrische Periphrasen von Benennungen, sondern die dramatische Versnderlich- keit der Objekte dieser Benennung. Die poetische Auf- gabe ist hier fiir Baranczak nicht die Erforschung der Stellung der Sprache gegeniiber den Dingen (und eben dies ist ein symbolistisch-avantgardistisches Motiv, das in unserer poetischen Tradition tief verwurzelt ist), sondern das Wiedererkennen der sprachlichen Ma- nipulationen, die mit Gegenstznden, Zeichen, Begriffen und Symbolen betrieben wird.
Baranczaks Poetik ist zusammen mitihrem generations- msssigen Kontext der Versuch einer Umwertung weiter Bereiche der polnischen poetischen Tradition. Ohne Zweifel bezeugt sie ein ganz entschiedenes Hinausgehen iiber die symbolistische Tradition, wenn wir die Fragen
158 WXodzimierz BoLecki
nach der Natur und nach dem Wesen der Sprache als sym- bolistische Tradition gelten lassen wollen. Sie ist such Zeugnis einer grossen Erneuerung der literari- schen Sprache, das heisst Zeugnis dafiir, wie in die Literatur ganz neue sprachliche Erfahrungsbereiche ein- gebracht werden, welche die Polen der Gegenwart haben machen mtissen. Und sie ist such ein Zeugnis dafiir, wie die Poesie der "Generation 68" an die aktivischtisch- sten Motive der polnischen literarischen Tradition an- kniipft.
Diese verschiedenen Traditionen habe ich nicht nur als Literarhistoriker in Erinnerung gerufen. Dass sie in Baraficzaks Gedichten nachwirken, widerspricht all den Meinungen, wonach Baranczaks Dichtung durch die Tagesaktualitgt der politischen Ereignisse der 7Oer Jahre begrenzt sei und sich im Grunde auf eine Varian- te der publizistischen oder agitatorischen Poesie re- duzieren lasse. Ihr politischer Charakter ist nach meiner Meinung ein ebensolches poetisches Element wie in den Gedichten Kochanowskis, Niemcewiczs, Mickie- wiczs, Norwids, Broniewskis oder Milosz'. Was immer man iiber die polnische Thematik in der Literatur den- ken mcchte, sie ist eine der h8chsten Strgmun- gen der polnischen literarischen Tra- dition von ihren Anfgngen an. Vielleicht leben wir doch in Zeiten, wo unter literarischen Traditionen und in Gedichten Kanonen verborgen sind. Aber dieser Ge- danke ist so alt wie die Ideengeschichte.
(Gbersetzt und im Einverstsndnis mit dem Autor leicht gekiirzt von Rolf Fieguth)
Baraticzaks dargestelzte SpracFze 159
ANMERKUNGEN
1. Siehe Stanisxaw Baranczak, "Miedzy wolnoscia a odpowiedzial- noicia (Ze S.Baranczakiem rozmawia Jan Nowara)" [Zwischen Freiheit und Verantwortung. Interview...] in: Opole 1981, Nr.7, 10-12.
2. Cf. Janusz Maciejewski, "Etyka i 's3.owiarstwo'. M%oda poezja polska wobec tradycji". [Ethik und 'Wortnerei'. Die junge polnische Poesie und die Tradition; in: WiqA 1978, Nr.6, 33-51.
3. Es sollte hier vermerkt werden, dass die Poesie der "Genera- tion 68" Teil der Bewegung "Junge Kultur" war, die in den 70er Jahren im Rahmen der bestehenden Strukturen des Kultur- lebens die Funktion einer Artikulierung gesellschaftlichen Protests ausate.
4. Gemeint sind: Victor Klemperer, Lingua tertii imperii. Die unbew&'ltigte Sprache (1946) und George Orwells Roman 1984 - d.6.
5. Zwei grosse Dichter des 2O.Jahrhunderts, Boleslaw Leimian und Czeslaw Miaosz, haben diese Art von Wertern aus der poeti- schen Rede ausgeschlossen. Wenn die Tradition des Symbolismus irgendwo in Frage gestellt worden ist, so bei Baraficzak und seinen Generationsgenossen.
6. Siehe Janusz Slawinski, "Prdba porzadkowania doswiadczefi" in: Alina Brodzka (Ed.), 2 problemow literatury polskiej XX w., t.3 (Warszawa 1965).
7. Siehe Edward Balcerzan, (Einleitung zu): Bruno Jasiefiski, Utwory poetyckie, manifesty i szkice, BN Nr.211, Seria I (Wroclaw 1972), XXXV-XLVIII.
8. Siehe Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, Cz.1: Strategie liryczne (Warszawa 1982), 109-140.
9. Janusz Slawinski, Koncepcja jqzyka poetyckiego awangardy krakowskiej (Wrocaaw 1965), 71.


































!["Die Revolution ist [...] die Revolution." Georg Forster über Sprache, Politik und Aufklärung.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631beb4a5a0be56b6e0df1f3/die-revolution-ist-die-revolution-georg-forster-ueber-sprache-politik.jpg)