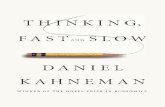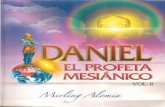Stanisław Wyspiańskis Libretto Daniel und die Deutung des Propheten Daniel in der polnischen...
Transcript of Stanisław Wyspiańskis Libretto Daniel und die Deutung des Propheten Daniel in der polnischen...
1
Jörg Schulte (Universität zu Köln)
Stanisław Wyspiańskis Libretto Daniel und die Deutung des Propheten Daniel in der polnischen Literatur
Im Kontext der russischen Danielrezeption ist eine Behandlung der polnischen Tradition fast unvermeidlicherweise ein subversiver Akt. Russland ist in den Daniel-Interpretationen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts allgegenwärtig; der Daniel-Stoff wurde sogar deshalb gewählt, weil er wie kein anderer geeignet schien, in kaum verhüllter Allegorie über das polnisch-russische Verhältnis zu sprechen. Die Texte sind zwar keine Texte aus der ersten literarischen Reihe, Einer von ihnen nimmt jedoch eine entscheidende Position in der polnischen Literaturgeschichte ein, da er ein Bindeglied zwischen zwei Epochen bildet.
Der Dramatiker, Dichter und Maler Stanisław Wyspiański – geboren 1869 in Krakau und 1907 im Alter von 42 Jahren verstorben – gilt als der herausragende Vertreter des polnischen Modernismus, insbesondere seiner bekanntesten Richtung, der Młoda Polska, des Jungen Polen. Das kurze Drama, genauer gesagt das Libretto, mit dem Titel „Daniel“ ist Wyspiańskis erstes literarisches Werk. Es entstand im Juli 1893 in Paris, wo Wyspiański zum Kunststudium weilte. Wyspiański schrieb es in der Absicht, dass sein Freund Henryk Opieński, die Musik verfasse. Der Wunsch blieb unerfüllt und der Text wurde erst 1908, ein Jahr nach dem Tod des Dichters, von Henry Opieński veröffentlicht.1
Die allegorische Verwendung des Themas war für den polnischen Leser bereits auf den ersten Seiten zu erkennen. Wenn Balthazar über die Israeliten an seinem Hofe spricht, zeigt Wyspiański die polnischen Untergebenen, die sich am russischen Hofe mit ihrer Unfreiheit abgefunden haben.
To są synowie dumy, Das sind die Söhne des Stolzes, wyrzekli się oyczyzny – sie haben ihrer Heimat entsagt – a gdzie honor? und wo ist die Ehre? Honor każe umierać: Die Ehre sagt zu sterben: wy jeszcze żywi – chcecie jeść, Und ihr seid noch lebendig – wollt essen, chcecie pić, wollt trinken bez honoru żyć… […] ohne Ehre leben. […] Taki lud, Ein solches Volk, to lud sług – ist ein Volk von Dienern – Służcie mi wiernie, dient mir treu, nie będę szczędzić łask, und ich werde an Gunst nicht sparen hojnie obdarzę was.2 und euch reichlich beschenken.
Ihm antwortet der ein Teil des „Chores der Söhne des unterlegenen Landes“: Obiecujem wiernie służyć, Wir versprechen deiner Krone, władco, potężny twojej koronie. mächtiger Herrscher, treu zu dienen.
1 Zum Kontext des Werkes vgl. Kaczmarek (1999); Backvis (1952), S. 88-95. 2 Wyspiański (1958), Bd. 1, S. 10.
2
Przed twoją dłonią schylamy czoło, Wir neigen vor deiner Hand die Stirn, pójdziem, gdzie głos twój zawoła.3 gehen dahin, wohin deine Stimme uns ruft.
Der ganze Chor fährt fort: Twe państwo sięga trzech mórz, Dein Reich reicht bis zu drei Meeren, twe berło całe złote dein goldenes Szepter besänftigt trzech mórz fale poskramia die Wellen dreier Meere und schützt i nas wiernych zasłania od burz.4 uns Getreue vor Stürmen.
Das babylonische Reich grenzte um 600 v. Chr. an das Mittelmeer und an den Persischen Golf, möglicherweise ist das rote Meer hinzuzurechnen, vom Kaspischen Meer war es durch das Mederreich getrennt. Die drei Meere passen viel besser – im allegorischen Kontext – auf die Russland umgebenden Meere. Auch die drei Herrscher („trzej mocarze“) passen auf Österreich, Russland und Preußen eher als auf das Ende des Babylonischen Reiches. Diese drei Herrscher singen:
My trzej podajem dłonie, Wir drei reichen die Hand, my trzej silni przymierzem, wir drei sind stark durch das Bündnis, rozum za boga bierzem, wir nehmen den Verstand als Gott, zapowiadamy państwo, und verkünden einen Staat, gzie spokojnie poddaństwo in dem die Untergebenen in Ruhe życie przepędzi.5 ihr Leben verbringen.
Im weiteren vergisst Wyspiański gänzlich, dass er von den Juden in babylonischen Exil schreibt, wenn er den Chor der Dichter klagen lässt:
Rzucamy ojczystą ziemię, Verlassen wir das Vaterland wygnani; als Verbannte wygnani rzucamy kraj – als Verbannte verlassen wir das Land wygnani.6 als Verbannte.
Zur Regierungszeit des Jojakim waren Daniel und seine Gefährten nach Babylon ver-schleppt, sie waren also bereits im Exil, im Gegensatz zu den polnischen Dichtern, die nach der Niederschlagung des Novemberaufstands (1830/31) ins zumeist französische Exil gegangen waren. Das Babylon unterlegene Volk ist im Libretto überhaupt ein Volk der Dichter. Dabei nimmt Wyspiański aber die naheliegenden biblischen Assoziationen des Sängers David oder des Hohelieds des Salomon nicht auf. Stattdessen singt die Stimme eines Dichters:
Śpiewałem wielkość ojczystego kraju, Ich sang die Größe meines Heimatlandes, śpiewałem dumę przodków mych, sang den Stolz meiner Vorfahren, śpiewałem chwałę rycerskich pokoleń… sang den Ruhm der Rittergenerationen … o skały rozbił się mój śpiew.7 mein Singen zerschellte an Felsen.
Angesichts der kaum verhüllten Anachronismen stellt sich die Frage, warum der vier-
3 Ibidem, S. 12. 4 Ibidem, S. 13. 5 Ibidem, S. 14. 6 Ibidem, S. 15. 7 Ibidem, S. 15.
3
undzwanzigjährige beginnende Dichter den biblischen Stoff gewählt hat. Die Frage hat eine eindeutige Antwort: Wyspiański hatte die Briefe des Antoni Edward Odyniec (1804-1885) gelesen. Odyniec war ein Freund von Adam Mickiewicz, selbst Übersetzer und ein eher zweit-rangiger Dichter. Seine Briefe wurden im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts mehrfach herausgegeben, da sie eine der wichtigsten Quellen für Mickiewiczs Leben boten. Im Brief des Antoni Odyniec an den Dichter Julian Korsak vom 23. Dezember 1829 konnte Wyspiański lesen.
Unlängst habe ich in der heiligen Schrift das Buch Daniel gelesen, das einen riesigen Eindruck auf mich gemacht hat. Fühlte ich mich als großer Dichter, würde ich daraus ein Poem oder ein Drama schreiben; und würde ich dies tatsächlich tun, und es gut tun, würde ich nicht nur der Literatur, sondern unserer ganzen Gemeinschaft einen großen Dienst erweisen. Darüber habe ich lange mit Adam [Mickiewicz] gesprochen. Jeder Mensch, vielleicht auch jedes Volk, hat, wie es sich einen göttlichen Geist hat auch eine geheime Quelle seiner Kraft, die keine menschliche Macht – und auch die Höllentore – nicht überwinden, es sei denn sie wird zuvor trübe oder trocknet aus. Das Übel ist, dass sie nicht bei allen im Selben liegt: beim einen liegt sie im Herzen, beim zweiten im Kopf, beim dritten in der Hand. Samson hatte sie zum Beispiel in den Haaren. Das zweite und größere Übel liegt darin, dass die Menschen, und vielleicht auch die Völker, das sie sich gewöhnlich selbst nicht kennen, diese Quelle in sich selbst nicht sehen und während sie auf andere schauen, sie suchen und sie eher darin zu finden glauben, worin ihnen die anderen überlegen sind, und nicht darin, worin sie selbst überlegen sein könnten. Der Mensch, der in sich diese echte Quelle der Kraft des göttlichen Geistes kennt, ist ein Weiser; der Mensch, der sie in seinem Volke kennt, ist ein Prophet. Israel als Ganzes war kein Weiser, es erging sich im Stolz, und wurde für das andere blind, wie Samson; und die Propheten, die es vom grauen Star heilen wollten, hat es gesteinigt oder zersägt. Es fiel in das Unglück, das es verdiente; und es bedurfte der Tränen vieler Generationen, um dieses Leukom in seine Augen zu zersetzen. Daniel sah am klarsten. Er hasste die Chaldäer nicht und liebte nur seinen Gott, aus allen Kräften des Herzens und seiner Seele. Sein Muster an Liebe und Glauben, dieser einzigen Quellen aller einstigen Tugenden und Kräfte Israels, überdeckte gewissermaßen die Erinnerung an Unbeständigkeit und Hochmut, jene Quellen aller Schuld und der Sünden seines Stammes; und da dieses Muster Achtung für den Propheten und Liebe im Herzen des Kyros erweckte, machte es ihn für ganz Israel zum Werkzeug der göttlichen Barmherzigkeit, wie seine Vorgänger das Werkzeug göttlicher Strafe gewesen waren. Dieses wäre der geistige Inhalt dieses Poems oder Dramas über Daniel, das zu schreiben ich Adam bewegen wollte. Aber seine Gedanken waren zu jener Zeit mit einem anderen Thema beschäftigt.
Niedawno czytałem w Piśmie św. xięgi Danielowe, które ogromne na mnie zrobiły wrażenie. Gdybym się czuł wielkim poetą, napisałbym z nich poemat czy dramat; a gdyby kto rzeczywiście zrobił to, a dobrze, oddałby wielką przysługę nie tylko literaturze ale i całej społeczności naszej. Szeroko o tem mówiliśmy z Adamem. Każdy człowiek, a może i naród, jak ma w sobie duch Bożego, tak ma też i tajemnicze źródło jego siły, której żadna moc ludzka ani bramy piekielne nie przemogą, chyba że wprzód w nim samym źródło się to zamąci lub wyschnie. Otóż bieda, że nie we wszystkich jest ono w jednym i tem samem: ten je ma w sercu, ten w głowie, ten w ręku; Samson miał np. we włosach. Druga zaś i największa bieda jest w tem, że ludzie, a może i narody, nie znając zwykle se ipsos (samych siebie), źródła tego sami w sobie nie widzą, a zapatrując się na drugich, szukają go i myślą znaleźć w tem raczej, przez co ci drudzy mają wyższość nad nimi, nie zaś w tem, przez coby sami osiągnąć ją mogli. Człowiek, znający w sobie to prawdziwe źródło siły ducha Bożego, to mędrzec; człowiek znający je w swoim narodzie, to prorok. Izrael nie był mędrcem w ogólności; wybujał w pychę, i oślepł do reszty jak Samson; a proroków, którzy mu kataraktę zdjąć chcieli, kamienował albo piłował. Popadł więc w biedę, na którą zasłużył; i trzeba było łez wielu pokoleń, nim to bielmo ócz jego przegryzły. Daniel przejrzał najjaśniej. Nie nienawidził on Chaldejczyków, ale miłował tylko Pana Boga swego, ze wszystkich sił serca i duszy swojej. Wzór w nim tej miłości i wiary, owych jedynych źródeł wszelkich dawnych cnót i sił Izraela, zatarł niejako pamięć
4
płochości i pychy, owych źródeł wszystkich win i grzechów jego plemienia, a wzbudziwszy ku prorokowi cześć i miłość w sercu Cyrusa, uczynił go dla całego Izraela narzędziem miłosierdzia Bożego, jak poprzednicy jego byli narzędziami kary Bożej. To byłaby treść duchowa tego poematu czy dramatu o Danielu, do napisania którego chciałem nakłonić Adama. Ale myśl jego w tych czasach zajęta jest innym przedmiotem.8
Die Idee, dass jedes Volk über eine besondere Kraft verfügt, ist natürlich eine Variation der Worte des Propheten (Dan. 10.13), dass jedes Volk seinen Engelobersten besitzt. Diese Zeilen aus dem Jahr 1829 erklären, warum sich vierundsechzig Jahre später der junge Stanisław Wyspiański des Daniel-Stoffes annahm. Die unerfüllte Aufforderung an Mickiewicz war ein ungeschriebenes Werk der Literaturgeschichte, vergleichbar mit der von Johann Wolfgang von Goethe in Dichtung und Wahrheit beschworenen Ausweitung der Geschichte von Joseph und seinen Brüdern.9 Doch in diesem Fall war nicht nur der Stoff, sondern auch seine Deutung vorgegeben. Wyspiański wusste, dass Mickiewicz eine nahezu identische Auffassung von der polnischen Geschichte hegte, und dass Odyniec ihm nur den Stoff für eine neue Variation dieser Deutung sowie der Sendung des polnischen Volkes gegeben hatte. Bedürfte es einer Bestätigung, ließen sich die folgenden von Stanisław Szczepanowski über Mickiewicz verfassten Zeilen heranziehen:
Nur der tiefe Glaube an die geschichtliche Sendung Polens konnte die Ruhe hervorbringen, mit der der Dichter [d. h. Mickiewicz] auf den Koloss der Moskauer Macht blickte. Wie der Prophet Daniel in der Vision des Nebukadnezar, erkannte er, dass er [dieser Koloss] auf ‚tönernen Füßen‘ ruhte, auf einer psychologischen Lüge, auf dem Vertrauen in die menschliche Niedertracht, die mit Angst beherrscht werden kann.
Tylko głęboka wiara w dziejowe posłannictwo Polski mogła wyrobić ten spokój, z którym poeta pogląda na kolos potęgi moskiewskiej. Jak Prorok Daniel w wizyi Nabuchodonozora, tak i on widzi olbrzymie roz-miary i potęgę kolosu, ale tak samo, jak prorok Daniel, dostrzega, że spoczywa „na glinianych podsta-wach“, na fałszu psychologicznym, na zaufaniu w podłość ludzką, która daje się opanować postrachem.10
Der Prophet Daniel ist Mickiewicz, und deshalb sind das Thema von Wyspiańskis Libretto die Dichter des unterworfenen Stammes. Sie treten nicht als handelnde Personen, sondern nur als „Stimme des Dichters“ (głos poety) und als „Chor der Dichter“ (chór poetów) auf. Wer der Koloss ist, erklärt Mickiewicz selbst im vierten Band seiner am Collège de France gehaltenen Vorlesungen über die Slawen. Er sieht hier sogar eine direkte ethnische Nachfolge:
Was die einstige Macht der assyrischen Slaven betrifft, so existiert dieser Typus in der Kunst nicht; wir kennen keine Statue von Nebukadnezar. Dieser Typus findet sich nur beschrieben im Buch der Propheten. Er ist zu riesig, zu materiell, um in der plastischen Kunst dargestellt zu werden. Die Bibel gibt eine Idee dieser Macht, die den Globus unterdrückte, indem sie ihn in Form eines Riesen darstellte, der einen Kopf aus Gold, eine Brust aus Silber und Füße aus Ton hat [Dan. 2.1]. Es ist bemerkenswert, dass mehrere moderne Historiker und Dichter Russland mit dieser Statue von Nebukadnezar verglichen haben; sogar die Historiker, die die Bibel scheinbar nicht gelesen haben, wiederholen den Vergleich, und sogar in der gängigen Diplomatensprache heißt Russland der Koloss des Nordens. Dieser Zufall gibt Grund zum Nachdenken.
8 Odyniec (1961), Bd. 2, S. 66-67. 9 Goethe (1994-2002), Bd. 9, S. 141. 10 Szczepanowski (1907), S. 164.
5
Quant à la puissance antique des Slaves assyriens, il n’en existe pas de type dans l’art; nous ne connaissons pas de statue de Nabuchodonosor. Ce type se trouve seulement décrit dans le livre des Prophètes. Il est trop énorme, trop matériel, pour être reproduit par l’art plastique. La Bible donne l’idée de cette puissance qui opprimait le globe, en la représentant sous la forme d’un géant qui avait le tête d’or, la poitrine d’argent et les pieds d’argile. Il est singulier que plusieurs historiens et poètes modernes aient comparé la Russie à cette statue de Nabukadnezar; ceux même des historiens qui ne paraissent pas avoir lu la Bible, répètent la comparaison, et même, dans la langage commun diplomatique, on appelle la Russie le Colosse du Nord.11
In Wyspiańskis Libretto tritt Daniel erst auf, als er nach dem Erscheinen der Schrift aus der Löwengrube (so werden zwei Kapitel des Danielbuches verbunden) gerufen wird, um die Zeichen zu deuten. Balthazar lässt den Schatz des Tempels bringen, den die Söhne des unterworfenen Volkes zunächst gehorsam darbringen:
Bierz je, monarcho wszechpotężny, Nimm ihn, allmächtiger Monarch, na co mi pamiątki przeszłości, wozu brauchen wir Andenken an die gdy nowe życie rozpocząć mam. Vergangenheit, wo ich ein neues Leben Precz z przeszłością — zaprzeczam jej! beginnen muss, fort mit der Vergangenheit! Nie miałem przeszłości.12 Ich leugne sie. Ich hatte sie nicht.
Erst als die Gefäße für das Mahl gebracht werden und der Tanz des Balletts beginnt, erheben sich Stimmen: „Świętokradztwo! … Bezczelność … Przyjdzie kara!“ („Gotteslästerung, Dreistigkeit. Die Strafe wird kommen“).13 Balthazar fragt im Übermut: „Wo sind die übernatürlichen, erträumten, ersehnten Mächte?“ („gdzie władze nadprzyrodzone / wyśnione, wymarzone?“).14 Es folgen Blitze, Dunkelheit und Panik. Balthazar will nicht in das Licht schauen, in dem die Hand schreibt, der Chor droht ihm mit dem Tode und zwingt ihn zu schauen: Er erkennt die Sprache der Unterworfenen und lässt den Propheten aus der Löwengrube rufen. Balthazar sagt über den Propheten:
Znam jego myśli i cenię jego myśli, Ich kenne und schätze seine Gedanken, królewskie myśli w nim. königliche Gedanken sind in ihm On mówi prawdę;15 Er sagt die Wahrheit.
Daniel kommt daraufhin aus dem Kerker und betet – in einem weiteren Anachronismus – zunächst die Sonne an:
Myśl wolna In mir lebte we mnie żyła, der freie Gedanke świętym ogniem pierś płonęła die Brust floss im heiligen Feuer ku słońcu. zur Sonne.
Dann spricht er die berühmtesten Worte des Werkes: Ja nie jestem jak tylko fantazją, Ich bin nichts als nur Phantasie, ja nie jestem jak tylko poezją, Ich bin nichts als nur Poesie, ja nie jestem jak tylko duszą… Ich bin nichts als nur eine Seele…
11 Mickiewicz (1849), Bd. 4, S. 125-126. 12 Wyspiański, op. cit., Bd. 1, S. 17. 13 Ibidem, S. 20. 14 Ibidem, S. 20. 15 Ibidem, S. 27.
6
Ale za mną przyjdzie moc, Aber nach mir kommt eine Macht, poczęta z moich słów, Von meinen Worten angefacht, moc, co pokruszy pęta, Die uns befreit von den Fesseln, co państwo wskrzesi znów! Die uns den Staat wieder schafft!
Ja nie jestem jak synem Ich bin nichts als nur Saat wyobraźni męczonej. Der qualvollen Einbildungskraft. Zginę — rozwieję się Ich werde fallen – verwehn we mgle waszych snów; Im Dunst eurer Träumereien; lecz w braci mojej Doch in der Bruderschaft ja się odrodzę czynem — Komme ich wieder als Tat – wieki żyć będę znów.16 Und werde Jahrhunderte sein.17
Daniel ist also nichts als Phantasie, Dichtung und Seele, er ein Held der Młoda Polska und zugleich ein Nachfahr des Dichter-Propheten Mickiewicz. Wyspiańskis hatte sich bereits über Jahre hinweg auf unterschiedliche Weise mit Mickiewicz beschäftigt. Noch zu Schulzeiten illustrierte er Balladen und Konrad Wallenrod, als Student bekam er einen Preis für das Projekt eines Frieses, der das Konzert des Jankiel (in Pan Tadeusz) vorstellen sollte, über Mickiewiczs Begräbnis in Krakau am 4. Juli 1890 schrieb Wyspiański: „Es war ein schrecklicher Moment, als das Grab noch Polen gebracht wurde – und man Leben in ihm suchte – man wollte durch den Atem der Gräber zu neuem Leben erwachen“ („Była to straszna chwila kiedy tę trumnę wprowadzono do Polski – i szukano w niej życia – chciano się odrodzić tchnieniem grobów“).18 Noch die Werke Legion (1900) und Wyzwolenie (Befreiung; 1903) sind eine explizite Auseinandersetzung mit Mickiewicz bzw. seinem Helden Konrad Wallenrod. Es ist jedoch zu erwähnen, dass Wyspiańskis Daniel mit einem Motiv des zweiten großen polnischen Romantikers endet. Der Ruf der Söhne Israels „Oto nasz prorok, nasz Król-duch“ („Dies ist unser Prophet, unser Geist-König“)19 bezieht sich natürlich auf Juliusz Sło-wackis Drama Król Duch. Daniel ist somit zugleich die metaphysische Kraft der polnischen Romantik. Wyspiański kannte ohne Zweifel auch den Vergleich im dritten Akt von Słowackis 1833 entstandenem Kordian, in dem die Polen mit dem Hofstaat des Belsazar verglichen sind:
„Jetzt sitzt der Zar am Tisch, / und unsere demütigen Satrapen beugen die Stirn, / es strömen die Brillanten der Weine aus tausenden Kelchen / und entzünden sich, und die dröhnende Musik lässt / den Gips von den Wänden bröseln. Die Frauen ringsum / erblüht, frisch und duftend wie Rosen aus Saron, / legen ihre Stirn auf die russischen Schultern. / Gehen wir dorthin… und brennen wir mit Feuer auf der Wand / das Urteil der Rache, der Zerstörung, das Urteil des Balthasar. / Dem Zaren fällt die nicht aus-getrunkene Schale aus den Händen, / mit blauem Glanz der Schwerter geschriebene Worte, / der Tod erklärt sie weiser als die Stimme des Daniel. / Und dann wird unser Land frei sein! Dann herrscht Ta-geslicht! Polen erstreckt sich mit seinen Grenzen zu den Meeren, und atmet und lebt nach einer stürmischen Nacht. / Es lebt! Habt ihr diesem Wort in die Seele geblickt? / Ich weiß es nicht… in diesem einen Worte schlägt das Herz, / Ich zerlege es in Klänge, zerdrücke es zu Buchstaben, / und in jedem Klange höre ich eine mächtige Stimme! Der Tag unserer Rache wird groß sein und erinnert werden!
16 Ibidem, S. 34. 17 Dieses Fragment hat Karl Dedecius übersetzt: Dedecius (1964), S. 14. 18 Wyspiański (1994), Bd. 1, Teil 1, S. 255. 19 Wyspiański (1958), Bd. 1, S. 36.
7
[…] Teraz car za stołem, Satrapy nasze korni pokładli się czołem, Win tryskają brylanty z kielichów tysiąca, I palą się pochodnie, a muzyka grzmiąca Gipsy ze ścian oprósza. Kobiety dokoła Rozkwitłe, świeże, wonne jak Saronu róże, Na rosyjskich ramionach opierają czoła. Idźmy tam... i wypalmy ogniami na murze Wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara. Carowi nie dopita z rąk wypadnie czara, Błękitnym blaskiem mieczów napisane słowa, Wytłumaczy śmierć mędrsza niż głos Danijela. A potem kraj nasz wolny! potem jasność dniowa! Polska się granicami ku morzom rozstrzela, I po burzliwej nocy oddycha i żyje. Żyje! czy temu słowu zajrzeliście w duszę? Nie wiem... w tem jednem słowie jakieś serce bije, Rozbieram je na dźwięki, na litery kruszę, I w każdym dźwięku słyszę głos cały ogromny! Dzień naszej zemsty będzie wielki - wiekopomny!20
Das interessanteste der drei polnischen Werke ist Elżbieta Bośniaczkas Drama Daniel, das erstmals 1869 in der Zeitschrift Przyjaciel domowy (Hausfreund) erschien, dann als Buch 1907, erneut als Teil der Werkausgabe von 1907 sowie in zweiter Auflage 1937. Elżbieta z Rulikowskich Grzymała-Bośniacka (1837-1904), wie ihr voller Name lautet, veröffentlichte ihre Dramen und Gedichte unter dem Pseudonym „Julian Moers z Poradowa,“ war aber auch unter dem Namen ihres Mannes Tuszowska bekannt. Sie ist heute allenfalls Spezialisten ein Begriff und gilt als Epigonin der Romantiker.21 In ihrem Daniel ist die Priesterin Sara in den in die Kaste der babylonischen Magier aufgenommenen Daniel verliebt. Bei ihrem ersten Treffen entreißt ihr Daniel ein Weihrauchgefäß und fordert sie auf, den Tempel zu verlassen.
Nad wszystko boli upadek narodu, Mehr als alles schmerzt der Fall des Volkes, Lecz srożej jeszcze boli upodlenie!… stärker noch schmerzt die Erniedrigung (do Sary) (an Sara gewandt) Ty, córko królów, ty z Dawida rodu, Du, Königstochter, aus Davids Geschlecht W stroju poganki! W jaskini zepsucia!… im Gewand einer Heidin! In der Höhle der Słuchaj! Jeżeli masz choć iskrę czucia, Verderbnis! Höre, hast du nur einen Funken Idź stąd nieszczęsna! Bo ono sklepienie Gefühl, geh fort, Unglückliche, denn das Nad twą występną zapadnie się głową…22 Gewölbe stürzt auf dein frevelhaftes Haupt
Sara antwortet mit dem Geständnis, sie sei die Geliebte des Balthasar, seitdem er ihre Liebe zurückgewiesen habe und droht ihm, ihn (wie eine Salomé) an Balthasar zu verraten.
Jam Baltazara kochanką!… Zobaczysz Ich bin Balthasars Geliebte! Du wirst sehen, Czyl u władcy ty tak wiele znaczysz, ob du beim Mächtigen so viel bedeutest By, kiedy twojej ja zażądam głowy, dass, wenn ich dein Haupt fordere,
20 Słowacki (1952), Bd. 2, S. 163. 21 Eustachiewicz (1982), S. 46. 22 Juliana Moers z Poradowa (1937), Bd. 7, S. 177.
8
Mojego pana doznała odmowy! die Bitte von meinem Herren verneint wird. [… ] Ja kochałam ciebie, Nad wszystko w świecie, ich liebte dich über alles in der Welt nad Jehowę w niebie, mehr als Jehova im Himmel, ich, aus dem Ja ze krwi królów, ja czysta dziewica, Blut von Königen, bin eine reine Jungfrau Ja w Babilonie pierwsza krasą lica, ich bin in Babylon die schönste an Gesicht, I tyś odrzucił miłość taką!23 und du hast solche Liebe verschmäht!
Baltazar aber will ihr Daniels Blut nicht geben, und glaubt ihr nicht, dass Daniel Jude sei. Er stellt ihn auf die Probe, und verlangt, er solle als Priester des Bellus, dem Gott im Namen des Balthasar ein Opfer bringen an. Daniel nimmt das Angebot an und liefert damit Sara dem Tode aus. Doch dann kündet er öffentlich:
Wielki Monarcho! Babilończykowie! Großer Monarch! Babylonier! Jesteście w błędzie. Ów Bóg wasz mniemany Ihr seid im Irrtum. Euer vermeintlicher Gott Jest niczem! Ludzi wprawnemi rękami ist nichts! Mit geschickten Händen Z drogiego kruszczu kunsztownie ulany, aus teurem Erz kunstvoll gegossen, Jest dziełem waszem!24 ist er Euer Werk!
Ein Blitz zerstört die Bel-Statue, Balthasar befiehlt Daniel zu töten, doch Daniel singt im Löwenkäfig. Hymnen an seinen Gott. Der Archimag empfiehlt, alle Juden zu ermorden und Bel zu opfern. Als die Frau des Balthasar verstirbt, erwählt er Sara zu seiner Frau, nicht wissend, dass auch sie eine Jüdin ist. Beim Festmahl vermögen die Magier die Schrift nicht zu deuten; man beschließt, das Gastmahl mit der neuen Königin zu wiederholen; es ist nun zugleich ein Hochzeitsmahl. Sara erfährt, dass Daniel am Leben ist, sie erklärt, sie fühle ihren Tod nahen und bekennt, dass sie Jüdin ist. Balthasar erklärt dem Gott der Hebräer Rache. Als die hebräische Schrift erneut erscheint, fordert Sara ihn auf, nach Daniel rufen zu lassen. Daniel verkündet dem König, seine Taten seien für zu leicht befunden und sein Reich sei bereits geteilt. Am Ende des Dramas hat Kyros II bereits die Macht übernommen, Balthasar begeht Selbstmord; Daniel verkündet Kyros II, er sei vorausbestimmt, das jüdische Volk aus der Unfreiheit zu lösen. Kyros antwortet ihm, er werde noch mehr und den Tempel auf Zion, das Werk des Salomo von neuem errichten (dies erwähnt Xenophon in der Erziehung des Kyros); denn er fühle, ihn habe eine höhere Macht in die Mauern Babylons geführt. Es ist ein historisches Drama ohne allegorischen Anspruch.
Wenn Wyspiański das Drama kannte, so haben ihn die angebotenen Möglichkeiten, den Stoff zu erweitern, nicht interessiert. Wir haben gesehen, dass sein Text so sehr auf die pol-nische Geschichte abzielte, dass der mit dem polnischen Król-Duch (König Geist) identifizierte Daniel für den jüdischen Leser scheinbar wenig Anknüpfungspunkte bot – ganz im Gegensatz zu dem proto-zionistisch anmutenden Ende der Elżbieta Bośniacka. Die Aufführungsgeschichte des Librettos bezeugt jedoch das Gegenteil. Das Werk fand seine erste Aufführung im Jahr 1927 in Krakau in jiddischer Übersetzung (von Daniel Leibel) unter der
23 Ibidem, S. 178. 24 Ibidem, S. 202.
9
Regie des sonst wenig bekannten A. Piekarski.25 Der polnische Philologe Tadeusz Sinko besuchte die Aufführung und verfasste eine kurze Rezension mit dem Titel Wyspiański w żargonie (Wyspiańki im Jargon):
Wyspiańskis biblischer Text […] ist bekannterweise das letzte prophetische Poem in der polnischen Literatur, das dem Volk in Unfreiheit von der erlösenden Macht der Poesie kündet. Was für uns eine Allegorie war, nehmen die Zionisten heute als ihre nationale Aktualität war. Daraus erklärt sich die Aufnahme des Daniel in das Repertuar in das im Jargon gespielte Theater, daraus erklärt sich der offensichtliche Pietismus in der Darstellung.
Biblijny tekst Wyspiańskiego, […] jest, jak wiadomo, ostatnim w literaturze polskiej poematem proroczym, głoszącym narodowi w niewoli zbawczą moc poezji. Co dla nas było alegorią, to Syjoniści uważają dziś za swoją aktualność narodową. Stąd przyjęcie Daniela do repertuaru teatru żargonowego, stąd widoczny pietyzm w grze.26
Und tatsächlich findet sich wenigstens ein Abschnitt, in dem die Dichter singen wie die biblischen Propheten:
Żegnaj, mój kraju, rodzinna ziemio, Lebe wohl, mein Land, meine Heimat, przyjmij me łzy, jedyny dar; empfang meine Leiden, die einzige Gabe; idę daleko – przeniesiesz echo ich gehe weit fort – du wirst ein Echo jako wspomnienie do nas twój czar – bringen als Erinnerung an deinen Zauber – Na obcej ziemi znajdę mój śpiew, Im fernen Lande finde ich meinen Gesang, moi wnukowie wrócą za niemi meine Enkel kehren ihm folgend zurück. do swojej ziemi.27 in ihr Land.
Diese Interpretation war nicht zufällig. Es lassen sich zwei Gründe nennen. Zum einen war Wyspiański der Schöpfer der vielleicht positivsten jüdischen Figur in der polnischen Literatur, der Rachel, in dem Drama Hochzeit (Wesele), dessen Übersetzung später ein Ereignis der hebräischen Literatur wurde.28 Wyspiański war einer der Favoriten der jüdischen Leser. Zum anderen war die Verbindung zwischen dem polnischen Dichter und dem biblischen Propheten seit dem Werk von Mickiewicz etabliert. Mickiewicz hatte in Pan Tadeusz den „arendar“ (Schankwirt) Jankiel als positive Figur und als polnischen Patrioten dargestellt; er hatte Puschkin und Dante in seiner Vorlesung am 20. Dezember 1842 für die Verwendung hebräischen Ausdrucks gelobt. Und er hatte in seinen Pariser Vorlesungen mehrfach davon gesprochen, dass der Geist der polnischen Nation eine Konzentration erreicht habe, für die es auf der Welt seit dem politischen Zerfall des Volkes Israel kein Beispiel gebe. Auf diesem Wege habe Polen die Mysterien der Geschichte Israels gelernt, sei zu seinem Repräsentanten geworden und habe eine wechselseitige Verantwortung erhalten. Er war überzeugt, es sei Vorsehung, dass ein Volk, das älter als Europa sei, älter als alle zivilisierten Völker, in Polen lebe. Wie die polnisch-litauische Union, trotz der Unterschiede, der Republik politische und militärische Größe gegeben habe, so werde die Union zwischen Polen und Israel die spirituelle
25 Vispyanski (1922). 26 Sinko (1927), S. 2. 27 Wyspiański (1958), Bd. 1, S. 16. 28 Dykman (1938), S. 5; Löw (1989), S. 21-22.
10
und materielle Macht vergrößern. Am 11. August 1845 rief er die Towianisten dazu auf, sich mit dem Leid Israels zu vereinen, das die Zerstörung Jerusalems beweine; und angesichts der Massaker von Praga und Warschau den Geist Israels bewundern, der über 1800 Jahre eine le-bendige Klage bewahrt habe, als sei das Unglück gestern geschehen. Anders als etwa das mittel-alterliche Danielspiel, in dem Daniel im Namen des Christentums vom Ende und die Unter-drückung des Reiches der Juden verkündet („instat regni Iudeorum finis et oppressio!“),29 baut die polnische Interpretation des Danielstoffes auf einer Geschichtsdeutung auf, in der das polnische und das jüdische Volk in einer engen Verbindung gesehen werden.
Literatur: Backvis, Claude (1952): Le dramaturge Stanislas Wyspianski 1869-1907, Paris. Bertoni, Ferdinando (1993): Balthassar. Actio sacra, hg. von Helen Geyer, Krako?w. Dedecius, Karl (1964): Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, München. Dronke, Peter (2008): Nine Medieval Latin Play, Cambridge 2008. Dykman, Salomon (1938): Wesele w szacie hebrajskiej. In: Ster, 6.3.1938. S. 5. Eustachiewicz, Lesław (1982): Dramaturgia Młodej Polski. Pro?ba monografii dramatu z lat 1890-1918,
Warszawa. Goethe, Johann Wolfgang von (1994-2002): Werke, Kommentare und Register (Hamburger Ausgabe in 14
Ba?nden), hgg. von Erich Trunz, Mu?nchen. Bd. 9, S. 141. Kaczmarek, Wojciech (1999): Złamane piecze?cie ksie?gi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski,
Lublin. Krzysztofik, Małgorzata (2003): Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksia?g Starego
Testamentu, Krako?w. Löw, Ryszard (1989): Wyspiański po hebrajsku. In: Magazyn kulturalny (Kraków), Bd. 24 (April 1989), S. 21-22. Mickiewicz, Adam (1849): Les Slaves, Paris. Juliana Moers z Poradowa (= Elżbieta z Rulikowskich Grzymała-Bośniacka) (1937): Pisma, Warszawa. Odyniec, Antoni Edward (1961): Listy z podróży, hgg. von Marian Toporowski, Warszawa. Sinko,Tadeusz (1927): Wyspiańki w żargonie. In: Czas (Kraków), Bd. 18, S. 2. Słowacki, Juliusz (1952): Dzieła wszystkie, hgg. von Juliusz Kleiner, Wrocław. Szczepanowski, Stanisław (1907): Myśli o odrodzeniu narodowem, Lwow. Wyspiański, Stanisław (1958): Dzieła zebrane. hgg. von Leon Płoszewski, Kraków. — Listy zebrane (1994), hgg. von Leon Płoszewski, Kraków. — Daniel (1922), übersetzt von Daniel Leibel, Varshe.
29 Dronke (2008), S. 142.