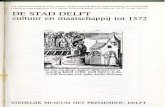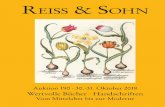Schriftmetrologie des Keils. Dreidimensionale Analyse von Keileindrücken und Handschriften
Peyrot 2012: Einleitung zu Peter Stumpfs „Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften“
Transcript of Peyrot 2012: Einleitung zu Peter Stumpfs „Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften“
Tocharian and
Indo-European Studies
Founded by Jörundur Hilmarsson
Edited by
Jens Elmegård Rasmussen (executive editor)
Michaël Peyrot · Georges-Jean Pinault
Thomas Olander (assistant editor)
Volume 13 · 2012
Museum Tusculanum Press University of Copenhagen
2012
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Tocharian and Indo-European Studies, Vol. 13 © Museum Tusculanum Press and the authors, 2012 ISSN 1012 9286 ISBN 978 87 635 3964 7 Published with support from: Roots of Europe – Language, Culture, and Migrations, University of
Copenhagen
Museum Tusculanum Press Njalsgade 126 DK 2300 Copenhagen S www.mtp.dk
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Contents
Hans Henrich hock
In memoriam Werner Winter 1
the editors
Werner Winter: A bibliographical note 5
Douglas Q. Adams
Another look at three Kuci-Prākrit−Tocharian B bilinguals 7
Douglas Q. Adams
Shedding light on *leuk- in Tocharian and Hittite and the wider im-plications of reconstructing its Indo-European morphology 21
gerd carling
Development of form and function in a case system with layers: Tocharian and Romani compared 57
ching chao-jung & ogihara hirotoshi
On a Tocharian B monastic account kept in the Otani Collection 77
olav hackstein
The evolution of finite complementation in Tocharian 117
Frederik Kortlandt
The Tocharian s-present 149
Melanie Malzahn
Position matters: The placement of clitics in metrical texts of Tocharian B 153
Ogihara Hirotoshi
A fragment of the Bhikṣu-prātimokṣasūtra in Tocharian B 163
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Michaël Peyrot
The Tocharian A match of the Tocharian B obl.sg. -ai 181
Georges-Jean Pinault
La parfaite générosité du roi Ambara (PK NS 32) 221
michaël Peyrot
Einleitung zu Peter Stumpfs „Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften“ 245
† Peter Stumpf
Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften 259
Review
Melanie Malzahn (ed.), Instrumenta Tocharica. (Reviewed by Doug hitch) 277
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Einleitung zu Peter Stumpfs „Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften“1
Michaël Peyrot
Im umfangreichen Nachlass von Werner Winter fand sich unter ande-rem auch ein „Dossier Stumpf “, das neben mehreren Sonderdrucken, die Stumpf an Winter geschickt hatte, und Briefen aus dem Briefwechsel zwischen Stumpf und Winter, auch ein Exemplar von Stumpfs Habilitationsschrift Die Erscheinungsformen des Westtocharischen ent-hält. Bekanntlich hat Winter diese Habilitationsschrift, höchstwahr-scheinlich von Jörundur Hilmarsson dazu angeregt, 1990 mit einem kurzen Vorwort herausgegeben, dreizehn Jahre nach dem frühen Tod des Verfassers.2 Soweit feststellbar, ist diese Ausgabe mit der ursprüng-lichen Habilitationsschrift identisch − abgesehen von drei Anhängen, die vollständig weggelassen wurden. Zweifelsfrei ist Hilmarsson und Winter in erster Linie dafür zu danken, Stumpfs Habilitationsschrift und damit einen Meilenstein in der Erforschung des Tocharischen, ver-gleichbar mit ihrer Vorgängerarbeit „A linguistic classification of “To-charian” B texts“,3 allgemein zugänglich gemacht zu haben. Allerdings
1 Ich danke Frau Guðrún Þórhallsdóttir (Reykjavík) und Herrn Stefan Zim-
mer (Bonn) für ihre Auskünfte und Frau Kristin Meier (Berlin) für ihr Kor-rekturlesen. Die Verantwortung für den Inhalt trage ich selbstverständlich allein.
2 Stumpf (1990). Im Folgenden zitiere ich, wenn nicht anders gekennzeich-net, immer nach dieser Ausgabe.
3 Werner Winter, Journal of the American Oriental Society 75 (1955), 216−225.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
246 michaël peyrot
wäre es hilfreich gewesen, das Weglassen dieser drei Anhänge zumindest zu erwähnen, da sie eine Fülle an Formen und Belegstellen enthalten, ohne die der Haupttext merkwürdig unfundiert erscheint.4 Eine vollständige Ausgabe der fehlenden Anhänge ist an dieser Stelle leider nicht möglich, „Anhang II: Analysen stufentypischer Hand-schriften“ will ich aber wiedergeben, weil dieser meines Erachtens nicht nur belegt, dass Stumpf durchaus eine geduldige Detailarbeit geleistet hat,5 sondern darüber hinaus auch heute noch durch die darin enthalte-nen akribischen Analysen von großem Nutzen ist.
Diesem Anhang lasse ich eine kurze, auf den Briefen basierende Chronologie der Kontakte zwischen Stumpf und Winter sowie eine knappe Einleitung zum Anhang selbst vorangehen.
Stumpf und Winter
Peter Stumpf wurde am 26. Januar 1940 in Berlin geboren und besuchte ab 1946 die Karl-Liebknecht-Schule in Blankenfelde bei Berlin.6 1953 zog er mit seiner Mutter nach Frankfurt am Main, wo er die Freiherr-vom-Stein-Schule besuchte. Ab 1959 studierte er an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität unter anderem Indogermanistik und In-dologie, bis er am 3. Juli 1968 mit der Dissertation Der Gebrauch der 4 Dies war auch ein Kritikpunkt von mir: „A serious shortcoming of Stumpf ’s
book is that it does not contain a systematic overview of the text types of the manuscripts he discussed.“ (Variation and change in Tocharian B. (Leiden Studies in Indo-European 15.) Amsterdam / New York: Rodopi, 2008, S. 25). Eine solche Übersicht findet sich jedoch in der Habilitationsschrift als „Anhang I: Klassifikation der wichtigsten westtoch. Handschriften, A: Liste der wichtigsten Handschriften“ (Habil. S. 181−186).
5 In seinem Vorwort schreibt Winter (S. 13): „so wird abzuwarten sein, ob es in geduldiger Detailarbeit gelingen wird, die noch bestehenden Unsicher-heiten zu beseitigen.“
6 Die biographischen Angaben in diesem Absatz habe ich dem Lebenslauf entnommen, der zu den Unterlagen für seine Habilitierung in Kiel gehörte.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 247
Demonstrativ-Pronomina im Tocharischen bei Werner Thomas promo-vierte. Die Dissertation wurde als „sehr gut“ (opus valde laudabile), die mündliche Prüfung als „ausgezeichnet“ (summa cum laude) bewertet. Ab April 1965 war er unter anderem als wissenschaftliche Hilfskraft, wissenschaftlicher Assistent und Dozent an der Frankfurter Universität tätig und ab Oktober 1972 als Dozent im Beamtenverhältnis auf Widerruf.
Der Kontakt zwischen Peter Stumpf und Werner Winter kam im Juni 1975 zustande, als Stumpf brieflich auf Winters Rezension zur Ausgabe seiner Dissertation reagierte.7 Als Beilagen enthielt dieser erste Brief8 Kopien von zwei weiteren Aufsätzen, die die Demonstrativpronomina betreffen.9 Besonders interessant ist in diesem Brief folgender Passus:
Den beiden Aufsätzen ist zu entnehmen, daß mich, jedenfalls soweit es das Tocharische überhaupt betrifft, die westtoch. Dialekte intensiv beschäftigen. Dabei hatte ich ursprünglich sogar vorgehabt, nichts mehr über das To-charische zu schreiben, − und zwar deshalb, weil ich die nicht unbeträcht-lichen Schwierigkeiten vermeiden wollte, die es macht, hier in Frankfurt Nicht-Eingesegnetes oder gar Abweichendes zu äußern. Andererseits macht es mir einfach zu viel Spaß, und ich habe auch schon zu viel Arbeit darauf verwendet, als daß ich hinter dem Busch halten könnte.
Weil Stumpf bald darauf in der Nähe von Kiel in Urlaub fahren wollte, schlug er vor, Winter dort zu besuchen, der seinerseits Stumpf für die Manuskripte dankte und ihn zu sich nach Hause einlud.10
Fast ein halbes Jahr später schrieb Stumpf Winter wieder, diesmal mit einem Sonderdruck seines Orbis Artikels (1974) und dem Manu-skript seines Aufsatzes über die lateinischen Demonstrativpronomina
7 Stumpf (1971). Von Winter rezensiert in Kratylos 18 (1973[1975]): 136−138,
später zusätzlich in der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesell-schaft 126 (1976): 179−181.
8 Datiert den 17. Juni 1975. 9 Es handelt sich hier ohne Zweifel um Stumpf (1974) und (1976a). 10 Brief vom 22. Juni 1975.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
248 michaël peyrot
(1976b) als Beilagen.11 Zugleich bat er Winter, ein Gutachten zu schrei-ben, um seinen sechsjährigen Dozentenposten bis zum Ende der Lauf-zeit behalten zu können:
Aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils über die Gleichartigkeit der Hoch-schullehrer werden alle Dozenten hessischer Machart, die ursprünglich Hochschullehrer waren und zu denen auch ich gehöre, einer erneuten Überprüfung unterzogen. Fällt diese Prüfung positiv aus, kehren sie in ihren alten Stand zurück, ist dem nicht so, werden sie als ‚Besitzständler‘ in der Gruppe der wissenschaftl. Bediensteten geführt und sitzen auf einer auslaufenden Stelle. Mit allen Konsequenzen, die das hat.
Obwohl Thomas in diesem Brief nicht namentlich genannt wird, hatte Stumpf anscheinend schon zu dieser Zeit persönliche Probleme mit ihm:
Nun ist ein solches Verfahren eben auch eine gute Möglichkeit, jemandem eins auszuwischen, ja jemanden abzuschießen. Denn daß ausbleibender Erfolg später als Argument gegen einen angeführt wird, z.B. wenn es um Stellen usw. geht, daran kann leider schon jetzt kein Zweifel sein. Ich könnte da einen ganzen Schauerroman schreiben, über den ich − da eine der Hauptpersonen − leider nicht einmal lachen könnte.
Trotz des Gutachtens, das Winter erstellte, konnte Stumpf seine ur-sprüngliche Stelle nicht behalten:12
Es hat gar kein Bewerbungsverfahren stattgefunden. Kurz nachdem ich Anfang Dezember meinen Antrag eingereicht hatte, stellte sich heraus, daß dies zu spät geschehen war, weil bis zum Jahresende nicht nur der Fach-bereich meinen Antrag behandelt und befürwortet haben mußte, sondern auch der Senat.
Derselbe Brief schließt mit einer Mitteilung über seine Arbeit an den westtocharischen Dialekten, die immer weiter voranschreitet:
11 Brief vom 12. November 1975. 12 Brief von Stumpf an Winter vom 9. Februar 1976.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 249
ich hatte eigentlich gehofft, daß ich noch im Januar einen Aufsatz über westtoch. Dialekte beenden könnte, den ich dann gleich beilegen wollte. Das hat leider nicht geklappt, und ich habe im Augenblick alle Hände voll zu tun, die Sache am Ausufern zu hindern. Ich glaube jedoch, daß ich zu-mindest einige interessante Entdeckungen gemacht habe, die ich Ihnen dann gerne mit der Bitte um Ihr kritisches Urteil zuschicken würde.
Diese Arbeit stellte Stumpf dann schließlich im Herbst 1976 fertig:13
Wie schon vor einem Jahr angekündigt, möchte ich Ihnen meinen Aufsatz übers Westtoch. schicken, − es ist nur leider inzwischen ein Buch daraus geworden.
Der Brief fährt mit einer Zusammenfassung von Stumpfs Theorie fort, dass Winters Dialekte tatsächlich unterschiedliche Entwicklungsstufen desselben Dialekts repräsentieren und als Hoch- und Umgangssprache nebeneinander existierten.
Dieses Zusammen [der Sprachstufen, Hrsg.] ist mir so plastisch, daß mich der noch verbleibende Rest an Vernunft beschleicht, mir möchte irgendwo ein ganz grober und grauenhafter Schnitzer unterlaufen sein. Immerhin: Ich sehe sie geradezu vor mir, die hageren und die dicken Mönche von Kuča, wie sie vormittags ihren Mangel an Getreide verwalteten und nachmittags noch ein Stündchen Udānālaṅkāra aufs Papier warfen. Sah der Vorgesetzte gerade mal nicht hin, konnte es jedoch gelegentlich auch passieren, daß so ein tumber Novize ein kleines Liebeslied abschrieb, − auf ein Stück Papier, das er von einer Rolle für die Buchhaltung abgezwackt hatte [= B496]. Nur: Ertappt setzt es natürlich Strafe, − Abschreiben bzw. nach dem Gedächtnis Nachschreiben von mehr oder weniger einschlägigen Vinaya-Passagen gegen allerlei sündige Gedanken und Taten.
Der fröhliche Ton vom Anfang des Briefs schlägt um, wenn er sich seinem Verhältnis zu Thomas hinwendet:
Was meine universitären Verhältnisse angeht, so könnte es im Augenblick nicht trauriger um sie bestellt sein. Das Manuskript ist ja auch das Ergebnis eines Versuchs, mich zu habilitieren. Leider stellen sich diesem Versuch hier
13 Brief von Stumpf an Winter vom 10. Oktober 1976.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
250 michaël peyrot
in Frankfurt immer wieder neue Hindernisse in den Weg, von denen man beim besten Willen nicht sagen kann, sie hätten einen sachlichen Hintergrund. So weigert sich Herr Thomas unter immer neuen Aus-flüchten, mit mir über meine Sachen (und natürlich ihre Verwertung bei einer Habilitation) überhaupt zu sprechen, obwohl es ursprünglich fest ver-abredet war. Der Widerwille, von meinen Sachen Kenntnis zu nehmen, scheint außerordentlich. Aber sachliche Dinge stehen sowieso im Hintergrund. Der gravierendste Vorwurf gegen mich, wenn man einmal die Zahl der ‘Rückläufe’ betrachtet, scheint zu sein, ich hätte Frau Thomas einmal sehenden Auges absichtlich nicht gegrüßt, − ein Vorwurf, der ebenso absurd und unsachlich wie auch schlicht unwahr ist. Mit Sachen dieses Kalibers werde ich nun schon seit geraumer Zeit konfrontiert.
In seiner Antwort führt Winter eine Reihe von Problemen mit Stumpfs Theorie sowie Gegenargumente an, von denen die meisten in gleicher Form in seinem Vorwort zur 1990er Ausgabe wiederkehren. Interes-santer als das Inhaltliche sind jedoch seine beiden großherzigen Ange-bote, Stumpf bei sich in Kiel habilitieren zu lassen und seine Habilita-tionsschrift bei Mouton zu veröffentlichen:14
Vielleicht sollten Sie eine externe Habilitation ausserhalb Frankfurts erwägen? Ich stehe da gern als Pate zur Verfügung. Allerdings fände ich es in Ihrem Interesse nicht gut, wenn Sie der tocharologischen Dissertation eine Habilitationsschrift des gleichen Genres folgen liessen − Sie müssen ja die Fehler von Thomas nicht wiederholen. Das heisst nun aber nicht, dass Ihr Anti-Winter-Buch nun nicht ver-öffentlicht werden sollte. Vielmehr möchte ich Ihnen vorschlagen, dass ich es − in der jetzigen oder einer durch Diskussionen noch veränderten Form − in meine neue Reihe Trends in linguistics: Studies and monographs, deren erste Bände jetzt bei Mouton herausgekommen sind, aufnehme.
Leider wurden innerhalb kurzer Zeit Stumpfs schlimme Befürchtungen wahr: Am 11. Dezember 1976 ließ Thomas dem Dekan des zuständigen Fachbereichs 11 ein negatives Gutachten über Stumpf zukommen. In
14 Brief von Winter an Stumpf vom 21. Oktober 1976.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 251
diesem zehnseitigen Schreiben bemängelt Thomas vor allem, dass Stumpfs Arbeit Die Erscheinungsformen des Westtocharischen unfundiert sei und deren Teiluntersuchungen jede Beweiskraft fehle. Obwohl manches für einen Wissenschaftler eines anderen Fachs möglicherweise überzeugend wirkte, waren viele seiner Argumente unangebracht. So meint er zum Beispiel, dass auch das Pariser und Londoner Material hätte ausgewertet werden müssen und eine Untersuchung der Paläogra-phie erforderlich gewesen wäre − Fragen, denen Stumpf in dieser Zeit unmöglich nachgehen konnte. In Thomas’ eigenen Worten:15
Ganz abgesehen davon, daß sie wiederum aus dem Bereich des Tocha-rischen stammt, läßt sie schon das vermissen, was ich selbst für eine Disser-tation für unabdingbar halte, nämlich eine ganz sorgfältige Durcharbeitung des gesamten Materials. Die Tatsache, das Herr Stumpf trotz allem immer wieder auf allgemeinsprachliche Gebiete ausweicht, kann ich mir in der Tat nur so erklären, daß sich bei Beschränkung auf allgemeinere Aussagen eben ohne die sonst notwendigen umfangreicheren Belegsammlungen auskom-men, rascher etwas publizieren und somit das Versäumte schneller nach-holen läßt.
Der Schluss des Gutachtens lässt keinen Zweifel mehr zu:
Während ich mich hinsichtlich der pädagogischen Eignung von Herrn Stumpf eines Urteils enthalten muß, weil ich darüber nicht aus eigener Er-fahrung zu berichten weiß, halte ich Herrn Stumpf auf Grund der vorlie-genden Arbeiten und Manuskripte für das Fach Indogermanistische Sprachwissenschaft keineswegs für so ausgewiesen, daß er die Bedingungen erfüllt, die die notwendige Voraussetzung für eine Dauerstelle als Professor bilden.
Selbstverständlich war mit diesem Gutachten Stumpfs Karriere in Frankfurt beendet. Das Gutachten wurde vom Dekan am 15. Dezember an den Präsidenten der Frankfurter Universität weitergeleitet, worauf Stumpf am 20. Dezember beim Fachbereich und dem Präsidenten
15 S. 9 des Gutachtens.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
252 michaël peyrot
protestierte und dem Dekan und dem Präsidenten am 25. Januar eine siebzehnseitige Entgegnung auf das Gutachten sandte.
Kurz darauf begannen Stumpf und Winter mit der Umhabilitation nach Kiel. Am 31. Januar 1977 schickte Stumpf die benötigten Unter-lagen an Winter, nebst einem Brief mit der folgenden Passage:16
Ich möchte Ihnen noch einmal herzlich für Ihre großzügige Hilfe danken, die so wesentlich verschieden ist von dem, was ich bisher erlebt habe.
Schon am 9. Februar 1977 schlug Winter bei einer Sitzung des zuständi-gen Fachbereichs der Kieler Universität eine Habilitationskommission vor, am 28. März ging Stumpfs Antrag auf Zulassung zur Habilitation beim Fachbereich ein und am 4. Mai wurden der Antrag und die Kom-mission gebilligt.
Am 26. Mai erlag Peter Stumpf jedoch einem plötzlichen Herztod − dramatischer hätte es kaum kommen können, so kurz vor seiner bevor-stehenden Habilitation in Kiel.
Horst Dieter Schlosser formulierte es so:17
Bei allen mitunter völlig unbegreiflichen Widerständen, die Stumpf zu überwinden versuchte, war es für ihn eine verdiente Genugtuung, daß die Anregung zur Habilitation von auswärtigen Fachkreisen kam. Doch Stumpf war wohl durch die jahrelangen Belastungen tiefer getroffen, als es seine kräftige Gestalt den Außenstehenden ahnen ließ. Ein Herztod signalisiert häufig mehr als nur einen organischen Defekt.
Am 5. Juli 1977 dankte schließlich seine Witwe Winter für alles, was er für Stumpf getan und bedeutet hatte.18 Obwohl es außer dem Beitrag von Herrn Schlosser17 keine Nachrufe gab, sei an dieser Stelle erwähnt, dass Stefan Zimmers Artikel „Tod und Sterben im Ṛgveda“ Stumpf gewidmet ist.19
16 Brief von Stumpf an Winter vom 31. Januar 1977. 17 “Peter Stumpf †”. UNI-REPORT Frankfurt, Jahrgang 10, Nr. 9, 15. Juni 1977. 18 Wahrscheinlich hat sie Winter hierbei auch Stumpfs Nachlass übergeben. 19 Indo-Iranian Journal 28 (1985): 191−199.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 253
Schriftenverzeichnis Stumpf
Obwohl die meisten Arbeiten von Stumpf das Tocharische betreffen und so den meisten Lesern bekannt sein werden, gebe ich hier sein Schrif-tenverzeichnis wieder, insoweit es mir, nicht zuletzt durch die Unterlagen, die er Winter für seine Umhabilitation nach Kiel geschickt hat, bekannt ist. 1971a Der Gebrauch der Demonstrativ-Pronomina im Tocharischen.
Wiesbaden: Harrassowitz.20 1971b „Der vokalische Sandhi im Tocharischen“. Zeitschrift für Verglei-
chende Sprachforschung 85: 96−133. 1974 „Der Plural der westtocharischen Demonstrativ-Pronomina − zu-
gleich ein Beitrag zur Dialekt-Gliederung des Westtocharischen“. Orbis 23: 404−428.
1976a „Westtocharisch se-seṃ: Zwei Paradigmen oder nur eines?“. Zeit-schrift für Vergleichende Sprachforschung 90: 114−127.
1976b „System und Gebrauch, Zu den lateinischen Demonstrativ-Pro-nomina“, Indogermanische Forschungen 81: 100−135.
1990 Die Erscheinungsformen des Westtocharischen, Ihre Beziehungen zueinander und ihre Funktionen. (Tocharian and Indo-European Supplementary Series 2.) Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands.
Ms.a Die Erscheinungsformen des Westtocharischen, Ihre Beziehungen zueinander und ihre Funktionen. (208 Seiten Schreibmaschinen-manuskript)
Ms.b Westtocharischer Index (über 40.000 Stellen, Auflistung nach Handschriften; über 600 Seiten Schreibmaschinenmanuskript)
20 Besprechungen (nebst denen von Winter, die in Fn. 7 genannt sind): J.P.
Levet, Bulletin de la Société Linguistique 69 (1974): 115−117; Pavel Poucha, Archív Orientální 43 (1975): 365−366; Albert J. Van Windekens, Orbis 24 (1975): 226−228.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
254 michaël peyrot
Ms.c „Zum Problem des sog. Transports der Negation“. (28 Seiten Schreibmaschinenmanuskript)21
Ms.d „Initiative und reaktive Sätze − Zur Theorie der Sprechakte“. (52 Seiten Schreibmaschinenmanuskript)
Ms.e „Behaupten und Mitteilen“. (22 Seiten Schreibmaschinenmanu-skript)
Stumpfs Habilitation
Abgesehen von den fehlenden Anhängen in der Ausgabe und dem − selbstverständlich − fehlenden Vorwort von Winter in der Habilitations-schrift gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Ver-sionen. Der auffälligste Unterschied ist wohl, dass die Anmerkungen, die in der Habilitationsschrift als Endnoten erst nach dem Text gegeben werden, in der Ausgabe als Fußnoten verarbeitet sind. Ferner wurden einige wenige Schreibfehler korrigiert und fehlt zum Beispiel zwischen den Fußnoten 77 und 78 in Abschnitt 3 (S. 138) eine Fußnote der Habili-tationsschrift, deren Nummer jedoch im Haupttext versehentlich ausgelassen wurde.
Vermutlich ist das von mir benutzte Exemplar ein anderes als das, was für die Ausgabe verwendet wurde. Im Exemplar aus Winters Nach-
21 In seinen Unterlagen gibt Stumpf an, dass dieser Artikel von Orbis akzep-
tiert worden sei und im Dezember 1976 in Band 25 erscheinen sollte. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein Missverständnis. Der Artikel wird zwar in einer Liste (Orbis 24 (1975), 543−546) für einen der folgenden Bände (25 und 26) angekündigt, dort jedoch erst am Ende. Die Zeitschrift hatte damals einen großen Rückstand und die Titel, die unmittelbar vor Stumpfs Artikel aufgelistet werden, sind teilweise erst mit erheblicher Verspätung erschienen: Keller, 26: 244−252; Read, 27: 163−175; Fontanella de Weinberg, 27: 215−247; Fellman, 27: 315−316; Agahi, 27: 329−343; Pedersen − Billiard, 28: 45−62; Billiard − Pedersen, 28: 223−241. Soweit ich dem nachgehen konnte, wurde Stumpfs Artikel dagegen nie publiziert.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 255
lass ist nämlich in Winters Schrift vermerkt, dass yāmwā, yāmwa ‚ich tat‘ (S. 79) ein „ghost“ ist (Stumpf hat offenbar Tocharisch B yamaṣṣawa ‚ich tat‘, yāmuwa, yāmwa ‚getan‘ (Fem.Pl.) und Tocharisch A yāmwā ‚ich tat‘ durcheinander gebracht), in der Ausgabe wird dieser Fehler jedoch unverändert wiedergegeben. Weil Stumpfs Witwe seinen Nach-lass Winter überlassen hat, vermute ich, dass Winter ein Exemplar, z.B. das von Stumpf selbst, Hilmarsson mitgegeben und sein eigenes behalten hat.
Es ist auch möglich, dass es eine frühere Fassung der Habilitations-schrift gab, in der die drei Anhänge fehlen. In den Unterlagen für seine Umhabilitation nach Kiel nämlich gibt Stumpf die Seitenzahl seiner Ha-bilitationsschrift mit „177“ an, − und das entspricht genau der Länge des Haupttextes ohne die Anhänge auf den Seiten 178−208. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass auf die Anhänge nur im Inhaltsverzeichnis, nicht aber im Haupttext, verwiesen wird.22 Aufgrund der ansonsten völligen Übereinstimmungen von Nachlassexemplar und Ausgabe sehe ich jedoch keinen Grund anzunehmen, dass das von Hilmarsson für die Ausgabe verwendete Exemplar vom Nachlassexemplar abweicht. Inhalt Seiten in der Habil. AusgabeInhalt 2−4 7−9Vorwort von Werner Winter fehlt 11−140. [Einleitung] 5−9 15−191. Die Prinzipien der Arbeit 10−47 21−612. Die westtocharischen Varianten 48−89 63−1093. Die Bedeutung der inkonsequenten Schrei-
bungen für die Bewertung der Entwicklung des Westtoch.
90−124 111−147
22 Es fällt zum Beispiel auf, dass es bei der Besprechung der beiden Varianten
ñäś und ñiś (Habil. S. 115−116 mit Anmerkungen auf S. 161 = Ausgabe S. 138−139) keinen Verweis auf die Belegsammlung in Anhang III (Habil. S. 205) gibt.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
256 michaël peyrot
Inhalt Seiten in der Habil. Ausgabe4. Der geographische und zeitliche Rahmen des
Westtocharischen125−132 149−158
5. Zusammenfassung 133−137 159−162Anmerkungen zu Abschnitt 0. 138 Fußnoten Anmerkungen zu Abschnitt 1. 138−146 Fußnoten Anmerkungen zu Abschnitt 2. 146−155 Fußnoten Anmerkungen zu Abschnitt 3. 155−163 Fußnoten Anmerkungen zu Abschnitt 4. 163−167 Fußnoten Anmerkungen zu Abschnitt 5. 167 Fußnoten Literaturverzeichnis 168−177 163−170Anhänge − Vorbemerkungen 178−180 fehltAnhang I: Klassifikation der wichtigsten wtoch.
Handschriften181−187 fehlt
Anhang II: Analysen stufentypischer Hand-schriften
188−204 fehlt
Anhang III: Index bemerkenswerter Wörter und Formen
205−208 fehlt
Die V-Regeln
Obwohl der im Folgenden (ab S. 259) wiedergegebene Appendix ohne weiteres als Ergänzung zur Ausgabe von Stumpfs Habilitationsschrift zu verstehen ist, scheint es mir nützlich, die von ihm verwendeten „V-Regeln“ an dieser Stelle kurz zu wiederholen. In der Tabelle sind die entsprechenden Seitenzahlen der Ausgabe („Stumpf “), meines „Varia-tion and change“ („Peyrot“, siehe Fn. 4) sowie die Nummern der „Ab-weichungen“ in Winters „A linguistic classification“ („Winter“, siehe Fn. 3) angegeben.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Stumpfs „Analysen stufentypischer Handschriften“ 257
V-Regel Stumpf Winter Peyrot2 -K1 + t # → -K1 65 13−15 673 -śc # → -ś # 65 703´ P23 V 3 im Allativ 65 704a P ṣp → ṣ ‚und‘ 65 674c P [samp] → [sam] 65 675a -ṃts → -ṃs 66 16 695b -ts → -s 66 846 -rm → -räm 66 577a -śc- → -ś(ś)- 67 708 -sts- → -ss- 67 12 869 -ts- → -s- 67 12 8710 -ṣlñe → -ṣñe 68 21 6411 -lñe → -ñe 68 21 6412 śtw- → św- 68 25 6313a kuse → se 68 7113b kuce → ce 68 7114 ä → i/ _Kpal. usw. 69 1 5515 i → ä/ _K−pal. usw. 70 5516 -ni- → -ñi- 70 9017a -auN- → -aumN-, -omN- 71 10 5217b -auN # → -aum, -om 71 10 52Sonst. Ass., z.B. śaktālye → śattaly- 72 S. 219a 17318a -c # → -ś # 72 17 7718b -ñc # → -ñś, -ṃś, -ś 72 18 70, 7718c 18a trifft zu, 18b nicht 7219a -p- → -w- 73 24 8819b Liqu. + -p- → Liqu. + -w- 73 24 8819c -w- → -p- 73 8820 Akzentregeln für ā, a, ä 79 2−5 3321a (-)eu- → (-)au- 79 8 4121b -ou → -au 79 9 50 23 Ein „P“ bedeutet „Pilotvariante“, siehe S. 65 der Ausgabe.
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
258 michaël peyrot
V-Regel Stumpf Winter Peyrot21 Ausl. -eu → -au 80 8 4122 -ṣ + K → -ś + K 83 19 7223 -e- → -i- 124 59 -äñ / -i 91 120 -llona / -lyana 94 S. 224b 117 Pl. d. Dem.-Pron. 94 124 se / seṃ 96 121 taisa usw. 101 171 peri 104 162 krui / kwri 106 177 ṣai / ṣey 107 58 cai / cey 107 58 yai / yey 107 58
Universität Wien Institut für Sprachwissenschaft
Sensengasse 3a A-1090 Wien
Austria
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Anhang II: Analysen stufentypischer Handschriften
† Peter Stumpf
Herausgegeben von Michaël Peyrot
Als Beispiele für die verschiedenen Erscheinungsformen, in denen uns das Westtoch. aus den Handschriften entgegentritt, sollen hier 10 Hand-schriften nach den in ihnen enthaltenen Merkmalen analysiert werden. Diese Handschriften wurden so ausgewählt, daß sie weder zu frag-mentarisch für eine sichere Klassifizierung ihres sprachlichen Profils sind, noch zu umfangreich für eine vernünftig in den Rahmen dieser Arbeit passende Ausarbeitung.
Es handelt sich um die Handschriften
B 338 − 344 MQ als Beleg für Sprachform I A B 388 − 390 MQR als Beleg für die Sprachform I B B 220 − 223 MQR als Beleg für den Mischtypus I B / I C B 349 − 351 MQR als Beleg für die Sprachform I C B 558 − 562 Š als Beleg für die Sprachform I C B 384 − 387 S als Beleg für die Sprachform I C B 231 − 233 MK als Beleg für den Übergang I C − II L B 415 − 421 M als Beleg für eine II L-Handschrift, die noch stark mit
Formen der Stufe I C durchsetzt ist B 591 S als Beleg für eine Handschrift der Sprachform II L B 459 − 489 MQ als Beleg für die Sprachform II O
Die Auswahl der Handschriften steht zugleich für die Spielbreite der Provenienzen. Wegen der besonderen Bedeutung der Stufe I C wurde aus jedem der drei Fundgebiete je eine Handschrift ausgewählt. Weitere,
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
260 Peter Stumpf
mehr oder weniger vollständige Handschriften-Analysen finden sich auf den Seiten 112f., 114, 115, 117f., 120ff., 158.1
Wegen der besonderen Bedeutung des a-Vokalismus für die Grup-pierung der Handschriften im Bereich I A − I C und den Kontrast der dort einzuordnenden Handschriften mit denen, die als I C und II L + O klassifiziert worden sind, wurden die Belege für (V 20) am Ende des je-weiligen Abschnittes separiert, und zwar bei den drei in dieser Be-ziehung interessanten Handschriften B 338−344, 388−390 und 220−223. Bei den anderen Handschriften würde eine Auflistung einen zugleich bedeutenden und unnötigen Aufwand bedeuten. Belege für (V 20)−jüngerer Zustand werden daher bei diesen Handschriften, da selbstver-ständlich und − bis auf ganz seltene Verschreibungen − überall zu fin-den, nicht aufgeführt.
Um die Belege für (V 20)−älterer Zustand aus den drei zuerst ge-nannten Handschriften zu klassifizieren, habe ich sie mit ihren I C / II−Pendants konfrontiert. Da jedoch auch in I C / II nicht in jedem einzelnen Fall Sicherheit herrscht, mag die eine oder andere Zuordnung diskutabel sein. Ein besonderes Problem stellt sich durch die Tatsache, daß in den Erscheinungsformen I C / II das Graphem /a/ einmal akzen-tuiert sein kann und dann mit unbetontem /ä/ wechselt, zum anderen aber auch unakzentuiert sein und dann mit betontem /ā/ wechseln kann, daß zugleich jedoch nicht in jedem Fall mit Sicherheit Aussagen über die Akzentstelle möglich sind; vgl. hierzu noch oben p. 76ff. Es ergibt sich so die Notwendigkeit, das Vorkommen des Graphems /a/ in den I A− und I B−Texten auf zwei verschiedene I C / II−Gruppen zu be-ziehen, und zwar ‚/a/ in I A + I B wie /á/ (= betont) in I C / II‘ und ‚/a/ wie /ă/ (= unbetont) in I C / II‘. Der Kürze wegen sind schließlich einige praktische Regelungen notwendig gewesen: − Zweifelsfälle können nicht diskutiert werden. Sie werden unter die
Belege eingeordnet, wenn dies aus Gründen der Vollständigkeit rät-lich scheint. So ist für mich kontac (B 477, 2) keineswegs ein unpro-blematischer Beleg für älteren Zustand nach (V 18a), solange dieses
1 Die Seitenzahlen wurden der Ausgabe angepasst (Hrsg.).
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 261
Wort weder morphologisch noch semantisch durchschaubar ist, und auch die Form plyewsa (B 386a4) scheint mir eher Anlaß, auf die Möglichkeit der weiteren Verfeinerung von (V 21a) hinzuweisen, als eine in der zugehörigen Handschrift eigentlich nicht zu erwartende ältere Form zu konstatieren. Auf der anderen Seite konnten gerade solche Formen nicht gut unterschlagen werden. In einigen Fällen wird die Unsicherheit der Einordnung durch ein Fragezeichen ver-deutlicht.
− Lehnwörter aus dem Sanskrit werden wie westtochar. behandelt, ob-wohl sich mit ihnen Probleme eigener Art stellen. Auch hier schien es mir sinnvoller, eher die Problematik eines beigebrachten Belegs in Kauf zu nehmen, als den Vorwurf eines unterschlagenen Belegs zu riskieren.
− Zeigt ein Wort mehrere Merkmale, so wird es mehrfach aufgeführt. Zeigt ein Wort mehrmals dasselbe Merkmal oder ist ein Zweifel über das jeweils gemeinte Merkmal möglich, so wird es durch Unter-streichung markiert.2
− Die Ending -śco (= Allativ-Affix mit beweglichem -o) wird als älter nach (V 7a) eingeordnet. Zur Verteilung dieser Endungsform vgl. p. 141 mit Anm. 87.
− Die beiden Varianten ñäś und ñiś, Pilotformen für (V 14), werden se-pariert.3
− Varianten nach (V 21) und (V 22) (sehr selten sind ältere Belege!) werden wie bei (V 20) nur für die drei Handschriften B 338−344, 388−390 und 220−223 notiert. Ausgenommen hiervon sind die Be-lege für die auch im Sinne von Pilotformen deutbaren Varianten des
2 Die doppelte Unterstreichung in der Habilitationsschrift habe ich beibe-
halten (Hrsg.). 3 Am deutlichsten ist dies in der Tabelle auf S. 275 dieses Bandes; in den Ana-
lysen der einzelnen Handschriften folgen ñäś und ñiś den anderen Belegen auf einer eigenen Zeile. Schließlich gibt es in Anhang III (Hab. S. 205) noch eine vollständige Belegsammlung der beiden Varianten, die hier nicht wiedergegeben ist (Hrsg.).
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
262 Peter Stumpf
Obl.Sg.m. der Demonstrativ-Pronomina der Klasse [su], nämlich ceu und cau, zu denen vgl. pp. 80ff. und 141f. Diese Varianten werden als (V 21 Ausl.) vermerkt.4
Handschrift B 338 − 344 MQ
Belege für älteren Zustand Belege f. jüng. Zustand(V 2) nest (340b4), yäst (338a4, b2, 7,
341a4, 344, 2a), ramt (341b1) −
(V 8) winastsi (338a2), ṣpärkastsi(343a4)
−
(V 9) kautsi (343b5) −(V 12) śtw(ā)ra (343a2) −(V 13) kuse (339b2), kuce (339b5, 6) −(V 14) pūdñäktentse (342a1), pūdñä///
(341a4), mārñäkte (340a6), räṣākäññe (343b4), ñäśäṣc (339a1), śärsāstā (341b7), ñäś (339a1, 3, b5, 6, 340a5, b2, 3, 343b5, 344, 1a, 5, 8)
− −
(V 17b) kaun (340a1) −Sonst. Ass. pärnnā (341b3) −(V 21a) − aiśaumyī (341b4), kaun
(340a1), kautsi (343b5), kraup(ānte) (338b2), naumyeṣṣān� (338a1), śaumo/// (341a6)
(V 21b) kätkowwa (338b3) nwau (342b7) ywau/// (342b7)Ausl. u-
Diphth. neseu (339a3), ceu (338a7, b6, 339a1, b7, 340a7, 341a7)
−
4 In der Habilitationsschrift wird an dieser Stelle der Titel des Anhangs
wiederholt (Hrsg.).
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 263
Belege für älteren Zustand Belege f. jüng. Zustand(V 22) mcuṣkeṃṣc (338b7), ñäśäṣc
(339a1), ṣcīre (341a5)säsuwiśkaṃ (338a3)
-äñ/ -i wesäñ (338b4) −Pl. d. Dem.
Pron. toṃ (338b3, 4, 341b5bis) −
se/ seṃ se (341b3) seṃ (340b6)krui/ kwri krui (338a3, 339a1, 344, 1a) −ṣai/ ṣey ṣai (339b3) ṣeym (344, 8), vgl. p. 107
m. Anm. 137
(V 20) a statt ā in I C / II: akaśäṣṣi (338a2, 6), akṣīt (341a7), kakaccoṣä (338a7),
kaśya/// (338b3), talantäṃ (338a3), nirvvaṃṣṣai (344, 7), päknastar (340b3), yamoṣ (340b5), yśamna (338b7), raittate (339a5), lante (338b6), lyāmastā (344, 6), winastsi (338a2), san (338b4)
ā wie ā in I C / II: kakkārpau (341b1), kāmānte (344, 1a), kārsaṃ (341a6), tākāṃ (339a7), tākoī (338b5, 340a1), tākoycer (338a6), papāṣṣorñe (341a5), pālkau (344, 2b), pāṣa (342a3), mā (339a7, b1, 340b6, 341b5, 344, 4), māka (338a3, 341a5), mākā (341b1, 4), mārñäkte (340a6), ///mālne (342a2), yamäṣṣāwa (344, 5), yāmi (343a1), yāmtsī (339b5), yāmīm(·)e/// (344, 1a), räksāmai (339b6), rämā(t)e (338a5), räṣākäññe (343b4), rittāwa (339b1), lyutsāmai (344, 3), śärsāstā (341b7), śpālmeṃ (339b2), tsäṅkāte (341b2), tsyālpāte (341a2)
ā statt a in I C / II: atyaṃpā (340a3), ākāl (343b6), �āttsāna (338a1), empreṃntsā (341a6), ersāte (338a5), kāmānte (344, 1a), kektsentsā (344, 1b), kloyomāne (338b6), cmelṣṣā/// (344, 2a), ñäktā (341a7), tākāṃ (339a7), tūsā (341b3, 342a3), tetekā (340a1), trīkā (339a4), naumyeṣṣān� (338a1), pärnnā (341b3), pälskā (339a2), pilkosā (340b2), mākā (341b1, 4), yaitkorsā (344, 1a), rā (340b7), rāno (341b5), räkwā (339a6), lātkātai (344, 4), lyāmastā (344, 6), wärkṣältsā (338b7), weñā (339a1, 341a4, 6, 7), śärsāstā (341b7), slemesā (339b4), tsyālpāte (341a2)
a wie ă in I C / II: anaiśai (344, 2b), kakaccoṣä (338a7), kakkārpau (341b1), kārsaṃ (341a6), kka (338b3), talantäṃ (338a3), täṅwsa (338a2), papāṣṣorñe (341a5), pāṣa (342a3), mamaiwarsa (338b2), māka
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
264 Peter Stumpf
(s.a. oben mākā; 338a3, 341a5), mewya (338a3), yamäṣṣāwa (344, 5), yśamna (338b7), ra (338b1), ramt (341b1), räṅka (338a4), rittāwa (339b1), wa (340a5), wat (340a1, 2), wäntärwa (343a2), wärkṣältsa (s.a. oben wärkṣältsā; 338a4), wärsa (338b1), śtw(ā)ra (343a2), ṣärmtsa (338b5), ṣlyämña/// (343a3)
ä statt a in I C / II: kärtse (341a7, b1), kenäṣṣe (339b3), kenäṣṣi (338a2, 6), kerccäpo (343b7), cäṅke(n)e (338b7), ñäktā (341a7), ñäktene (338b7), ñäkti (338b2), takärṣkeṃ (338a7), täṅwsa (338a2), täṅwäṣṣe (339b4), pärnnā (341b3), pälskā (339a2), pälsko (338a5, 7, 341a2, b2, 4), pikwäla (338b3), mänt (339a2, 341a4, b2bis, 6), yamäṣṣāwa (?; 344, 5), yäkne (338b4), räkwā (339a6), räṅka (338a4), rämā(t)e (338a5), läkle (341a6), wäntärwa (343a2), wärsa (338b1), ṣärmtsa (338b5), ṣäle (338a4), ṣäleṃ/// (340a3), ṣkäs (338b4), ṣkäste (342a2), ṣlyämña/// (343a3), sklokäcci (338b2)
a wie á in I C / II: wärpamo (339b2) ä wie ä in I C / II: akaśäṣṣi (338a2, 6), kätkowwa (338b3), käṣṣi (338b5),
talantäṃ (338a3), nesäṃ (341b3), päknastar (340b3), pūdñäktentse (342a1), postäṃ (338a4, 339a6), mārñäkte (340a6), mäkte (338b3), mälṣälle (341a1), miwäṃ (338b4, 5), wäntre (341b3), wäntärwa (343a2), wärttoṣṣi (338a2), wärpamo (339b2), säsuwiśkaṃ (338a3), tsäṅkāte (341b2)
a statt ä in I C / II: pūdñakte (s.a. oben pūdñäktentse; 342b7)
Handschrift B 388 − 390 MQR
Belege für älteren Zustand Belege für jüng. Zustand(V 4c P) somp (389a2, b3) som (389b4, = som no,
kons. Sandhi wie om no für omp no)
(V 7a) kraupeścä (388a7), praściye (388b4), ścirinne (389b2), ścmane (389a5), ścmare (389b2)
−
(V 8) tsälpastsi (388a8) −(V 9) śämtsi (388a7) −(V 13) kus(e) (388b5) −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 265
Belege für älteren Zustand Belege für jüng. Zustand(V 14) cämpyare (388a7),
cärkārene/// (389b7), ñätkatai (389a5), pudñäkt� (388a7), pudñäkteṣṣe (388b8), bramñäkte (388a5), meññäkte (389a8, b2), meñäṣṣa (389a6), yäknāntär (390b7), pudñäkte (388a5, b5, 390a4),
−
ñäś (388b2) −(V 17b) /// kauṃ (388a5) −(V 18a) keuc (388b3) −(V 19b) ṣälypesa (389a7) −(V 21a) keuc (388b3), neuṣä///
(389a2) ///kauṃ (388a5), kraupeścä(388a7), morauśkaṃ (389a7), lalaupau (388a6)
(V 21b) − nätkau (389a3), lalaupau(388a6), l(m)au (388b5)
(V 21 Ausl.) ceu (388b7), cew (390a3) −(V 22) morauśkaṃ (389a7) −cai/ cey cai (388a7, 389a7) −yai/ yey yai (388a5) − (V 20) a statt ā in I C / II: akṣa (389a6), antpi (388b4), cämpyare (388a7),
ñätkatai (389a5), takoy (388b7), pyappyaiṃ (?; 389b7), pratimokṣne (390b4), msame (389b6), yamor (389a2), yamornta (388b2), śamnā (388b2), ścmane (389a5), ścmare (389b2), śwatsi/// (390b3), sa (389b4), saryat� (388a2), soyṣṣa(r)e/// (389a7)
ā wie ā in I C / II: asāṃ (388a2), krāke/// (388a6), cärkārene/// (389b7), tasānte (388b2), tāy (388a4), naṭākä (?; 389b3), nervvāntse (390b5), pā(cer) (389a6), pkāte (388a8), māka (388a8), yäknāntär (390b7),
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
266 Peter Stumpf
wärpāte (390a2), śār (389b7), śārä (388b5), sā (389b3), sāu (388a6), stām (388a3)
ā statt a in I C / II: śamnā (388b2) a wie ă in I C / II: akṣa (389a6), asāṃ (388a2), ka (388a2, 389a6, b7,
390b8), karpa (389b8), kalpänma (388b7), klena (389a1), coksa (388a6), cmema(r) (388b2), ñäkciya (388a4), tasānte (388b2), täṅwsa (390a2), naṭākä (?; 389b3), nanoyträ (389b2), padum (388a6), padu(mne) (388a5), (pä)lskonta (390b7), praściye (388b4), bramñäkte (388a5), māka (388a8), yanne (388b3), yamornta (388b2), ra (388b4), ramt (389a1), ramtä (388a5, 6, 389a3, b2), lalaupau (388a6), witskaṃ (388a2), ṣälypesa (389a7), säkusa (389b5), (tsä)ṅkärwa (388b6)
ä statt a in I C / II: aräñcä/// (389a3), kalpänma (388b7), känte (388b7), käntsa (388b7), kärtse (389a2), cäṅke (389b8), cämelne (390b8), cämpcer (390b4), täṅwäñña (389b5), täṅwäññe (388b6), täṅwsa (390a2), tärkär (388a3, b4), tällästrä (389b4), tälle (389b4), pärso (389b3), pälka (389a4), läcä (388a3), wälo (389a6), vidyäntse (388b3), śämtsi (388a7), ṣäñ (388b2), ṣärmä (390b5), ṣälypesa (389a7), säkusa (389b5), (tsä)ṅkärwa (388b6)
a wie á in I C / II: Kein Beleg ä wie ä in I C / II: täṅwäñña (389b5), täṅwäññe (388b6), tärkär (388a3,
b4), tärkoṣ (390a4), tällästrä (389b4), nätkau (389a3), pudñäkt� (388a7), pudñäkte (388a5, b5, 390a4), pudñäkteṣṣe (388b8), bramñäkte (388a5), mäkci (388a2, 389b7), mäkte (389b8), mänt (388b3, 6, 8), meñäṣṣa (389a6), meññäkte (389a8, b2), yäknāntär (390b7), räddhi (388b3), läkutsetse (388a3), wärpāte (390a2)
a statt ä in I C / II: Kein Beleg
Handschrift B 220 − 223 MQR
Belege für ält. Zustand Belege für jüng. Zustand(V 2) kest (220b1) −(V 3) − āś (220a5)(V 3´ P) riśc (221a2), lkātsiśc
(221a4)−
(V 4aP) ṣp (220a5) −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 267
Belege für ält. Zustand Belege für jüng. Zustand(V 5a) �ālyeṅkäṃts (220a2),
ceṃts (220a4), preteṃts (220b1), (ma)hārtteṃts (221a4), läklentaṃts (220a5), wnolmeṃts (220b4)
−
(V5a o. b) lwās(a)ts (220b1) −(V 8) tsalpästsi (220b2) −(V 9) naktsi (220a2), yoktsi
(220a4), lkātsi (220b5), lkātsiśc (221a4)
−
(V 11) nuwalñe (222b4), yātalñe (222b2), laitalñe (220b2)
−
(V 12) śtwāra (221b3) −(V 13) kuse (220b2) −(V 14) cärkāsta (221a5),
yänmaskeṃ (221b5), snai-yärm (220a4), ñäś (220a4)
ñiś (222b5)
(V 18a) karāntec (221b3), kauc(220a5), m·āntec (221b2)
−
(V 18b) kreñc (221b5) −(V 19a) snai-yparwece (221b3) −(V 21a) − aṅklautk· − (222a1),
kakraupauwa (221b2), kaklautkaṣ (221b5), kauc (220a5), nauṣ (220a3), palauna (221b1), śaul (220a4bis), śaulanma (220b3)
(V 21b) kakraupauwa (221b2)(V 21 Ausl.) ceu (220a2) tākau (220a2), skāyau
(220b2)(V 22) lykaśke (220b4) −krui/ kwri krui (220b2, 5) −-llona/ -lyana empelona (220a1) −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
268 Peter Stumpf
Belege für ält. Zustand Belege für jüng. ZustandPl. d. Dem.
Pron. toṃ (220b1, 2) −
(V 20) a statt ā in I C / II: prakkre (220b3), prakreṃ (222a2), yänmaskeṃ
(221b5) ā wie ā in I C / II: akāl(km)eṃ (222b5), āś (220a5), āsta (220b4), kakātai
(221a2), karāntec (221b3), kulātsi (222b3), krākesa (221b4), krämpā/// (223, 2b), klātai/// (221a1), cärkāsta (221a5), ñāwa (220a2), takāreñ (220a3), tākau (220a2), tāsātai (221b1), tkātärñ (220a3), nervānṣai (221a2), papyākoṣ (220a5), pātärñ (220a3), pkāt� (220a1), pkāte (220a2), pwārṣṣe (220b1), bodhisātveṃ (223, 1a), bhavāggär (220a5), (ma)hārtteṃts (221a4), mā (220b5), yātalñe (222b2), yāmu (220b2), yāmṣate (220b3), yāmṣare (220b2), ysāra (220a4), lkāskeṃ (221b4), lkātsi (220b5), lkātsiśc (221a4), lyakāsta (223, 1b), lyāka (220a5), lwās(a)ts (220b1), wawārp· (221b1), wawālaṣ (221b4), wärpāte (220a1), wsāwa (220a4), wsāsta (221a4), śāmna/// (220a3), śtwāra (221b3), saṃsā/// (221b3), skāyau (220b2), (ts)yālpatai (223, 2a)
ā statt a in I C / II: tāsātai (221b1) a wie ă in I C / II: akāl(km)eṃ (222b5), (aknā)tsaññe (221a3), aṅklautk·
(222a1), ara(ñc) (222b5), aräñc(ä)ṣṣ(e) (221a1), aviśo (220a5), �āsaṃkhyainta (220a1), āsta (220b4), empelona (220a1), ersatai (223, 1b), onwañe (221a4), kakātai (221a2), kakraupauwa (221b2), kaklautkaṣ (221b5), karāntec (221b3), karunäṣṣe (222a2), kerusa (221a2), krākesa (221b4), grahanman(e) (221b1), cärkāsta (221a5), cmela (220b1), cmelane (220a3), cmelaṣṣeṃ (221a2), ñāwa (220a2), takāreñ (220a3), takärṣkñesa (220a4), tessa (220a3), nreyṣana (222a1), papyākoṣ (220a5), palauna (221b1), palskompa (220b3), pälskonta (221b4), pernesa (220a4), bhavāggär (220a5), mantanta (222b3), maiytarṣṣana (221a5), yarponta (221b2), yāmṣate (220b3), yāmṣare (220b2), yokñana (221a5), ysāra (220a4), ra (220a4, b4, 221a3, 4, b1), rintsante (220a4), lareṃ (220a4), läklenta (220a1, b5), läklentaṃts (220a5), läklentameṃ (220b2), läklentaṣṣai (222b4), lyakāsta (223, 1b), lyāka (220a5), wat (220b4, 5bis), warkṣältsa
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 269
(222a2), warpoymar (220b5), warsa (221a1, b4), waltsañy (220b4), wawārp· (221b1), wawālaṣ (221b4), wertsyaṃ (221b3), wnolmentsa (220b3), wsāwa (220a4), wsāsta (221a4), śāmna/// (220a3), śaulanma (220b3), śtwāra (221b3), ṣarmtsa (220b5), ṣecakäññe (220a2), sanaṃmpa (222a4), saṃsā/// (221b3), samûdrä (221a1, b2), säsuwa (220a3), swañcaiyno (221a5), tsalpästsi (220b2), (ts)yālpatai (223, 2a)
ä statt a in I C / II: aräñc(ä)ṣṣ(e) (221a1), ekämätte (221b5), orkämñe (221a3; s.a. unten �orkamñe), takärṣkñesa (220a4), täṅ (223, 1a), täñ (221a1, 5; s.a. unten tañ), mettärṣṣe (?; 221a1), läkle (221b4), säk (223, 1b)
a wie á in I C / II: ara(ñc) (222b5), �orkamñe (220a2; s.a. oben orkämñe), aiśamñeṣe (221b2), aiśamñeṣṣeṃ (222a3), kartseśco (220b4), grahanmane (221b1), tañ (221b4; s.a. oben täñ), tary� (220a1), naktsi (220a2), palsko (222b3), 223, 1b), palskompa (220b3), pit-santse (220b5), mant (220a2), mantanta (?; 222b3), maiytarṣṣana (221a5), snai-yparwece (221b3), lakle (220b1, 5), lykaśke (220b4), warkṣältsa (222a2), warpoymar (220b5), warsa (221a1, b4), walo (221a4), śaulanma (220b3), ṣañ (220a2, 3, b2, 3), ṣarmtsa (220b5)
ä wie ä in I C / II: �ālyeṅkäṃts (220a2), ekämätte (221b5), karunäṣṣe (222a2), kälymi kälymi (?; 221a3), kälymintsa (221a5), krämpā/// (223, 2b), cärkāsta (221a5), ñäś (220a4; s.a. oben ñiś), tkātärñ (220a3), pātärñ (220a3), pälskonta (221b4), snai-yärm (220a4), läklenta (220a1, b5), läklentaṃts (220a5), läklentameṃ (220b2), läklentaṣṣai (222b4), warkṣältsa (222a2), wärpāte (220a1), ṣecakäññe (220a2), tsalpästsi (220b2)
a statt ä in I C / II: yarponta (221b2)
Handschrift B 349 − 351 MQR
Belege für älteren Zustand Bel. f. jüng. Zust.(V 2) päst (350a1, b5, 351 Frgm. 1, 1) −(V 4aP) ṣp (350a3, b4) −(V 5a) ṣamāneṃts (349a5) −(V 7a) preściyaine 349b5) −(V 8) swāsästsi (350a3) −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
270 Peter Stumpf
Belege für älteren Zustand Bel. f. jüng. Zust.(V 9) klautkattsi (350b6), mätstsātsi
(350a6), lantsi (350a5), lkātsi (349a1)−
(V 12) śtw·/// (351b5) −(V 13b) kucesa (350b4) −(V 14) cämpamñe (350a5), pañäkte (349a2,
5), tu-yäkne/// (351a3), śle-yärke (350b4), yältsenma (350a6),
−
ñäś (351b4) −(V 17a) katkauwñai (351b5; vgl. p. 72 mit
Anm. 21), krentonampa (351b6), rekauna (349a5, 351a2)
−
(V 18a) − − yūrc (350a1) −(V 18b) arañcmeṃ (351b4) −(V 21 Ausl.) cew (351b1) cau (351b4)ṣai/ ṣey ṣai (349b2, 350b2) −cai/ cey cai (349a1, 350a4) −se/ seṃ se (350b1, 4) −taisa usw. taisa (350a6) −
Handschrift B 558 − 562 Š
Belege für ält. Zustand Bel. f. jüng. Zust.(V 3' P) − yāmtsiś (558b4)(V 5a) akalṣälyeṃts (560a1), onolmeṃts
(562, 4), krentaunaṃts (558b4), ///ceṃts (562, 3)
−
(V 7a) ayātoścä (561a4), nesalñeścä (561a2), tsārwästsiścä (560a4)
−
(V 8) wastsi (560a3), tsārwästsiścä (560a4) −(V 9) yoktsine (559b4), lamatsi (561a1−2),
śwātsi (559b4), tsaṅkatsi (561a2)−
(V 11) yamalñenta (559b2−3) −(V 13a) kuse (559b4, 562, 2) −(V 14) ekāsanýkäṃñe (558b4−5, b5),
kuhākäṃñe (558b1−2), pañäktipañīkte (560a3)
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 271
Belege für ält. Zustand Bel. f. jüng. Zust.(560a1), pañäkte (558b2, 560a2, 4), yä(kw)eñe (559b4−5), yänmāṣṣeñca (558b3)
(V 17a) auñentaṃtse (561a4), krentaunaṃts(558b4), tarśauna (558b2), läktsauña (562, 4)
−
(V 18a) kauc (558b3) −(V 19a) yparwe (559b2) −(V 21 Ausl.) ceu (562, 2) −ṣai/ ṣey ṣai (560a4) −-llona/
-lyana yamaṣälona (559b3), wikṣalo(na)(559b5)
−
se/ seṃ se (559b1) −taisa usw. taiysa (559a5) −
Handschrift B 384 − 387 S
Belege für älteren Zustand Bel. f. jüng. Zust.(V 2) ramt (385b3) −(V 3' P) − wñāneś (384b3)(V 4aP) ṣp (384a4, 387, 1b) ṣ (386a4, 6)(V 4cP) comp (386b5) −(V 5a) ñäkteṃts (386a3), (bo)dhisātweṃts
(384a2), śāmnaṃts (384b4, 386a3)−
(V 7a) uttareṃśco (384a3) −(V 8) wästsi (384b3) −(V 9) yoktsi (386b4), śwātsi (386b4) −(V 12) śtwāra (385a1) −(V 14) cäñca(r)ñ(e)/// (386b4), cämpauc
(387, 1a), cämpyāre (387, 4), ñä/// (385a4), ñäkcyana (386a6, ñäkteṃts (386a3), pūdñäkte (385b5), ñäś (384b5, 387, 1a)
−
(V 18a) cämpauc (387, 1a) −(V 21a) plyewsa (386a4) −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
272 Peter Stumpf
(V 21 Ausl.) ceu (384b3) cew (386a3)krui/ kwri krui (384b2, 385a4) −-äñ/ -i tainaisäñ (387, 3a) −se/ seṃ se (386b3) −
Handschrift B 231 − 233 Ming-Öi bei Kucā
Belege für älteren Zustand Belege für jüng. Zustand(V 5a) alyeṅkäṃts (231b3),
pontaṃts (231b2), ylaṃts (232b5)
cmelaṣṣeṃs (231a2)
(V 11) yātalñesa (231a1) −(V 13a) kuse (231a1) −(V 13b) kuce (231b3) −(V 14) ñäṣṣitär (231b1) cimpamñe (231b5)(V 17a) larauññe (231b5) −(V 18a+c) − kulyitärś (231b1), wākṣtärś
(231b4)(V 18b+c) kärsnoyeñc (231a4bis),
kautanoñc (231a5), päkṣiyeñc (231a5), yāmṣiyeñc (231a4), latkanoyeñc (231a5), tsaknoyeñc (231a4), tsarkanoyeñc (231a5), tsäkṣyeñc (231a5)
−
(V 21 Ausl.) − cau (231b3), cauk (231b1)(V 23) − āktike (231b1), inte (231a4)krui/ kwri − kwri (231b3)cai/ cey cai (231a1, 3) −ṣai/ ṣey ṣai (233a2), ṣait (231b5) ṣeyeṃ (231a1)-äñ/ -i wesäñ (231b5) −Pl. d. Dem.
Pron. toṃ (231a4) −
se/ seṃ se (231b1, 3, 5) seṃ (231b4)
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 273
Handschrift B 415 − 421 M
Belege für älteren Zustand Bel. f. jüng. Zust.(V 2) päst (415a2) −(V 3'P) − śemneś (417b2)(V 5a) krentaṃtso (416a3) alyeṅkäṃs (415a4)(V 8) − lāssi (419a1)(V 11) kätkālñemeṃ (418a2) −(V 13a) kus(e) (420b1) −(V 14) aśokäṃñana (415b2), ñäkcīyana
(415b1), ñäkcyana (415b5), pudñaktäṃñe (416a1)
yipoym(eṃ)(419a2)
− ñiś (415a3)(V 17a) (kä)r(ts)auñene (419b5), ypaunane
(416b4), larauñesa (415a5, 416a1)−
(V 18b+c) arañco (415a2), ///morkäñc (421, 3) −(V 21 Ausl.) − cau (421, 1a)krui/ kwri − kwri (418b4)ṣai/ ṣey ṣaiyn� (416b2) −Pl. d. Dem.
Pron. toṃ (416b4) toyna (419b2)
Handschrift B 591 S
Belege für ält. Zustand Belege für jüngeren Zustand(V 2) − päs (591a2), ṣuk (591b5)(V 4a P) − ṣ (591a2, 7, b5)(V 5b) − paramañiya(te)s (591b2)(V 6) − täräm (591b2)(V 9) kautatsy (591a4),
wentsi (591a6)āksi (591a6), lkāsi (591a5), sāṃkaṃ (591a2)
(V 10) − miyaṣñe (591a2), wikäṣñeṣṣai(591b2)
(V 11) akṣalñe (591b4), triwäṣṣälñ(e) (591b1), yukalñeṣṣai (591b3)
−
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
274 Peter Stumpf
Belege für ält. Zustand Belege für jüngeren Zustand(V 13a) kuse (591a5) − (V 14) − ekṣalyīsa (591b3), pañiktiññe
(591b5), morñiktantse (591a1)(V 16) − paramañiya(te)s (591b2)(V 17a) − (ka)tkaumñaṣṣe (591a6)(V 18b+c) arañc (591b7), arañcn�
(591b7)−
(V 19c) lypauwa (591a3) − (V 21 Ausl.) − cau (591a5, b5)taisa usw. taisāk (591a3) −
Handschrift B 459 − 489 MQ
Belege f. ält. Zustand Belege für jüngeren Zustand(V 2) − ok (461, 3), ṣukne (459, 5)(V 3' P) − teṅkeś (484, 4)(V 5b) − uwatakas (459, 2), kapyāres
(462, 2), śattālyantyas (475, 3)(V 9) täṅtsi (461, 3) śwasiṣṣe (462, 2), śwāsi (469, 1)(V 12) − śwāra (462, 2, 465, 1, 468, 1, 474,
3) (V 14) − yirpṣuki (460, 2, 6, 464, 2, 466,
3, 467, 3, 472, 2), yirmakkai (460, 5, 465, 2, 466, 2)
(V 16) − wilāsiñintse (460, 5), ///sumaswiñis·/// (?; 489, 1)
(V 17a) − komtak (459, 2, 461, 6), kaumtak(459, 4)
(V 17 b) − tom (465, 1, 466, 1, 474, 3, 481, 1, 484, 3), taum (459, 4, 461, 3, 462, 5, 471, 2)
(V 18a) kontac (?; 477, 2) plāś (485, 2)(V 19a) − uwatakas (459, 2),
pratiw(aṅk)t(e) (462, 1)(V 19b) − kälwāwa (476, 2, 477, 2),
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
Analysen stufentypischer Handschriften 275
Belege f. ält. Zustand Belege für jüngeren Zustandkälworsa (467, 2)
(V 21 Ausl.) − cau (459, 2, 4, 461, 6)sonst. Ass. − śattālyantyas (475, 3), śattāly[ai]
(472, 1)se/ seṃ se (460, 3, 7, 463, 1, 2,
3, 4, 464, 5, 465, 4)seṃ (461, 3), tāṃ (485, 2)
peri (s.p. 104)
− peri (462, 5)
Statistische Auswertung
A) Verteilung der Merkmale bei den im Anhang behandelten Hand-schriften
jüngerer Zustand älterer Zustand
338−344388−390220−223349−351558−562384−387231−233415−421591459−489338−344388−390220−223349−351558−562384−387231−233415−421591459−489
V 2 7 − 1 3 − 1 − 1 − − − − − − − − − − 2 3V 3 − − − − − − − − − − − − 1 − − − − − − −V 3'P − − 2 − − − − − − − − − − − 1 1 − 1 − 1V 4aP − − 1 2 − 2 − − − − − − − − − 2 − − 3 −V 4cP − 2 − − − 1 − − − − − (1) − − − − − − − −V 5a − − 6 1 4 4 3 1 − − − − − − − − 1 1 − −V 5b − − − − − − − − − − − − − − − − − − 1 3V 7a − 5 − 1 3 1 − − − − − − − − − − − − − −V 8 2 1 1 1 2 1 − − − − − − − − − − − 1 − −V 9 1 1 4 4 4 2 − − 2 1 − − − − − − − − 3 2V 10 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 2V 11 − − 3 − 1 − 1 1 3 − − − − − − − − − − −V 12 1 − 1 1 − 1 − − − − − − − − − − − − − 4V 13a 1 1 1 − 2 − 1 1 1 − − − − − − − − − − −V 13b 2 − − 1 − − 1 − − − − − − − − − − − − −V 14 6 13 3 5 9 7 1 4 − − − − − − 1 − 1 1 4 9ñäś/ ñiś 11 1 1 1 − 2 − − − − − − 1 − − − − 1 − −
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012
276 Peter Stumpf
jüngerer Zustand älterer Zustand
338−344 388−390 220−223 349−351 558−562 384−387 231−233 415−421 591 459−489 338−344 388−390 220−223 349−351 558−562 384−387 231−233 415−421 591 459−489
V 17a − − − 3 4 − 1 4 − − − − − − − − − − 1 3V 17b 1 1 − − − − − − − − − − − − − − − − − 9V 18a − 1 3 1 1 1 − − − (1) − − − − − − 1 − − 1V 18b − − 1 1 − − 9 2 2 − − − − − − − − − − −V 19a − − 1 − 1 − − − − − − − − − − − − − − 2V 19b − 1 − − − − − − − − − − − − − − − − − 3V 19c − − − − − − − − − − − − − − − − − − 1 −V 21a − 2 − − − − − − − − 6 4 8 + + + + + + +V 21b 1 − − − − − − − − − 2 3 1 + + + + + + +V 21* 6 2 1 1 1 2 − − − − − − − 1 − − 2 1 2 3krui/kwri 3 − 2 − − 2 − − − − − − − − − − 1 1 − −ai/ ey 1 3 − 4 1 − 4 1 − − 1 − − − − − 1 − − −* = Ausl. (ceu/ cau)
B) Auswertung der Varianten nach (V 20) in den Handschriften B 338−344, 388−390 und 220−223
338ff. 388ff. 223ff.a statt ā 14 17 3ā wie ā 34 16 46ā statt a 35 1 1a wie ă 32 34 95ä statt á 40 26 10a wie á 1 − 30ä wie ä 21 26 21a statt ä 1 − 1
@ Museum Tusculanum Press and the author 2012