Die Freiheit des Helden in der fiktiven Welt: Das utopistische Potential in "Evgenij Onegin"
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Freiheit des Helden in der fiktiven Welt: Das utopistische Potential in "Evgenij Onegin"
Wiener Slawistischer Almanach 74 (2014), 5-45
Nora Scholz
DIE FREIHEIT DES HELDEN IN DER FIKTIVEN WELT: DAS UTOPISTISCHE POTENTIAL IN EVGENIJ ONEGIN
Wie Jurij Lotman in seiner Puškin-Biographie (Lotman 1989) bemerkt, zeichnen sich all die Werke, die Puškin während seines Aufenthaltes in der „südlichen Verbannung“ (1820-1824) fertigstellte oder begann, so auch den Roman in Ver-sen Evgenij Onegin, an dem er die Arbeit im Mai 1823 in Kišinev aufnahm, durch ein gemeinsames Thema aus:
Als verbindender Leitfaden diente das Bild des Autors. Dieses aus den Werken des Dichters hervorgehende Bild [war] auf komplizierte Weise mit seinen im romantischen Geist stilisierten biographischen Fakten ver-flochten […]. Der Grundzug dieses Bildes war „der Dichter als Flücht-ling“ – bzw. als „Vertriebener“. Der Flüchtling, der freiwillig seine Hei-mat verlassen hat, und der Vertriebene, der gewaltsam zum Weggehen ge-zwungen worden war, muteten in diesem Ideenkreis gewissermaßen wie Synonyme an. (Lotman 1989, 97)
Das Bild des Dichters als Flüchtling ist bei Puškin eng verbunden mit der Thematik des Gefangen-Seins in der Fremde, aus welcher man sich in die verlo-rene Heimat sehnt. Dieses Sehnen wird zum Selbstzweck des Dichters, der bei der Ankündigung der Versetzung nach Odessa im August 1823 an seinen Bruder Lev schreibt: "#$%& '#( )*+#,$-#' ./*/01/2, )*+0+(-#' (#03 /4#05 6-78/2/, /9:-3263;' (0#, 4'/ 3 )#*#</$& )/% #=/ 0-4-657'2/, 4'/ /7'-;75 2 >%#77# – 8-$#'73 + </*/?/ – %- 0/2-3 )#4-65 (0# 7$-6- =*&%5 – (0# 7'-6/ $-65 (/+< )/8+0&'@< 1#)#A. (XIII, 19)1
Lotman sieht hier eine Parallele zu dem leicht abgewandelten Schlussvers aus Žukovskijs Übertragung von Byrons Poem The Prisoner of Chillon (!il’onskij uznik): „C/=%- ,- %2#*5 72/#A ';*5(@ / D- 2/6; 3 )#*#?-=0&6 – / E / ';*5(# 72/#A 2,%/<0&6.“ (zit. nach Lotman 1989, 101) Das real-lebenswelt-liche Gefühl der Trauer, einen lieb gewonnen Ort zu verlassen – denn Kišinev war für Puškin kein Gefängnis – wird hier umstilisiert zur Trauer des Gefange- 1 Die Angaben beziehen sich durchgehend auf die Bände der im Literaturverzeichnis
angegebenen Gesamtausgabe.
Nora Scholz
6
nen, der sich in seinen Kerker – die Fremde – zurücksehnt.2 Der Dichter stilisiert sich so selbst zum romantischen, in die Flucht geschlagenen Helden. So bemerkt Lotman:
Für Alexander I. war Puškin ein kleiner Beamter, den die Regierung diszi-pliniert hatte. Puškin lieferte sich selbst und dem Leser eine andere Legen-de: Er sei Ovid, der vom Tyrannen verbannte Dichter. (Lotman 1989, 98)
In Verbindung gebracht wird diese Sehnsucht nach der Heimat mit der Sehn-sucht nach Freiheit: „F*+%#' 6+ 4-7 (/#A 72/9/%@? / F/*-, )/*-! – 2,@2-; 8 0#A.“ (EO, 1, L)3 Die Verbindung der Sehnsucht nach der Heimat mit der Sehn-sucht nach Freiheit wird in Evgenij Onegin auf vielfältige Weise ausgespielt und mit dem Element der natürlichen Grenze in Form des Meeresufers (die Strophe wurde in Odessa verfasst) und dem Schiff als Fluchtmittel in Verbindung ge-bracht: G*/$& 0-% (/*#(, $%& )/=/%@, / "-0; 2#'*+6- 8/*-96#A. / F/% *+,/A 9&*5, 7 2/60-(+ 7)/*3, / F/2/650/(& *-7)&'5; (/*3 / C/=%- $ 0-40& 3 2/650@A 9#=? / F/*- )/8+0&'5 78&40@A 9*#= / "0# 0#)*+3,0#00/A 7'+<++ / H 7*#%5 )/6&%#00@< ,@9#A, / F/% 0#9/( IJ*+8+ (/#A4, / .,%@<-'5 / 7&(*-40/A K/77++. (EO 1, L)
Die bewusste Orientierung an dem ein oder anderen literarischen Typus kann als charakteristisches Merkmal auch romantischen Verhaltens gelten. So ergibt sich eine literaturnost’ des Alltagslebens, die, als künstliche Gegenwelt zu die-
2 Diese Stilisierung des eingesperrten Künstlers in der Fremde wird etwa auch in Vik-
tor Šklovskijs Emigrationsroman ZOO ili pis’ma ne o ljubvi (Berlin 1923) anhand des Motivkomplexes um den ob’esjanyj orden aufgegriffen. Hier wird die Gefangen-schaft in der Fremde zur künstlerischen Notwendigkeit, da die Mangelsituation der ‚Fremde‘ die Voraussetzung des Schaffens im Sinne des formalistischen priem ostra-nenija ist. Die doppelten Gitterstäbe, hinter denen der Affe im Berliner Zoo gefangen ist, drücken eben jene Notwendigkeit aus, auf keinen Fall ,heimisch‘ zu werden, ge-nauso wie auch die angelegte Liebesgeschichte eben NICHT eingelöst werden darf – die Parallelführung zu den Abschweifungen des Autor-Erzählers von Evgenij Onegin sowie der Nicht-Einlösung der Liebesgeschichte (vgl. unten) ist nicht zu übersehen.
3 Zur Konnotation des „pora“ als Anzeichen des Verlassens der Welt vgl. Hansen-Löve 1996, 190. Zum „pora!“ speziell bei Puškin vgl. unten. Die Abkürzung „EO“ für Ev-genij Onegin bezieht sich durchgehend auf Band IV der im Literaturverzeichnis an-gegebenen Gesamtausgabe.
4 Das „pod nebom afriki moej“ spielt auf die ‚Ur-heimat‘ des Dichters an, dessen Ur-großvater Ibrahim PetroviM Gannibal (1696-1781) im Kindesalter in Abessinien (heu-te Äthiopien) geraubt und an den Hof des Zaren Peter IV. gebracht wurde. Zu diesem Themenkomplex, den Puškin in seinem unvollendeten Roman Arap Petra Velikogo (entstanden 1827, veröffentlicht 1837) behandelt, vgl. auch die Biographie von Bar-nes 2006.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin
7
ser, für den Romantiker ‚realer‘ ist, als die ihn umgebende reale Wirklichkeit (vgl. dazu auch Lotman 1989, 85).
Der romantische Dichter, der in einer ihm fremden Welt gefangen ist, was als gnostischer Grundtonus verstanden werden kann (vgl. Hansen-Löve 1996, 194), wird zu einem Parallelismus des verbannten Dichters, der seine Einsamkeit in der Fremde zum romantischen Ideal stilisiert. Die Vermischung von Autobio-graphie und Fiktion, wie sie in Evgenij Onegin in Gestalt der gespaltenen Autor-Erzähler-Person zu finden ist, entspricht der für emigrantisches Schreiben als typisch zu bezeichnenden Vermischung von Leben und Text, mittels derer der Autor versucht, sich die reale Welt durch die von ihm geschaffene fiktive Welt als ‚nicht-fremd‘ anzueignen. Gleichzeitig lässt sich die Position des Autors in der Fremde als ‚Außerhalb‘-Position bezeichnen. Dieses ‚Außerhalb‘ kenn-zeichnet sich in diesem Zusammenhang durch die Abgeschiedenheit und Ein-samkeit des Dichters, der als Fremder, als Flüchtling, in der ‚Einöde‘, sich je-denfalls außerhalb der Heimat befindet.
Ebenfalls als Merkmal des Schreibens aus dem Exil lässt sich die Gesprächs-
situation bezeichnen, die der Autor-Erzähler mit dem Leser eingeht. In Evgenij Onegin zeichnet sich diese ,plaudernde‘ Gesprächssituation dadurch aus, dass hier die von Karla Hielscher als fiktionsbrechende Autor- Erzähler- Manifestati-on (s.u.) bezeichnete Erzählerinstanz die ‚reale‘ Leserschaft des realen Autors Puškin anspricht, indem sie sich auf tatsächlich geschriebene Werke desselben (Ruslan i Ljudmila) bezieht und der Leser somit als Teilhaber an der Welt des Helden und somit auch des Autors angesprochen wird5: N*&,53 O;%(+6@ + K&76-0-! / P =#*/#( (/#=/ */(-0- / G#, )*#%+76/-2+A, 7#A $# 4-7 / F/,2/65'# )/,0-8/(+'5 2-7: / >0#=+0, %/9*@A (/A )*+3'#65, / K/%+673 0- 9*#=-< D#2@ / Q%#, (/$#' 9@'5, */%+6+75 2@ / H6+ 96+7'-6+, (/A 4+'-'#65. (R> 1, II )
Unterstützt wird der Eindruck der Nicht-Fiktionalität des erzählenden Ichs zusätzlich durch die nächsten beiden Verse, die auf die Exil- bzw. Verbannungs-situation des realen Autors anspielen: „S-( 0#8/=%- =&636 + 3: / D/ 2*#%#0 7#2#* %63 (#03.“ (EO 1,II). Die Spaltung des Autor-Erzählers, der einerseits nicht nur deutlich autobiographische Züge Puškins trägt, sondern an manchen Stellen auch als der Dichter selbst in Erscheinung tritt, andererseits aber ein ‚gu-ter Freund‘ seines Helden Onegin ist, lässt sich so als Versuch erklären, die re-alweltliche Mangelsituation des ‚Außerhalb‘, die Verbannung, in welcher der reale Autor ‚gefangen‘ ist, zu überwinden, indem der Autor ein Simulacrum
5 Weiterführende Hinweise auf die Rolle des Lesers finden sich auch bei Rybnikova
1924, 22-45
Nora Scholz
8
seiner Selbst in den Text sendet – und sich dort nicht nur einen guten Freund, sondern zusätzlich noch einen vielstimmigen, wenngleich schweigenden Ge-sprächspartner (den Leser) erschafft.
Die Außerhalb-Position des Autors erfährt eine Doppelung auf semantischer und struktureller Ebene. Während sich auf der semantischen Ebene der Autor als Person außerhalb der Heimat befindet, woraus sich eine Ohnmacht hinsichtlich der alltäglichen Lebenswelt und die Sehnsucht nach der unerreichbar geworde-nen Heimat ergibt, ist es auf narratologischer Ebene die Außerhalb-Position des Autors, der die Grenze hin zu der von ihm geschaffenen fiktiven Welt ebenfalls nicht überschreiten kann. Durch die ‚Entsendung‘ eines Autor-Erzählers in den Text findet auf narratologischer Ebene ein Machtverlust statt: Ein sich in einer fiktiven Diegese befindlicher Erzähler, der vorgibt, der Autor des Romans zu sein, den er schreibt, hat aus narratologischer Sicht weit weniger Macht über die ‚Geschichte‘, als der außerhalb stehende Autor.6 In seiner Version von Puškins Roman in Versen Evgenij Onegin schreibt Nabokov:
What I feel to be the real [...] world is the world the artist creates, his own mirage (EO 112). I […] stress once again the […] reality of art and the un-reality of history. (EO III, 177)
Betont wird also der Realitätscharakter der ‚Geschichte‘, der fiktiven Welt im Sinne von ‚story‘, wohingegen die ‚Geschichte‘ im Sinne der ‚history‘ als unreal bezeichnet wird. ‚Eine Welt erzählen‘ („to narrate the world“) entspricht dem romantisch-ironischen Autorverständnis, das den Autor als einen außerhalb der Welt stehenden Puppenspieler betrachtet, der die Helden wie Marionetten an den Strängen hält und beliebig über sie gebieten kann (vgl. Bethea 1989, 33). Die Vorstellung einer außerhalb der Welt sich befindlichen, allmächtigen In-stanz, die das Geschehen lenkt und leitet, nämlich auf ein Ende zu, entspricht dem einen Teil des kultursemiotischen Konzeptes, das David Bethea für escha-tologische Weltbilder entworfen hat und in welchem er zwei Möglichkeiten sieht:
[…] Ultimately, however, the apocalypticist and utopian cannot be said to translate simply into opposite sides of one eschatological coin; they have radically different conceptions of what constitutes narrative authority in the historiographical process. To the one, this authority comes from God, who is outside human (hi)story; to the other, this authority comes from
6 Da die ,Werkherrschaft‘ letzten Endes dem konkreten Autor als Person obliegt und es
in diesem Zusammenhang keinen Sinn ergibt, von einem abstrakten, impliziten oder sonstwie im Werk inbegriffenen Autor zu sprechen, wird der Begriff ‚Autor‘ hier als der konkrete Autor (nach Schmid 2006) verstanden, während der fiktive Erzähler, der sich gewissermaßen als Autor ‚aufspielt‘, als Autor-Erzähler bezeichnet wird.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin
9
human beings, who can make themselves and their ideal POLIS within history […]. (Bethea 1989, 15)
Voraussetzung, um dieses Konzept als Ausgangsstruktur für die Untersu-chung der utopistischen Grundstruktur der fiktiven Welt von Evgenij Onegin zu-grunde zu legen, muss zunächst sein, den narrativen Text (die Welt) des Romans als ein grundsätzlich ,eschatologisches‘, d.h. also end-gerichtetes (Zeichen-) System zu definieren.
Die Narrativität des Textes ist insofern als Voraussetzung unerlässlich, als ein Geschichten-Erzähler als ,Narrateur‘ im Zwang steht, immer ‘von hinten her‘ zu erzählen; d.h. er befindet sich nach dem Ende der Geschichte, die er er-zählt; er weiß, im Gegensatz zu den Protagonisten, die sich – sowohl zeitlich als auch räumlich gesehen – in der Geschichte befinden, um deren Ausgang. Ist nun also die End-gerichtetheit des narrativen Textes grundsätzlich gegeben, kann das oben zitierte Modell von Bethea herangezogen werden, um die Machtposition der Erzählhaltung hinsichtlich einer utopistischen oder auch apokalyptischen Ausrichtung festzustellen. Die Überwindung der uslovnost’ Als eine der bedeutendsten Neuerungen und Besonderheiten des „Romans in Versen“ Evgenij Onegin sieht Lotman die künstlerische Gestaltung der Erzähl-weise: P6/$0/# )#*#)6#'#0+# J/*( «4&$/A» + -2'/*78/A *#4+ 7/7'-263#' 2-$0#A?&; #=/ <-*-8'#*+7'+8&. >%0-8/ 7-(/ *-,%#6#0+# 0- «4&-$&;» + -2'/*78&; *#45 6+?5 2 7-(/( =*&9/( 2+%# <-*-8'#*+,&#' 8/07'*&81+; 7'+63 */(-0-. (Lotman 1995, 412)
Die komplizierte Verflechtung von ‚fremder Rede‘ und ‚Autor/Erzähler-Re-de‘ manifestiert sich in verschiedenen Bereichen. Zum Einen sind es die durch Anführungszeichen markierten Monologe der Charaktere oder Dialoge der Cha-raktere untereinander, welche die Autorerzählung objektivieren und sie dialogi-schen Formen, in denen keine Episierung stattfindet, wie etwa dem Drama, an-nähern (vgl. Lotman 1995, 412).7
7 Lotman nennt darüber hinaus fünf weitere Kategorien der „fremden Rede“ in Evgenij
Onegin, darunter die nicht graphisch gekennzeichnete fremde Rede, die in die Autor-rede eingebettete fremde Rede, Zitate sowie fremdsprachige Elemente des Textes. Als eine weitere Kategorie fremder Rede zählen auch paratextuelle Elemente, wie die Motti zu Beginn der Kapitel oder das dem Roman vorangestellte „Gespräch des Ver-legers mit dem Dichter“ (vgl. das Kapitel „’TuUaja reM’ v ‚Evgenij Onegine’“ in: Lot-man 1995, 411-417). Auf einige dieser Elemente wird noch gesondert einzugehen sein.
Nora Scholz
10
Dem Element der ‚fremden‘ Rede steht in Evgenij Onegin die Autor-Erzäh-lerrede gegenüber. Die Verflechtung dieser beiden Elemente bedingt ein als in-szeniert zu bezeichnendes ständiges Schwanken der to"ka zrenija. Durch das Übereinanderlegen verschiedener Typologien ergeben sich Interferenzen, wo-durch eine Darstellung nicht von ‚Typen‘, sondern von ‚Wirklichkeit‘, also einer einmaligen, eigenständigen Welt erreicht wird. Besonders deutlich zeigt sich dies etwa in den Elementen der in die Autorrede eingebetteten fremden Rede, von welcher hier ein exemplarisches Beispiel gegeben werden soll: >0#=+0 7 )#*2/=/ %2+$#0+3, / C )/76& '-8/=/ )/*&4#053 / >9/*/'375, 9#, 6+?0+< 76/2 / 78-,-6, 4'/ /0 #$%&'( &)*)#. (EO VI, IX; Kursiv im Original.)
Das kursiv gesetzte vsegda gotov stellt eine in die Autor- Erzählung eingebet-tete direkte Rede des Helden (parole) dar, wodurch für einen Moment die to"ka zrenija vom Erzähler zum Helden wechselt, der sich an die ihn umgebende Welt richtet. Die Einbettung der Elemente fremder Rede in die Strophenform als stili-sierte Rede zeigt jedoch unter dem Blickpunkt einer Erzählanalyse die absolute Vorherrschaft der ,Autorstimme‘ auf. Durch das ständige Wiederkehren der Au-torstimme in ihren verschiedenen Ausrichtungen ergibt sich ein schillerndes, nicht auf einen Typus festlegbares Bild des Autors (obraz avtora), über den Eri-ka Greber schreibt:
Diese Absage an das egomane Modell autobiographischen Schreibens, das sich innerfiktional auf die Relation zwischen dem Helden Onegin und sei-nem Schöpfer bezieht, besagt wiederum für den Text selbst, dass auch dessen Schöpfer – der reale Autor Puškin – sich nicht nahtlos in der Ich-Figur porträtieren will, sondern auf der Differenz des Literarischen, auf der Fiktionalität und Phantasie besteht. So sind denn auch die Eigenspuren Puškins, wie die trotzdem an seiner Selbstliterarisierung interessierten Forscher herausgearbeitet haben, auf mehrere Figuren verteilt: den Ich-Erzähler, die beiden Protagonisten Onegin und Lenskij und nicht zuletzt auch die Heldin Tat’jana – Modellierungen als sprachgewandter Roman-cier, byronistisch angehauchter Dandy, empfindsamer Poet, echtes Kind des traditionsverbundenen Volkes. Wenn also Puškin überhaupt ein Au-to(r)portät zeichnet, dann das eines diskursiv gesplitteten, vielstimmigen Selbst in einer ironisch-ambivalenten Mischung von sympathischen und antipathischen Zügen, von aktuellen und überlebten Charakteristika, von faktischen und erfundenen Eigenheiten. (Greber 2007, 98)
Unterbrochen wird die Strophenform, abgesehen von den Motti zu Beginn der Kapitel, nur an drei Stellen im Roman, dem Brief Tat’janas an Onegin im dritten Kapitel, dem Lied der Jungfrauen gegen Ende des dritten Kapitels und schließlich dem Brief Onegins an Tat’jana. Der Brief Tat’janas an Onegin zu-mindest ist jedoch, obwohl der Autor-Erzähler vorgibt, das (auf Ebene der ‚Ge-schichte‘, nach W. Schmid) auf Französisch verfasste Original des Briefes vor
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 11
sich liegen zu haben, eine Übersetzung des Autor-Erzählers ins Russische und somit keine direkte Rede Tat’janas: F+75(/ S-'530@ )*#%/ (0/;, / R=/ 3 723'/ 9#*#=& / V+'-; 7 '-A0/; '/78/; / H 0-4+'-'573 0# (/=&. […] / D/ 2/' / 0#)/650@A, 76-9@A )#*#2/% / P $+2/A 8-*'+0@ 7)+7/8 96#%0@A. (EO 3, XXXI)
Es ergibt sich hier eine Null-Referenz zwischen Original und Übersetzung, da das Original auf der Ebene der ‚Präsentation der Erzählung‘ fehlt, auf der Ebene der ‚Geschichte‘ jedoch vorhanden ist. Dieses Spiel mit Wirklichkeit und Fiktion wird durch eine Spaltung der Autor-Erzählstimme auf die Spitze getrie-ben.
In ihrer unübertroffenen Analyse der Erzählsituation und des fiktiven Autor-Ichs in Evgenij Onegin hat Karla Hielscher, ausgehend von Vinokur8,
eine Auf-spaltung der Erzählerfigur in drei Instanzen festgestellt. Sie unterscheidet bei dem Erzähler von Puškins „Roman v stichach“ die drei Ebenen eines wirklich-keitsfingierenden Erzähler-Ichs, eines fiktionsschaffenden/fiktions-bewusst-ma-chenden Erzähler-Ichs und schließlich die Instanz eines fiktionsbrechenden, aus der Fiktion heraustretenden Erzähler/Autor-Ichs. (vgl. Hielscher 1965, 119 f.) Besonders deutlich wird der fliegende Wechsel zwischen diesen drei Autor- Erzählerstimmen bereits in der zweiten Strophe des ersten Kapitels: „S-8 %&(-6 (/6/%/A )/2#7- / O#'3 2 )@6+ 0- )/4'/2@< / .7#2@?0@A 2/6#; W#2#7- / D-76#%0+8 27#< 72/+< */%0@<.“ (EO 1, II) Sofort nach dieser einleitenden, ‚objektiven‘ Er-Erzählung erfolgt ein Bruch und es tritt im nächsten Satz ein Autoren-Ich auf, das den Leser offiziell mit dem Helden des Buches bekannt macht: „N*&,53 O;%(+6@ + K&76-0-! / P =#*/#( (/#=/ */(-0- / G#, )*#%+-76/2+A, 7#A $# 4-7 / )/,2/65'# )/,0-8/(+'5 2-7...“ (EO 1,II) Damit ist die Grundlage für ein Gespräch zwischen Autor und Leser gelegt.9 Dass die Stimme hier nicht einer rein fiktiven Autorgestalt gehören kann, wird durch die Erwäh-nung von Puškins Poem Ruslan i Ljudmila (1820) deutlich: Puškin führt sich selbst als Erzähler des Romans ein, den er schreibt. Ebenso sind die Leser, die da angesprochen werden, keine fiktiven Leser, sondern es sind seine Zeitgenos-sen, Puškins wirkliche Leser, die sich, genau wie der Autor, außerhalb der fikti-ven Welt befinden:10
„Q%#, (/$#' 9@'5, */%+6+75 2@ / H6+ 96+7'-6+, (/A
8 Die Aufspaltung in avtor-rasskas"ik, avtor-u"astnik und avtor o samom sebe geht
auf Vinokur (Vinokur 1941, 169 ff) zurück. 9 Wie oben dargelegt, kann die Gesprächssituation zwischen Autor-Erzähler und Le-
ser als ein Merkmal des Schreibens aus der Fremde betrachtet werden. 10 Hielscher weist darauf hin, dass die reale Autor-Gestalt sowie auch die reale Leser-
schaft dadurch, dass sie in die Welt der Dichtung mit einbezogen werden, in gewis-
Nora Scholz
12
4+'-'#65.“ (EO 1, II) Im Vers davor heißt es jedoch noch: „>0#=+0, %/9*@A (/A )*+3'#65, / */%+673 0- 9*#=-< D#2@...“ (EO 1, II)
Während zwei Verse weiter oben noch von einem vom Autor erschaffenen Romanhelden die Rede war, wird nun die Erzählung von Wirklichkeit fingiert: Dadurch, dass der Held nun als ein Freund des gerade noch als aus der Fiktion heraustretender, ,konkreter‘ Autor Puškin klassifizierten Erzählers bezeichnet wird, begibt sich dieser Erzähler in die fiktive Welt, die er erzählt. Damit wird jedoch nicht nur die Erzählerfigur fiktiv, sondern sie gibt auch vor, etwas real Erlebtes (mimetisch) ‚nach-zuerzählen‘ – und nicht etwas Erdichtetes frei zu erfinden.
Der Autor-Erzähler in seiner fiktionsbrechenden Gestalt macht sich an dieser Stelle also zum Geschichte (hi-story)-Erzähler im Sinne eines erzählenden Ichs, der als solcher den Lauf der Geschichte nicht beeinflussen kann, sondern nur etwas wiedergibt, was sich ,wirklich‘ ereignet hat; in derselben Welt, in der auch er sich befindet und sich früher, als erzähltes Ich, befand.
So gibt es also drei Aggregatszustände – oder auch ,Hypostasen‘ – des Erzäh-ler-Ich in Evgenij Onegin: 1. das aus der Fiktion heraustretende Autor-Ich als autobiographische Persönlichkeit des realen Autors Puškin, 2. den fiktiven Au-tor-Erzähler als das Werk schreibende Instanz sowie 3. das als mithandelnde Person am fiktiven Geschehen teilhabende Ich als ,guter Freund‘ seines Helden.
Der Autor-Erzähler weist insgesamt deutlich auktoriale Züge mit einer Null-fokalisierung (nach Genette 1994) auf, obwohl er, als homodiegetisch auftreten-de Person, nicht auktorial sein dürfte. Ein Beispiel für das homodiegetische Auf-treten des Erzählers als Figur ist neben seiner Freundschaft mit seinem Helden Evgenij Onegin auch der Brief Tat’janas, in dessen Besitz er ist. Gleichzeitig weiß er jedoch beispielsweise alles, was Tat’jana mit ihrer Amme in der Abge-schiedenheit des Zimmers spricht (EO 3, XVII / XVIII) und alles über ihr Den-ken und Fühlen sowie auch das der anderen Personen.11 Da die verschiedenen
ser Weise selbst fiktiv werden. Zur Funktion dieser Fiktionalisierung vgl. ausführli-cher unten.
11 Anders als etwa in dem historischen Roman Kapitanskaja Do"ka (im Folgenden KD, 1831), der von einem Herausgeber als historisches Dokument fingiert wird, legt Puškin in Evgenij Onegin keinen Wert auf die Rechtfertigung seiner springenden Erzählinstanz. Während Grinev, der Verfasser der „persönlichen Aufzeichnungen“, die den Kerntext der KD ausmachen, behauptet, er hätte alles, was er eigentlich nicht wissen kann, erlebt, gleichsam, „als sei er dabeigewesen“, wird hier eine eindeutig und nicht versteckt fiktive Situation geschaffen. Anders auch als in der KD, wo Gri-nev als erzählendes Ich so zu tun versucht, als sei er das erzählte Ich, und somit Un-wissenheit und Nicht-Verstehen vorgibt, wird in Evgenij Onegin zumindest an den Stellen, an denen das Autor- Ich als demiurgischer Weltschöpfer auftritt, kein Hehl daraus gemacht, dass der Autor allmächtig ist und über das Geschehen frei be-
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 13
Ebenen schwer zu gewichten sind, scheint es hier nicht sinnvoll, von einer Para-lepse zu sprechen. Vielmehr kann das Schwanken des point of view, das als Po-lymodalität zu bezeichnen wäre, sowie auch die vielen Elemente fremder Rede in der Autorrede als ein künstlerisches Verfahren gelten, das als eine absichtli-che Verschleierung der uslovnost’ des Textes gelten muss. So heißt es auch bei Lotman: I «$+,05» 2 6+'#*-'&*0/( )*/+,2#%#0++ – X'/ 0#X7'#'+,+*/2-00-3 *#45, '#87', <&%/$#7'2#00/ 0# /*=-0+,/2-00@A + )/X'/(& +7'+00@A. D/ #7'#7'2#00/, 4'/ 6;9/A '#87', 2</%3Y+A 2 <&%/$#7'2#00/# )*/+,-2#%#0+#, #7'5 <&%/$#7'2#00@A '#87'. S-8 2/,0+8-#' ,-%-4- )/7'*/-#0+3 <&%/$#7'2#00/=/ (/*=-0+,/2-00/=/) '#87'-, 8/'/*@A +(+'+*/-2-6 9@ 0#<&%/$#7'2#00/7'5 (0#/*=-0+,/2-00/7'5), 7/,%-0+3 '-8/A 7'*&8'&*@, 8/'/*-3 2/7)*+0+(-6-75 9@ 8-8 )*$+*$*#,% 7'*&8'&*@. (Lotman 1995, 419/420)
So sprunghaft wie die Ausprägungen des Autor-Erzähler-Ichs sind auch des-sen Bewegungen, die es gleich einer Kameraschwenkung innerhalb des Textes unternimmt. Einem fliegenden Erzähler vergleichbar, der mal hier, mal dort ver-weilt und in Windeseile überall sein kann, also nicht an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist, ‚fliegt‘ die Erzählstimme gleichsam über ihren Helden, lässt sich mal nieder, schweift ab, kommt wieder zurück.12
Ein Beispiel für die Überwindung von Raum und Zeit sei hier genannt. So heisst es zu Beginn der Strophe XXVII des ersten Kapitels: „Z 0-7 '#)#*5 0# '/ 2 )*#%(#'#: / "@ 6&4?# )/7)#?+( 0- 9-6, / C&%- 7'*#(=6-2 2 3(78/A 8-*#'# / Z$ (/A >0#-=+0 )/78-8-6.“ (EO 1, XXVII) Der Erzähler hat über einer Abschweifung (ot-stuplenie) seinen Helden aus den Augen verloren und muss sich beeilen, ihn wieder ‚einzufangen‘. Im Fortgang der Strophe XXVII wird der Weg geschil-dert, den Onegin – und nach ihm, da Onegin ja vor ihm losgefahren ist – auch
stimmt. Die Nicht-Beendigung der KD ist, vergleichbar dem Null-Ende von Evgenij Onegin, das die fiktive Welt absolut setzt (vgl. unten), vor allem auch eine Erschei-nung, die deutlich macht, dass die geschilderten Ereignisse nicht auf ein vorher vom Erzähler festgelegtes Resultat abzielen; es hebt den historischen Charakter der Auf-zeichnungen im Gegensatz zum belletristisch/fiktiven hervor – die ‚Geschichte‘ als Historie hat eben kein Ende, während die ,Geschichte‘ als erzählte Geschichte (story) sich dadurch auszeichnet, dass sie (mehr oder weniger wohlgeordnet und dem jeweiligen ,Genre-Usus‘ angeglichen –) Anfang und Ende hat.
12 Das Fliegen und Umherschweifen der Erzählstimme erinnert an die schamanische Autorgestalt des Igorliedes (vgl. dazu etwa Hansen-Löve 2015), die auch dort durch ihr Umherschweifen, ihre Überwindung von Raum und Zeit und ihre Auswahl des-sen, was erzählt wird, die erhöhte Fiktionalität des Slovo ausmacht. Besonders auch die ‚Wandlungsfähigkeit‘ des Erzählers, der innerhalb eines Satzes verschiedene Hypostasen annehmen kann, spricht für eine Referenz auf das Slovo o polku Igoreve, die allerdings noch genauer zu untersuchen sein wird.
Nora Scholz
14
der Erzähler ‚fährt‘. Zu Beginn der nächsten Strophe jedoch hat der Erzähler Onegin bereits überholt und ist vor ihm angekommen: „./' 0-? =#*/A )/%:#-<-6 8 7#03(; / [2#A1-* - (+(/ /0 7'*#6/A / .,6#'#6 )/ (*-(/*0@( 7'&)#0-3(,/ K-7)*-2+6 2/6/7- *&8/A, / ./?#6.“ (EO 1, XXVIII)
Auffällig ist jedoch, dass trotz aller Freiheit der lineare Zeitablauf der Erzäh-lung zwar auf der Ebene der ,Präsentation der Erzählung‘ unterbrochen wird, nicht aber auf der Ebene der ,Geschichte‘: Während beispielsweise ein Ball in St. Petersburg geschildert werden müsste, um den Helden zu begleiten, schweift die Autor-Erzählstimme zu einem fünfeinhalb Strophen umfassenden Exkurs über Frauenfüßchen und eine eigene, unglückliche Liebe ab. Die Schilderung des Balles wird aber nicht später nachgeholt, sondern dann ausgelassen – es gilt, den Helden, der bereits zu Hause im Bett liegt, wieder ‚einzuholen‘, was nicht nur auf den eigenständigen Charakter der erzählten Welt hinweist, die sich auch ohne ihren Autor dreht, sondern gleichwohl den Eindruck hervorruft, der Erzäh-ler hätte seinen Helden vergessen: „V'/ $ (/A >0#=+0? F/6&7/00@A / . )/-7'#6; 7 9-6- #%#' /0.“ (EO 1, XXXV) Das humoristisch-ironische Moment, das sich aus dem beständigen Wechsel des point of view (to"ka zrenija) ergibt, ist auch auf das ,Geplauder‘ des Romans zurückzuführen.13 Durch die ständigen Umkodierungen wird deutlich, dass die Oberhand über die Anordnung der ver-schiedenen Elemente beim Autor liegt, der ihre beständige Verflechtung als Verfahren einsetzt, eine Darstellung von ‚außerliterarischer‘ Wirklichkeit zu er-zeugen. Lotman bringt die ironische Redeweise und die Prosaelemente, die in die strenge Strophenform eingebettet sind, mit dem Terminus des Humoristen in Verbindung, wie er in einem Notizbucheintrag Kjuchel’bekers als spielerischer Herrscher über die zur Verfügung stehenden ,Gefühle‘, die Lotman zu dem ver-gleichbar hält, was wir unter to"ka zrenija verstehen, beschrieben wird: „\(/-*+7' […] %/7'&)#0 27#( 2/,(/$0@( 4&7'2-(, 0/ /0 0# *-9 +< – 0# /0+ +(, /0 +(+ 26-7'2&#', /0 +=*-#' +(+ […].“ (Kjuchel’beker, zitiert nach Lotman 1995, 425)
So sind es gerade die durch das Schwanken der Erzählstimme und des point of view erzeugte ironische Distanz und die absichtliche ‚Unorganisiertheit‘ des Textes, die mittels der übereinander gelegten Ebenen Interferenzen erzeugen und so von der Darstellung der erzählten Welt als Fiktion, als ‚Typus‘ also ab-kommen: Indessen rufen sie einen Eindruck von ‚Wirklichkeit‘ der erzählten Welt hervor – die Wirklichkeit in ihrer ‚freien‘, chaotischen, unerklärlich-unlo-
13 So schreibt etwa Puškin am 16. November 1823 an Del’vig: „F+?& '#)#*5 0/2&; )/X(&, 2 8/'/*/A ,-9-6'@2-;75 %/ 0#65,3“ und im Sommer 1825 an BestuUev: „...)/60/ '#9# )+7-'5 9@7'*@# )/2#7'+ 7 */(-0'+4#78+( )#*#</%-(+ – X'/ </-*/?/ %63 )/X(@ 9-A*/0+4#78/A. K/(-0 '*#9&#' 9/6'/20+“. (zit. n. Lotman 1995, 425)
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 15
gischen und eben nicht literarisch oder sonstwie auktorial initiiert auf ein Ende hin geordneten Gestalt.
Ausgewählte Paratexte Da es sich nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne um Grenz-bereiche des Textes handelt, scheint eine Beschäftigung mit den Paratex-ten des Romans unumgänglich. Die Paratexte im Grenzbereich von Evgenij O-negin sind insofern nicht leicht zu bestimmen, als der Roman nicht im Ganzen, sondern kapitelweise erstveröffentlicht wurde (auch das ein wesentliches Ele-ment der Nicht-Endgerichtetheit des Textes). Die dem Textkörper vorangestell-ten Texte erfuhren so immer wieder Umstellungen. Nach den beiden Titeln wer-de ich mich insofern auf die Texte beziehen, die dem Roman zum Zeitpunkt der ersten Gesamtausgabe 1834 vorangestellt waren. Darüber hinaus ist jedoch auch das „Gespräch des Dichters mit dem Verleger“ (Razgovor knigaprodavca s po--tom) einer Erwähnung wert, das zwar bis zur ersten Gesamtausgabe den jeweils erscheinenden Teilen vorangestellt war, der Gesamtausgabe jedoch nicht mehr.
Genette unterscheidet im Wesentlichen zwischen zwei Arten von Titeln: thematischen und rhematischen (vgl. Genette 2001, 82 f). Puškins „Roman v sti-chach“ Evgenij Onegin trägt beiderlei. „Evgenij Onegin“ wäre als thematischer Titel zu bezeichnen, während „Roman v stichach“ als Gattungsbezeichnung ein rhematischer Titel ist. Mit dem thematischen Titel, der den Namen des Helden nennt, steht Puškin in der Tradition des 19. Jahrhunderts, wobei Genette an-merkt, dass der Name des Helden im Titel eher mit der Tragödie konnotiert ist (vgl. Genette 2001, 90/91).
Am meisten Respekt vor dem Leser bezeugen Titel, die sich auf den Na-men des Helden beschränken […], aber auch der Verweis auf die Hauptfi-gur kann eine ungebührliche Einmischung seitens des Autors sein, etwa wenn Balzac mit Vater Goriot die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Per-son des Alten lenkt, obgleich der Roman auch das Epos von Rastignac und von Vautrin alias Collin ist. (Eco 1987, 10)
Der Frage, ob die Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Helden Evgenij Onegin eine ‚Finte‘ sein könnte, lässt sich erhellen, wenn man berücksichtigt, was der Dichter im „Gespräch des Dichters mit dem Verleger“ als ‚Thema‘ sei-nes Werkes bezeichnet: nämlich „die Freiheit“: C0+=/)*/%-2#1: S#)#*5, /7'-23 ?&(0@A 72#', / H (&,, + 2#'*#0&; (/%&, / V'/ $ +,9#-*#'# 2@? F/X':
Nora Scholz
16
P2/9/%&. (EO 2, 345)
So bringt der Rezipient den Namen des Titelhelden im thematischen Titel mit dem vom ,Dichter‘ genannten Thema des Werkes in Verbindung. Erst im Nach-hinein (nach der Lektüre; das Phänomen des Von-hinten-Lesens entspricht dem Von-hinten-Konzipieren des Autors) wird deutlich, dass der Titel die Freiheit des Helden in ambivalenter, wenn nicht gar ‚tragischer‘ Weise konnotiert14. Der Held erweist sich als in verschiedener Hinsicht unfrei. Anders als der Dichter Puškin hat der Held Onegin jedoch keinerlei demiurgische Schaffenskraft, mit-tels derer er sich – über das Schaffen einer fiktiven Welt – aus seinem Gefängnis befreien könnte; Onegin ist kein Poet.
Die ,Freiheit‘ Evgenijs von jeglicher sozialer und gesellschaftlicher Verant-wortlichkeit, die nicht zuletzt die Ursache für sein Leiden, den „Spleen“ (vgl. EO I, XLII) ist, weist darüber hinaus eine autobiographische Bezugnahme zum Autor auf, der ebenfalls ‚frei‘ in der Verbannung ist und seine Sehnsucht mit Langeweile in Verbindung bringt („F/*- )/8+0&'5 78&40@A 9*#=“, EO I, L). Nicht zuletzt ergibt sich über das Thema der Freiheit eine negativ konnotierte Parallele zu der Instanz des Autor-Erzählers, der sich, genau wie sein Held, durch eine ‚Freiheit‘ von Verantwortung für das Land auszeichnet – die einzigen männlichen Charaktere im Werk, die nicht dienen, sind Onegin, Lenskij und der Autor-Erzähler. Dies ist, berücksichtigt man das Jahr (1812), in dem der Held in die „Freiheit“, die ‚große Welt‘ eintritt („./' (/A >0#=+0 0- 72/9/%#; […] H 0-8/0#1 &2+%#6 72#'“, EO, 1, IV), als eine markierte Leerstelle zu betrachten (vgl. dazu Lotman 1980, 42 ff und unten).
Bezüglich des Vornamens des – gleichnamig dem Protagonisten des Mednyj vsadnik – Helden stellt Puškin in einem Brief an Fürst Vjazemskij vom Novem-ber 1825 den Bezug aus der mönchischen Tradition her und erklärt sich über ein Wortspiel zum Vater des Helden: „S-(/?0+A -*<+#*#A /'#1 R2=#0+A )*+036 (#03 8-8 /'1- R2=#0+3.“ (Puškin IX, 342) Der Name „Onegin“ zeigt einen Verzicht auf die in der nachpetrinischen russischen Literatur üblichen „Charak-ternamen“, die „den Helden als Typus charakterisieren“, steht jedoch gleichzei-tig für die poeti"nost’ des Helden, der nicht außerhalb der fiktiven Welt existie-ren kann: H,9+*-3 J-(+6+; %63 72/#=/ =#*/3, F(&?8+0) /'8-,-673 /' )*+01+)- ,0-4+(/7'+, /%0-8/ 7/<*-0+6 )*#%7'-26#0+# / '/(, 4'/ /0- %/6$0- +(#'5 7)#1+J+4#78+# 4#*'@ 6+'#*-'&*0/7'+ +, 0-)/(+0-3 *#-650@# J-(+6++, /%0/2*#(#00/ 9@'5 0#2/,(/$0/A 20# <&%/$#7'2#00/=/ '#87'-. (Lotman 1980, 114)
14 Diese Ambivalenz zeigt sich etwa schon in der Reimung von modu und svobodu.
Zum unfreien, apokalyptischen Charakter des modnyj "elovek vgl. unten.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 17
Der Name Onegin kann mit dem Fluss in Verbindung gebracht werden (auch Lenskij trägt ja den Namen eines Flusses, der Lena, im Stamm); dies nicht nur, weil Onegin dort, also an einer natürlichen ‚Grenze‘ geboren wurde („*/%+673 0- 9*#=-< 0#2@“, EO 1, II) sondern auch gemäß der etymologischen Herkunft des Namens Onegin, der sich auf einen Fluss mit Namen Onega beziehen könn-te. Familiennamen, die auf der Wurzel eines Flusses aufbauen, bezeichnet Lot-man als unmöglich für reale russische Familiennamen der Puškin-Zeit (vgl. Lot-man 1980, 114, Turbin 1996, 118). So nimmt der Name des Helden im Titel be-reits die Fremdartigkeit Onegins vorweg. Die fiktive Welt ist nicht Abbild der realen Welt, in welcher der Held beheimatet und in der Fiktion ‚abgebildet‘ sein könnte, sondern offenbart sich als Produkt ihres Autors. Da Onegin in keiner ‚realen‘ generischen Kette stehen kann, wird der Autor auch hier zum ‚Vater‘ des Helden.
Der Unter- oder sekundäre rhematische Titel „Roman v stichach“ weist eben-falls auf ein ambivalentes Verhältnis zwischen Freiheit und ‚Eingesperrt sein‘ hin: die ‚freie‘ Prosa ist in die formale Regelhaftigkeit der Onegin-Strophe ge-bettet. Diese hybride Form des Romans spiegelt andererseits auch die Projektion des lyrisch-dichterisch freien Ichs wider, das sich den Forderungen des Genres (Roman) zu unterwerfen hat. Über die Bezugnahme auf das Thema des Romans – die Freiheit – erweist sich also der Titel als ironisches Statement des Autors, der sich somit dem seinerzeit häufig vorgebrachten Vorwurf der Konzeptlosig-keit entzieht.15
In dieser Hinsicht ist der Titel als Grenzmarkierung zwischen Werk und Welt insofern bezeichnend, als er die ambivalente Struktur bezüglich Freiheit, außer-textueller Wirklichkeit (in welcher der Autor ‚in der Fremde gefangen‘ ist) und dem Gefangensein in der Fiktion thematisiert. Aufgrund der durch die Hybridi-sierung der Genregrenzen („Roman v stichach“) erreichten Interferenzen wird jedoch eine Befreiung auch im Text möglich: Die fiktive Welt muss kein Ge-fängnis, kein starres Gebilde im Sinne eines ‚Typus‘ sein (wie auch Onegin kein ,Typus‘ ist; der starre Typus des „6+?0+A 4#6/2#8“(zu einer vergleichenden Analyse vgl. etwa Wedel 1961) wird eben auf verschiedenste Weise konterka-riert und durchbrochen) sondern erhält selbst ‚Wirklichkeitscharakter‘.
Eines der wenigen paratextuellen Elemente, die dem Roman von der ersten Ausgabe des ersten Kapitels bis zu der Ausgabe aus letzter Hand 1837 unverän-dert vorangestellt sind, ist das Motto pétri de vanite…, das als „aus einem Pri-vatbrief“ gekennzeichnet ist. Aus Entwürfen lässt sich schließen, dass es ein fik-tives, vom Autor erfundenes Motto ist (vgl. Puschkin 1999, 245). Das „Gefühl der Überlegenheit“ des Helden, die „vielleicht nur eingebildet ist“ („supériorité, 15 Zur zeitgenössischen Kritik vgl. die umfangreiche Monographie von Beatrice von
Sambeek-Weideli (1990).
Nora Scholz
18
peut-être imaginaire“) und das „jene[r] Art von Stolz [entspringt], die gute wie böse Taten mit der gleichen Unbeteiligtheit erkennen lässt“ („la même indiffé-rence les bonnes comme les mauvaises actions“) weist sowohl auf ein Element im Charakter des Helden als auch auf den Charakter des Textes selbst hin: die fehlende ‚Moral der Geschichte‘. In der Überlegenheit (die vielleicht nur einge-bildet ist), spiegelt sich sowohl die Autonomie des Textes als auch die des Hel-den wider.
Über Werkszueignungen16, wie wir auch vor Evgenij Onegin eine finden, schreibt Genette:
Die Werkszueignung ist […] immer demonstrativ, ostenativ, exhibitionis-tisch: Sie stellt eine intellektuelle oder private, wirkliche oder symbolische Beziehung zur Schau, und diese Zurschaustellung steht als Argument für einen höheren Wert oder als Motiv für Kommentare immer im Dienst des Werkes […]. (Genette 2001, 132)
Die Widmung gilt Petr AleksandroviM Pletnev, selbst Literat und Direktor der Petersburger Universität. Als ein enger Freund Puškins gab er ab 1825 dessen Werke heraus. Die Widmung erschien ursprünglich vor den Kapiteln vier und fünf des Romans, die 1828 veröffentlicht wurden. Erst in der zweiten Auflage der Gesamtausgabe des Romans 1837 wurde sie dem gesamten Werk vorange-stellt. Dem ersten Kapitel war bei Veröffentlichung 1825 eine Widmung an Puš-kins Bruder Lev SergeeviM vorangestellt (vgl. Lotman 1980, 116). Weiter heißt es bei Genette:
Erwähnt man als Auftakt oder Schlusstakt eines Werkes eine Person oder eine Sache als vorrangigen Adressaten, so wird sie zwangsläufig als eine Art idealer Inspirator einbezogen und auf die eine oder andere Weise an-gerufen, wie einst der Sänger die Muse anrief. „Für Soundso“ enthält im-mer ein gewisses „Durch Soundso“. Der Adressat der Zueignung ist ge-wissermaßen immer verantwortlich für das ihm zugeeignete Werk, dem er nolens volens ein Quentchen seiner Unterstützung und damit seiner An-teilnahme zukommen lässt. Dieses Quentchen ist keineswegs belanglos: Muß man noch einmal daran erinnern, dass der Bürge im Lateinischen auctor hieß? (Genette 2001, 133)
Die Widmung kann also als ein Zeichen der ‚auktorialen Machtabgabe‘ gese-hen werden. Gleichzeitig beinhaltet sie einen ‚Grund‘, aus dem das Werk ge-schrieben wurde: „He(@763 =/*%@A 72#' ,-9-2+'5, / .0+(-05# %*&$9@ 2/,-6;93, / ]/'#6 9@ 3 '#9# )*#%7'-2+'5 / W-6/= %/7'/A0## '#93“ – eine Funkti-
16 Genette unterscheidet zwischen Widmung und Werkszueignung, wobei er bei einer
Widmung von der persönlichen Widmung eines Einzelexemplars ausgeht. Da eine solche hier keine Rolle spielt, werden die Begriffe synonym verwendet.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 19
on, die Genette eigentlich für das Vorwort festgestellt hat (vgl. Genette 2001, 192).
Gleichzeitig wird das Ideal geschildert, von dem die Wirklichkeit sich ab-hebt: N/7'/A0## %&?+ )*#8*-70/A, / P23'/A +7)/60#00/A (#4'@, / F/X,++ $+2/A + 370/A, / .@7/8+< %&( + )*/7'/'@; / D/ '-8+ 9@'5 – *&8/A )*+7'*-7'0/A / F*+(+ 7/9*-05# )#7'*@< =6-2 (EO, vstuplenie).
„Dieser Kapitel bunterlei“ weist auf das Prosaelement hin, das der Dichter auch im „Gespräch des Dichters mit dem Verleger“ beklagt. Neben der „Blitz-ableiterfunktion“ des Vorwortes, die Genette für die vornehme Herabwürdigung des eigenen Werkes veranschlagt, tritt hier eine andere Funktion in den Vorder-grund: „Pestryj“ weist in seiner Bedeutung als nicht nur „bunt“ und „zusam-mengewürfelt“, sondern auch „gekünstelt“ (pestryj slog) auf die ‚Gemachtheit‘ des Textes hin.17 Der „zusammengewürfelte“ Text jedoch lässt in seiner Anei-nanderreihung von Prosaelementen Realitätseffekte (effets de réel) entstehen:
Die reine und einfache ,Repräsentation‘ des ,Realen‘, die nackte Darstel-lung dessen, ,was ist‘ (oder gewesen ist), erscheint somit wie ein Wider-stand gegenüber dem Sinn; dieser Sinn bestätigt den grossen, mythischen Gegensatz zwischen dem Gelebten (den Lebenden) und dem Verstehbaren (Barthes 1986, 145)
Die uslovnost’, die die Meisterschaft des Autors und die Systembedingtheit des Textes voraussetzt, wird hier ambivalent thematisiert: Es ist gerade die – absichtliche – Unvollkommenheit des ‚gemachten‘ Textes, die einer uslov-nost’18
entgegenwirkt und den Roman so in eine Sphäre der scheinbaren bezus-lovnost’ führt; eine Ebene, auf welcher der Text nicht mehr dem durch die Dif-ferenz zwischen Signifikat und Signifikant bedingten Aufschub unterliegt, son-dern zu einem ‚Sprung‘ in die Evidenz, d.h. also der Wirklichkeit der dargestell-ten Welt, fähig wird.
Das Evgenij Onegin vorangestellte „Gespräch des Verlegers mit dem Dich-ter“ (erschien erstmals zusammen mit dem Erstdruck des ersten Kapitels des Romans 1826. Bis 1829 blieb es an dieser Stelle in späteren Teilveröffentli-chungen von Evgenij Onegin erhalten. Erst nach der Vollendung ließ Puškin das Gespräch nicht mehr vor dem Roman drucken, sondern reihte es unter die Ge-dichte, wo es auch heute in der hier verwendeten Gesamtausgabe zu finden ist. (vgl. Puschkin 1999, 245) Auffällig ist zunächst die Form, die hier gewählt wur-de: Das Gespräch zwischen Autor und Verleger stellt den Dichter und den Ver-
17 Bereits 1824 erwähnt Puškin in einem Brief an Vjazemskij den Roman Evgenij O-
negin als „)#7'*@# 7'*/J@ */(-0'+4#78/A )/X(@.“ (XIII, 92) 18 Zum formalistischen Begriff der uslovnost’ vgl. Hansen-Löve 1978, 175ff
Nora Scholz
20
leger als in derselben Welt befindlich dar wie auch das Publikum, das das Buch schließlich in den Händen halten wird. Anstelle einer Herausgeberfiktion, die für einen ‚historischen Wahrheitsgehalt‘ der fiktiven Welt eingesetzt werden könnte, wird das Werk so deutlich als fiktiv gekennzeichnet und seine ‚künstle-rische Bedingtheit‘ (uslovnost’) betont. Zu beachten ist darüber hinaus die End-positionierung des Dichters, die hier an den Anfang gestellt wird: Wenn es auch pragmatisch scheinbar eine Selbstverständlichkeit ist, dass das Werk abge-schlossen sein muss, bevor der Dichter es aus der Hand und zur Veröffentli-chung freigibt, war das im Falle von Evgenij Onegin zunächst eben nicht der Fall, da der Roman kapitelweise erstveröffentlicht wurde.
Durch eine Analogieziehung mit der hier augenscheinlichen Allusion auf das „Vorspiel auf dem Theater“, das Goethes Faust vorangestellt ist, wird die Künstlichkeit der fiktiven Welt sowie die Funktion von (Prosa-) Literatur ver-stärkt betont. Der Dichter trauert hier den Tagen nach, als er noch Poesie schrieb, die von der Muse inspiriert war und bekennt sich nun zur Professionali-tät seines künstlerischen Schaffens: E 9@6 %-6#8/: / E 2*#(3 '/ 2/7)/(+0-6, / C/=%-, 0-%#$%-(+ 9/=-'@A, / F/X' 9#7)#40@A, 3 )+7-6 / H, 2%/<0/2#053, 0# +, )6-'@. / E 2+%#6 20/25 )*+;'@ 78-6 / H '#(0@A 8*/2 &#%+0#053, / Q%# 3 0- )+* 2//9*--$#053, / G@2-6/, (&,& )*+,@2-6. (EO II, 244)
Es ergibt sich in diesem Zusammenhang eine Leerstelle bezüglich des „Pro-logs im Himmel“ zu Goethes Faust, der im Rahmenbereich von Evgenij Onegin kein Äquivalent findet. Dieser in Anlehnung an die Hiobswette im AT verfasste Prolog drückt den Glauben des Herrn an seinen ‚Helden, Faust, aus, den er für stark genug hält, den ‚bösen‘ Verführungskünsten Mephistos zu widerstehen („Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“, Goethe, Faust I). Die ‚göttliche‘ Allmacht, die an ihren Helden glaubt, wird in Evgenij Onegin dergestalt als absent präsentiert. So erhält die Welt des Romans einen Realitätsanspruch, der wohlgemerkt nicht gleichbedeu-tend mit einem ‚realistischen Roman‘ ist, sondern ein utopistisches Potential des Helden ermöglicht: Wie der Held sich letzten Endes verhält, ist ihm selbst über-lassen. Die ‚Machtposition‘, wie sie David Bethea als ausschlaggebend für ein utopistisches vs. apokalyptisches Weltbild veranschlagt, ist eindeutig ‚innerhalb‘ der fiktiven Welt angelegt, die denn vom Autor auch einfach verlassen wird (vgl. auch unten).
Der Epilog kann in Evgenij Onegin wiederum als Leerstelle gesetzt werden. Bestimmt man die Funktion eines Epilogs mit Boris Ejchenbaum als ein „Ele-ment von Nach-Geschichte“ (after history) für die Hauptfiguren (^jchenbaum 1971, 232), so kann diese ‚Nach-Geschichte‘ im Fall von Evgenij Onegin im wahrsten Sinne als gelöscht bezeichnet werden: Die erhaltenen Fragmente des gelöschten 10. Kapitels lassen auf eine Annäherung des Titelhelden an die De-
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 21
kabristen schließen, wodurch dieser in eine nicht nur utopistische, sondern viel-mehr utopische, da revolutionäre Richtung gegangen wäre, wäre das Kapitel im Gesamtwerk des Romans erhalten geblieben. (vgl. Lotman 1980, 391f)
Vorwegnahme und „fremde Rede“ Über den Anfang von Evgenij Onegin schreibt Viktor Šklovskij: S-8 $# 0-4+0-#'73 «R2=#0+A >0#=+0»: W-0-2#7 /'8*@2-#'73 2 7#*#-%+0# */(-0-, 7 7#*#%+0# *-,=/2/*-, )*+ 4#( 6+40/7'5 =/2/*3Y#=/ 0# 2@370#0- 0-( 7/2#*?#00/. (Šklovskij 1923, 207)
Es wird also nicht eine Geschichte von Beginn an erzählt, sondern es wird mitten aus der Geschichte herausgegriffen und so in einer kompletiven Prolepse (Genette 1994) etwas vorweggenommen, was mitten aus der Geschichte heraus stammt.19 Erst in Strophe LII des ersten Kapitels ist die Geschichte an dem Punkt angelangt, mit dem sie beginnt: .%*&= )/6&4+6 /0 2 7-(/( %#6#/ >' &)*-2+'#63 %/86-% / V'/ %3%3 )*+ 7(#*'+ 2 )/7'#6+ / H 7 0+( )*/7'+'573 9@6 9@ *-%. / F*/4'3 )#4-65-0/# )/76-05#, / R2=#0+A '/'4-7 0- 72+%-05# / P'*#(=6-2 )/ )/4'# )/-78-8-6 / H '&' ,-*-0## ,#2-6, / F*+=/'/263375, %#0#= *-%+, / D- 2,%/<+, 78&8& + /9(-0 (+ '#( 3 0-4-6 (/A */(-0). (EO 1, LII)
Durch den ‚Vorausgriff‘ auf ein in der histoire erst später stattfindendes Er-eignis, nämlich Evgenij Onegins Gedanken auf der Fahrt zu seinem Onkel, bei der die Erzählung erst in Strophe 52 ankommen wird, ist der Standpunkt des Autor- Erzählers ‚nach der Geschichte‘, oder, streng genommen, zumindest sein Standpunkt nach Strophe LII des ersten Kapitels bewiesen – er weiß bereits, was kommen wird und wird so zum Komponisten, der die vorhandenen Teile eines in der fiktiven Welt ‚wirklichen Geschehens‘ (der histoire) nach seinem Gut-dünken im discours anordnet. Hier ist der Autor also offensichtlich ‘Außerhalb‘ der Geschichte – es ist nicht nur der Autor-Erzähler, sondern selbstverständlich der reale Autor Puškin, der die Geschichte anordnet. Der Umstand, dass der Roman mit einem in Anführungszeichen gesetzten ‚fremden‘ Wort bzw. Gedan-ken, nämlich dem des Helden, beginnt, und die Erzählung („'-8 %&(-6 (/6/%/A )/2#7-“, EO, 1, II) erst in der zweiten Strophe einsetzt, ist unter der Vorausset-
19 Das Verfahren der kompletiven Prolepse erzeugt gleichzeitig ein Geheimnis (zagad-
ka) dem Leser gegenüber, das erst in Strophe 52 gelichtet wird (razgadka). Zu den ‚Spuren‘, denen nicht nur der Leser, sondern vor allem auch der Autor-Erzähler zu folgen hat, und allgemein den Index-Zeichen, die ja auch Tat’jana schließlich von ihrer Verliebtheit in das ,Traumgebilde‘ (den ,Typus‘ Onegin) zu heilen vermögen, vgl. unten.
Nora Scholz
22
zung, dass der (durch seine Abwesenheit hervorgehobene) Anfang als besonders markiertes Konstruktionsverfahren zu gelten hat (vgl. Lotman 1966, 34), dahin-gehend zu interpretieren, dass die ‚eigene‘ Stimme des Helden betont wird. Ent-sprechend der Annahme, dass ein ‚innerhalb‘ der fiktiven Welt verankertes Handlungspotential des Helden als Voraussetzung zu einer utopistischen Aus-richtung des Werkes vorhanden ist, kann ein solches utopistisches Potential hier – in der ersten Strophe des Werkes – bereits als veranschlagt gelten. Die auf-grund der kompletiven Prolepse konstatierte Befindlichkeit des Autors nach der Geschichte, also eigentlich der Allmacht des Autor-Erzählers, wird auf diese Weise – durch das Verfahren der Setzung einer ‚fremden Rede‘ zu Beginn des Werkes – relativiert. Auch die hysteron proteron-Figur, die eine Inversion (pe-restanovka) auf dem linearen Zeitstrahl angeordneter Elemente darstellt, ist An-zeichen einer Aufhebung der Linearität. Damit wird einer End-Gerichtetheit, einer Teleologie des Textes entgegengewirkt. Die Erwartung (des Lesers) auf ein ‚Initium‘ wird enttäuscht – er weiß nicht, an welcher Stelle des linearen Zeitablaufs der histoire er sich befindet, sondern wird mit der Folge von etwas ihm bislang Unbekannten konfrontiert. So wird der Leser bereits mit dem ersten Satz von Evgenij Onegin zum Detektiv: Er muss das Rätsel, das der Autor ihm stellt, entschlüsseln; sich gewissermaßen auf die Suche nach der ‚Geschichte‘ machen. Endloser Text und Verabschiedung des Autors Das Ende der histoire von Evgenij Onegin gegen Ende des 8. Kapitels weist ebenfalls eine Leerstelle auf: Entgegen der Erwartungshaltung, die man an einen ‚realistischen‘ Roman, als welcher EO auch heute noch oft wahrgenommen wird, hatte, fehlt das Ende, das den Protagonisten entweder sterben oder heiraten lässt.20
Evgenij steht wie vom Blitz getroffen im Zimmer, nachdem Tat’jana ihn abgewiesen hat. Tat’janas Ehemann gewinnt an Lebendigkeit und kommt, be-gleitet vom Klang seiner Sporen, ins Zimmer: >0- &?6-. P'/+' R2=#0+A, / C-8 9&%'/ =*/(/( )/*-$#0. / . 8-8&; 9&*; /Y&Y#0+A / S#)#*5 /0 7#*%1#( )/=*&$#0! / D/ ?)/* 0#,-)0@A ,2/0 *-,%-673, / H (&$ S-'530+0 )/8-,-673 / (EO 8, XLVIII)
Das „8-8 9&%'/ =*/(/( )/*-$#0“ lässt auf die versteinerte Haltung des Helden schließen, der sich nicht mehr bewegen kann. Diese Bewegungslosigkeit steht 20 Zu Evgenij Onegin als realistischer Roman vgl. Pospelov 1941, 75 f. Zur Nicht-Ein-
lösung eines zu erwartenden Endes als Motivation und Daseinsberechtigung für das Sujet vgl. Hansen-Löve 1996, 194. Durch das ‚offene‘ Ende wird einer Teleologie der ‚Geschichte‘ entgegengewirkt: Es gibt keine übergeordnete (moralische) Instanz, die sich um ein ordnungsgemäßes Ende der Geschichte kümmern würde.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 23
der (scheinbaren) Lebendigkeit von Fürst N. gegenüber, dessen Sporen auch auf seine /Dienstgeschäfte/ hinweisen, während Evgenij Onegin in keinerlei sozialen Zusammenhalt mehr eingebunden ist. Anders als die beiden anderen Figuren in Evgenij Onegin, die nicht /dienen/, nämlich Lenskij und der Autor- Erzähler, ist Onegin auch kein Dichter, der sich mittels der Erschaffung einer fiktiven Welt /befreien/ könnte (auch Lenskij als /schlechter/ Dichter kann dies nicht). Dar-über hinaus ist Onegin nicht tot, nicht verrückt geworden, was ihn aus der (ge-linde gesagt) etwas /unbequemen/ Situation seiner Person befreien würde und insofern nicht /erlöst21
(„H /0 0# 7%#6-673 )/X'/(, D# &(#*, 0# 7/?#6 7 &(-.“, EO 8, XXXIX); der Autor-Erzähler verbündet sich mit dem Leser und lässt sei-nen Helden allein in der fiktiven Welt, überlässt ihn sich selbst „in seinem schlimmsten Moment“: „H ,%#75 =#*/3 (/#=/, / . (+0&'&, ,6&; %63 0#=/, / V+'-'#65, (@ '#)#*5 /7'-2+(, / D-%/6=/... 0-27#=%-.“ (EO 8, XLVIII)
Die Liebe „'#)#*5 /0 7#*%1#( )/=*&$#0“) jedoch, mit der Onegin zurück-gelassen wird, spricht für eine Entwicklung, die dieser durchgemacht hat: Jetzt erst ist er zum Menschen geworden, der nicht mehr als fiktiver ,Held‘ bzw. ,Typus‘ Spielball seines Autors ist – in übertragenem Sinne Mensch, der nicht mehr den gesellschaftlichen Regeln ausgeliefert ist, aus denen er sich während der Romanhandlung nicht befreien konnte. Er hat also eine Grenze hin zur Frei-heit überschritten. Das letzte Kapitel von Evgenij Onegin steht unter dem By-ronschen Motto:
Fare thee well, and if for ever Still for ever fare thee well. (EO 8, 245)
und kann somit als eine ‚Verabschiedung‘ des Helden gelten, der nun sich selbst überlassen wird. Es gibt jedoch noch einen anderen Aspekt dieses Phäno-mens: den Dichter, der sich von seinem Helden befreit.
[…] W- 0+( / N/2/650/ (@ )&'#( /%0+( / G*/%+6+ )/ 72#'&. F/,%*--2+( / N*&= %*&=- 7 9#*#=/(. Z*-! / N-20/ 9 (0# )*-2%- 6+?) )/*-! (EO 8, XLVIII)
Der Ausruf „)/*-!“, der nicht nur hier auftritt, sondern auch in einer Strophe, die Puškin in der Vorrede zu den separat veröffentlichten „>'*@28+ +, )&'#-?#7'2+3 >0#=+0-“ als „geopfert“ bezeichnet, F/*-: )#*/ )/8/3 )*/7+'; / E %#23'5 )#7#0 0-)+7-6; / D- 9#*#= *-%/7'-0@A 2@0/7+' / "/; 6-%5; %#23'@A 2-6– / ]2-6- 2-(, %#23'+ C-(#-0-(, + )*/4. (IV, 266)
21 Interessant ist hier das „Mut’“, das „fast“:„4&'5 7 &(- 0# 72/*/'+6, / H6+ 0# 7%#-6-673 )/X'/(. F*+,0-'573: '/-'/ 9 /%/6$+6!“ (EO 8, XXXVIII) Es bleibt also ein ‚Rest‘, auf den der Autor- Erzähler keinen Einfluss zu haben scheint.
Nora Scholz
24
deutet in seiner Unmittelbarkeit auf die Notwendigkeit hin, das Werk zu voll-enden und die (fiktive) Welt zu verlassen – was für den Sprechenden durchwegs mit glücklichen Assoziationen belegt ist, wie sich sowohl an dem „Z*-!“ als auch dem „*-%/7'0@A“ zeigt. Die Konnotation des „)/*-!“ mit dem ‚die Welt verlassen‘ wird auch durch eine Parallelziehung zu einem Gedicht deutlich, das Puškin in den 30er Jahren des 19. Jhts. an seine Frau Natalija GonMarova richte-te: F/*-, (/A %*&=, )/*-! [)/8/3] 7#*%1# )*/7+'- / O#'3' ,- %03(+ %0+, + 8-$%@A 4-7 &0/7+' V-7'+48& 9@'+3, - (@ 7 '/9/A 2%2/#( / F*#%)/-6-=-#( $+'5, + =63%5 – 8-8 *-, – &(*#(. D- 72#'# 74-7'53 0#', 0/ #7'5 )/8/A + 2/63. / N-20/ ,-2+%0-3 (#4'-#'73 (0# %/63 – N-20/, &7'-6@A *-9, ,-(@76+6 3 )/9#= / . /9+'#65 %-650&; '*&%/2 + 4+7'@< 0#=. (II, 354)
Auf den Text des Romans folgen in der Ausgabe aus letzter Hand (1837) die “>'*@28+ +, )&'#?#7'2+3 >0#=+0-“. In die erste Gesamtausgabe des Romans 1834 wurden sie nicht mit aufgenommen, sondern als Anhang angefügt. Sie können somit als ein Nach-Text bezeichnet werden. Odessa, das in den otryvki als eine Stadt der Freude und des sorglosen Lebens geschildert wird, verweist hier auf eine mit dem Paradies konnotierte Welt („C-8 (&7&65(-0 2 72/#( *-;“). Die Spiegelung von Puškins Leben in Odessa weist hier wiederum eine Interferenz zwischen der prosaischen und der feierlich-poetischen, ‚stilisierten‘ Wirklichkeit auf (vgl. Lotman 1989, 132). Dadurch, dass das ‚außerhalb‘ der Welt des Romans platzierte Kapitel eine paradiesische Welt eröffnet, ergibt sich eine Kreisbewegung zum Anfang hin: Der Held, der inmitten der Geschichte keinen Ausweg sieht und nicht erlöst wird, hat die Aussicht auf ein glückliches Leben ‚nach‘ der Geschichte – jedoch noch immer in der fiktiven Welt, die nach der Verabschiedung des Autors sich selbst überlassen wurde. Unter einer ande-ren Perspektive ergibt sich eine weitere Dimension dieses ,Paradieses‘. Nabokov schreibt in seinem Kommentar:
If today, in modern Russia, discarded stanzas such as the fragment of “Chapter 10” are affixed by editors to the established text, this is done un-der the pressure of an even more despotic and grotesque regime. (Nabokov 1975 i, 59).
Unter dieser Voraussetzung wäre die fiktive Welt als solche – da die Macht-haber der realen Welt auf sie keinen Zugriff haben – tatsächlich eine Art ‚Para-dies‘, in dem zumindest die Helden sicher weiter- (und bis in die Gegenwart über-)leben können, während der reale Autor der politischen Zensur und Verfol-gung weiterhin ausgesetzt ist.
Onegin could not possibly have embodied Decembrist principles, because the Decembrist world is outside the ‘magic crystal’ of the novel whose boundaries Pushkin had come to discern by the time he wrote the eighth
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 25
chapter. . . Nothing more can happen to these people, only to their author, who has already begun to detach himself from them. (Bayley 1971, 24, zit. nach: Franklin 1984, 375)
Der Text-Raum als absichtlich nicht-stilisierte Doppelung des Welt-Raumes In dem Kapitel „Literatura i ‚literaturnost’‘ v ‚Onegine’“ (Lotman 1995, 434-444) schreibt Lotman: F&?8+0 2 «>0#=+0#» )/7'-2+6 )#*#% 7/9/A, )/ 7&'+ %#6-, 0#2@)/6-0+(&; ,-%-4& – 2/7)*/+,2#7'+ 0# $+,0#00&; 7+'&-1+;, )*/)&Y#0-0&; 782/,5 )*+,(& )/X'+8+ */(-0- + )#*#2#%#00&; 0- #=/ &76/20@A 3,@8, - $+,0#00&; 7+'&-1+; 8-8 '-8/2&;. (Lotman 1995, 434)
In diesem Sinne kann der Roman Evgenij Onegin nicht als ein abgeschlos-senes Weltmodell betrachtet werden, das eine Objekthaftigkeit der fiktiven Welt (wie sie sich etwa durch die Parallelsetzung von Textanfang als Weltanfang und Textende als Weltende konstituiert) voraussetzen würde. Nicht nur die zeitge-nössische Kritik fasste den Roman als eine Reihe nicht weiter miteinander ver-bundener Episoden22
auf („6+?5 1#)5 0#723,0@< X)+,/%/2“, Lotman 1995, 434/435). So beinhalte der Roman eine Ansammlung verschiedenster Elemente, die „bis in die Unendlichkeit“ fortgesetzt werden könnte: F&7'5 F/X' 0-%-#' 0-( )*+3'0@< 2)#4-'6#0+A, 27# *-20/ – (#6/45; +6+ =&*'/(. Z 0-7 9&%#' 0#78/658/ <-*-8'#*/2, /)+7-0+3 70/2, 2+0, /9#%/2, 2*#(#0 =/%-, %*&,#A, */%0@< 6;%#A, + 4#=/ $# 9/65?#? F&7'5 )*/%-6$-#'73 >0#=+0 à l’ infini. (Zelinskij 1887, 78, zit. nach: Lotman 1995, 435)
Die End-losigkeit des Textes ist von Puškin bereits in der Einleitung zur Erst-veröffentlichung des ersten Kapitels 1825 impliziert („./' 0-4-6/ 9/65?/=/ 7'+</'2/*#0+3, 8/'/*/#, 2#*/3'0/, 0# 9&%#' /8/04#0/.“ (Puškin IV, 451)) und kongruiert mit der ‚Anfangslosigkeit’, welche die Erzählhandlung mitten im Verlauf der Geschichte einsetzen lässt.
22 Die Aneinanderreihung scheinbar nicht miteinander verbundener Episoden ent-
spricht dem Prinzip, das Puškin auch in seinem historischen Drama Boris Godunov (entstanden 1824/25) anwendet und lässt sich so als Verfahren werten, das eine his-torische ,Wirklichkeit‘ des Geschehens erzeugen möchte. So heißt es bei Striedter über Boris Godunov: „Ebenfalls von Shakespeare übernommen wurde die Technik der lockeren Reihung räumlich und zeitlich wechselnder Szenen, die ein Darstellen historischer Dynamik mit ständigen irrationalen Schwankungen erleichterte.“ (Strie-dter 1977, 21)
Nora Scholz
26
Die Anfangs- und Endlosigkeit des Textes wie auch die kapitelweise Erstver-öffentlichung implizieren die Eigenständigkeit der fiktiven Welt, die der wirkli-chen Welt als ein äquivalenter Text-Raum gegenübergestellt wird. Es soll nicht eine Geschichte erzählt werden, die von vornherein (also von ‚hinten‘ her) abge-schlossen ist, um dann erzählt werden zu können, sondern es soll eine Welt ge-schaffen werden, die in ihrem Werden und Vergehen derselben Prozesshaftig-keit unterliegt wie die außertextuelle Welt. Die Thematisierung des Schreibpro-zesses geht in den meisten Fällen mit der Ansprache an die Leser einher und stellt so eine Verbindung zwischen ‚innen‘ und ‚außen‘ der fiktiven Welt her. So wird beispielsweise am Ende des 1. Kapitels die absichtliche Unvollkommenheit des Textes konstatiert: E %&(-6 &$ / J/*(# )6-0- / H 8-8 =#*/3 0-,/2&; / F/8-(#7' (/#=/ */(-0- / E 8/04+6 )#*2&; =6-2&; F#*#7(/'*#6 27# X'/ 7'*/=/: / F*/'+2/*#4+A /4#05 (0/=/, / D/ +< +7)*-2+'5 0# </4&. (EO 1, LX)
Mittels der ,entblößenden‘ Offenlegung des Schreibprozesses wird der fiktive Charakter der Welt verdeutlicht, wodurch der Welt des Textes jedoch nichts an Eigenständigkeit genommen wird – die Betonungen des Schreibprozesses inter-ferieren auf auffällige Weise mit dem mimetischen (also nach-erzählenden, ,rea-listischen‘) Charakter des Romans, wodurch der Wirklichkeitscharakter (istin-nost’) der fiktiven Welt deutlich wird. Ein Beispiel für diese Interferenz wäre etwa die folgende Sequenz: H 2/' &$# '*#Y-' (/*/,@ / H 7#*#9*3'73 7*#%5 )/6#A... / (V+'-'#65 $%#' &$ *+J(@ .)/0; / D-, 2/' 2/,5(+ ## 78/*#A!) / >)*3'0#A (/%0/-=/ )-*8#'- / G6+7'-#' *#48-, 65%/( /%#'-. (EO 4, XLII)23
Das narrative Prosa-Element steht hier also für den mimetisch-,realistischen‘ Part des Romans, während das Lyrik-Element, das mit dem ,romantischen‘ Cha-rakter vor allem durch das Wortkunst-Element (vgl. Hansen-Löve 1983, 291-360) das eine Welt mittels der Signifikanten erschafft, verbunden ist und zu-gunsten der Narration zurückgedrängt wird. Das narrative Element ist verbun-den mit einer linear ablaufenden Zeit. Dadurch ist die erzählte Welt auf ein Ende gerichtet. Die nach festem Plan linear ablaufende Zeit zeigt sich besonders in der Beschreibung des Stadtlebens in St. Petersburg, das Onegin zunehmend langweilt:
23 In seinem bereits erwähnten Emigrations-,Roman‘ ZOO ili pis’ma ne o ljubvi (1923)
greift Viktor Šklovskij dieses Zitat auf und verdreht es in sein Gegenteil. Während Puškin sich dem Diktat des Reimes hier widersetzt, die Erwartungshaltung des Le-sers enttäuscht, wie um zu zeigen, dass die erzählte Welt sich eben nicht der Re-gelhaftigkeit der Sprache beugt, heißt es dort: „K/,@ + (/*/,@ & 0-7 </%3' 2 )-*#, )/'/(& 4'/ – *+J(@.“ (Šklovskij 1923, 296)
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 27
>0#=+0 #%#' 0- 9&652-* / H '-( =&63#' 0- )*/7'/*#, / F/8- 0#%*#(-6;Y+A 9*#=#' / D# )*/,2/0+' #(& /9#%. (EO 1, XV) RY# 9/8-6/2 $-$%- )*/7+' / W-6+'5 =/*34+A $+* 8/'6#', / D/ ,2/0 9*#=#'- +( %/0/7+', / V'/ 0/2@A 0-4-673 9-6#'. (EO 1, XVII)
Die ablaufende Zeit der Uhr, die das menschliche Zeitsystem in einen Rahmen einbettet und sie auf ein Ende hinführt, ist ergänzt um die Leerstelle zwischen dem ‚Tick‘ und dem ‚Tock‘, die Stelle, an der ein Entkommen aus der ablau-fenden Zeit möglich sein könnte.
The clock’s ‘tick-tock’ I take to be a model of what we call a plot, an or-ganisation which humanises time by giving it a form; and the interval be-tween ‘tock’ and ‘tick’ represents purely successive, disorganized time of the sort we need to humanise. (Kermode 1968, 45)
Nicht erkennend, dass etwa auf dem Land die „Uhren anders ticken “24 („. %#*#20# 9#, 9/65?+< 7&#': _#6&%/8 – 2#*0@A 0-? 9*#=#'“, EO 5, XXXVI) führt der Dandy Onegin als ein Kampfmittel gegen die ablaufende Zeit die Mode ins Feld, unterwirft sich aber gleichzeitig deren ‚Despotismus‘25: „C 4#(& 9#7)6/%0/ 7)/*+'5 7 2#8/(? / >9@4-A %#7)/' (#$ 6;%#A.“ (EO 1, XXV)
Die angestrebte Unsterblichkeit und somit das Anhalten des ablaufenden Zeitstromes kann so auch nicht eingelöst werden. Anstatt einer Metaphorisie-rung, die es Onegin erlauben würde, eine Göttin, die ja das Attribut der Unsterb-lichkeit trägt, zu werden, wird er ihr in einer metonymischen Annäherung nur ähnlich:
24 Vgl. dazu auch P. A. Jensen, „Zwischen ‚Tick-Tack‘ und ‚Tack.... Tick‘: Die aspek-
tuelle Konvergenz in der späten Prosa Cechovs“, J.R. Döring-Smirnov, P. Rehder, W. Schmid (eds.), Text. Symbol. Weltmodell. Johannes Holthusen zum 60. Geburts-tag, München 1984, S. 291-308.
25 „Der Herr der Mode ist – auf das Feld des Pansemiotismus reduziert – auch eine Art A p o k a l y p t i k e r: Wie dieser lebt er aus der Vorwegnahme eines nicht eintre-tenden Ereignisses […] Der Diskurs der Mode teilt mit dem der Apokalyptik die Pa-radoxie der Differenz, d. h. des Aufschiebens des Eigentlichen (des Endes, der Voll-endung im Apokalyptischen und der ‚Perfektion‘ im Modischen) und seiner Ankün-digung. Denn einerseits ist das Modische totaler Sklave der Zeitlichkeit (der Zyklen von Saisonen als säkularisierte Nachklänge eines mythisch-magischen Denkens in landwirtschaftlichen Perioden und Jahreszeiten), andererseits versucht die Mode die Zeit durch Aktualität zu ersetzen, indem sie – eben im Akt der Vorwegnahme, der ja immer auch einer der Beherrschung der Zeit sein will – das im Eintreten Begriffene schon w e i ß […].“ (Hansen-Löve 1996, 196)
Nora Scholz
28
H +, &9/*0/A 2@</%+6 / F/%/90@A 2#'*#0/A .#0#*#, / C/=%-, 0-%#2 (&$78/A 0-*3%, / G/=+03 #%#' 2 (-78-*-%. (EO 1, XXV)26
Die Leerstellen in Form der ausgelassenen Kapitel im Text, die diesem ‚Nicht-Zeit-Raum‘ innerhalb der ablaufenden Zeit entsprechen, spiegeln dieses Phänomen auf der textuellen Ebene wieder. So schreibt Brigitte Obermayr:
Sogar und gerade für den Exzess, wie wir ihn in Evgenij Onegin vorfinden (zwei Strophen sind mit einer Seite Punkte zusammengefasst), würde ich im Vergleich zu den sentimentalistischen Auslassungszeichenschüben von territorialer Askese sprechen, die mit ästhetischen Transformationen ein-hergeht, für die nicht mehr die Spannung zwischen Stimme und Schrift zentral ist, sondern bereits jene zwischen der Ordnung der Schrift und ih-rem Außerhalb. (Obermayr 2006, 11)
Die Spannung zwischen der Ordnung der Schrift und ihrem Außerhalb the-matisiert die Sehnsucht nach einer nicht auf ein Ende gerichteten, nicht linear ablaufenden Zeit, die, wie oben bereits angedeutet, außerhalb der diesseitigen, erreichbaren Welt angesiedelt ist und sich insofern weder in der Gegenwart noch in der Zukunft erreichen lässt. Sie ist konnotiert mit der Sehnsucht nach dem mythischen ‚Vorgestern‘, der Urheimat. Ausgedrückt ist diese Unerreichbarkeit etwa in dem gedoppelten Motto zum 2. Kapitel des Versromans:
O rus!.. D/r. > K&75!
Sich zwischen zwei Kapiteln und insofern also außerhalb des Textverlaufes befindend, ist in diesem einmal in lateinischer, einmal kyrillischer Schrift über-nommenen Wortspiel die uneingelöste Sehnsucht nach der Vergangenheit, dem ländlich-idyllischen ‚alten Russland‘, das die vorpetrinische Zeit betrifft, ge-kennzeichnet – die Doppelung in lateinischer Schrift kann für die po1lost’ des Landlebens in der Gegenwart stehen, in der Onegin bereits nach zwei Tagen in die gleiche Krankheit zurückfällt, die ihn auch in der Großstadt, St. Petersburg,
26 Das Maskerade-Motiv verbunden mit der Androgynität Onegins bringt diesen hier
mit dem Narziss-Mythos in Verbindung: „Im narzisstischen Verhältnis zur Außen-welt reproduziert sich nur das schon im Androgynismus ausgedrückte Prinzip. Es verneint die notwendige Beziehung zu anderen […]”. (Mattenklott 1970, 57, zit. n. Hansen-Löve 1989, 127) Auch an anderer Stelle wird Onegin mit Narziss in Verbin-dung gebracht: Das Motto zum dritten Kapitel „Elle était fille, elle était amoureuse” von Malfilâtre stammt aus dessen Verserzählung „Narcisse ou l’Ile de Vénus“ (1768). Der Satz bezieht sich dort auf die Nymphe Echo, deren selbstlose Liebe zu Narziss an dessen egoistischer Lieblosigkeit scheitert.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 29
bedrückte: den Spleen. Die Widersprüchlichkeiten (protivore"ii) des Textes (vgl. dazu etwa auch Woodward 1982) sind so in semantischer Hinsicht auf die erzählte Welt übertragen. Mittels der erweckten, doch nicht eingelösten Erwar-tungen (o2idanie), die sich auch auf der Ebene des Sujets gehäuft finden lassen, wird so in einer metonymischen (Ähnlichkeits-) Relation die außertextuelle Wirklichkeit, die ebenfalls keinen ,Plot‘ aufweist, der ein Ende impliziert hätte, nicht mimetisch abgebildet, sondern gedoppelt: Der durch die Narration erzeug-te Text-Raum entspricht dem Welt-Raum mit all seinen Lücken, Unvollkom-menheiten, Unerwartbarkeiten und Enttäuschungen.
Das Paradoxon demiurgischer Autorschaft Der konkrete Autor fungiert sowohl als Selektor als auch als Kombinator des Textes. Das Schicksal, das er seinen Helden auferlegt, kann, so er keinen schlechten Text schreibt, keine Zufälligkeiten beinhalten – es ist notwendiger-weise ‚von hintenher‘ konzipiert. Die Verantwortlichkeit für den Ablauf der (fiktiven) Geschichte kann der Autor nur in einer ‚Als-ob‘ -Handlung an einen innerhalb des Textes sich befindlichen Autor- Erzähler delegieren. Diese Positi-on des realen Autors als Alleinherrscher über die Welt des Textes bedingt die grundsätzlich apokalyptische Ausrichtung des narrativen Textes (vgl. oben).
Die erzählte Welt ist bereits abgeschlossen, bevor sie erzählt werden kann und insofern auf ein Ende hin gerichtet, als jede Handlung der in der Welt le-benden Personen zwangsläufig zu dem vom Autor bestimmten Ende hinführt.
Dieser Abgeschlossenheit der fiktiven Welt in Form eines Plots wird in Ev-genij Onegin auf verschiedenste Weise entgegengewirkt. Neben den bereits be-handelten Verfahren der ‚fremden Stimme‘, der Anfangs- und Endlosigkeit des Textes, der kapitelweisen Veröffentlichung und den absichtlich im Text belas-senen Widersprüchlichkeiten sind es auf der Ebene der ‚Geschichte‘ besonders die nicht eingelösten Erwartungen, die einem teleologischen Verlauf der ‚histoi-re‘ entgegenwirken. So ist beispielsweise die von Onegin in Strophe I des ersten Kapitels befürchtete ‚Erwartung‘, er müsste seinen Onkel zu Tode heucheln, umsonst: Der Onkel ist bereits tot, als Onegin dort eintrifft. Die gesamte Fabel (histoire) von Evgenij Onegin ist von der Nicht-Einlösung der angelegten Hand-lung geprägt: Der Autor, gezwungen, Schicksal zu spielen, lässt die Liebenden einander verpassen, lässt Onegin seinen Freund Lenskij erschießen und tut nichts, um der Grausamkeit der Geschichte entgegenzuwirken. Dass der Autor dieser Verantwortung des ‚Weltherrschers‘ entkommen und sie an den allmäch-tigen Willen des Zeves (Zeus) abgeben möchte, zeigt sich bereits in der 2. Stro-phe des ersten Kapitels: S-8 %&(-6 (/6/%/A )/2#7-, / O#'3 2 )@6+ 0- )/4'/2@<, / .7#2@?0#A 2/6#; W#2#7- / D-76#%0+8 27#< 72/+< */%0@<. (EO 1, II)
Nora Scholz
30
Dass jedoch unmittelbar in den darauf folgenden Versen das – fiktionsbrechende – Autor-Ich den Lesern seinen „Helden“ vorstellt, zeigt das Paradoxon, dem der Autor unterliegt. Wie um die Allmacht, die der Autor über seinen Helden hat, zu vertuschen, wird dieser im wieder unmittelbar darauf folgenden Vers als „guter Freund“ des Autoren-Ichs bezeichnet. So macht der Autor, obwohl er die Fikti-onalität der von ihm geschaffenen Welt betont, sich zu einem hilflosen Erzähler eines Geschehens, das er nicht beeinflussen kann. Diese ‚Entsendung‘ des doch eigentlich allmächtigen Autor-Ichs in den Text wird aufgrund der durch die Wechsel in der Ausprägung der Autor-Gestalt bedingten Interferenzen auf am-bivalent-ironische Weise thematisiert. Besonders deutlich klingt diese Ironie etwa im dritten Kapitel an: S-'530-, (+6-3 S-'530-! / P '/9/A '#)#*5 3 76#,@ 65;; / S@ 2 *&8+ (/%0/=/ '+*-0- / Z$ /'%-6- 7&%59& 72/;. (EO 3, XV) F+75(/ =/'/2/, 76/$#0/... / S-'530-! %63 8/=/ $ /0/? (EO 3, XXI)
Die ironische Grausamkeit des Autors, der Tat’jana sich in den (vom Autor konzipierten!) Helden mit all seinen Unzulänglichkeiten verlieben lässt, zeigt so das Spiel mit Wirklichkeit und Fiktion, das zum beherrschenden Thema des Romans wird. Onegin wird zum Träger dieser Ironie, wenn er Tat’jana vor sich selbst warnt: „Z$#6+ $*#9+A 2-( '-8/A / D-,0-4#0 7'*/=/; 7&%59/A.“ (EO 4, XV) Der dauernd unterbrochene Handlungsablauf, der besonders durch die Abschweifungen des Autor-Erzählers gekennzeichnet ist, gilt in derselben Grau-samkeit der nicht eintretenden Erwartung auch für den Leser. So wird am Ende des dritten Kapitels die ‚Spannungskurve‘, die aufgebaut wurde, indem Onegin nach Erhalt von Tat’janas Brief und dem langen Warten dieser auf seine Ant-wort, der Heldin nun endlich gegenübersteht, jäh unterbrochen, als es heißt: D/ 76#%7'2+3 0#$%-00/A 27'*#4+ / P#=/%03, (+6@# %*&,53, / F#*#78-,-'5 0# 2 7+6-< 3; / "0# %/6$0/ )/76# %/6=/A *#4+ / H )/=&63'5 + /'%/<0&'5: / N/8/04& )/76# 8-8-0+9&%5. (EO 3, XLI)27
Wie es keine Ein-lösung angelegter Sequenzen gibt, gibt es auch keine Er-lösung. Tat’jana verbleibt am Ende in ihrer ‚realen‘ Welt mit Fürst N. und geht nicht in ein fiktives Land des ‚Happy End‘ ein; Onegin steht wie versteinert und wird nicht erlöst, um das Leid, das ihm die fiktive Welt beschert hat, nicht län-ger ertragen zu müssen. Dies ist es, was das utopistische Moment von Evgenij
27 Berücksichtigt man, dass der zeitgenössische Leser nicht einfach umblättern konnte,
um zu erfahren, wie es weitergeht, bekommt diese Unterbrechung der Spannungs-kurve einen doppelt ‚grausamen‘ Charakter und wird über ein simples Verfahren der Spannungssteigerung, wie es etwa in der Trivialliteratur verwendet wird, hinausge-hoben: Das vierte Kapitel erschien erst Anfang 1828, während das dritte im Oktober 1827 veröffentlicht wurde. (vgl. Lotman 1980, 395)
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 31
Onegin wesentlich ausmacht: Die Helden werden nicht aus der fiktiven Welt entlassen, indem sie von außen – aus dem ‚Jenseits‘ der Text- und insofern auch Weltgrenze, also vom Autor, der das Schicksal der Helden lenkt, zu einer – wie auch immer gearteten – ‚Lösung‘ geführt werden. Sie verbleiben – führungslos, da der Autor sich verabschiedet, (vgl. unten) – in der Welt, die keine der in der Literatur möglichen oder üblichen ‚Lösungen‘ bietet und insofern ‚wirklich‘ wird: Die Helden werden zu Menschen, die sich selbst entscheiden müssen, wie und ob sie weiterleben wollen. So heißt es bei Lotman: F*+ X'/(, 4#( 96+$# =#*/A 8 (+*& 6+'#*-'&*0/7'+, '#( +*/0+40## /'0/?#0+# 8 0#(& -2'/*-. F/60/# /72/9/$%#0+# >0#=+0- + S-'530@ 2 2/75(/A =6-2# /' )&' 6+'#*-'&*0@< -77/1+31+A (%/7'+=-#(/# '#(, 4'/ ,-%-#'73 )*#%#650/ 6+'#*-'&*0-3 7+'&-1+3, 8/'/*-3 *#?-#'73 '-8, 4'/ 27# «6+'#*-'&*0/#» /8-,@2-#'73 6+?#00@( ,0-4#0+3) /7/,0-#'73 8-8 2</$%#0+# +< 2 )/%6+00@A, '/ #7'5 )*/7'/A + '*-=+4#78+A (+* %#A7'2+'#650/A $+,0+. (Lotman 1995, 444)
Die „einfache und tragische Welt des wirklichen Lebens“, die sich in der Fik-tion darstellt, verfügt eben nicht über eine auktorial gesteuerte ‚Ordnung‘, son-dern ist dergestalt durch den ‚Trick‘ des Autors, der sich mittels verschiedenar-tiger Interferenzen und Metalepsen ‚in den Text‘ begeben hat, von einer ebenso großen Vielfältigkeit und Unabschließbarkeit wie die ‚reale‘, außertextuelle Welt. Die doppelte Projektion: Der Held als Null-Person In einer synekdochischen Pars pro Toto-Beziehung werden die ‚Spuren‘, also die Index- Zeichen, über den Text verteilt, woraus sich die fiktive Welt für den – imaginären, idealen – Leser, der den Typus kennt und erkennen kann, als Gan-zes re-konstruieren lässt. Dies setzt ein ‚Mehr-Wissen‘ des adäquaten Lesers voraus, denn nur wer die über den Text verteilten Indizes ‚lesen‘ kann, erkennt die sich aus der Übereinanderlegung mehrerer Typologien ergebenden Interfe-renzen und kann so die Text-Welt als Ganzes nach-bilden. Die metonymische Ähnlichkeitsrelation der fiktiven zur außertextuellen Welt spiegelt sich auch innerhalb des Textes wieder. Hier gilt es zunächst auf die Spuren einzugehen, die von ‚außerhalb‘, also vom Autor, in den Text gelegt werden, und die von den Protagonisten gelesen werden können, insofern ihnen das nötige prophe-tisch-‚detektivische‘ Potential mitgegeben wurde.28
28 Die unbedeutenden Kleinigkeiten führen etwa auch im Detektivroman (der, so er das
Genre ungebrochen bedient, im Sinne von Bethea eine eindeutig apokalyptische Ausrichtung aufweist) zum Ziel. Holmes‘ berühmte Methode: „Achte stets auf die Belanglosigkeiten“ funktioniert nur unter einer Voraussetzung: Er muss sich, bevor
Nora Scholz
32
Die ‚Spuren‘, die den Autor-Erzähler von Evgenij Onegin immer wieder zu Abschweifungen ‚verführen‘, also gerade nicht auf eine Erfüllung des Plots aus-gerichtet sind, sind die leichten Spuren der Frauenfüße, die der Dichter als me-tonymische (pars pro toto) Ersetzung für seine eigene verlorene, unglückliche Liebe einsetzt: I<, 0/$8+, 0/$8+! […] N-20/ 65 %63 2-7 3 ,-9@2-6 / H $-$%& 76-2@ + )/<2-6, / H 8*-A /'1/2, + ,-'/4#05#? / H74#,6/ 74-7'5# ;0@< 6#', / C-8 0- 6&=-< 2-? 6#=8+A 76#%. (EO 1, XXXI)
Die Füßchen gelten hier also als ein Parallelismus zum (verlorenen) Glück – wie das Glück der Vergangenheit schwand, schwinden auch die Spuren in der Wiese. Der ‚Stellvertretercharme‘ und der prophetische Charakter der Füßchen werden auch in der nächsten Strophe hervorgehoben: >0-, )*/*/4#7'2&3 2,=63%& / D#/1#0#00&; 0-=*-%&, / .6#4#' &76/2-0/; 8*-7/A / _#6-0+A 72/#2/650@A */A. (EO 1, XXXII)
Der prophetische („)*/*/4#78+A“) Charakter der Füßchen ist jedoch trüge-risch. Am Ende der sich über 5 ` Strophen (EO 1, XXXVIII-XXXIV) erstrek-kenden otstuplenie heißt es: >0+ 0# 7'/3' 0+ 7'*-7'#A, / D+ )#7#0, +(+ 2%/<0/2#00@<: / P6/2- + 2,/* 2/6?#90+1 7+< / >9(-04+2@... 8-8 0/$8+ +<. (EO 1, XXXIV)
Die ‚Urheber‘ der Spuren, die zu den Füßen gehörenden Frauen, werden als „Zauberinnen“ bezeichnet, die den Leser (der Spuren) betrügen und in die Irre führen. So stellt der Dichter sich selbst als Opfer der ‚von außen‘, der unwieder-bringlichen Vergangenheit in die Gegenwart seiner Träume gelegten ‚Spuren‘ dar. Er konnte sie nicht ‚lesen‘, nicht einfangen, und konnte so nicht in der Ge-genwart ankommen. Dies ist es auch, was den Autor- Erzähler mit seinem Hel-den verbindet: Auch Onegin, nachdem er den Frauen entsagt hat („H 2-7 )/-8+0&6 (/A R2=#0+A“, EO 1, XLIII) und feststellen musste, dass er kein Poet ist („]/'#6 )+7-'5 – 0/ '*&%& )/*0@A / R(& 9@6 '/?#0; 0+4#=/ / D# 2@?6/ +, )#*- #=/“, EO 1, XLIII) wird zum ‚gescheiterten Leser‘:„>'*3%/( 80+= &7'--
er sich auf die Suche nach Indizien macht, eine Vorstellung davon gemacht haben, wie das Verbrechen begangen worden sein kann. Ist alles auf ein solches Ende, also die Lösung des Falles, hin geordnet, müssen die vorhandenen ‚Spuren‘ nur noch in diese Hypothesen eingefügt werden. Vorausgesetzt werden also ein ‚prophetisches‘ Potential des Helden und ein verantwortungsbewusster (alleinverantwortlicher, d.h. ‚apokalyptischer‘) Autor, der die richtigen Spuren ausgelegt hat. (vgl. dazu auch die Studie „Du kennst meine Methode… Charles S. Peirce und Sherlock Holmes“, Sebeok/Umiker-Sebeok 1982).
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 33
2+6 )/68&, / V+'-6, 4+'-6, - 27a 9#, '/68&: / S-( 78&8-, '-( /9(-0 +65 9*#%.“ (EO 1, XLIV)
Die für seinen Autor zum Zeitpunkt des Verfassens des 1. Kapitels wichtigs-
ten Eigenschaften, die Verantwortung für sein Land und das Dichter-Sein, feh-len Onegin.29
Er verkehrt auf Bällen, begeistert sich jedoch, ganz im Sinne eines modnyj "elovek („(/% 2/7)+'-00+8“, EO 1, XXIII) nur für den Tanz und die Damen und nimmt nicht an ernsthaften Gesprächen teil („]*-0+'5 (/64-05# 2 2-$0/( 7)/*#“, EO 1, V). Sein Interesse an Ökonomie („W-'/ 4+'-6 I%-(- P(+'- / H 9@6 =6&9/8/A X8/0/(“, EO 1, VII) gilt für Puškin als das Gegenstück zu der Ablehnung von ‚leichter‘ Poesie im Stile Karamzins (vgl. Lotman 1995, 402). Bezeichnend in dieser Hinsicht ist auch Onegins Desinteresse an Geschichte – er interessiert sich nur für die ‚Anekdoten‘ und spricht Latein lediglich in Flos-keln.30 Unter ‚Freiheit‘ versteht er, seinen Lehrer wegzujagen: „F/*- 0-%#$%+ =*&7'+ 0#$0/A, / Monsieur )*/=0-6+ 7/ %2/*-. / ./' (/A >0#=+0 0- 72/9/-%#.“ (EO 1, IV)
So ist die Oberflächlichkeit seiner Bildung eines der bezeichnenden Charak-teristika des Helden. Onegin weist einen Katalog von Negativitäten auf und be-findet sich, da er keinerlei militärischen Rang hat, in einer totalen Außenseiter-Rolle in Bezug auf die russische Gesellschaft (vgl. dazu Lotman 1995, 406, Lotman 1980, 42 f, Clayton 1985, 138f). H'-8, +%#/6/=+4#78+A /96+8 =#*/3 2#75(- /)*#%#6#0. >0 )*#%7'-2-63#'73 0-( 8-8 /9Y#7'2#00@A '+), %-6#8+A /' %#8-9*+7'78+< +%#-6/2 + /' )/,+1++ 7-(/=/ -2'/*-. (Lotman 1995, 404)
Der Katalog dieser Negativitäten nähert Onegin der Figur des Dämons in dem gleichnamigen Gedicht (1823) an:
[…] R=/ &6@98-, 4&%0@A 2,=63%, / R=/ 3,2+'#650@# *#4+ / .6+2-6+ 2 %&?& <6-%0@A 3%. / D#+7'/Y+(/A 86#2#'/; / >0 )*/2+%#05# +78&-?-6; / >0 ,2-6 )*#8*-70/# (#4'/;; / >0 2%/<0/2#05# )*#,+*-6; / D# 2#*+6 /0 6;92+, 72/9/%#; / D- $+,05 0-7(#?6+2/ =63%#6 – / H 0+4#=/ 2/ 27#A )*+*/%# / G6-=/76/2+'5 /0 0# </'#6. (II, 13)
29 Die ausdrückliche Nicht-Identifizierung des Dichters mit seinem Helden (EO 1,
LVI) widerspricht dem romantischen Poem, wie es etwa von Byron (Childe Ha-rold’s Pilgrimage) verfasst wurde.
30 „N/7'-'/40/ 27)/(0+'5, 8-8/# 20+(-0+# &%#636+ %#8-9*+7'@ + F&?8+0 S-1+-'& 8-8 /96+4+'#6; '+*-0/2, 4'/9@ )/03'5 (0/=/,0-4+'#650/7'5 X'+< 76/2.“ (Lotman 1995, 404)
Nora Scholz
34
Nicht zuletzt die Maskenhaftigkeit und Widersprüchlichkeit in Onegins Charak-ter ist es, die ihn so zu einem Diabol, einer Null-Person werden lässt: V'/ 0-( )*#%7'-2+' /0 )/8-? / V#( 0@0# 32+'73? / "#65(/'/(, C/7-(/)/6+'/(, )-'*+/'/(, / Q-*/65%/(, 82-8#*/(, <-0$/A, / H65 (-78/A Y#=/650#' +0/A, / H65 )*/7'/ 9&%#' %/9*@A (-6@A, C-82@ %- 3, 8-8 1#6@A 72#'? (EO 8, VIII)
So wird der Held des Romans zu einer freien Projektionsfläche. Tat’jana in ihrer Eigenschaft als Leserin erschafft sich ‚ihren‘ Onegin – den sie aufgrund seiner ‚Charakter-losigkeit‘ gar nicht näher kennen(-lernen) kann, aus den Vor-bildern ihrer Lektüre von Werken wie etwa Richardsons sentimentalistischem Briefroman Sir Charles Grandison und Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse (EO 2, XXIX).
In seiner Eigenschaft als ‚Leser‘ wiederum setzt Onegin jedoch selbst Index-Zeichen, anhand derer Tat’jana später ihren Irrtum rekonstruieren kann. Als sie sich in Onegins Bibliothek begibt, findet sie die indexhaften Spuren seines Dau-mennagels (zum Daumennagel Onegins vgl. Hansen-Löve 2008, 173-198), ein-gedrückt ins Papier der von ihm gelesenen Bücher: ]*-0+6+ (0/=+# 7'*-0+1@ / >'(#'8& *#,8&; 0/='#A; / Q6-,- 20+(--'#650/A %#2+1@ / Z7'*#(6#0@ 0- 0+< $+2#A. / S-'530- 2+%+' 7 '*#)#-'-05#(, / C-8/; (@765;, ,- (#4-05#( / G@2-6 >0#=+0 )/*-$#0, / . 4#( (/64- 7/=6-?-673 /0. (EO 7, XXIII)
Diese Spuren bringen sie schließlich zu der Erkenntnis, dass der Onegin, in den sie sich verliebt hat, nur eine Projektion war – und dass der wirkliche One-gin wiederum nur eine Projektion, ein Scheinbild (prizrak) ist, wenn auch eine andere / das eines anderen: V'/ $ /0? Z$#6+ )/%*-$-05#, / D+4'/$0@A )*+,*-8, +65 #Y# / "/7-82+4 2 Q-*/65%/2/( )6-Y#, / V&$+< )*+4&% +7'/68/2-05#, / P6/2 (/%0@< )/60@A 6#87+8/0?.. / Z$ 0# )-*/%+3 6+ /0? (EO 7, XXIV)
Die ‚Geschichte‘ von Evgenij Onegin beruht auf einer doppelten Projizierung des Helden. Einerseits ist es Tat’jana selbst, die ein Scheinbild ihres Helden aufgrund ihrer Lektüre projiziert, andererseits ist der Held von seinem Autor als Null-Person in die Fiktion projiziert und konstituiert sich aus Worten („slov modnych polnyj leksikon“).
Das Fehlen des ‚Eigenen‘ in Onegin drückt sich vor allem auch in seiner Fremdartigkeit ("u2oe) aus, die sich auch in der Bezeichnung „4&%-8“ (EO 7, XIV) zeigt. Die damit verbundene Konnotation ("udo…) des Befremdlichen, Wundersamen erlaubt keinen Rückschluss auf einen vollständigen Typus, da der Typus nicht bekannt ist und macht Onegin zu einer ‚Null-Person‘ insofern, als er
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 35
aufgrund der nicht schlüssigen Index-Zeichen kein ‚Ganzes‘ ergibt.31 Er spricht
vornehmlich französisch und umgibt sich mit Dingen, für die der russischen Sprache die Worte fehlen: „D/ 3(4*(5)40, 6.(7, 8,5%*, / .7#< X'+< 76/2 0- *&778/( 0#';“ (EO 1, XXVI).32
Gerade die ‚dämonischen‘ Qualitäten des Helden – wörtlich in Verbindung gebracht mit Puškins Demon durch die „höhnische“ Rede („3,2+'#650@A“) bringen diesem die Freundschaft zu seinem Autor ein: „P)#*2- >0#=+0- 3,@8 / "#03 7(&Y-6; 0/ 3 )*+2@8 / C #=/ 3,2+'#650/(& 7)/*&.“ (EO 1, XLVI)
Da die ‚dämonischen‘ Qualitäten Onegins eben keine schöpferischen sind, sondern mit der Handlungslosigkeit, dem Gefangen-Sein (als Fremder in der Fremde) einhergehen, ist der Held als Figur ‚eingesperrt‘ in starre Verhaltens-codes, die ihn dazu zwingen, sich wie ein Automat zu verhalten. Obwohl er die-se Handlungsunfähigkeit erkennt, vermag er sich nicht daraus zu befreien und tritt wider besseres Wissen das Duell gegen seinen Freund Lenskij an33:
[…] R2=#0+A / D-#%+0# 7 72/#A %&?/A / G@6 0#%/2/6#0 7-( 7/9/A. (EO 6, IX) […] >0 (/= 9@ 4&27'2- /90-*&$+'5, / I 0# Y#'+0+'573, 8-8 ,2#*5; / >0 %/6$#0 9@6 /9#,/*&$+'5 / "6-%/#7#*%1#. «D/ '#)#*5 / Z$ )/,%0/; 2*#(3 &6#'#6/.../ […] H 2/' /9Y#7'2#00/# (0#05#!34
/ F*&$+ 0- 4#7'+, 0-? 8&(+*! / H 2/' 0- 4#( 2#*'+'73 (+*! (EO 6, XI)
Die Codes und Rollen, die Onegin einnimmt, sind zahlreich. Er ist nicht nur Duellant, sondern vor allem auch Verführer, „(/%0@A 4#6/2#8“, Zyniker und
31 Die Erscheinung eines Individuums in verschiedenen Gestalten kann als dämoni-
sches, teuflisches Artefakt gelten. Es handelt sich hier jedoch nicht um einen positiv-schöpferischen ‚Dämon‘, sondern um einen ‚Geist der Verneinung‘. (vgl. auch Clay-ton 1985, 140 f)
32 Tat’jana steht demgegenüber an dieser Stelle als ‚Plus-Person‘: Sie verkörpert das ‚Eigene‘ (svoe), die einfache, russische Schönheit mit dem starken Charakter, die russkaja du1a. Die im Text enthaltenen Widersprüchlichkeiten erlauben jedoch auch in Bezug auf Tat’jana nicht den Rückschluss auf einen ‚Typus‘. Während sie an die-ser Stelle als russkaja du1a bezeichnet wird, kann sie an anderer Stelle nicht einmal genug Russisch, um den Brief an Onegin in ihrer Muttersprache zu verfassen, und liest die Werke der westlichen Romantiker und Sentimentalisten.
33 Zum Duell als striktem Code, der den Teilnehmern ihren freien Willen nimmt und sie zu Automatons reduziert, vgl. Lotman 1980, 102/103. Unablässlich an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis auf Puškins Vystrel’, dessen Held sich innerhalb dieser starren Struktur durch den verzögerten (ausgebliebenen) Schuss seine Indivi-dualität zu erhalten vermag.
34 Hierbei handelt es sich um einen Vers Griboedovs. Die ebenso ‚unabschließbare‘ Vielfalt des Intertextes in Evgenij Onegin, auf die hier nicht eingegangen werden kann, wäre als ein weiteres Indiz auf die ‚Offenheit‘der fiktiven Welt zu werten.
Nora Scholz
36
Landbesitzer. Während er als Landbesitzer entgegen der Norm handeln kann und die Fronarbeit – entgegen dem Gerede der anderen Landbesitzer – durch eine „leichte Pacht“ ersetzt (EO 2, IV), vermag er sich aus dem Joch der öffent-lichen Meinung jedoch in einer entscheidenden Angelegenheit, in der es schließ-lich gilt, Lenskijs Leben zu retten, nicht zu befreien, wie er sich auch am Vor-abend des Duells nicht aus der Rolle des ‚Verführers‘ befreien konnte, der mit der Verlobten seines Freundes flirtet. Zwischen diesen beiden Modi, dem in seiner Maskenhaftigkeit unbeweglich-erstarrten Zyniker und dem handlungsfä-higen Menschen, ist Onegins duale, nicht auf einen Typus festlegbare Natur angelegt. Die Kehrseite seines ‚Versagens‘ im Falle des Duells mit Lenskij zeigt sich daran, dass Onegin hier als Wert-Erhalter auftritt. Die Zerstörung des Wer-tes ‚Freundschaft‘ impliziert die Zerstörung der (für Puškin) inadäquaten, senti-mentalen Poesie, die immer an der Oberfläche verharrt. Indem sie keine Gren-zen überschreitet und nicht an die Wurzeln des menschlichen Daseins heran-reicht, hat sie sich nicht von ihren starren Codes und Automatismen befreit und kann somit wiederum als eine Verneinung der Individualität gesehen werden. Onegin wird so zum Träger von Puškins ästhetischer Theorie und verkörpert die Kraft, die von Karamzin’scher Versifikation zu Puškins Lyrik führt. (Clayton 1985, 149)
Die forcierte Unbeweglichkeit des Helden erinnert an Puškins Faszination des statischen Bildes, der Skulptur, des Denkmals.35 Die Mensch-Skulptur-Alternation bildet eine Parallele zum ‚Mednyj vsadnik‘ (Peter I.) und dem ka-menyj gost’ des Don Juan. Präsent ist sie auch in der Figur Napoleons, der als kleine (Stein-) Statuette in Onegins Bibliothek auftaucht. In der Beschreibung des Moskauer Petrovskij zamok (EO 7, XXXVII) wird die Parallele von Onegin und Napoleon noch deutlicher: D#', 0# )/?6- "/782- (/3 / C 0#(& 7 )/2+00/A =/6/2/;. / D# )*-,%-0+8, 0# )*+#(0@A %-*, / >0- =/'/2+6- )/$-* / D#'#*)#6+2/(& =#*/;. / >'7#6#, 2 %&(& )/=*&$#0, / Q63%#6 0- =*/,0@A )6-(#05 /0. (EO 7, XXXVII)
In der gleichen Haltung wird auch Onegin am Ende (EO 8, XLVIII) ‚be-siegt‘: Er steht unbeweglich, von Tat’jana, die er erobern wollte, abgewiesen. Während es bei Napoleon jedoch der Verstand (um) ist, der ‚versunken‘ („)/-=*&$#0“) ist, ist es bei Onegin das Herz (vgl. oben).
35 Über den Bezug auf Exegi Monumentum („E )-(3'0+8 7#9# 2/,%2+= 0#*&8/'2/*-0@A […] / D#', 2#75 3 0# &(*& – %&?- 2 ,-2#'0/A 6+*# / "/A )*-< )#*#$+2#' + '6#053 &9#$+' […]“, 1836) drückt sich hier gleichwohl auch die Dimension des Dichters aus, der in seinem Werk weiterlebt, obwohl er sich daraus ‚verabschiedet‘. Vgl. dazu Lachmann 1990, 303ff.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 37
Die Konzeption der dualen Natur Onegins, in der beide Möglichkeiten, so-wohl die starre Unbeweglichkeit als auch die Fähigkeit, diese zu überwinden, angelegt sind, ist auch in der hybriden Form des Romans in Versen ausgedrückt. Während die Onegin-Strophe den Rahmen für die Prosa-Erzählung gibt, muss diese sich aufgrund der möglichen Flexibilität der Strophenform nicht in jedem Fall daran halten und kann der strikten Regelhaftigkeit der Poesie entkommen.
Das ‚Eingesperrt-Sein‘ der individuellen Natur in Onegin, die dem ‚Typus‘ entkommen könnte, zeigt sich an einer weiteren ‚Grenzstelle‘ im Text: Tat’jana malt, als sie den Helden erwartet, nachdem sie ihm ihren Brief hat zukommen lassen, ein E für Evgenij auf die Fensterscheibe und umschließt es mit einem O für Onegin.
Das Motiv des Gefängnisses in der Fremde findet sich also nicht nur auf der Ebene des Autor-Erzählers, sondern auch auf der Ebene der Helden. So verab-schiedet sich Tat’jana aus ihrer ländlichen Welt, die durch das Motto „/ *&75“ vor dem zweiten Kapitel mit dem alten, vorpetrinischen Russland, der glückli-chen Vergangenheit assoziiert ist, mit den Worten: „[…] F*/7'+ $ + '@, (/3 72/9/%-! C&%-, ,- 4#( 7'*#(6;73 3? V'/ (0# 7&6+' 7&%59- (/3?“ (EO 7, XXVIII)
Beinahe-Grenzüberschreitungen Gerade Onegins Zynismus und sein Gelangweilt-Sein in der Welt sind es, die ihm eine – wenn auch nur scheinbare – ‚Grenzüberschreitung‘ erlauben. Als er sich damit abfinden muss, dass er kein Poet ist und selbst in den Büchern, als ‚Leser‘, keine Erfüllung mehr findet, gewinnt Onegin an Evidenz. Er ist der Sphäre der künstlich-oberflächlichen Welt der Zeichenhaftigkeit, die ihn in den Konventionen des St. Petersburg der nachpetrinischen Zeit gefangen hielten, entronnen. Dies ist die Stelle, an der eine Freundschaft zwischen Onegin und seinem Autor, dem Autor-Erzähler, möglich wird: „Z76/2+A 72#'- 72#*=0&2 9*#(3, / C-8 /0, /'7'-2 /' 7&#'@, / P 0+( )/%*&$+673 3 2 '/ 2*#(3.“ (EO 1, XLV) Besonders bezeichnend bezüglich einer metaleptischen ‚Grenzüberschrei-tung‘ zwischen Text und Welt muss das von Puškin eigens angefertigte Bild gelten, das diesen mit seinem Freund und Helden an der Nevamauer stehend zeigt:
Nora Scholz
38
In Hinsicht auf die ‚Freiheit‘ des Helden spielt vor allem der Unterschied zwi-schen linear und nicht-linear ablaufender Zeit eine Rolle. Die nicht-linear ablau-fende Zeit zeigt sich in den Träumen und Sehnsüchten Onegins,36
der sich in einer ‚leeren‘ Welt wähnt und damit die Sympathie des Autor- Erzählers ge-winnt: "0# 0*-2+6+75 #=/ 4#*'@, / "#4'-( 0#2/650-3 )*#%-00/7'5, / D#)/%-*-$-'#650-3 7'*-00/7'5 / H *#,8+A, /<6-$%#00@A &(. […] S/(+6- $+,05 /9/+< 0-7; / . /9/+< 7#*%1- $-* &=-7. (EO 1, XLV)
Das Gefühl ist es, das Onegin in Vergangenheit und Erinnerung versinken und ihn nicht ‚handeln‘ lässt, ihn jedoch nichtsdestotrotz oder gerade deshalb zu einem für den Autor-Erzähler interessanten Menschen macht: C'/ 4&27'2/2-6, '/=/ '*#2/$+' / F*+,*-8 0#2/,2*-'+(@< %0#A: / S/(& &$ 0#' /4-*/2-0+A, / S/=/ ,(+3 2/7)/(+0-0+A, / S/=/ *-78-305# =*@-,#'. .7# X'/ 4-7'/ )*+%-#' / G/65?&; )*#6#7'5 *-,=/2/*&. (EO 1, XLVI)
Dem in Träume abgleitenden Außenseitertum Onegins, der sich zurücksehnt nach dem Glück der Vor-Vergangenheit („S-8 &0/7+6+75 (@ (#4'/A / C 0-4--6& $+,0+ (/6/%/A“ EO 1, XLVII), sich besonders aber auch durch seine Ziel- und Tatenlosigkeit auszeichnet („G#, 76&$9@, 9#, $#0@, 9#, %#6, / D+4#( 36 Die Unterscheidung zwischen linear und nicht-linear ablaufender Zeit entspricht der
Stadt-Land-Opposition. Als Stadt gilt in diesem Zusammenhang besonders St. Pe-tersburg als ‚künstlich‘ erbaute Stadt, während das ‚alte‘ Moskau auf natürliche Art und Weise gewachsen ist. (vgl. dazu u.a. auch Striedter 1977)
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 39
,-03'573 0# &(#6“, EO 8, XII) steht die linear ablaufende Zeit jener gegenüber, die in die Regelhaftigkeit der Gesellschaft eingebunden sind: G6-$#0, 8'/ 7(/6/%& 9@6 (/6/%, / G6-$#0, 8'/ 2/2*#(3 7/,*#6,/ C'/ )/7'#)#00/ $+,0+ </6/%/ P 6#'-(+ 2@'#*)#'5 &(#6;/ C'/ 7'*-00@( 70-( 0# )*#%-2-673, / C'/ 4#*0+ 72#'78/A 0# 4&$%-673, / C'/ 2 %2-%-1-'5 6#' 9@6 J*-0' +65 <2-', / I 2 '*+%1-'5 2@=/%0/ $#0-'; / C'/ 2 )3'5%#73' /72/9/%+673 / >' 4-7'0@< + %*&=+< %/6=/2, / C'/ 76-2@, %#0#= + 4+0/2 / P)/8/A0/ 2 /4#*#%5 %/9+673, / > 8/( '2#*%+6+ 1#6@A 2#8: / N. N. )*#8*-70@A 4#6/2#8. (EO 8, X)
Die – ironisch als „prachtvoller Mensch“ bezeichnete –‚unbekannte‘ Person (N. N.) zeichnet sich so durch keinerlei Individualismus aus. Durch den Initial „N.“ kann diese Person u. a. mit Tat’janas Ehemann, dem Fürst N., in Verbin-dung gebracht werden, der so einen ‚positiven‘ (oder eben auch negativen) Kon-trapunkt zu Onegin darstellt. Der fehlende Individualismus, der ein Leben nach den geregelten Abläufen der Gesellschaft gewährleistet, führt dazu, dass das, was das Leben ausmacht, die Gefühle und Leidenschaften, verleugnet werden, wodurch das Dasein ein farbloser „Strang“ wird: D#70/70/ 2+%#'5 )*#% 7/9/; / >%0+< /9#%/2 %6+00@A *3%, / Q63%#'5 0- $+,05, 8-8 0- /9*3%, / H 276#% ,-4+00/; '/6)/; / H%'+, 0#*-,%#-633 7 0#A / D+ /9Y+< (0#0+A, 0+ 7'*-7'#A. (EO 8, XI)
Während also jene, die ohne zu hinterfragen in der Menge mittrotten, dem li-nearen Zeitablauf von der Geburt zum Tod unterliegen, ist Onegin in seiner ‚Freiheit‘ von jeglichen Einbindungen und Verpflichtungen von diesem Ablauf ausgenommen. Immer wieder hat es den Anschein, als könne Onegin dem Kata-log seiner Negativitäten entkommen. So widerspricht etwa der Dichter selbst der Ähnlichkeit des Helden mit seinem Demon: "#$%& 6;%#A 96-=/*-,&(0@< / F*/76@'5 )*+'2/*0@( 4&%-8/(, / H6+ )#4-650@( 7&(-79*/%/(, / H65 7-'-0+4#78+( &*/%/(, / H65 %-$# %#(/0/( (/+( (EO 8, XII)
Als Onegin sich in Tat’jana verliebt, kommt er der russischen Poesie und selbst dem Dichtertum am nächsten: V'/ 4&'5 7 &(- 0# 72/*/'+6 / H6+ 0# 7%#6-673 )/X'/(. / F*+,0-'573: '/-'/ 9 /%/6$+6! / I '/40/: 7+6/A (-=0#'+,(- / P'+</2 */77+A78+< (#<-0+,(- / R%2- 2 '/ 2*#(3 0# )/7'+= / "/A 9#7'/68/2@A &4#0+8. (EO 8, XXXVIII)
Wichtig ist jedoch auch hier wieder das „fast“ („4&'5“, „#%2-“), es bleibt immer ein Rest; die angelegte Handlung wird nicht eingelöst: „H /0 0# 7%#6-6-73 )/X'/(, / D# &(#*, 0# 7/?#6 7 &(-.“ (EO 8, XXXIX) Dieser „Rest“, das „4&'5“ ist es, der Onegin am Leben und innerhalb der fiktiven Welt hält: Er wird nicht auf eine wie auch immer geartete Er-Lösung zugeführt, sondern an
Nora Scholz
40
der Schwelle zum Ende hin sich selbst überlassen. Das „4&'5“ findet sich auch an Tat’janas ‚Fast-Grenzüberschreitung‘ hin zur Ohnmacht/zum Tod („S-'530- 4&'5 $+2- 6#$+'“, EO 5, XX). Der Traum in Kapitel 5 ist nicht so sehr als eine Grenzüberschreitung hin zu Vergangenheit oder Zukunft zu betrachten, sondern vollzieht vielmehr eine Grenzüberschreitung in Tat’janas Inneres (in den Be-reich Jenseits der (angelesenen und gesellschaftlichen Konventionen): Sie wird mit ihren Ängsten und Wünschen konfrontiert. Die durchaus als sexuell zu be-trachtende Konnotation des „(/#!“ bringt sie der Ohnmacht nahe. Sie stirbt je-doch nicht, sondern erwacht ratlos. Den Zugang zum ‚Außerhalb‘ hat sie nicht gewonnen; sie muss, um den Traum zu deuten, mit einem Weissagungsbuch vorlieb nehmen („S/ 9@6, %*&,53, "-*'@0 W-%#8-, / Q6-2- <-6%#A78+< (&-%*#1/2, / Q-%-'#65, '/68/2-'#65 70/2“; EO 5, XXII).
Der Traum der Gegenwart: zwischen Prophetie und Erinnerung Die ‚Vorahnung‘, die Tat’jana (in der Mitte des Romans, vgl. Clayton 1985, 34) zugeschrieben ist, weist die Welt als sinn-haft aus, indem sich in ihr ein rätsel-haftes Muster (pattern) aus dem volkstümlichen Aberglauben entnommenen Be-deutungszusammenhängen abzeichnet: S-'530- 2#*+6- )*#%-053( / F*/7'/0-*/%0/A 7'-*+0@, / H 70-(, + 8-*'/40@( =-%-053(, / H )*#%78-,-0+3( 6&0@. / R# '*#2/$+6+ )*+-(#'@; / S-+07'2#00/ #A 27# )*#%(#'@ / F*/2/,=6-?-6+ 4'/-0+9&%5, / F*#%4&27'2+3 '#70+6+ =*&%5. (EO 5, V)
Es ist dies jedoch nicht die apokalyptische Vor-schau, die die Welt auf ein Ende ausrichtet, sondern der Glaube in die Sinnhaftigkeit des Diesseits, der sich auf die (irdische) Zukunft bezieht: S/-'/ *-%/7'5! / Q-%-#' 2#'*#0-3 (6-%/7'5, / C/'/*/A 0+4#=/ 0# $-65, / F#*#% 8/'/*/A $+,0+ %-65 / O#$+' 72#'6-, 0#/9/,*+(-; (EO 5, VII)
Selbst die ‚Alten‘ geben die Hoffnung, und sei sie noch so unberechtigt, nicht auf: „H 27# *-20/: 0-%#$%- +( / O$#' %#'78+( 6#)#'/( 72/+(.“ (EO 5, VII)
Die Frage Tat’janas, die sie aus den priznaki beantwortet haben möchte, weist so einen erstaunlich ‚nüchternen‘ Charakter auf. Abgewiesen von ihrem Geliebten, wäre der Plot für eine sentimentalistische Heldin klar vorgezeichnet: Die nicht erfüllte Liebe wäre für sie mit dem Tod im Wasser, dem Tod nach einer langen Krankheit oder dem Gang ins Kloster verbunden. Die zu erwarten-de Frage wäre also: ‚wird Onegin mich (doch noch) heiraten?‘ Stattdessen stellt Tat’jana in ihrem Ritual eine erstaunlich zukunftsorientierte Frage nach dem Vornamen des Mannes, den sie heiraten wird – Onegin kommt hier nur noch als eine von vielen Möglichkeiten in Betracht („C-8 2-?# +(3?“, EO 5, IX). Das Thema der sich verpassenden Liebenden korreliert mit der Nicht-Einlösung der
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 41
angelegten Handlungen auch in anderen Bereichen des Romans und ist darüber hinaus mit der steten Sehnsucht nach dem Unerreichbaren verbunden, die bereits das Paradies (die glückliche Vor-Vergangenheit) zerstörte: > 6;%+! .7# )/</$+ 2@ / D- )*-*/%+'#650+1& b2&: / V'/ 2-( %-0/, '/ 0# 26#4#', / .-7 0#)*#7'-00/ ,(+A ,/2#' / C 7#9#, 8 '-+07'2#00/(& %*#2&; / W-)*#'0@A )6/% 2-( )/%-2-A: / I 9#, '/=/ 2-( *-A 0# *-A. (EO 8, XXVII)
Da es jedoch gerade der sich aus der Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, Verbotenen, ergebende ‚Sündenfall‘ ist, der den auf die Erde geworfenen Men-schen zum Menschen macht, ist diese unerfüllte Liebe die notwendige Voraus-setzung zu der ‚Mensch-werdung‘ auch der Protagonisten von Evgenij Onegin: Eine erfüllte Liebe würde sie aus der Realität ihrer Welt in das Reich der ‚Lite-raturhaftigkeit‘ eingehen lassen, in der jegliche Enttäuschung und Verwicklung in einem dem Genre entsprechenden Plot aufgelöst würde – und jegliches ,uto-pistische‘ Potential verspielt wäre. Die Liebe zu Tat’jana ist es, die Onegin schließlich ein Ziel, eine Sehnsucht verleiht und ihn aus seiner chandra befreit. Damit einhergehend ist er einem Menschen als ‚Lenker‘ seines eigenen Schick-sals in Kapitel 8 des Romans näher als je zuvor: C&%- )/ 0#( 72/A 9@7'*@A 9#=. (EO 8, XXXIX) P'*#(+' >0#=+0? .@ ,-*-0# Z$ &=-%-6+; '/40/ '-8: / F*+(4-673 8 0#A, 8 72/#A S-'530# / "/A 0#+7)*-26#00@A 4&%-8. (EO 8, XL)
Nicht zuletzt die an dieser Stelle auftretende Interferenz in Form der Stro-phen-überschreitung (Enjambement) ist es, die einen größeren Handlungsspiel-raum und die Möglichkeit einer Steuerung des eigenen Schicksals impliziert: Aus den starren Verhaltensweisen ausgebrochen, kann Onegin sich seiner (tö-richten) Hoffnung hingeben und so zum Menschen werden.
Sowohl die nicht erfüllte Liebe von Evgenij und Tat’jana als auch die des Autor-Erzählers, der an verschiedenen Stellen im Roman auf seine unglückliche, verlorene Liebe hinweist, weisen jedoch einen Hang zur Vergangenheit auf. So liebt Tat’jana Evgenij weiterhin, weigert sich diese Liebe jedoch einzulösen, da sie sie in der Vergangenheit begründet sieht: E )6-4&... #76+ 2-?#A S-0+ / .@ 0# ,-9@6+ %/ 7+< )/* (EO 8, XLV) P#A4-7 /'%-'5 3 *-%- / .7; X'& 2#'/?5 (-78-*-%-, / .#75 X'/' 96#78, + ?&(, + 4-% / W- )/68& 80+=, ,-%+8+A 7-%, / W- 0-?# 9#%0/# $+6+Y#, / W- '# (#7'-, =%# 2 )#*2@A *-,, / >0#=+0, 2+%#6- 3 2-7, / N- ,- 7(+*#0-0/# 86-%9+Y#, / Q%# 0@04# 8*#7' + '#05 2#'2#A / D-% 9#%0/A 030#; (/#A... (EO 8, XLVI)
Nora Scholz
42
Auch die verlorene, enttäuschte Liebe des Autor-Erzählers liegt in der Ver-gangenheit begründet. Seine unglückliche Liebe ist es, die sich zur „Muse“ auf-schwingt und ihn zum Poeten macht: W-(#4& 87'-'+: 27# )/X'@ – / O;92+ (#4'-'#650/A %*&,53. / G@2-6/, (+6@# )*#%(#'@ / "0# 70+6+75, + %&?- (/3 / H< /9*-, '-A0@A 7/<*--0+6-; / H< )/76# (&,- /$+2+6- (EO 1, LVII)
Jedoch handelt es sich hier nicht um einen sentimentalistischen Poeten, der sein Gefühl in seiner ganzen Unmittelbarkeit benötigt, um Poesie zu schaffen. Vielmehr ist es die Erfahrung, die es ihm im Nachhinein ermöglicht, die uslov-nost’ der fiktiven Welt zu gestalten: F*/?6- 6;9/25, 32+6-75 (&,-, / H )*/370+673 '#(0@A &(. / P2/9/-%#0, 20/25 +Y& 7/;,- / ./6?#90@< ,2&8/2, 4&27'2 + %&(; / F+?&, + 7#*%1# 0# '/78&#', / F#*/, ,-9@2?+75, 0# *+7&#', G6+, 0#/8/04#00@< 7'+</2, / D+ $#078+< 0/$#8, 0+ =/6/2 (EO 1, LIX)
Wie die Liebe von Tat’jana und Onegin nicht eingelöst wird und sie somit zu in der ‚Gegenwart‘ der fiktiven Welt sich befindlichen Menschen macht, die mit all ihren Sehnsüchten, Erinnerungen und Enttäuschungen allein gelassen wer-den, wird die Liebe des Autor-Erzählers nicht eingelöst, um ihm nicht die Kunstfertigkeit seines poetischen Schaffens zu nehmen. So bedingt sich die Nicht-Einlösung gegenseitig: Um die Protagonisten in einem ‚welthaften‘ Text leben zu lassen, der in seiner absichtlichen Nicht-Organisiertheit und der Nicht-Einlösung der angelegten Handlung eine Doppelung der wirklichen Welt dar-stellt, muss der Autor-Erzähler sein eigenes Gefühl und die daraus entspringen-de Enttäuschung und Sehnsucht (sowohl die Liebe als auch die Heimat betref-fend) als Erfahrung, als Material nutzen. So stellt sich der Dichter in den Dienst der Poesie, die eine eigenständige Welt erschaffen kann, die nicht von den Sche-mata, Genre-Regelhaftigkeiten oder auch – und das wohl nicht zuletzt – mora-lisch/gesellschaftlichen Ansprüchen einer übergeordneten Autor-Figur (bzw. des politischen Machthabers, der diese zu zensieren vermag) dominiert wird.
L i t e r a t u r
Puškin, A.S. Sobranie so"inenij v desjati tomach, Gosudarstvennoe izdatel’stvo chudoUestvennoj literatury, M. 1960.
Puschkin, A.S.: Jewgeni Onegin, aus dem Russischen von Wolf-Dietrich Keil, Frankffurt/M., 1. Auflage, 1999.
Barnes, H. (2006): The Stolen Prince: Gannibal, Adopted Son of Peter the Great, Great-Grandfather of Alexander Pushkin, and Europe's First Black Intellectual, New York.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 43
Barthes, R. (1968/1986): „The Reality Effect“, Ders.: The Rustle of Language, London, 141-148.
Bayley, J. (1971): Pushkin: A Comparative Commentary, Cambridge. Bethea, D. M. (1989): The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction,
Princeton. Boyd, A. (1972): „The Master and the Source: Alexander Puškin and Evgenij
Onegin“, ders. (Hg.): Aspects of the russian novel, Princeton. Boyd, B. (1965): „Eugene Onegin“, Vladimir Nabokov: The American Years,
Princeton, 318-355. Brodskij, N.L. (1932): Kommentarij k romanu A.S. Pu1kina „Evgenij Onegin“,
Moskva. TiUevskij, D. (Hrsg.) (1953): Evgenij Onegin. A novel in verse by A. S. Pu1kin,
Cambridge. Clayton, D.J. (1975): „Emblematic and Iconographic Patterns in Pushkin’s
Eugene Onegin: A Shakespearean Ghost?“, Germano-Slavica 6, 53-66. Clayton, D.J. (1985): Ice and Flame. Aleksandr Pushkin’s Eugene Onegin, To-
ronto. Dolinin, A. (1995): „Eugene Onegin“, Alexandrov, Vladimir (Hrsg.): The Gar-
land Companion to Vladimir Nabokov, New York, 117-130. Ebbinghaus, A. (2004): Pu1kin und Russland. Zur künstlerischen Biographie des
Dichters, Wiesbaden Eskin, M. (1994): Nabokovs Version von Pu1kins „Evgenij Onegin“. Zwischen
Version und Fiktion – eine übersetzungs- und fiktionstheoretische Untersu-chung, München.
Franklin, S. (1984): „Novels without end: Notes on ‚Eugene Onegin‘ and ‚Dead Souls‘“, Modern Language Review; 79/2, 372-383.
Gearhart, S. (1984): The open boundary of History and Fiction. A Critical Ap-proach to the French Enlightenment, Princeton.
Genette G. (2001): Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, aus dem Französischen von Dieter Hornig, Frankfurt/M.
Genette, G. (1994): Die Erzählung [Discours du récit; 1972, u.: Nouveau dis-cours du récit; 1983.], Übers. v. Andreas Knop, München.
Greber, E. (2007): „Aleksandr Puškin: Evgenij Onegin“, In: Bodo Zelinsky (Hg.): Der russische Roman, Köln, Weimar, Wien (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte N. F., A: Slavistische Forschungen 40, 2; Russische Literatur in Einzelinterpretationen 2), 93–116.
Hansen-Löve, A.A. (1978): Der russische Formalismus. Methodologische Re-konstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien.
Hansen-Löve, A.A. (1983): „Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort- und Bildkunst. Am Beispiel der russischen Moder-ne“,W. Schmid und W.-D. Stempel (Hg.), Dialog der Texte, Wiener Slawis-tischer Almanach, Sonderband 11, Wien 1983, 291-360.
Nora Scholz
44
Hansen-Löve, A.A. (1989): Der russische Symbolismus. System und Entwick-lung seiner Motive, Band I, Diabolischer Symbolismus, Wien.
Hansen-Löve, A.A. (1996): „Diskursapokalypsen: Endtexte und Textenden. Russische Beispiele“, Karlheinz Stierle, Rainer Warning (Hg.): Das Ende. Figuren einer Denkform, München, 193-250.
Hansen-Löve A.A (2008): „Das Buch als solches: Russische Beispiele von Puš-kin bis Mandelštam“, Ph. A. Häcker, Th. Mundi, B. Rath, M. Wiefarn (Hg.), textern. Beiträge zur literaturwissenschaftlichen Kontext-Diskussion, Mün-chen, 173-198.
Hielscher, K. (1965): A. S. Pu1kins Versepik. Autoren-Ich und Erzählstruktur, München.
Jensen, P.A. (1984): „Zwischen ‚Tick-Tack‘ und ‚Tack.... Tick‘: Die aspektuelle Konvergenz in der späten Prosa Cechovs“, J.R. Döring-Smirnov, P. Rehder, W. Schmid (Hgg.), Text. Symbol. Weltmodell. Johannes Holthusen zum 60. Geburtstag, München, S. 291–308
Kelley, G. (1964): The characterization of Tat’jana in Pu1kin’s ‘Evgenij Onegin’, Ann Arbor.
Kermode, F. (1968): The sense of an ending. Studies in the Theory of Fiction, Oxford.
Lachmann, R. (1990): Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russi-schen Moderne, Frankfurt/M., 303ff.
Laksin, V. (1979): „DviUenie ‚svobodnogo romana‘: Zametki o romane Evgenij Onegin“, Literaturnoe Obozrenie (6): Organ Sojuza Pisatelej SSSR, Moskva, 17-24.
Lotman, J. M. (1960): „K cvoljucij postroenija charakterov v romane Evgenij Onegin“, Pu1kin: Issledovanija i materialy III, Moskva,131-173.
Lotman, J. M. (1995): „Roman v stichach Puškina ‚Evgenij Onegin‘“, Speckurs. Vvodnye lekcii v izu"enie teksta, SPb.
Lotman, J.M. (1966): „Die modellbildende Bedeutung der Begriffe „Anfang“ und „Ende“ in künstlerischen Texten (O modelirujušMem znaMenii ponjatij „konca“ i „naMala“ v chudoUestvennych tekstach)“, Eimermacher (1971): Se-miotika Sovietica 2. Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962-1973), Aachen.
Nabokov, V. (1975): Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksandr Pushkin, Translated from the Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokov, I-IV, Princeton.
Pospelov, G. (1941): „Evgenij Onegin kak realistiMeskij roman“, Pu1kin. Sbor-nik stat’ej pod red. A. Egolina, Moskva.
Rybnikova, M.A. (1924): „Avtor v ‚Evgenii Onegine’“, dies.: Po voprosam komposizii, Moskva.
Das utopistische Potential in Evgenij Onegin 45
Schmid, W. (1982): „Die narrativen Ebenen ,Geschehen‘, ,Geschichte‘, ,Erzäh-lung‘ und ,Präsentation der Erzählung‘“, Wiener Slawistischer Almanach 9, 83-110.
Schmid, W. (1991): Pu1kins Prosa in poetischer Lektüre. Die Erzählungen Bel-kins, München.
Schmid, W. (2001): „Narratologija Pushkina [Puschkins Narratologie]“, D. Be-thea / A. L. Ospovat / N.G. Ochotin / L. S. Fleishman (Hg.): Pushkinskaja konferencija v Stenforde 1999. Materialy i issledovanija, Moskva, 300-317.
Schmid, W. (2006): „Abstrakter Autor und abstrakter Leser“, URL: http://www.icn.uni-hamburg.de/sites/default/files/download/publications/ ws_abstrautorleser030325.pdf [23.01.2015].
Šklovskij, V. (1969) [1916]: „Die Kunst als Verfahren.“ in: Striedter, Jurij (Hg.): Texte der russischen Formalisten, Bd. I, München.
Šklovskij, V. (1923): „Evgenij Onegin (Puškin i Stern)“, O"erki po po-tike Pu1-kina, Berlin.
Šklovskij, V. (2002) [1923]: „Zoo ili pis’ma ne o ljubvi“, iE1"e ni"ego ne kon"i-los’, Moskva.
Striedter, Jurij (1977): Dichtung und Geschichte bei Pu1kin, Konstanz. Torgovnick, M. (1981): Closure in the Novel, Princeton. Turbin, V.N. (1996): Poetika romana A. S. Pu1kina „Evgenij Onegin“, Moskva Vinokur, G.O. (1941): „Slovo i stich v Evgenii Onegine“, Pu1kin. Sbornik statej
pod. red. Egolina, Moskva. Wedel , E. (1961): „Onegin-PeMorin-Tackij“, Welt der Slaven (6), 355-367. Woodward, J.B. (1982): „The 'Principle of Contradictions' in Yevgeniy One-
gin“, The Slavonic and East European Review 60/1, 25-43. Zelinskij V.A. (1887): Russkaja kriti"eskaja literatura o proizvedenijach Pu1-
kina, Moskva.









































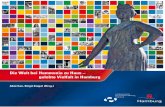










![Jähnichen, Gisa (2008). Musik Welt Bilder 1. Aachen, Shaker Media. [160 p.].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314a3bd3ed465f0570b3bf0/jaehnichen-gisa-2008-musik-welt-bilder-1-aachen-shaker-media-160-p.jpg)









