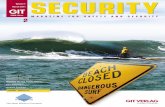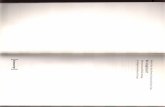Sicherheit in Freiheit
Transcript of Sicherheit in Freiheit
1
Gert-Joachim Glaeßner
Sicherheit in Freiheit
(Technische Universität Dortmund 9. Dezember 2011)
Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ist von
einem zentralen Thema beherrscht: Sicherheit.
Spätestens nach dem 11. September 2001 ist für alle
sichtbar geworden, dass wir völlig neuen Gefährdungen
unserer Sicherheit gegenüber stehen. Alte Gewissheiten
sind dahin. Moderne Staaten und Gesellschaften werden
nicht mehr allein im „klassischen“ Sinne von Außen,
durch andere Staaten und von Innen, durch Gegner und
Feinde der politischen und gesellschaftlichen Ordnung
bedroht. Die tradierte Trennung zwischen äußerer und
innerer Sicherheit eines politischen Gemeinwesens ist
überholt, so sie denn jemals im modernen Staatenleben
gerechtfertigt war - man denke nur an die enge
Verknüpfung von politischer Systemauseinandersetzung,
„nationalen Befreiungsbewegungen“ und als Agenten
einer revolutionären Weltzentrale agierenden Parteien
in der Zwischenkriegszeit und im Kalten Krieg. Das
dieser Art von Auseinandersetzungen innewohnende
Freund-Feind-Denken hat, so scheint es, einen neuen
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
2
Gegenstand gefunden: den realen oder imaginierten
Islamismus.
Allen Grobschlächtigkeiten vieler Diskussionen zum
Trotz verweist die Debatte über das neue Feindbild
„Islamismus“ auf ein tiefer liegendes Problem. Mittels
eines Feindbildes, der Markierung des Anderen, kann
Gemeinschaft gestiftet und Sicherheit im Sinne einer
Zugehörigkeit zu einer gegen innere und äußere
Anfechtungen und Zumutungen verschworenen
„Gesinnungsgemeinschaft“ erzeugt werden. Es geht um
die Verteidigung des „Eigenen“ gegenüber dem
„Fremden“. Sicherheit, nicht Freiheit wird zur
Richtschnur des Handelns. Aus der Abwehr realer oder
vermeintlicher Sicherheitsrisiken erwächst ein
Freiheitsrisiko (Denninger 1977, Bd. 1:20; Braunthal
1990). In Zeiten wachsender Ungewissheiten ist diese
Gefahr der Vertauschung von Wertorientierungen von der
Freiheit zur Sicherheit evident und es wird deutlich,
welche Bedeutung der Bewahrung oder Wiederherstellung
von ”Sicherheit” im Wertehaushalt der Bevölkerung
zukommt.
Moderne Gesellschaften sind aber unsichere
Gesellschaften. Die Globalisierung der Wirtschaft, die
Informationsrevolution und durch sie hervorgerufene Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
3
tief greifende mentale und kulturelle Veränderungen,
die beschleunigte Ablösung industriegesellschaftlich
geprägter Sozialstrukturen und sozialer Milieus,
demographische Entwicklungen und Wanderungsbewegungen,
welche die Grundfesten der tradierten sozialen
Sicherungssysteme erodieren lassen, die Bedrohung
durch international agierende organisierte
Kriminalität, die wachsende Zahl von staatlichen
Gebilden, in denen private Gewalt statt Recht und
Ordnung das Leben der Menschen bestimmt, dramatische
Veränderungen im internationalen System, die zur
Auflösung bipolarer Sicherheitsstrukturen geführt
haben, das Entstehen einer multipolaren, kaum
steuerbaren internationalen Ordnung und nicht zuletzt
der internationale Terrorismus - all dies sind
Faktoren der Unsicherheit.
Sicherheit zu gewährleisten ist von Alters her Aufgabe
der staatlichen Ordnung. Mit Sicherheit, so hat es
schon 1651 Thomas Hobbes formuliert, sei nicht allein
die bloße Erhaltung des Lebens gemeint, „sondern auch
alle anderen Annehmlichkeiten des Lebens, die sich
jedermann durch rechtmäßige Arbeit ohne Gefahr oder
Schaden für den Staat erwirbt“.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
4
Die Bürger erwarten vom Staat, dass er sie vor
Angriffen auf Leib und Leben, ihr Eigentum, ihre
Lebensweise und ihre persönlichen Freiheiten schützt,
gleichgültig ob sie aus der Gesellschaft heraus oder
von äußeren Feinden drohen. Dafür akzeptieren sie,
dass sie sich bestimmten Normen und Regeln unterwerfen
und dem Staat Kompetenzen übertragen müssen, die ihn
in die Lage versetzen, diesen Schutz zu gewährleisten.
Diese Aufgabe rechtfertigt die Ausstattung des Staates
mit besonderen Machtmitteln und sein Monopol auf
legitime Gewaltausübung.
Damit könnte es sein Bewenden haben, wäre da nicht ein
Problem, das uns allen in den letzten Jahren wieder
deutlich bewusst geworden ist: Sicherheit hat ihren
Preis.
In seiner 1929 entstandenen Schrift „Das Unbehagen in
der Kultur“ hat Sigmund Freud den Verzicht das
Einzelnen auf uneingeschränktes Ausleben der eigenen
Triebe und Freiheitsmöglichkeiten zugunsten von
Gemeinschaftsregeln, Recht und anderen normativen
Vorgaben und Regeln als wesentliches Merkmal moderner
Zivilisation dargestellt. Was der Einzelne dafür
gewinnt, ist Sicherheit.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
5
„Der Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit
ein Stück Sicherheit eingetauscht.“ (Freud, Das
Unbehagen 243)
Wir geben ein erhebliches Maß an individueller
Freiheit her und unterwerfen uns - mehr oder weniger
freiwillig - allen möglichen Regeln, Vorschriften und
Einschränkungen, in der Hoffnung und Erwartung, dafür
Sicherheit zu gewinnen.
Was aber bedeutet Sicherheit in modernen politischen
Gemeinwesen und in der modernen Staatenordnung? Welche
Bedeutung haben Sicherheit, Unsicherheit und Vertrauen
(in Sicherheit) in modernen Gesellschaften und welche
Rolle kommt ihnen bei der Gestaltung der
gesellschaftlichen und politischen Ordnung zu, nachdem
überkommene Normen und Regeln, die tradierten,
Sicherheit gewährenden oder zumindest versprechenden
Konzepte versagen und die alten
Ordnungskonfigurationen ihre Bindekraft verlieren?
Was kann Sicherheit in einer multipolaren, durch
wachsende Unübersichtlichkeit bestimmten
internationalen Ordnung bedeuten?
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
6
Welche Rolle fällt der staatlichen Ordnung bei der
Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit zu und
was kann sie noch „souverän“ bearbeiten?
Und schließlich: wie steht es um das
Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit?
Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sich eine
Betrachtung des Sicherheitsproblems konfrontiert
sieht.
Im folgenden werde ich
1.zuerst dem Bedeutungsgehalt der in der
öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte
häufig pejorativ besetzten oder normativ
überlasteten Begriffs ”Sicherheit nachgehen, um
danach
2. der Sicherheit als zentraler Wertorientierung in
den verschiedenen Sphären der Gesellschaft und im
politischen Raum nachzuspüren.
3.In einem weiteren Schritt wird die Rolle des
Staates bei der Gewährleistung von Sicherheit und
Ordnung beleuchtet, um dann abschließend
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
7
4.auf einige politische Implikationen eines
umfassenden Sicherheitsverständnisses
hingewiesen.
1. Soziologische und politische Dimensionen des
Sicherheitsbegriffs
Sicherheit in Freiheit, nicht Sicherheit versus
Freiheit lautet der Titel dieses Beitrags. Beide
stehen unzweifelhaft in einem Spannungsverhältnis,
schließen einander aber nicht aus. Die verkürzte
Gegenüberstellung von Sicherheit und Freiheit ist
falsch.
Problematisch ist auch eine häufig beobachtbare
Verkürzung des Freiheits- ebenso wie des
Sicherheitsbegriffs.
Auch wenn unstreitig sein sollte, dass das Recht auf
die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die
Entfaltung individueller Freiheit in den Grenzen des
Rechts eine conditio sine qua non für jede liberale und
demokratische Ordnung darstellen, bleibt doch die
immer wieder neu zu beantwortende Frage nach den
Voraussetzungen und Bedingungen unter denen Individuen
oder soziale Gruppen real in der Lage sind, diese
Freiheiten wahrzunehmen. Dies verweist auf die Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
8
rechtlichen, institutionellen, sozialen und
demokratisch-politischen Dimensionen eines modernen
Freiheitsbegriffs. Wie müssen Normen und Verfahren
ausgestaltet sein, dass sie dem Einzelnen und sozialen
Gruppen Schutz vor Willkür Anderer, Mächtigerer
gewährleisten, welche institutionellen Bedingungen
müssen zu diesem Ziel erfüllt sein und stets neu
justiert werden, welcher sozialökonomischen
Voraussetzungen bedarf es, um die volle Entfaltung und
Wahrnehmung von Rechten und Freiheiten zu ermöglichen
und schließlich: wie muss eine rechtliche und
politische Ordnung ausgestaltet sein, die es allen
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, individuell oder
gemeinschaftlich ihre staatsbürgerlichen Freiheiten
wahrnehmen zu können. Dazu bedarf es bestimmter,
elementarer „Sicherheiten“: der des Rechts,
institutioneller Arrangements und sozialökonomischer
Bedingungen.
Sicherheit und Sicherheitsgewährleistung kann in
modernen Gesellschaften nicht auf den Schutz von Leib
und Leben vor physischer Gewalt und die Garantie des
Eigentums reduziert werden, wie dies im klassischen
liberalen Staats- und Gesellschaftsverständnis der
Fall war, sondern erstreckt sich auch auf die
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
9
wirtschaftliche und soziale Existenz der Menschen und
die politische Gemeinschaft, in der sie leben.
Dabei wird aber häufig übersehen, dass im Zentrum
allen staatlichen Handelns nach wie vor der Schutz der
Bürger vor Gewalt, die Bewahrung des inneren und
äußeren Friedens und die Sicherung der
gesellschaftlichen und politischen Ordnung vor inneren
und äußeren Feinden stehen. Die Gegenüberstellung von
Sicherheit und Freiheit als unvereinbare kollektive
Güter und eine Prioritätensetzung zu Gunsten des einen
und zu Lasten des anderen führt also nicht weiter. Es
kommt vielmehr darauf an, dem widersprüchlichen
Verhältnis beider „Staatsaufgaben“ nachzugehen.
Was ist Sicherheit?
Sicherheit ist ein soziales Konstrukt, weil sie sich
nicht auf unverrückbare soziale Gegebenheiten (z.B.
klare Aussagen über ökonomische Risiken oder die
Kriminalitätsentwicklung) bezieht, sondern auf
bestimmte unterstellte soziale Gewissheiten. Als
sozialwissenschaftlicher Begriff ist Sicherheit kaum
präzise zu definieren, allenfalls in seinem
Bedeutungsgehalt einzugrenzen. Zudem ist Sicherheit
(ebenso wie ”Unsicherheit”) normativ hoch aufgeladen
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
10
und dadurch zum ”Wortsymbol einer gesellschaftlichen
Wertidee” geworden, wie es Franz Xaver Kaufmann
ausgedrückt hat.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die
Feststellung, dass Sicherheit angesichts des rasanten
sozialen und politischen Wandels eine elementare
Kategorie moderner Gesellschaften ist.
Vier Bedeutungsebenen des Begriffs Sicherheit lassen
sich ausmachen:
1.Sicherheit bedeutet: Gewissheit, Verlässlichkeit,
Vermeiden von Risiken. Abwesenheit von bzw.
Schutz vor Gefahren werden mit diesem Begriff
assoziiert.
2.Sicherheit meint aber auch Statussicherheit,
Gewährleistung des erreichten Lebensniveaus und
der Lebensumstände einzelner Menschen und/oder
sozialer Gruppen und Bewahrung der
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse,
in denen Menschen leben und sich eingerichtet
haben.
3.Mit dem Begriff wird weiterhin ein bestimmtes
institutionelles Arrangement assoziiert, das als
geeignet erscheint, innere oder äußere Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
11
Bedrohungen einer sozialen und politischen
Ordnung abzuwehren.
4.Und schließlich wird Sicherheit im juristische
Sinne als ”Unversehrtheit von Rechtsgütern”
verstanden, die zu schützen und bei Verletzung
wieder herzustellen Aufgabe der Rechtsordnung und
des Staates ist. Einige Autoren sprechen sogar
von einem Grundrecht oder Menschenrecht auf
Sicherheit (Josef Isensee 1983, Gerhard Robbers
1987). Rechtssicherheit bedeutet Schutz vor
willkürlicher Gewaltausübung und Beachtung von
anerkannten Regeln des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und der individuellen
Lebensführung (Beetham 1991: 138 ff.).
Ein wesentlicher subjektiver Faktor von Sicherheit ist
das Faktum, dass moderne Gesellschaften aus der Sicht
des Einzelnen überkomplex geworden und als
Gesamtordnung nicht mehr durchschaubar sind. Die
Wahrnehmung der Wirklichkeit stößt an Grenzen. Die
wachsende Komplexität aller Lebensbereiche macht ein
sachliches Urteil, eine rationale Entscheidung und
eine begründbare sichere Zukunftserwartung immer
schwieriger.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
12
Das Verhältnis des Einzelnen zu seiner komplexen
Umwelt kann wahlweise als Überforderung, vergebliche
oder gelungene Anpassung oder aber als Chance für
individuelle oder kollektive Gestaltung wahrgenommen
werden. Die Überkomplexität moderner Gesellschaften
und die nicht präzise prognostizierbaren zukünftigen
Entwicklungen produzieren eher Unsicherheit als dass
sie das Gefühl von Sicherheit aufkommen lassen (Diese
Zusammenhänge hat Niklas Luhmann ausführlich
beschrieben).
Unsicherheit im gesellschaftlichen und politischen
Raum hat verschiedene Dimensionen: sie kann als
ökonomische, soziale und politische Unsicherheit
erscheinen und sie hat jeweils eine Binnen- und eine
Außendimension.
Sicherheit nach Außen und im Inneren eines
Gemeinwesens zu garantieren und Unsicherheit zu
vermeiden, ist Aufgabe staatlicher Instanzen.
Angesichts neuer ”Bedrohungslagen” - seien es die
Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten,
sei es der internationale Terrorismus oder die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität - zeigt
sich immer deutlicher, dass das politische
Institutionengefüge nur noch bedingt in der Lage ist, Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
13
angemessene und wirksame Gegenstrategien zu entwerfen
und umzusetzen. Das Beharrungsvermögen von
Institutionen und ihr Bestehen auf (sich
verflüchtigender) Problemlösungskompetenz korreliert
nicht mit der beschleunigten Produktion von neuen
Problemlagen. Tendenzen der Internationalisierung und
Privatisierung gefährden das Regelungs- und
Gewaltmonopol der Nationalstaaten, ohne dass in jedem
Falle erkennbar wäre, was an seine Stelle tritt.
2. Gesellschaftliche und politische Dimensionen von
Sicherheit
Damit aber ist das zentrale Problem benannt: Seit
Thomas Hobbes und John Locke standen öffentliche
Sicherheit und Ordnung im Zentrum staatlicher
Aufgabenzuweisung. Beide Aspekte, der Schutz der
Bürger vor dem Staat und der Bürger voreinander durch
den Staat sind zentrale Themen, die sich wie ein rotes
Band durch die moderne Staats- und
Verfassungsgeschichte ziehen.
In Art. 5 der Europäischen Menschenrechtscharta von
1950 und erneut in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, die auf der Ratstagung in Nizza im
Dezember 2000 verabschiedet und in den Vertrag von
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
14
Nizza integriert wurde, ist diese Aufgabe
hervorgehoben und auf die europäische Ebene
transponiert worden:
”Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit” (Art. 6
Grundrechtscharta).
Politik findet aber immer mehr unter Bedingungen von
Unsicherheit statt: Die Globalisierung der Wirtschaft,
die Informationsrevolution und durch sie
hervorgerufene tief greifende mentale und kulturelle
Veränderungen, die beschleunigte Ablösung
industriegesellschaftlich geprägter Sozialstrukturen
und sozialer Milieus, demographische Entwicklungen und
Wanderungsbewegungen, welche die Grundfesten der
tradierten sozialen Sicherungssysteme erodieren
lassen, die Bedrohung der demokratischen Ordnungen
durch international agierende, z. T. staatlich
organisierte oder doch zumindest geduldete
organisierte Kriminalität, dramatische Veränderungen
im internationalen System und nicht zuletzt der
international agierende und vernetzte Terrorismus, all
das hat das Koordinatensystem der Politik fundamental
verändert.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
15
All dies sind Faktoren der Unsicherheit, auf die
Politik Antworten finden muss, obwohl zukünftige
Entwicklungen kaum vorhersehbar sind und der Glaube an
die Fähigkeiten vorausschauender Politik sich
weitgehend verflüchtigt hat.
Unter diesen Rahmenbedingungen kann es - und dies ist
die zentrale These - nicht mehr um Garantie von
Sicherheit, sondern bestenfalls um die Reduktion von
Unsicherheit. Gehen.
Welches ist die politische Konsequenz dieser Aussage?
Reduktion von Unsicherheit impliziert, will Politik
sich „ehrlich machen“, ein eingeschränktes
Sicherheitsversprechen. ”Absolute Sicherheit”, ist
angesichts sich rasant verändernder Umweltbedingungen
nicht herstellbar, sie würde im übrigen Stillstand
oder gar Regression bedeuten. Schon dies verbietet
eine Status quo-Politik, auch wenn sie angesichts
aktueller politischer Auseinandersetzungen mit
machtvollen Gruppeninteressen und eingeschliffenen
Haltungen und Erwartungen der Wähler gelegentlich
attraktiv erscheinen mag.
Der Staat muss nicht nur seine protektive Rolle neu
definieren, sondern eine Antwort darauf finden, welche
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
16
Strategien eingeschlagen werden können, um eine
Dissoziation der sozialen Ordnung und des politischen
Gemeinwesens zu verhindern.
Diese Gewährleistungspflicht des Staates umfasst nicht
nur den unmittelbar politischen Bereich - hier
beinhaltet sie die Formulierung von Staatszielen und
die konkrete Staatstätigkeit - sondern erstreckt sich
auch auf die soziale, die wirtschaftliche, und die
Wertesphäre.
1.So sind in der sozialen Sphäre der post-industriellen
Gesellschaften Desintegrationstendenzen und die
Auflösung traditioneller Sozialmilieus Faktoren
potenzieller gesellschaftlicher Konflikte und
Unsicherheit. Sie werfen daher die Frage nach den
Bedingungen sozialer Integration unter
veränderten gesellschaftlichen
Konstitutionsbeziehungen auf, wenn denn soziale
Integration als Faktor der Stabilisierung und
Sicherung von Sozialbeziehungen angesehen wird.
2.In der wirtschaftlichen Sphäre haben veränderte
weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen,
Internationalisierung und Globalisierung, die
sich in den Staaten der Europäischen Union
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
17
wesentlich als Europäisierung darstellen, sicher
geglaubte wirtschaftliche Rahmenbedingungen in
Frage gestellt und ehemals wirkungsvolle
wirtschaftspolitische Instrumente unwirksam
werden lassen.
Wirtschafts- und Finanzpolitik können das
Staatsziel wirtschaftlicher Prosperität bei
stetigem Wachstum, Geldwertstabilität,
Vollbeschäftigung und außenwirtschaftlichem
Gleichgewicht seit mehr als zwei Jahrzehnten
nicht mehr gewährleisten. Die Vorstellung, es
könne der Politik gelingen, die Wirtschaft „im
Gleichgewicht“ zu halten, hat sich als Illusion
erwiesen, das Sicherheitsversprechen ist nicht
mehr zu erfüllen.
3.Der dritte Bereich ist der klassischer
Sicherheitspolitik im Inneren als Gewährleistung
der inneren Sicherheit und Ordnung und der Außen-
und Sicherheitspolitik. Dass in diesem Bereich
Innen und Außen nicht mehr eindeutig
unterscheidbar sind ist offenkundig. Grund
hierfür sind nicht nur völlig neue
Bedrohungsszenarien, sondern auch die immer
engere internationale Verflechtung und, in
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
18
unserem Falle, die Konsequenzen der Europäischen
Intergration.
4.Gesellschaften und politische Ordnungen bedürfen
schließlich bestimmter Mindestübereinkünfte über
gemeinsam akzeptierte Werte und Normen. Auf welche
Werte sich eine gesellschaftliche und politische
Ordnung einigen muss, um das Zusammenleben der
Individuen und gesellschaftlichen Gruppen zu
organisieren ist stets strittig. Die Antworten
reichen von einer minimalistischen liberalen
Position, die sich auf die Normierung von
Abwehrrechten der Individuen gegenüber
staatlichen Machtansprüchen beschränken will,
über kommunitaristische Konzepte einer ”guten
Ordnung” bis zur traditionell konservativen
Auffassung, dass es Aufgabe der
gesellschaftlichen und politischen Ordnung sei,
tradierte Werte zu sichern, allgemein verbindlich
zu machen und durchzusetzen.
3. Sicherheit und Ordnung - Zur Rolle des Staates
Am Beginn des modernen Staatsdenkens stand die
Vorstellung, dass es Aufgabe des Leviathan sei, im
Inneren Sicherheit zu gewährleisten, um den
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
19
Bürgerkrieg zu verhindern sowie Vorkehrungen gegen
Angriffe äußerer Feinde zu treffen.
Seit Thomas Hobbes’ „Leviathan“ von 1651 wird es als
Aufgabe der staatlichen Gewalt angesehen, die
Bedingungen eines Lebens in Sicherheit und die
Befriedigung der individuellen Lebensbedürfnisse zu
garantieren.
"Die Aufgabe des Souveräns, ob Monarch oder
Versammlung, ergibt sich aus dem Zweck, zu dem er mit
der souveränen Gewalt betraut wurde, nämlich der Sorge
für die Sicherheit des Volkes... Mit ‘Sicherheit’ ist
hier aber nicht die bloße Erhaltung des Lebens
gemeint, sondern auch alle anderen Annehmlichkeiten
des Lebens, die sich jedermann durch rechtmäßige
Arbeit ohne Gefahr oder Schaden für den Staat erwirbt
(Hobbes 1984: 255).
Dieses Zieles wegen wird der Staat begründet und mit
dem summum imperium, der höchsten, zur
Letztentscheidung berufenen und damit souveränen
Herrschaftsgewalt ausgestattet, weil nur durch eine
solche souveräne, letztentscheidende Instanz Frieden
und Sicherheit gewährleistet und zwischen Recht und
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
20
Unrecht sicher unterschieden werden kann (Böckenförde
1991: 106).
Der Leviathan beschrieb das Prinzip der politischen
Einheit. Ihm gelang es, die konfessionellen
Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts, die von den
jeweiligen Kombattanten als "gerechte Kriege" geführt
wurden, zu beenden und sich als oberster Hüter von
Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu etablieren und zu
rechtfertigen. Das Ergebnis war eine Konzentration und
Bündelung der Gewaltmittel in den Händen des aus den
Wirren der Bürgerkriege hervorgehenden Fürstenstaates.
Die Herausbildung des modernen staatlichen
Gewaltmonopols, die "Verstaatlichung der Gewalt"
(Wolfgang Reinhard 1999: 351 ff), legitimiert sich
prima vista mit der Schutz und Sicherheit gewährenden
Funktion des Staates.
Die Konzentration der Machtmittel in der Hand des
Staates bedeutete jedoch nicht, dass eine Verminderung
von Gewalt bewirkt worden wäre. Sie konnte zweierlei
bedeuten: Dass der Inhaber der Staatsgewalt, der
absolute Herrscher, darüber entscheiden konnte, ob er
seine Stellung zur Schlichtung von Konflikten und zur
Beendigung des Bürgerkrieges nutzte oder selbst, wie
im Frankreich der Hugenottenkriege, BürgerkriegsparteiSicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
21
wurde. Die Theorie der Souveränität, welche die
Grundlage des Friedensmodells absoluter Herrschaft
bildete, erwies sich als ambivalent, weil sie keine
Vorkehrungen und Sicherungen bereithielt, um eine
solche Situation zu verhindern.
Eine zweite, fortwirkende Folge der Entwicklung des
Souveränitätsgedankens war, dass es zur Konzentration
der physischen Machtmittel in den Händen weniger
Akteure, nämlich in die "professioneller
Gewaltspezialisten“ kam. Die Armee und die Polizei auf
der einen Seite, Berufsverbrecher auf der anderen. Der
große Rest der Bevölkerung wurde entwaffnet (Reinhard
1999: 354).
Die bislang unbekannte Konzentration von Macht und
Monopolisierung von Gewalt in den Händen des Staates
konnte sich mit der Behauptung legitimieren, Ruhe und
Ordnung zu gewährleisten. Insoweit war auch "absolute"
Herrschaft rechtlich gebunden. Ihre
Rechtfertigungsgrundlage war ein materielles
"Staatsziel", die Gewährung von Sicherheit und die
Reduzierung von Unsicherheit. Werden diese Ziele nicht
erreicht, entfällt die Legitimitätsgrundlage
staatlicher Macht.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
22
Bereits hier ist ein weiter Sicherheitsbegriff
verwendet worden - modern übersetzt: Sicherheit ist
ein politischer und gesellschaftlicher Begriff. Nur
wenn das Sicherheitsversprechen des liberalen
Verfassungsstaat und seiner Institutionen und die
Garantie von Freiheit bei der individuellen und
kollektiven Lebensgestaltung in eins gehen, kann
beides verlässlich und dauerhaft, also sicher
gewährleistet werden.
Erst die modernen demokratischen Verfassungsstaaten
haben Regeln und Mechanismen entwickelt und Schranken
errichtet, die ein Ausufern und einen Missbrauch
staatlicher Gewalt im Zeichen von Sicherheit mehr oder
weniger wirksam verhindern.
Der moderne Verfassungsstaates gründet auf der
Einsicht, dass es damit nicht getan ist - seit
Montesquieu beschäftigt die Frage nach der Einhegung
staatlicher Macht, nach Sicherheit vor Übergriffen des
Staates in die Sphäre der zivilen Gesellschaft und das
Privatleben der Bürger Philosophen, Staatstheoretiker
und Sozialwissenschaftler.
Schutz vor dem Staat und Schutz durch den Staat bilden
eine untrennbare, wenngleich auch konfliktreiche
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
23
Einheit. Nach den Erfahrungen mit autoritären und
totalitären Regimen im 20. Jahrhundert ist dieses
Problem aktuell wie eh und je.
Aber damit ist die alte Hobbes’sche Frage nach der
Sicherheit gewährleistenden Funktion des Staates nicht
obsolet. Der Zerfall staatlicher Ordnungen nach dem
Ende der Kolonialreiche und des sowjetischen Imperiums
haben sie wieder auf die Tagesordnung gesetzt.
In diesem Kontext bekommt die Frage nach dem Schutz
einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung erneut
eine Bedeutung, wie sie vor über 60 Jahren den
Schöpfern des Grundgesetzes äußerst präsent war: Die
Freiheit als Kollektivgut einer offenen Gesellschaft
bedarf des Schutzes, bedarf starker Institutionen, die
ihn gewährleisten und ebenso starker Institutionen,
die eine wirksame Kontrolle gegen Machtmissbrauch
sicherstellen.
Die modernen Wohlfahrtsdemokratien verstehen
Sicherheit aber noch in einem anderen Sinne als dem
des Schutzes der etablierten gesellschaftlichen
Ordnung, des politischen Gemeinwesens und der
staatlichen Institutionen. Mit der Sicherung vor
Übergriffen des Staates in die Sphäre der zivilen
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
24
Gesellschaft und das Privatleben der Bürger auf der
einen und der Abwehr äußerer Feinde als zentralem
Staatsziel auf der anderen Seite ist es nicht getan.
Das politische Gemeinwesen hat auch darüber zu wachen,
dass die Beziehungen der Bürger untereinander so
gestaltet werden, dass die grundlegenden
Menschenrechte, insbesondere die Menschenwürde, die
allgemeine Handlungsfreiheit und die Freiheit der
Person weder von staatlicher noch von privater Seite
oder durch unkontrollierte Machtansprüche aus der
Gesellschaft gefährdet oder in Frage gestellt werden –
bei Hobbes war dies der bellum omnium in omnes, den es
mittels staatlicher Gewalt einzuhegen galt.
Neben den Schutz der physischen Sicherheit der Bürger,
neben die Freiheit vor staatlichen Eingriffen und
Übergriffen tritt seit dem späten 19. Jahrhundert die
Gewährung "sozialer Sicherheit". Staatlicher Schutz
gegen die Risiken des wirtschaftlichen Lebens und
soziale Gefährdungen wird nicht nur Staatsaufgabe,
sondern entwickelt sich - neben der Sicherung von Ruhe
und Ordnung - zu einem zentralen Feld staatlichen
Handelns. Die Gewährleistung von sozialer Sicherheit
wird als eine neben anderen Bedingungen individueller
und kollektiver Freiheit erkannt und zu einer
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
25
wichtigen Legitimationsquelle der politischen Ordnung.
Diese Einsicht konnte sich in Deutschland erst im
Grundgesetz volle Geltung verschaffen
Die hier nur skizzenhaft angedeutete Entwicklung ist
freilich nicht ohne Folgen und Probleme, da
Erwartungshaltungen produziert werden, die auf einen
dauerhaften, einen als "sicher" erfahrenen Schutz vor
ökonomischen Veränderungen gerichtet sind und bei
Enttäuschung Legitimationsprobleme erzeugen. Nach dem
Ende des wirtschaftlich „goldenen Zeitalters“ (Eric
Hobsbawm) und der Enttäuschung der keynesianischen
Utopie eines gesicherten, dauerhaften ökonomischen
(und damit auch sozialen) Aufstiegs in den 1970er-
Jahren ist diese Enttäuschung eine der wesentlichen
Ursachen sowohl für Unsicherheit als auch für das
allseits erkennbare Legitimationsproblem moderner
Demokratien.
Ein weiterer Aspekt ist zu nennen: individuelle
Freiheit verliert an Bedeutung zu Gunsten normativ
befrachteter Begriffe wie ”Gerechtigkeit" oder
”Solidarität”.
Der Versuch, „Sicherheit“, „Solidarität“ und
„Kooperation“ (oder, altertümlich gesprochen:
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
26
Genossenschaft) neu und zusammen zu definieren, wie
dies in der europäischen Sozialdemokratie immer wieder
einmal geschieht, ist ein Indiz dafür, dass diese
Gegenüberstellung sich als nicht mehr tragfähig
erwiesen hat.
Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass die
Gefährdung von Freiheit und Sicherheit des Menschen
ihren Ursprung nicht mehr ausschließlich im Staat hat.
Der demokratische Staat fungiert vielmehr auch als
Schutzinstanz gegenüber privater Macht, übernimmt also
auf neue Weise Funktionen, die am Beginn der modernen
Staatsentwicklung nach der Erfahrung der religiösen
Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts standen.
Vor diesem Hintergrund sind alle rechtlichen und
institutionellen Vorkehrungen um so bedeutsamer, durch
die relative Sicherheit in wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Angelegenheiten erreicht werden soll.
Die Gewährung von Sicherheit als gesellschaftliche und
als ”Staatsaufgabe” kann verschiedene Formen annehmen,
Kompetenzzuweisungen, Kompetenzabgrenzungen und
Handlungsmuster erfordern. Im Zentrum der Tätigkeit
öffentlicher Institutionen stehen nach wie vor und mit
erneuter Dringlichkeit die klassischen Aufgaben jeder
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
27
politischen Ordnung: Gewährleistung des inneren und
äußeren Friedens, von Freiheit und sozialer Wohlfahrt
der Bürger.
Als ebenso ”sicher” kann aber auch gelten, dass weder
die bisherigen Instrumente noch die territorialen
Begrenzungen von Macht auf Dauer wirksam sind: Die
wachsende Komplexität und Undurchschaubarkeit von
Entscheidungen, vor allem aber Internationalisierungs-
und Globalisierungsprozesse, d.h. die ”Entgrenzung”
von Produktions-, Distributions- und
Entscheidungsprozessen, ja, die immer weiter gehende
Verlagerung des Politischen aus den staatlichen
Grenzen heraus auf überstaatlich agierende Akteure
machen sicher geglaubte Arrangements der Einhegung von
Unsicherheit obsolet und produzieren neue
Unsicherheit.
4. Sicherheit und Ordnung Politische Implikationen
Am Beispiel der ”inneren Sicherheit” sollen diese
Zusammenhänge abschließend exemplarisch aufgezeigt
werden. Der Begriff innere Sicherheit hat den alten
Begriff der „öffentlichen Ruhe und Ordnung“ abgelöst.
Ich definiere ihn als Minimum an Risiken im
öffentlichen Raum eines nach außen begrenzten
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
28
Gemeinwesens, ohne dabei das Phänomen zunehmender
„Entgrenzung“ aus dem Auge zu verlieren.
Schon die simple Frage nach der Sicherheit „wessen vor
wem“ führt in vermintes Gelände. Ein ausschließlicher
Verweis auf klassische Abwehrrechte der Bürger
gegenüber staatlichen Übergriffen, die im Zentrum des
Grundrechtskataloges moderner Verfassungen stehen,
greift erkennbar zu kurz. Dem Grundgesetz liegt
vielmehr eine weiter gefasste Vorstellung von
„Sicherheitsgewährleistung“ zugrunde.
Sicherheitsgewährleistung im Sinne des Grundgesetzes
heißt Schutz privater und öffentlicher Güter vor
Angriffen und Eingriffen dritter, mit Macht
ausgestatteter politischer, ökonomischer oder sozialer
Akteure.
Aufgabe des politischen Gemeinwesens ist es, seinen
Bürgern die Chance zu geben, frei und unangefochten
leben zu können. Die grundlegenden Veränderungen der
wirtschaftlichen und sozialen Ordnungen und die
ungleiche Zuteilung von Ressourcen in modernen
Gesellschaften behindern sie aber in vielerlei
Hinsicht an der freien Entfaltung ihrer Fähigkeiten
und der Wahrnehmung sozialer Chancen.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
29
In wachsendem Maße sind sie durch gesellschaftliche
Kräfte, international agierende wirtschaftliche
Interessen oder sich organisierende kriminelle
Aktivitäten gefährdet. Bedrohung der Sicherheit und
Freiheit der Bürger durch nicht-staatliche Herrschaft
wird zunehmend zum Problem. Joseph Isensee konstruiert
angesichts dieser Gefährdungslage ein ”Grundrecht auf
Sicherheit” und entwickelt daraus - in der Tradition
des Staatsdenkens seit Hobbes und Locke - die
Vorstellung eines demokratischen Verfassungsstaates,
dessen primäres Ziel es ist, Hüter von Sicherheit und
Ordnung zu sein (Isensee 1983).
Hier kehrt sich in gewisser Weise die alte
Frontstellung um: der Staat bildet ein Korrektiv
gegenüber diesen Machtansprüchen, die aus der
Gesellschaft formuliert werden. Da viele Individuen
und soziale Gruppen zu schwach sind, ihre Rechte und
Freiheitenwirksam zu schützen muss der Staat in
bestimmten Fällen als Garant und Beschützer der
Grundrechte Einzelner gegenüber Anderen auftreten.
Diese Vorstellung, wie sie von Isensee vertreten wird,
geht über das klassische Verständnis der Grundrechte
als Abwehrrechte gegenüber staatlicher Willkür hinaus.
Die Grundrechte erschöpfen sich nicht im status Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
30
negativus. Neben dem Schutz vor der Staatsgewalt,
welche die Abwehrrechte moderner Verfassungen wie des
Grundgesetzes bereithalten, bedarf es auch eines
verfassungsrechtlichen ”Schutzes vor dem Bürger”
(Isensee 1983: 2) Ähnlich argumentiert Roman Herzog!
(Herzog 1971).
Auch wenn man die hier vorgestellte Position, zumal
seine auf einen starken Staat zielenden
Schlussfolgerungen nicht teilt, kann man doch nicht
umhin einzugestehen, dass sie einen wunden Punkt
treffen: Der Topos ”Sicherheit und Ordnung” wurde,
wenn überhaupt, in den Politik- und
Sozialwissenschaften wie in der liberalen
Staatsrechtslehre als konservative Reaktion auf die
Emanzipation der zivilen Gesellschaft gegenüber dem
Staat verstanden. Wenn man jedoch ”innere Sicherheit”
im klassischen Sinne als Schaffung der Voraussetzungen
für ein friedliches Zusammenleben der Bürger begreift,
bleibt sie die zentrale Aufgabe des Staates.
Freilich lässt sich eine solche Auffassung nach den
Erfahrungen des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr
”naiv” vortragen, wie in den Anfängen modernen
politischen Denkens. Tendenzen der Entwicklung eines
allumfassenden Sicherheitsstaates in modernem Gewand Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
31
waren auch schon vor dem September 2001 zu
diagnostizieren. Die Warnung, dass angesichts der
Entwicklung der Sicherheitspolitik die
parlamentarischen Demokratien immer weniger in der
Lage sind, die notwendige demokratische Steuerung und
Kontrolle zu gewährleisten, ist nicht von der Hand zu
weisen. Hinzu kommt, dass erfolgreiche
Sicherheitspolitik nicht nur daran gemessen wird, ob
es ihr gelingt, Störungen der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung zu ahnden, nachdem sie eingetreten sind,
sondern an ihrer Fähigkeit, Unsicherheit und
Ordnungsverstöße zu verhindern.
Angesichts moderner Gefährdungslagen von der
organisierten Kriminalität bis hin zum Terrorismus
erweist sich die Kompetenz des Staates, Sicherheit zu
gewährleisten nicht mehr nur an der Fähigkeit
angemessen zu reagieren, sondern in wachsendem Maße
daran, ob es ihm gelingt, erfolgreich präventiv tätig
zu werden.
Die Janusköpfigkeit der Prävention
Prävention bedeutet mehr als das Verfolgen eines je
konkreten Verdachts. Methoden wie die Rasterfahndung,
die bereits in den 1970er Jahren erprobt wurden,
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
32
werfen ein präventives Netz über die ganze
Gesellschaft ohne dass es eines konkreten Verdachts
bedarf. Sie werfen erneut die Frage auf, wie weit der
Staat bei der Gewährung von Sicherheit gehen und
welcher Mittel staatliche Behörden und Einrichtungen
sich bedienen dürfen, um diese Ziel zu erreichen.
Begriffe wie ”Präventionsstaat”, ”Sicherheitsstaat”,
”Überwachungsstaat” markieren die Dimensionen des
Problems und haben nach dem 11. September 2001 eine
bedrückende Aktualität erlangt.
Was aber, so lässt sich fragen, ist schlecht an dem
Versuch präventiver Verhinderung schwerer Straftaten?
Während das traditionelle Ordnungsrecht darauf
gerichtet war, eine konkrete, unmittelbar drohende
Gefahr rechts- und gesetzwidrigen Verhaltens zu
verhindern und zu ahnden, wenn es geschehen war, wenn,
ausgehend von Erfahrungswerten, Regeln zu schaffen
waren, die Gesetzesübertretungen erschwerten oder
verhinderten, so geht es in einer neuen Ordnungs- und
Sicherheitspolitik um die rechtzeitige Erkennung
potenzieller Risiken und Gefahren und um die
Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Verfahren zu
ihrer Vermeidung.
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
33
Freilich ist nicht immer klar, wer eigentlich
Ansprechpartner des Staates bei der Prävention von
Risiken ist. Sicherheitsgefährdende Gefahrenquellen
und Störungsherde sind in allen Bereichen des
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens zu
finden, ohne dass in jedem Fall die Verursacher klar
zu benennen sind. Die Frage der Zurechenbarkeit
(Luhmann 1991: 34) ist häufig, selbst bei vielen
terroristischen Aktivitäten, nicht eindeutig zu
beantworten.
Prävention war schon immer ein Aspekt der Tätigkeit
des Ordnungsstaates. Sie zielt auf die Früherkennung
möglicher Störungsherde und Gefahrenquellen. Wie sich
insbesondere im Kontext der Terrorismusbekämpfung in
den 1970er-Jahren erwiesen hat, wächst durch eine
solche Verschiebung der Schwergewichte in
Angelegenheiten der inneren Sicherheit der staatliche
Informationsbedarf außerordentlich an, weil die Zahl
potenzieller Gefahrenquellen stets ungleich größer ist
als die akuten Gefahren.
”Die Prävention löst sich auf diese Weise”, warnt
Dieter Grimm, ”aus ihrem Bezug auf gesetzlich
definiertes Unrecht und wird zur Vermeidung
unerwünschter Lagen aller Art eingesetzt. Der EinzelneSicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
34
kann den Staat nicht mehr durch legales Betragen auf
Distanz halten” (1994: 283).
Die Gründe, die gleichwohl für einen solchen
Paradigmenwechsel in der Sicherheits- und
Kriminalitätspolitik angeführt werden können, liegen
in der wieder entdeckten Erkenntnis, dass Prävention
im Bereich der Sicherheit eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist und zu den Kernaufgaben der staatlichen
Ordnung gehört.
Wenn man diese Argumentation zu Ende führt, bleibt
Prävention nicht auf den Bereich der Politik der
inneren Sicherheit beschränkt, sondern greift
tendenziell auch auf andere ”sicherheitsrelevante”
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus. Gefahr
wird nicht mehr ausschließlich in den Kategorien des
Strafrechts definiert und damit in gewisser Weise auch
eingehegt, sondern wird bestimmend für die Wahrnehmung
gesellschaftlicher Probleme. Gefahr wird ebenso
allgegenwärtig wie Technische Instrumente wie das CCTV
und Kategorien wie „anti social behaviour“. Sie
grenzen aus – diesseits des Strafrechts.
Die Antwort ist eine Erweiterung der staatlichen
Instrumentarien zur Wahrung und Herstellung von
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
35
Sicherheit und Ordnung, ohne dass gesichert erscheint,
ob diese auch greifen können. Reaktives wie
präventives staatliches Handeln ist in vielerlei
Hinsicht konditioniert: durch eingegangene rechtliche
Verpflichtungen, supranationales und vor allem und in
erster Linie europäisches Recht. Die Bedrohung von
Sicherheit und Ordnung hat, wie die hilflose Debatte
über die Bekämpfung organisierter Kriminalität belegt,
längst die Grenzen überschritten - und dies gilt auch
für die meisten anderen Bedrohungslagen - seien es
Umweltprobleme, Entwicklungen der Biogenetik, neue
Technologien, unkontrollierte Proliferation von
Massenvernichtungswaffen, sezessionistische oder
irredentistische Bewegungen und Bürgerkriege oder der
internationale Terrorismus.
Fünf Thesen
Ist Sicherheit eine Illusion? Sicher nicht. Wohl aber
der Wunsch nach absoluter Sicherheit und das
Versprechen eines solchen idyllischen Zustandes.
Dies führt unweigerlich zum entscheidenden Problem:
Wer wird und mit welchen Mitteln in Zukunft das teure
Kollektivgut Sicherheit gewährleisten können, wenn die
dafür eingesetzte Macht, wenn der Staat, dazu nicht
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
36
mehr in vollem Umfange in der Lage ist oder auf Grund
der Funktionsmechanismen demokratischer Politik und
Legitimation nur bedingt problem- und sachorientiert
reagieren kann?
Eine sicherheitstheoretische und -politische
Neuorientierung erscheint unabdingbar. Dazu vier
kurze, unsystematische abschließende Anmerkungen:
1.Sicherheit als Wertidee bedeutet keine auf „ewig“
angelegte verbindliche und allgemein akzeptierte
Übereinkunft darüber, was dieser Begriff
beinhaltet, sie ist nichts ein für alle Male
Festgeschriebenes, bedarf angesichts veränderter
Umstände und neuer Entwicklungen einer steten
Neujustierung. In-Frage-Stellen von sicher
Geglaubtem produziert aber ebenso Unsicherheit
wie Furcht vor Neuem, Unbekanntem.
2.Sicherheit und Ordnung lassen sich, wie
dargelegt, nicht auf den engeren Bereich der
„inneren Sicherheit“ reduzieren, sondern berühren
in vielerlei Hinsicht die verschiedenen Sphären
des gesellschaftlichen und politischen Ordnung.
Im klassischen Bereich der „inneren Sicherheit“
zeigt sich eine zwiespältige Tendenz. Es wachsen
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
37
die Bedrohungen für die soziale und politische
Ordnung durch gesellschaftliche Kräfte, die in
zunehmendem Maße auch transnational agieren.
Organisierte Kriminalität (Drogen- und
Menschenhandel, Geldwäsche), Korruption,
international agierender Terrorismus. Sie heben
die Grenzen zwischen innerer und äußerer
Bedrohung auf, infiltrieren demokratische und
rechtsstaatliche Verfahren und drängen
Regierungen und Parlamente zu einer „Entgrenzung“
und Ausweitung staatlicher Sicherungsaufgaben.
Die Sicherheit gewährleistenden Institutionen des
Staates werden ausgebaut, zwischenstaatliche
Einrichtungen im Rahmen der intergouvernementalen
Zusammenarbeit im europäischen Raum neu
geschaffen und ihre Eingriffsrechte in die
Freiheitssphäre der Bürger ausgeweitet. Der
Primat der Sicherheit gefährdet auf neue Weise
die Freiheitsräume der Bürger.
3.Auf der anderen Seite wird das Gewaltmonopol des
Staates ausgehebelt. Es ist nicht zu übersehen,
dass das Kollektivgut Sicherheit immer mehr zum
Aufgabengebiet nicht-staatlicher Experten wird.
Private Sicherheitsdienstleistungen,
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
38
Sicherheitsgewährleistung durch räumliche
Segregation (z.B. gated cities) u.a.m. sind
Tendenzen, die auf eine Aushöhlung des
staatlichen Gewaltmonopols und eine
Entstaatlichung von Sicherheit hinauslaufen und
damit eine wesentliche Errungenschaft moderner
Staatlichkeit in Frage stellen.
Selbst kriegerische Handlungen werden, wie im
Irak zu studieren war, partiell privatisiert
Münkler 2001).
Freilich gibt es auch gegenläufige Tendenzen. So
wurden nach dem eklatanten Scheitern der privaten
Sicherheitsfirmen an den amerikanischen Flughäfen
nach dem 11. September 2001 private
Sicherheitskontrollen durch staatliche die neu
geschaffene Transportation Security
Administration ersetzt.
4.Damit bekommt der klassische Konflikt zwischen
staatlichem Sicherheitsversprechen und
Abwehrrechten der Bürger eine neue Dimension. Im
Konfliktfeld zwischen der Sicherheitsaufgabe des
Staates (heute auch zwischenstaatlicher
Einrichtungen) und der Freiheitssphäre der Bürger
gewinnen Prinzipien der Gerechtigkeit und
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
39
Fairness, der Responsivität von Sicherheit
gewährleistenden Institutionen und der
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher
Organisationen gegenüber den klassischen
repressiven Funktionen von
Sicherheitsspezialisten an Bedeutung.
(Allerdings sind neue Formen der
„Vergemeinschaftung“ von Sicherheit wie etwa das
community-policing, bislang kaum über Anfänge
hinausgekommen und zeitigen dort, wo sie
praktiziert werden, durchaus widersprüchliche
Ergebnisse).
Fazit
Ein erweiterter Begriff von Sicherheit und Ordnung,
der die Frage nach einem friedlichen Zusammenleben der
Bürger und ihren Schutz vor inneren und äußeren
Bedrohungen nicht auf die Aspekte staatlicher
Machtentfaltung gegenüber Störungen jedweder Art
reduziert, sondern die sozialen, ökonomischen,
politischen und normativen Bedingungsfaktoren in die
Analyse einbezieht, kommt nicht umhin, einzugestehen,
dass der Staat allein die neuen Probleme nicht
bewältigen kann und dass es auch zweifelhaft ist, ob
dies zu wünschen wäre. Es bedarf vielmehr einer neuen Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
40
Zusammenarbeit des Staates mit gesellschaftlichen
Akteuren, einer neuen Verbindung von
gesellschaftlicher Selbstregelung und politischer
Steuerung.
Angesichts diffuser und unvorhersehbarer Bedrohungen
und Gefahren sind Staaten geneigt, alle Machtmittel,
die ihnen zur Verfügung stehen, einzusetzen, um diesen
Gefahren entgegenzutreten - auch auf Kosten der
Freiheitsrechte der Bürger. Demokratische Staaten
sind, wie an verschiedenen Beispielen gezeigt wurde,
vor einer solchen Überreaktion nicht gefeit.
Der Staat ist Garant von Rechtsgütern, die in einem
natürlichen Spannungsverhältnis zueinander stehen:
Sicherheit, Recht und Ordnung auf der einen,
individuelle Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen
und Freiheiten der Bürger auf der anderen Seite. Im
demokratischen Rechtsstaat ist diese Aufgabe nur in
einem von bürgerschaftlicher Verantwortung geprägten
Kooperationsverhältnis von staatlichen Institutionen
und Bürgern realisierbar. Es begrenzt das Monopol
legitimer Gewaltanwendung auf die dazu legitimierten
staatlichen Institutionen, macht diese aber den
Bürgern gegenüber verantwortlich und
rechenschaftspflichtig. Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
41
Gleichwohl bleibt die Furcht vor einem Missbrauch der
dem Staat übertragenen Gewalt auch in demokratischen
Systemen lebendig. Bei akuten Gefährdungen der
öffentlichen Sicherheit und in Zeiten aufgewühlter
Emotionen ist die feine Linie zwischen Sicherheit als
Bedingung für Freiheit und der Gefährdung von Freiheit
durch ein überzogenes Sicherheitsdenken nur schwer
auszumachen und es kann der Eindruck entstehen, dass
es seitens der staatlichen Behörden eine Art
Generalverdacht gegen die Bürger oder zumindest eine
nach bestimmten Kriterien “gerasterte” Gruppe von
Bürgern gibt, dass die kriminalistische Methode der
Eingrenzung von potenziell Verdächtigen zur generellen
Wahrnehmungsfolie wird.
Andererseits ist der Staat als alleiniger und als
einzig demokratisch autorisierter Garant von
Sicherheit und Ordnung angesichts der neuen
Sicherheitsgefährdungen in Frage gestellt. Er hat sein
Monopol bereits in wichtigen Bereichen aufgeben müssen
oder freiwillig geräumt. Seine neue Rolle im
Widerstreit gesellschaftlicher Gruppen und Interessen,
internationaler Regime, supranationaler Institutionen
und intergouvernementaler Zusammenarbeit, aber auch
der Desintegration und des Zerfalls von Staatlichkeit
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
42
und der ”Reprivatisierung des Krieges” und des
international agierenden Terrorismus ist noch nicht
gefunden.
Das einzige was sicher ist, ist, dass am Ende eines
langen und schmerzhaften Prozesses eine neue Form von
Staatlichkeit stehen wird. Wie diese aussehen wird,
ist offen. Dass der Staat aber, wenn er seine
regulierende Rolle und sein Monopol auf legitimierte
Gewaltausübung nicht endgültig an private Mächte
abgeben will, ein im neuen Sinne „starker Staat“ sein
muss, scheint unausweichlich.
Um mit einem Zitat von Thomas Hobbes zu schließen:
”Denn wo es keinen Staat gibt, da herrscht... ständig
Krieg eines jeden gegen seinen Nachbarn, und deshalb
ist alles sein, was er mit Gewalt erlangt und behält.
Dies ist weder Eigentum noch Gemeinschaft, sondern
Unsicherheit.”(Hobbes 1984: 190 f.).
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011
43
Literatur
Beetham, David (1991): The Legitimation of Power. Basingstoke, Hampshire: Macmillan.Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1991): Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Freud, Sigmund (1974): Das Unbehagen in der Kultur, in: Kulturtheoretische Schriften. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 191-270.Grimm, Dieter (1994): Die Zukunft der Verfassung, in: Ulrich K Preuß., Hrsg.: Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen. Frankfurt a.M.: Fischer: 277-303.Herzog, Roman (1971): Allgemeine Staatslehre., Frankfurt a. M.: Athenäum.Hobbes, Thomas (1984): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, herausgegeben von Iring Fetcher. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.Hobsbawm, Eric (1994): Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991. London: Michael Joseph.Isensee, Josef (1983): Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates. Berlin/New York: de Gruyter.Kaufmann, Franz Xaver (1970): Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem. Untersuchungen zu einer Wertidee hochdifferenzierter Gesellschaften. Stuttgart: Ferdinand Enke.Luhmann, Niklas (1991): Soziologie des Risikos. Berlin/New York: de Gruyter.Münkler, Herfried (2001): Die privaten Kriege des 21. Jahrhunderts, in: Merkur 55. Jg., H.3, 222-234.Reinhard, Wolfgang (1999): Geschichte der Staatsgewalt: eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Beck.Robbers, Gerhard (1987): Sicherheit als Menschenrecht, Baden-Baden: Nomos
Sicherheit in Freiheit Dortmund 9. Dezember 2011


















































![Wie funktioniert Sicherheit ohne (viel) Staat? Befunde aus Nordostafghanistan und Pakistan [DRAFT attached - for published version see book!]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632e1c3c2be52b9c7202f98c/wie-funktioniert-sicherheit-ohne-viel-staat-befunde-aus-nordostafghanistan-und.jpg)