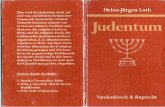Die Welt in Bildern. Erfahrung und Evidenz in Friedrich J. Bertuchs »Bilderbuch für Kinder«...
Transcript of Die Welt in Bildern. Erfahrung und Evidenz in Friedrich J. Bertuchs »Bilderbuch für Kinder«...
Wallstein Verlag
Silvy Chakkalakal
Die Welt in BildernErfahrung und Evidenz in Friedrich J. Bertuchs»Bilderbuch für Kinder« (1790-1830)
5
Inhalt
Einleitung1. Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten . . . . . . . 7
1.1 Kinder amüsieren sich mit Bildern . . . . . . . . . . . 71.2 Anthropologie der Sinne und ihre
reizvoll-vergnüglichen Bilder . . . . . . . . . . . . . . 111.3 Bilder als relationales Kulturphänomen
und als kulturelle Narrative . . . . . . . . . . . . . . . 171.4 Grundriss der Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Ausgangspunkte: Friedrich Justin Bertuch, sein Verlag und das Bilderbuch für Kinder . . . . . . . . . 32
I. Die Entdeckung der Kindheit und die Entdeckung der Sinne
1. Anthropologie der Sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.1 Das Paradigma der Erfahrung . . . . . . . . . . . . . . 441.2 Die kindlichen Sinne als Wegbereiter
von Verzeitlichungsprozessen . . . . . . . . . . . . . 692. Pädagogik als praktische Anthropologie: Sinnlichkeit –
Anschauende Erkenntnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.1 Johann Amos Comenius’ Orbis pictus (1653)
als Prototyp des Bilderbuchs . . . . . . . . . . . . . . 1062.2 Pädagogische Bildprogramme und -didaktiken
um 1800 als praktische Anthropologie . . . . . . . . . 1223. Der Kind-Bild-Komplex:
›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ . . . . . . . . . . . . . 177
II. Lebendige Bilder als kunstvolle Wissenschaft
1. Lebendige Anschaulichkeit – Verbildlichte Naturgeschichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891.1 Bertuchs Ruf nach lebendiger Anschaulichkeit . . . . 1921.2 Schauplätze der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971.3 Das Leben im Blick – Lebendige und
anschauliche Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102. Repräsentationen des Lebens . . . . . . . . . . . . . . . . 221
2.1 Die naturgeschichtliche Illustration im Spannungsfeld von Abwertung und Gebrauch . . . . . . . . . . . . . 221
6
2.2 Nachahmung der Natur: Das Verlangen nach ›lebendigen‹ Bildern . . . . . . . . . . . . . . . . 237
3. Bertuchs Medialisierung von Natur . . . . . . . . . . . . . 2433.1 Die (An-)Ordnungen der Bilderbuch-Bilder . . . . . . 2433.2 Netzwerke bildgeschichtlicher Bildpraxis . . . . . . . 2523.3 Bertuchs dritter Weg: das Bild als Erkenntnisobjekt . . 256
III. Bilder von Verzeitlichung und Entwicklung als Generatoren eines neuen historischen Wissens
1. Archäologen der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631.1 Schichten, Schächte, Schuften . . . . . . . . . . . . . . 2661.2 Die Genese des Lebendigen: Wachstum,
Form und Gestalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3202. Das alte Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
2.1 Pittoreske Landschaften – Alte Architekturen . . . . 3542.2 Indiens organologische Ganzheit . . . . . . . . . . . . 372
Resümée
Bilder für Kinder als Experimentierfeld veränderter Sehbedürfnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 4031. Der schlechte Ruf des »Abkupferns« . . . . . . . . . 4032. Das Kind als kulturelle Übergangsfigur . . . . . . . . 4053. Das Paradigma der Erfahrung und ihrer Bilder . . . . 408
Literatur
Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413Sekundärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Dank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Inhalt
7
Einleitung
1. Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
1.1 Kinder amüsieren sich mit Bildern
Rückblickend auf das Jahr 1789 erzählt der Philosoph und Natur-forscher Heinrich Steffens (1773-1845) in seinen Memoiren über sein botanisches Studium bei Martin Vahl (1749-1804), einem Schüler Carl von Linnés (1707-1778). Eine Episode, die dem Studenten dabei ganz besonders in Erinnerung blieb, war die strikte Ablehnung seines reso-luten Lehrers bezüglich des Einsatzes von Bildern bei der botanischen Praxis der Bestimmung von Pflanzen:
Erfuhr er, daß wir bei der Bestimmung der Pflanzen, weil uns die Linnéische Beschreibung in den technischen Ausdrücken nicht ge-läufig war, etwa Abbildungen zu Hülfe nahmen, dann wies er uns jederzeit streng zurecht. »Hier ist das Buch, sagte er dann, und gab uns den Linné; die Pflanze ist hier beschrieben, hier muß sie aufge-sucht werden, Kinder amüsiren sich mit Bildern.«1
›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ markiert die eigentümliche Anzie-hungskraft zwischen Kind und Bild, die sich wohl am eindrücklichsten in der Konzeptionierung und Rezeption der Bildwerke für Kinder geäußert hat. Dieses Wissen, das Kind und Bild in einen Nexus brachte, kann dabei nicht auf ein pädagogisch-didaktisches reduziert werden, sondern findet sich – wie der eingangs erwähnte O-Ton von Steffens zeigt – in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen sowie gesell-schaftlichen Debatten der Zeit.
In einer longue-durée-Perspektive verfolgt meine Arbeit die Aus-sage ›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ wie einen roten Faden durch die Geschichte seit der Frühen Neuzeit, bis sie sich als eine der epi-stemologischen Grundvoraussetzungen in Friedrich Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder wiederfindet.2 Dieser schreibt über den Inhalt und die Gestaltung seines erfolgreichsten Werkes:
1 H. Steffens: Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. 10 Bde., Breslau 1840-1844, Bd. 1, 1840, S. 311-312.
2 F. J. Bertuch: Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung
8
Einleitung
Daher habe ich die krellste und bunteste Mischung der Gegenstände gemacht, und bitte nur immer, wenn man mich deshalb tadeln wollte, zu bedenken, dass ich es mit Kindern zu thun habe, die ich blos amüsiren will.3
Der Anspruch, Kinder durch Bilder zu amüsieren, fächert einen gan-zen Katalog an Themen auf, die berücksichtigt werden müssen, um das Bilderbuch für Kinder zu untersuchen: der richtige Gebrauch der Sinne, Sehen-Lernen, der kindliche Blick, anschauende Erkenntnis und Prinzipien der Anschaulichkeit. Dies sind nur einige Schlagworte, die in der Arbeit vertiefend aufgegriffen werden. Sie verdeutlichen bereits, dass der Nexus von Kind und Bild innerhalb größerer wahr-nehmungs- und wissenschaftsgeschichtlicher Zusammenhänge zu ver-orten ist. Lange Zeit hat man Bilder für Kinder gerade aufgrund der zum Common Sense gewordenen Annahme, dass sich Kinder mit Bildern amüsieren sollen, nicht als legitime Quellen kulturhistorischer und wissenschaftsgeschichtlicher Forschung angesehen. Vor allem die dünn gesäten Studien zu den Bildinhalten lassen vermuten, dass Bil-der für Kinder bis heute ihre Themen mit einer kindlichen Aura des Unschuldig-Harmonischen und Reizvollen transportieren. Folgende Analyse nimmt Bertuchs Bilderbuch für Kinder als Ausgangsort dieser spürbaren Wechselbeziehung von Kind und Bild.
Mit dem Bilderbuch für Kinder entstand zwischen 1790 und 1830 das erste enzyklopädisch ausgerichtete natur- und weltkundliche Sach-buch im deutschsprachigen Raum. Ganz im Kontext der anthropo-logischen Wende des 18. Jahrhunderts (Sergio Moravia) finden die BetrachterInnen im Bilderbuch für Kinder eine Konzentration auf die Naturgeschichte, die Geographie und ihre völkerbeschreibenden Kupferstiche. Hatte das philanthropisch-pädadogische Elementarwerk (1770) Johann Basedows dem Kind allgemein bekannte Dinge und Begebenheiten nahegebracht, setzte Bertuch gemeinhin Exotisches und Unbekanntes ins Bild. Das Bilderbuch publizierte im Wettlauf mit anderen wissenschaftlichen Werken der Zeit die neuesten technischen
von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften: alle nach den besten Originalen gewählt, gestochen und mit einer kurzen wissenschaftlichen, und den Verstandes-Kräften eines Kindes angemessenen Erklärung begleitet. 12 Bde., Weimar 1790-1830.
3 F. J. Bertuch: »Plan, Ankündigung und Vorbericht des Werks (Weimar, den 16. April 1790)«, in: ders. (Hg.): Bilderbuch für Kinder. Weimar 18012a, Bd. 1, S. 1-6, hier S. 5 (Hervorh. i. O.).
9
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
und architektonischen Erfindungen, naturgeschichtlichen Entdeckun-gen sowie ethnologischen und anthropologischen Ansichten. Es wurde als Zeitschriftenheft von je fünf Kupfern ausgeliefert, die zusammen-genommen in ihrem Erscheinungszeitraum auf 237 Einzelhefte kamen. Sie enthielten die beträchtliche Anzahl von 1.186 Kupfertafeln, die sich wiederum in ca. 6.000 Einzelstiche aufteilten. Damit zählt das Bilder-buch für Kinder zu einem der umfangreichsten Bildwerke seiner Zeit.
Im Zuge der modernen Wissenschaftsentwicklung im letzten Drit-tel des 18. Jahrhunderts nahmen Kindheit und das Kind innerhalb der neu entstehenden anthropologischen und erkenntnistheoretischen Debatten eine zentrale Position ein. Eine der dringlichsten Fragen, wie denn der Mensch Wissen erwerbe, wurde an der Figur des Kindes exemplarisch nachvollzogen. Die kindliche Imaginationsfähigkeit und der geistig-körperliche Reifungsprozess dienten dabei vielen Wissen-schaftlern der Zeit als Anschauungsmodelle. Kindheit wurde in diesem anthropologischen Rahmen als Lebensphase definiert, in der das Kind zum Erwachsenen heranreift, um seinen Platz in der bürgerlichen Er-fahrungs- und Berufswelt einzunehmen. Die »Entdeckung der Kind-heit« (Philippe Ariès) war nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass Kindheit Wachsen sowie ›Hineinwachsen‹ hieß, sondern dass man sie nun selbst als einen abgegrenzten Raum der Erfahrungsvermittlung verstand. Kindheit bedeutete Weltvermittlung: In der neuen genera-tionalen Ordnung lehrten Erwachsene Kinder, wie die Welt aussieht und was in ihr vorgeht. Der Einsatz des Bildes sollte dem Kind als Erfahrungsersatz dienen und die Bilderbuchwelt die wirkliche Welt der Erwachsenen simulieren.
Bilderbücher für Kinder wurden in der Forschungsliteratur bisher weder als adäquate historische Quellen berücksichtigt, noch – und das ist für meine Arbeit noch weit wichtiger – als Teil bürgerlicher Kultur-praxis interpretiert, innerhalb derer und durch die zeitgenössische sozi-ale Ordnungen hergestellt und tradiert wurden. Tatsächlich markierten Bildwerke für Kinder den Beginn einer Medialisierung der Lebenswel-ten, durch die die Kultur der Moderne wesentlich durch Bilder hervor-gebracht und vermittelt wurde. Wie kann das Bilderbuch für Kinder als Motor und Ausdruck dieser medialen Verwissenschaftlichung der Weltbetrachtung sowie als Instrument kultureller und sozialer Evi-denzerzeugung betrachtet werden? Das Bild spielte im Spannungs-verhältnis zum wissenschaftlichen Text eine wichtige Rolle, wenn es um die Frage nach der Vermittlung von Erkenntnis ging. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts diskutierten die Fraktion der materiellen Sensualisten und derjenigen, die für eine von der Sprache geleitete
10
Einleitung
Beobachtung plädierte, noch kontrovers über den wissenschaftlichen Einsatz des Bildes. Eine der Thesen dieser Arbeit ist, dass es die Figur des Kindes war, mit der man das Bild als Medium der Weltbetrachtung legitimierte. Das Wissen, dass Bilder dem Kind das Lernen ermög-lichen, bewirkte den Einzug des Bildes eben nicht nur in den Unter-richt des Kindes, sondern in die bürgerliche Alltagswelt im Allgemei-nen. Bei der visuellen Entdeckung, Eroberung und Klassifizierung von Welt spielten die Bilder für Kinder eine entscheidende Rolle.
Kind und Bild bildeten einen starken semantischen Nexus, den ich in unterschiedlichen Feldern nachverfolgen werde. Die Spur, die hier hinterlassen wird, erzählt konkrete Geschichten von der menschlichen Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit, den Bedürfnissen nach Anschaulichkeit und Lebendigkeit sowie vom Denken, Fühlen und Träumen, ausgelöst durch Bilder. Wie in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung findet sich auch in der Rhetorik des Iconic Turns, dessen VertreterInnen das Bild gegenüber der Sprache rehabilitieren möchten, die Aussage ›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ bzw. der Kind-Bild-Komplex implizit wieder. Bilder hätten in unserer textdominierten Kultur lange Zeit als Vorstufe einer Mediengeschichte gegolten: »Sie gehörten noch der kindlichen Entwicklungsstufe der Menschheit und der Vorgeschichte der Medien an, während die Erfindung der Spra-che den eigentlichen Beginn der Mediengeschichte markiere.«4 Hier wird die starke Beziehung ersichtlich, die Kind und Bild nicht nur rhetorisch aneinander bindet. In den wissenschaftlichen Bewertungen des Bildes schwangen und schwingen noch immer Ideen von der Vorstufe der Erkenntnis, von Entwicklung und von kindlicher Wahr-nehmung als bereits den Kind-Bild-Komplex um 1800 konstituierende Elemente mit. Mit der folgenden Arbeit zu Bertuchs Bilderbuch für Kinder sollen sowohl die Hervorbringung eines kindlichen Blickes im Kontext der Geschichte der Sinnesphysiologien und der wissenschaft-lichen Debatten der Zeit untersucht werden als auch Bildinhalte und Darstellungspraktiken.
4 M. Schulz: Ordnungen der Bilder. Eine Einführung in die Bildwissenschaft. München 2005, S. 8. Ebenso aufgegriffen wird die Analogie Kind und Bild von J. Hörisch: Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der Medien. Frank-furt a. M. 2001, S. 55 ff.
11
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
1.2 Anthropologie der Sinne und ihre reizvoll-vergnüglichen Bilder
Die wohl bekannteste und am meisten rezipierte Studie an der Schnitt-stelle zwischen visueller Erziehung, Wissenschaft und Kultur des 17./18. Jahrhunderts ist das Standardwerk der Kunstgeschichtlerin Bar-bara Maria Stafford Artful Science. Enlightenment, Entertainment, and the Eclipse of Visual Education (1996). Stafford verfolgt die zentrale These, die visuelle Kultur der Frühen Neuzeit sei von einer textzent-rierten Lesekultur im aufklärerischen Europa abgelöst worden:
Mid-eighteenth-century northern Europe (especially France, Ger-many, the Low Countries, and Great Britain) was in the throes of changing from an oral, visual, and aristocratic culture to a mar-ket-centered, democratic, print culture. Supposedly ignorant lis-teners and gullible onlookers had to be molded into silent and solitary readers. While the transformation in late modernism runs in the opposite direction from texts to images, the pangs of this culture-making metamorphosis were registered in similar analogies during early modernism’s trajectory from images to texts.5
Bei meiner Verfolgung des Kind-Bild-Komplexes und bei meinen Nachforschungen zum wissenschaftlichen Bild um 1800 lässt sich je-doch kein Niedergang der visuellen Kultur feststellen, sondern viel-mehr eine Verschiebung derselben in den erzieherischen und familiären Bereich der nun aufkommenden Bürgerlichkeit.6 Visuelle Erziehung verschwand nicht, sondern mit dem pädagogischen Erziehungskontext
5 B. M. Stafford: Artful Science. Enlightenment, Entertainment, and the Eclipse of Visual Education. Cambridge 1996, S. 1.
6 Es liegt mir fern, mit dem Begriff Bürgerlichkeit eine einfache Homogeni-sierung und Differenzierung einer bürgerlichen Schicht einerseits und einer adeligen Schicht andererseits vorzunehmen. Mit Bürgerlichkeit / bürgerlich ist vielmehr der Blick auf spezifische kulturelle Praktiken, Lebensstile und »Selbststilisierung als ästhetische[r] Praxis« gemeint, vgl. W. Kaschuba: »Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. Kultur als symbolische Praxis«, in: J. Kocka (Hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Band II. Wirtschaftsbürger und Bildungsbürger. Göttingen 1995, S. 92-127, hier S. 94. »Wenn es also um ›Bürgerlichkeit‹ im Sinne historisch gewachsener kultureller Praxis geht, müssen wir wohl umdenken: nicht ausgehend von einer vordefinierten So-zialstruktur eine feste Zuordnung kultureller Werte und Muster versuchen, sondern solche gesellschaftliche Situationen und Figurationen als Maßstab nehmen, in denen sich bürgerliche Kulturpraxis zugleich als ein konkreter sozialer Handlungskontext präsentiert«, ebd., S. 93.
12
Einleitung
des Bürgertums, aber auch der Volksaufklärung ergaben sich neue wichtige Konsumentenschichten für wissenschaftliche sowie experi-mentelle Bilder. Mit der neuen Zielgruppe veränderten sich auch die Inhalte, die Arrangements und die Ästhetik des Bildes.
Die Annahme Staffords, Bilder des Wissens in der Frühen Neuzeit hätten sich in ein visuell-belustigendes Unterhaltungsformat umge-wandelt, kann mit der generellen Abwertung vom Bild für das Kind als ernstzunehmendem Forschungsgegenstand erklärt werden. Es gibt mittlerweile unzählige wissenschaftshistorische, kunstgeschichtliche und historische Abhandlungen zu visuellen Medienformaten der Frü-hen Neuzeit und der Aufklärung. Bilder für Kinder spielen in ihnen meistens keine Rolle, da sie zumeist nicht unter das Label ›wissen-schaftliche Bilder‹ fallen. Die Grenzen zwischen Wissenschaft, Öffent-lichkeit und auch Erziehung sind um 1800 jedoch mehr als fließend und in Bezug auf das Bild als Wissensmedium nur schwer in die Kate-gorien kindlich / Unterhaltung und erwachsen / Wissenschaft einteilbar. Stafford nimmt diese Unterteilungen vor, wobei sie diese noch durch die Differenzierung männlicher und weiblicher Unterhaltungsformate unterfüttert. Tatsächlich geht es ihr dabei um einen größeren Wandel von einer frühneuzeitlichen oral-visuellen hin zu einer modernen und textdominierten Kultur. Meine Arbeit möchte im Unterschied dazu nachweisen, dass die (Aus-)Bildungssphären des Kindes um 1800 nicht als hermetisch abgeriegelter Raum der Kindheit zu verstehen sind.
In dieser Zeit gab es die binäre Opposition von männlich-textzent-riertem Wissen zu weiblich-kindischen Unterhaltungsmedien natürlich in unterschiedlichen Schattierungen. Der zeitgenössische Ausspruch ›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ scheint diese Kontrastrierung zu bestätigen. Die Charakterisierung der Bilder als unterhaltend, belus-tigend und erzieherisch trennte sie diskursiv vom Bereich des Ernst-haften, Wissenschaftlichen und Erwachsen-Männlichen ab. Meine Untersuchung der historischen Bildpraxen zeigt in diesem Zusam-menhang, dass diese abwertenden Einschätzungen vor allen Dingen gerade dann angeführt wurden, wenn es um den Einsatz des Bildes beim Erkenntnisprozess ging. Nicht selten uferte dabei diese Kritik am Bild in eine übersprudelnde Textproduktion aus. Bertuchs begleitender Kommentar zum Bilderbuch für Kinder für Lehrer und Eltern, der die Kupfer tafeln einzeln im Detail beschrieb und in den jeweiligen For-schungskontext einordnete, kam auf 24 Bände!7 Diese Menge an kon-trollierendem Text verdeutlicht, wie stark man den Einfluss der Bilder
7 C. P. Funke: Ausführlicher Text zu Bertuch’s Bilderbuche für Kinder. Ein
13
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
einschätzte. Die Abwertung des Bildes bedeutet also nicht gleich die Unwichtigkeit des Bildes um 1800. Die Abqualifizierung und Außer-achtlassung des Bildes für Kinder in der heutigen Forschungsliteratur überrascht insofern sehr. Sie deutet näherliegend auf eine selbstevidente Wirkmächtigkeit des Kind-Bild-Komplexes hin.
Dies mag auch die Erklärung dafür sein, warum man Bilder für Kin-der bisher lediglich in ihren didaktischen Funktionen untersucht hat und eine Analyse der Bildinhalte meistens außer Acht ließ. Eine Aus-nahme bildet Anke te Heesens Werk Der Weltkasten. Die Geschichte einer Bildenzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert (1997), in dem die Autorin die Bilder-Akademie für die Jugend (1780-1784) von Johann S. Stoy untersucht, einem Nürnberger Pädagogen und Theologen. Te Heesen ist vor allen Dingen an einer »Geschichte der Dinge« bzw. einer »materialen Kultur« der Aufklärungszeit interessiert.8 Letztere entwickelt sie neben der Mentalitätsgeschichte auch aus der »Sachkul-turforschung« der Europäischen Ethnologie / Empirischen Kulturwis-senschaft.9 In ihrer Auseinandersetzung mit den Kupferstichen von Stoys Bilder-Akademie beschreibt sie die Bilder nicht nur als »Dinge« in ihrer historischen Funktionsweise, sondern liefert eine Geschichte der symbolischen Praktiken und Strategien im Kind-Bild-Diskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Anke te Heesens Studie, die sich im Schnittfeld von Wissenschafts-geschichte und Kulturanalyse befindt, habt meine Arbeit wesentlich inspiriert. Ebenso wie in meiner Untersuchung spielen bei te Heesen bürgerliche Identitätsdiskurse, kulturelle Praxen des Sammelns und
Commentar für Eltern und Lehrer, welche sich jenes Werks bei dem Unter-richt ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen. 24 Bde., Weimar 1796-1833.
8 A. te Heesen: Der Weltkasten. Die Geschichte einer Bildenzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert. Göttingen 1997a, S. 12.
9 Vgl. dies. 1997a, Anm. 10 auf S. 12. Bei meiner Durchsicht der Forschungen innerhalb der Europäischen Ethnologie / Volkskunde finden sich natürlich die bekannten Werke zur Kulturgeschichte der Kindheit (Weber-Kellermann 1979, 1985, 1991), aber nur ein historischer Beitrag zum Zusammenhang zu Kind und Bild: C. Burckhardt-Seebass: »Belohnung durch Bilder«, in: K. Köstlin: Kinderkultur. 25. Deutscher Volkskundekongress in Bremen vom 7. bis 12. Oktober 1985. Bremen 1987, S. 135-142. Es geht Burckhardt-Seebass hier um die Kulturgeschichte des Bildes als Erziehungs- bzw. Belohnungsmit-tel, die an die Sachkulturforschung angelehnt ist. So bezieht sie sich nur am Rande auf Bildwerke um 1800. Im Vordergrund stehen eher das Andachtsbild und Fleißbillet des 19. Jahrhunderts, wobei sich die Autorin auf die Forschung von Adolf Spamer bezieht: A. Spamer: Das kleine Andachtsbild. München 1930. Forschungen der Volkskunde zu Bilderbögen bleiben in meiner Arbeit unberücksichtigt, da sie nicht in die von mir untersuchte Zeit fallen.
14
Einleitung
Ordnens sowie die Erforschung sinnlicher Methoden im Erziehungs-kontext eine wichtige Rolle. Wenn te Heesen Bildinhalte beschreibt und diese kulturhistorisch einordnet, liegt die Stärke ihrer Arbeit ins-besondere in der Erörterung der Methoden und Praktiken der Dar-stellung.10 Detaillierte Betrachtungen der Bilderthemen, wie z. B. Reli-gion, fremde Völker oder auch die vielen Sachanschauungsthemen der Botanik, Zoologie und Anatomie, nimmt sie dagegen nicht vor. Meine Arbeit möchte hier als Vertiefung zu te Hessens Studie gerade die naturgeschichtlichen und frühethnologischen Bildinhalte der Kupfer-tafeln ergründen und diese nicht nur als Träger kultureller Bedeutung sichtbar machen, sondern als materielle Objekte, die auf ihre beson-deren sinnlichen Weisen wirken. Die Analyse dieser ästhetischen und aisthetischen Dimensionen des Bildes wird zeigen, inwiefern Bilder eben nicht die andere, irrationale Seite der Aufklärung waren, sondern vielmehr elementarer Teil einer visuellen Kultur, die ganz eigenen bild-didaktischen Faktoren folgte, gleichzeitig aber auch Teil einer umfas-senden Wahrnehmungsgeschichte und Wissensmedienlandschaft um 1800. Bilder für Kinder und die mit ihnen verbundene Bildpraxis kann man nicht von Wissensbildern aus anderen erwachsenen Zusammen-hängen loslösen; im Gegenteil, sie müssen in Beziehung zueinander verstanden werden. Der Raum der Kindheit im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert ist nur in seiner Relationalität verstehbar.
Ein weiteres wichtiges Feld, auf dem sich meine Analyse der Bilder für Kinder bewegt, ist das der Anthropologie der Sinne. Seit Mitte der 1980er-Jahre kann man in der Erziehungswissenschaft den Beginn einer historisch-pädagogischen Anthropologiedebatte beobachten, die sich an der Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners orien-tiert.11 Hierbei spielen der Körper und sinnliche Wahrnehmung eine
10 So fokussiert te Heesen in ihrer Analyse der Bildinhalte beispielsweise auf die Darstellung des bürgerlichen Körpers im Bild. Vgl. dies. 1997a, S. 113-139.
11 Das »Interdisziplinäre Zentrum für Historische Anthropologie« der FU Ber-lin um Christoph Wulf und Gunter Gebauer ist der Tradition der Philoso-phischen Anthropologie verpflichtet. Vgl. G. Gebauer [u. a.]: Historische Anthropologie. Zum Problem der Humanwissenschaften heute oder Versuche einer Neubegründung. Reinbek bei Hamburg 1989. Vgl. für die davon zu un-terscheidende historische Anthropologiedebatte in den 1970er-Jahren in den Geschichts- und Sozialwissenschaften W. Lepenies: »Probleme einer Histo-rischen Anthropologie«, in: R. Rürup (Hg.): Historische Sozialwissenschaft. Beiträge zur Einführung in die Forschungspraxis. Göttingen 1977, S. 126-159. Vgl. zum Stichwort »Literarische Anthropologie« den fächerübergreifenden Überblick von W. Riedel: »Anthropologie und Literatur in der deutschen Spät aufklärung. Skizze einer Forschungslandschaft«, in: Internationales Ar-
15
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
neue Rolle: Der Mensch soll als Subjekt lebendiger Erfahrung rehabi-litiert werden, die leiblich-sinnlichen Erfahrungsdimensionen sollen in die pädagogische Theorie mit einfließen.12
Für Plessner bedeutet »Anthropologie der Sinne«, Sinnesprozesse (Sehen, Riechen, Tasten etc.) nicht als bloße physiologische Reiz-Reaktions-Schemata zu verstehen. Ebenso wenig soll sie unter dem Aspekt einer traditionellen Ästhetik begriffen werden, der zufolge die wachsende Industrialisierung die Sinne überfordere, »das Schöne« noch wahrzunehmen.13 Stattdessen geht es Plessner um die Freilegung der Doppelstruktur des sinnlichen Erlebens: Dieses ist »Abstraktion und Einfühlung« zugleich.14 Plessner geht davon aus, dass sinnliche Eindrücke das menschliche Bewusstsein in Form von Abstraktionen erreichen und die Menschen die Welt somit sinnlich wahrnehmen. Folglich wird sinnliche Wahrnehmung von Plessner als Verschränkung von Körper und Vernunft, von sinnlichem Eindruck und Reflexion sowie von Empathie und Abstraktion verstanden.15 Auf die Tradition der Plessner’schen Anthropologie der Sinne beziehen sich die sinnlich-leiblichen Ansätze innerhalb der historisch-anthropologischen Pädago-gik der 80er- und 90er-Jahre.16 Verstärkt werden hier die mensch liche Einbildungskraft, Imagination und Phantasie als anthropologische Phänomene in Relation zum Bild untersucht.17
Für die historische Ausrichtung dieser Arbeit spielt die Hinwen-dung zur Anthropologie der Sinne jedoch noch eine weitere wichtige Rolle, da sie konkret auf anthropologische Konzepte des 18. Jahr-hunderts bezogen werden kann und sollte.18 Wenn Rationalität die
chiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 6. Sonderheft, Tübingen 1994, S. 93-157.
12 D. Kamper, C. Wulf (Hg.): Die Wiederkehr des Körpers. Frankfurt a. M. 1982; dies. (Hg.): Das Schwinden der Sinne. Frankfurt a. M. 1984.
13 H. Plessner: »Anthropologie der Sinne, Bd. 3«, in: G. Dux (Hg.): Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M. 1980.
14 Ebd., S. 195.15 Ebd., S. 194-195.16 Kamper / Wulf 1984, S. 15.17 G. Schäfer, C. Wulf (Hg.): Bild-Bilder-Bildung. Weinheim 1999. Zuletzt
erschienen mit Aufsätzen bekannter Bildtheoretiker, wie z. B. Hans Belting oder Gottfried Boehm. B. Hüppauf, C. Wulf (Hg.): Bild und Einbildungs-kraft. München 2006; außerdem C. Wulf, J. Zirfas (Hg.): Ikonologie des Performativen. München 2005. Hier findet sich eine ganze Sektion zum Thema »Anthropologie der Bilder«, S. 35-132; zuletzt erschienen: C. Wulf: Anthropologie: Geschichte – Kultur – Philosophie. Köln 2009, S. 299-326.
18 Diesen Zugang findet man in den bildungshistorischen Arbeiten, die sich durch detaillierte Quellenstudien auszeichnen. Äußerst gewinnbringend in
16
Einleitung
eine Seite der Vernunft ist, dann beruft sich Plessner im Rahmen der Philosophie auf die andere Seite – die Sinnlichkeit. Stichworte wie Empirismus und Sensualismus, Rehabilitierung der Sinnlichkeit, Emp-findung und Körperlichkeit gingen im 18. Jahrhundert in die anthro-pologischen Debatten um den »ganzen Menschen« ein.19 Sie spielen bis heute in der Konzeption einer Anthropologie der Sinne eine tragende Rolle.
Interessanterweise sind die Erträge der historisch-anthropologi schen Pädagogik zur Aufklärungspädagogik spärlich geblieben, was mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung zu tun hat. Der Bildungshistoriker Heinz- Elmar Tenorth kritisiert in einem gewinnbringenden Überblick über den Stand der historisch-anthropologischen Pädagogik, dass diese »doch eher über den Umweg der großen Begriffe« gehe, anstatt »in-tensiv z. B. in die Historie des 18. Jahrhunderts oder in die lange Ge-schichte der Erziehungspraktiken zurückzugehen«.20 Dieses Desiderat ist umso erstaunlicher, als dass es noch immer die Aufklärungspädago-
diesem Rahmen ist die Dissertation von Christa Kersting, die sich mit den Schriften der philanthropischen Pädagogik im Kontext der Anthropologie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts beschäftigt hat: C. Kersting: Die Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert. Campes Allgemeine Revision im Kontext der neuzeitlichen Wissenschaft. Weinheim 1992; dies.: »Wissenschaft vom Menschen und Aufklärungspädagogik in Deutschland«, in: F.-P. Hager (Hg.): Bildung, Pädagogik und Wissenschaft in Aufklärungsphilosophie und Aufklä-rungszeit. Bochum 1997, S. 77-107; vgl. J. Garber: »Von der ›Geschichte des Menschen‹ zur ›Geschichte der Menschheit‹. Anthropologie, Pädagogik und Zivilisationstheorie in der deutschen Spätaufklärung«, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung. Bad Heilbrunn 1999, Bd. 5, S. 31-54; C. Wulf: Anthropologisches Denken in der Pädagogik 1750-1850. Weinheim 1996.
19 Die Habilitationsschrift von H. R. Müller: Ästhesiologie der Bildung. Bil-dungstheoretische Rückblicke auf die Anthropologie der Sinne im 18. Jahr-hundert. Würzburg 1998, sieht sich in der Tradition und als Fortführung des Plessner’schen Ansatzes. Müller stellt die Hervorbringung moderner Bildungsideen in den Kontext anthropologischer Debatten um 1800. Dabei skizziert er den Wandel von mechanistischen zu organologischen Bildungs-konzepten, die als Indikatoren eines veränderten wissenschaftlichen Ver-ständnisses von Mensch, Natur und Geschichte angesehen werden.
20 H.-E. Tenorth: »›Vom Menschen‹. Historische, pädagogische und andere Perspektiven einer ›Anthropologie‹ der Erziehung. Eine Sammelbesprechung neuerer Literatur«, in: Zeitschrift für Pädagogik, 46: 905-925, 2000, hier S. 914. Tenorths Kritik verdeutlicht den Unterschied zur Historischen Anth-ropologie der Geschichts- und Sozialwissenschaften, deren Vorgehensweise eher einer »historischen Ethnographie« ähnelt und in der es nicht um »große« Entwürfe von Menschenbildern geht, vgl. Lepenies 1977, S. 138-139.
17
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
gik ist, die leitende Begriffe der heutigen Erziehungswissenschaft wie z. B. »Bildsamkeit«, »perfectibilité« oder »Vervollkommnung« liefert.21
Um eine Anthropologie der Sinne als mögliche kulturwissen-schaftliche Methodologie zu entwerfen, möchte ich diese zunächst als Diskursformation des 18. Jahrhunderts untersuchen. Dabei sind die Konzepte von Erfahrung, Sinnlichkeit, Beobachtung und Empirie ge-rade für die Europäische Ethnologie als einer empirisch verfahrenden Kulturwissenschaft von größtem Interesse. Diese Begrifflichkeiten, die heute zum Standardrepertoire der Disziplin gehören, werden in der Studie einer historisch-anthropologischen Tiefenanalyse unterzogen.
1.3 Bilder als relationales Kulturphänomen und als kulturelle Narrative
Visuelle Kultur als Netz
Die Kupferstiche des Bilderbuchs für Kinder sollen in dieser Arbeit als Teil der visuellen Kultur des 18. Jahrhunderts begriffen werden, die durch spezifische Bildpraxen und bestimmte Darstellungsweisen sowie Bildinhalte und Ordnungen hervorgebracht wurde. Ich möchte die Bilder aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive als Teile größe-rer kultureller Figurationen sichtbar machen, die durch ihre sinnlich-epistemische Logik auf ganz eigene Weisen wirken. Hierbei ist es unerlässlich, interdisziplinär vorzugehen – weniger um unterschied-liche disziplinäre Bildkompetenzen abzurufen als vielmehr um das Bil-derbuch für Kinder als ein neues Forschungsobjekt zu konstituieren: »Will man Interdisziplinarität betreiben, genügt es nicht, ein ›Thema‹ zu nehmen und darum zwei oder drei Wissenschaften zusammenzuru-fen. Die Interdisziplinarität besteht darin, einen neuen Gegenstand zu
21 Hier haben die bildungshistorischen Untersuchungen Ullrich Herrmanns eine Vorreiterposition, in denen er eine historische Sozialisationsforschung mit Blick auf Norbert Elias betreibt. U. Herrmann: »Perfektibilität und Bildung. Funktion und Leistung von Kontingenzformeln der Anthropologie, Kulturkritik und Fortschrittsorientierung in den reflexiven Selbstbegrün-dungen der Pädagogik des 18. Jahrhunderts«, in: D. Hoffmann [u. a.] (Hg.): Begründungsformen der Pädagogik in der ›Moderne‹. Weinheim, 1992, S. 79-99; ders.: »Pädagogische Anthropologie und die ›Entdeckung‹ des Kindes im Zeitalter der Aufklärung. Kindheit und Jugendalter im Werk von Joachim Heinrich Campe«, in: ders. (Hg.): »Die Bildung des Bürgers«. Die Formie-rung der bürgerlichen Gesellschaft und die Gebildeten im 18. Jahrhundert. Weinheim [u. a.] 1982, S. 178-193.
18
Einleitung
kreieren, der niemandem gehört.«22 Das nun folgend interdisziplinär ausgearbeitete methodische Instrumentarium und die Fragestellungen dienen dazu, den Gegenstand Bilderbuch kulturanalytisch jenseits dis-ziplinärer Zuständigkeitsbereiche zu erfassen.
Im Kontext der Cultural Studies lehnt sich mein Begriff der visuellen Kultur an Raymond Williams’ Kulturbegriff von ›culture as a whole way of life‹ an. Dieses Konzept von Kultur bezieht populärkulturelle Gegenstände, ihre materielle Produktion sowie kulturelle Praxen, Re-präsentationen und »signifying or symbolic systems«23 mit ein:
[V]isual culture is used in a far more interactive sense, concentrating on the determining role of visual culture in the wider culture to which it belongs. Such a history of visual culture would highlight those moments where the visual is contested, debated and trans-formed as a constantly challenging place of social interaction and definition in terms of class, gender, sexual and racialized identities.24
Der Fokus der Arbeit liegt somit nicht nur auf den Kupferstichen und auf den Fragen der Bildlichkeit, sondern ich möchte das Bilderbuch als feldübergreifendes Thema analysieren.25 Die von mir untersuchten Bildinhalte, Bildpraxen und das von ihnen hervorgebrachte Bildwis-
22 »Pour faire de l’interdisciplinaire, il ne suffit pas de prendre un ›sujet‹ (un thème) et de convoquer autour deux ou trois sciences. L’interdisciplinaire consiste à créer un objet nouveau, qui n’appartienne à personne. Le Texte est, je crois, l’un de ces objets«, in: R. Barthes: »Jeunes chercheurs«, in: Commu-nications, 19: 1-5, 1972, hier S. 3 (Übers. S. C.).
23 R. Williams: Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York 1983, S. 91 (Hervorh. i. O.).
24 N. Mirzoeff: »What is Visual Culture?«, in: ders. (Hg.): The Visual Culture Reader. London [u. a.] 1998, S. 3-13, hier S. 6. Dabei verstehen die Vertreter der Visual Culture Studies diese anlehnend an die Cultural Studies als kriti-sches Projekt. Beispielsweise soll Geschichte ›anders‹ geschrieben werden. In diesem Rahmen wird visuelle Kultur auch als »field of knowledge« begriffen, das Wissen über das kulturell Andere produziert, vgl. hierzu I. Rogoff: »Stud-ying Visual Culture«, in: ebd., S. 14-26; vgl. ebd., S. 5.
25 Ich verfolge in dieser Arbeit nicht das Ziel, Aussagen über die Ontologie des Bildes zu machen. Viele Untersuchungen, die sich seit dem Pictorial Turn in den 90er-Jahren mit Bildern beschäftigen, nehmen zuallererst an den weit ver-breiteten theoretischen und methodologischen Debatten um Bildbegriffe und Bildmethoden teil. Meine Untersuchung möchte sich auf den Forschungs-gegenstand Bilderbuch für Kinder konzentrieren; dort, wo sich aus meiner Analyse heraus Aussagen zu Bildlichkeit und Bildbegriffen treffen lassen, werde ich diese herausarbeiten. Vgl. zu dem Umstand des Verlierens des eigentlichen Forschungsgegenstands D. Hornuff: »Aus dem Blick verloren.
19
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
sen konstituieren sich aus verschiedensten kulturellen Feldern, an die sich ein heterogener Korpus von Quellen anschließt. Diese Felder sind Literatur (Romane, Gedichte, Novellen), Architektur (Gebäude, Innenräume, Landschaften), Wissenschaft (erkenntnistheoretische, pädagogische, anthropologische, naturgeschichtliche, kunstästhetische Werke der Zeit, Rezensionsorgane, Experimente etc.), Salonkultur (Kabinette, Schauräume, -spektakel), Biographie und Lebensgeschichte (Briefe, Autobiographien, Selbstzeugnisse), Volksaufklärung (Ratge-ber, Magazine, Kalender), Kunst (Gemälde, Kupferstiche, Zeichnun-gen) und das der Kinderkultur (Bildwerke, ABC-Bücher etc.). Ich verfolge dabei ein close reading und eine dichte Beschreibung der diese Bereiche betreffenden historischen Quellen.
Dabei verwende ich im Rahmen dieser mannigfaltigen Quellen-analyse einen weiten Bildbegriff, der eben nicht nur Bilder in ihrer materiellen Form untersucht, sondern weitere materielle Artefakte sowie Sprach- und Vorstellungsbilder und darüber hinaus Seh- und Wahrnehmungspraxen in die Untersuchung mit einbezieht. Gottfried Korff hat den Einfluss und die Wichtigkeit eines weiten Bildbegriffs, wie er von Aby Warburg eingebracht wurde, für die empirisch verfah-rende Kulturwissenschaft an mehreren Stellen herausgearbeitet26 und spricht in diesem Kontext von einem Bildzugang, »der am Bild auch vor, unter und neben der Kunst interessiert ist«.27 Dieser weite Blick, der versucht, die Relationalität der zu untersuchenden Phänomene he-rauszuarbeiten, fußt gleichzeitig auf einem empirischen Verhaftetsein im Material selbst.28 Es gilt hier, die vermeintlichen Grenzen einzelner
Wie sich die aktuelle Bildwissenschaft von ihrem Gegenstand entfernt«, in: Merkur, November-Heft: 995-1003, 2008.
26 G. Korff: »Aby Warburg und der Volkskundekongress von 1905. Eine fach-historische Momentaufnahme«, in: Zeitschrift für Volkskunde, 101: 1-29, 2005a; ders.: »Kulturforschung im Souterrain. Aby Warburg und die Volks-kunde«, in: K. Maase, B. J. Warneken (Hg.): Unterwelten der Kultur. The-men und Theorien der volkskundlichen Kulturwissenschaft. Köln [u. a.] 2003, S. 143-177.
27 G. Korff: »Vor, unter und neben der Kunst. Warburgs Methode und die volkskundliche Bildforschung«, in: H. Gerndt, M. Haibl (Hg.): Der Bilder-alltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft. Münster [u. a.] 2005b, S. 49-66, hier S. 54 (Hervorh. i. O.).
28 Hier folge ich Helge Gerndts empirischer Kennzeichnung der kulturwissen-schaftlichen Bildanalyse: »[S]ie [richtet] ihre Aufmerksamkeit speziell auf die sinnlich erfahrbare visuelle Kultur, die in den Dimensionen von Raum, Zeit und Gesellschaft als ein miteinander verbundenes Dreieck aus Bilderwelt, Bildüberlieferung und Bilderpraxis abstrahiert werden kann«, H. Gerndt:
20
Einleitung
Bildinhalte zu überschreiten. So münden meine wissenschaftshisto-rischen Untersuchungen nicht selten in Wissens- und Wissenschafts-geschichten, die der erzählenden Struktur der ins Bild gesetzten Phä-nomene geschuldet sind, auf die ich im Folgenden noch näher eingehen werde.29
Ich möchte Bertuchs Bilderbuch für Kinder als ein relationales Phänomen im Sinne Ernst Cassirers analysieren, dessen Arbeit Rolf Lindner für eine Kulturanalyse fruchtbar macht:
Im Mittelpunkt der Kulturanalyse stehen also kulturelle Konstella-tionen – cultural conjunctures im Sinne der Cultural Studies –, bei denen soziale, kulturelle und biographische Komponenten auf eine zeitspezifische Weise zusammen treffen. Diese sichtbar zu machen und ihre Logik nachzuzeichnen ist Aufgabe der Feld-Analyse im Sinne einer Untersuchung kultureller Komplexe.30
Bildpraxis, Bildtradierung und das hervorgebrachte Bildwissen wer-den so als Elemente eines historischen Zusammentreffens (»historical conjuncture«) und eines kulturellen Moments sichtbar gemacht. Eines Moments, in dem sich »Umstände von struktureller, kultureller und biographischer Art« verflechten, um in einem »historischen Augen-blick [. . .], in dem die verschiedenen Impulse zusammenkommen [. . .] eine neue gestaltgebende Einheit [zu] bilden«.31 So können Bilder der Verzeitlichung (Kap. III.1) oder Bilder über Indien (Kap. III.2) nur innerhalb eines Bedeutungsnetzwerkes ausgemacht werden, das das Feld der Bildwerke für Kinder weit überschreitet. Aus diesem Grund ist meine Arbeit auch keine Untersuchung zum literarischen, päda-gogischen oder bildungshistorischen Genre der Bilderbücher; ebenso wenig biete ich eine werkimmanente Analyse des Bilderbuchs mit einer Konzentration auf Werk und Künstler an. Stattdessen soll der Forschungsgegenstand Bilderbuch im Sinne des eben skizzierten Ver-ständnisses von visueller Kultur kulturrelational auf unterschiedlichen Feldern untersucht werden.
»Bildüberlieferung und Bildpraxis. Vorüberlegungen zu einer volkskund-lichen Bildwissenschaft«, in: ders. / Haibl 2005, S. 13-34, hier S. 29.
29 Vgl. zu Wissenschaftsgeschichten R. Lindner: »Spür-Sinn. Oder: Die Rück-gewinnung der ›Andacht zum Unbedeutenden«, in: Zeitschrift für Volks-kunde, 107 (2): 155-169, 2011, S. 157.
30 R. Lindner: »Vom Wesen der Kulturanalyse«, in: Zeitschrift für Volkskunde, 99 (2): 177-188, 2003, hier S. 184.
31 R. Lindner: Die Stunde der Cultural Studies. Wien 2000, S. 11-12.
21
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
Ich möchte herausarbeiten, wie die einzelnen wissenschaftlichen, pädagogischen und alltagskulturellen Aussagen über ›Kind und Bild‹ in ihrer jeweiligen Form Gestalt annehmen, dass sie einen Komplex bil-den, der eine gewisse Selbstverständlichkeit erlangt. Lediglich in einem System von Differenzen wird Gestaltbildung möglich; oder anders for-muliert: »Nur in einem Beziehungsgeflecht macht Gestalt [in unserem Fall der Kind-Bild-Komplex] als Symbolformation überhaupt Sinn; nur im Angesicht des Anderen bildet sich das Eigene (über)prägnant heraus.«32 Innerhalb dieser Korrelationen werden Identitäten wie Kind und Erwachsener gebildet. So wird der erwachsene Bildgebrauch, der vernünftig-rationale Einsatz des erwachsenen Verstands und die Kon-stituierung ›ernsthafter‹ Bilder in Abgrenzung zu Bildern für Kinder und der kindisch-kindlichen Imagination gesetzt. Hier schließen sich folgende Fragen an: Wie kam das Bild zum Kind und umgekehrt? Wie formierte sich das Wissen um 1800, das Kind und Bild im Prozess des Lehrens und Lernens miteinander vereinte? Innerhalb welchen sozio-historischen Kontexts etablierte sich jenes Wissen über den Kind-Bild-Komplex? Worauf verweisen die für das damalige Kind produzierten Bilderwelten? Welche sozialen Prozesse offenbaren sie erwachsenen WissenschaftlerInnen von heute?
Um den Kind-Bild-Komplex nachzuvollziehen, wie er sich im letz-ten Drittel des 18. Jahrhunderts auch gerade in Bertuchs Werk mani-festiert, möchte ich das Wissen, das Kind und Bild zusammenbringt, in die Frühe Neuzeit und weiter zurückverfolgen. Hiermit bezwecke ich keine Ursprungsgeschichte, sondern den »Versuch, historische Ver-änderungen im Makromaßstab, etwa Epochenschwellen, auf die mög-liche Veränderung elementarer Verhaltensweisen, die gleichermaßen das Substrat solcher Veränderungen bilden könnten, zu untersuchen«.33 Im Sinne des hier von Wolf Lepenies skizzierten Erkenntnisinteresses der Historischen Anthropologie kann man anhand des geschichtlichen Nachvollzugs des Kind-Bild-Komplexes einen Wandel der Einstellun-gen zum (Wissens-)Bild, aber auch Veränderungen in der Bildpraxis und in der Hervorbringung von Bildwissen untersuchen. Die Histori-sche Anthropologie ist dabei nicht als eine wissenschaftliche Disziplin zu verstehen, sondern eher als eine historische Blickweise auf Anthro-pologisierungsphänomene innerhalb der Geschichtsschreibung selbst. Denn anthropologische und geschichtsphilosophische Fragestellungen waren im 18. Jahrhundert eng miteinander verknüpft, wie ich im
32 Lindner 2003, S. 180.33 Lepenies 1977, S. 131.
22
Einleitung
Laufe meiner Untersuchung herausarbeiten werde. Welche Rolle wird hierbei der Imaginationsfähigkeit und der Bildbetrachtung beim Wis-senserwerb zugesprochen? Warum werden kindliche und erwachsene Imaginationsfähigkeiten anthropologisch voneinander unterschieden? Welche Bildprogramme und Bilddidaktiken bringen überhaupt erst den kindlichen Blick hervor?
Bei all diesen Fragen geht es mir nicht um die Suche nach der ›condi-tio humana‹, verstanden als Bedingung des Menschseins oder der Natur des Menschen, sondern um die Praktiken, um die symbolischen, sinn-stiftenden und kennzeichnenden (signifying) Klassifizierungssysteme und Ordnungen. Mich interessieren hierbei auch die sozialen Bezie-hungen, die menschlichen Bedürfnisse und die Erfahrungsverarbeitung im Sinne der Historischen Anthropologie, wie Richard van Dülmen sie entwirft: »Die historische Anthropologie stellt den konkreten Men-schen mit seinem Handeln und Denken, Fühlen und Leiden in den Mittelpunkt der Analyse.« Weiter schreibt van Dülmen, »Geschichte [werde] als vom Menschen gemachtes Werk betrachtet, wie umge-kehrt der Mensch als durch die Geschichte geprägtes Wesen definiert wird.«34 Die historisch-anthropologische Analyse findet im Bild einen einzigartigen Ort der Erfahrungsverarbeitung und Evidenzerzeugung. Bilder nehmen im Prozess des Erfahrungmachens eine elementare Rolle ein. Eltern und Pädagogen erklären den Kindern die Welt mit-tels Bilder, während Letztere gleichzeitig die Welt sinnlich erfahrbar machen. Kinder sollen so über Bilder sinnliche Eindrücke sammeln und Erfahrungen machen. Wie wird dabei im zeitgenössischen Kon-text über sinnliche Erfahrung gesprochen und hier insbesondere auch visuelle Erfahrung thematisiert? Wie lässt sich der Prozess beschreiben, nach dem Bilder zu einem anschaulichen Erziehungsmittel werden? Wie wird Anschaulichkeit verstanden und welcher Adaptionen des kindlichen wie des erwachsenen Blickes bedarf es dabei? Und nicht zu-letzt: Welche Erfahrungen und Bedürfnisse sollen und können visuell umgesetzt werden? Erfahrung, Evidenz und Wissen werden in meiner Arbeit somit als historische Konzepte sichtbar gemacht.
Der historisch-anthropologische Ansatz bietet sich auch deswegen so gut an, weil der Komplex zwischen Kind und Bild – als auch damit
34 R. v. Dülmen: Historische Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben. Köln [u. a.] 2000, S. 32 f.; vgl. zum Fokus auf die »Praxis der historischen Akteure« A. Lüdtke: »Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anth-ropologie«, in: H.-J. Goertz (Hg.): Geschichte. Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg 1998, S. 557-578.
23
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
verbunden die Anthropologie der Sinne – historische Diskursforma-tionen des 18. Jahrhunderts bilden. In diesem Zusammenhang muss auf die Doppelstruktur der Themen ›Kind und Bild um 1800‹ und ›Anthropologie der Sinne‹ eingegangen werden, die auch im methodi-schen Vorgehen reflektiert werden muss: Beides sind feldübergreifende Themen, die in disziplinären, öffentlich-gesellschaftlichen und litera-rischen Feldern hervorgebracht, ausgehandelt und tradiert wurden; gleichzeitig bilden sie auch gegenwärtige Forschungsthemen innerhalb eines heterogenen und interdisziplinären Feldes, das sich spätestens in den letzten Jahren – wie im Forschungsstand gezeigt – herausgebildet hat. Aus diesem Grund spreche ich, wenn ich mich auf die historische Diskursformation beziehe, von der im zeitgenössischen Kontext viel-fach geäußerten Meinung ›Kinder amüsieren sich mit Bildern‹ sowie von der ›Anthropologisierung der Sinne‹ in Kontrast zur Anthropolo-gie der Sinne als Forschungsfeld. Damit sollen beide Aspekte dort, wo es nötig ist, analytisch voneinander getrennt werden.35
Bilder als Initiatoren von Geschichten
Anhand meiner Wahl der Analyse von Indienbildern aus dem Bil-derbuch möchte ich eine weitere Dimension meines methodischen Vorgehens erklären. Bei einem Indien-Besuch im Sommer 2009 fiel mir in einem Buchladen in Cochi (Kerala) ein Buch mit europäischen Gemälden und Kupferstichen über Indien in die Hände. Ich hatte bereits damals vor, Bilder des Fremden im Bilderbuch zu analysieren, hatte aber noch keine genaue Auswahl getroffen. Als ich diese Stiche
35 Die angloamerikanischen Felder der Anthropology of the Senses, aber auch der Visual Anthropology, wollen die sinnliche Wahrnehmung stärker in ethnogra-phische Studien miteinbeziehen. Dabei werden die Aspekte der menschlichen Sinnesfähigkeiten, der Wahrnehmung und der Imagination im 18. Jahrhundert mit der des menschlichen Wissenserwerbs verknüpft und auf allen gesellschaft-lichen Ebenen diskutiert. Meine Analyse der historischen Zusammenhänge lässt dann auch die Historizität der gegenwärtigen Forschungszusammenhänge erkennen und problematisieren. Denn die Fragen einer Anthropologisierung der Sinne im 18. Jahrhundert beinhalten nicht nur eine methodologische Dimension, sondern sie wurden oftmals von bestimmten sozialen und kultu-rellen Ästhetiken, Bewertungen und Konzepten begleitet. Diese gilt es auch sichtbar zu machen, denn die Anthropologie der Sinne lässt sich nicht einfach reduzieren auf ihre empirische Anwendbarkeit Vgl. z. B. S. Pink: Doing Sen-sory Ethnography. London 2009. Der Fokus liegt hier auf dem »doing«, das mit der forschungspraktischen Umsetzung übersetzt werden kann.
24
Einleitung
sah, fiel mir die Ähnlichkeit zu den Bildern im Bilderbuch auf. Meine Neugierde war geweckt und zurück in Deutschland begann ich, mich mit Bildern über und aus Indien zu beschäftigen. Die Anzahl und Qualität der Indien-Bilder im Bilderbuch für Kinder unterstützten meine Themenauswahl; denn eben in den Jahren 1790-1830 setzten sich die deutsche Öffentlichkeit, die Geschichts-, Sprach- und Kunst-wissenschaft sowie Literatur-, Lyrik- und Kunstschaffende intensiv mit Indien und indischen Motiven auseinander, was die Rede von einer regelrechten Indophilie rechtfertigt.
Gerade die Kupferstiche, in einem deutschen Kontext gestochen und rezipiert, eröffneten mir den Blick auf kulturelle Narrative, wie bei-spielsweise Geschichten über das alte Indien. Kulturelle Narrative ver-stehe ich dabei als verdichtete Formen von Motiven, die sich zunächst wie Spuren oder Fäden durch die Geschichte ziehen und über die zu bestimmten Zeitpunkten kulturelle Ästhetiken, symbolische Kämpfe um legitime Bedeutungen und das Hervorbringen sozialer Ordnungen vollzogen werden. Im Folgenden werde ich diese Narrative in Bild, Text und Literatur nachverfolgen und freilegen, nicht selten auch mit-tels einer Begriffsgeschichte, die unterschiedliche Motive in ihren se-mantischen Relationen sichtbar macht. Meine Beschreibung kultureller Narrative will weder formalisierend noch interpretativ sein. Vielmehr soll sie herausgelöst werden aus den unterschiedlichsten Bereichen und Disziplinen, deren Themen sich um meine analysierten Motive drehen. Die verstreuten Erzählungen zu einzelnen Motiven sollen in dieser Arbeit in einen ›neuen‹ Zusammenhang gestellt werden, in den Zusammenhang dessen, was Rolf Lindner als »Beziehungsgeflecht«36 und Roland Barthes, wie vorher bereits zitiert, als »einen neuen Gegenstand«37 bezeichnet. Dabei möchte ich ihre zeitgenössischen epi-stemischen Bedeutungen herausarbeiten. Einige der hier untersuchten Narrative haben – wie das Indien-Thema – meinen Untersuchungsweg gleichsam gekreuzt, ohne dass ich dezidiert nach ihnen gesucht hätte. Hierin zeigt sich die Qualität des kulturellen Narrativs, das dem/r KulturanalytikerIn eben in seiner verdichteten Form als Erzählung an vielen unterschiedlichen Stellen begegnet und dem man als unter-schiedliche Felder durchlaufende Kategorie nachspüren kann.38
36 Lindner 2003, S. 180.37 Barthes 1972, S. 3.38 Vgl. zur »durchlaufenden Kategorie« Lepenies 1977, S. 142; vgl. zum Ver-
folgen von »Spuren«, der Zufälligkeit des Findens und »peripathetischen Aktivitäten«, wie Schmökern, Browsing und Umherschweifen im städtischen Raum (auch aus wissenschaftshistorischer Perspektive mit vielen weiteren
25
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
Das kulturelle Narrativ als zentrale Analysekategorie kann dabei meiner Meinung nach auch auf das Bild bezogen werden, ohne diesem eine alleinige semiotische Struktur aufzuerlegen. Denn die Untersu-chung zielt zwar auf die kulturelle Bedeutung bestimmter Bildinhalte und -motive ab, fragt aber darüber hinausgehend nach der ikonischen Hervorbringung als auch Verhandlung des Narrativs. In diesem Sinne verwende ich den Begriff des kulturellen Narrativs in Kontrast zu dem Konzept des »kulturellen Imaginären«, für das der Zusammenhang zwischen sozialen und psychologischen Aspekten als wichtig heraus-gestellt wird.39 Da es mir jedoch um die Erzählzusammenhänge und um die damit verbundenen Geschichten geht, die das Bild sinnlich und ikonisch generiert, erscheint mir der Begriff des kulturellen Narrativs geeigneter. Dieser bezieht selbstverständlich die Ebene der menta-len Bilder mit ein, richtet sein Interesse jedoch nicht so sehr auf die Schnittfläche von sozialen mit psychologischen Faktoren.
Es geht in meiner Analyse nicht um eine Ontologie des Bildes, son-dern um Bilder als Teile größerer kultureller Figurationen, die in den Praktiken des Erzählens erfassbar werden. Der ikonische Mehrwert
Literaturverweisen), Lindner 2011; vgl. auch Anke te Heesen zur Kontingenz der Auswahl des historischen Materials: »Es hat was mit Intuition, mit Gefühl zu tun. [. . .] Entweder es kommt der Moment, wo man weiß, hier musst Du den Sack zumachen und das Ganze von Grund auf bearbeiten und Dich hin-setzen, oder aber das Gefühl stellt sich nicht ein. Das ist sicherlich einer der Aspekte meiner Arbeit, die mich lange umgetrieben haben, und je erfahrener ich werde, desto weniger treibt mich das um, denn das ist ein kontingenter Prozess. Diese Kontingenz – sie liegt in der Lektüre, sie liegt darin, was ich gerade sehe, welche Ausstellung ich besuche oder durch welchen Wald ich laufe. Vieles ergibt sich beim Laufen selbst, das meine ich jetzt nicht im über-tragenen Sinne. Wenn ich nicht weiß, wo und wie ich einen Text beginnen soll oder wo ich noch weiteres Material finde, laufe ich einfach. Ich laufe und dann ergibt sich zumeist irgendetwas.« A. te Heesen: »Erkennen und Begrenzen«, in: A. Kraus, B. Kohtz (Hg.): Geschichte als Passion. Über das Entdecken und Erzählen der Vergangenheit. Zehn Gespräche. Frankfurt a. M. [u. a.] 2011, S. 71-108, hier S. 88.
39 Der Begriff des »kulturellen Imaginären« wird innerhalb der Kulturwissen-schaften, der Gender Studies und der kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft verwendet. Vgl. G. Dawson: Soldier Heroes. British Adventure, Empire and the Imagining of Masculinities. London [u. a.] 1994, S. 48; M. Bryld, N. Lykke: Cosmodolphins. Feminist Cultural Studies of Technology, Animals and the Sacred. London [u. a.] 2000; W. Fluck: Das kulturelle Imaginäre. Eine Funktionsgeschichte des amerikanischen Romans 1790-1900. Frankfurt a. M. 1997; N. Lykke, A. Smelik (Hg.): Bits of Life. Feminism at the Intersections of Media, Bioscience, and Technology. Seattle 2008, S. 11.
26
Einleitung
des Bildes und sein symbolisches Surplus machen hier eine unabding-bare Dimension der Narrative aus. Bilder besitzen ganz eigene Wir-kungs- und Funktionsweisen, auf die ich – im Rahmen der Debatten um den Pictorial Turn – natürlich eingehen werde. Ich sehe Bilder als historische Quellen, die nicht nur Geschichte dokumentieren und repräsentieren, sondern die eben auch in der Lage sind, Geschichte (und Geschichten) zu erzeugen.40 An dieser Stelle möchte ich Horst Bredekamps Begriff des Bildakts produktiv machen, der darauf abzielt, Bilder als zentrale Kommunikationsmittel und als Aspekte sozialen Handelns zu analysieren.41 Dies korrespondiert mit meinem kultur-analytischen Erkenntnisinteresse, da ich Bildpraxis als kulturelle Praxis nachvollziehen möchte und der Begriff des Bildakts dem des kulturel-len Akts sehr nahe steht.42 Clifford Geertz folgend sehe ich Kultur in diesem Zusammenhang als
historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes towards life.43
Bilder sind in diesem Kontext nicht nur historische Dokumente. Alex Artega folgend lädt
das Bild [. . .] den Betrachter ein, es zwingt ihn sogar, sein Verhalten zu modifizieren, seine Fragestellungen, seine Meinungen, den Kurs seiner Gedanken, die Perspektive seiner Betrachtung, seiner Posi-tion und seiner Bewegung im Raum zu ändern. Das Bild liefert un-erwartete Antworten auf Fragen, die vor der Bildbetrachtung nicht
40 Vgl. hier den sehr lesenswerten Überblicksartikel zur historischen Bild-forschung in Deutschland von G. Paul: »Von der Historischen Bildkunde zur Visual History. Eine Einführung«, in: ders. (Hg.): Visual History. Ein Studi-enbuch. Göttingen 2006, S. 7-36; auch die volkskundliche Bildforschung hat dem Bild in ihren Anfängen zunächst nur einen dokumentierenden Charakter zukommen lassen. Dies hat sich mit dem Pictorial Turn geändert.
41 H. Bredekamp: Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007. Berlin 2010. Auch Gerhard Paul macht das Konzept des Bildakts für die Visual History fruchtbar, s. Fußnote zuvor.
42 Clifford Geertz definiert einen kulturellen Akt als einen »in which symbo-lism forms the positive content«. C. Geertz: The Interpretation of Cultures. New York 1973, S. 91.
43 Ebd., S. 89.
27
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
formuliert werden konnten. [. . .] Dies ist die Art der Interaktion, die zwischen dem Betrachter und dem Bild als Erfahrung stattfindet.44
Bilder sind dazu fähig, Einfluss auf menschliches Handeln, Denken und Empfinden zu nehmen. In dieser ihrer Wirkung sollen Bilder und die damit verbundenen Bildpraxen untersucht werden.
Meine feldübergreifenden Beobachtungen werden zeigen, wie be-stimmte Motive eben in verdichteter Form in unterschiedlichen Kon-texten immer wieder neu erzählt und in Bildern dargestellt werden. Bilder sind elementarer Teil sozialer Kommunikationsprozesse. In der Erzählung können menschliche Erfahrungen verarbeitet und nach-vollziehbar gemacht sowie Wirklichkeit und Ordnungen hergestellt werden, die von bestimmten Gruppen oder auch Gesellschaften geteilt werden.45 In diesem Kontext spielen auch die Fragen nach dem Ver-hältnis von Bildpraxen zu Darstellungsweisen eine Rolle: Wie werden kulturelle Narrative im Bild sichtbar gemacht und tradiert? Welche spezifischen Darstellungspraxen gehen mit dieser Narrativierung einher? Wie wird also beispielsweise Zeitlichkeit im Bild umgesetzt und erfahrbar gemacht? Welche Rolle spielen Bilder wiederum in der Erfahrbarmachung von Zeitlichkeit im Kontext der zeitgenössischen Prozesse der Verzeitlichung? Dabei muss man bemerken, dass eben auch die Rufe nach Anschaulichkeit, Bildhaftigkeit und Lebendig-keit im 18. Jahrhundert in komplexen Bild-Text-Relationen umgesetzt wurden. Anhand des Nachverfolgens kultureller Narrationen möchte ich deutlich machen, wie dies geschieht. Dabei möchte ich mich nicht in Detailanalysen verlieren, sondern die einzelnen Motive innerhalb der weiteren Perspektive einer historisch-anthropologischen Analyse einbetten und ihre epistemologische Bedeutung herausarbeiten.
44 A. Artega: »Die Lebendigkeit des Bildes. Ansätze einer enaktivistischen Be-gründung«, in: H. Bredekamp, J. M. Krois (Hg.): Actus et Imago. Sehen und Handeln. Berlin 2011, S. 45-64, hier S. 47 (Hervorh. i. O.).
45 Auch die Methodik narrativer Interviews basiert auf diesen Überlegungen. Vgl. G. Rosenthal, W. Fischer-Rosenthal: »Analyse narrativ-biographischer Interviews«, in: U. Flick [u. a.] (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg 20108, S. 456-468.
28
Einleitung
1.4 Grundriss der Studie
Nach einer kurzen Situierung des Materials in den verlegerischen Kon-text des Bertuch’schen Landes-Industrie-Comptoirs beschäftigt sich der erste Analyseteil dieser Studie mit dem Zusammenhang zwischen moderner Kindheit und Anthropologisierung der Sinne im 18. Jahrhun-dert (Kap. I). Die wechselseitige Verschränkung von Kindheit und der Entdeckung der Sinne wurde auf unterschiedlichen gesellschaft lichen Feldern umgesetzt und diskutiert (Kap. I.1.1 »Das Paradigma der Er-fahrung«). Auf dieser Basis fokussiere ich hier in einem zweiten Schritt die epistemologischen und gesellschaftlichen Aspekte des Phänomens der Verzeitlichung im 18. Jahrhundert (Kap. I.1.2). Es waren Strategien der Verzeitlichung von Wissensbeständen, der Historisierung von Kul-tur und der Prozessualisierung von Erkenntnisgewinn, die Konzepte von Entwicklung hervorbrachten. Diese Verzeitlichungsstrategien und damit zusammenhängende Entwicklungsideen fanden in der Hervor-bringung des modernen Kindheitsbildes eine die gesamte bürgerliche Lebenswelt durchdringende Modellhaftigkeit. Mit Kindheit wurde die bürgerliche Gesellschaft in Generationen unterteilt, die Biographie des bürgerlichen Individuums in Lebensabschnitte gegliedert und die Vernunftserlangung des Einzelnen in verschiedene Stufen des Lernens, Reflektierens und Erkennens eingeteilt. In einer dieses Teilkapitel ab-schließenden Analyse sollen spezifische erkenntnistheoretische An-sätze und die mit ihnen einhergehenden Kindheitsbilder untersucht werden. Mit der Betrachtung der unterschiedlichen Kindheitskonzepte möchte ich damit die engen Bezüge von Erkenntnistheorie, Verzeit-lichung und Kindheitsbild detailliert und im Kontext der Anthropolo-gisierung der Sinne herausarbeiten.
Jede der untersuchten Erkenntnis- und Wahrnehmungstheorien ist somit auch Ausdruck eines spezifischen Kindheitsbildes. Einmal steht ›Bild‹ für das Unterrichtsmittel, das eingesetzt wurde, um dem Kind einen Inhalt zu vermitteln: Das Bild, das auf ein Trägermaterial gebracht wird und sich dort physisch materialisiert. Der zweite Bild-begriff steckt in ›bürgerliches Kindheitsbild‹: das Bild als Vorstellung, Entwurf, Konzept und Idee von Kindheit. Die Figur des Kindes, die in der Argumentation einzelner Theorien und Werke auftaucht, dient dabei als Projektionsfläche für Kindheitsbilder. Nicht nur die Text-formate, sondern auch die ›Bilder für Kinder‹ waren getrieben vom ›Bild von Kindheit‹ und müssen somit als Teil des bürgerlichen Kind-heitsdiskurses verstanden werden:
29
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
Auch literarische Kindheitsimaginationen und -inszenierungen sind ihrer Logik und ihrer Erscheinungsform nach symptomatische Effekte eines weitläufigen kultursemiotischen Diskursfeldes, der auf ihm sich vollziehenden Generierung, Organisation wie Umor-ga nisation von kulturellen Wissensbeständen, von Anschauungen, Be-Deutungen usw.46
Während Rüdiger Steinlein sich hier auf die Textform von Kindheits-bildern bezieht, möchte ich den Aspekt der Wissensproduktion auf das Bild in seiner Doppelfunktion als ›Bild für das Kind‹ und ›Bild von Kindheit‹ übertragen. Erkenntnis- und Wahrnehmungstheorien sowie Entwürfe zu didaktischen Bildprogrammen haben sich wiederholt auf die Figur des Kindes bezogen. Sie waren dabei angetrieben von Kind-heitsbildern und haben diese gleichzeitig auch mit hervorgebracht.
Kap. I.2 lenkt den Blick dann auf die einflussreichen Bildprogramme und Theoreme anschauender Erkenntnis. Im zeitgenössischen Diskurs wird Johann Amos Comenius’ Orbis pictus (1653) als Beginn der sinnlichen Ausbildung des Kindes benannt, weswegen ich dieses Bild-werk als Ort der Relation zum neuzeitlichen Bildeinsatz untersuche (Kap. I.2.1). In einer longue durée-Perspektive verfolge ich hierbei die besagte Setzung, Kind und Bild gehörten zusammen. In diesem Kon-text werde ich die Theoreme der philanthropischen Anschauungspäd-agogik sowie ihre kulturelle Bildpraxis betrachten. Die aufkommende Pädagogik wird an dieser Stelle als praktische Anthropologie einge-führt, die vielen Beobachtungen und Ausführungen zur kindlichen Blickweise, Imaginationsfähigkeit und Wissensakkumulation können damit als empirische Fallstudien innerhalb des anthropologischen Fel-des verstanden werden (Kap. I.2.2). In dem diesen Teil abschließenden Kap. I.3 »Der Kind-Bild-Komplex: Kinder amüsieren sich mit Bil-dern« sollen schließlich die unterschiedlichen Ebenen der diskursiven Relation von Kind und Bild um 1800 quellenkritisch erweitert und analytisch wieder zusammengeführt werden.
Der folgende Teil II. »Lebendige Bilder als kunstvolle Wissen-schaft«, möchte das Bilderbuch für Kinder innerhalb größerer wissen-schaftsgeschichtlicher Traditionslinien verorten. Zwischen der sensua-
46 R. Steinlein: »›Die Kindheit ist der Augenblick Gottes‹ (Achim von Arnim). Faszinationsgeschichte der Kindheit um 1800 als kulturwissenschaftlicher Diskurs«, in: P. U. Hohendahl, R. Steinlein (Hg.): Kulturwissenschaften – Cultural Studies. Beiträge zu einem umstrittenen literaturwissenschaftlichen Paradigma. Berlin 2001, S. 115-131, hier S. 116 (Hervorh. i. O.).
30
Einleitung
listisch orientierten Enzyklopädik und den traditionellen Linné’schen Ordnungsmustern entwarf Bertuch einen dritten Weg der sensuellen Klassifikation, der im Bilderbuch für Kinder zur Anwendung kam. Dieser Analyseteil beschäftigt sich mit dem Wandel in der Ansicht der Natur selbst: Der Ruf nach besserer Anschaulichkeit und die sensua-listisch motivierte Kritik an zu komplizierten Klassifikationssystemen (Kap. II.1) ließ die Bilder- und Repräsentationsfrage in den Mittel-punkt rücken (Kap. II.2). Die Naturgeschichte sollte nicht mehr nur Lebewesen kategorisierend sammeln, sondern sie musste nun, so der zeitgenössische Anspruch, das Leben selbst darstellen. Dieser sinnliche Ansatz der lebendigen Anschaulichkeit bildete neben den erkenntnis-theoretischen, anthropologischen und pädagogischen Grundlegungen für den Bildeinsatz eine wichtige Voraussetzung für Bertuch, das Bild als Wissensmedium einzusetzen (Kap. II.3).
Teil III. »Bilder von Verzeitlichung und Entwicklung als Genera-toren eines neuen historischen Wissens« nimmt zum Ausgangspunkt, dass bisherige Analysen über das Phänomen der Verzeitlichung deren mediale Visualisierung außer Acht gelassen haben. Die Untersuchun-gen des vorhergehenden Teil II. zeigen jedoch, warum man Verzeit - lichung auch als Anschaulich-Machen von historischen und natur-geschichtlichen Prozessen verstehen muss. Ein geschichtliches Interesse des Bürgertums und dessen Rezeptionsbedürfnisse hingen zusammen mit der Historisierung weltgeschichtlichen Geschehens sowie mit der Ersetzung räumlicher Taxonomien durch zeitliche Ordnungssysteme. Der Ruf nach Anschaulichkeit war aufs Engste verknüpft mit Natur, Kultur und den Menschen betreffenden erkenntnistheoretischen und philosophischen Fragen. So argumentiert Rudolf Vierhaus, dass es »nicht in erster Linie die professionelle Geschichtswissenschaft selbst [war], die diese Entwicklung vorangetrieben hat, sondern zum einen der Eindruck des realgeschichtlichen Prozesses, zum anderen die phi-losophische Frage nach dem Sinn des geschichtlichen Prozesses«,47 Aus dieser Motivation heraus entstanden neue Darstellungsweisen von naturgeschichtlichem, anthropologischem und historischem Wissen. Wolf Lepenies deutet in Das Ende der Naturgeschichte an mehreren Stellen visuelle Praktiken an,48 führt diese jedoch nicht weiter aus. Ich
47 R. Vierhaus: »Historisches Interesse im 18. Jahrhundert«, in: H. E. Bödeker [u. a.] (Hg.): Aufklärung und Geschichte. Studien zur deutschen Geschichts-wissenschaft im 18. Jahrhundert. Göttingen 1986, S. 264-275, hier S. 274.
48 »Was sich unter dem Druck zur Temporalisierung ändert, ist aber zunächst nicht die jeweilige naturhistorische Methode, sondern die Naturgeschichte in ihrer Darstellungsform.« W. Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte.
31
Von Wissens- und Wissenschaftsgeschichten
möchte dieses Desiderat überwinden und Kupferstiche und Zeichnun-gen als Generatoren des verzeitlichten Denkens in den Mittelpunkt der Analyse rücken. Dabei sollen die Ansichten des Bilderbuchs für Kinder weder als bloße Hilfsmittel bei der Hervorbringung von Erkennt-nis, noch als zusätzliches Archivgut verstanden werden. Stattdessen möchte diese relationale Bildanalyse die Wechselwirkungen zwischen veränderten gesellschaftlichen Ideen, kulturellen Narrativen und ihren Darstellungsformaten aufzeigen. Ich untersuche dabei Verzeitlichung nicht nur auf den Feldern der Naturgeschichte, sondern begreife sie als ein feldübergreifendes kulturelles Phänomen, hervorgebracht auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, die sich gegenseitig beein flussten.
Anhand der Kupferstiche des Bilderbuchs und ihrer Vorbilder werde ich herausarbeiten, wie geologische und erdzeitgeschichtliche Ansichten mit frühen biologischen Bildern von Entwicklung, Wachs-tum und Zeugung zusammenhingen (Kap. III.1). Darauf aufbauend sollen im Abschlusskapitel des dritten Teils, »Das alte Indien«, die Be-züge zwischen topographisch-geographischen Bildern in Indien sowie dem vorhergehend betrachteten mineralogisch-geologischen und dem biologisch-organologischen Sujet analysiert werden (Kap. III.2). An dieser gemeinsamen Analyse von Menschheits- und Naturgeschichte wird deutlich werden, wie sich beide Geschichtsschreibungen wech-selseitig hervorbringen. Gerade anhand der Bilder zu Indien soll eine spezifisch deutsche Perspektivierung auf koloniale Räume im europä-ischen Vergleich herausgearbeitet werden. Bilder des fremden Indiens müssen hier auch als Auslöser und Verhandlungsorte für soziokultu-relle Debatten und Prozesse des eigenen deutsch-bürgerlichen Kontex-tes verstanden werden.
Im die Arbeit abschließenden Resümee werden die verschiedenen Ebenen der Studie nochmals zusammen getragen und die feldübergrei-fenden Aspekte verdeutlicht.
Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1978, S. 62; vgl. auch ebd., S. 73-74.



































![Kunst und Erfahrung. Eine theoretische Landkarte [mit Jasper Liptow und Martin Seel]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631611895cba183dbf084a85/kunst-und-erfahrung-eine-theoretische-landkarte-mit-jasper-liptow-und-martin-seel.jpg)




![Evaluation of the novel 5-HT4 receptor PET ligand [11C]SB207145 in the Göttingen minipig](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633536912532592417006fcd/evaluation-of-the-novel-5-ht4-receptor-pet-ligand-11csb207145-in-the-goettingen.jpg)