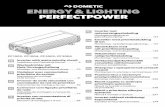Auf der anderen Seite der Kamera. Leihmutterschaft in Indien und das moralische Anliegen der...
-
Upload
herzzentrum-goettingen -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Auf der anderen Seite der Kamera. Leihmutterschaft in Indien und das moralische Anliegen der...
Originalarbeit
1 3
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
S. L. Hansen, M.A. () · S. MitraInstitut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universitätsmedizin Göttingen,Humboldtallee 36,37073 Göttingen, DeutschlandE-Mail: [email protected]
Auf der anderen Seite der KameraLeihmutterschaft in Indien und das moralische Anliegen der Dokumentarfilmerin Surabhi Sharma
Sayani Mitra · Solveig Lena Hansen
Ethik MedDOI 10.1007/s00481-014-0334-4
Zusammenfassung Die Verbreitung kommerzieller Leihmutterschaft und ihr wachsender globaler Markt hat zu einer breiten Diskussion sowohl unter Wissenschaftlern als auch unter Aktivisten geführt. In diesem Aufsatz eröffnen wir durch die Auseinandersetzung mit einem Dokumentarfilm ethische Fragen, die mit der transnationalen indischen Leihmutter-schaft in Verbindung stehen. Über den filmisch präsentierten Alltag von Leihmüttern wird deutlich, dass der Diskurs über kommerzielle Leihmutterschaft einer sensiblen Kontex-tualisierung für den spezifischen indischen Kontext bedarf. Die Perspektive von Surabhi Sharma bereichert die Diskussion, da sie den Zusammenhang von Leihmutterschaft und Arbeit fokussiert. Dabei werden nicht nur die physischen Risiken betrachtet, denen Leih-mütter ausgesetzt sind, sondern auch ihre soziale Vulnerabilität.
Schlüsselwörter Kommerzielle Leihmutterschaft · Indien · Dokumentarfilm · Vulnerabilität · Arbeitsrechte
On the other side of the camera – Surrogacy in India and the moral concern of the film maker Surabhi Sharma
Abstract Background The spread of commercial surrogacy and its rapidly growing global market has raised many concerns among academics and activists alike. In this paper, we present some of the ethical issues associated with the practice of transnational surrogacy in India in the light of a documentary film. Arguments By discussing the nuances of the daily events occurring in the lives of the surrogate mothers as shown in the film, we point out that the discourse of commercial surrogacy in India needs to contextualize itself to the cultural expectations, social vulnerabilities and moral sensibilities of the actors. Results
2 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
The perspective of Surabhi Sharma is helpful as an impulse for the discussion, focusing on surrogacy as labor and taking into consideration not only the physical risks that the surrogate mothers are prone to but also their social vulnerability.
Keywords Commercial surrogacy · India · Documentary film · Vulnerability · Labor law
Hintergrund: Kommerzielle Leihmutterschaft in Indien
Der Umsatz der kommerziellen Leihmutterschaft wird weltweit auf 6 Mrd. $ geschätzt [12]. Während sie in den USA, der Ukraine und Russland prosperiert, ist sie in Deutschland, Frankreich und Italien verboten. Großbritannien und Kanada erlauben nur eine altruistische Form [1]. Indien hingegen avanciert in diesem Zusammenhang zum Hauptumschlagspunkt für sowohl transnationale als auch nationale Leihmutterschaft [17, 27]. Hier wird der kom-merzielle Umsatz auf mehr als 2,3 Mrd. $ pro Jahr geschätzt [28].1 Die kulturelle Veranke-rung ist sowohl in der indischen Mythologie2 als auch im beeindruckenden Fortschritt des Landes hinsichtlich der ART (Artificial Reproductive Techniques) zu finden. Ein entschei-dender Schritt hierfür war die Geburt des ersten IVF-Kindes Druga, das in Kolkata nur 67 Tage nach der Geburt von Louise Brown auf die Welt kam [7]. Was ART jedoch im eigent-lichen Sinne so verbreitet macht, ist ein im kulturellen Bewusstsein tief verwurzeltes Stigma der Unfruchtbarkeit. Hinzu kommt die stillschweigende Annahme, dass Unfruchtbarkeit ein rein medizinisches Problem ist.
Gegenwärtig ist die Leihmutterschaft in Indien zwar legal, allerdings hat ihre zuneh-mende Kommerzialisierung und der schnell wachsende „Medizintourismus“ den Bedarf nach einem neuen Gesetz verdeutlicht. Mit der Assisted Reproductive Technology Bill aus dem Jahr 2010 werden bei der Leihmutterschaft die Anzahl transferierter Embryonen, die Geheimhaltung der Identitäten von der Keimzellspendern, die formale Form der Verträge, die Eignung einer Frau als Leihmutter sowie die Akkreditierung durch die Klinik reguliert [3]. Das Gesetz legt zwar fest, dass nicht mehr als drei Embryonen übertragen werden dür-fen und eine Frau nur max. fünf Kinder im Rahmen einer Leihmutterschaft lebend zur Welt bringen darf. Es bleibt jedoch unreguliert, an wie vielen Befruchtungszyklen eine Leih-mutter insgesamt beteiligt sein darf [21]. Des Weiteren wird in diesem Gesetz kein Modell des Informed Consent berücksichtigt, das auch die sozialen Risiken umfasst, denen eine Leihmutter durch diese Praktik ausgesetzt ist [3].3 Diese sozialen Risiken haben jedoch im indischen Kontext – im Vergleich zu den USA und Europa – stärkeres Gewicht, da ein
1 Laut der indischen National Commission for Women gibt es dort derzeit ca. 3.000 registrierte Kliniken, die Leihmutterschaft für Auftraggeber aus der ganzen Welt anbieten [8]. In der aktuellen Forschungsliteratur wird jedoch auch betont, dass sich die Branche noch erheblich ausweiten könnte, da über 30.000 indische Kliniken dafür ausgestattet wären, Leihmutterschaft durchzuführen [24].2 Tief verankert in der indischen Hindu-Mythologie ist die Sage über den Gott Krishna als frühe Anspielung auf Leihmutterschaft. Krishna wird im Schoß der Göttin Devaki empfangen. Sein boshafter Cousin wünscht sich, dass dieses Kind getötet wird, da es in einer Prophezeiung heißt, dass es ihn später umbringen würde. Aus diesem Grund transferiert Devaki Krishna in den Schoß einer anderen Göttin; und ein anderes Kind wird an seiner Stelle getötet. Diese Opferung eines anderen Kindes macht die Geburt des positiv konnotierten Gottes Krishna erst möglich [12].3 Während das Gesetz noch ratifiziert werden muss und derzeit umfassend diskutiert wird, wird Leihmutter-schaft weiterhin durchgeführt.
Auf der anderen Seite der Kamera 3
1 3
Drittel der indischen Frauen von Armut, Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt, schlechter Ausbildung und dem vorherrschenden gesellschaftlichen und familiären Patriarchat betrof-fen ist [18]. Diese Bedingungen machen sie aufgrund der finanziellen Rendite auf einem unregulierten Markt leicht empfänglich für das Austragen von Kindern. Weiterhin ergibt sich aufgrund der sozioökonomischen Verhältnisse eine große Wahrscheinlichkeit, dass den Frauen Unrecht zustößt – sie können deshalb mit der Definition von Hurst [5] als vulnerabel gelten.
Während der Staat den schlechten Ernährungszustand der Frauen und das hohe Vor-kommen der Müttersterblichkeit im Land größtenteils ignoriert, werden zugunsten von Unternehmensgewinnen von dieser Seite das Geschäft eher unterstützt und Misserfolge ver-schwiegen; auch fehlen staatliche Maßnahmen, um sekundärer Sterilität vorzubeugen [18, 25].4 Es sind gerade die ökonomischen Faktoren, die Indien zu einem bevorzugten Land für Leihmutterschaft machen, da der gesamte Prozess sehr günstig ist – hier liegen die Kosten für eine Leihmutterschaft etwa zwischen einem Fünftel und max. der Hälfte der Kosten in den USA [11]. Die große Anzahl möglicher Leihmütter, die aus religiösen Gründen weder Alkohol noch Drogen konsumieren, die guten medizinischen und personellen Infrastruktu-ren sowie die englische Sprache machen Indien damit zu einem bevorzugten Land; hinzu kommt ein geringes Risiko, dass Behörden nach der Geburt Kontrollen durchführen [11].
Leihmütter erfahren über Nachbarn, Agenten, Familienmitglieder, Medien oder Werbung über die Möglichkeit, dieser Tätigkeit nachzugehen [20]. Die sogenannten Agenten werden von den Fertilitätskliniken aufgrund ihrer Kontakte in einer bestimmten Gemeinde aus-gewählt, wobei einerseits ihr Überzeugungsgeschick im Anwerben von Leihmüttern oder Eizellspenderinnen und andererseits ihre Qualifikation bei der Aushandlung von Verträgen relevant sind. Einer Frau werden Informationen über den Prozess der Leihmutterschaft nur zugänglich gemacht, nachdem ihre Krankheitsgeschichte (insbesondere ihre eigenen Gebur-ten) geprüft und mehrere medizinische Tests durchgeführt wurden, um ihre gesundheitliche Eignung zu bestätigen. Als notwendige Bedingung für die Annahme zur Leihmutter gilt, dass die Frau selbst bereits ein leibliches Kind bekommen haben muss [20].5 Bestätigt sich im Fall einer Leihmutter eine Schwangerschaft, wird ihr ein Lebensstil bezüglich umfang-reicher Ernährung, eingeschränktem Sexualverhalten und stark reduzierter Mobilität vor-geschrieben. Häufig (aber nicht zwangsläufig) wird ihr auch ein Aufenthaltsort zugewiesen, z. B. eine Unterkunft nahe der Klinik, was als speziell indisches Phänomen gilt.
Im Allgemeinen wird die Vereinbarung über eine Leihmutterschaft durch einen Vertrag zwischen der Leihmutter bzw. ihrem Ehemann auf der einen und den Auftrag gebenden Eltern auf der anderen Seite formalisiert. Der Vertrag einer Leihmutter wird von einem
4 Die absolute Infertilitätsrate liegt in Indien bei acht bis zehn Prozent. 98 % dieser Frauen leiden an sekun-därer Sterilität, der jedoch durch pränatale und postnatale Maßnahmen vorgebeugt werden kann, da sie durch schlechte Gesundheitszustände, Ernährung, Anstrengungen der Mutterschaft und Infektionen ausgelöst wer-den [18]. Zwei Prozent dieser indischen Frauen leiden an primärer Sterilität, die durch ART ausgelöst wurde [19].5 Die Grundlage für eine Annahme seitens der Klinik ist neben der biologischen Eignung die Bereitschaft der Frau, sich dem medizinischen Prozedere und den Regularien der Klinik zu unterziehen. Auch wenn die Frauen während der Schwangerschaft und der postnatalen Versorgung eine emotionale Verbindung zum Kind aufbauen, müssen sie dieses abgeben. Die Anbieter der Gesundheitsversorgung argumentieren diesbezüglich, dass die Leihmutter für ihre Arbeit bezahlt wurde und verpflichtet sei, das Kind abzugeben – diese Position wird jedoch in der Fachdebatte kritisiert: Gerade die kontinuierliche Erinnerung der Frauen daran, dass das Kind den beauftragenden Eltern „gehöre“, sowie die Notwendigkeit einer Distanz der Leihmutter zum Kind mache es den Leihmüttern unmöglich, eine intime Beziehung aufzubauen [9, 23, 26].
4 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
Anwalt vorbereitet, der der Leihmutter i. d. R. von der Klinik empfohlen wird [20]. Der Ver-trag wird meist auf Englisch verfasst, einer Sprache, die viele Leihmütter (im Gegensatz zu ihren Vertragspartnern) nicht lesen können [16]. Zwar werden mündlich Teile des Vertrags erklärt; dies bezieht sich jedoch hauptsächlich auf Rechte der beauftragenden Eltern und der gezeugten Kinder. Die Auftrag gebenden Eltern gelangen vorrangig durch das Internet an die Kliniken. Während die internationalen Auftraggeber zumeist nur zwei Mal dorthin kommen (bei der Auswahl der Leihmutter und nach der Geburt des Kindes), sind einige der indischen Auftraggeber aus dem In- und Ausland auch bei den Arztterminen der Leihmütter dabei. Eine erfolgreiche Leihmutterschaft endet damit, dass die Leihmutter das Kind an die Auftraggeber übergibt.
Leihmutterschaft wird trotz der emotionalen und physischen Anstrengungen, deren „Ergebnis“ den Auftraggebern überbracht wird, von vielen nicht als produktive Arbeit im eigentlichen Sinne betrachtet [29]. Dies wird von einigen Positionen als Fortsetzung einer kolonialen Ausnutzung verstanden; denn wie im traditionellen Kolonialismus des 18. und 19. Jahrhunderts wird das Leben in der sog. „ersten Welt“ durch die Arbeit und die Güter der sog. „dritten Welt“ gestützt.6 Kalindi Vora bspw. stellt aus diesem Grund eine Verbin-dung her „between the exhaustion of biological bodies and labours in India to extend ,life‘ in the First World and a longer history of power relations underpinning what may seem like an emerging form of biopower in sites like commercial surrogacy“ ([29], S. 684). Die Leihmutter werde „[a] capitalist worker subject“ ([29], S. 690), der in entsprechenden Kli-niken beigebracht wird, selbst die Rolle einer „mother-worker“ ([16], S. 983) einzunehmen. Aus dieser Sicht erschweren insbesondere der Analphabetismus und das koloniale Erbe den Informed Consent der Frauen [4]. Auch ihre Körper werden einer ungleichen Form eines Austausches ausgesetzt, da ein hohes Risiko hinsichtlich ihres sozialen Status sowie ihres physischen und psychischen Wohlbefindens besteht [30]. Hingegen kritisiert Pande [16] gerade die euro-zentristischen Darstellungen von Leihmüttern als „ausgebeutete Opfer“. Sie argumentiert, dass die Leihmutterschaft zwar eine vergeschlechtlichte, stigmatisierende und sogar ausnutzende Form der Arbeit sei, aber nichtsdestotrotz immer noch Arbeit [14, 15].
Vor diesem Hintergrund entstand Surabhi Sharmas Dokumentarfilm Can We See the Baby Bump Please?7 Während Filme wie Frozen Angels oder Google Baby verschiedene Perspektiven der in die Leihmutterschaft involvierten Personen aufgreifen und zuweilen die Grenzen zwischen fiktionalem und faktualem Erzählen verschwimmen lassen,8 wählt Surabhi Sharma mit ihrem Dokumentarfilm eine gänzlich andere Darstellung. Sharma ent-schied sich bewusst, die Perspektive der betroffenen Leihmütter zu stärken, gerade weil diese im Diskurs kaum gehört werden. Die ästhetische Darstellung in ihrem Film zeigt oft nur Bilder und gibt keinen Ton im Hintergrund, was ihre Unmöglichkeit, mit betroffe-nen Leihmüttern zu sprechen, widerspiegelt (s. u., Interview). Die abstrakte akademische Debatte um Leihmutterschaft in Indien wird so einerseits mit der fehlenden Perspektive der Frauen kontrastiert, zugleich wird aber ihre agency innerhalb der eigenen Gruppe durch-aus hervorgehoben. Damit nimmt der Film dezidiert keine Position gegen Leihmutterschaft
6 Hierbei muss allerdings betont werden, dass ein Teil der Auftrag gebenden Eltern inzwischen im Ausland lebende Inder sind [16, 20]. Die meisten Studien haben bisher eher die Auftraggeber aus dem Ausland fokus-siert und die indischen Auftraggeber als Akteure in Indien vernachlässigt [22].7 Can We See the Baby Bump Please, IND (2013). Die DVD kann über [email protected] (zuge-griffen: 10. Nov. 2014) bestellt werden.8 Vgl. den Beitrag von Tobias Eichinger im vorliegenden Heft.
Auf der anderen Seite der Kamera 5
1 3
ein, sondern lenkt unseren Blick darauf, dass es sich hier nicht um „Opfer“ einer medizini-schen Praxis handelt, sondern um Personen, die handlungsfähig sind und dieser Praxis z. T. zustimmen würden, die jedoch in kritikwürdige Bedingungen eines viel größeren als nur medizinischen Rahmens eingebettet sind. Im Folgenden geben wir zunächst einen Einblick in die Szenerie des Films.
Can We See the Baby Bump Please? als Beispiel für die dokumentarische Verhandlung indischer Leihmutterschaft
Der Film stellt die Situation von Leihmüttern in einer Klinik in Mumbai dar. Er wurde von der indischen Nichtregierungsorganisation SAMA initiiert. SAMA hat ihren Hauptsitz in Delhi und setzt sich für die Gesundheitsversorgung von Frauen und ihr Wohlergehen im indischen Kontext ein. Seit 2002 engagiert sich diese Organisation auch im Bereich der ART und dem Einfluss, den diese auf die Gesundheit indischer Frauen haben. Der hier vorgestellte Film wurde 2014 mit Magic Lantern Films als ausführenden Produzenten und Surabhi Sharma als Regisseurin gedreht.
Der Film beginnt mit einer virtuellen Konversation zwischen einer Leihmutter und den beauftragenden Eltern über Skype™ (00:00:10). Das Gespräch wird von einer Übersetzerin gedolmetscht, da die Leihmutter kein Englisch spricht. Sie wird gefragt, „wie schwanger“ sie sich „fühle“ und ob es für sie in Ordnung wäre, ihnen die „Baby Beule“, also ihren Bauch, zu zeigen (00:00:45). Direkt im Anschluss fordert die Übersetzerin die Leihmutter auf, sich zu erheben und gibt ihr Anleitungen für eine geeignete Position vor der Kamera, sodass die zukünftigen Eltern des Kindes einen guten Blick auf den Schwangerschaftsbauch bekommen. Während die Auftraggeber erfreut aussehen, bleibt die Frage nach dem Einver-ständnis der Frau, ihren Bauch zu zeigen, eine rein rhetorische.
Der Film stellt im Weiteren einen gewöhnlichen Tag im Leben von Leihmüttern dar, die in einem Hostel nahe einer Klinik die Zeit verstreichen lassen (00:03:51). Sie haben keine andere Handlungsoption als sich auszuruhen. Sie sind dankbar dafür, dass sie regel-mäßig Milch, Eier und proteinhaltige Nahrungsergänzungsmittel bekommen, was für sie zuvor unmöglich war, haben z. T. aber auch das Gefühl, dass sie mehr Nahrung essen müs-sen, als sie tatsächlich brauchen. Gemäß ihrem Vertrag müssen sie die neun Monate ihrer Schwangerschaft ohne Familie und Kinder verbringen, die sie lediglich einmal pro Woche besuchen dürfen. Diese Momente der potentiellen Einsamkeit verwandeln die Leihmütter in eine Situation der Kollektivität, in der sie sich beistehen. Ihre häusliche Abwesenheit wird i. d. R. dadurch kompensiert, dass ihr Ehemann in dieser Zeit nicht arbeitet, um sich um die Familie zu kümmern. Eine der Leihmütter erzählt der Filmemacherin, dass sie sich aufgrund des Geldes für eine erste Leihmutterschaft entschieden hat. Der Betrag, der ihr versprochen wurde, erschien ihr sehr großzügig, da sie sich damit später ein Haus bauen konnte (00:08:17). Als allerdings ihr ältestes Kind krank wurde, sah sie in einer erneuten Leihmutterschaft die beste Möglichkeit, das Geld für die Behandlung aufzutreiben. Sie sagt, dass sie sich selbst als eine Mutter von drei Kindern betrachte, obwohl sie das Kind aus der Leihmutterschaft niemals gesehen hat.
Als nächstes zeigt die Kamera eine Frau mittleren Alters, bei der sich herausstellt, dass sie eine Agentin für Leihmütter ist (00:10:43). Die Agentin macht deutlich, dass ihr Gewinn relational zu der Anzahl rekrutierter Leihmütter steigt. Sie berichtet, dass die Bezahlun-
6 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
gen der Leihmütter in Raten nach regelmäßigen Sonographien und medizinischen Unter-suchungen verläuft. Die Leihmütter wiederum erzählen (00:14:07), dass sie einen Bonus von 10.000 Rupien (ca. 170 US-Dollar) erhalten, wenn das geborene Kind mehr als 3,1 kg wiegt. Allerdings wird ihnen ein entscheidender Betrag der Bezahlung erst nach dem fünften Monat ihrer Schwangerschaft gewährt. Nach der Selbstaussage eines Arztes in der Klinik dienen die Ratenzahlungen auch als Erinnerung der Leihmütter, dass sie „sich anstrengen müssen“ (00:12:20). Die Aussage dieses Arztes wird aus dem Off kommentiert, indem darauf hingewiesen wird (00:12:29), dass die Klinik selbst die subjektiven und schmerz-haften Teile des Aufenthaltes ausklammert: die zahlreichen Injektionen, Übelkeitsanfälle, die Müdigkeit, die schlaflosen Nächte und die Angst der Folgen eines nicht arbeitenden Ehemannes sowie die Schwäche nach der Geburt. Anschließend kommt eine ehemalige Leihmutter zu Wort, die sich für einen solchen Auftrag interessierte, da eine Freundin ihr in einer finanziellen Krise von dieser Möglichkeit erzählte (00:14:55). Nachdem sie von einer Klinik abgelehnt wurde, da sie zu schwach sei, ging sie zu einer anderen Klinik, wo fünf-zehn Tage nach der Implantation eines befruchteten Embryos eine Schwangerschaft diag-nostiziert wurde. Anders als in anderen Kliniken, durfte diese Frau temporär nach Hause, allerdings erst im fünften Monat der Schwangerschaft. Dort blieb sie drei Tage und wachte, zurück im Hostel für Leihmütter, mit schweren Blutungen auf. Sie wurde sofort in ein Kran-kenhaus gebracht, jedoch konnte die Blutung nicht gestoppt werden und sie erlitt, unter kontinuierlichen Schmerzen, eine Fehlgeburt. Seitens der Klinik wurde ihr vorgeworfen, den Fötus intendiert abgetrieben zu haben, so dass sie sofort ohne weitere Medizin oder Überweisungen zu anderen Ärzten aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ihr Vertrag galt damit als beendet und ihr Geld wurde aus diesem Grund einbehalten.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Auswirkungen der Leihmutterschaft auf die Gesundheit der Leihmutter selbst nicht im Vertrag abgedeckt werden. Die Frau blutete zehn bis 15 Tage kontinuierlich weiter und musste die Behandlung schließlich mit ihrem eigenen Geld finanzieren. Sie hatte bereits acht Kinder, war aber der Klinik gegenüber nicht auf-richtig und sagte, sie habe nur zwei. Hiermit wird aus der Sicht der Filmemacherin aufge-zeigt, dass viele Kliniken sich von der konkreten, komplexen Lebensrealität der Leihmütter weit entfernen und viele Frauen sich aus ihrer sozialen Not heraus für die Leihmutterschaft bewerben. Surabhi Sharma will deutlich machen, dass die Frage, ob Kliniken die konkrete Lebenssituation außer Acht lassen, nicht unabhängig von der Frage diskutiert werden sollte, ob es legitim ist, dass Medizinethik in Indien nur innerhalb der Kliniken, d. h. ohne einen breiteren Diskurs, stattfindet (00:18:43). Ausgehend von diesem Beispiel macht der Film den Zuschauern deutlich, dass Leihmütter weder zuhause noch in den Kliniken frei sprechen können (00:06:09). Ihre agency, die Rechte als Patientinnen zu verhandeln oder selbst einen Vertrag zu entwerfen, ist durch ihren sozio-ökonomischen Status stark eingeschränkt. Dies wird vor allem durch die Aussage eines ART-Spezialisten deutlich, für den der Gedanke „einer Leihmutter, die den Mut fasst, in mein Büro zu kommen“, eine „idealtypische Situ-ation“ (00:36:08) sei, die allerdings real nicht vorkomme. Mit diesen Darstellungen der Leihmütter wird durch die Filmemacherin eine Geschichte der Brutalität, Fahrlässigkeit und Geringschätzung erzählt, der die Frauen in der staatlichen Gesundheitsversorgung aufgrund ihres geringen sozio-ökonomischen Status gegenüber stehen. Wenn eine Frau, die sich für Leihmutterschaft interessiere, in einer Klinik ankomme, wird zunächst eine gynäkologi-sche Untersuchung durchgeführt und dann mit ihr gesprochen, was deutlich macht, dass das Interesse der Klinik auf ihren körperlichen Fähigkeiten liegt. Die Aussage eines Arztes
Auf der anderen Seite der Kamera 7
1 3
verdeutlicht dies: „Warum sollte ich mit jemandem reden, der keinen (schwangeren) Uterus hat“ (00:34:59). Der Film endet mit Ehepaaren, die den beauftragten Leihmüttern alles Gute wünschen und ihre Bereitschaft ausdrücken, die Schwangerschaft für die Frauen so komfor-tabel wie möglich zu gestalten. Als eine Leihmutter gefragt wird, ob es etwas gebe, was ihr unangenehm sei, sagt diese zögerlich, dass sie ihre Familie vermisse (00:37:34).
Als wir auf den Film durch eine öffentliche Veranstaltung aufmerksam wurden,9 wandten wir uns an Surabhi Sharma, um nach ihrer Perspektive und moralischen Intention im Pro-zess des Filmens zu fragen. Das vorliegende Interview wurde von Sayani Mitra und Solveig Lena Hansen via E-Mail auf Englisch geführt und von Solveig Lena Hansen anschließend übersetzt.
Interview mit Surabhi Sharma
Was hat Sie zu dem Thema der Leihmutterschaft geführt?Surabhi Sharma: Ich habe viele Jahre an der Idee eines Films über die Medikalisierung der Schwangerschaft gearbeitet. Ich hatte über die Idee auch bereits gesprochen, sie aber noch nicht vollständig entwickelt. Wahrscheinlich sind die ausführenden Produzenten der Magic Lantern Foundation deshalb auf mich zugekommen, um diesen Film für SAMA zu machen. Auch wenn mich dies ein wenig von meiner ursprünglichen Idee wegbrachte, hatte ich Lust, die Fragen rund um die Reproduktionsbranche durch einen Film zu erforschen.
Haben Sie vor diesem Film schon einmal zum Thema Medizinethik/Reproduktionsmedizin gearbeitet?Surabhi Sharma: Nicht direkt zu Medizinethik, aber ich habe einen Film über ein gemein-schaftliches Gesundheitsprogramm gemacht, welches von einigen Ärzten durchgeführt wird, die Ghandis Idealen folgen. In diesem Stammesgebiet, im Süden Gujrats, ist Mangel-ernährung weit verbreitet. Die Ärzte setzen sich für die Gesundheit von Müttern und Neu-geborenen in der Gemeinde ein. Die einzige Möglichkeit, eine gesunde Gemeinschaft zu erzielen, besteht in der Intervention hinsichtlich der Gesundheit der Frauen während ihrer Schwangerschaft. Die Arbeit der Ärzte war sehr anregend für mich. Der Filmtitel lautet „Pregnancy, Prescription and Protocol“.
Welche Erfahrungen während des Drehs haben dazu geführt, dass Sie den Titel „Can We See the Baby Bump Please“ gewählt haben?Surabhi Sharma: Diese Frage kam bei den Skype™-Konversationen zwischen den Leih-müttern und den Auftrag gebenden Eltern immer wieder auf. Ich fand sie sehr ergreifend. Auf der einen Ebene liegt die berührende Verbindung der beauftragenden Eltern zu dem wachsenden Babybauch, auf der anderen die nahezu düstere und befremdliche Abkopplung vom Rest des Körpers, der diesen Babybauch (in sich) trägt. Aus kulturellen Gründen versu-chen Frauen in Indien eigentlich, den Schwangerschaftsbauch zu verdecken. Sie wollen so „das böse Auge“ fernhalten. Frauen ziehen einen Schal (Dupatta) oder einen Sari über den Bauch. Den schwangeren Bauch zu zeigen, ist also nichts, was einfach so geschieht. Diese
9 http://www.uni-goettingen.de/de/can-we-see-the-baby-bump-please/480941.html (zugegriffen: 23. Sept. 2014).
8 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
fehlende Verbindung zu den Frauen, die sich wahrscheinlich nicht wohl dabei fühlten, ihren Bauch zu zeigen, empfand ich beunruhigend.
Der Untertitel lautet: „An attempt to understand surrogacy in India“. Was ist die Botschaft hinsichtlich der Praktik der kommerziellen Leihmutterschaft, die der Film vermitteln wollte?Surabhi Sharma: Als Filmemacherin interessierte ich mich für das Thema der kommer-ziellen Leihmutterschaft aus der Perspektive der Arbeit. Während Medizinethik und Ver-handlungsprotokolle den wichtigsten formellen Rahmen darstellen, um diese Fragen zu verhandeln, hatte ich den Eindruck, dass ich das Bild durch die Thematik der Arbeit in einer notwendigen und wichtigen Weise verkomplizieren könnte.
Welches Publikum wollten Sie erreichen, als Sie anfingen, an dem Film zu arbeiten? (Aka-demisches Publikum, andere Filmemacher, nationale oder internationale Kinogänger, Per-sonen, die aktiv an der Leihmutterschaft teilhaben)?Surabhi Sharma: Die meisten unabhängigen Filmemacher beginnen damit, Filme über The-men zu machen, die ihnen wichtig sind, ohne dabei ein Publikum festzulegen. Wenn ich Filme mache, versuche ich, dicht bei meinen Interpretationen, dem Thema und dem Aus-drucksmodus zu bleiben. Je drastischer dieser ist, desto eher erreicht der Film alle Arten von Publikum. Der Film wurde Aktivisten und Personal im Gesundheitswesen, Wissen-schaftlern, Studierenden und Film-Begeisterten gezeigt. Es gab auch eine Vorführung für fast 200 Personen, die in der Ausbildung zu Lehrern in weiterführenden Schulen sind. Sie hatten zwar nichts mit speziellen Gesundheitsfragen zu tun, waren jedoch von der sozial-ge-sellschaftlichen Dimension der Debatte betroffen. Es war eine beeindruckende Diskussion, die dieser Vorführung folgte.
Gab es irgendwelche Hürden, die Ihnen zu Beginn des Films begegnet sind, wie z. B. der Zugang zur Zielgruppe oder zu Räumlichkeiten? Wenn es welche gab, wie haben Sie diese überwunden? Haben die Herausforderungen ggf. einen Einfluss auf die jetzige Form des Films?Surabhi Sharma: Der Film war schwierig zu machen. Ich mache nun schon seit 13 Jahren Dokumentarfilme und ich bin noch nie solchen Schwierigkeiten begegnet, wenn es darum ging, ein harmonisches Verhältnis und Vertrauen zu den Betroffenen aufzubauen. Dies war in meinem Empfinden das erste Mal, dass ich den Zugang zu Leihmüttern verlor, während ich zugleich versuchte, Kontakt zu ihnen aufzubauen. Je mehr Zugang ich zu Kliniken und Ärzten bekam, desto mehr verschlossen sich die Türen zu den Frauen, die ich unabhängig davon kontaktiert hatte. Dies erschwerte meine Arbeit sehr, da die Frauen den Fokus und den Kern des Films darstellen sollten. Die Kliniken waren lediglich bereit, mir in ihren Räumlichkeiten und in Anwesenheit ihres Personals Zugang zu den Frauen zu gewähren. Das machte für mich aber keinen Sinn. Ich realisierte, dass die Netzwerke der Kliniken und ihrer Agenten so weitreichend und so gut konstruiert sind, dass die Frauen, die zunächst einverstanden waren, sich in ihrem Zuhause zu äußern, dann abblockten, auch wenn sie einem Interview schon zugestimmt hatten. Das war verwirrend und frustrierend. Am Ende des Drehs fand ich, dass sich der Großteil meines Materials um sehr klare und detaillierte Interviews mit Ärzten und dem Klinik-Management drehte. Die Interviews mit den Frauen hingegen waren lückenhaft. Das war der Moment, als ich die drastische Entscheidung fällte, aus den lückenhaften Interviews und dem provisorischen Filmmaterial mit den Frauen eine
Auf der anderen Seite der Kamera 9
1 3
Struktur zu erzeugen und die „guten“ Interviews alle auszulassen. Ich entschied mich zu dem Versuch, so eine Präsenz der Frauen zu kreieren. Obwohl ich keine klaren, langen Interviews mit den Frauen hatte (abgesehen von dem mit derjenigen, die eine Fehlgeburt erlitt), entschied ich mich, filmisch eine Präsenz zu erzeugen. Dies sollte zu einem Unbe-hagen seitens des Publikums führen – zu einer Position des Wissens und Nicht-Wissens, die aber zugleich sehr deutlich den Eindruck einer unbequemen und ungelösten Gegenwart vermittelt. Denn genau so arbeitet diese Branche, und die Art und Weise, wie das Gesetz, das die Reproduktionsbranche regulieren soll, bisher ausgearbeitet wurde. Das Zentrum dieses Geschäftszweigs, die Frau, fehlt in deren Bewusstsein. Als Filmemacherin wollte ich ihre Präsenz zurückbringen – gerade weil die Präsenz nicht vollends artikuliert und klar benannt wird.
Inwiefern trägt der Film zu Debatten in der Medizinethik bei? Was vermittelt dieser Film über die Verhältnisse von Medizinethik im indischen Gesundheitssystem?Surabhi Sharma: Ich bin mir nicht sicher, ob mein Film alle Themen abdeckt, die mit den medizinethischen Fragen verbunden sind. Ich hoffe allerdings, dass ich in die Debatte das Thema der Arbeitsrechte einspeisen kann. Die praktizierenden Ärzte denken, dass, wenn der Frau bezahlt wird, was ihr versprochen wurde, die ärztliche Verantwortung an dieser Stelle endet. Sie berechnen die Bezahlung von dem Tag der medizinisch festgestellten Schwanger-schaft bis zum Tag der Entbindung. Danach gibt es selten Kontrolluntersuchungen oder eine Beobachtung des Einflusses auf die Gesundheit der Frau. Es gibt auch keine Untersuchung über den Einfluss der Maßnahmen und Medikationen, die die Frau während der Schwan-gerschaft erhält. Krankenversicherung ist hierbei auch kein Thema. Ebenso gibt es kein ernsthaftes Bestreben, die Daten, die in jeder Klinik zugänglich sind, zu archivieren und zu analysieren. Die meisten Kliniken stellen nur stolz „Erfolgsgeschichten“ dar. Sie scheinen die Daten der Misserfolge nicht zu archivieren. Die meisten Frauen gaben an, dass nicht sie selbst, sondern die Kliniken ihre medizinischen Unterlagen hätten. Die Frauen haben kei-nerlei Beweis dafür, dass sie Leihmütter waren. Frauen haben uns ihre Rezepte und Pillen aus der Zeit ihrer Schwangerschaft gezeigt, ansonsten hatten sie keine weiteren Unterlagen. Wenn sie morgen von einem ernsthaften medizinischen Problem betroffen sind, können sie nicht nachvollziehen, ob es eine Verbindung zur Leihmutterschaft gibt. Diese Themen wollte ich in die medizinethische Debatte einbringen. Es reicht einfach nicht, die Debatte nur auf ein ethisch legitimiertes medizinisches Protokoll zu begrenzen.
Surabhi Sharmas Perspektive als Impuls für eine medizinethische Auseinandersetzung mit indischer Leihmutterschaft
Der Film bietet durch die ungleiche Positionierung der Akteure verschiedene Ansatzpunkte für eine medizinethische Reflexion. Erstens sticht die Frage hervor, inwiefern ein west-liches Konzept des Informed Consent überhaupt greift. Schon weil die Leihmütter u. U. gar nicht alle Schritte im Prozess verstehen und oft kein hinreichendes Englisch sprechen, ist der Informed Consent hier häufig nicht gegeben. Auch werden sie, so stellt es der Film dar, nicht hinreichend über Medikamente (wie bspw. Hormonpräparate) im Zusammenhang mit der IVF aufgeklärt. Anders als z. B. in Großbritannien, wo eine Leihmutter einen Ver-trag abschließt, der sie gegen Schäden und Misserfolge absichert [2], werden die indischen
10 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
Frauen selten über die möglichen Gesundheitsrisiken informiert, die mit der Leihmutter-schaft verbunden sind. Auf einer weiteren Reflexionsebene stellt der Film rein formale Kriterien des Informed Consent noch weiter in Frage, denn für den speziellen indischen Kontext müssen nicht nur die physischen Risiken, sondern auch „social risks and impacts“ ([4], S. 742) im Zuge der Leihmutterschaft berücksichtigt werden, die die Frauen zu vulne-rablen Akteurinnen machen.
Zweitens wird an dem Film deutlich, dass die Frauen in einen kommerzialisierten Markt eingebettet sind, den sie selbst und Teile der Forschungsliteratur nicht per se ablehnen, dessen Bedingungen und „Nebenwirkungen“ sich jedoch durchaus kritisieren lassen. Auf der einen Seite sind die Leihmütter dankbar, dass sie eine Möglichkeit erhalten, Geld für ihre Familie zu verdienen, auf der anderen Seite verzweifeln sie oft angesichts der Tren-nung von ihren Familien, der Abgabe des Kindes nach der Geburt sowie ihrer Schmer-zen, Unannehmlichkeiten und des Verlusts der Möglichkeit, das eigene Leben während der neunmonatigen Schwangerschaft selbst zu bestimmen. Dies verdeutlicht Sharma, indem sie zeigt, wie schnell die Kliniken ihre Verantwortung als beendet ansehen und nur die Pflichten der Frauen im Arbeitsverhältnis hervorheben, nicht aber ihre Rechte. Für ein Land, in dem späteren Leihmüttern gesundheitliche Erstversorgung nicht leicht zugänglich ist, müssten sich die Kliniken aus ihrer Sicht mehr mit erfolgloser Empfängnis sowie der Versorgung nach der Geburt (insbesondere bei Komplikationen) befassen. Im Moment gibt es in Indien bspw. nur sehr wenige Institutionen mit einem wirkungsvollen Ethik-Komitee [10]. Die existierenden, funktionierenden Komitees wiederum sind zumeist nicht aufgefordert, einer Öffentlichkeit Bericht zu erstatten bzw. sind nicht unabhängig von den Institutionen, deren Arbeit sie bewerten sollen [6]. Aufgrund des sozialen Tabus der Leihmutterschaft verheim-lichen die Leihmütter häufig ihre Schwangerschaft vor ihrer näheren Verwandtschaft oder ihren Nachbarn, was eine Spannung oder emotionale Entfernung zwischen ihnen herbei-führt. Auch für diese Belange ist in der gegenwärtigen Diskussion bisher kaum Platz oder Hilfe für die Leihmütter, sich nach ihren Schwangerschaften wieder in ihre persönlichen Lebensumstände einzufügen.
Drittens kann die Perspektive des Films die westliche Debatte für die tatsächlichen Bedürfnisse und die Situation der Leihmütter sensibilisieren, ohne sie als „Opfer“ einer bestimmten Praktik zu stigmatisieren. Indem Sharma die Stimmlosigkeit der Frauen the-matisiert, werden so neue, im Diskurs verschwiegene Aspekte deutlich. Damit konfrontiert die Situation der indischen Frauen auch die Auftraggeber mit ihrer Verantwortung und der Frage, ob sie sich in dem Prozess in die Situation der Leihmütter hineinversetzen. Ihr rela-tiv großer Handlungsspielraum als wohlhabende, werdende Eltern steht dabei dem relativ geringen (aber nicht fehlenden) Handlungsspielraum der Leihmütter gegenüber. Das Pub-likum hierzulande wird wiederum durch den Film mit „anderen“ Arbeits- und Familien-verständnissen konfrontiert. Can We See the Baby Bump Please? zeigt, dass ein solcher Dokumentarfilm keine neutrale Wirklichkeit darstellt, sondern dass er eine Perspektive und einen Standpunkt vertritt, der sich durchaus als moralisch bezeichnen und identifizieren lässt. Dass dieser Standpunkt möglicherweise von dem des Publikums abweicht (welches die Leihmutterschaft beispielsweise gänzlich ablehnt), demonstriert nicht nur die eigene, medizinethische Perspektive eines solchen Films, sondern auch die Notwendigkeit, über dieses Thema mit einer Sensibilität für den speziell indischen Kontext zu sprechen.
Auf der anderen Seite der Kamera 11
1 3
Danksagung Sayani Mitra und Solveig Lena Hansen danken Prof. Dr. Silke Schicktanz und Dr. Sheela Saravanan, dass sie sie auf den Film aufmerksam gemacht haben und ihnen im Interview- und Schreibprozess mit Anmerkungen und Kritik behilflich waren.
Interessenkonflikt S. Mitra und S. L. Hansen geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.
Literatur
1. Armour KL (2012) An overview of surrogacy around the world: trends, questions and ethical issues. Nurs Womens Health 16(3):231–236
2. Burrell C, O’Connor H (2013) Surrogate pregnancy: ethical and medico-legal issues in modern obst-etrics. Obstet Gynaecol 15:113–119
3. Deonandan R, Bente A (2012) India’s assisted reproduction bill and the maternal surrogacy industry. Int Rev Soc Sci Humanit 4:169–173
4. Deonandan R, Green S, Beinum A (2012) Ethical concerns for maternal surrogacy and reproductive tourism. J Med Ethics 38:742–745
5. Hurst S (2008) Vulnerability in research and health care. Describing the elephant in the room? Bioethics 22:191–202
6. Jesani A (2009) Ethics on ethics committees: time to share experiences, discuss challenges and do a better job. Indian J Med Ethics 6:62–63
7. Kambli R (2011) IVF in India: the story so far… Express Healthc. http://healthcare.financialexpress.com/201112/market01.shtml. Zugegriffen: 18. Juli 2014
8. Kannan S (2009) Regulators eye India’s surrogacy sector. India business report, BBC World; 18th March. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7935768.stm. Zugegriffen: 18. Juli 2014
9. Karst K (1980) The freedom of intimate association. Yale Law J 89(4):624–69310. Kaushik SP (2002) Ethics in surgical practice: an Indian viewpoint. Natl Med J India 15:34–3611. Kirby J (2014) Transnational gestational surrogacy: does it have to be exploitative? Am J Bioeth
4:24–3212. Lee S (2013) Outsourcing a life. San Franc Chron. http://www.sfgate.com/local/bayarea/item/India-
surrogacy-Chapter-One-23858.php. Zugegriffen: 18. Juli 201413. Mohapatra S (2012) Stateless babies & adoption scams: a bioethical analysis of international commer-
cial surrogacy. Berkeley J Int Law 30:412–44914. Pande A (2008) Commercial surrogate mothering in India: nine months of labor? In: Kosaka K, Ogino
M (Hrsg) A quest for alternative sociology. Trans Pacific Press, Melbourne, S 71–8715. Pande A (2009) Not an ‘angel’, not a ‘whore’: surrogates as ‘dirty’ workers in India. Indian J Gend Stud
16:141–17316. Pande A (2010) Commercial surrogacy in India: manufacturing a perfect mother-worker. J Women Cult
Soc 35:969–99317. Pennings G (2006) International parenthood via procreative tourism. In: Shenfield F, Surau C (Hrsg)
Contemporary ethical dilemmas in assisted reproduction. Informa Healthcare, Abingdon, S 43–5618. Qadeer I (2009) Social and ethical basis of legislation on surrogacy: need for debate. Indian J Med
Ethics 1:28–3119. Qadeer I, John M (2009) The business and ethics of surrogacy. Econ Polit Wkly 44:10–1220. Sama (2012) Birthing a market: a study of commercial surrogacy. Impulsive Creations, New Delhi.
http://www.samawomenshealth.org/downloads/Birthing%20A%20Market.pdf. Zugegriffen: 18. Juli 2014
21. Sama (2012) The regulations of surrogacy in India – questions and concerns. Kafila. http://kafila.org/2012/01/10/the-regulation-of-surrogacy-in-india-questions-and-concerns-sama/. Zugegriffen: 10. Nov. 2014
22. Sama (2014) The invisible mother: the stigma of surrogacy. In Plainspeak (TARSHI). http://www.tarshi.net/blog/voices-the-invisible-mother-the-stigma-of-surrogacy/. Zugegriffen: 25. Nov. 2014
23. Saravanan S (2010) Transnational surrogacy and objectification of gestational mothers. Econ Polit Wkly 16:26–29
12 S. Mitra, S. L. Hansen
1 3
24. Saravanan S (2013) An ethnomethodological approach to examine exploitation in the context of capacity, trust and experience of commercial surrogacy in India. Philos Ethics Humanit Med 8. doi:10.1186/1747–5341-8–10
25. Sarojini N, Marwah V, Shenoi A (2011) Globalization of birth markets: a case study of assisted repro-ductive technologies in India. Glob Health 7:27–36
26. Shanley ML (1993) Surrogate mothering and women’s freedom: a critique of contracts for human repro-duction. J Women Cult Soc 18:618–639
27. Shenfield F et al (2010) Cross border reproductive care in six European countries. Hum Reprod 25:1361–1368
28. Shetty P (2012) India’s unregulated surrogacy industry. Lancet 380:1633–163429. Vora K (2012) Limits of labor: accounting for affect and the biological in transnational surrogacy and
service work. South Atl Q 111:681–70030. Vora K (2013) Potential, risk, and return in transnational Indian gestational surrogacy. Curr Anthropol
54:97–106