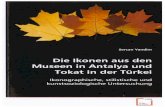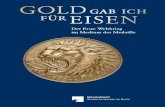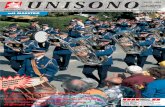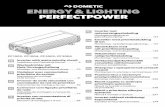"Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen", in Haller Münzblätter,...
Transcript of "Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen", in Haller Münzblätter,...
HALLER MUNZ- BLATTER
Band VIII – März 2015
N A C H R I C H T E N D E R T I R O L E R N U M I S M A T I S C H E N G E S E L L S C H A F T H A L L I N T I R O L
Beiträge zum 6. Österreichischen Numismatikertag2014
Halle
r Mün
zblä
tter –
Ban
d VI
II
B
eiträ
ge z
um 6
. Öst
erre
ichisc
hen
Num
ismat
ikerta
g 20
14
ÖSTERREICH
STÜCK FÜR STÜCK
SILBERMÜNZE „TIROL“
WAS TIROL PRÄGT
Heiliges, Heimatliches, Heutiges und die ewige Natur. Tirol – auf den Punkt und auf die Münze gebracht. Das neue Glanzstück der Bundesländer-Serie. Erleben Sie Österreich –Stück für Stück. Erhältlich in den Geldinstituten, im Sammelservice der Post, in den Filialen des Dorotheums, im Münzhandel, in den Münze Österreich-Shops Wien und Innsbruck sowie unter www.muenzeoesterreich.at.
MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.
Aus der Serie sind bereits erschienen: Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg. Die weiteren Bundesländer folgen.
Heiliges, Heimatliches, Heutiges und die ewige Natur.Münze gebracht. Das neue Glanzstück der Bundesländer-Serie. Erleben Sie Österreich –
Umschlag.indd 1 18.03.2015 20:38:52
Beiträge zum6. Österreichischen Numismatikertag
Hall in Tirol, 14.–16. Mai 2014
Herausgegeben vonTiroler Numismatische Gesellschaft,
Hall im März 2015
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ......................................................................................................................... 5
PROGRAMM ...................................................................................................................... 7
FESTVORTRAG – MEINRAD PIZZININIBergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I. .................................................................. 9
EMANUELE SBARDELLADie numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen MuseenEckhel, Mechel und die administrative Schönheit ............................................................ 31
DANIELA WILLIAMS – BERNHARD WOYTEKThe scholarly correspondence of Joseph Eckhel (1737‒1798): a new source for the history of numismatics .................................................................... 45
JIRÍ MILITKÝSchatzfund keltischer Goldmünzen von einem unbekannten mittelböhmischen Fundort - „OSOV 2“ ....................................................... 57
ANDREA CASOLIDie Anfänge der römischen Reichsprägung unter Kaiser Nero ........................................ 69
MARTIN ZIEGERTVespasian und die Hortfunde ........................................................................................... 83
KARL STROBELMünzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I. ........................................................... 105
ALENA TENCHOVA-JANZIKVerbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen in Westfalen-Lippe ..................... 129
NIKOLAUS SCHINDELSasaniden, Kushan, Kushano-Sasaniden: Münzprägung, Propaganda und Identitäten zwischen Westiran und Ostiran ................. 137
EHSAN SHAVAREBIEin vorläufiger Bericht zur Katalogisierung der sasanidischen Münzen des Malek-Museums in Teheran ........................................................................................... 169
JÜRGEN WILDEin Gerichtsurteil vom 1. Juni 1290 und die Brakteaten der Herren von Schlotheim ............................................................................................................... 179
HALLER MÜNZBLÄTTER
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): Tiroler Numismatische Gesellschaft, Burg Hasegg 5, 6060 Hall in Tirol. Offenlegung: Art und Höhe der Beteiligung am Medienunterneh-men. Alleininhaber Tiroler Numismatische Ge-sellschaft; grundlegende Richtung des Mediums: Numismatische Fachzeitschrift. Redaktion: Martin Holzknecht, Layout: Andrea Pancheri. Gezeichnete Beiträge liegen nicht in der Verant-wortung der Redaktion. – Titelbild: Marijan Rabik, Tiroler Numismatische Gesellschaft.
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung vonHistorisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung Documenta Antiqua
Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett
Münze Österreich
Wir danken unseren SponsorenStadt Hall
Hall AG – Münze Hall
Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol
Tourismusverband Region Hall – Wattens
2120
VARIANTE 3
WEISSEr HINtErGrUNDMIt PoSItIVEM LoGo IN 4c MIt ScHUtZZoNE.
UNZULÄSSIGES BEISPIEL
bUNtEr HINtErGrUND MIt ScHWAcHEM UND IrrItIErENDEM koNtrASt ZUM 4c LoGo MIt ScHUtZZoNE.
Die münze ist ein offizielles Zahlungsmittel in Österreich.erhältlich in Geldinstituten, im münzhandel sowie im münZe ÖsterreicH-shop Wien und innsbruck und unter www.muenzeoesterreich.at
Kundmachung der münZe ÖsterreicH aG in der „Wiener Zeitung“ am 20.12.2011.
ANLEGEN. SAmmELN. SChENKEN.
50-EURO-GOLDmÜNZE „ADELE BLOCh-BAUER I“
der erste Klimt für ihre sammlunG
3
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ......................................................................................................................... 5
PROGRAMM ...................................................................................................................... 7
FESTVORTRAG – MEINRAD PIZZININIBergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I. .................................................................. 9
EMANUELE SBARDELLADie numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen MuseenEckhel, Mechel und die administrative Schönheit ............................................................ 31
DANIELA WILLIAMS – BERNHARD WOYTEKThe scholarly correspondence of Joseph Eckhel (1737‒1798): a new source for the history of numismatics .................................................................... 45
JIRÍ MILITKÝSchatzfund keltischer Goldmünzen von einem unbekannten mittelböhmischen Fundort - „OSOV 2“ ....................................................... 57
ANDREA CASOLIDie Anfänge der römischen Reichsprägung unter Kaiser Nero ........................................ 69
MARTIN ZIEGERTVespasian und die Hortfunde ........................................................................................... 83
KARL STROBELMünzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I. ........................................................... 105
ALENA TENCHOVA-JANZIKVerbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen in Westfalen-Lippe ..................... 129
NIKOLAUS SCHINDELSasaniden, Kushan, Kushano-Sasaniden: Münzprägung, Propaganda und Identitäten zwischen Westiran und Ostiran ................. 137
EHSAN SHAVAREBIEin vorläufiger Bericht zur Katalogisierung der sasanidischen Münzen des Malek-Museums in Teheran ........................................................................................... 169
JÜRGEN WILDEin Gerichtsurteil vom 1. Juni 1290 und die Brakteaten der Herren von Schlotheim ............................................................................................................... 179
HALLER MÜNZBLÄTTER
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): Tiroler Numismatische Gesellschaft, Burg Hasegg 5, 6060 Hall in Tirol. Offenlegung: Art und Höhe der Beteiligung am Medienunterneh-men. Alleininhaber Tiroler Numismatische Ge-sellschaft; grundlegende Richtung des Mediums: Numismatische Fachzeitschrift. Redaktion: Martin Holzknecht, Layout: Andrea Pancheri. Gezeichnete Beiträge liegen nicht in der Verant-wortung der Redaktion. – Titelbild: Marijan Rabik, Tiroler Numismatische Gesellschaft.
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung vonInstitut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung Documenta Antiqua
Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett
Münze Österreich
Wir danken unseren SponsorenStadt Hall
Hall AG – Münze Hall
Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol
Tourismusverband Region Hall – Wattens
2120
VARIANTE 3
WEISSEr HINtErGrUNDMIt PoSItIVEM LoGo IN 4c MIt ScHUtZZoNE.
UNZULÄSSIGES BEISPIEL
bUNtEr HINtErGrUND MIt ScHWAcHEM UND IrrItIErENDEM koNtrASt ZUM 4c LoGo MIt ScHUtZZoNE.
Die münze ist ein offizielles Zahlungsmittel in Österreich.erhältlich in Geldinstituten, im münzhandel sowie im münZe ÖsterreicH-shop Wien und innsbruck und unter www.muenzeoesterreich.at
Kundmachung der münZe ÖsterreicH aG in der „Wiener Zeitung“ am 20.12.2011.
ANLEGEN. SAmmELN. SChENKEN.
50-EURO-GOLDmÜNZE „ADELE BLOCh-BAUER I“
der erste Klimt für ihre sammlunG
4
Die Idee, Numismatikern in Österreich ein geeignetes Forum zur Präsentation ak-tueller Forschungen und zum fachlichen Diskurs zu bieten, geht auf das Jahr 2004 zurück, als der erste Österreichische Numismatikertag am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien veranstaltet wurde. Der Kongress wurde vom Institut in Zusammenarbeit mit dem Münzkabinett des Kunsthistorischen Mu-seums Wien und der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften organisiert, die 2013 in der Abteilung Documenta Antiqua des Instituts für Kulturgeschichte der Antike aufging. Das Konzept der Veranstaltung erwies sich als so erfolgreich, dass seither alle zwei Jahre ein Österreichischer Numismatikertag unter Federführung der drei genannten Institutionen veranstaltet wurde. Nachdem die ersten drei Kongresse in Wien abgehalten worden waren, forderten die Bundesländer ihr Recht ein: Nach Graz und Enns durften wir zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2014 den 6. Österreichischen Numismatikertag in Hall in Tirol be-gehen. Die Tiroler Numismatische Gesellschaft, die seit mehr als vier Jahrzehnten einer der aktivsten regionalen numismatischen Vereine in Österreich ist, lud in die Burg Hasegg, und mehr als 60 Gäste – wissenschaftliche Numismatiker ebenso wie mit der Münzquelle arbeitende Historiker, Sammler und Händler – folgten der Einladung. In historischem Ambiente wurde vom 14. bis 16. Mai 2014 konstruktiv und fruchtbar gearbeitet, aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Wie schon bei früheren Numismatikertagen wurde die Veranstaltung durch zahlreiche Teil-nehmer wie auch Referenten aus dem Ausland bereichert: 2014 kamen sie aus Deutschland, Italien, Tschechien, Ungarn und dem Iran.Es ist uns an dieser Stelle eine angenehme Pflicht, all jenen, die zum Gelingen des Kongresses beigetragen haben, unseren Dank abzustatten. An erster Stelle ist hier Martin Holzknecht zu nennen, der vom ersten Tag weg die Planungen – in enger Abstimmung mit den Unterzeichneten – in vorbildlicher Weise durchführte und ganz maßgeblich für das Gelingen der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.Ohne die Großzügigkeit unserer Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, den Numismatikertag durchzuführen und die vorliegenden Akten zu publizieren: Nach der Veröffentlichung der Akten des 4. Österreichischen Numismatikertags im Schild von Steier 23 (2010) und des 5. Österreichischen Numismatikertags in den Forschungen in Lauriacum 15 (2014) konnte nunmehr zum dritten Mal eine Tagungspublikation zum Druck gebracht werden. Wir danken neben der Tiroler Nu-mismatischen Gesellschaft der Stadt Hall, der Hall AG – Münze Hall, der Raiffei-senregionalbank Hall in Tirol sowie dem Tourismusverband Region Hall-Wattens,
VorwortHUBERT EMMERIG – ELLEN BOŠNJAK – MICHAEL G. L. HERRMANNGeld in Abrechnungen – Beispiele aus Tirol (13. Jh.) und Bayern (16. Jh.) ................... 193
HELMUT RIZZOLLIFalschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten vom Lagertal ................................................................................................................... 209
JÁNOS BUZADer Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn ...................................... 227
MARTIN ULONSKADie Prägetechniken der Stadt Straßburg und ihre Nutzbarkeit für die Datierung der Straßburger Münzen ................................................................................ 241
DAGMAR GROSSMANNOVÁBeitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in Bezug auf Mähren .......................................................................................................... 249
ANNA FABIANKOWITSCHDie Inventare des k. k. Hauptmünzamts für die Jahre 1767 und 1768 .......................... 255
BERNHARD PROKISCHAspekte der österreichisch-ungarischen Medaille im Ersten Weltkrieg .......................... 265
DANIELA PFENNIGNot macht erfinderisch: Als Tiroler Gemeinden ihr eigenes Geld druckten .................... 289
MICHAEL HERRMANNNotgeld – Probe – Fälschung?!Neue Erkenntnisse zur Notgeldprägung der Marktgemeinde Garmisch 1917/18 .......................................................................................................... 311 JÜRGEN MÜHLBACHERDie protestantische Arbeitsethik – Mythos oder Realität?Eine Untersuchung an Hand der 5 Euro Münzen der Niederlande und Österreichs ............................................................................................................... 319
5
Die Idee, Numismatikern in Österreich ein geeignetes Forum zur Präsentation ak-tueller Forschungen und zum fachlichen Diskurs zu bieten, geht auf das Jahr 2004 zurück, als der erste Österreichische Numismatikertag am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien veranstaltet wurde. Der Kongress wurde vom Institut in Zusammenarbeit mit dem Münzkabinett des Kunsthistorischen Mu-seums Wien und der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften organisiert, die 2013 in der Abteilung Documenta Antiqua des Instituts für Kulturgeschichte der Antike aufging. Das Konzept der Veranstaltung erwies sich als so erfolgreich, dass seither alle zwei Jahre ein Österreichischer Numismatikertag unter Federführung der drei genannten Institutionen veranstaltet wurde. Nachdem die ersten drei Kongresse in Wien abgehalten worden waren, forderten die Bundesländer ihr Recht ein: Nach Graz und Enns durften wir zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2014 den 6. Österreichischen Numismatikertag in Hall in Tirol be-gehen. Die Tiroler Numismatische Gesellschaft, die seit mehr als vier Jahrzehnten einer der aktivsten regionalen numismatischen Vereine in Österreich ist, lud in die Burg Hasegg, und mehr als 60 Gäste – wissenschaftliche Numismatiker ebenso wie mit der Münzquelle arbeitende Historiker, Sammler und Händler – folgten der Einladung. In historischem Ambiente wurde vom 14. bis 16. Mai 2014 konstruktiv und fruchtbar gearbeitet, aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Wie schon bei früheren Numismatikertagen wurde die Veranstaltung durch zahlreiche Teil-nehmer wie auch Referenten aus dem Ausland bereichert: 2014 kamen sie aus Deutschland, Italien, Tschechien, Ungarn und dem Iran.Es ist uns an dieser Stelle eine angenehme Pflicht, all jenen, die zum Gelingen des Kongresses beigetragen haben, unseren Dank abzustatten. An erster Stelle ist hier Martin Holzknecht zu nennen, der vom ersten Tag weg die Planungen – in enger Abstimmung mit den Unterzeichneten – in vorbildlicher Weise durchführte und ganz maßgeblich für das Gelingen der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.Ohne die Großzügigkeit unserer Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, den Numismatikertag durchzuführen und die vorliegenden Akten zu publizieren: Nach der Veröffentlichung der Akten des 4. Österreichischen Numismatikertags im Schild von Steier 23 (2010) und des 5. Österreichischen Numismatikertags in den Forschungen in Lauriacum 15 (2014) konnte nunmehr zum dritten Mal eine Tagungspublikation zum Druck gebracht werden. Wir danken neben der Tiroler Nu-mismatischen Gesellschaft der Stadt Hall, der Hall AG – Münze Hall, der Raiffei-senregionalbank Hall in Tirol sowie dem Tourismusverband Region Hall-Wattens,
VorwortHUBERT EMMERIG – ELLEN BOŠNJAK – MICHAEL G. L. HERRMANNGeld in Abrechnungen – Beispiele aus Tirol (13. Jh.) und Bayern (16. Jh.) ................... 193
HELMUT RIZZOLLIFalschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten vom Lagertal ................................................................................................................... 209
JÁNOS BUZADer Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn ...................................... 227
MARTIN ULONSKADie Prägetechniken der Stadt Straßburg und ihre Nutzbarkeit für die Datierung der Straßburger Münzen ................................................................................ 241
DAGMAR GROSSMANNOVÁBeitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in Bezug auf Mähren .......................................................................................................... 249
ANNA FABIANKOWITSCHDie Inventare des k. k. Hauptmünzamts für die Jahre 1767 und 1768 .......................... 255
BERNHARD PROKISCHAspekte der österreichisch-ungarischen Medaille im Ersten Weltkrieg .......................... 265
DANIELA PFENNIGNot macht erfinderisch: Als Tiroler Gemeinden ihr eigenes Geld druckten .................... 289
MICHAEL HERRMANNNotgeld – Probe – Fälschung?!Neue Erkenntnisse zur Notgeldprägung der Marktgemeinde Garmisch 1917/18 .......................................................................................................... 311 JÜRGEN MÜHLBACHERDie protestantische Arbeitsethik – Mythos oder Realität?Eine Untersuchung an Hand der 5 Euro Münzen der Niederlande und Österreichs ............................................................................................................... 319
6
Mittwoch, 14. Mai 2014
18.00 Eröffnungsvortrag: MEINRAD PIZZININI Bergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I.
Donnerstag, 15. Mai 2014
9.00 – 9.30 MARTIN ZIEGERT Auswertung flavischer Münzfunde
9.30 – 10.00 HELMUT RIZZOLLI Falschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten vom Lagertal
10.15 – 10.45 ALENA TENCHOVA-JANZIK Verbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen in Westfalen-Lippe
10.45 – 11.15 JÁNOS BUZA Der Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn
11.15 – 11.45 BERNHARD PROKISCH Aspekte zur österreichischen Medaille im Ersten Weltkrieg
12.45 – 14.00 Führung durch die Münze Hall
14.00 – 14.30 DANIELA PFENNIG Tiroler Notgeld erzählt – Plurale Bedeutungen eines Kleingeldersatzes
14.30 – 15.00 HUBERT EMMERIG, ELLEN BOŠNJAK, MICHAEL G. L. HERRMANN Geld in Abrechnungen - Beispiele aus Tirol (13. Jh.) und Bayern (16. Jh.)
15.00 – 15.30 MICHAEL HERRMANN Notgeld, Probe oder Fälschung? - Neue Erkenntnisse zur Kriegsnotgeldprägung der Gemeinde Garmisch - Bayern
16.00 – 16.30 HANNE MAIER – Vortrag entfiel krankheitshalber Die monetäre und wirtschaftliche Entwicklung der Peloponnes im 4. Jh. v. Chr. – Eisenproduktionen
16.30 – 17.00 KARL STROBEL Münzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I.
Programmwelche die von den Institutionen der Unterzeichneten bereitgestellten Mittel in nam-hafter Weise aufstockten.Es ist uns eine besondere Freude, dass die vorliegende Publikation aufgrund des außerordentlichen Einsatzes von Martin Holzknecht und Andrea Pancheri innerhalb Jahresfrist nach der Tagung erscheinen kann. Nach acht Jahren wird der Österreichische Numismatikertag 2016 wieder nach Wien zurückkehren, wo wir uns in der Oesterreichischen Nationalbank einfinden werden: unsere numismatischen Freunde aus den Bundesländern haben die Latte hoch gelegt!
Michael Alram, Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums WienHubert Emmerig, Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien
Bernhard Woytek, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung Documenta Antiqua
7
Mittwoch, 14. Mai 2014
18.00 Eröffnungsvortrag: MEINRAD PIZZININI Bergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I.
Donnerstag, 15. Mai 2014
9.00 – 9.30 MARTIN ZIEGERT Auswertung flavischer Münzfunde
9.30 – 10.00 HELMUT RIZZOLLI Falschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten vom Lagertal
10.15 – 10.45 ALENA TENCHOVA-JANZIK Verbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen in Westfalen-Lippe
10.45 – 11.15 JÁNOS BUZA Der Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn
11.15 – 11.45 BERNHARD PROKISCH Aspekte zur österreichischen Medaille im Ersten Weltkrieg
12.45 – 14.00 Führung durch die Münze Hall
14.00 – 14.30 DANIELA PFENNIG Tiroler Notgeld erzählt – Plurale Bedeutungen eines Kleingeldersatzes
14.30 – 15.00 HUBERT EMMERIG, ELLEN BOŠNJAK, MICHAEL G. L. HERRMANN Geld in Abrechnungen - Beispiele aus Tirol (13. Jh.) und Bayern (16. Jh.)
15.00 – 15.30 MICHAEL HERRMANN Notgeld, Probe oder Fälschung? - Neue Erkenntnisse zur Kriegsnotgeldprägung der Gemeinde Garmisch - Bayern
16.00 – 16.30 HANNE MAIER – Vortrag entfiel krankheitshalber Die monetäre und wirtschaftliche Entwicklung der Peloponnes im 4. Jh. v. Chr. – Eisenproduktionen
16.30 – 17.00 KARL STROBEL Münzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I.
Programmwelche die von den Institutionen der Unterzeichneten bereitgestellten Mittel in nam-hafter Weise aufstockten.Es ist uns eine besondere Freude, dass die vorliegende Publikation aufgrund des außerordentlichen Einsatzes von Martin Holzknecht und Andrea Pancheri innerhalb Jahresfrist nach der Tagung erscheinen kann. Nach acht Jahren wird der Österreichische Numismatikertag 2016 wieder nach Wien zurückkehren, wo wir uns in der Oesterreichischen Nationalbank einfinden werden: unsere numismatischen Freunde aus den Bundesländern haben die Latte hoch gelegt!
Michael Alram, Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums WienHubert Emmerig, Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien
Bernhard Woytek, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung Documenta Antiqua
8
Meinrad Pizzinini
__________ Es wurde versucht, bei den Anmerkungen mit wenigen, aber möglichst aktuellen Literaturan-
gaben auszukommen. Daher wird in besonderer Weise auf das verhältnismäßig umfangrei-che Literaturverzeichnis verwiesen.
1 Pizzinini 1986, S. 8–25, hier S. 21 f.2 Maximilian I. Innsbruck, Ausstellungskatalog 1969, S. 69–74; Egg – Pfaundler 1992, S. 54–64,
Abb. 1: Kaiser Maximilian I. (1459-1519) als Privatmann.
Bergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I.
Maximilan I., landläufig mit so romantischen Beinamen bedacht wie „der letzte Ritter“ oder „der erste Kanonier“, war am 16. Februar 1486 in Frankfurt von den Kurfürs-ten einstimmig zum Römischen König gewählt und wenig später zu Aachen gekrönt worden. Herrschaftsrechte enthielt ihm aber sein Vater, Kaiser Friedrich III., vor. Das änderte sich mit dem Jahr 1490. Auf der Tiroler landständischen Versammlung vom
16. März 1490 löste er Erzherzog Sigmund den Münzreichen als Landesfürsten von Tirol ab.1 Seine besondere Beziehung zu diesem Land, in dem er nun endlich seine eigenen politischen Vorstellungen verwirklichen konnte, drückte be-reits sein Schreiben an den Papst in Rom aus, den er wissen ließ, wer nun Herr in diesem Land im Gebirge sei und dass die „namhaft fürstlich Grafschaft Tirol ein Klausen, Schild und Porten“ der deutschen gegen die welsche Nation sei. Bekannt ist auch Maximilians Ausspruch, die-ses Land sei wie ein rauer Bauernkittel, in des-sen Falten man sich gut wärmen könne. – Von großer Anziehungskraft in diesem gebirgigen Land waren für ihn Jagd und Fischerei.2 Maxi-milian verband mit dem Naturerlebnis die Be-friedigung seiner Abenteuerlust durch den per-sönlichen Einsatz von Mut und Kraft. Auch die Fischerei faszinierte Maximilian und vielfach –
wie am Achensee – konnte er beide Vergnügen – Jagd und Fischerei – verbinden. Ein weiteres Zitat Maximilians I. ist für ihn wohl noch bezeichnender als das mit dem rauen Bauernkittel, wenn er sagte, Tirol sei wie eine Geldbörse, in die man nie umsonst greife! – Und damit sind wir schon beim eigentlichen Thema des Beitrags, der sich in einem lediglich komprimierten Überblick mit dem Bergbau und davon ausgehend mit der Münzprägung und – mit einem modernen Ausdruck – kulturel-lem Sponsoring befasst.
17.00 – 17.30 JÜRGEN MÜHLBACHER Die protestantische Arbeitsethik – Mythos oder Realität Ein interkultureller Vergleich an Hand niederländischer und österreichischer Münzen
Freitag, 16. Mai 2014
9.00 – 9.30 EMANUELE SBARDELLA Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen
9.30 – 10.00 DANIELA WILLIAMS – BERNHARD WOYTEK Joseph Eckhel (1737-1798) und sein numismatisches Netzwerk: Ein Forschungsprojekt an der Österr. Akademie der Wissenschaften
10.00 – 10.30 ANNA FABIANKOWITSCH Ein Inventar des k. k. Hauptmünzamtes für das Jahr 1768
10.45 – 11.15 JIRÍ MILITKÝ Schatzfund keltischer Goldmünzen von einem unbekannten mittelböhmischen Fundort - „OSOV 2“
11.15 – 11.45 EHSAN SHAVAREBI Zur Katalogisierung der sasanidischen Münzen des Malek-Museums in Teheran
13.00 – 14.15 Stadtführung14.15 – 14.45 JÜRGEN WILD Ein Gerichtsurteil vom 1. Juni 1290 und die Brakteaten der Herren von Schlotheim
14.45 – 15.15 KLAUS VONDROVEC Nachahmungen römischer Münzen im sogenannten Barbaricum
15.15 – 15.45 MARTIN ULONSKA Prägetechnik als Mittel zur Datierung der Gepräge der Stadt Straßburg
16.15 – 16.45 ANDREA CASOLI Die Münzprägung von Kaiser Nero
16.45 – 17.15 DAGMAR GROSSMANNOVÁ Beitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in Bezug auf Mähren
17.15 – 17.45 NIKOLAUS SCHINDEL Die kushano-sasanidische Münzprägung - eine Neubewertung
Samstag, 17. Mai 2014
10.00 – 12.00 Führung durch Schloss Ambras bei Innsbruck
31
Emanuele Sbardella
__________1 Savoy 2006, passim.
Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
Bevor ich die numismatischen Wege zurückverfolge, die zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen geführt zu haben scheinen, muss angesprochen werden, was man unter „Wissenschaftlichkeit“ und „modernem Museum“ zu verstehen habe.
DAS MODERNE MUSEUM UND DIE WISSENSCHAFTLICHKEIT
Ein modernes Kunstmuseum ist laut Bénédicte Savoy1 durch drei Merkmale cha-rakterisiert: eine ständige Zugänglichkeit der Bestände für ein möglichst breites Publikum; die Gemeinnützigkeit der Einrichtung hinsichtlich der Belehrung der Bevölkerung; die Wissenschaftlichkeit bei der Bearbeitung und Ausstellung der Sammlungen. Die Geburt des modernen Museums sei also nicht, wie üblicher-weise angenommen, mit der Eröffnung des Louvre (1793) gleichzusetzen, da alle diese Merkmale schon ungefähr ab 1775 auch in anderen Museen auffindbar wa-ren. Unter den von Savoy in Betrachtung gezogenen Museen befindet sich auch die Wiener Gemäldegalerie, die 1781 im Belvedere durch Christian von Mechel neuorganisiert wurde. Während im Zusammenhang mit der Frage nach der Entstehung des modernen Museums bislang hauptsächlich Kunstmuseen miteinander verglichen worden sind, ist das Ziel der vorliegenden Studie, einen Vergleich zwischen zwei Sammlungen anzustellen, die zwar in Wien geographisch nahe beieinander lagen, aber bisher durch eine disziplinäre Aufteilung voneinander getrennt betrachtet worden sind: die kaiserliche Sammlung von Gemälden und die von Münzen, mit besonderem Hin-blick auf deren zeitgleich erfolgte Neuorganisation durch Christian von Mechel bzw. Joseph Hilarius von Eckhel. Im Fazit wird die These vertreten, dass die Wissenschaftlichkeit nicht nur die mo-dernen Kunstmuseen charakterisiert, sondern sich – sowohl zeitlich als auch epis-temologisch – zunächst bei den Münzkabinetten entwickelte.
Tiroler Bergbau zur Zeit Kaiser Maximilians I.
Moser – Tursky 1977 H. Moser – H. Tursky, Die Münzstätte Hall in Tirol 1477–1665, Innsbruck 1977.
Moser – Rizzolli – Tursky 1984 H. Moser – H. Rizzolli – H. Tursky, Tiroler Münzbuch. Die Geschichte des Geldes aus
den Prägestätten des alttirolischen Raumes, Innsbruck 1984.
Oberhammer 1943 V. Oberhammer, Die Bronzestatuen am Grabmal Maximilian I., Innsbruck 1943.
Oberhammer 1970 V. Oberhammer, Das Goldene Dachl zu Innsbruck, Innsbruck 1970.
Öttinger 1966 K. Öttinger, Die Bildhauer Maximilians am Innsbrucker Kaisergrabmal, Nürnberg 1966.
Palme 1986 R. Palme, Frühe Neuzeit (1490–1665), in: Geschichte des Landes Tirol, Bd. 2, Bo-zen-Innsbruck-Wien 1986, S. 1–287.
Pizzinini 1977 M. Pizzinini, Münzen als Quelle zur Kulturgeschichte Tirols, in: Tiroler Tageszeitung, 33. Jg. (1977), Nr. 213, Sonderbeilage, S. 8.
Pizzinini 2009 M. Pizzinini, Kaiser Maximilian I. – Ein Porträt, in: Kaiser Maximilian I. (1459–1519) und die Hofkultur seiner Zeit (Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 17, 2008/2009), Wiesbaden 2009, S. 473–480.
Ringler 1958 J. Ringler, Das Maximiliangrab in Innsbruck, Königstein 1958.
Senn 1954 W. Senn, Musik und Theater am Hof zu Innsbruck, Innsbruck 1954.
Unterkircher 1968 F. Unterkircher, Jörg Kölderer und die Donauschule. Studien zur Kunst der Donauschu-le, Linz 1968.
Wiesflecker 1986 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 5 Bände, Wien 1971 bis 1986, besonders Bd. V: Der Kaiser und seine Umwelt: Hof, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Wien 1986.
Wiesflecker 1991 H. Wiesflecker, Maximilian I. Die Fundamente des habsburgischen Weltreiches, Wien 1991.
Univ.-Doz. Dr. Meinrad PizzininiKustos der Historischen Sammlungen
am Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum a. D.Albertistraße 2a, 6176 Völs
Österreich Tel. 0650/4304820
32
Emanuele Sbardella
__________5 Heyne 1793, zit. nach Döring 1838, S. 498–499.6 Kultermann 1990, S. 59.7 Millin 1797, S. 49.8 Wegner 2005, S. 70.9 Aus Platzgründen wird hier auf eine ausführliche Erläuterung der Beziehungen Mechels zu
den Theorien von Goethe, Winckelmann, de Plies und Fernow verzichtet.10 Fischer 2013, S. 28.11 „Man putzt die Gemälde auf, und verderbt sie; man flickt, man vergrößert und verkleinert nach
Belieben; sehr viele sind beschädiget; ebenso schlecht sind sie auch geordnet. Bey einem trefflichen Titian hängt oft eines, das ich nicht geschenkt haben möchte“ (Bericht eines anony-men Besuchers, zit. nach Fischer 2013, S. 25).
Veröffentlichung des ersten Bandes der Doctrina Numorum Veterum erklärte sich Heyne (1793) darüber zutiefst erstaunt, „wie gedanken-, zweck- und planlos“5 die Numismatik vor Eckhel ihre Forschung durchgeführt habe. Eine ähnliche Rezeption besorgte Justi Winckelmann durch die Bemerkung, dass zu dessen Zeit kein ande-rer da gewesen sei, „der eine sachkundige Kritik der Kunstgeschichte zu schreiben im Stande gewesen wäre.“6
Ein weiteres rhetorisches Werkzeug für die Legitimation der eigenen Wissenschaft könnte aemulatio Linnæi genannt werden und zeigte sich in der Form eines ständig sich wiederholenden Hinweises auf Carl von Linné. Das numismatische System Eckhels wurde 1797 von Millin mit dem systema nathurae (1735) verglichen.7 Auch ein wissenschaftliches Kunstsystem habe den „modernen Ordnungssystemen na-turwissenschaftlicher Provenienz“8 zu entsprechen gehabt.
MECHEL
Es ist also kaum verwunderlich, dass Christian von Mechel, der 1767 Winckel-mann in Rom kennenlernte, von diesem grenzüberschreitenden Gedankengut be-einflusst war und als Illustrator derartige Radierungen anfertigte (Abb. 1). Derselbe vor-darwinistische Geist, der in diesen Radierungen deutlich wird, durchdrang be-greiflicherweise auch seine innovative kuratoriale Tätigkeit im Belvedere. Das von Mechel eingeführte Novum, das eigentlich schon in Düsseldorf (1778) sichtbar war, wurde in Wien noch deutlicher. Direkt (den damaligen Direktor Josef Rosa umge-hend) von Maria Theresia beauftragt, schuf Mechel eine Systematisierung9, die ihre Verschwägerungen mit den Taxonomien der Botanik und dem Evolutionsgedanken der Biologie nicht verschleierte.
Vor Mechel galt das sog. barocke Modell10, nach welchem Axialität und Symme-trie der Hängung an vollbedeckten Wänden herrschten. Gemälde konnten früher kaum einzeln betrachtet werden; ihre Gesamtheit hatte dem selbstrepräsentati-ven Bedürfnis des Kaiserhauses zu dienen, und dafür scheute man sich nicht da-vor, sogar die Bilder dem gewünschten Format anzupassen. Nicht nur Experten, sondern auch das Publikum11 fing um die Mitte des 18. Jahrhunderts an, diese
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________2 Folgende tabellarische Darstellung ist aus Kenner 1871 und Lhotsky 1941–1945 zusammen-
gefasst.3 Kenner 1871, S. 18.4 „[W]enigstens zwei Male in der Woche im Münzkabinett ausführliche Erläuterungen für die
Münzfreunde zu geben“ (Lhotsky 1941–1945, S. 461). Vgl. Stichwort: Zugänglichkeit und Gemeinnutzen des modernen Museums.
ECKHEL
Gegenüber dem Leser dieser fachspezifischen Publikation brauche ich über das eckhelsche System nicht viele Worte zu verlieren.2
1772 Direktor der Münzsammlung der Jesuiten (Wien)1772–1774 Aufenthalt in Italien und Mitarbeit u. a. bei Cocchi (Firenze)1774 „director zur besorgung der alten münzen“ (Wien)1775 Numi veteres anecdoti1775 Lehrkanzel „der Altertümer und der historischen Hilfsmittel“1779 Catalogus Musei Cæsarei Vindobonensis numorum veterum1786 Kurzgefaßte Anfangsgründe zur alten Numismatik1792–1798 Doctrina Numorum Veterum
Das System Eckhels ist bereits in den späten 60er Jahre des 18. Jahrhunderts ent-standen, „als er die Sammlungen Wiczay, Festetics und Medidi ordnete.“3 Sein Sys-tem baute er ab 1772 im Rahmen seiner Tätigkeit als Direktor der Münzsammlung der Jesuiten und im Rahmen eines italienischen Studienaufenthaltes auf, während dessen Eckhel Kontakt mit Cocchi – dem Direktor des Münzkabinetts von Florenz – aufnahm. Nach diesen Erfahrungen und der Aufhebung des Jesuitenordens (1773) kehrte Eckhel 1774 nach Wien zurück und ließ die Numi veteres anecdoti ... veröf-fentlichen. Im Zuge seiner musealen Beschäftigung verpflichtete sich Eckhel, ge-gen eine monatliche Belohnung in Höhe von 600 Gulden, u. a. zwei Mal pro Woche den Besuchern die Sammlung offen zu halten.4 In dieser Zeit begann Eckhel, den Catalogus Musei Cæsarei Vindobonensis numorum veterum zusammenzustellen. Hier ist erstmals eine Geschichte der Sammlung enthalten. Spätestens 1786 (in: Kurzgefasste Anfangsgründe zur alten Numismatik) sind deutliche Anzeichen des neuen Systems zu sehen, das wohl aber erst in der Doctrina Numorum Veterum voll zum Ausdruck kommt.
ALLGEMEINE MYTHISCHE WISSENSCHAFTSGRÜNDUNG
Es gibt ein rhetorisches Repertoire, auf dessen Grundlage der Mythos der Wissen-schaftlichkeit konstruiert wird, und dieses Repertoire ist bei allen Wissenschaften ähnlich. Die erstaunte Feststellung, dass es vor dem ‚Advent‘ eines Disziplingründers an Systematik fehlte, einigt z. B. (nicht nur) Geld- und Kunstgeschichte. Schon bei der
33
Emanuele Sbardella
__________5 Heyne 1793, zit. nach Döring 1838, S. 498–499.6 Kultermann 1990, S. 59.7 Millin 1797, S. 49.8 Wegner 2005, S. 70.9 Aus Platzgründen wird hier auf eine ausführliche Erläuterung der Beziehungen Mechels zu
den Theorien von Goethe, Winckelmann, de Plies und Fernow verzichtet.10 Fischer 2013, S. 28.11 „Man putzt die Gemälde auf, und verderbt sie; man flickt, man vergrößert und verkleinert nach
Belieben; sehr viele sind beschädiget; ebenso schlecht sind sie auch geordnet. Bey einem trefflichen Titian hängt oft eines, das ich nicht geschenkt haben möchte“ (Bericht eines anony-men Besuchers, zit. nach Fischer 2013, S. 25).
Veröffentlichung des ersten Bandes der Doctrina Numorum Veterum erklärte sich Heyne (1793) darüber zutiefst erstaunt, „wie gedanken-, zweck- und planlos“5 die Numismatik vor Eckhel ihre Forschung durchgeführt habe. Eine ähnliche Rezeption besorgte Justi Winckelmann durch die Bemerkung, dass zu dessen Zeit kein ande-rer da gewesen sei, „der eine sachkundige Kritik der Kunstgeschichte zu schreiben im Stande gewesen wäre.“6
Ein weiteres rhetorisches Werkzeug für die Legitimation der eigenen Wissenschaft könnte aemulatio Linnæi genannt werden und zeigte sich in der Form eines ständig sich wiederholenden Hinweises auf Carl von Linné. Das numismatische System Eckhels wurde 1797 von Millin mit dem systema nathurae (1735) verglichen.7 Auch ein wissenschaftliches Kunstsystem habe den „modernen Ordnungssystemen na-turwissenschaftlicher Provenienz“8 zu entsprechen gehabt.
MECHEL
Es ist also kaum verwunderlich, dass Christian von Mechel, der 1767 Winckel-mann in Rom kennenlernte, von diesem grenzüberschreitenden Gedankengut be-einflusst war und als Illustrator derartige Radierungen anfertigte (Abb. 1). Derselbe vor-darwinistische Geist, der in diesen Radierungen deutlich wird, durchdrang be-greiflicherweise auch seine innovative kuratoriale Tätigkeit im Belvedere. Das von Mechel eingeführte Novum, das eigentlich schon in Düsseldorf (1778) sichtbar war, wurde in Wien noch deutlicher. Direkt (den damaligen Direktor Josef Rosa umge-hend) von Maria Theresia beauftragt, schuf Mechel eine Systematisierung9, die ihre Verschwägerungen mit den Taxonomien der Botanik und dem Evolutionsgedanken der Biologie nicht verschleierte.
Vor Mechel galt das sog. barocke Modell10, nach welchem Axialität und Symme-trie der Hängung an vollbedeckten Wänden herrschten. Gemälde konnten früher kaum einzeln betrachtet werden; ihre Gesamtheit hatte dem selbstrepräsentati-ven Bedürfnis des Kaiserhauses zu dienen, und dafür scheute man sich nicht da-vor, sogar die Bilder dem gewünschten Format anzupassen. Nicht nur Experten, sondern auch das Publikum11 fing um die Mitte des 18. Jahrhunderts an, diese
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________2 Folgende tabellarische Darstellung ist aus Kenner 1871 und Lhotsky 1941–1945 zusammen-
gefasst.3 Kenner 1871, S. 18.4 „[W]enigstens zwei Male in der Woche im Münzkabinett ausführliche Erläuterungen für die
Münzfreunde zu geben“ (Lhotsky 1941–1945, S. 461). Vgl. Stichwort: Zugänglichkeit und Gemeinnutzen des modernen Museums.
ECKHEL
Gegenüber dem Leser dieser fachspezifischen Publikation brauche ich über das eckhelsche System nicht viele Worte zu verlieren.2
1772 Direktor der Münzsammlung der Jesuiten (Wien)1772–1774 Aufenthalt in Italien und Mitarbeit u. a. bei Cocchi (Firenze)1774 „director zur besorgung der alten münzen“ (Wien)1775 Numi veteres anecdoti1775 Lehrkanzel „der Altertümer und der historischen Hilfsmittel“1779 Catalogus Musei Cæsarei Vindobonensis numorum veterum1786 Kurzgefaßte Anfangsgründe zur alten Numismatik1792–1798 Doctrina Numorum Veterum
Das System Eckhels ist bereits in den späten 60er Jahre des 18. Jahrhunderts ent-standen, „als er die Sammlungen Wiczay, Festetics und Medidi ordnete.“3 Sein Sys-tem baute er ab 1772 im Rahmen seiner Tätigkeit als Direktor der Münzsammlung der Jesuiten und im Rahmen eines italienischen Studienaufenthaltes auf, während dessen Eckhel Kontakt mit Cocchi – dem Direktor des Münzkabinetts von Florenz – aufnahm. Nach diesen Erfahrungen und der Aufhebung des Jesuitenordens (1773) kehrte Eckhel 1774 nach Wien zurück und ließ die Numi veteres anecdoti ... veröf-fentlichen. Im Zuge seiner musealen Beschäftigung verpflichtete sich Eckhel, ge-gen eine monatliche Belohnung in Höhe von 600 Gulden, u. a. zwei Mal pro Woche den Besuchern die Sammlung offen zu halten.4 In dieser Zeit begann Eckhel, den Catalogus Musei Cæsarei Vindobonensis numorum veterum zusammenzustellen. Hier ist erstmals eine Geschichte der Sammlung enthalten. Spätestens 1786 (in: Kurzgefasste Anfangsgründe zur alten Numismatik) sind deutliche Anzeichen des neuen Systems zu sehen, das wohl aber erst in der Doctrina Numorum Veterum voll zum Ausdruck kommt.
ALLGEMEINE MYTHISCHE WISSENSCHAFTSGRÜNDUNG
Es gibt ein rhetorisches Repertoire, auf dessen Grundlage der Mythos der Wissen-schaftlichkeit konstruiert wird, und dieses Repertoire ist bei allen Wissenschaften ähnlich. Die erstaunte Feststellung, dass es vor dem ‚Advent‘ eines Disziplingründers an Systematik fehlte, einigt z. B. (nicht nur) Geld- und Kunstgeschichte. Schon bei der
34
Emanuele Sbardella
__________13 Siehe Lhotsky 1941–1945, S. 464.14 Eckhel am 13. Januar in Enzesfeld; Mechel am 4. April in Basel.15 Siehe Hegel 1842, insb. Buch I, Kap. II. Wissenschaftliche Behandlungsarten des Schönen
und der Kunst.16 Brief von Stendhal an Denon, 27. Oktober 1810, zit. nach Savoy 2013, S. 407.
ECKHEL UND MECHEL
Zu diesem Zweck wählte Mechel ca. ein Drittel der über 3.000 ihm zur Verfügung stehenden Gemälde aus: nicht einmal die schönsten, sondern die kunsthistorisch bedeutendsten. Auch Eckhel traf eine Vorauswahl der Münzen, wobei seine Ent-scheidungen indes drastischer ausfielen, sodass einige ausgeschiedene Stücke zum Einschmelzen13 geschickt wurden. Zusammenfassend: das, was Mechel und Eckhel vereint, ist nicht nur das Geburts-jahr (1737)14, sondern die geteilte Absicht, die Anordnung der jeweiligen Samm-lungen sowohl von rein subjektiven (ästhetischen), als auch von trivial objektiven (physikalischen) Kriterien zu lösen.Die Gemälde wurden von Mechel nicht nach passenden Formen und Farben aufge-stellt, sondern mit Informationstafeln versehen und auf der Grundlage einer histori-schen und theoretischen Struktur geordnet. In ähnlicher Weise wurden Münzen von Eckhel nicht nach Metall, Gewicht oder Größe der einzelnen Stücke organisiert, son-dern als Vertreter unterschiedlicher Orte und Epochen einer Geschichte bedacht. In beiden Fällen ging die Neuorganisation der Sammlung gewissermaßen über die einzelnen Stücke hinweg und wurden somit praktisch die Voraussetzungen vorweg erfüllt, die Hegel 40 Jahre später in seinen Vorlesungen über die Ästhetik (1835–1838) als erforderliche Bedingungen für eine „wissenschaftlichen Behandlung der Kunst“15 gestellt hat, und zwar die dialektische Kombination zwischen einer empiri-schen und einer eher spekulativen Betrachtungsweise.
INVENTAIRE NAPOLÉON UND DIE ADMINISTRATIVE SCHÖNHEIT
Beide Werke (Eckhels und Mechels) wurden unmittelbar von den meisten Experten und Museumsdirektoren aufgenommen. Das Modell Mechels fand z. B. auch im Louvre, der 1803 in Musée Napoléon umbenannt wurde, Verwendung. Dort ergab sich ein merkwürdiger Vorfall.Nach gesetzlicher Verfügung des Französischen Senats von Januar 1810 wur-de das Musée Napoléon dazu aufgefordert, die kaum überschaubare Menge von Kunstwerken zu inventarisieren, die seit der révolution europaweit geplündert und zum nationalen Eigentum ernannt worden waren. Noch im Oktober desselben Jah-res hatte man mit den Inventarisierungsarbeiten nicht begonnen. Daher nahm der unter dem Pseudonym Stendhal bekannte Schriftsteller und Politiker Marie-Henri Beyle Kontakt zu Direktor Denon auf, um ihm das Modell eines Protokolls vorzule-gen, anhand dessen „innerhalb einer einzigen Zeile jedes beliebige Gemälde, wie schön es auch ist, beschrieben werden könne, sogar die Transfiguration. Unsere Arbeit wird zwar keine pittoreske Schönheit aufweisen, dafür aber die administrati-ve Schönheit: Klarheit und Knappheit“16
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________12 Mechel 1783, S. xi.
Abb. 1: Links: Zwölf Stufen in der Reihenfolge vom Kopf eines Frosches zum Kopf eines primiti-ven Menschen.
Rechts: Zwölf Stufen in der Reihenfolge vm Kopf eines primitiven Menschen zum Kopf des Apollo von Belvedere.
Kolorierte Radierungen von Christian von Mechel, nach Lavater 1797.
Herangehensweise zu kritisieren und eine kunsthistorische Behandlung der Be-stände zu beanspruchen. Ein Verdienst Mechels ist es gewesen, dieser neuen Sen-sibilität entsprochen und das interwissenschaftliche Gedankengut in die museale Praxis durchgesetzt zu haben.Die Aktivität von Mechel begann im Erscheinungsjahr des Catalogus Musei Vin- dobonensis (1779) und dauerte 20 Monate an. Gleichzeitig verfasste Mechel den Katalog, der im November 1782 fertiggeschrieben und im Jahre 1783 veröffentlicht wurde. Im Vorwort dazu wird die Absicht erklärt, durch die Ausstellung eine „sicht-bare Geschichte der Kunst“ anzubieten.12 Kunst muss so aufgestellt werden, dass der Besucher in die Lage versetzt wird, die Geschichte zu lernen.
35
Emanuele Sbardella
__________13 Siehe Lhotsky 1941–1945, S. 464.14 Eckhel am 13. Januar in Enzesfeld; Mechel am 4. April in Basel.15 Siehe Hegel 1842, insb. Buch I, Kap. II. Wissenschaftliche Behandlungsarten des Schönen
und der Kunst.16 Brief von Stendhal an Denon, 27. Oktober 1810, zit. nach Savoy 2013, S. 407.
ECKHEL UND MECHEL
Zu diesem Zweck wählte Mechel ca. ein Drittel der über 3.000 ihm zur Verfügung stehenden Gemälde aus: nicht einmal die schönsten, sondern die kunsthistorisch bedeutendsten. Auch Eckhel traf eine Vorauswahl der Münzen, wobei seine Ent-scheidungen indes drastischer ausfielen, sodass einige ausgeschiedene Stücke zum Einschmelzen13 geschickt wurden. Zusammenfassend: das, was Mechel und Eckhel vereint, ist nicht nur das Geburts-jahr (1737)14, sondern die geteilte Absicht, die Anordnung der jeweiligen Samm-lungen sowohl von rein subjektiven (ästhetischen), als auch von trivial objektiven (physikalischen) Kriterien zu lösen.Die Gemälde wurden von Mechel nicht nach passenden Formen und Farben aufge-stellt, sondern mit Informationstafeln versehen und auf der Grundlage einer histori-schen und theoretischen Struktur geordnet. In ähnlicher Weise wurden Münzen von Eckhel nicht nach Metall, Gewicht oder Größe der einzelnen Stücke organisiert, son-dern als Vertreter unterschiedlicher Orte und Epochen einer Geschichte bedacht. In beiden Fällen ging die Neuorganisation der Sammlung gewissermaßen über die einzelnen Stücke hinweg und wurden somit praktisch die Voraussetzungen vorweg erfüllt, die Hegel 40 Jahre später in seinen Vorlesungen über die Ästhetik (1835–1838) als erforderliche Bedingungen für eine „wissenschaftlichen Behandlung der Kunst“15 gestellt hat, und zwar die dialektische Kombination zwischen einer empiri-schen und einer eher spekulativen Betrachtungsweise.
INVENTAIRE NAPOLÉON UND DIE ADMINISTRATIVE SCHÖNHEIT
Beide Werke (Eckhels und Mechels) wurden unmittelbar von den meisten Experten und Museumsdirektoren aufgenommen. Das Modell Mechels fand z. B. auch im Louvre, der 1803 in Musée Napoléon umbenannt wurde, Verwendung. Dort ergab sich ein merkwürdiger Vorfall.Nach gesetzlicher Verfügung des Französischen Senats von Januar 1810 wur-de das Musée Napoléon dazu aufgefordert, die kaum überschaubare Menge von Kunstwerken zu inventarisieren, die seit der révolution europaweit geplündert und zum nationalen Eigentum ernannt worden waren. Noch im Oktober desselben Jah-res hatte man mit den Inventarisierungsarbeiten nicht begonnen. Daher nahm der unter dem Pseudonym Stendhal bekannte Schriftsteller und Politiker Marie-Henri Beyle Kontakt zu Direktor Denon auf, um ihm das Modell eines Protokolls vorzule-gen, anhand dessen „innerhalb einer einzigen Zeile jedes beliebige Gemälde, wie schön es auch ist, beschrieben werden könne, sogar die Transfiguration. Unsere Arbeit wird zwar keine pittoreske Schönheit aufweisen, dafür aber die administrati-ve Schönheit: Klarheit und Knappheit“16
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________12 Mechel 1783, S. xi.
Abb. 1: Links: Zwölf Stufen in der Reihenfolge vom Kopf eines Frosches zum Kopf eines primiti-ven Menschen.
Rechts: Zwölf Stufen in der Reihenfolge vm Kopf eines primitiven Menschen zum Kopf des Apollo von Belvedere.
Kolorierte Radierungen von Christian von Mechel, nach Lavater 1797.
Herangehensweise zu kritisieren und eine kunsthistorische Behandlung der Be-stände zu beanspruchen. Ein Verdienst Mechels ist es gewesen, dieser neuen Sen-sibilität entsprochen und das interwissenschaftliche Gedankengut in die museale Praxis durchgesetzt zu haben.Die Aktivität von Mechel begann im Erscheinungsjahr des Catalogus Musei Vin- dobonensis (1779) und dauerte 20 Monate an. Gleichzeitig verfasste Mechel den Katalog, der im November 1782 fertiggeschrieben und im Jahre 1783 veröffentlicht wurde. Im Vorwort dazu wird die Absicht erklärt, durch die Ausstellung eine „sicht-bare Geschichte der Kunst“ anzubieten.12 Kunst muss so aufgestellt werden, dass der Besucher in die Lage versetzt wird, die Geschichte zu lernen.
36
Emanuele Sbardella
__________20 Diese von Savoy gestellte Kondition, im musealen Besitz, der Gegenstandsbeschränkung, ist
ja nicht unproblematisch, da Museen in modernem Sinne gerade dabei waren, zu entstehen. Erst wenn man auch vormoderne Formen von Museen beobachtet, kann die Neuartigkeit des betrachteten Phänomens aus dem Hintergrund seiner longue durée hervortreten.
21 Savoy 2013, S. 409. 22 Siehe Denucé 1932. Wenn man die vom Denucé wiedergegebenen Inventare durchliest, fällt
einem auf, dass die allerersten keine Preisangaben aufweisen, auch nicht wenn sie notarielle Protokolle sind. Das erste mit Wertangabe versehene Inventar aus dem flämischen Raum scheint Nr. 14 zu sein, von einem gewissen Nicolaes Cornelis Cheeus, datiert: „IIII Maij 1622“ (Denucé 1932, S. 29). Dann Nr. 118 von Jan-Baptista Anthoine, Protokoll 1697: „Nr. 1 Een stuxcken naecte vrouwkens op copere platien van Breugel ende van Baelen gewerdeert f. 100.“
23 Über das sog. Inventario di Lorenzo siehe Müntz 1888 und Spallanzani/Bertelà 1992. In diesem Inventar werden folgende Maße und Münzsorten benutzt:
Währung1 fiorino 20 soldi1 soldo 12 denari
Das Verhältnis zwischen Fiorino und Lira war nicht stabil. Nur in drei Fällen (z. B. Folio 114v) wird der geschätzte Wert sowohl in fiorini als auch in lire angegeben. Daraus lässt sich auf das Verhältnis schliessen: 1 fiorino = 6,25 bis 6,6 Lire.
Länge (1 canna = 4 braccia = 80 soldi = 960 denari)1 canna 4 braccia 2,33 m (ca.)1 braccio 20 soldi 0,583 m (ca.)1 soldo 12 denari 0,029 m (ca.) Gewicht1 libbra 12 once 339,54 g1 oncia 24 denari 28,29 g1 denaro 24 grani 1,17 g1 carato 4 grani 0,19 g
Die Mehrheit der Objekte wird auch monetarisch geschätzt, und zwar in fiorini (und ihren Un-tereinheiten: manchmal werden soldi, sehr selten denari genannt – nur für einige Perlen wird der Wert in venezianischen Dukaten angegeben; einmal wird der minderwertigere fiorino del sugello genannt, der wohl außer Kurs geraten war, doch manchmal als Zahlungseinheit blieb) und lire di piccoli. Die Wertzahl ist schon in indisch-arabischen Zahlen angegeben! Auffallend ist außerdem, dass numismatische Objekte erst in Folio 23v und 28v genannt werden und keine wirtschaftliche Schätzung haben!Auf Folio 23v befindet sich:
Una medaglia sciolta, d’oro, schulto la testa di Cosimo f. 12Un altro vaso d’oro di san Lodovico Pisano, once 1 denari 12
Die Nennung eines konkreten Geldwertes für Kunstwerke in musealem Besitz20 ist laut Savoy „völlig neu“21, und darin sei der Wert einer Kunstsammlung sowohl als symbolisches als auch als finanzielles Kapital erstmalig sichtbar gemacht worden. So würde sich nicht nur der damalige Geschmack durch diese Preise eindeutig rekonstruieren lassen; darüber hinaus hatten diese Preisangaben dem Museum seinen Wert auch gegenüber den Nicht-Kunstinteressierten bescheinigen können. Betrachtet man jedoch einige Inventare von Kunstsammlungen in Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert22 oder gar das sog. Inventario di Lorenzo23 (1494), so wird
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________17 Darunter ca. 4.400 Gemälde. Münzen bzw. Medaillen werden nicht genannt, sind aber ver-
mutlich in der letzten Kategorie allgemeiner Kunstgegenstände enthalten.18 „[…] angesichts der Währungsvielfalt in Europa und der um 1810 in Frankreich immer noch
herrschenden Konkurrenz vieler verschiedener Währungen retrospektiv als Segen angese-hen werden“ (Savoy 2013, S. 409).
19 Savoy 2013, S. 407.
Das erst 1813 angefertigte Inventar verzeichnete über 13.000 Objekte17 in insge-samt 17 Foliobänden und weist einige wirklich beachtenswerte Besonderheiten auf. Hier sei die Aufmerksamkeit auf zwei Spalten gelenkt, die zur neuartig standardi-sierten Erfassung der Objekte beitragen: Dimensions und Prix (Abb. 2). Seit Kurzem (1790/1795) hatte die Assemblée Nationale das Mètre als offizielle Maßeinheit ein-geführt, wobei früher jede Region Europas unterschiedliche Maßeinheiten (manch-mal je nach Gütern) in Anwendung gebracht hatte. Das metrische Einheitensystem führte also zu einer beachtlichen Vereinheitlichung, die für die Weiterentwicklung der Wissenschaften, der Technik und des internationalen Handels von unschätzba-rer Bedeutung gewesen ist. Eine ähnliche und gleichbedeutend vereinheitlichende Funktion lässt sich aus der Prix-Spalte entnehmen, wo die in Francs erfolgten Preis- angaben (fast als „Segen“18) der Währungsvielfalt entgegenwirkten. Dies hänge nicht nur von der Entwicklung des Kunstmarkts ab, sondern eher mit dem staatlich, international verbreiteten Verlangen nach Vergleichbarkeit.19
Abb. 2: Inventaire Napoléon. Paris, AMN, 1 DD 17, Inventaire général du musée Napoléon 1810, fol. 281.
37
Emanuele Sbardella
__________20 Diese von Savoy gestellte Kondition, im musealen Besitz, der Gegenstandsbeschränkung, ist
ja nicht unproblematisch, da Museen in modernem Sinne gerade dabei waren, zu entstehen. Erst wenn man auch vormoderne Formen von Museen beobachtet, kann die Neuartigkeit des betrachteten Phänomens aus dem Hintergrund seiner longue durée hervortreten.
21 Savoy 2013, S. 409. 22 Siehe Denucé 1932. Wenn man die vom Denucé wiedergegebenen Inventare durchliest, fällt
einem auf, dass die allerersten keine Preisangaben aufweisen, auch nicht wenn sie notarielle Protokolle sind. Das erste mit Wertangabe versehene Inventar aus dem flämischen Raum scheint Nr. 14 zu sein, von einem gewissen Nicolaes Cornelis Cheeus, datiert: „IIII Maij 1622“ (Denucé 1932, S. 29). Dann Nr. 118 von Jan-Baptista Anthoine, Protokoll 1697: „Nr. 1 Een stuxcken naecte vrouwkens op copere platien van Breugel ende van Baelen gewerdeert f. 100.“
23 Über das sog. Inventario di Lorenzo siehe Müntz 1888 und Spallanzani/Bertelà 1992. In diesem Inventar werden folgende Maße und Münzsorten benutzt:
Währung1 fiorino 20 soldi1 soldo 12 denari
Das Verhältnis zwischen Fiorino und Lira war nicht stabil. Nur in drei Fällen (z. B. Folio 114v) wird der geschätzte Wert sowohl in fiorini als auch in lire angegeben. Daraus lässt sich auf das Verhältnis schliessen: 1 fiorino = 6,25 bis 6,6 Lire.
Länge (1 canna = 4 braccia = 80 soldi = 960 denari)1 canna 4 braccia 2,33 m (ca.)1 braccio 20 soldi 0,583 m (ca.)1 soldo 12 denari 0,029 m (ca.) Gewicht1 libbra 12 once 339,54 g1 oncia 24 denari 28,29 g1 denaro 24 grani 1,17 g1 carato 4 grani 0,19 g
Die Mehrheit der Objekte wird auch monetarisch geschätzt, und zwar in fiorini (und ihren Un-tereinheiten: manchmal werden soldi, sehr selten denari genannt – nur für einige Perlen wird der Wert in venezianischen Dukaten angegeben; einmal wird der minderwertigere fiorino del sugello genannt, der wohl außer Kurs geraten war, doch manchmal als Zahlungseinheit blieb) und lire di piccoli. Die Wertzahl ist schon in indisch-arabischen Zahlen angegeben! Auffallend ist außerdem, dass numismatische Objekte erst in Folio 23v und 28v genannt werden und keine wirtschaftliche Schätzung haben!Auf Folio 23v befindet sich:
Una medaglia sciolta, d’oro, schulto la testa di Cosimo f. 12Un altro vaso d’oro di san Lodovico Pisano, once 1 denari 12
Die Nennung eines konkreten Geldwertes für Kunstwerke in musealem Besitz20 ist laut Savoy „völlig neu“21, und darin sei der Wert einer Kunstsammlung sowohl als symbolisches als auch als finanzielles Kapital erstmalig sichtbar gemacht worden. So würde sich nicht nur der damalige Geschmack durch diese Preise eindeutig rekonstruieren lassen; darüber hinaus hatten diese Preisangaben dem Museum seinen Wert auch gegenüber den Nicht-Kunstinteressierten bescheinigen können. Betrachtet man jedoch einige Inventare von Kunstsammlungen in Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert22 oder gar das sog. Inventario di Lorenzo23 (1494), so wird
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________17 Darunter ca. 4.400 Gemälde. Münzen bzw. Medaillen werden nicht genannt, sind aber ver-
mutlich in der letzten Kategorie allgemeiner Kunstgegenstände enthalten.18 „[…] angesichts der Währungsvielfalt in Europa und der um 1810 in Frankreich immer noch
herrschenden Konkurrenz vieler verschiedener Währungen retrospektiv als Segen angese-hen werden“ (Savoy 2013, S. 409).
19 Savoy 2013, S. 407.
Das erst 1813 angefertigte Inventar verzeichnete über 13.000 Objekte17 in insge-samt 17 Foliobänden und weist einige wirklich beachtenswerte Besonderheiten auf. Hier sei die Aufmerksamkeit auf zwei Spalten gelenkt, die zur neuartig standardi-sierten Erfassung der Objekte beitragen: Dimensions und Prix (Abb. 2). Seit Kurzem (1790/1795) hatte die Assemblée Nationale das Mètre als offizielle Maßeinheit ein-geführt, wobei früher jede Region Europas unterschiedliche Maßeinheiten (manch-mal je nach Gütern) in Anwendung gebracht hatte. Das metrische Einheitensystem führte also zu einer beachtlichen Vereinheitlichung, die für die Weiterentwicklung der Wissenschaften, der Technik und des internationalen Handels von unschätzba-rer Bedeutung gewesen ist. Eine ähnliche und gleichbedeutend vereinheitlichende Funktion lässt sich aus der Prix-Spalte entnehmen, wo die in Francs erfolgten Preis- angaben (fast als „Segen“18) der Währungsvielfalt entgegenwirkten. Dies hänge nicht nur von der Entwicklung des Kunstmarkts ab, sondern eher mit dem staatlich, international verbreiteten Verlangen nach Vergleichbarkeit.19
Abb. 2: Inventaire Napoléon. Paris, AMN, 1 DD 17, Inventaire général du musée Napoléon 1810, fol. 281.
38
Emanuele Sbardella
WERTMESSER-FUNKTION DES GELDES UND KOMPUTATIONELLE TRADITION DER NUMISMATIK Nicht sämtliche Geldfunktionen einer Münze brauchen in Vergessenheit zu geraten, damit sie historisiert und zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Münzkunde werden kann. Nach meiner Auffassung ist es dagegen gerade eine Art von „Erinne-rung“ an die gewesene Wertmesser-Funktion, welche die Wege zur numismati-schen Wissenschaftlichkeit insofern ebnet, als dadurch die konkrete Bemessung und die abstrakte Katalogisierung erleichtert werden.Daher lassen sich die Preisangaben im Inventaire Napoléon als eine nachträgli-che, im kunsthistorischen Bereich verbliebene, Spur der Verwissenschaftlichung auslegen, wozu die Numismatik aufgrund der Beschaffenheit ihres Gegenstandes großenteils beigetragen hatte.Selbst wenn Münzen ursprünglich lediglich aufgrund einer zelebrativen Memo-ria-Funktion der Machtinhaber (man bedenke einen Andrea Fulvio oder einen Jacopo Strada)26 und einer Faszination für das Exotische in cabinets des curio-sités gesammelt wurden, wandten sich numismatische Sammlungen bald an ein eher ausgewähltes Publikum zum Forschungs- und Lehrzweck. Das Sammeln von Münzen baute sich, schneller als das Sammeln von anderen Kunstwerken, ein theoretisches Konstrukt abstrakter Ordnung auf, in das sich die empirischen Einzelbeobachtungen zusammenfügen ließen. Ein Grund dafür, dass diese Wis-senschaftlichkeit zuerst im numismatischen Bereich ihre Wurzel schlug, scheint mir darin zu liegen, dass sich jene komputationelle Tradition gerade anhand von Mün-zen und Jetonen entwickelte. Die komputationelle Tradition der Algebra entstand ausgerechnet unter Anwendung von später als numismatisch begriffenen Objekten (aufgrung ihrer Eigenschaft als mentale Operatoren) und floss demnach zuerst in die Münzkunde, danach in die Kunstwissenschaft ein.
ALGEBRA UND NUMISMATISCHE WISSENSCHAFTLICHKEIT
Es gibt so etwas wie eine komputationelle Tradition, welche die Wissenschaftlich-keit der Numismatik prägt und auf das Liber Abaci Fibonaccis (1202) und die Sum-ma de Arithmetica Paciolis (1494) zurückgeht, zwei grundlegende mathematische Traktate, die meines Wissens im numismatischen Bereich noch nicht mit gebüh-render Sorgfalt ausgelegt worden sind. Sie könnten nicht nur als Quelle (wegen der Hinweise auf verschiedene Münzsorten, auf ihre Wertverhältnisse und Kaufkraft) herangezogen werden. Wie sich schon ihrer ähnlichen Inhaltsstruktur ablesen lässt, bestehen diese Bü-cher aus einem rein algebraischen und aus einem praktischen Teil angewandter Mathematik. Hier gilt es festzustellen, dass nicht nur in den an Kaufleute gerichte-ten Teilen angewandter Mathematik, sondern am wesentlichsten auch in den rein algebraischen Überlegungen Münzen fast als Eponyme der Zahlen benutzt und verstanden werden. __________26 Siehe Helmrath 2009, passim.
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________23f 28v
Dugento 84 medaglie d’ariento, pesono lib. Ii once 7 denari xii Dugento monete di più ragioni, pesono lib. Una once 3 Uno bossolo di porfino senza coperchio e senza fondo, sottile,
diamitro br. 1/3 et alto br. ¼, pulito f. 10Milleottocentoquarantaquattro medaglie di bromzo f. -Una chassetta d’osso con freg[i]atura di più colori, a uso di chalamaio f. 1Una chassetta da bilancie die tarsie con diamante f. -Un’altra cassenna da bilancie, lavorata con osso f. -
24 Einige im Inventario di Lorenzo geschätzte Künstler: Beato Angelico, Giotto und Filippo Lippi; z. B. auf Folio 16v: „Uno quadro chon chornicie messe d’oro, dipintovi uno sancto Girolamo et uno sancto Francesco, di mano di Pesello e fra‘ Filippo – f. 10.
Una tavoletta, dipintovi il Nostro Signore crucifix chon 3 figure di mano di Giotto – f. 6”.25 Sobald sich ein Gemälde in einem Museum befindet, ist dieses Gemälde keine am freien
Markt mehr erhältliche Ware. Dies gilt natürlich auch für eine Münze in einem öffentlichen Münzkabinett, und zwar mit einem scheinbar unbedeutenden, doch ausschlaggebenden Un-terschied. Für eine Münze, im Vergleich zu einem Gemälde, ist es bei der Musealisation zumindest das zweite Mal, dass es zu einem radikalen Wechsel im Bewertungsparadigma kommt.
Bevor eine Münze auf den Sammlermarkt kommt, verfügt sie über einen Nominalwert und eine damit mehr oder weniger fest verbundene Kaufkraft (Zahlungsmittelfunktion). Diese Funktion, die eine Münze gehabt haben muss, endete in dem Moment, in dem sie Teil einer Sammlung wird, da sie außer Kurs gesetzt wird. Nachdem die Münze ihren Nominalwert ver-loren hat, verlor sie bei der Musealisation praktisch auch ihren verhandelbaren Sammlerwert und erhielt einen denkmalpflegerischen Wert, der fester ist, aber auch unaustauschbar.
ersichtlich, dass solche monetären Bemessungen von Meisterwerken24 nicht völlig neu waren, doch neuartig. Das, was im sog. Inventaire Napoléon wirklich erstaunt, ist also nicht die Preisan-gabe an sich, sondern die Beschaffenheit dieser „Preise“. Um die Eigenart dieses Inventars richtig begreifen zu können, muss es – wie ich es glaube – angenom-men werden, dass die darin enthaltenen Preisangaben keinem echten Kapitalwert entsprechen. Dass das öffentliche Museum seinen Kunstwerken einen Preis gibt, muss nicht mit sich bringen, dass das Museum seine Kunstwerke dem Markt preis-gibt. Ganz im Gegenteil soll, neben dem sog. Prinzip der Unveräußerlichkeit,25 auch bedacht werden, dass ein echter Kapitalwert auf Marktschwankungen und auf die Inflation angewiesen wäre; ein Inventar, wie es das Inventaire Napoléon ist, ist sicherlich nicht dazu gedacht, ständig je nach solchen Veränderungen aktualisiert zu werden. Ich gehe davon aus, dass es beim Inventaire Napoléon, das – beiläufig bemerkt – wenige Jahre nach der Einführung von Assignaten und Bankozetteln abgefasst worden ist, um keine realen Marktpreise geht. Die von 1 bis 1.500.000 Francs reichenden Preisangaben sind eher ein Maßstab, der auf die offizielle Wäh-rung nur konventionell oder, besser gesagt, normativ hinwies. Lediglich wegen ihrer Wertmesser-Funktion wurden Francs herangezogen. Die Frage lautet also nicht: Wozu die Spalte Preis im Inventaire Napoléon?, son-dern Warum wird Geld, aller seiner anderen Funktionen entblößt, noch als Wert-messer herangezogen?
39
Emanuele Sbardella
WERTMESSER-FUNKTION DES GELDES UND KOMPUTATIONELLE TRADITION DER NUMISMATIK Nicht sämtliche Geldfunktionen einer Münze brauchen in Vergessenheit zu geraten, damit sie historisiert und zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Münzkunde werden kann. Nach meiner Auffassung ist es dagegen gerade eine Art von „Erinne-rung“ an die gewesene Wertmesser-Funktion, welche die Wege zur numismati-schen Wissenschaftlichkeit insofern ebnet, als dadurch die konkrete Bemessung und die abstrakte Katalogisierung erleichtert werden.Daher lassen sich die Preisangaben im Inventaire Napoléon als eine nachträgli-che, im kunsthistorischen Bereich verbliebene, Spur der Verwissenschaftlichung auslegen, wozu die Numismatik aufgrund der Beschaffenheit ihres Gegenstandes großenteils beigetragen hatte.Selbst wenn Münzen ursprünglich lediglich aufgrund einer zelebrativen Memo-ria-Funktion der Machtinhaber (man bedenke einen Andrea Fulvio oder einen Jacopo Strada)26 und einer Faszination für das Exotische in cabinets des curio-sités gesammelt wurden, wandten sich numismatische Sammlungen bald an ein eher ausgewähltes Publikum zum Forschungs- und Lehrzweck. Das Sammeln von Münzen baute sich, schneller als das Sammeln von anderen Kunstwerken, ein theoretisches Konstrukt abstrakter Ordnung auf, in das sich die empirischen Einzelbeobachtungen zusammenfügen ließen. Ein Grund dafür, dass diese Wis-senschaftlichkeit zuerst im numismatischen Bereich ihre Wurzel schlug, scheint mir darin zu liegen, dass sich jene komputationelle Tradition gerade anhand von Mün-zen und Jetonen entwickelte. Die komputationelle Tradition der Algebra entstand ausgerechnet unter Anwendung von später als numismatisch begriffenen Objekten (aufgrung ihrer Eigenschaft als mentale Operatoren) und floss demnach zuerst in die Münzkunde, danach in die Kunstwissenschaft ein.
ALGEBRA UND NUMISMATISCHE WISSENSCHAFTLICHKEIT
Es gibt so etwas wie eine komputationelle Tradition, welche die Wissenschaftlich-keit der Numismatik prägt und auf das Liber Abaci Fibonaccis (1202) und die Sum-ma de Arithmetica Paciolis (1494) zurückgeht, zwei grundlegende mathematische Traktate, die meines Wissens im numismatischen Bereich noch nicht mit gebüh-render Sorgfalt ausgelegt worden sind. Sie könnten nicht nur als Quelle (wegen der Hinweise auf verschiedene Münzsorten, auf ihre Wertverhältnisse und Kaufkraft) herangezogen werden. Wie sich schon ihrer ähnlichen Inhaltsstruktur ablesen lässt, bestehen diese Bü-cher aus einem rein algebraischen und aus einem praktischen Teil angewandter Mathematik. Hier gilt es festzustellen, dass nicht nur in den an Kaufleute gerichte-ten Teilen angewandter Mathematik, sondern am wesentlichsten auch in den rein algebraischen Überlegungen Münzen fast als Eponyme der Zahlen benutzt und verstanden werden. __________26 Siehe Helmrath 2009, passim.
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
__________23f 28v
Dugento 84 medaglie d’ariento, pesono lib. Ii once 7 denari xii Dugento monete di più ragioni, pesono lib. Una once 3 Uno bossolo di porfino senza coperchio e senza fondo, sottile,
diamitro br. 1/3 et alto br. ¼, pulito f. 10Milleottocentoquarantaquattro medaglie di bromzo f. -Una chassetta d’osso con freg[i]atura di più colori, a uso di chalamaio f. 1Una chassetta da bilancie die tarsie con diamante f. -Un’altra cassenna da bilancie, lavorata con osso f. -
24 Einige im Inventario di Lorenzo geschätzte Künstler: Beato Angelico, Giotto und Filippo Lippi; z. B. auf Folio 16v: „Uno quadro chon chornicie messe d’oro, dipintovi uno sancto Girolamo et uno sancto Francesco, di mano di Pesello e fra‘ Filippo – f. 10.
Una tavoletta, dipintovi il Nostro Signore crucifix chon 3 figure di mano di Giotto – f. 6”.25 Sobald sich ein Gemälde in einem Museum befindet, ist dieses Gemälde keine am freien
Markt mehr erhältliche Ware. Dies gilt natürlich auch für eine Münze in einem öffentlichen Münzkabinett, und zwar mit einem scheinbar unbedeutenden, doch ausschlaggebenden Un-terschied. Für eine Münze, im Vergleich zu einem Gemälde, ist es bei der Musealisation zumindest das zweite Mal, dass es zu einem radikalen Wechsel im Bewertungsparadigma kommt.
Bevor eine Münze auf den Sammlermarkt kommt, verfügt sie über einen Nominalwert und eine damit mehr oder weniger fest verbundene Kaufkraft (Zahlungsmittelfunktion). Diese Funktion, die eine Münze gehabt haben muss, endete in dem Moment, in dem sie Teil einer Sammlung wird, da sie außer Kurs gesetzt wird. Nachdem die Münze ihren Nominalwert ver-loren hat, verlor sie bei der Musealisation praktisch auch ihren verhandelbaren Sammlerwert und erhielt einen denkmalpflegerischen Wert, der fester ist, aber auch unaustauschbar.
ersichtlich, dass solche monetären Bemessungen von Meisterwerken24 nicht völlig neu waren, doch neuartig. Das, was im sog. Inventaire Napoléon wirklich erstaunt, ist also nicht die Preisan-gabe an sich, sondern die Beschaffenheit dieser „Preise“. Um die Eigenart dieses Inventars richtig begreifen zu können, muss es – wie ich es glaube – angenom-men werden, dass die darin enthaltenen Preisangaben keinem echten Kapitalwert entsprechen. Dass das öffentliche Museum seinen Kunstwerken einen Preis gibt, muss nicht mit sich bringen, dass das Museum seine Kunstwerke dem Markt preis-gibt. Ganz im Gegenteil soll, neben dem sog. Prinzip der Unveräußerlichkeit,25 auch bedacht werden, dass ein echter Kapitalwert auf Marktschwankungen und auf die Inflation angewiesen wäre; ein Inventar, wie es das Inventaire Napoléon ist, ist sicherlich nicht dazu gedacht, ständig je nach solchen Veränderungen aktualisiert zu werden. Ich gehe davon aus, dass es beim Inventaire Napoléon, das – beiläufig bemerkt – wenige Jahre nach der Einführung von Assignaten und Bankozetteln abgefasst worden ist, um keine realen Marktpreise geht. Die von 1 bis 1.500.000 Francs reichenden Preisangaben sind eher ein Maßstab, der auf die offizielle Wäh-rung nur konventionell oder, besser gesagt, normativ hinwies. Lediglich wegen ihrer Wertmesser-Funktion wurden Francs herangezogen. Die Frage lautet also nicht: Wozu die Spalte Preis im Inventaire Napoléon?, son-dern Warum wird Geld, aller seiner anderen Funktionen entblößt, noch als Wert-messer herangezogen?
40
Emanuele Sbardella
beziehen Kataloge algebraische Elemente (nämlich die figure – Zahlen, die Null, die Leere, res – das Unbekannte) ein.Das Unbekannte – res – wird neben dem Grundstock der herkömmlichen Samm-lung zum Bestandteil der modernen Sammlung. Sammelmünzen werden verhält-nismäßig leichter zu erfassen und zu organisieren, indem man in ihnen dieselben Eigenschaften der Zahlen hervorhebt, wie Pacioli ausdrücklich in seiner Definition von Nummer (Abb. 3) ausgeführt hat: „keine Zahl von einer anderen [qualitativ] un-terscheidet. Die Zahl ist eine Menge, die Vielzahl der Einheiten, wie die Dukaten.“32 Nach dieser abschließenden Überlegung kann ich die folgende Antwort auf die Fra-ge versuchen, die uns vom Inventaire Napoléon gestellt wurde, und gleichzeitig zum Fazit meiner Ausführungen über die numismatischen Wege zur Wissenschaft-lichkeit kommen.
Warum wird Geld, aller seiner anderen Funktionen entblößt, doch noch als Wert-messer herangezogen? Weil durch Preisangaben die Werte der Kunstwerke (wenn auch willkürlich und zuungunsten ihrer angeblichen Einzigartigkeit) eindeutig ge-messen und auf jene von allen leicht erkennbare Skala reduziert werden können, die sich in der Moderne als Generalnenner (so Simmel über das Geld33) durch-setzte. Die Prix-Spalte im Inventaire Napoléon steht als Spur des Prozesses da, durch welchen sich die Geld- und die Kunstgeschichte zur Wissenschaft konstruiert haben.
__________32 Von mir ins Deutsche summarisch übersetzt: „Die Nummer ist jeder Menge inhärent und
mit ihr gleichzeitig geboren worden. Wie auch von Boethius angegeben: Alles, was es gibt, existiert der Nummer wegen. Daraus folgt, dass sich keine Zahl von einer anderen [qualitativ] unterscheidet. Die Zahl ist eine Menge, die Vielzahl der Einheiten, wie die Dukaten, die sich nur durch ihre Vielzahl unterscheiden: der eine hat mehr, der andere weniger davon.“ (Pacioli 1494 [1523], Distinctio octava, Tractatus quartus, S. 144).
33 Siehe Simmel 1900.
Abb. 3: Folio 144r (Distinctio octava, Tractatus quintus) der Summa Paciolis, 1494 (1523).
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
Das Liber abaci führte das erste Mal indisch-arabische Zahlen (9 figure), die Null und die res (den Begriff von unbekanntem Betrag)27 ins Abendland ein.Fast drei Jahrhunderte später vollendete der Franziskaner Luca Pacioli durch sei-ne Summa (das erste mathematische Buch, das überhaupt gedruckt worden ist) das von Fibonacci angefangene Werk zur Bildung der algebraischen Methode (das Rechnen mit Buchstaben bzw. figure). Trotz des Erfolgs dieses Werkes brauchte das neue System noch einige Jahrzehn-te, um sich durchzusetzen. Beweis dafür sind auch die Rechenbücher zur Erklärung des Systems des Rechnens auf den Linien, das noch lange neben dem neueren System des Rechnens mit Federn parallel benutzt werden musste.28
Die Summa de Arithmeticha ist noch heute deswegen weltweit gepriesen, weil sie die kaufmännische Methode der Doppelten Buchhaltung erfand, die laut dem deut-schen Ökonomen und Soziologen Werner Sombart: „aus demselben Geist wie die Systeme Galileis und Newtons, wie die Lehren der modernen Physik und Chemie“29
stammt und die Goethe als „eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes“ bezeichnet hat.30 Ich glaube, man könne diese „schöne Erfindung“ als Stifter derjenigen „administrativen Schönheit“ ansehen, die nach Stendhal die mo-derne Katalogisierung prägte.Genauso wie beim Liber abaci finden sich solche praktischen Anweisungen in einem getrennten Buchteil, wo naturgemäß Geld eine große Rolle spielt. Auch hier aber erhalten Münzen schon in den rein mathematischen Kapiteln einen großen Belang. Kursierende Münzen werden in mentalen Experimenten etwa als Rechenpfennige verwendet, aufgrund ihrer gesellschaftlich anerkannten Wertmesser-Funktion. Die Algebra stützte sich in ihrer Jugend gerne auf Beispiele, die aus der wirtschaft-lichen Praxis herausgesucht werden; die Numismatik erhält dabei einen Impuls zur Wissenschaftlichkeit, und zwar durch die Anwendung der neuen Rechen- und Denkensart z. B. für metrologische Studien und für die Ordnung der Inventare. Die algebraische Komputation bringt die Numismatik zu einer Verallgemeinerung in der Einstellung zu einem eigenen Gegenständ. Ähnlich wie die indisch-arabi-schen Zahlen nicht mehr in analogischem oder ikonischem Zusammenhang zum Dargestellten stehen, so verzeichnen die Einträge eines Münzkatalogs nicht länger lediglich die Einzelstücke31 und ihre örtliche Herkunft bzw. Lokalisation, sondern
__________27 „Wenn du diese Regel auf unsere Aufgabe anwenden willst, so setze, der Zweite habe res
und die 7 Denare, die der Erste von ihm verlangt; und verstehe unter res einen unbekannten Betrag, den du finden willst“ (Gericke 1990, S. 99).
28 Adam Ries veröffentlichte 1518 die Rechenung auff der linihen und 5 Jahre später eine er-weiterte Auflage: Rechenung auff der linihen und mit federn (d. h. nicht mehr mit dem Abacus, sondern durch Zeichen – vgl. den Index bei Peirce 1986).
29 Sombart, zit. nach Hoffmann 1996, S. 14.30 Goethe über die Doppelte Buchführung Paciolis, zit. nach Hoffmann 1996, S. 14: Laut Pacioli
seien „hauptsächlich drei Dinge für den notwendig, der mit gebührenden Fleiß Handel treiben will: [erstens] das bare Geld; [zweitens,] daß man ein guter Rechner und geschickter Buch-halter sei; [und drittens,] daß man zum Schluß mit schöner Ordnung alle seine Geschäfte in gebührender Weise einträgt.“ (Pacioli, zit. nach Hoffmann 1996, S. 19).
31 Laut Radnoti-Alföldi 1989 stellten die ersten numismatischen Forscher nur Einzelobjekte in den Mittelpunkt. Im Laufe der Zeit vergrößerten sich die Sammlungen. Sie wurden öffentliche und staatliche Sammlungen.
41
Emanuele Sbardella
beziehen Kataloge algebraische Elemente (nämlich die figure – Zahlen, die Null, die Leere, res – das Unbekannte) ein.Das Unbekannte – res – wird neben dem Grundstock der herkömmlichen Samm-lung zum Bestandteil der modernen Sammlung. Sammelmünzen werden verhält-nismäßig leichter zu erfassen und zu organisieren, indem man in ihnen dieselben Eigenschaften der Zahlen hervorhebt, wie Pacioli ausdrücklich in seiner Definition von Nummer (Abb. 3) ausgeführt hat: „keine Zahl von einer anderen [qualitativ] un-terscheidet. Die Zahl ist eine Menge, die Vielzahl der Einheiten, wie die Dukaten.“32 Nach dieser abschließenden Überlegung kann ich die folgende Antwort auf die Fra-ge versuchen, die uns vom Inventaire Napoléon gestellt wurde, und gleichzeitig zum Fazit meiner Ausführungen über die numismatischen Wege zur Wissenschaft-lichkeit kommen.
Warum wird Geld, aller seiner anderen Funktionen entblößt, doch noch als Wert-messer herangezogen? Weil durch Preisangaben die Werte der Kunstwerke (wenn auch willkürlich und zuungunsten ihrer angeblichen Einzigartigkeit) eindeutig ge-messen und auf jene von allen leicht erkennbare Skala reduziert werden können, die sich in der Moderne als Generalnenner (so Simmel über das Geld33) durch-setzte. Die Prix-Spalte im Inventaire Napoléon steht als Spur des Prozesses da, durch welchen sich die Geld- und die Kunstgeschichte zur Wissenschaft konstruiert haben.
__________32 Von mir ins Deutsche summarisch übersetzt: „Die Nummer ist jeder Menge inhärent und
mit ihr gleichzeitig geboren worden. Wie auch von Boethius angegeben: Alles, was es gibt, existiert der Nummer wegen. Daraus folgt, dass sich keine Zahl von einer anderen [qualitativ] unterscheidet. Die Zahl ist eine Menge, die Vielzahl der Einheiten, wie die Dukaten, die sich nur durch ihre Vielzahl unterscheiden: der eine hat mehr, der andere weniger davon.“ (Pacioli 1494 [1523], Distinctio octava, Tractatus quartus, S. 144).
33 Siehe Simmel 1900.
Abb. 3: Folio 144r (Distinctio octava, Tractatus quintus) der Summa Paciolis, 1494 (1523).
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
Das Liber abaci führte das erste Mal indisch-arabische Zahlen (9 figure), die Null und die res (den Begriff von unbekanntem Betrag)27 ins Abendland ein.Fast drei Jahrhunderte später vollendete der Franziskaner Luca Pacioli durch sei-ne Summa (das erste mathematische Buch, das überhaupt gedruckt worden ist) das von Fibonacci angefangene Werk zur Bildung der algebraischen Methode (das Rechnen mit Buchstaben bzw. figure). Trotz des Erfolgs dieses Werkes brauchte das neue System noch einige Jahrzehn-te, um sich durchzusetzen. Beweis dafür sind auch die Rechenbücher zur Erklärung des Systems des Rechnens auf den Linien, das noch lange neben dem neueren System des Rechnens mit Federn parallel benutzt werden musste.28
Die Summa de Arithmeticha ist noch heute deswegen weltweit gepriesen, weil sie die kaufmännische Methode der Doppelten Buchhaltung erfand, die laut dem deut-schen Ökonomen und Soziologen Werner Sombart: „aus demselben Geist wie die Systeme Galileis und Newtons, wie die Lehren der modernen Physik und Chemie“29
stammt und die Goethe als „eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes“ bezeichnet hat.30 Ich glaube, man könne diese „schöne Erfindung“ als Stifter derjenigen „administrativen Schönheit“ ansehen, die nach Stendhal die mo-derne Katalogisierung prägte.Genauso wie beim Liber abaci finden sich solche praktischen Anweisungen in einem getrennten Buchteil, wo naturgemäß Geld eine große Rolle spielt. Auch hier aber erhalten Münzen schon in den rein mathematischen Kapiteln einen großen Belang. Kursierende Münzen werden in mentalen Experimenten etwa als Rechenpfennige verwendet, aufgrund ihrer gesellschaftlich anerkannten Wertmesser-Funktion. Die Algebra stützte sich in ihrer Jugend gerne auf Beispiele, die aus der wirtschaft-lichen Praxis herausgesucht werden; die Numismatik erhält dabei einen Impuls zur Wissenschaftlichkeit, und zwar durch die Anwendung der neuen Rechen- und Denkensart z. B. für metrologische Studien und für die Ordnung der Inventare. Die algebraische Komputation bringt die Numismatik zu einer Verallgemeinerung in der Einstellung zu einem eigenen Gegenständ. Ähnlich wie die indisch-arabi-schen Zahlen nicht mehr in analogischem oder ikonischem Zusammenhang zum Dargestellten stehen, so verzeichnen die Einträge eines Münzkatalogs nicht länger lediglich die Einzelstücke31 und ihre örtliche Herkunft bzw. Lokalisation, sondern
__________27 „Wenn du diese Regel auf unsere Aufgabe anwenden willst, so setze, der Zweite habe res
und die 7 Denare, die der Erste von ihm verlangt; und verstehe unter res einen unbekannten Betrag, den du finden willst“ (Gericke 1990, S. 99).
28 Adam Ries veröffentlichte 1518 die Rechenung auff der linihen und 5 Jahre später eine er-weiterte Auflage: Rechenung auff der linihen und mit federn (d. h. nicht mehr mit dem Abacus, sondern durch Zeichen – vgl. den Index bei Peirce 1986).
29 Sombart, zit. nach Hoffmann 1996, S. 14.30 Goethe über die Doppelte Buchführung Paciolis, zit. nach Hoffmann 1996, S. 14: Laut Pacioli
seien „hauptsächlich drei Dinge für den notwendig, der mit gebührenden Fleiß Handel treiben will: [erstens] das bare Geld; [zweitens,] daß man ein guter Rechner und geschickter Buch-halter sei; [und drittens,] daß man zum Schluß mit schöner Ordnung alle seine Geschäfte in gebührender Weise einträgt.“ (Pacioli, zit. nach Hoffmann 1996, S. 19).
31 Laut Radnoti-Alföldi 1989 stellten die ersten numismatischen Forscher nur Einzelobjekte in den Mittelpunkt. Im Laufe der Zeit vergrößerten sich die Sammlungen. Sie wurden öffentliche und staatliche Sammlungen.
42
Emanuele Sbardella
Peirce 1986 C. S. Peirce, Semiotische Schriften I., Frankfurt am Main 1986.
Radnoti-Alföldi 1989 M. Radnoti-Alföldi, Methoden der antiken Numismatik (Wege der Forschung 529), Darmstadt 1989.
Savoy 2006 B. Savoy, Zum Öffentlichkeitscharakter deutscher Museen im 18. Jahrhundert, in: B. Savoy (Hg.), Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815, Mainz am Rhein 2006, S. 1–22.
Savoy 2013 B. Savoy, „Unschätzbare Meisterwerke“. Der Preis der Kunst im Musée Napoléon, in: Swoboda 2013, S. 406-419.
Simmel 1900 G. Simmel, Philosophie des Geldes, Leipzig 1900.
Sombart 1911 W. Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911.
Spallanzani – Bertelà 1992 M. Spallanzani – G. G. Bertelà, Libro d‘inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, Fi-
renze 1992.
Swoboda 2013 G. Swoboda, Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Wien 2013.
Wegner 2005 R. Wegner, Kunst als Wissenschaft: Carl Ludwig Fernow – ein Begründer der Kunstge-schichte, Göttingen 2005.
Emanuele [email protected]
www.emanuelesbardella.es
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
AbbildungsnAchweis
Abb. 1: Wellcome Library, London, CC http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0030345.html (letzter Zugriff: 31.10.2014)
Abb. 2: B. Savoy 2013, S. 410, Abb. 2.Abb. 3: e-rara.ch. URL: http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/2683541 (letzter Zugriff: 31.10.2014)
bibliogrAphie
Denucé 1932 J. Denucé, Inventare von Kunstsammlungen zu Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert, Antwerpen 1932.
Döring 1838 H. Döring, Eckhel, in: J. S. Ersch u. a. (Hg.), Allgemeine Encyklopädie der Wissen-schaften und Künste, Section 1, Band 30, Leipzig 1838, S. 497-500.
Fibonacci 1202 L. Fibonacci, Liber abaci, 1202. URL: http://la.wikisource.org/wiki/Liber_abbaci (letzter Zugriff: 31. 10. 2014).
Fischer 2013 N. Fischer, Kunst nach Ordnung, Auswahl und System. Transformation der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien im späten 18. Jahrhundert, in: Swoboda 2013, S. 22-89.
Gericke 1990 H. Gericke, Mathematik im Abendland. Von den römischen Feldmessern bis zu Descar-tes, Berlin 1990.
Hegel 1842 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Berlin 1842.
Helmrath 2009 J. Helmrath, Medien und Sprachen humanistischer Geschichtsschreibung, Berlin 2009.
Heß 1996 W. Heß, Rechnung Legen mit Rechenpfennigen, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 45, 1996, Heft 4, S. 11–20.
Heyne 1793 Ch. G. Heyne, Rezension zu J. Eckhel, Doctrina numorum veterum, pars I, in: Göttingi-sche Anzeigen von gelehrten Sachen 1793, S. 2–8.
Hoffmann 1996 W. Hoffmann, Algebra des Kapitals, in: K. Piper, Die großen Ökonomen, 2., überarbei-tete Auflage, Stuttgart 1996, S. 14–20.
Kenner 1871 F. Kenner, Joseph Hilarius von Eckhel. Ein Vortrag, Wien 1871.
Kultermann 1990 U. Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschaft, Mün-chen 1990.
Lhotsky 1941–1945 A. Lhotsky, Festschrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes. Band 2: Die Geschichte der Sammlungen, Wien 1941–1945.
Mechel 1783 C. von Mechel, Verzeichniss der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bilder Gallerie in Wien, Wien 1783.
Millin 1797 A. L. Millin, Notice historique sur Joseph H. Eckhel, Paris 1797.
Müntz 1888 E. Müntz, Les collections des Médicis aux ve siècle, Paris 1888.
Pacioli 1494 L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitä, Venezia 1494 (1523). URL: http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/2683230 (1523) (letzter Zugriff: 31.10.2014).
43
Emanuele Sbardella
Peirce 1986 C. S. Peirce, Semiotische Schriften I., Frankfurt am Main 1986.
Radnoti-Alföldi 1989 M. Radnoti-Alföldi, Methoden der antiken Numismatik (Wege der Forschung 529), Darmstadt 1989.
Savoy 2006 B. Savoy, Zum Öffentlichkeitscharakter deutscher Museen im 18. Jahrhundert, in: B. Savoy (Hg.), Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815, Mainz am Rhein 2006, S. 1–22.
Savoy 2013 B. Savoy, „Unschätzbare Meisterwerke“. Der Preis der Kunst im Musée Napoléon, in: Swoboda 2013, S. 406-419.
Simmel 1900 G. Simmel, Philosophie des Geldes, Leipzig 1900.
Sombart 1911 W. Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911.
Spallanzani – Bertelà 1992 M. Spallanzani – G. G. Bertelà, Libro d‘inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, Fi-
renze 1992.
Swoboda 2013 G. Swoboda, Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Wien 2013.
Wegner 2005 R. Wegner, Kunst als Wissenschaft: Carl Ludwig Fernow – ein Begründer der Kunstge-schichte, Göttingen 2005.
Emanuele [email protected]
www.emanuelesbardella.es
Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit
AbbildungsnAchweis
Abb. 1: Wellcome Library, London, CC http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0030345.html (letzter Zugriff: 31.10.2014)
Abb. 2: B. Savoy 2013, S. 410, Abb. 2.Abb. 3: e-rara.ch. URL: http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/2683541 (letzter Zugriff: 31.10.2014)
bibliogrAphie
Denucé 1932 J. Denucé, Inventare von Kunstsammlungen zu Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert, Antwerpen 1932.
Döring 1838 H. Döring, Eckhel, in: J. S. Ersch u. a. (Hg.), Allgemeine Encyklopädie der Wissen-schaften und Künste, Section 1, Band 30, Leipzig 1838, S. 497-500.
Fibonacci 1202 L. Fibonacci, Liber abaci, 1202. URL: http://la.wikisource.org/wiki/Liber_abbaci (letzter Zugriff: 31. 10. 2014).
Fischer 2013 N. Fischer, Kunst nach Ordnung, Auswahl und System. Transformation der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien im späten 18. Jahrhundert, in: Swoboda 2013, S. 22-89.
Gericke 1990 H. Gericke, Mathematik im Abendland. Von den römischen Feldmessern bis zu Descar-tes, Berlin 1990.
Hegel 1842 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Berlin 1842.
Helmrath 2009 J. Helmrath, Medien und Sprachen humanistischer Geschichtsschreibung, Berlin 2009.
Heß 1996 W. Heß, Rechnung Legen mit Rechenpfennigen, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 45, 1996, Heft 4, S. 11–20.
Heyne 1793 Ch. G. Heyne, Rezension zu J. Eckhel, Doctrina numorum veterum, pars I, in: Göttingi-sche Anzeigen von gelehrten Sachen 1793, S. 2–8.
Hoffmann 1996 W. Hoffmann, Algebra des Kapitals, in: K. Piper, Die großen Ökonomen, 2., überarbei-tete Auflage, Stuttgart 1996, S. 14–20.
Kenner 1871 F. Kenner, Joseph Hilarius von Eckhel. Ein Vortrag, Wien 1871.
Kultermann 1990 U. Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschaft, Mün-chen 1990.
Lhotsky 1941–1945 A. Lhotsky, Festschrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes. Band 2: Die Geschichte der Sammlungen, Wien 1941–1945.
Mechel 1783 C. von Mechel, Verzeichniss der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bilder Gallerie in Wien, Wien 1783.
Millin 1797 A. L. Millin, Notice historique sur Joseph H. Eckhel, Paris 1797.
Müntz 1888 E. Müntz, Les collections des Médicis aux ve siècle, Paris 1888.
Pacioli 1494 L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitä, Venezia 1494 (1523). URL: http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/2683230 (1523) (letzter Zugriff: 31.10.2014).
HALLER MUNZ- BLATTER
Band VIII – März 2015
N A C H R I C H T E N D E R T I R O L E R N U M I S M A T I S C H E N G E S E L L S C H A F T H A L L I N T I R O L
Beiträge zum 6. Österreichischen Numismatikertag2014
Halle
r Mün
zblä
tter –
Ban
d VI
II
B
eiträ
ge z
um 6
. Öst
erre
ichisc
hen
Num
ismat
ikerta
g 20
14
ÖSTERREICH
STÜCK FÜR STÜCK
SILBERMÜNZE „TIROL“
WAS TIROL PRÄGT
Heiliges, Heimatliches, Heutiges und die ewige Natur. Tirol – auf den Punkt und auf die Münze gebracht. Das neue Glanzstück der Bundesländer-Serie. Erleben Sie Österreich –Stück für Stück. Erhältlich in den Geldinstituten, im Sammelservice der Post, in den Filialen des Dorotheums, im Münzhandel, in den Münze Österreich-Shops Wien und Innsbruck sowie unter www.muenzeoesterreich.at.
MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.
Aus der Serie sind bereits erschienen: Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg. Die weiteren Bundesländer folgen.
Heiliges, Heimatliches, Heutiges und die ewige Natur.Münze gebracht. Das neue Glanzstück der Bundesländer-Serie. Erleben Sie Österreich –
Umschlag.indd 1 18.03.2015 20:38:52