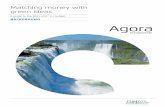Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III: vom Wettergott und dem Dynasten Teththiweibi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III: vom Wettergott und dem Dynasten Teththiweibi
Kadmos Bd. 51, S. 114–142© Walter de Gruyter 2012ISSN 0022-7498 DOI 10.1515/kadmos-2012-0008
diether Schürr
ZUM AGORA-PFEILER IN XANTHOS III: VOM WETTERGOTT UND DEM DYNASTEN TEΘΘIWEIBI
Auf der Ostseite des Pfeilers (TL 44b)1 kommt nach einer Kette von Ablativen in Z. 34 der Wettergott Trqqas zum ersten Mal vor. Von diesem Punkt ausgehend soll hier wieder eine längere Passage des Pfeilertextes behandelt werden, bis zur Nennung des Dynasten Teiweibi in Z. 61. Der im folgenden gegebene Text beruht auf der Überprüfung des Originals im Sommer und Herbst 2011 und nochmals im Hinblick auf einige Doppelpunkte im Frühjahr und Sommer 2012, mit Heranziehung von Kalinkas Umschrift (= Ka), dem von Heberdey stammenden Faksimile (= Fs) und auch den älteren Kopien: Fellows 1841, pl. 20 (= Fe1), Fellows 1842 (= Fe2), Schmidt 1868, Taf. VII (= Sch). Außerdem konnte ich Ende 2005 im British Museum auch zwei Stellen an dem Gipsabguß von 1844 überprüfen (= GBM). Der Text ist bereits in – mehr oder weniger plausible – syntaktische Einheiten abgeteilt, mit Segmentierungen, Ergänzungen und Korrekturen, die noch begründet werden müssen. Unsichere Zeichen sind durch Unterstreichung markiert.
I
Zunächst sei das Stück Z. 34–36 angeführt:pri: trqqas: heis35[ttu?.]rmez{ez}i: erbbi: sttãti: teli: qehñ36[n\i?]me-j-ese<-tebe/\ti>: terñ:punerebe: se-b’ epibere
1 Lykische Inschriften werden mit TL nach E. Kalinka, Tituli Lyciae lingua Lycia conscripti (Tituli Asiae Minoris I), Vindobonae 1901, und mit N nach G. Neumann, Neufunde lykischer Inschriften seit 1901 (Denkschriften der Österr. Ak. Wiss., phil.-hist. Kl. 135), Wien 1979, angeführt, soweit nicht anders angegeben. Lykische Münzlegenden mit M nach O. Mørkholm – G. Neumann, Die lykischen Münzlegenden (Nachr. Ak. Wiss. Göttingen, phil.-hist. Kl. 1978, Nr. 1), Göttingen 1978. Für kritische Bemerkungen danke ich H. C. Melchert.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 115
Z. 34 und 35 Ende Punkt oben nur Fs: nicht vorhanden! Doppelpunkt am Zeilenen-de ist auf dem Pfeiler auch sonst in den Prosatexten nicht belegt, im ‚Nordgedicht‘ nur c, 52, im ‚Westgedicht‘ dann öfters. Daher müssen die Wörter am Zeilenende nicht vollständig sein, wie Kalinka annahm. Z. 36 hat ein Zeichen mehr (also 31).
Abb. 1. Pfeiler-Text b, 34–39
Das in Z. 38 mit hiatvermeidendem n- und in Z. 39 auftretende emu ‚mir‘ spricht dafür, dass wir uns hier in einer Rede befinden, deren Beginn unklar bleibt. Eine Ich-Form dürfte aber schon in hijãnaã Z. 24 vorliegen („den hija machte ich“?). Alle klaren Verbformen in Z. 35–39 stehen im Präsens: sttãti, asati, kumezeiti.
Im ersten Satz tritt der Wettergott im Nominativ auf. Voraus geht pri, das hier wie in der poetischen Inschrift TL 55, 3 als Adverb gebraucht sein könnte. Dort lautet Str. V nach meiner Rekonstruktion (Schürr 2005, 132):
me-uwe-memleje: pri-pe trija date qirz\ qabalimedi:sljtãmi udrñte: sebe-kuprimesi k<ñ?>ta-\: i[sñ?]te-j-epñ)
Das könnte – unter Weglassung vieler eigentlich nötiger Fragezei-chen2 – etwa bedeuten:
„Nun immer dem Memle zuerst aber die drei (sc. Nymphen) da-ten den qirz\ mit qabalime-,den sljtãmi bewässerten und den kuprim-ischen, wenn [sie?] die k<ñ?>ta i[s]-te[n?] später.“
Da dürfte pri am Ende epñ kontrastieren (Ševoroškin 2002, 148), vor dem sich eine Form des Verbs i(s)- ergänzen lässt, und wenn es die Pluralform ist, dann könnte auch das eine Aktion der Nymphen sein. Denn zu vergleichen ist Str. VIII, wo i wohl eine Verbform sein muss (2. P. Sg. Imperativ), der mit trqqiz der Wettergott als Agens folgt. Im Nordgedicht erscheint c, 35 ibati nach trqqiz, aber da dürfte als Verb bati abzutrennen sein, i also ein Nomen sein, vgl. dazu uwadra-i in TL 44a, 33 nach istte: wawadra in der Zeile davor. Daher könnte heis, das keine vollständige Wortform sein muss, 2 Und eines möglichen Doppelpunkts nach prip, eines sicheren nach qir.
116 Diether Schürr
zum Verbstamm i(s)- gehören, he- also ein Präfix sein, vergleiche etwa ha-laza in a, 51 zu dem im Infinitiv laina in a, 50 belegten Verb, gegenüber asa-lazu (Akk. Sg.) in der Trilingue (N 320a, 5). Vergleiche auch Mreisa, TL 61 Patronym? Der Vorschlag, heis[ttu (3. P. Sg. Imperativ) zu ergänzen, stützt sich darauf, dass nach dem folgenden nicht der Wettergott angeredet wird.
Allerdings könnte pri hier auch räumlich im Sinn von ‚vorn‘ zu ver-stehen sein, ähnlich wie beispielsweise in der hieroglyphen-luwischen Inschrift von Yalburt der Wettergott auf dem Feldzug ‚vorauseilt‘ (Hinweis Melcherts).
In ]rmezezi liegt möglicherweise Dittographie vor wie vielleicht auch in TL 44a, 27f. mahãna: neleze [7 s.]ezeze, „den Göttern der Agora [und? des ]e(ze)-“. Aber es gibt keinen Grund, an beiden Stel-len das gleiche Wort anzunehmen. Nach dem Ausgang kann es sich um ein Ethnikon handeln, zu einem allerdings unklaren Ortsnamen. Es könnte sich um eine Epiklese des Wettergotts handeln, um eine Einzelperson (möglicherweise auch ihren Namen), die Objekt der vom Wettergott erwarteten Aktion wäre, oder schon das Subjekt des Relativsatzes, also Leute aus einem Ort. Mir scheint die zweite Möglichkeit die wahrscheinlichste zu sein, vergleiche in TL 55 Str.VIII (epe-)palarã (Akk. Sg.) als Objekt zur Wettergottaktion i.
Das Verb stta- ist auf dem Pfeiler auch c, 5ff. in sttati: sttala, sttati-m\: sttala und sttati-m\ urublij\ belegt und mit angehängtem -teli wie hier auch in der Trilingue N 320a, 16f. in \ti: \: sttati-teli, „der Platz, wo der (Altar-)Bau stehen soll“. Wenn es zusammen mit sttala aus dem Griechischen entlehnt ist, dann ist es primär auf das Stehen von Monumenten bezogen und hier übertragen etwa im Sinne von ‚standhalten‘ gebraucht3.
Zu erbbi vergleiche TL 29, 3 se-ñteml\: qastte-teli: erbbe „und wo er das ñteml\ schlug in Schlachten“ (Schürr 2001, 134).
Qehñ ist sicher nicht vollständig und schließt an qehñnedi in Z. 31 an. In dem Stelenfragment von Limyra (N 337) ist nun Z. 12 zwar qehñnirm\ belegt (Christiansen 2012), was dazu verlocken könnte, hier qehñ[nir]me (Dat. Pl.) zu ergänzen, aber es dürfte eher eine andere Form von qehñne- anzunehmen sein, der ein satzeinleitendes me- folgt. Dann kommt wohl nur ein Nom. Pl. in Frage, und da zumindest im Normallykischen das Subjekt nie vor me- steht, dürfte es sich eher um das Subjekt des vorausgehenden Satzes handeln. Zur
3 Vergleiche aber beispielsweise auch altenglisch stodon fæste / wigan on gewinne The Battle of Maldon v. 301f.: „es standen fest / die Krieger im Kampf“.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 117
Stellung nach der enklitischen Konjunktion -teli lässt sich TL 11 vergleichen, wo das Subjekt auf -teri ‚als‘ folgt.
Im folgenden ist zwischen dem Präverb ese- und dem Objekt terñ so gut wie sicher eine Form des Verbs tebe- ausgefallen, vergleiche:
ese: trbb\nimi: tebete: terñ TL 44a, 44ese: er\i: tebete: <t>erñ a, 48ese-tabãna: terñ a, 52ese: humrã: tebãna terñ a, 54f.ese: perikle: tebete: artturparã TL 104a, 2f.me-ñn’-ese-teb\t\ TL 29, 10
Ob das Verb im Singular oder im Plural stand, muss offen bleiben.Zum Zusammenhang mit erbbi vergleiche man a, 47 er\i:
qastte τerñ: tlahñ: erbbedi „Cher\i schlug das Heer von Tlos mit Schlacht(en)“ und auch c, 13 erbbedi ñtube: τer[ñ] (siehe Schürr 2004, 188f.).
Bei punerebe könnte das enklitische -be abzutrennen sein wie bei dem folgenden sebe, und an punere ließe sich dann b, 2 puna[ra?] anschließen4. Es könnte sich dann um eine Entlehnung des luwischen p)nata- ‚all‘ mit der hieroglyphen-luwischen Lautentwicklung /d/ > /r/ handeln (Schürr 2007b, 121 Anm. 18). Aber es liegt wohl näher, dass pune- ein Vorderglied ist wie bei dem Namen punamuwe[ TL 35, 12 und m.E. auch bei punãmadi TL 26, 7 und den davon abge-leiteten Formen. Und analog könnte auch bei dem mit punerebe gepaarten Wort epi-bere statt pibere abzutrennen sein. Dann sollte man wohl bei punerebe Vertauschung von r und b annehmen, also in pune-<ber>e oder besser pun-e<ber>e korrigieren. Das Wortpaar könnte so etwas wie ‚ganz und gar‘ bedeuten.
Das erste Textstück könnte also etwa so zu übersetzen sein:„erst/vorn der Wettergott [möge?] …en (den?) .]rmez{ez}iwo (im) Kampf stehen (die?) qehñ[n\i?].Nun (soll er / sollen sie) nieder <werfen> das Heerganz und gar (?).“
Um welchen Kampf es sich dabei handelt, bleibt freilich gänzlich unklar. Im Hinblick auf das folgende Bauprogramm ist aber jedenfalls bemerkenswert, dass hier von einem gerade stattfindenden Kampf die Rede ist.
4 Nicht puna[ma?] … Eichner 2005, 22, weil noch eine Senkrechte erhalten ist (und ein Wort punama- m.E. gar nicht existiert).
118 Diether Schürr
II
37[trq]qas-ppe: asati: ñtawatã: tuwi: se-’be38[i-j-\]n\: arawazija: ñtew\: n-emu: se-ã39[na u?]be dew\ emu: kumezeiti-ti:Z. 37 as[a]ti Ka: e Fe1-2, Sch (unsicher, p. 9 t vermutet), a Fs. Eindeutig a. Z. 38 Doppelpunkt nach n\ Fe2, Sch, Punkt oben Fs. Nicht erkannt. Ende qã- Ka, wobei q ein Schreibfehler ist, ã) Fe1, ãq Fe2, ãn Sch, unklare Konturen Fs. Ich glaubte, an GBM den Unterteil eines s erkannt zu haben, aber nicht am Original. Wohl doch kein Zeichen mehr und wegen einer Störung des Stoichedons gegen Ende nur 29 Zeichen. Z. 39 Beginn b Ka: r F1-2, a: Sch, b Fs. Erkennbar.
Im ersten Satz hat „der Wettergott liebt“ hieroglyphen-luwische Parallelen (Schürr 1997b, 61). Der sprichwortähnliche Satz schließt das Kampfthema ab. Bei Behandlung dieser Formel hatte ich poe-tische Diktion vermutet, auch weil tuwi sonst nur in den lykischen Gedichten vorkommt5, und daher in sebe- Z. 36 und 37 die sonst ebenfalls nur in den Gedichten vorkommende Form der Konjunkti-on ‚und‘ gesehen. Aber es folgt ja in Z. 38 das normale se-, und zu se-be- in Z. 36 lässt sich sebe-be c, 52 im ‚Nordgedicht‘ vergleichen. Hier scheint mir mit tuwi: sebe[. . .]n\ im Pire-Poem (TL 55) me-i-’bei-pe: tuwi-be-w’-\n\ „nun (in?) ihm hier aber, im Land (?) -be-we unten“ am Beginn der Str. IX zu vergleichen (Schürr 2005, 132 und 154). ‚Unten‘ ließe sich vom Wettergott im Himmel her verstehen.
Arawazija oder erawazija ist bisher sechsmal in Xanthos (TL 40c), Phellos (N 303)6, Limyra (TL 117, 128, 135) und Korydalla (N 302) als Bezeichnung von Grabbauten verschiedenen Typs belegt. Dass diese Pluralform auch hier ein einziges Grab bezeichnet, scheint aus den noch zu besprechenden Belegen in a, 21f. hervorzugehen. Zu ñtew\: n-emu ist die Lokalisierung wohl des Pfeilers selbst zuerst mit ñtepi, dann mit ñtew\ in Bezug auf Grabbauten von Verwand-ten und zuletzt den „Göttern der Agora“ in a, 24ff. zu vergleichen (Eichner 2005, 29 Anm. 156 und Schürr 2007a, 31). Entsprechend dürfte hier die Errichtung eines Grabbaus „gegenüber“ dem Grab-bau des Sprechers gefordert sein, was gleich am Beginn des nächsten Abschnitts eingelöst wird. Außerdem werden auch ãna und ein dew\ gefordert. Sie kehren erst in Z. 58 und 57 wieder. Ein passen-5 Es könnte mit hieroglyphen-luwisch tuwi- (ERE’LI 2) und keilschrift-luwisch
t)wazza- zusammenhängen, die beide auf Erde/Land bezogen sind.6 Diese Inschrift gehört zu dem erhaltenen freistehenden Grabhaus im ‚Heroon‘, wie
aus Beans Angaben hervorgeht.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 119
des Verb gewinnt man mit der Ergänzung von u]be, 2. Sg. Imp. von ube- ‚stiften‘ (o.ä.). Dieses Verb dürfte schon in b, 12 verwendet sein, wo allerdings nur ub[ erhalten ist (dazu Schürr 1998, 160). Es passt weniger zu arawazija und dürfte nur zu dem folgenden dew\ gehören, zumal dann in c, 4 von einer ‚Stiftung‘ (ubu, Akk. Sg.) die Rede ist, die m.E. ddew\ (c, 6) betrifft. Folglich dürfte im Satz davor das Verb fehlen, so dass ‚seien‘ zu ergänzen sein wird, vergleiche dazu etwa:
me-htt\mi: ãnabah\ „dann (sei) Zorn der Anabischen!“ TL 149, 8 gegenüberme-we-j-esu htt\mi „dann -we sei Zorn!“ TL 91 (Schürr 1997b, 63).
Dass der folgende Satz ohne Konjunktion anschließt, ist ungewöhn-lich. Wenn zwischen dew\ und emu im Gegensatz zu dem voraus-gehenden emu der Übergangslaut n fehlt, so wird das daran liegen, dass der Anschluß hier weniger eng ist, weil mit emu der Relativsatz beginnt. Kumez(e)i- dürfte hier nicht ‚opfern‘ bedeuten, sondern ‚beopfern‘, wie das vielleicht auch bei kumezidi (…) arã: kumehedi „beopfern soll man den arã mit einem Opferschaf“ N 320a, 26f. gegenüber der griechischen Entsprechung yÊein (...) flere›on b, 24f. der Fall ist. In N 324, 16f. (Bousquet 1992, 183) dürfte se-de-ñte: muha[s kum]ezidi: ebeis zu ergänzen sein: „und -de darin (?) diese Götter soll man beopfern“.
Es ergibt sich also etwa:„Der Wettergott aber liebt Herrschaft (im) Land (?). Und hi[er un]ten (seien?) arawazija gegenüber mir und ã[na]! *Stifte einen dew\, den sie mir beopfern sollen!“
Damit endet die Rede. Der Übergang von der Wettergott-Sentenz zu konkreten Forderungen ist jäh; das Stichwort ‚Herrschaft‘ wird explizit erst in Z.58 wiederaufgenommen.
III
me-’rawaz40[ija] ade: tuminehi: mlatraza: tizzidi41[se-.]ahrmãta: qarazutazi: tezi: aruwãt42[ise-]tukedri: se-j-etipuw\i: se-j-urubli43[j\ a]de: urzi-de:se-tukedri: atrã: tehlu44[seZ. 43 nach atrã Doppelpunkt Sch, möglich Fs. Deutlich.
120 Diether Schürr
Abb. 2. Pfeiler-Text b, 40–47
Es folgt nun offenbar die Ausführung der Forderungen, im Rah-men eines Bauprogramms, das bis Z. 61 reicht und vermutlich als Manifestation von Herrschaft zu verstehen ist. Dass die arawazija in Tuminehi gebaut werden, ist eine auffällige Entsprechung zur Südseite:
]21eimi arawazije-de kuprl[lehe? . . . ara]22wazija: prñnawate tumi[nehi„… den arawazija -de [des?] Kuprl[li . . . ara]wazija baute (in) Tumi[nehi“.
Da ist auf jeden Fall der bedeutende Dynast Kuprlli mit arawazija verbunden, wie immer der Passus zu ergänzen ist7. Dass „ein Heroon des Großvaters Kuprlli in Tymnessos bestanden zu haben scheint“, schließt bereits Eichner 2005, 29 aus der Stelle. Merkwürdig dar-an ist, dass unmittelbar davor in a, 18–20 von der Errichtung des Grabpfeilers und der Statue (darauf) die Rede sein dürfte, während in a, 24–27 m.E. der Grabpfeiler zwischen Grabmonumenten von Verwandten und den „Göttern der Agora“ verortet ist. Da passt der Bau eines Grabmonuments an einem anderen Ort nicht dazwischen. Daher dürfte es eher um einen Vergleich mit dem Großvater Kuprlli gehen, der arawazija in Tuminehi gebaut hatte – warum auch immer ein so bedeutender Herrscher, der Münzen von Xanthos bis Limyra prägte, ein solches Grab nicht in Xanthos, sondern in einem viel weni-ger wichtigen Ort baute. Weil er diesen Ort selbst gegründet hatte?
Der Bergort Tuminehi (siehe Borchhardt–Neumann–Schulz 2003) kontrollierte den Pass, der vom Xanthos-Tal nach Zentrallykien und in die nördlich davon gelegene Milyas (um das heutige Elmalı) führt.
7 Dabei ist sehr wahrscheinlich von 30 Zeichen pro Zeile auszugehen, wie sich zuerst in Z.25 zuverlässig ergänzen lässt.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 121
Ich halte ihn für identisch mit Artumnhsow – ‚Ober-Tuminehi‘ –, das Stephanos von Byzanz als Stadt Lykiens und Kolonie von Xanthos anführt (Schürr 2012a, 215ff.).
Ein Rückbezug auf Kuprlli liegt auch zu Beginn der Inschrift N 324 vor. Da stellt Erbbina, der Urenkel des Kuprlli, im Letoon eine ihn selbst darstellende Statue auf und fügt Z. 2f. bei:
kupr]lli: ade-ti: u[a tei ehbi?] \ti: atrã: pude: erb[bina„(dem) Kupr]lli, der machte, Großvat[er des Vaters seiner?], (den) Platz, (sein) Selbst beigesellte (?) Erb[bina“ (Schürr 2001, 132 Anm. 4).
Der Bezug zu den arawazija des Kuprlli legt nahe, dass der Sprecher, der arawazija „gegenüber mir“ fordert, Kuprlli selbst ist, der hier also vielleicht aus dem Jenseits, womöglich im Traum, sprechen müsste. Da der Text der Südseite m.E. nicht über das Jahr 428 hinausgeht (Schürr 1998, 154), sollte bei chronologischem Anschluß der Text der Ostseite spätere Ereignisse schildern. Und Kuprlli dürfte nach seinen Münzprägungen damals nicht mehr am Leben gewesen sein.
Es gibt allerdings sonst nichts im Text, was auf Kuprlli deutet. Man sollte aber erwarten, dass nun am Beginn der Baumaßnahmen deren Subjekt genannt wird und damit auch der Angeredete: Das dürfte mit mlatraza tizzidi geschehen: Das erste Wort ist mit dem für Berufsbezeichnungen typischen Suffix -aza gebildet. Es könnte sich dabei zwar auch um einen Dat. Pl. handeln, aber in Z. 46 werden die arawazija ja als ‚seine‘ bezeichnet. Tizzidi gleicht im Ausgang przzidi TL 128, mahanahidi TL 92, tubehidi TL 30, ãrahidi TL 29, 2, die alle Bestandteil von Titeln sind, und ist von tizzi in TL 29, 17 abgeleitet.
Dass eine Person nur mit ihrem Titel angeführt wird, der Name also als bekannt vorausgesetzt wird, ist etwa auch am Ende der Südseite bei dem halaza (…) bide: hriñtawatahi (a, 51f.) der Fall, dem „großköniglichen halaza in Kaunos“ (siehe Schürr 1998, 152 und 155).
Danach dürfte tatsächlich vom Bau eines Grabes für eine andere Person die Rede sein. Ahrmãta ist vielleicht vollständig (falls davor [se-j-] zu ergänzen wäre) und wohl ein Name, qarazutazi wohl ein Ethnikon mit typischem Suffix. Dass auch dieses Grab in Tuminehi gebaut wurde, ist nicht ganz sicher – auch der Ort Qarazuta käme vielleicht in Frage. Bei diesem Grabbau geht es wohl um eine Ehrung, wie der Anschluß einer Statue unterstreicht. Das dritte Objekt etipuw\i wird m.E. durch eine Formulierung der Trilingue (N 320) erklärt:
122 Diether Schürr
\ti / sttali: ppuweti: krm\: ebehi (a, 22f.)\ti: sttali: ppuw\ti-<kr>m\: ebehi (a, 33f.)= ˜sa §n t∞i stÆlhi §gg°graptai (b, 20f. und 28f.).
Demnach dürfte eti- hier für \ti stehen und die Bedeutung ‚Inschrift‘ sein.
Erst bei der nächsten Baumaßnahme wird ade ‚machte‘ wiederholt, und nun findet sicher ein Ortswechsel statt: Wie das in Z. 44 folgende Ethnikon zeigt, steckt in urzide ein Ortsname, vermutlich urza- im Dat. Sg., mit dem öfters auch an Nomina tretenden -de. Urublij\ ist nach c, 9f. ein mit sttala ‚Stele‘ vergleichbares Monument, vermutlich auch hier mit Inschrift, und nun folgt dem eine Statue des Bauherrn selbst. Das letzte Wort lässt sich nach TL 51 auf einer Statuenbasis in Xanthos zu tehluse ergänzen:
„Hin ihn Qarñnaa stell[te],des Qñtbe- (Sohn), seinen SohnWezzeimi dem Tehlus.“
Dabei dürfte es sich um ein Theonym handeln, das vielleicht auf ein Ethnikon zurückgehen könnte wie ebuis in Korba (N 332, siehe Neumann 2000).
Es ergibt sich also:„Nun arawazija machte (in) Tymnessos der mlatraza tizzidi[und (dem) .]ahrmãta von Qarazuta einen hohen Sarkophag[und] eine Statue und eine Inschrift (?),und ein urublij\ machte er (in) Churza -deund als Statue (sein) Selbst dem Tehlus.“
IV
m]e-i: rrmã: pibijeti: urzaz\:kumez45[ei]{s}ne: uhazata: wawã: trisñni:se-ñte-pd46[d\-]zrppudeine: arawazije: ehbije: kbi47[ja?] me-i-m\ adru <a>de: mahãi:Z. 44 Beginn l] Ka: Rest eines Schrägstrichs Fs? Möglich. Fälschlich kurzazã Ka.Z. 45 ..in]e Ka: sne Fe1-2, s „doubtful“, n „sufficiently sure“ Sch (p. 9); anscheinend Unterteil eines s, danach l bzw. n ohne den dritten Strich Fs. Unklar, ob s. Ende pl Ka: d Fe1, l Fe2, l „uncertain. (D?)" Sch (p. 9), d Fs. Sicher d.
Der erste Passus unterbricht die Aufzählung von Baumaßnahmen, wie schon der Gebrauch des Präsens und von Infinitiven zeigt. Es handelt sich primär um eine Opfervorschrift, wobei am Beginn sicher zu me-i wie am Beginn des nächsten Passus zu ergänzen ist und das enklitische Personalpronomen -i sich auf den zuvor genannten Gott
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 123
bezieht. Zur Sicherstellung der jährlichen Opfer werden die Einwoh-ner des Ortes herangezogen. Im folgenden sind TL 26 (Tlos) Z. 16 und 18 zu vergleichen:
me-kumezeiti (…) uhi-de: trqqñti: wawã: trisñni„Sie sollen nun opfern (…) im Jahr außerdem dem Wettergott ein dreijähriges Rind.“
Da geht eine Liste von Geldbeträgen voraus, die in verschiedenen Orten wohl aufgebracht werden sollen. Hier dürfte rrmã eine solche Abgabe bezeichnen.
In ñtepd[. .] lässt sich nach ñte-pdd\-had\ N 320a, 2f. eine Präverb-Folge erkennen, zum Verb zrppud(e)i- ist der PN Serpodiw bzw. [Ser]poudiw (Zgusta 1964, § 1409-1 und -2 bei Levissi und in Telmessos) zu vergleichen, was freilich nicht weiterhilft. Am Ende ist wohl kbi[ja] und nicht kbi[je] zu ergänzen, da „seinen anderen ara-wazija“ wohl keinen Sinn macht. Dann ist sinngemäß uwa ‚Rinder‘ zu ergänzen, so dass im Rahmen der Opfer für den Gott auch für Rinderopfer am Grab des Bauherrn gesorgt würde. Danach dürfte Churza wohl in der Nähe von Tuminehi zu suchen sein.
Ab Z. 47 bis Z. 57 lässt sich die Übersetzung von Eichner 2005, 31ff. vergleichen:
„Und da be-libierte (??) er ebenfalls (m\) die Götter (mit dem Versprechen)“.
Am Beginn wird sich aber -i wieder auf den Gott Tehlus beziehen, zumal -m\ anschließt. Dann kann mahãi m.E. nur ein Gen. Pl. sein, der vom Akk. Sg. adru abhängt. Ob adru auch auf der Silberphiale in N 323, 4 zu lesen ist, scheint mir freilich nicht sicher8. Es könnte sich dabei theoretisch um eine Ableitung vom Verb ‚essen‘ handeln, wie bei heth. edri-, luw. atrahit- ‚Nahrung‘ (Starke 1990, 161). Die Ergänzung des verbleibenden de zu ade ‚machte‘ scheint mir aber zwingend, und das spricht wohl dafür, dass es hier wieder um eine Baumaßnahme geht.
Es ergibt sich also wohl:„*Nun ihm ein rrmã wird man stets geben der Leute von Churza,zu opfern jährlich ein dreijähriges Rindund hin-vor zu ...en seinen arawazija *andere (Rinder).Nun ihm ebenfalls einen adru *machte er der Götter.“
8 Neumann 2007, 4 bucht „adru oder adlu“.
124 Diether Schürr
V
se-dde: ahata ha48[de] \n\: qla’bi: ehetehi:se-mahãna: ehete49[he]arñna: tuminehi: keri: ãkbi: epid50[e ñ]teml\ sitãma:se-we ne-pe: astte: trrm51is:
Abb. 3. Pfeiler-Text b, 48–61
Ab hier lässt sich auch die Übersetzung von Cau 2003, 54f. verglei-chen:
„e cose eccelse (?) (fece) in questo santuario eccelso e agli dèi eccelsi,a Xanthos, a Tymnessos, a Keri, a Kandyba(oppure „Xanthos, Tymnessos, Keri, Kandyba (fecero) […]“),inoltre … e (si disse): ‚non (lo) fece (mai) la Licia‘“.
Eichner:„(dass) er Friedensmale im hiesigen Temenos des Friedens (?)sowie für die Götter des Friedensin Xanthos, Tymnessos, Kerththi, Kandybasoundso ([ñ]teml\) erbauen werde, und Lykien vollbrachte es jeweils fürwahr.“
Die nun folgende Aktion gilt offenbar nicht mehr dem Tehlus, und dde scheint hier -m\ zu kontrastieren. Es kommt schon in b, 29 vor: „und mit Neffe(n), mit [Onkel(n)], mit señnahischem/n dde Lykien
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 125
(Akk.) pu[. . te]“ (Schürr 2008, 178). Und es wiederholt sich in Z. 519. Im folgenden gebe ich es provisorisch mit „darauf“ wieder.
Im folgenden ist statt ahataha ‚ehetische‘ ohne Bezugswort besser ha[de] abzutrennen und zu ergänzen, ein Verb, das in der Pfeiler-Inschrift sonst nur in me-ubu hãt\ c, 4 verwendet ist. Ahata ist in TL 29, 4 belegt, und da gehen Sätze mit ñteml\ bzw. ñt\ml\ voraus, das hier folgt (Text nach der Revision von Teko‘lu 2006):
se-ñteml\: qastte-teli: erbbe:me-ti ñt\ml\: przze: astte-teli4se-j-ahata: astte“und wo er das ñteml\ schlug (in) Schlachten,da nun sich das ñt\ml\ den Vorderen unterwarf (?)und (sich) ahata unterwarf (?)“ (Schürr 2001, 134 und 2012a, 220).
Auch die Verbform astte10 kehrt im folgenden wieder.Ein Friedensheiligtum mit Friedensgöttern scheint mir zu pazi-
fistisch. Die Idee geht auf Neumann zurück, der in esetesi-[k]e erb[b]esi-ke, das im ‚Westgedicht‘ (d, 12f.) auf den Wettergott bezo-gen ist, ein Gegensatzpaar „Sieg und Niederlage“ angenommen hatte (1984, 90 = 1994, 152). Mit der Neubestimmung von erbbe/i- als ‚war, battle‘ durch Melchert ergab sich daraus die Vermutung ‚peace‘. Sie passt aber nicht zu dem zweiten Beleg im ‚Westgedicht‘ (d, 44f.):
zzãtã-pe: trqqi<z> / [t]rrmile: zrpde eseti: erigazñ„Xanthos aber der Wettergott den Lykiern …te (als) eseti des Cheriga“ (Schürr 1997a, 134 und 1997b, 65).
Das legt es nahe, in eseti so etwas wie ‚Residenz‘ zu vermuten (Schürr 2007a, 33), und das würde auch als Gegensatz zu ‚Schlacht‘ und zu dem angenommenen Zusammenhang mit heth. !ss- ‚bleiben‘ passen. Es wäre aber auch Anschluß an heth. es-/as- ‚sitzen‘ denkbar wie bei pdd\n-ehrmi ‚Vor-sitzender‘11. Das passt freilich zu den beiden Belegen für ahata (das hier ein ‚Kollektivplural‘ sein müsste) zumin-dest nicht nahtlos. Was hier mit ha[de gemeint ist, ist auch nicht klar. Griechische Entsprechungen gibt es nur für die Verwendung von ha- mit Präverbien in der Trilingue (N 320): ñte-pdd\-had\ a, 2f. entspricht kat°sthse b, 2f. und ddazas: epi-de arawa: hãti-krm\tis a, 20f. ˜soi ín épeleÊyeroi g°nvntai b, 18f. (wörtlich etwa: „wieviele Sklaven sie auch in Freiheit lassen“). Da geht es um 9 Außerdem scheint es in dde-i-’pñte TL 84, 4 vorzuliegen.10 Es handelt sich bei as- m.E. nicht einfach um ein „iter. to a- ‚do, make‘“ (Melchert
2004, 6), denn in keinem Fall hat es sicher ein direktes Objekt.11 Dies nach Melchert (brieflich).
126 Diether Schürr
Statusveränderung von Personen, und nach TL 29, 4 sind ahata auch Personen, zu denen das Heiligtum und die dort verehrten Götter zu gehören scheinen. So dürfte wohl gemeint sein, dass die ahata ‚unter‘ der Zuständigkeit dieser Götter ‚belassen‘ werden, im Gegensatz zu dem folgenden epide.
Bei ubu hãt\ in c, 4 ist wegen des Zusammenhangs mit u]be dew\ in b, 39 vielleicht an „die Stiftung bestätigten sie“ zu denken. Bemer-kenswert ist, dass lykisch esetesi und ehetehi eine Entsprechung in keilschrift-luwisch assattasssis als Epiklese einer Gottheit haben (s. Starke 1990, 102 Anm. 264).
Das Heiligtum, ‚unter‘ dem die Aktion stattfindet, wird nicht mehr in Churza zu lokalisieren sein, sondern wohl in Xanthos, das ja als eseti bezeichnet zu sein scheint und am Beginn der folgenden Ortsliste erscheint. In ihr kehrt Tuminehi wieder, nun als Station auf einer von Xanthos nach Kandyba am Rande des Kasaba-Tals führenden Route.
Kandyba erscheint schon früher in b, 7:kbihu: tu7[minehi hr]zzikbihu: ãkbi:kbihu: 8[. . . . . .]„zweimal (im?) [ob]eren Tu[minehi],zweimal (in?) Kandyba,zweimal (in?) [ON?]“.
In b, 10 folgt dann auch schon der Ort Keri (bei Hacıo‘lan). Die Verbform epide ist bereits in a, 41 verwendet, wo sie eine
ebenfalls an verschiedenen Orten – darunter dem ‚unteren‘ Tumine-hi – durchgeführte Aktion bezeichnet, und das dürfte auch für die Pluralform epeite in TL 26, 19 gelten (Schürr 2007b, 119). Und an das Akkusativobjekt [pr]ulija in a, 41 schließen sich am Beginn der Fortsetzung des Textes auf der Ostseite kbija: prulija „andere prulija“ an, worauf in b, 2 ein Satz mit estte folgt wie hier astte. Die Abfolge epide → estte, astte scheint mit qastte → astte in TL 29 vergleichbar. Für ñteml\ wäre ‚Einwohnerschaft‘ denkbar (Schürr 2001, 134); die syntaktische Funktion von sitãma ist unklar. Es hängt vielleicht mit der Verbform sit\ni zusammen, die in b, 61 und N 320, a 25 (g¤nhtai b, 24 entsprechend) belegt ist (und m.E. von dem Verb sije- ‚liegen, ruhen‘ fernzuhalten ist). Es wäre denkbar, dass sitãma eine von die-sem Verb abgeleitete Personenbezeichnung ist12.
Im folgenden ist in ne-pe sicher die Negation zu sehen, vergleiche ni-pe und im Gegensatz dazu -pe-’ne, beispielsweise in me-pe-’ne tubi-12 Von ihm selbst könnte der Personenname stamaha abgeleitet sein (TL 127 und N
351 [Seyer–Teko‘lu 2009], die gleiche Person).
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 127
di (…) trqqiz (d, 11f.) „dann aber soll ihn schlagen (…) der Wetter-gott“. Zu vergleichen mit ne-pe: astte ist n’-estte im ‚Westgedicht‘ (d, 51). Die durch epide ausgedrückte Aktion hat also anscheinend nicht zum Erfolg geführt, wobei nun anstelle von ñteml\ der Landesname Trrmis erscheint (zum zweiten Mal, siehe b, 29). Möglicherweise kontrastiert dem in b, 2f. se-j-estte ’beli: puna[ra?] τere-τere „und es gehorchte hier die Gesamtheit Ort für Ort“?13
Damit ergibt sich etwa:„und darauf (?) die ahata *beließ er unter dem ehetischen Hei-ligtum und den ehetischen Göttern.(In) Xanthos, Tuminehi, Keri, Kandybaergriff er die Einwohnerschaft (?) (als?) sitãma,und -we nicht aber gehorchte (?) Lykien.“
Der mlatraza tizzidi dürfte also erst einmal gescheitert sein.
VI
se-dde tuwet\: kumezija: τere-τere 52trqqñti: pddãtahi: qñnãkba: rss\ni: eh53bi: tabahaza:kumezija: padritahi: arñ54natuminehija: kumezija: ãkbija: kume55zijase-tukedri: keri: ade: urublij\ 56hãtahe:Z. 51 hat ein Zeichen weniger (also 29).Z. 52 hat zwei Zeichen mehr (also 31).Z. 54 Doppelpunkt nach na Fe2 Sch, nichts Fs. Nicht erkennbar. Ein Zeichen mehr (also 31).Z. 55 Doppelpunkt nach zija Fe2, Sch, nur Punkt unter der Standlinie Fs. Dieser ist erkennbar.
Cau: „e ha eretto santuari ovunque a Tarhunta locale, qñnãkba (?) al suo rss\ni (?) … santuari di Padrita a Xanthos, santuari a Tymnessos, santuari a Kandyba e ha fatto una statua a Keri come monumento personale“.
13 ‚Überall‘ scheint mir zu weit zu gehen. Für die Bedeutung von τere-τere ist wohl aufschlussreich, dass b, 4 im nächsten Satz τeτeris ‚die Städte‘ (Akk.) folgen. Ebeli scheint dazu schlecht zu passen, wenn es geradezu ‚hier‘ bedeutet, aber vielleicht wäre auch ‚darin‘ (d.h. in dieser Sache?) möglich. Bei dem negierten astte kehrt τere-τere nicht wieder, wohl aber im folgenden Satz, siehe nächster Abschnitt.
128 Diether Schürr
Eichner: „und er stellte Altäre allenthalben dem lokalen Wettergott auf … zwei für sein(en) Soundso (Kopf?) … Altäre im Heiligtum/Temenos der Aphrodite in Xanthos, tymnessische Altäre, kandybäische Altäre und ein Standbild in Kerththi machte er als Monument (bzw. zum Andenken) für die Siege im Kampf“.Mit diesem Abschnitt kehren wir zu Baumaßnahmen zurück, anschei-nend, um den Misserfolg zu kompensieren. Dde ist wiederholt, das Verb ist nun vorgezogen und endnasaliert, warum auch immer. In der Trilingue entspricht N 320a, 7 kumezij\:\ b, 7 bvmÒn; später (a, 16) erscheint auch \ allein. Ob kumezija daher ‚Altäre‘ sind, ist fraglich – eher wohl alles, was zu einem Opfer gehört: also „richtete Kulte ein“ (Starke 1990, 490 Anm. 1797)?
Da sonst aber stereotyp ade ‚machte‘ für die Baumaßnahmen ver-wendet wird, ist vielleicht mit einer anderen Bedeutung von tuwe- zu rechnen, die in der Trilingue belegt ist: me-t’-epi-tuw\ti: mara: ebeija (a, 32f.) entspricht da poiÆsein §ntel∞ (b, 29). Es könnte also auch um die Durchführung von Kulthandlungen gehen.
Und kumezija dürfte ebenso wie arawazija für ein Monument – oder einen Kult – gebraucht worden sein. Am Beginn des Passus dürfte es wirklich eine Mehrzahl bezeichnen, am Ende wohl nicht: Warum sollten denn mehrere Altäre/Kulte in einem xanthischen Hei-ligtum (v)errichtet worden sein? Warum in den folgenden Städten?
Mir scheint, dass auf einen einleitenden, zusammenfassenden Satz mit τere-τere eine Auflistung der kumezija an den verschiedenen Orten folgt und dass der Wettergott nur der erste Adressat ist – warum sollte ihm denn ein Altar/Kult in einem Aphrodite-Heiligtum gewidmet werden? Folglich möchte ich auch pddãtahi auch nicht als Epiklese des Wettergotts, sondern als Ortsbezeichnung analog padri-tahi verstehen. Wenn es ‚lokal‘ bedeuten würde, wäre es überflüssig. Und pddãt- kann m.E. auch nicht ‚Ort‘ o. ä. bedeuten14.
14 Siehe Schürr 2007b, 121 Anm. 21. Laroche 1967, 61 hatte bei \ti: malijahi: pddãti in c, 5 angenommen, dass malijahi von pddãti abhängt und folglich darin „le téménos de la déesse“ gesehen. Wie aber schon die Parallele in c, 7ff. zeigt, ist das Bezugswort von malijahi das vorausgehende \ti (hier ‚Platz‘, siehe auch Schürr 2009a, 112f.), und mit pddãti (m.E. Verbform, siehe im folgenden Abschnitt) beginnt ein neuer Satz. Hawkins–Morpurgo-Davies 1975, 130 und Anm. 21 haben dann für hieroglyphen-luwisch TERRA-319/172-t- eine lykisch pddãti analoge Lesung pedant- erwogen, und Rieken–Yakubovich 2010, 210 halten daran fest, obwohl sie die beiden fraglichen Zeichen sonst la/i lesen: „The reconstruction of
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 129
In den griechischen Versen der Nordseite heißt es c, 30:„dem Zeus aber die meisten Siegeszeichen von allen Sterblichen stellte er auf“.
Da wird Zeus dem Wettergott entsprechen, und ¶<s>[t]hsen könnte tuwet\ entsprechen. Aber trÒpaia und kumezija lassen sich nicht gleichsetzen, und so dürfte kein Zusammenhang bestehen.
In qñnãkba steckt das Wort für ‚zwei‘, wie die Entsprechung qñnãtba d, 8 und die Weiterbildung qñnãtbisu c, 51 in den Gedichten klarmachen, wobei letzteres auf trisu ‚dreimal‘ folgt. Das macht aber die von Meriggi angenommene Bedeutung ‚zwölf‘ unwahrscheinlich, siehe auch Eichner 2005, 34. Vielleicht bedeutet also ‚qñnã-zwei‘ vier? Wenn die Wortstellung wie zuvor ist, sollte man darin den Adressaten und im folgenden eine Ortsbestimmung sehen. Dann folgt tabahaza, bei dem mir die Erklärung mit dem luwischen Wort für ‚Himmel‘, keilschrift-luwisch tappas- und hieroglyphen-luwisch tipas- (Ševoroškin 1979, 193) attraktiv erscheint. Da es Dat. Pl. sein kann, könnte es mit qñnãkba kongruieren. Und es wäre m.E. dann verlockend, diese Himmelswesen mit den vier Stierprotomen zu verbinden, die an den Ecken der Grabkammer angebracht waren und die den vier Flügelstierprotomen über dem Eingang zum Heroon von Trysa entsprechen.
Diese beiden Altäre/Kulte könnten in Xanthos zu lokalisieren sein wie die folgenden kumezija: padritahi. Erst dann folgen kumezija in Tuminehi und in Kandyba, die ein wenig überraschend als tuminehija und ãkbija bezeichnet werden, ohne dass eine Gottheit genannt wird. Neumann 1983, 150 = 1994, 212 hatte angenommen, dass diese ‚tymnessischen‘ und ‚kandybischen‘ kumezija im Aphrodision lokalisiert sind15, aber dagegen spricht, dass darauf eine Baumaßnah-me in dem weniger bedeutenden Keri folgt. Da wird nur eine Statue ‚gemacht‘, anscheinend in der Funktion eines urublij\, während zuvor in Churzi ein urublij\ und eine Statue ‚gemacht‘ worden waren. Das folgende hãtahe dient in der Schlußpassage der Südseite als eine Art Refrainwort, das der Rühmung dient (Schürr 2009b, 170), und so könnte es auch hier den Schlusspunkt der Aktion bilden.
Damit ergibt sich also etwa:
the Luwian stem *paddant- ‚place‘ finds confirmation in the existence of its cognate pddãnt- ‚place‘ in the closely related Lycian language.“
15 „Dass sich in einem Kultbereich Altäre für mehrere Götter finden, kennen wir z.B. aus Griechenland“, aber das ist ja mit Altären/Kulten für andere Städte nicht vergleichbar.
130 Diether Schürr
„Und darauf (?) (v)errichtete er kumezija Ort für Ort (?):dem Wettergott (im?) pddãtahi, (den) vier(en) (?) (in?) sein(em) rss\ni, den Himmelsherren (?), kumezija (im) Aphrodision (zu) Xanthos,tymnessische kumezija, kandybische kumezija,und eine Statue (in) Keri machte er (als) urublij\ ‚herrlich‘.“
VII
tubehi: prñnezi: se-lihbeze: ehb57ije se-dew\: zaza: se-ñtuwe <h>riha: ade: se-58ãna: ugaha: se-ñnaha: se-ñtawati 59azzalãi: ñtarijeusehe: se-j-ertassi60razahe: ride: hriha: trrmilise: se-ti: te61iweibi: ade-m\: lei qlã:
Z. 56 fehlt das b am Ende schon Fs. Mit ihm 31 Zeichen.Z. 57 nach ije Doppelpunkt Fe1-2, Sch, wohl nichts Fs. Nicht erkennbar. Ebenfalls 31 Zeichen.Z. 60 hat ebenfalls 31 Zeichen.
Cau: „per la famiglia del tubi- e per suoi lihbezi-“.Eichner: „für den Hausstand des Tube (??) und für seine/dessen Soundso und Kämpfer und Soundsos machte er“.Damit brechen diese Übersetzungsversuche ab. Etwas weiter reicht der von Melchert 2002, 247: „to the tubehi of the household and his lihbeze- and he made a dew\ for/to the warriors and ñtuweriha and (he made) ãna for the grandfather(s) and grandmother(s)“. Ich nehme an, dass hier ein neuer Abschnitt ohne Konjunktion beginnt. Erst jetzt werden ãna und dew\ ‚gemacht‘, aber in umgekehrter Reihenfolge und nach tubehi, das m.E. das erste Akku-sativobjekt sein dürfte. Vergleiche zu diesem tube (TL 29, 10) und tubehidi (TL 30 im Titel des Graberbauers), während tubedi TL 44c, 60f. wohl eher zum Verb tube- gehört. Lihbeze hat das vor allem Ethnika bildende Suffix -eze/i-. Dew\ wird hier mit zaza ‚Kämpfer‘ o.ä.16 im Dat. Pl. assoziiert, was auf der Nordseite wiederkehrt:
pddãti 6ddew\: zazãi ne-une: m\seweh{:}rmi„…en sollen Ddew\ die Kämpfer, die nicht gut ge…ten“ (Schürr 2009c, 104f.).
16 Es wird wie das b, 54 und c, 3 belegte Verb za- zu heth. z!h-/zahh- ‚schlagen‘ und zahhai-/zahhi- ‚Schlacht, Krieg‘ gestellt.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 131
Da ist Ddew\ ein Ortsname, wie der Beleg in c, 9 klarmacht: se-ddewe: sttati-m\ urublij\: me-i-ti: puwe10ti: azzalã “und (in) Ddewe soll stehen ebenfalls ein urublij\.
Nun (auf) ihm sich schreiben soll man das Dekret.“ (Schürr 2007a, 30).
Denn vorher soll je eine Stele in utãna/Hytenna und in bide/Kaunos stehen. Außerdem wird in TL 65 (Isinda) ein Heiligtum von Ddewe erwähnt: Z. 19f. trqqñti: se-[q]la-j-ebi: ddewe[zi „dem Wettergott und dem Heiligtum von Ddewe“ Z. 23f. me-i ne-httemi: tr[qqñtahi]: se-qlahi: ebijehi: ddewezehi
„dann (sei) ihm nicht Zorn des Wettergotts und des Heiligtums von Ddewe“.
Dagegen scheint es sich auf der Ostseite bei dew\ nicht um einen Ortsnamen zu handeln. Die unterschiedliche Schreibung könnte damit zu tun haben; allerdings ließe sie sich wohl auch durch einen Schreiberwechsel in der Textvorlage erklären: Der Name des Tissa-phernes wird in c, 1 zisaprñna geschrieben, in c, 11, 14 und 15 aber kizzaprñna.
Das in TL 65 erwähnte Heiligtum lässt sich wohl mit dem in Kıranda‘ı am Ostrand des Bergzugs zwischen Isinda und Apollonia durch spätere griechische Inschriften belegten Zeusheiligtum gleich-setzen (Schürr 1997a, 128)17. In TL 65 wird zwar Chezixa mehrfach erwähnt, vermutlich ein früherer Dynast (siehe Anhang), aber das Heiligtum könnte trotzdem späteren Datums als TL 44 sein. Nach Z. 39 „den sie mir beopfern sollen“ scheint dew\ zwar irgendeine Kult-Anlage zu sein, aber der Bezug zum Sprecher lässt eher an eine Beziehung zum Totenkult und damit auch an eine Lokalisierung in der Nähe seines Grabes denken. Und nun scheint d(d)ewe wegen der Verbindung mit zazãi eher von militärischer Bedeutung zu sein, was damit nicht vereinbar zu sein scheint. Aber es könnte zur Lage von Kıranda‘ı hoch über Apollonia passen. Wie aus griechi-schen Sarkophag-Inschriften hervorgeht (Schuler 2003a), gehörte es zumindest später noch zum Gebiet von Phellos, und es mag bereits hier in TL 44 ein Grenzort sein18. Und da zwischen der Ost- und der
17 Zur Verbindung mit kbij\ti in c, 4 und dem weiter nördlich inschriftlich bezeugten Peripolion der Tyinder Schürr 2009, 107 Anm. 5 und 113 Anm. 22.
18 In b, 15 werden mit trusñ: se-tuburehi die Orte Trysa und Tyberissos weiter im Osten erwähnt, aber das mag ein vorübergehendes Ausgreifen gewesen sein,
132 Diether Schürr
Nordseite m.E. ein Zeitsprung von mindestens 12 Jahren anzuneh-men ist (dazu später), könnte in dieser Zeit d(d)ewe zum Ortsnamen geworden sein.
Die Zeichenfolge ñtuweriha wird zu trennen und nach hriha in Z. 60 zu berichtigen sein. Dann ist ñtuwe eine weitere Personen-bezeichnung im Dat. Pl., entweder zu ñte-tuwe- ‚hinstellen‘ oder eher zu tuwe/i- ‚Land(?)‘. Dann wären das so etwas wie ‚Inländer‘. Und <h>ri-ha (Akk. Pl. n.) ‚Ober-ha‘ dürfte eine zusammenfassende Bezeichnung für tubehi und dew\ sein. Als drittes folgen nun die ãna, die Großvater und Großmutter zugeordnet werden – d. h. für sie bestimmt sind? Dabei könnte an den Redner zu Beginn zu denken sein (Kuprlli?).
ãna findet Anschluß in anahi im Letoon, das dort auf zwei Basen in einem Gebot erscheint (N 318 Zusatz, N 326 allein, siehe Bousquet 1992, 192f.). Vermutlich ist es eine Personenbezeichnung19. Außerdem gehört dazu auch ase, das in der Grabinschrift TL 131 (Limyra) in einer Zusatz-Strafbestimmung vorkommt: „Und es fordert (?) die Mutter des Heiligtums (= Leto) monatlich ase 5 ada“. Auch dabei kann es sich um eine Personenbezeichnung handeln, as im Dat. Sg., als Empfänger der Zahlung. Da in N 318 zuvor ein jährliches Rinderopfer vorgeschrieben wird und da in TL 131 eine in Rindern zu begleichende Buße vorausgeht, mag ein Zusammenhang damit bestehen. Dienten die „großväterlichen und großmütterlichen20 ãna“ also etwa dem Ahnenkult?
Im nächsten Satz kommt zum ersten Mal im Pfeilertext ñtawati vor, das in der Trilingue basileÊw entspricht und an ñtawatã in Z. 37 anschließt21. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Herrscher-bezeichnung hier in Verbindung mit den Namen persischer Groß-könige auftritt, und azzalãi ‚Dekrete‘ o.ä., von dem diese Namen abhängen, kann hier nur Gen. Pl. sein. Der Sinn muss wohl sein, dass das Führen dieses Titels auf die Perserkönige zurückgeht. Das Verb ri- schließt an rrmã in Z. 44 an, das Akkusativobjekt wird hriha
vielleicht nach dem Tod des Trbb\nimi, der nach a, 44f. bei Kyaneai (bane) den athenischen Strategen Melesandros besiegt hatte (430/29 v. Chr.).
19 In N 318 ist das Wort davor nicht erhalten, in N 326 geht niede voraus, das m.E. wohl kein Personenname ist (wie Melchert 2004, 100 vermutet), da dies nicht zu einem Gebot passt.
20 In dem schon erwähnten Stelenfragment N 337 in Limyra (Christiansen 2012) hat das nun in l. 7f. eine Entsprechung: ugahi: se: ñna[hi], worauf te]i: se-j- \nehi „väterlich und mütterlich“ folgt.
21 In Z. 62 folgt ñtew\: ñtawati analog ñtew\: n-emu in Z. 38, in Z. 63 ist ñtawati wohl das Satzsubjekt, und in Z. 64 erscheint die Adjektivform ñtawatije.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 133
sein. Darauf folgt trrmilise, Dat. Sg. von trrmilis. Dieses kommt wohl schon in a, 38 vor, wo tupelijã: trrmilis[ñ zu ergänzen sein wird: „den tupelija der Lykier“. Es dürfte hier trotz des Abstands an ñtawati anschließen, wie trrmilise in TL 40d an den Herrschertitel tel\zi (Schürr 2009b, 162). Daher halte ich ñtawati für einen Dat. Sg. und nicht für das Subjekt des Satzes. Dann ergibt sich, dass der bisher Handelnde die hriha an einen wenigstens nominell gesamtly-kischen ‚König‘ abtritt o.ä. und damit dessen Autorität anerkennt. Er selbst wird im folgenden Satz endlich auch mit Namen genannt sein: Teiweibi, der sonst nur von Münzen bekannt ist. Da folgt eine letzte Baumaßnahme, und -m\ spricht entschieden dafür, dass Teiweibi auch schon zuvor der Bauherr ist, also mit dem mlatraza tizzidi von Z. 40 identisch. Dass er jetzt mit Namen genannt wird, könnte damit zusammenhängen, dass er diesen Titel nun nicht mehr trug und nun sozusagen als Privatmann agierte.
Das lei: qlã ist mit dem tel\zijehi qla in b, 13 und c, 12 (da eben-falls im Akk. Sg.) zu vergleichen (Schürr 1997a, 129): kein Heiligtum (wie qla + ebi) und nicht mit Leto zu verbinden22, sondern mit lei = lai (TL 83, 9 und 14)23 von lada ‚Ehefrau‘ dieser zugeordnet wie die ãna Großvater und Großmutter. Wo er das ‚machte‘, ist nicht angegeben.
Ertaxssiraza wird allgemein mit Artaxerxes II. gleichgesetzt, der aber erst ab 404 regierte. Der Münzen prägende Dynast Teiweibi war aber unter ihm sicher nicht mehr aktiv (Schürr 2007a, 30 Anm. 6), und Artaxerxes II. passt m.E. auch nicht in die Chronologie der Pfeiler-Inschrift, soweit sie sich aus anderen Angaben erschließen lässt. Der Text der Südseite geht wohl nicht über das Jahr 428 hinaus, gehört also in die Zeit des Artaxerxes I. (464–424). Am Beginn der Nordseite tritt Tissaphernes auf, und wahrscheinlich ist da sein Aufenthalt in Kaunos im Winter 412/11 gemeint, bevor er den dritten Vertrag mit den Peloponnesiern abschloss, zusammen mit Hieramenes (Thuk. VIII 57f.), der hier in c, 12 auf Tissaphernes folgt (Schürr 1998, 150). Die Ereignisse der Ostseite dürften chro-nologisch nach 428 anzusetzen sein und wegen der Erwähnung des Artaxerxes I. gegen Ende wohl auch nicht viel später als 424, also in einem engen Zeitfenster. Der kurz darauf folgende Zeitsprung in den Winter 412/11 dürfte damit zusammenhängen, dass damals
22 So Melchert 2004, 35; vergleiche auch Neumann 2007, 185f. und besser 212 sub m\.
23 Nur durch i-Umlaut unterschieden, vergleiche etwa malijehi a, 43 neben malijahi c, 5 von malija (Athene).
134 Diether Schürr
eine Ddewe betreffende Entscheidung stattfand, also inhaltlich an die dew\ betreffenden Ausführungen der Ostseite angeknüpft wird.
In Ñtarijeusi wird man folglich Darius I. (522–486) zu sehen haben – den Großkönig, dessen Vorbild sich der Agora-Pfeiler in Bild und Schrift anschließt und der das Ka[r]ika g°now (c, 31) bereits mit der Königswürde betraut haben könnte (siehe auch Anhang). Der Dynast, der von Artaxerxes I. autorisiert wurde, wird Cher\i sein, der auf der Südseite über Tlos und den Dynasten Waxssep ddimi triumphiert und auf der Ostseite in b, 23 nochmals erwähnt wird (trijer\ er\he). Und er trägt auf seinen Münzen als erster die medische Tiara, was sein enges Verhältnis zu den persischen Großkönigen veranschaulichen dürfte. Dass Teiweibi ihn auf die hier geschilderte Weise aner-kennt, dürfte ein wichtiger Schritt in seiner Karriere gewesen sein.
Der letzte hier behandelte Abschnitt besagt also etwa:„Einen tubehi dem Haushalt und seinen lihbezeund einen dew\ den Kriegern und ñtuwe (als?) <h>riha machte erund ãna, großväterliche und großmütterliche.Und (dem) König (aufgrund) der Dekrete des Dariusund des Artaxerxes ri-te er die hriha, dem der Lykier.Und sich Teiweibi machte ebenfalls ein Temenos der Gattin.“
VIII
Es ergibt sich also, dass Teiweibi im Pfeilertext wohl eine viel größere Rolle spielt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Er scheint damit auch wichtiger als die anderen kleineren Dynasten: Trbb\nimi, der schon a, 44f. als Sieger über Melesandros auftritt und in b, 11 nochmals, Miyrapata in b, 16, Aruwãtijesi in b, 18 und 20f. – alles Namen, die auf Münzen wiederkehren24. Er ist zunächst Adressat einer Rede, deren Beginn unklar bleibt und die auf den früheren Dynasten Kuprlli zurückgehen könnte. Am Ende wird er zu bestimmten Maßnahmen im Hinblick auf Herrschaft aufgefordert. Es folgt deren Realisierung, aber im Kontext von weit umfangreicheren Maßnahmen. Die geforderten arawazija werden sogleich in Tuminehi errichtet und wohl auch da ein weiterer Grabbau plus Statue und Inschrift (?) für eine andere Person. Es folgen ein urublij\ und eine den Dynasten selbst darstellende Statue in dem nicht weiter bekannten Churza, die dem Gott Tehlus gewidmet sind. Daran schließen sich
24 Dazu kommt möglicherweise noch ein Punamuwa: b, 14f. pu[nam]uwahe und M 218a puna, b pun, M 201 pu.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 135
Opferbestimmungen, die bemerkenswerterweise auch die arawazija einbeziehen, und wohl eine weitere Baumaßnahme für Tehlus.
Der nächste Abschnitt hat nichts mit Baumaßnahmen zu tun: Thematisiert werden der Umgang mit ahata und ñteml\, was beides Personengruppen zu sein scheinen. Erstere werden anscheinend den zuständigen Göttern überlassen, letztere aber auf einer von Xanthos nach Kandyba führenden Route ‚ergriffen‘, aber mit negativem Erfolg: ‚Lykien‘, das hier als handelndes Subjekt auftritt, widersetzt sich. Die Konsequenz ist wohl, dass der Dynast nun eine Reihe von kumezija (v)errichtet, beginnend mit einem für den Wettergott und dann ebenfalls der o.a. Route folgend, wobei in der Zwischenstation Keryyi nur eine Statue aufgestellt wird, diesmal als urublij\.
Bis dahin tritt auch die große Bedeutung des Passortes Tuminehi hervor, als Scharnier zwischen dem Xanthostal und Zentrallykien, speziell dem Kasaba-Tal, das von Kandyba aus beherrscht werden konnte. Dass Teiweibi in beiden Regionen aktiv war, passt dazu, dass er Münzen sowohl im leichten (westlykischen) Standard (M 213) als auch im schweren (zentral- und ostlykischen) Standard (M 127) prägte. Münzen, die in Tuminehi geprägt wurden, sind allerdings nur von Cheriga und Miyrapata bekannt (Zahle 1988, 98 Abb. 2 und 3).
Erst danach kehren die ãna und dew\ wieder, in der umgekehr-ten Reihenfolge, wobei letzteres mit tubehi gepaart zu sein scheint. Beide werden (als?) <h>riha gemacht und dann dem jetzt einge-führten, von den Perserkönigen autorisierten „König der Lykier“ abgetreten. Dew\ wird hier mit ‚Kämpfern‘ assoziiert, was bei ddew\ auf der Nordseite wiederkehrt, das hier als Ortsname fungiert und wohl in Kıranda‘ı östlich von Isinda zu lokalisieren ist. Das scheint zu dieser Zeit ein wichtiger Grenzort gewesen zu sein.
Anschließend wird noch ein „Temenos der Gattin“ gemacht, und dabei der Dynast endlich auch beim Namen genannt.
Während die griechischen Pfeiler-Verse vom Ruhm eines einzigen Herrschers – m.E. Cher\i – künden, erhalten wir hier also überra-schenderweise einen Einblick in die res gestae eines der kleineren Dynasten. Wie ersichtlich, gibt es aber viele auch mit Ergänzungen und Emendationen nicht befriedigend gelöste Probleme: Wir verste-hen zu wenig von den Dingen, von denen der Text redet.
136 Diether Schürr
Anhang: „In den Jahren des Chezixa“ –Ruhm und Nachruhm eines frühen lykischen Dynasten
Auf dem Agora-Pfeiler in Xanthos heißt es in den griechischen Versen auf der Nordseite, dass die Götter dem Dynasten die Gunst gewährten, „sieben Hopliten zu töten am Tag, arkadische Männer“ (TL 44c, 29). Im lykischen Prosa-Text der Südseite dürfte das in a, 49 eine Entsprechung haben, wo das Zahlzeichen CII erscheint. Da handelt es sich um einen Zusatz zu dem Feldzug des Cher\i gegen Tlos, und abschließend folgt in a, 50 mit ãka: herikle ein Vergleich mit Herakles.
Diese Großtat war auch im Relief auf der Südseite der Grabkam-mer dargestellt, wo der Dynast inmitten der Getöteten erschien, von denen sechs Schilde links oben aufgereiht sind, während der siebte noch von einem Gegner gehalten wird25. 1987 zeigte Jacobs, dass damit das B%sut)n-Felsrelief des Darius I. nachgeahmt wird, der sich ebenfalls in Wort und Bild rühmt, neun Gegner in einem Jahr geschlagen zu haben. Ich habe darauf im Anhang I zu meinem Art-tumbara-Aufsatz (Schürr 2012b, 39f.) hingewiesen, aber übersehen, dass Cher\i nicht nur direkt auf den Perserkönig zurückgriff, sondern dabei schon ein lykisches Vorbild hatte, wie Colas-Rannou 2009, 464 zeigt. Im Archäologischen Museum von Istanbul ist es gleich neben seinem Triumph zu sehen: auf der Südseite der Grabkammer des Pfeilers von Isinda, der ungefähr hundert Jahre älter ist als der Agora-Pfeiler. Da hält ein Krieger, zu dessen Füßen und vor dem Gefallene liegen, den ersten einer Serie von Schilden hoch. Akurgal 1941, 55 Abb. 7 rekonstruiert acht Gefallene und Schilde, bemerkt aber S. 56, dass es auch nur sieben sein könnten.
Abb. 4. Die Tötung vieler Gegner in Isinda, nach der Rekonstruktion Akurgals
25 Rekonstruktionsvorschlag ohne Block Nr. 1394 mit einem Kopf bei Borchhardt et al. 1997–1999, Taf. 4, 1.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 137
Colas-Rannou 2009, 471 vergleicht damit beiläufig auch den „roi victorieux face aux prisonniers“ von B%sut)n und sieht in dem Pro-gramm der Pfeiler-Reliefs von Isinda „une volonté d’affirmation dans un nouveau cadre politique, celui de l’empire perse“ (Résumé S. 453), geht aber nicht auf die Texte ein, die in B%sut)n und in Xanthos das Bildmotiv erklären. In Isinda, wo die Selbstdarstellung des Darius I. kurze Zeit später nachgeahmt wurde, fehlt eine solche inschriftliche Erläuterung. Daher wird Cher\i mit der ausführlichen Beschriftung seines Pfeilers in drei Sprachen (Lykisch, Griechisch, und der Dich-tersprache ‚Lykisch B’) direkt auf Darius I. zurückgegriffen haben, wobei auch dessen Grabinschrift Vorbild war.
Es mag noch mehr Pfeiler-Reliefs mit diesem Motiv gegeben haben, vergleiche etwa den Ringkampf, der außer in Isinda auch auf einem ungefähr gleich alten Pfeiler-Relief in Xanthos erscheint, während in den griechischen Versen auf dem Agora-Pfeiler das Brillieren des Dynasten im Ringkampf hervorgehoben wird. Aber es könnte auch sein, dass eine spezifische Beziehung zwischen dem Dynasten des Isinda-Pfeilers und Cher\i bestand, d.h. beide der gleichen Dynastie angehörten.
Nun stieß Heberdey, der 1896 die Pfeiler-Reliefs von Isinda nach Istanbul schaffen ließ, dabei auch auf einen über 1,5 m hohen Pfei-ler oder besser eine schmale Stele mit einer langen lykischen und einer ebenfalls langen griechischen26 Inschrift (TL 65), die nach ihm anscheinend niemand mehr gesehen hat. Sie ist mit Sicherheit erheb-lich später als der Agora-Pfeiler, weil das Zeichen \ nicht mehr die ursprüngliche Form hat; Heberdey 1898, 42 setzte die Stele „etwa um die Mitte des IV. s. a.C.“ an. Darin taucht der Name Chezia mehrfach auf: Z. 8f. :ez 9[i?]i:, Z. 13 :[. .]eziene:, Z. 15 :eziahe:, Z. 17 :ezia:, Z. 20 Ende :eziahe.
Dabei geht dem Beleg in Z. 17 mit astti eine Verbform im Präsens voraus. Aber in Z. 15 dürfte se-uhe: eziahe: „und (in) den Jahren des Chezia“ bedeuten, also in die Vergangernheit zurückgreifen. Was folgt, ist nur teilweise klar:
teteri 16[ca. 6 Z.] mara: mla: kebeija: (usw.).27
Da könnte auf teteri ‚Stadt‘ wie in Z. 18f. mit iz19[ und Z. 21f. mit isñt[.]22[ oder izñt[ der Stadtname Isinda gefolgt sein (wohl in der Form des Ethnikons *izñtezi, vgl. nun teteri urrmezi N 337, 9,
26 Die wohl später ist, denn am Ende ist eine Geldbuße von 1000 Drachmen vor-gesehen. In lykischen Inschriften gibt es aber solche Geldbußen noch nicht. Zu dieser Inschrift auch Sokolowski 1955, Nr. 76 und Schuler 2003b, 502f.
27 Kalinka umschreibt nur „ara“, davor ist aber noch ein Winkel sichtbar.
138 Diether Schürr
siehe Christiansen 2012). Aber dann müsste man wohl in mla:k- eine zwischen mara ‚Gebote‘ und ebeija ‚diese‘ (vergleiche mara ebeija TL 45b und N 320a, 33) eingeschobene Verbform sehen, also etwa in mla<d>e oder mla<t>e verbessern. Leichter scheint mir die Annah-me, dass auf teteri hier ein Verb folgte, dann mara mit unklaren Beiwörtern:
„und (in) den Jahren des Chezia (die) Stadt […te] die Gebote, die mla: kebeija“oder „(in der) Stadt […te (man)] die Gebote“.
Damit könnte die Zeit des Chezia als vorbildlich erinnert werden.Dieser Chezia dürfte der gleichen Dynastie angehören wie Cher\i,
der auf dem Agora-Pfeiler in a, 31 ezigah: tuhes „Neffe des Cheziga“ genannt wird. Aber dieser Onkel hatte anscheinend einen gleichnami-gen Vorgänger, denn Herodot führt VII 98 beim persischen Feldzug von 480 v. Chr. unter den „namhaftesten Männern in der Flotte“ den Lykier Kybernis, Sohn des Kossikas, an. So hatte Imbert bereits 1888 die Abteilung der Namen berichtigt (siehe Neumann 2007, 178f.) und damit auch eine Entsprechung zu Cheziga gewonnen28. Bereits Heberdey 1898, 41 verglich ezia mit beiden Namen, vermutete aber in dem Chezia von Isinda „einen Nachkommen, vielleicht einen Enkel“ des in Xanthos belegten Cheziga.
Nun lebte aber Cheziga I. alias ‚Kossikas‘ zur Zeit des Darius I., kommt also für den Relief-Pfeiler von Isinda als Urheber in Frage. Warum er ihn an diesem Ort errichtet haben sollte, ist unklar. Isinda war später so unbedeutend, dass kein antiker Autor seinen Namen überliefert hat, aber es gibt dort noch weitere Grabpfeiler. Und Kybernis, der offenbar auch die Münzen mit den griechischen Buchstaben KV oder KVB prägte, wird viel bedeutender als sein Vater gewesen sein. Aber es wäre verständlich, dass man in Isinda selbst später an Cheziga I. erinnerte, wenn er dort beigesetzt war und man seinen Grabpfeiler ständig vor Augen hatte. An Kybernis erinnerte man sich dagegen in Xanthos, wie eine kürzlich entdeckte griechische Weihe-Inschrift aus dem 3. Jh. v. Chr. zeigt (Baker–Thériault 2012). Seine Heroisierung erklärt wohl auch die hellenistischen Beisetzungen zu Füßen des Harpyien-Pfeilers, der sein Grab sein dürfte, und in dem hohlen Pfeiler daneben, auf dem ein Sarkophag steht (Cavalier–des Courtils 2012).
28 Dass lykischem e hier griech. o entspricht, ist überraschend, zumal eriga auf dem Agora-Pfeiler Ka[r]ika (Gen.) in c, 31 entsprechen dürfte. Das Omikron kann aber der falschen Segmentierung und der Herstellung von Kubern¤skow geschuldet sein.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 139
Korrekturen und Nachträge zu Schürr 2009b
S. 160f. h\mene- ‚Bogen‘ (?) lässt sich vielleicht an hieroglyphen-luwisch sà-ma- ‚Schießen‘ anschließen (siehe BOHÇA § 5 „and here he gives wild animals for shooting to me“ Payne 2010, 99).
S. 167 Auf der Münze von Patara ist statt [w]assepddimi nach brieflicher Mitteilung von K. Konuk ussepddimi zu lesen, erst um 400 anzusetzen.
S. 168f. Burgin 2010 sieht in turassi lautlich und vor allem geo-graphisch plausibel den Berg Thorax (zu dessen Füßen der sandische Hügel liegt), bietet aber keine befriedigende Übersetzung:
„At Mykale, in sight of Samos, he trbb’ed the army at Mt. Thorax in order to fight, and to destroy Amorges and (his) army hãtahe“(S. 183).Das entspricht nicht der Syntax und Phraseologie des lykischen
Textes. Da hat trbbet\ zwei Akkusativobjekte, denen jeweils ein Infi-nitivsatz folgt, nämlich (a) turassi und (b) humrã = Amorges. Der Bezug von trbbe- auf eine Person passt zu dem Personennamen Trebhmiw (Partizip), aber schlecht zu einem Berg als parallelem Objekt. ‚Brust‘ könnte zwar ein sinnvoller Bergname sein, ist aber wohl eher die volksetymologische Umformung eines karischen Namens, der ursprünglich der eines Ortes gewesen sein könnte. Dafür spricht, dass es in Phrygien einen Ort Tyraxa gab, wie aus der Bezeichnung einer Muttergöttin als Turajhn[Æ] hervorgeht (Zgusta 1984, § 1386). Und wenn die Kombination mit der von Thukydides III 19 überlieferten Schlacht richtig ist, müsste turassi der Stadt Anaia westlich des Thorax entsprechen.
S. 172 sind im Diagramm zwei Namen vertauscht; es muss a. Puweje und c. Arppaxu heißen. Das Temenos der 12 Götter der Agora dürfte schon von Erbbina I. nach dem Vorbild Athens ange-legt angelegt worden sein, wo der Altar der 12 Götter auf der Agora Mittelpunkt-Funktion hatte. Der Pfeiler könnte diese Mittelpunkt-Funktion übernommen und auf den Dynasten bezogen haben.
Literatur
Akurgal, E. 1941: Griechische Reliefs des VI. Jahrhunderts aus Lykien, Berlin.
Baker, P. – Thériault, G. 2012: Dédicace de mercenaires lagides pour Kyber-nis sur l’Acropole lycienne de Xanthos, in P. Brun et al. (eds.), Carie et Lycie méditerranéennes: échanges et identités, Bordeaux.
140 Diether Schürr
Borchhardt, J. et alii 1997–1999: Archäologisch-sprachwissenschaftliches Corpus der Denkmäler mit lykischer Schrift, Anz. Österr. Ak. Wiss., phil.-hist. Kl. 134/2, 11–96.
Borchhardt, J. – Neumann, G. – Schulz, K. 2003: Tuminehi/Tymnessos, Adalya 6, 21–89.
Bousquet, J. 1992: Les inscriptions gréco-lyciennes, in Fouilles de Xanthos IX.1, III, Paris, 147–199.
Burgin, J. 2010: A Geographical Note on the Xanthos Stele, Kadmos 49, 181–186.
Cau, N. 2003: Nota sulla stele di Xanthos: TL 44b, 11–23 e 47–57, Kad-mos 42, 50–64.
Cavalier, L. – des Courtils, J. 2012: Permanence d’un culte héroïque dans la nécropole intra muros de Xanthos?, in K. Konuk (ed.), Stephanèpho-ros. De l’économie antique à l’Asie Mineure. Hommages à R. Descat, Bordeaux.
Christiansen, B. 2012: Die lykische Nova N 337 aus Limyra: Ein Vertrag zwischen der Stadt Z\muri (Limyra) und *Xuxrrme/i? Mit einem Exkurs von Heiner Eichner zum neuen lykischen Ethnikon Xurrmezi, in M. Seyer (ed.), 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des internationalen Sym-posions Wien, 3.–5. Dezember 2009, Wien, 141–153.
Colas-Rannou, F. 2009: Images et société en Lycie au VIe siècle avant J.-C.: le pilier d’Isinda et son programme iconographique, REA 111, 453–474.
Eichner, H. 2005: 4.0 Die philologische Evidenz, in J. Borchhardt – H. Eichner – K. Schulz, KERTHTHI oder der Versuch, eine antike Siedlung der Klassik in Zentrallykien zu identifizieren, Antalya, 19–37.
Fellows, Ch. 1841: An Account of Discoveries in Lycia Being a Journal Kept During a Second Excursion in Asia Minor, London.
Fellows, Ch. 1842: The Inscribed Monument at Xanthus. Recopied in 1842, London.
Hawkins, J. D. – Morpurgo-Davies, A. 1975: Hieroglyphic Hittite: Some New Readings and their Consequences, JRAS 1975, 121–133.
Heberdey, R. 1898: Eine zweisprachige Inschrift aus Lykien, Wiener Jah-reshefte I, 37–42.
Jacobs, B. 1987: Griechische und persische Elemente in der Grabkunst Lykiens zur Zeit der Achämenidenherrschaft, Jonsered.
Laroche, E. 1967: Comparaison du louvite et du lycien (suite), BSL 62, 46–66.
Melchert, H. C. 2002: The God Sanda in Lykia?, in P. Taracha (ed.), Silva Anatolica. Fs Popko, Warschau, 241–251.
Melchert, H. C. 2004: A Dictionary of the Lycian Language, Ann Arbor –New York.
Neumann, G. 1983: Zur Erschließung des Lykischen, in E. Vineis (ed.), Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione / Die indogermanischen Restsprachen, Udine, 135–151.
Neumann, G. 1984: Beiträge zum Lykischen VI, Die Sprache 30, 89–95.
Zum Agora-Pfeiler in Xanthos III 141
Neumann, G. 1994: Ausgewählte kleine Schriften, edd. E. Badalì et al., Innsbruck.
Neumann, G. 2000: Neue lykische Texte vom Av÷ar Tepesi und aus Korba, in F. Kolb (ed.), Lykische Studien 5, Bonn, 183–185.
Neumann, G. 2007: Glossar des Lykischen. Überarbeitet und zum Druck gebracht von J. Tischler, Wiesbaden.
Payne, A. 2010: Hieroglyphic Luwian. An Introduction with Original Texts, 2nd Revised Edition, Wiesbaden.
Rieken, E. – Yakubovich, I. 2010: The New Values of Luwian Signs L 319 and L 172, in I. Singer (ed.), ipamati kistamati pari tumatimis. Fs Haw-kins, Tel Aviv, 199–219.
Schmidt, M. 1868: The Lycian inscriptions after the accurate copies of the late Augustus Schoenborn, Jena.
Schürr, D. 1997a: Nymphen von Phellos, Kadmos 36, 127–140.Schürr, D. 1997b: Luwisch-lykische Wettergottformeln, Die Sprache 39,
59–73.Schürr, D. 1998: Kaunos in lykischen Inschriften, Kadmos 37, 143-162.Schürr, D. 2001: Bemerkungen zu Lesung und Verständnis einiger lykischer
Inschriften, Kadmos 40, 127–154.Schürr, D. 2004: „Handel“ in den anatolischen Sprachen. Lykische und
lydische Fußnoten zum hethitischen ‚Anitta-Text‘, IF 109, 183–203.Schürr, D. 2005: Das Pire-Poem in Antiphellos, Kadmos 44, 95–164.Schürr, D. 2007a: Formen der Akkulturation in Lykien: Griechisch-lykische
Sprachbeziehungen, in Ch. Schuler (ed.), Griechische Epigraphik in Lyki-en. Eine Zwischenbilanz, Wien, 27–40.
Schürr, D. 2007b: Zum Agora-Pfeiler in Xanthos I: Anschluß eines weiteren Fragments, Kadmos 46, 109–124.
Schürr, D. 2008: Lykisch urtta- und *señnaha-, IF 113, 176–186.Schürr, D. 2009a: Zwei atypische lykische Schreibungen, Österreichische
Namenforschung 37, 105–119.Schürr, D. 2009b: Zum Agora-Pfeiler in Xanthos II: Selbstlob auf Perserart
und Ordnung des Raumes, Kadmos 48, 157–176.Schürr, D. 2009c: Lykisch und karisch un-, Historische Sprachforschung
122, 100–110.Schürr, D. 2012a: „Frühe Götter“ in Lykien, Archiv für Religionsgeschichte
13, 213–224.Schürr, D. 2012b: Der lykische Dynast Arttumbara und seine Anhänger,
Klio 94, 18–44.Schuler, Ch. 2003a: Neue Inschriften aus Kyaneai und Umgebung V: Eine
Landgemeinde auf dem Gebiet von Phellos?, in F. Kolb (ed.), Lykische Studien 6, Bonn, 163–186.
Schuler, Ch. 2003b: Ein Priestertum der Artemis in Arykanda, Chiron 33, 485–504.
142 Diether Schürr
Seyer, M. – Teko‘lu, R. 2009: Das Felsgrab des Stamaha in Ostlykien – ein Zeugnis für die Ostpolitik des Perikle von Limyra?, in *h2nr. Festschrift für H. Eichner, Die Sprache 48, 217–226.
Sokolowski, F. 1955: Lois sacrées de l’Asie Mineure, Paris.Starke, F. 1990: Untersuchung zur Stammbildung des keilschrift-luwischen
Nomens, Wiesbaden.Ševoroškin, V. 1979: On the Hittite-Luwian Numerals, JIES 7, 177–198.Ševoroškin, V. 2002: Word Combination in Milyan and Lycian Inscriptions,
in A. S. Kassian – A. V. Sidel’tsev (eds.), Studia Linguarum 3, Memoriae A. A. Korolev dicata. Fasc. 1, Moscow, 117–189.
Teko‘lu, R. 2006: TL 29: Una nuova proposta di lettura, in R. Bombi et al. (eds.), Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Alessandria, 1703–1710.
Zahle, J. 1988: Den lykiske by Tuminehi, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 5, 98–104.
Zgusta, L. 1964: Kleinasiatische Personennamen, Prag.Zgusta, L. 1984: Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg.
Zusammenfassung
In dem Textstück TL 44b, 34–61 ist zunächst eine Rede erkennbar, die in einer sehr knappen Aufforderung zu Baumaßnahmen mündet. Sie lässt sich vielleicht dem früheren Dynasten Kuprlli zuordnen. Es folgt die Ausführung durch eine zunächst nur mit dem Titel mlatra-za tizzidi bezeichnete Person. Sie ist sehr viel detaillierter als die Aufforderung und an ihrem Ende wird – ebenfalls ohne Namens-nennung – ein „König der Lykier“ eingeführt, der von Perserkönigen autorisiert ist. Er scheint hier auch von dem Bauherrn anerkannt zu werden. Erst danach dürfte bei einer letzten Baumaßnahme auch der Name dieses Bauherrn genannt werden: Teiweibi. Da dieser nach seinen Münzen deutlich vor Artaxerxes II. aktiv war, kann es sich bei den im Text genannten Perserkönigen nur um Darius I. und Artaxerxes I. handeln, so dass der Text der Südseite nicht über 424 v. Chr. hinausreichen dürfte. Erst danach gibt es einen Sprung in den Winter 412/11 v. Chr., der mit der Stiftung eines dewe und dessen späterem Schicksal motiviert sein könnte.