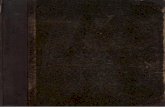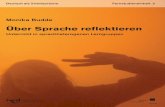Vom Drama zum Psychodrama. Über einige Zeitaspekte in der psychodramatischen Gruppentherapie
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Vom Drama zum Psychodrama. Über einige Zeitaspekte in der psychodramatischen Gruppentherapie
Drumi DimtschevVom Drama zum Psychodrama. Über einigeZeitaspekte in der psychodramatischenGruppentherapie
Drumi Dimtschev,Arzt und Psychodramatherapeut, Leiter von Ausbildungsgrup-pen am Institut für Psychodrama Ella Mae Shearon in Köln
Summary:(From drama to psychodrama. On some aspects of time in psychodrama group therapy.)Psychodrama probably is the first therapeutic method, that realizes a modern conception of time –space relation. This article demonstrates a theory about different ways of experiencing time andits application in psychodrama group therapy.
Zusammenfassung:Das Psychodrama ist wahrscheinlich die erste therapeutische Methode, die eine moderne Vor-stellung von Raum-Zeit-Verhältnissen verwirklicht. Dieses Werk demonstriert eine Theorie überverschiedene Arten von Zeiterleben und ihre Anwendung in der Praxis der psychodramatischenGruppentherapie.
Einführung
Der Zeitbegriff ist von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des psychodramatischenDenkansatzes (14). Was aber ist Zeit, wie ist Zeit zu verstehen (8,9,18)?
Der Philosoph Johannes Rehmke (1848 -1930) gibt eine ganz prägnante Definition: Zeitist ein Allgemeines, ein unveränderliches Einfaches, nämlich eine Beziehung. Weitermacht Rehmke klar, daß er damit die Beziehung „nacheinander“ meint und noch deutlicher:Nacheinander von „Augenblickeinheiten“ [24]. Was zwei Augenblickeinheiten unter-
42 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
scheidet, ist eine Veränderung; liegt keine Veränderung dazwischen, handelt es sich umdie gleiche Augenblickeinheit dieses Systems (24).
In dieser Definition ist erkennbar, daß Zeit sowohl als ein objektives Phänomen (da-her spricht man von objektiver Zeit, Welt-Zeit usw.), als auch als ein subjektives Erle-ben einer Person oder einer Gruppe von Personen aufzufassen ist.
Der Zeitbegriff entwickelt sich nach Piaget (17) in enger Verbindung mit demRaumbegriff. Beide sind nicht „a priori“ im psychischen Apparat „gegeben“, sondernbilden sich beim kleinen Kind nur aus Ereignissen, die in der Aktion entstehen. Die Er-fassung von Zeit und Raum basiert wesentlich auf der sensomotorischen Entwicklungim ersten Jahr des Lebens.
Die Verquickung vom Zeit- mit dem Raumbegriff heißt aber nicht, daß beide sich völ-lig „simultan“ bilden: es besteht ein Primat der Raum- vor der Zeiterfassung (Piaget), dasdurch die größere Anschaulichkeit der räumlichen im Vergleich zu zeitlichen Ge-gebenheiten entsteht.
Nach Piaget und seinen Mitarbeitern (17) ist das intrapsychische Bild des Raumesnie etwas anderes als die verinnerlichte symbolische Imitation früherer ausgeführterHandlungen. Eine innere „Repräsentation“ des Raumes entsteht nur dann, wenn überdurchgeführte „Aktionen“ des kleinen Kindes genügend Informationen eingetroffen sind.Dabei geht es nicht um eine einfache „Summe“ von ausgeführten Bewegungen und„Aktionen“, sondern um ihre Beziehung zueinander.
Das Erleben von Zeit ist in dem Maße mit der Erfassung des Raumes verschränkt, indem es auch auf eine Bewegungskoordination aufgebaut ist. Während der Raum in demSinne als eine „Koordination von Ortsveränderungen“1 erscheint, stellt die Zeit eine„Koordination von Bewegungen mit verschiedener Geschwindigkeit“ dar. Währendder Raum „Proportionen“ von gleichzeitig bestehenden Körpern „beschreibt“, ist dieZeit eine Erfassung von nacheinanderfolgenden Ereignissen.
Diese Erkenntnis entspricht vollkommen den Ergebnissen der modernen Physik, dieZeit und Raum als zwei „komplementäre“ Systeme oder als ein Raum-Zeit-Kontinu-um (3) darstellt: beide sind erst durch „Ereignisse“ verstehbar, wobei das „Zeitsystem“Beziehungen zwischen verschieden schnellen Ereignissen und das „Raumsystem“ Be-ziehungen zwischen „simultanen“ Ereignissen beschreibt. Die Zeit kann daher als ein„diachrones System“ verstanden werden, dessen Charakteristika die Nacheinanderfolgeund das Geschehen sind, der Raum aber – als ein „synchrones System“, zu dessenMerkmalen die Dreidimensionalität und das Nähe-Distanz-Verhältnis gehören (s. Abb.).
Versuchen wir uns vorzustellen, was passiert, wenn eine Situation, Geschichte oderinneres Bild mit ihren zeitlichen und räumlichen Aspekten im Laufe einer Psychothera-pie dargestellt wird. Viele psychotherapeutische Schulen haben hauptsächlich die Spra-che als Mitteilungsmedium und verfügen daher nur über ein Mittel in der Darstellung: dieErzählung. Wenn ein Bild erzählt wird, muß eine lineare Sprache benutzt werden, auchum räumliche (simultane) Verhältnisse zu beschreiben. Die lineare Sprachstruktur er-zeugt aber eine lineare Zeitlichkeit, die dem „diachronen System“ zuzuordnen ist. Daherkann sie nur inadäquat Ereignisse erfassen, die im synchronen System (im Raum) statt-
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 43
finden. Die Erzählung ist in diesem Sinne immer eine erzwungene „Zeit-Raum-Verzerrung“ der realen Geschehnisse (der wahren Geschichte).
Im Gegensatz dazu ermöglicht die psychodramatische Bühne, daß räumliche Ver-hältnisse durch „räumliche Sprache“ dargestellt werden. Erst wenn die Beschreibung, diezum synchronen System gehört, durch „synchrone“ Sprache erfolgt, wird es möglich, daßauch das diachrone System (die zeitliche Dimension einer Geschichte) durch das Mittelder linearen Sprache in einer adäquaten Form dargelegt wird. Mit anderen Worten: diepsychodramatische Bühne stellt einen Zauberort dar, wo gleichzeitig zwei Sprachen ge-sprochen werden können: eine räumliche und eine zeitliche.2
Abb. 1:
In einer Therapiegruppe, bestehend aus psychodramatisch unerfahrenen Patienten, fing T.D.3 (28J.) damit an, seinen Konflikt mit einem anderen Patienten zu schildern. Der genannte Mitpatientbefand sich in derselben Einrichtung, gehörte aber zu einer anderen Gruppe und war daher nichtdabei. In der Erzählung vermischten sich die Einzelheiten über den Raum, wo die Auseinander-setzung stattfand, mit zeitlichen Abläufen (wann wer was getan/gesagt hat) in einer solchen Wei-se, daß eine totale Konfusion entstand. Erst mein Angebot an T.D. als Leiter, die Szene psycho-dramatisch zu gestalten, brachte Klarheit und gewisse Entspannung, indem Raum (im Sinne vongleichzeitig bestehenden Verhältnissen) und Zeit (als Abfolge sich nacheinander abspielender Er-eignisse) voneinander entzerrt wurden. Meine spätere Nachfrage hat ergeben, daß die Erzählungder Geschichte nicht nur verwirrend und anstrengend, sondern auch als „zu lang“ erlebt wurde,währenddessen das psychodramatische Spiel von den meisten Gruppenmitgliedern als lebendig,wahrhaft und „relativ kurz“ wahrgenommen wurde, obwohl es objektiv länger dauerte.
Wie auch in diesem Beispiel deutlich wird, kann ein realistischer linearer Zeitablauf erstdann entstehen, wenn im psychodramatischen Spiel die inneren Bilder des Protagonistenauf der Bühne mit ihren konkreten Raumdimensionen aufgebaut sind. Das räumlich-zeitliche Gestalten der Psychodramabühne ist die Voraussetzung für die Wiederher-stellung der wahren Geschichte eines Protagonisten einerseits und für das effektiveErproben seiner inneren Neuorientierung andererseits. Beides setzt sicherlich voraus,daß die Psychodramabühne eine große Freiheit der Ausdrucksmöglichkeiten der Personermöglicht.
44 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
Ein anderer Aspekt, der auch durch dieses Fallbeispiel anschaulich wird, besteht in derArt und Weise, wie durch die psychodramatische Methode die Gruppe in spezifische Zeit-und Raumerlebensmuster involviert ist. Indem die Gruppe in ihrem Halbkreis die Bühneumrahmt, bildet sie hierdurch auch eine räumliche „Grenze“ zwischen den Welten „in-nen“ und „außen“. Die Zeitprozesse innerhalb der Gruppe verlaufen sehr komplex undmultipel. Als auf der Bühne das Protagonistenspiel verlief, identifizierte sich der größereTeil der Gruppe mit dem Protagonisten und entwickelte eine ihm ähnliche Art von Zeiter-leben. Andere (wenige) aber hielten sich jedoch an eine „objektive Zeitwahrnehmung“und guckten ab und zu auf die Uhr. Andere wiederum wurden am Anfang „parteiisch“und ärgerlich auf den Protagonisten, reagierten auf den Inhalt des Spieles kritisch und er-lebten daher das Geschehen als „zu lang“. Später aber wurden sie auch von der Dynamikerfaßt und näherten sich in ihrer Wahrnehmung der Mehrheit an.
Arten des Zeiterlebens und ihre Entwicklung
In meiner Arbeit über den Zeitbegriff im Psychodrama (5) habe ich versucht, detaillier-ter 4 Arten von Zeiterleben zu beschreiben, die nacheinander in der menschlichen Ent-wicklung entstehen und miteinander integriert werden. Was die Entwicklung des Zeit-erlebens anbetrifft, stütze ich mich hier hauptsächlich auf die Arbeiten von Piaget(16,17), wie auch auf einige Ergebnisse der modernen Säuglingsforschung (6,12,21,22).
Im ersten Stadium der Entwicklung des kleinen Kindes, das nach Piaget den Zeit-raum bis zum 1,5 ten Lebensjahr umfaßt und von ihm als die senso-motorische Früh-phase bezeichnet wird, geht es hauptsächlich darum, daß der Säugling langsam lernt,räumliche von zeitlichen Abläufen voneinander zu unterscheiden.
Schon in dieser Phase entwickeln sich von Geburt an erste, unbewußte, raum-zeitliche „Kognitionen“ in Form von völlig „egoistischen“ Schemata. Wie auch die ande-ren Prozesse in diesem Stadium, stützen sich diese Kognitionen auf angeborene Automa-tismen und Reflexe. Da der Säugling eine psychomotorische Koordination zwischen denverschiedenen Sinnesgebieten noch entbehren muß, sind diese Erfahrungen völlig frag-mentiert. Räumliche und zeitliche Dimensionen sind daher verschmolzen: zeitliche Fol-gen fallen gänzlich mit Raumfolgen zusammen.
Im Lichte der modernen Säuglingsforschung erscheint heute diese These von Piagetnicht unumstritten, zumindest was die Dauer dieser Phase anbetrifft. Nach den For-schungsergebnissen von D. Stern (22) reagiert der Säugling schon in den ersten Lebens-wochen überaus sensibel auf die zeitlichen und räumlichen Merkmale seiner Umgebung.
Viel weniger strittig ist aber die Erkenntnis, daß in den ersten Monaten der Entwick-lung eines Kindes die Regulation von zyklischen Abläufen einen Vorrang bekommt.„Während der ersten zwei Monate widmet die Mutter einen Großteil der Zeit der Regulie-rung und Stabilisierung der Schlaf- und Wach-, Tag- und Nacht-, Hunger- und Sättigungs-Zyklen“ (22). Diese Art von Regulierung führt später dazu, daß grundlegende physiologi-sche Prozesse, die vorwiegend außerhalb des Bewußtseins stattfinden, eine stabile Dyna-
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 45
mik bekommen, die entweder ein 24-Stunden-Muster aufweist (18) (den sog. cirkadia-nen Rhythmus) oder nach dem Homöostaseprinzip funktioniert. Die cirkadiane Rhyth-mik bestimmt hauptsächlich die Organisation des Arousal Systems (Schlaf-Wach-Regulation) und des Vegetativums. Dem Homöostaseprinzip ist die Dynamik des Trieb-systems unterworfen (6,22). Ein Beispiel für die Funktion des Homöostaseprinzips istdas „Eßverhalten“ eines Säuglings, das durch die „Extreme“ Hunger (Eßbedürfnis) undBefriedigung reguliert wird. Es entwickelt sich eine zyklische (wiederholbare) Dynamik,die folgendermaßen aussieht: relative Ruhe (evtl. Schlaf) – Ansteigen des Hungers – Un-ruhe – Erreichen eines Schwellenwertes der Unruhe – „Aktion“ (Weinen, psychomotori-sche Unruhe) – Stillen – Aufheben der Unruhe – Zurückkehren zur „Ausgangsposition“.
Was also das Zeiterleben in dieser Phase charakterisiert, ist die langsame Integrationvon rhythmischen Folgen, dessen Muster als zyklische Zeitlichkeit zusammengefaßtwird. Die zyklische Zeitlichkeit ist die früheste relativ stabile Art von Zeiterleben. Wegenihrer Zugehörigkeit zu primären Befriedigungsbereichen und Vertrauenserfahrungen (Ur-vertrauen nach E. Erikson) bleibt sie auch später als eine stabilisierende Organisation.4
Eine andere Art von Zeiterleben ist die sog. lineare Zeitlichkeit, die allgemein in derErfahrung liegt, daß Zeit eine progressive, einseitige und nicht wiederholbare Naturaufweist.
Nach Hermann Schmitz können hauptsächlich drei Arten von linearem Zeiterlebenunterschieden werden (19). Die urälteste von ihnen ist die Maßzeit oder Dauer undwird durch das Verhältnis kurz-lang, bzw. kürzer-länger gekennzeichnet. Die Lagezeitkann als eine Beziehung zwischen Gegebenheiten verstanden werden, die im Verhältnisfrüher-später zueinander stehen. Im Wesen der Modalzeit dagegen liegt eine Unter-scheidung von Vergangenheit, Jetzt und Zukunft (19).
Lineares Zeiterleben entwickelt sich nach Piaget in der nächsten Entwicklungsphase:des symbolischen Denkens (1,5 – 4-5 LJ.), wo das Kind langsam beginnt, die senso-mo-torischen Abläufe, die für die erste Phase kennzeichnend sind, in Worte zu „fassen“. „DieBegriffe, die vorher ‚getan‘ wurden, bedürfen nun zu ihrer wirklichen Bildung einer richti-gen neuen Lehrzeit“, schreibt Piaget (zit.v.3)). Das Kind entfaltet in dieser Phase einenBegriff für lagezeitliche Zeiterlebenmuster, indem es die richtige Anwendung von Prä-positionen wie „vor“, „hinter“, „vorher“, „nachher“ versucht. Allerdings ist aber in diesemStadium noch kein übergeordneter Zeit- (wie auch Raum-) Begriff vorhanden. „Die prak-tische Zeit ist für jede einzelne Handlung eine spezielle Zeit, und es gibt so viele Zeitrei-hen wie Handlungsschemata, nicht aber eine einzige Zeit, die die einen mit den andernverbände“ (3).
Eine zusammenhängende Zeitperspektive entsteht schon langsam in der danach fol-genden Phase des intuitiven Denkens (4 bis 7 LJ.). Das Kind zeigt schrittweise Ver-ständnis für „modalzeitliche“ Muster, indem es Wörter, wie „heute“, „morgen“, „ge-stern“ etc. gebrauchen kann. Es fehlt ihm aber immer noch an übergeordneten Raum-und Zeitbegriffen, was sich auch durch die weiterbestehende Schwierigkeit zeigt, diesebeiden Dimensionen auseinanderzuhalten. Die Wahrnehmung von Zeit-Verhältnissenist immer noch in hohem Maße vom Raumbegriff dominiert.5
46 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
Ähnlich groß sind die Schwierigkeiten des Kindes mit dem Begriff der Gleichzeitig-keit. Läßt man zum Beispiel in einem Experiment Spielzeugautos auf einem TischStrecken mit verschiedener Geschwindigkeit laufen und hält sie dann im gleichen Mo-ment an, so wird das Kind behaupten, daß das Auto , das die größte Strecke zurückge-legt hat, „mehr Zeit gebraucht“ habe oder zuerst stehengeblieben sei.
Die Aufgabe des Kindes in seiner weiteren Entwicklung ist es, langsam einzelne Er-eignisketten (d.h. mit verschiedenen räumlichen Verhältnissen und Geschwindigkeiten)zu einer übergeordneten abstrakten Gestalt zu koordinieren. Diese „Abstraktion“ ist näm-lich der Zeitbegriff als solcher. Wenn das Kind diese „Leistung“ erreicht hat, so befindetes sich schon im Stadium der konkreten Operationen (7-8 bis 11-12 Lj.). Die so entstan-denen neuen Zeit- und Raumbegriffe bleiben aber noch an konkrete Erlebnisse gebunden.
In diesem Stadium wird langsam ein anderes Zeiterlebenmuster präsent: die Gleichzei-tigkeit. Dieser Modus ist der generelle Nenner, der die Existenz einer zwischenmensch-lichen Beziehung als solche definieren läßt. Gleichzeitigkeit bedeutet in der zwischen-menschlichen Beziehung zugleich Gegenseitigkeit: die Mutter stillt ihr Kind nur dann,wenn das Kind gleichzeitig ihre Milch saugt; ich stehe in Kontakt zu jemandem nurdann, wenn er gleichzeitig mit mir in Kontakt steht.
Obwohl der Modus der Gleichzeitigkeit schon ganz früh im Leben funktionieren soll,wie das Beispiel mit dem Baby verdeutlicht, ist diese Art des Zeiterlebens, wie auch dieUntersuchungen Piagets bestätigen, erst später erfahrbar. Das Erleben von Gleichzeitig-keit ist die Grundlage, aus der der Begegnungsbegriff bei Moreno lebt. Begegnung be-steht für Moreno in der Unmittelbarkeit: „Es gibt kein Mittel zwischen mir und an-deren. Ich bin unmittelbar: in der Begegnung. Ich bin nicht einzig: bloß in der Begeg-nung,....Ich bin geweiht, geheiligt, gelöst in der Begegnung, ob ich das Gras oder dieGottheit treffe“ (Moreno, J.L., 1914, zit. in 15)6
Begegnungserfahrung gehört weiterhin zu einem Stadium des Zeiterlebens, das Pia-get Phase der formalen Operationen (11 bis ca. 14 Lj.) nennt. Zeit und Raum werdenschon in diesem Stadium als Abstraktionen aufgefaßt, die vom konkreten Erleben voll-kommen unabhängig existieren können. Dies ist die Vorstufe des „reifen Verständnisses“der Zeit, die nicht am konkreten Geschehen „hängt“, sondern als eine abstrakte Dimensionder Welt den unmittelbaren „dinglichen“ Abläufen gegenübersteht.7
Zu diesem „reifen Verständnis“ der Zeit gehört ein Modus von Zeiterleben, der para-doxerweise das Gegenteil von Zeitlichkeit darstellt: der Modus der Zeitlosigkeit. DasParadox ist natürlich nur ein scheinbares, denn „Zeitlosigkeit“ besteht nur dann, wennZeitverständnis schon vorhanden ist (sonst würde sein Gegenteil nicht erlebbar).
Auch in der heutigen Physik wird von der Idee ausgegangen, daß Zeit als solchenicht das letzte Konzept in der Beschreibung der Natur sein kann. „Zeit ist wederursprünglich, noch genau. Sie ist ein sekundärer Begriff. Sie wird in ihrer Wichtigkeitirgendwann ins zweite Glied rücken“ (25).
Zeit ist wahrscheinlich mit dem Urknall entstanden. Somit wird dieses „Urereignis“als das erste Tor der Zeit definiert. Der Gravitationskollaps, oder das sog. „schwarzeLoch“ stellt das zweite Tor der Zeit dar, wo es kein „Nachher“ mehr gibt: Wenn ein
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 47
Stern in ein „schwarzes Loch“ verschwindet, geht somit auch seine Materie verloren(9,25).
Was die Physiker für das Universum ahnen, ist auch auf den Maßstab des einzelnenmenschlichen Individuums übertragbar: die „Tore“ der individuellen menschlichen Zeitsind die Zeugung und der Tod. Was außerhalb dieser Grenzen geschieht ist für den Ein-zelnen mehr oder weniger „zeitlos“. Die Negation der Zeitlichkeit, die durch die Er-kenntnisse der modernen Physik beweisbar erscheint, ist eine „Urerfahrung“ des Men-schen von einem Zustand der Zeitlosigkeit, der auch bewußt oder unbewußt vom Men-schen immer wieder erstrebt wird.8
Es handelt sich um Erfahrungsweisen, die jeder bei sich erinnern, aber nicht richtig be-schreiben kann. Die einsame Meditation vor dem rauschenden Meer, die stille Träumereibeim Zuhören eines Klavierkonzerts, das glückliche Miteinander durch die Anwesenheitder/des Geliebten erleben wir als Augenblicke9, wo die Zeit „stillsteht“. Nicht nur das: essind Zustände, die etwas vom tiefen Kern unseres Selbst ausdrücken und erlebbar machen.Im Grunde genommen, sind wir alle durch eine kosmische „Urkraft“ verbunden, derMensch ist ein „kosmisches Wesen“, wie dies Moreno dachte (14). Dieses kosmische We-sen in uns überwindet die Isolation der individuellen Grenzen und des einzelnen Daseinsund ist selber zeitlosen und „ursachelosen“ kosmischen Prinzipien unterworfen.
Eine andere Seite dieser inneren Erfahrung der Zeitlosigkeit ist das vorbewußte„Wissen“ von der Endlichkeit der persönlichen Existenz: daß „irgendwann“ der Toddas Ende der „persönlichen“ Zeitlichkeit verkünden wird. Was die reife und seelisch ge-sunde Persönlichkeit charakterisiert, ist die ruhige, furchtlose Einstellung zum Tod, derals natürlicher Ausgang eines würdigen und erfüllten Lebens aufgefaßt wird. Die see-lisch gestörte Person zeigt dagegen eine verzerrte, angstvolle und karikierte Einstellungzum eigenen Tode oder versucht ihn zu verleugnen.
Integration des Zeiterlebens
In meiner schon zitierten Arbeit (5) habe ich ausführlicher die These argumentiert, daßdas Zeiterleben nicht nur in einem langsamen Entwicklungsprozeß steht, sondern daßauch die einzelnen Zeiterlebensmodi im Laufe der individuellen Entwicklung miteinan-der integriert werden (vgl. 18). Diese Integration geschieht in der Reihenfolge, in derdie einzelnen Modi entstehen. Je differenzierter das auf einem gewissen Entwicklungs-stadium „erlernte“ Zeiterlebenmuster ist, desto komplizierter ist zugleich das gesamteErleben von Zeit, weil die primitiveren Formen von Zeiterleben weiterhin in einer be-stimmten Form bestehen bleiben. So verfügt eine „reife“ Persönlichkeit zugleich übereinen cirkadianen Rhythmus (zyklische Zeitlichkeit), wie auch über lineare Zeitbegriffeund Erfahrungen mit den Modi der Gleichzeitigkeit und der Zeitlosigkeit.
Ich gehe von der Vorstellung aus, daß die gelungene reife Zeitintegration eine pyra-midale Struktur besitzt. Die „Basis“ der Pyramide wird durch das Entwickeln und Ver-
48 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
festigen relativ primitiver zyklischen Abläufe untermauert. Die „Spitze“ dagegen ent-steht durch die Integration abstrakter Prozesse höchster Ordnung. Die „Zwischenstufen“stehen für die Zwischenstadien dieses komplizierten Integrationsprozesses (s. Abb.).
Da ungefähr fünf wichtigste Stufen in der Entwicklung des Zeiterlebens nacheinan-derfolgen, bestehen auch fünf Stufen seiner Integration. Zu einer einfachen Übersichtüber diese einzelnen Ebenen habe ich folgendes Schema entwickelt:
Integration V. Ranges entspricht: der Phase der formalen Operationen nach Piaget und der „reifen“Entwicklung des Individuums; umfaßt: die Integration der anderen drei Zeiter-lebenmodi mit dem Modus der Zeitlosigkeit.
Integration IV. Ranges entspricht: der Phase der konkreten Operationen nach Piaget; umfaßt: die In-tegration des Modus der Gleichzeitigkeit mit dem zyklischen und mit dem li-nearen Zeiterlebenmodus.
Integration III. Ranges entspricht: der Phase des intuitiven Denkens nach Piaget; umfaßt: die Integra-tion von linearzeitlichen Prozessen durch Verbindung modalzeitlicher Dimen-sionen (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) mit der Dauer und der Lage-zeit. Dazu: Integration des linearen Zeiterleben des Individuums mit den zy-klisch-zeitlichen Abläufen.
Integration II. Ranges entspricht: der Phase des symbolischen Denkens nach Piaget; umfaßt: die In-tegration relativ elementarer linearer Zeitabläufe (lagezeitliche Präpositionenwie „vorher“ und „nachher“) mit zyklischen Zeiterlebenmodi.
Integration I. Ranges entspricht: der senso-motorischen Frühphase nach Piaget; umfaßt: die Integra-tion zyklischer Prozesse: cirkadiane Rhythmik, Vegetativum, Schlaf-Wach-Rhythmus, Triebdynamik usw.
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 49
Behandlung von Störungen des Zeiterlebens impsychodramatischen Gruppenkontext
Psychisches Leiden (Pathologie) beinhaltet immer auch den Aspekt von nicht gelunge-ner Zeitintegration. Jedes psychische Leiden hat eine Entstehungsgeschichte, die mitTraumatisierungen auf einem bestimmten (mehr oder weniger langen) Lebensabschnittin Zusammenhang steht. Nach D. Stern (22) läßt sich die Vielfalt an Traumatisierungendurch ein Kontinuum beschreiben, an dessen einem Extrem der (mehr oder wenigerideale) Typus von Neurosen steht, bei dem ein vereinzeltes traumatisches Ereignis aufdas Individuum einwirkt und pathogene Folgen zeitigt. Das andere Extrem bilden diekumulativ-interaktiven traumatischen Muster, die sich noch im frühesten (Säuglings-)Alter bilden und auch in der späteren Entwicklung bestehen bleiben. Es ist offensicht-lich, daß diese beiden Extreme verschiedene Arten von Störungen des Zeiterlebens er-zeugen und entsprechend verschiedene Arten von Heilung bedingen.
A. Störungen mit früher Entstehungsgeschichte.
a. Beschreibung ihrer zeitlichen Struktur.Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um Störungsbilder, die sich durch Ku-mulierung ähnlicher traumatischer Erlebnisse aus früher Kindheit entwickeln. Bestimm-te „archaisch-pathologische“ Interaktionsmuster sind im Individuum und seinem Milieuüber lange Entwicklungsphasen aktiv und bekommen eine Vorherrschaft über spätere,zeit- und entwicklungsgerechte Interaktionen. Das Zeiterleben ist entsprechend von frühenModi dominiert, die sich mit späteren in einer pathologischen Weise verwickeln. Bei einerschwerwiegenderen Störung besteht auch eine Verwechslung räumlicher und zeitlicherParameter.
Diese Art von Störungsbildern hat die zeitliche Struktur eines Mythos (vgl. 1, 2, 4, 7,10, 20), die aus den folgenden Eigenschaften besteht.
1. Zeitlosigkeit. Ein Mythos ist eine „Geschichte“, die sich in einer „unbestimmten“Zeit entwickelt. Er steht im undifferenzierten Grenzbereich zwischen dem „Realen“ ausder Außenwelt mit seiner linearen Handlungsabfolge und dem „Idealen“ aus der Weltder intrapsychischen Phantasmen, die außerhalb einer historischen Zeit stehen (schönesAnalog dazu wäre die Zeitlosigkeit eines Traumes). Daher ist es im Rahmen des My-thos sinnlos zu fragen, ob es den Ödipus oder den Orpheus „wirklich“ gab, da ein My-thos „Eigenzeiten“ und „Eigenräume“ entwickelt, die mit einem „objektiven“ Zeit-Raum-Begriff schwer zu vereinbaren sind.
Die Struktur eines Mythos ist der eines Dramas sehr verwandt. Noch im alten Grie-chenland wurde der Mythos durch die Mittel des Dramas (besser gesagt durch die Tra-gödie als früheste Gattung des Dramas) erlebbar gemacht. Die Inszenierung eines My-thos bedeutete einerseits eine weitere „Verewigung“ der beinhalteten Themen, anderer-seits aber auch eine Konkretisierung und hierdurch gewisse „Entmythologisierung“ der
50 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
erzählten Geschichte. Die dramatische Geschichte gehört meist zu einer konkreten Ver-gangenheit, sie wird aber durch den Zauber des theatralischen Spiels immer wieder neugeboren und weckt immer wieder die intensivsten Gefühle der Zuschauer.
2. Verwicklung linearer mit zyklischen Abläufen. Auch wenn sich im Mythos einlinearer Prozeß ereignet und sich als „Geschichte“ erzählen läßt, ist der gesamte Hinter-grund von einem zyklischen Ablauf dominiert. So z.B. fängt der klassische Ödipus-Mythos (dessen Inhalt uns durch die Tragödie Ödipus Rex von Sophokles überliefertwurde) mit einer erschütternden Ungerechtigkeit an: Laios, der König von Theben, derlange zu Besuch beim König Pelopses war, entführte den Sohn von Pelopses. Der be-trogene Vater betete die Götter an, Laios für seine Übeltat zu bestrafen und zwar durchseinen noch nicht geborenen Sohn: der soll Laios töten.
Die weitere Handlung, die wohl bekannt ist, führt letzten Endes dazu, daß die Unge-rechtigkeit aufgehoben wird, indem dieser Fluch in Erfüllung geht. Ödipus tötet Laios,heiratet seine eigene Mutter und bestraft am Ende sich selbst. Der ursprüngliche Zu-stand von „Gerechtigkeit“ ist wieder hergestellt und damit hat ein zyklischer Zeitablaufseinen Kreis vollendet (s. Abb.).
Abb. 3:
Diese Inkongruenz zwischen dem bewußten linearen Zeiterleben und Gestalten und derunbewußten zyklischen Zeitlichkeit, ist eine der Grundmetaphern in der Psychoanalyseund kein Zufall, daß der Ödipusmythos da eine so wichtige Rolle spielt.
3. Verwicklung vom Jetzt mit den Dimensionen der Vergangenheit und Zu-kunft. Was im Drama wie auch im Mythos zentral erscheint ist das Thema des Schick-
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 51
sals. Hamlet kann nicht das Treffen mit dem Geist seines Vaters verweigern: es ist seinSchicksal. Ödipus kann seinem Schicksal nicht entrinnen: er „muß“ seinen Vater tötenund seine Mutter heiraten. In beiden Dramen ist das Schicksal etwas, was „über“ demEinzelnen steht und womit der Einzelne sich nicht auseinandersetzen und – dementspre-chend – es nicht ändern kann, weil er tragischerweise „nur“ ein Glied in einem „Spiel“ist, das mindestens eine Generation vor ihm angefangen hat.
Es entsteht eine Zeitstruktur, wo ein Haupt-Protagonist und alle am Drama Beteiligtenverwickelt bleiben. Diese Struktur besteht darin, daß der tragische Held nicht als Schöpfersein eigenes Tun im Jetzt bestimmen kann, sondern eine fremde Vergangenheit (des Va-ters, der Mutter usw.) in der Gegenwart aktualisiert und zu dessen Opfer wird.
4. Verwicklung von Raum- mit Zeitverhältnissen. Die Geschichte des Vaters istnatürlich eine andere als die Geschichte des Sohnes, auch wenn es viele Überschnei-dungsstellen gibt. Ein Teil der Geschichte von Laios ist, daß er ein Gauner war, der ei-nen anderen Vater, seinen Sohn und die eigene Frau betrogen hat und der seinen einzi-gen Sohn (Ödipus) in Stich gelassen hat. Die wahre Geschichte von Ödipus hat einenanderen Anfang und einen anderen Ablauf, als die Geschichte des Vaters. Im Dramadagegen sind die beiden Geschichten nicht mehr zu unterscheiden: der Sohn leidet we-gen der Leiden, die der Vater anderen Personen zugefügt hat und der Vater muß von derHand seines unwissenden Sohnes sterben.
Hiermit entsteht eine Verwechslung von Personen mit ihren Grenzen (im Raum- undErlebenskontext), wie auch der Orte und Zeiten, in denen sich ihre Geschichten ereignethaben. Das, was im Schloß von Pelopes durch Laios getan wurde, wird an einem ande-ren Ort durch Ödipus wiederholt. Was damals dort durch den Vater geschah, wird späterirgendwo anders durch den Sohn aktualisiert.
Das Skript, das auf einer mythologisch-dramatischen Ebene festgeschrieben wird,umfaßt mehrere Personen und Generationen. Die beschriebenen Zeit-Raum-Verwick-lungen, die im Mythos und im Drama „produziert“ werden, sind in der Regel Phänome-ne, die nicht nur einen Protagonisten, sondern zugleich seine Antagonisten betreffen.
Die geschilderten Strukturähnlichkeiten zwischen Mythos und Drama werden michauch im weiteren Text dazu veranlassen, beide zusammen (auch durch Bindestrich) zuerwähnen. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre verschiedenen Akzente: imMythos überwiegt die „zeitlose“ Struktur, das Dramatische wird hauptsächlich mit dem„Schicksalhaften“ assoziiert.
Wenn wir als Psychotherapeuten in unserem Erstkontakt einem Patienten mit früherStörungsgeschichte begegnen, erkennen wir immer wieder einen tragischen Helden, deruns seine Problematik durch eine mythisch-dramatische Ausdrucksweise beschreibt.
Frau B.A.10 41 J., mit depressiver Störung nicht-endogener Natur, erzählte beim ersten InterviewFolgendes: „In meinem Leben bin ich immer der Pechvogel gewesen. Immer wieder passiertmir etwas Unerwartetes. Gestern z.B. ist mein Fernseher kaputtgegangen. Ich sitze alleine zuHause und plötzlich so was. Ich war so verzweifelt, daß ich alles liegen ließ. Heute, als ich ganzpünktlich zu Ihnen kommen wollte, habe ich total vergessen, daß es einen neuen Fahrplan fürmeinen Linienbus gibt; deshalb bin ich später gekommen, was mir jetzt ganz peinlich ist. Das ist
52 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
eine Geschichte ohne Anfang und ohne Ende. Es muß so was wie ein Fluch sein....“ Im weite-ren Gespräch mit dieser Patientin merkte ich, daß sie aufrichtig bemüht war, konkrete Beispielefür ihr „Pech“ oder „Schicksal“ zu liefern. Womit sie völlig überfordert war, war die Frage, wiesoin verschiedener „Bekleidung“ immer dieselbe Geschichte in ihrem Leben auftritt, wo sie (diePatientin) wie ein Sisyphus sich anstrengt, etwas zu Ende zu bringen, letztendlich aber scheiternsoll. Das einzige, was sie antworten konnte, war: „Ich weiß nicht... Es soll ein Fluch sein...“
In diesem Beispiel entdecken wir die schon beschriebene klassische Struktur einesDramas, aus der die Patientin alleine offensichtlich nicht aussteigen konnte. Genau sowie Hamlet, Orpheus oder Ödipus konnte sie nichts gegen ihren Fluch oder ihr Schick-sal unternehmen. Ihr Drama, wie jedes andere, produzierte sich selbst, indem es eineStruktur voraussetzte, die das Verhalten in die Richtung einer Wiederholung steuerte.Die Zuschreibung „ich bin ein Pechvogel“ tendierte sich immer wieder zu bestätigenund zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.11
b. Psychodramatische Gruppentherapie bei Störungen mit früherEntstehungsgeschichte.
Wie können wir als TherapeutInnen einer/m PatientIn helfen, die/der sich als eine(n)dramatische(n) Held(in) erlebt? Auf dieser Stelle kann ich die Frage mit dem Satz be-antworten: Indem wir ihr/ihm helfen, ihre/seine wahre Geschichte zu finden unddas Drama (den Mythos) aufzugeben.12
Denn Drama (Mythos) und Geschichte sind nicht nur zwei ganz verschiedene geisti-ge Konstrukte, sondern zwei völlig verschiedene Arten, sich selber oder einen anderenMenschen zu erleben. Der wirkliche Anfang der Geschichte von Ödipus besteht darin,daß er als kleines Kind von seinem verbrecherischen Vater in Stich gelassen wurde,dann bei fremden Eltern aufwuchs, die ihn gut behandelten, wo er sich aber nicht be-heimatet fühlte. In der Geschichte erleben wir ein verlassenes Kind, dessen Leiden unsverständlich erscheint und unser Mitleid erweckt.
Das Drama sieht aber anders aus: das Leiden von Ödipus erscheint als ein „vorpro-grammiertes“ Schicksal, sein Verhalten wirkt oft arrogant und entfremdend, insbeson-dere was den Mord an Laios anbetrifft.
Genau so war es auch mit B. A.: Durch ihr sich wiederholendes Drama konnte sie nur Abstand,Isolation und Entfremdung zu den wichtigen Anderen ernten. Sie konnte ihr eigenes Verhaltenselber nicht begreifen und sich keine Liebe geben. Desto weniger waren ihre Mitmenschen dazufähig. Viele ihrer „Annäherungsversuche“ wurden als „Manipulationen“ oder als „Suche nachAnerkennung“ abgewertet. Da sie die eigenen Motive nicht verstehen konnte, blieb ihr Verhaltenauch für die Anderen uneinfühlbar.
Der erste Aspekt einer wahren Geschichte besteht also im Wiederfinden des indi-viduellen Leidens und der dazugehörigen Gefühle. In der wahren Geschichte hat dasLeiden des Protagonisten eine verständliche Quelle und einen Sinn. Die Gefühle, diedazu gehören, sind auch für die Umgebung des Protagonisten verständlich und nachzu-fühlen. Im Gegensatz dazu wirkt das Verhalten der Person, die ihr Drama ausagiert, ent-fremdend und manipulativ.
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 53
Ein anderer Aspekt besteht in der Notwendigkeit, zwischen den Geschichtenverschiedener Beteiligter zu unterscheiden. Die wahre Geschichte von Ödipus hat ei-nen anderen Anfang und einen anderen Ablauf, als die Geschichte seines Vaters. Wasim Drama durch die beschriebene raum-zeitliche Verzerrung „schicksalhaft“ erscheint,wird in der Geschichte als real, nachvollziehbar und mitreißend erlebt.
Ein dritter Aspekt einer wahrer Geschichte ist ihre konkrete Raum-Zeit-Ord-nung. Zu einer wahren Geschichte paßt nicht der Anfang: „es war einmal...“, weil sieklare zeitliche und räumliche Parameter hat. Eine wahre Geschichte entwickelt sich ineiner bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort (oder an mehreren bestimmtenOrten). Wenn der Geschichte eine konkrete Vergangenheit zugeordnet wird, dann be-steht für die Person die Chance, ein Ende der „Tragödie“ zu finden, das 'Jetzt' frei zugestalten und die eigene Zukunft zu bestimmen. Die lineare Zeitordnung bekommt da-mit ein Übergewicht über die zyklische.
Eine therapeutische Methode ist nur dann effektiv, wenn sie das Instrumentari-um für die Übersetzung des Leidens eines Patienten von der mythisch-dramati-schen auf die geschichtlich-emotionale Sprache liefern kann.
Die Psychoanalyse benutzt für diesen Prozeß das Instrument der Übertragung, diedarin besteht, daß der Patient seine emotionale Vergangenheit im analytischen Setting„reinszeniert“, indem er wichtige Anteile seiner früheren Objektbeziehungen durch diePerson des Analytiker „wiederbelebt“. Im Psychodrama wird dieser Inszenierungsraumdurch die Bühne und durch die Gruppe kreiert, wodurch auch sehr feine Zeit-Raum-Verhältnisse wieder erlebbar und integrierbar werden.
Als Frau B. A. nach der Aufnahme in der Tagesklinik sich vor der Gruppe vorstellen sollte, warsie verwirrt: „Was soll ich den anderen eigentlich erzählen!?... Für wen ist eigentlich mein Lebeninteressant!?... Wie kann ich ihnen erklären, warum ich hier bin!?...“ Mit allen diesen Fragen, diesie mir in einer zum Teil hilflosen, zum Teil fordernd-aggressiven Art stellte, wiederholte sie oh-ne Zweifel ihr dramatisches Lebensspiel, dessen Hauptmotto war: „Ich bin ein langweiliger unduninteressanter Pechvogel und keiner wird mir zu Hilfe kommen“.
Als ich der Patientin teilweise den Druck „weggenommen“ habe und mit ihr später in dieGruppe ging, konnte sie langsam feststellen, daß nicht ihr Drama oder irgendein anderes dasHauptanliegen der therapeutischen Arbeit war. In der Erwärmungphase, die dann in der Gruppestattfand, war ein strukturiertes Gruppenspiel vorgegeben: die Gruppe sollte Lebenssituationenvorspielen, die von verschiedenartigen (z.T. polaren) Gefühlen begleitet werden. Obwohl Frau B.A. sehr schüchtern wirkte, konnte sie sich am Spiel beteiligen und war deutlich berührt, als dieSituation „Party mit Unbekannten“ gespielt wurde und einer von den Herren, offensichtlich an ihrinteressiert, sie ansprach.
In dieser Übung konnte Frau B. A. schon einen wichtigen „Schritt“ in ihrer Therapie machen,indem sie entgegen ihrer ursprünglichen Erwartung nicht ihr Drama produzierte, sondern in einer,wenn auch „künstlich geschaffenen“, aber dafür klar strukturierten Geschichte, echte Gefühle vonTrauer aufkommen ließ.
Im Laufe der nächsten 2 Wochen wirkte Frau B. A. weiterhin sehr zögernd und schüchtern undhatte außerhalb der therapeutischen Sitzungen wenig Kontakt zu den anderen Gruppenmigliedern.Dann aber konnte sie sich als Protagonistin melden. Die Erwärmung für ihr Spiel kam ein Tag
54 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
vorher, als die ganze Gruppe einen Kinobesuch machte. Es lief gerade ein Film, wo es um einestark ambivalente Bindung zwischen einem älteren Mann und einer jungen Frau ging und dieFrau letztendlich eine schwere körperliche Krankheit bekam, die sie selber „Krankheit aus Liebe“nannte. Die Sozialarbeiterin, die die Gruppe begleitete, erzählte am nächsten Tag, daß Frau B. A.am Ende der Vorstellung sehr geweint habe und andererseits schwer zulassen konnte, von ande-ren getröstet zu werden.
Eingeladen auf die Bühne am nächsten Tag, teilte Frau B. A. mit, daß sie sich „für den Ge-fühlsausbruch gestern“ sehr schäme und die Gruppe um Entschuldigung bitte, weil sie alle in einevöllig blöde Situation gebracht hätte. Ich habe darauf mit der Anweisung für ein „Zwischenfeed-back“ von der Gruppe geantwortet, um zu prüfen, wie der affektive Kontakt der Gruppe zu derProtagonistin aussieht. Die Gruppe gab eine sehr warme und unterstützende Rückmeldung undzeigte deutliches Interesse daran, zu erfahren, was solche intensiven Gefühle in B.A. ausgelösthat. Von der Leiterposition her habe ich der Protagonistin angeboten, zu untersuchen, woher siedas beschämende Gefühl kennt, andere belästigt zu haben.
So wurde die erste Szene in diesem Spiel aufgebaut: Der Ort war das Zimmer in der kleinenEinzimmerwohnung der Protagonistin; in der Situation ging es darum, daß sie ihren Freund (vondem sie sich bereits vor wenigen Monaten getrennt hat) erwartet. Im Interview schilderte sie ihreBeziehung zum Freund als sehr anstrengend, er sei mit seiner Ausbildung und mit seinem sozia-len Status „für sie vielleicht eine Nummer zu groß“. Sie wünsche sich von ihm mehr Nähe undWärme, er gebe ihr aber nur Versprechungen und sie erlebe sich von ihm auch ausgebeutet. ImMoment erwarte sie Ärger, weil sie wieder Pech gehabt habe und wieder zu spät vor einem Ge-schäft erschien, das mittlerweile schon geschlossen war. Als Folge davon konnte sie nicht dasLieblingsmenü ihres Freundes vorbereiten. In der Rolle des Freundes präsentierte sie auf derBühne einen erfolgreichen, gut aussehenden Mann, der sich keine besondere Mühe in der Bezie-hung gab, sich eher bedienen ließ und selbstverständlich von seiner Freundin erwartete, daß sieihm Wärme und Gemütlichkeit gibt.
In der Situation vor der Ankunft ihres Freundes konnte die Protagonistin relativ deutlich aus-sprechen, was sie auf ihn ärgerlich macht. Als er aber ankam, war der Ärger quasi wie weggebla-sen. Ihr Verhalten wurde devot, unterwürfig, klagend und auf „Verständnis“ orientiert: der Freundsolle doch verstehen, wie peinlich ihr das Versäumnis sei und wie viel Mühe sie sich gebe, allesrichtig zu machen. In der Rolle des Freundes (die dann sehr realistisch von einem Hilfs-Ich über-nommen wurde) zeigte sie zunehmende Wut und verbale Aggressivität. Je mehr die Protagonistinin ihrer Rolle nach Verständnis suchte, desto ärgerlicher wurde der Freund, der schließlich brüllte,er hätte einen schweren Tag hinter sich und hätte sich nach Ruhe und Gemütlichkeit gesehnt undkönne diese ganzen Geschichten nicht mehr hören.
Gefragt nach ihrem Befinden sagte die Protagonistin, sie fühle sich einerseits ärgerlich auf denFreund dafür, daß er ihr nicht den Trost und die Wärme gibt, die sie erwartet, andererseits aber„nichtig“ und „klein“, als jemand, der so unbedeutend ist, daß er gar kein Recht darauf hat, sichetwas zu wünschen und auf andere ärgerlich zu sein. Die Stimme der Protagonistin wurde immerstiller, ihr Körper wurde „immer kleiner“, weil sie langsam die Haltung eines kleinen Kindesübernahm. In der Situation wurde ihr Ärger auf den Freund von mehreren Gruppenteilnehmer ge-doppelt. Die Protagonistin schien am Anfang halbherzig diese Doppel anzunehmen, dann aberwirkte sie zunehmend „abwesend“, als ob dies ein fremdes Spiel sei.
Ich hatte die Hypothese, daß die Szene mit dem Freund eine tatsächlich stattgefundene Episo-de war, aber immer noch nicht die wahre Geschichte des Leidens dieser Patientin darstellte. Dennes war offensichtlich, daß es kein wahres Verhältnis zwischen zwei Erwachsenen war, sondern
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 55
eine Übertragungsbeziehung, wo jeder von beiden im Anderen die unterstützende und wärme-spendende Person suchte. Indem B.A. ihren Freund durch Nichterfüllen seiner Wünsche dafür be-strafte, daß er nicht ihren Erwartungen entsprach, zeigte der Freund ihr gegenüber Unzuverlässig-keit, verletzendes und aggressives Verhalten als Strafe dafür, daß sie nicht die ideale mütterlichePerson für ihn war.
Der böse Zauber des Mythos war in dieser Szene noch nicht durchbrochen. Die emotionaleAntwort der Protagonistin war hier eindeutig: außen erlebte sie einen „Block“ von Resignation,innen war sie in einem Zeitchaos. Denn es stimmte tatsächlich etwas nicht mit der Zeit. Wie kannsich eine Partnerin adäquat in der Situation mit ihrem Partner fühlen und die entsprechendenEmotionen äußern, wenn sie in einem kindlichen Körper steckt?
Deshalb bot ich der Protagonistin an, mit mir nach einer Szene zu suchen, wo sie sich so be-schämt, unverstanden und resigniert wie jetzt fühlte. In meiner Intervention setzte ich viel auf dieSensationen ihres Körpers, denn ich wußte, daß ihr Körper keine Mythen, sondern die wahre Ge-schichte erzählte.
Diese Strategie erwies sich als richtig: Die Patientin gestaltete eine Szene, wo sie sich alsvierjähriges Kind um ihre immer kranke Mutter kümmern sollte. Der Ort der Handlung war dasSchlafzimmer, wo die Mutter lag; der Vater war „wie immer“ abwesend. Die Protagonistin alskleines Kind versuchte, ihre Mutter zu bedienen. Die Wünsche der Mutter hatten kein Ende, siestellte sich sehr leidend (Migräne!) dar, sprach mit leiser, aber fordernder Stimme und beschrieb ineiner für ein Kind unzumutbarer Ausführlichkeit ihre Leiden. Nach anfänglich häufigem Rollen-tausch konnte das Hilfs-Ich sehr zutreffend die Rolle der Mutter übernehmen. In der Szene ging esweiterhin darum, daß die Mutter immer wieder das Kind irgendwohin schickte und immer unzufrie-den war: mal weil das Kind zu langsam sei, mal weil es nicht gerade das Richtige geholt habe usw.Im „Selbstgespräch“ war die Protagonistin als kleines Kind sehr unzufrieden mit der Mutter undwurde immer ärgerlicher. Gleichzeitig hatte sie eine große Angst davor, die Mutter zu verlieren,denn sie erlebte ihre Schmerzen als lebensbedrohlich. Noch stärkere Angst hatte sie aber davor,daß sie durch ihren „Ungehorsam“ den Tod der Mutter verursachen könnte.
Der Höhepunkt war der Moment, wo die Szene mit dem „Hin-und-her-Schicken“ maximiertwurde und die Protagonistin ein Glas kaputtmachte. Im Rollentausch mit der Mutter kamen inten-sive Wutgefühle, die die Protagonistin in ihrer eigenen Rolle als Kind unter Kontrolle zu bringenversuchte. Für einem Moment stieg sie aus der Rolle aus mit den Worten: „Das war nicht so; ichschreie jetzt, meine Mutter hat mich nie angeschrien. Sie konnte mit mir alles machen, schreienkonnte sie aber nicht“. Sie wollte die Szene nicht weiter spielen. Gefragt nach ihrem Befinden,sagte sie: „Jetzt ist es o.k. Ich bin sehr entlastet, weil ich endlich einen Schrei aus mir herausbrin-gen konnte“.
Im Sharing wurde sie durch viele Geschichten anderer Gruppenmitglieder belohnt , im Rollen-feedback bekam sie die wichtige Rückmeldung vom Hilfs-Ich, das die Mutter gespielt hat, daß siesich in der Rolle vom Vater verlassen fühlte und mit ihrem ganzen Leben so unzufrieden war, daßes ihr überhaupt nicht um ihre Tochter ging. Es wurde auch für die Protagonistin deutlich, daß dasLeiden der Mutter andere Quellen hatte und nicht durch sie als Tochter verursacht wurde.
Dieses Spiel war ein wichtiger Schritt dazu, den Mythos zu erkennen und die wahre Ge-schichte der Patientin herauszufinden. „Irgendwann“ in der Kindheit von B.A. wurdeder „zeitlose“ und zugleich „ewig wiederholbare“ Mythos geboren, daß sie sich „im-mer“ um die Personen kümmern müsse, von denen sie eigentlich erwarten sollte, daßsie ihr Schutz und Wärme geben und daß das Wohlbefinden und sogar das Leben dieser
56 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
Personen in ihrer Verantwortung liege. Ihr Schicksal war aber, ihre Aufgabe „nie rich-tig“ schaffen zu können, weil sie letztendlich durch Ungehorsam, Ungeschick oder ein-fach Untauglichkeit (eigentlich ging es um abgespaltene Wut!) immer „alles wie einGlas kaputtmache“ und „immer wieder neu anfangen müsse“. In diesem Mythos warnicht nur ein unveränderbares individuelles Schicksal enthalten, sondern auch eineWiederholung der Geschichte der Mutter: genau so wie die Mutter soll auch die Tochterleiden und zu Einsamkeit verdammt sein!
Im psychodramatischen Spiel dagegen gab es zwei Geschichten: die der Mutter unddie der Protagonistin. In der Geschichte der Mutter ging es um eine mit ihrem Lebenunzufriedene Frau, die sich verlassen fühlte und innerlich sehr wütend (auf den Vater)war, aber ein großes Problem hatte, mit ihrer Wut fertig zu werden und Migräneanfällebekam. Dies war die Hauptlinie in der Geschichte. Was die Mutter mit ihrem Kindmachte, war nur eine Nebenlinie: sie ließ sich durch ihre kleine Tochter bringen, was sievon anderen Erwachsenen in ihrem Leben erwartete (vom Ehemann) oder noch früherselbst als Kind erwartet hatte (von der eigenen Mutter).
In der Geschichte von B.A. ging es um ein emotional verlassenes Kind, das auf dieMutter sehr viel Wut hatte, weil es sich von ihr schlecht versorgt fühlte. Die Wut wurdenoch stärker, weil das Kind merkte, daß die Mutter es noch dazu für „die eigene Ver-sorgung“ mißbrauchte. Das Kind fühlte sich aber in seiner Wut „nicht richtig“, weil esgroße Angst um das Leben und um die Gesundheit seiner Mutter hatte und befürchtete,daß, wenn auch die Mutter nicht mehr auf dieser Welt lebe, auch sein eigenes Leben inGefahr sein würde. Da das Kind nicht offen wütend und aggressiv werden konnte (ausAngst!), wendete es die Aggression gegen das eigene Selbst oder zeigte seine Wut derMutter „indirekt“, z.B. durch „ungewolltes“ Zerstören von Gegenständen.
Das Drama von B.A. bestand aus der „blinden“ (unbewußten) Wiederholung stereo-typer Handlungs- und Erlebensmodi, wo die einzelnen wichtigen Personen im Laufe ih-res Lebens in der Tat austauschbar waren. Der Freund, der am Anfang des Spiels eineso große Wichtigkeit hatte, war am Ende „nur ein Schatten“ in der realen inneren Weltder Protagonistin. Ähnlich wie Orpheus, der in die Schattenwelt hinunterging, denSchatten von Euridike traf und daran scheiterte, sie zu einer realen Gestalt zu verwan-deln, habe ich auch die Beziehung der Protagonistin zu ihrem Freund (und natürlichauch umgekehrt) erlebt. B.A. versuchte vergebens, sich durch ihren Freund etwas vonder Vergangenheit zurückzuholen, war aber nicht imstande, zu ihm eine reife Beziehungzu entwickeln, da sie seine Person nicht in ihrer realen Qualität und den realen Grenzenwahrnehmen konnte. Der Freund blieb für sie ein zeitloser Schatten und wie OrpheusEuridike, hat sie ihn in ihrem Leben für immer verloren.
Dieser Schattenaspekt des Erlebens war deutlich auch daran zu erfahren, wie dieProtagonistin sich selbst erlebte. In der Szene mit dem Freund war sie selbst ein Schat-ten, der immer mehr verblasste und irrealer wurde. Sie tendierte immer mehr dazu, ineiner eigentlich konkreten Szene eine zeitlose mythische Erlebensweise zu aktualisie-ren, in der sie für reale menschliche Gefühle und menschlichen Kontakt unerreichbarwar. Ihr Mythos und ihr Drama führten ihre Existenz außerhalb der geordneten
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 57
linearen Zeit, sie „parasitierten“ nur auf der linear-zeitlichen Ebene und zerstör-ten hiermit auch teilweise die reale Zeitlichkeit im Erleben.
Ein anderer wichtiger Aspekt bestand darin, daß im Drama alles „zusammengehörte“:das Leiden der Mutter wurde als vom Kind verursacht erlebt; das Kind befürchtete, daß esmagischerweise durch kleine „Auslassungen“ die Mutter töten könnte. Die Parallelen mitdem Ödipus-Drama waren hier augenscheinlich. Die innere „Beschäftigung“ mit Themen,wie das Leiden und das Wohlbefinden der Mutter, wie auch die starre Kontrolle über ihrewahren Gefühle bedeuteten für B.A. eine übermäßige innere Wichtigkeit des Mutterin-trojekts und dementsprechend – den Verlust an eigener Energie. In der psychodramati-schen Sitzung war es gerade umgekehrt: Die Mutter bekam ihre Geschichte zurück undwurde zu einer realen Person, mit realen Grenzen und eigener Vergangenheit. Die Ge-schichte der Tochter wurde von der Geschichte der Mutter „abgekoppelt“ und erst dannwar es möglich, daß B.A. ihrer realen Mutter begegnen und ihre Rolle erleben konnte.
In meiner Arbeit mit Psychodrama fasziniert mich oft die Erfahrung, daß die Mehr-dimensionalität der Dynamik immer wieder ein „Fenster“ in die richtige Geschichte an-bietet. Ähnlich wie im Märchen „Des Königs neue Kleider“, wo alle durch den Mythosgeblendet sind, bis endlich ein naives Kind die wahre Geschichte ausschreit. In derdurch den Mythos verzauberten erwachsenen Protagonistin sitzt oft ein Kind, das diewahre Geschichte ausrufen will, auch wenn die ganze Menge herum es zur „Vernunft“zwingt. In der ersten Szene des Spiels von B.A. hat sich dieses kleine Kind in der Kör-perhaltung gezeigt und die wahre Geschichte erzählt. Das wichtigste Indiz dafür, daß essich dann in der zweiten Szene (mit der Mutter) um eine wahre Geschichte handelte, be-stand darin, daß die Protagonistin anfing, wieder zu „leben“ und echte Affekte auszu-drücken. Auch wenn die Szene von ihr unterbrochen wurde, konnte die Protagonistindoch den Wutaffekt, der zu ihrer wahren Geschichte gehörte, erleben und noch mehr:zwischen ihrer Wut und der Wut der Mutter unterscheiden.
Noch faszinierender erscheint die Rolle der Gruppendynamik im Prozeß der Rekon-struktion der wahren Geschichte. Noch in der ersten Erwärmung, die B.A. erlebte, wur-de sie durch die Gruppe zu einem raum-zeitlichen Experiment eingeladen, dessen Sinnin der Hilfe bestand, aus der raum- und zeitlosen mythisch-dramatischen Bühne ihresLebens auszusteigen, um sich in klare Situationen zu begeben, wo echte Gefühle undwahres Erleben berührt wurden. Der weitere Austausch in der Gruppe, die aus hetero-genen Patienten mit verschieden langer psychotherapeutischer „Praxis“ bestand, be-deutete für B. A. eine weitere Erfahrung, nämlich daß an ihrer Person ein mehrfachesInteresse besteht und daß sie sich auf die Gruppe wie auf eine „gute Mutter“ verlassenkann. Gleichzeitig wiederholte sie vor der Gruppe etwas von der Geschichte mit der ei-genen Mutter, indem sie sich für ihr Leiden (ausgelöst durch den Inhalt des Films)schuldig fühlte und die Angst entwickelte, durch das eigene Bedürfnis die Mutter ver-letzen (töten) zu können.
Wie auch die moderne Psychoanalyse feststellt (23), werden wichtige Erlebensberei-che zuerst durch das „Tun“ von der Person erforscht und „erlebbar“ gemacht. Das Ver-trauen in der Beziehung ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, daß dieses Tun ei-
58 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
nen Sinn erhält. B.A konnte die Gruppe durch ihr Tun erst dann „belästigen“, nachdemsie ein gewisses Vertrauen zu ihr aufgebaut hatte.
Dann, im Spiel, konnte sie sehr differenziert unterscheiden, welcher Teilnehmer wel-che Rolle als Antagonist übernehmen sollte und andererseits waren die in ihre Ge-schichte eingeladenen Mitspieler stark involviert. Unter den übrigen Teilnehmern habeich drei Typen beobachtet: 1. die durch die Tragik des Mythos erfaßt waren und wiegelähmt auf ihren Stühlen saßen, 2. die mit der wahren Geschichte identifiziert warenund die Wut von B.A. (als Erwachsene, wie auch als kleines Mädchen) intensiv gedop-pelt haben und 3. die mit regem Interesse die Szene beobachteten, aber gewisse emotio-nale Distanz bewahrten. Diese drei Typen waren nicht starr verteilt, sondern wechseltenmit der Zeit.
Es war auch offensichtlich, daß die verschiedenen „Zuschauer“-Typen auch unter-schiedliche Arten von Zeit-Raum-Erleben aktualisierten. Für die „Involvierten“ war dieZeit kurz, intensiv und spannend, die „Erstarrten“ verloren das klare Zeitmaß und die„Neutralen“ guckten ab und zu auf die Uhr, um zu prüfen, ob es nicht schon Mittagszeitwar.
Diese Fallgeschichte habe ich gewählt, weil sie einen wichtigen Aspekt enthält, derzum Thema dieses Artikels gehört: der wichtigste Schritt zur Rekonstruktion der wah-ren Geschichte der Protagonistin kam nicht auf der Bühne, sondern im Rollenfeedbackund im nachfolgenden Gruppenprozeß, wo die deutliche Rückmeldung vom „Mutter“-Hilfs-Ich und der Gruppe die weitere Abkoppelung der beiden Geschichten (der Mutterund der Tochter) möglich machte. Die Nachbesprechungsphase im klassischen Psycho-drama, wo nicht mehr „die Bühne“, sondern die Gruppe den Vorrang bekommt, ist derZeitpunkt, wo die verschiedenen Arten von Zeiterleben in der Gruppe für jeden Einzel-nen, wie auch für die Gruppe als Ganzes miteinander integriert werden. Jeder Teilneh-mer teilt sich über die eigene Erfahrung im Spiel mit, je nach der „Rolle“, die er dabeiübernommen hat: als Betroffener, als Mitfühlender, als Mitspieler, als kritischer Beob-achter usw. und somit implizit darüber, welche Art(en) von Zeiterleben er im Laufe desSpiel verkörpert hat. In diesem Austausch bekommt jeder die Wahrnehmung des ande-ren mit und hiermit auch die Gelegenheit, eine neue Synthese verschiedener Zeiterle-benmodi zu gestalten.
In diesem Beispiel wird deutlich, daß die wahre Geschichte der Protagonistin nur imRahmen eines komplexen psychodramatischen Gruppenprozesses rekonstruierbar war.Hiermit bekam die rekonstruierte wahre Geschichte eine „richtige“ Zeit und einen„richtigen Ort“ wieder. Moreno meinte, daß das Psychodrama nur dann eine wahre the-rapeutische Methode sein kann, wenn sie der Person dabei hilft, ihre bisher verborgenenGefühle „in statu nascendi“, im Zustand und auf dem inneren Ort (Locus) ihres Entste-hens, wiederzuerleben. So können wir auch seinen berühmten Satz verstehen: „Jedeswahre zweite Mal befreit vom ersten“ (Moreno, J.L., 1923, zit. v. 11). Ein Mensch kanndie mythisch-dramatische Konstruktion seiner inneren Welt so lange wiederholen, bis erstirbt; dadurch wird er aber nicht befreit. Ein Protagonist kann auf der Bühne eine Szenenach der anderen produzieren, bis er in Ohnmacht fällt, ohne von der ewigen Wiederho-
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 59
lung seines Lebensdramas erlöst zu sein. „Das wahre zweite Mal“ findet nur dannstatt, wenn der Protagonist seine wahre Geschichte in der „Zeit“ und am „Ort“ ihresEntstehens mit den dazugehörigen wahren Gefühlen in seinem Inneren erlebt undmit dem „übrigen“ Zeiterleben integriert.
B. Störungen mit traumatischer Genese, dargestellt durch zweiVignetten.
Wie im vorigen Fallbeispiel gezeigt, besteht das Problem bei den „kumulativen“ Stö-rungsmustern im Überwiegen zyklischer Zeitlichkeit, wie auch in der Verwicklungräumlicher mit zeitlichen Abfolgen. Dies ist offenbar bei Störungen mit traumatischerGenese anders: Da ein traumatisches Moment nur in einer spezifischen Phase gewirkthat, wird dieses Trauma als ein „Riß“ in der Lebenslinie der Person erlebt, der schwer ineine sonst kontinuierliche Entwicklung zu integrieren ist. So ein zeitlich begrenztesTrauma verändert in ähnlicher Weise auch das Zeiterleben von Menschen, die an einer„kumulativen“ (frühen) Störung leiden: Das spezifische traumatische Moment erzeugteine Art Bruch in der üblichen Organisation des Zeiterlebens.
Im Protagonistenspiel mit O. H. (29 J.) bin ich als Leiter an den Punkt gekommen, wo das Thema„Anerkennung von Anderen“ im Vordergrund stand. Bald entstand ein Bild, wo der 16-jährige O.H. stolz sein selbstrepariertes Mofa vor seinen Mitschülern zeigte. Das Geschehen wurde auchvom ironischen Blick seines Vaters beobachtet, der kurz darauf zu den Anderen kam und spottendviele „Reparaturfehler“ aufdeckte. Dies führte dazu, daß O. H. auch von seinen Mitschülern ver-spottet und beschämt wurde. Die Niederlage und die damit verbundene Scham waren für O. H.offensichtlich so groß, daß er sich zu Hause auf dem Boden versteckte. Mein Versuch als Leiter,O. H. über seine momentane Gefühlslage zu interviewen, wurde abgelehnt durch eine lange Er-zählung über das, was nachher geschah: viele erfolgreich reparierte Motorräder und gute Leistun-gen im Motorsport. Das Erzählen über den späteren Erfolg war lustlos und von einer bedrücktenMiene begleitet.
Es war für mich klar, daß O. H. jetzt die lineare Art von Zeiterleben dazu benutzte, um von derWiederholung der damaligen Niederlage wegzukommen. Denn das Trauma, für reale Leistung nichtanerkannt, sondern verspottet zu werden, war für ihn sehr schmerzhaft – insbesondere deshalb, weilsein Vater für ihn damals ein Idealbild verkörperte. Heute versuchte er quasi das Trauma zu über-springen, indem er nicht aufhören konnte, über das Gegenteil vom dem zu berichten, was der Grundfür die Beschämung damals war. Diese Taktik war aber wenig erfolgreich, denn er wurde immer de-primierter. Die Verleugnung des Traumas konnte nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Ein Blick auf die Gruppe, die offensichtlich viel Mitgefühl mit dem Leiden vom O. H. hatte,gab mir den Mut, O. H. ein zyklisch-zeitliches Ritual vorzuschlagen, in dem er von der Gruppegetragen und vorsichtig geschaukelt werden sollte. Nach kurzem Zögern willigte er ein, die Grup-pe näherte sich an und hob ihn sehr behutsam hoch. Als das Schaukeln begann und die Gruppeein langsam-rhythmisches Summen von sich gab, wurde O. H. von intensivem Trauergefühlüberwältigt, woran die ganze Gruppe beteiligt war. Erst dann war er imstande, die traumatischeEpisode mit den dazugehörigen Gefühlen wiederzubeleben. Nach dem Spiel war O. H. einigeWochen lang mit Trauerarbeit beschäftigt.
60 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
Dieses kleine Beispiel demonstriert sehr anschaulich einen Fall, wo das lineare Zeiter-leben mit Qualitäten wie Erfolg, Prosperität und Zielstrebigkeit über andere Zeiterle-benmodi dominierte, wodurch das Verarbeiten des Traumas durch Trauerarbeit verhin-dert wurde. Denn zum Trauern ist ein gewisser „Ausstieg“ aus dem Fluß des Lebensnötig und es ist auch das Vertrauen nötig, daß jemand dabei nicht „fallengelassen“ wird.Alles Qualitäten, die mit nicht-linearen Arten, die Zeit zu erleben, zusammenhängen.Die jahrhundertelangen Erfahrungen mit Babys zeigen, daß die sich zyklisch wiederho-lenden Handlungsmuster, die die Mutter unternimmt, eine starke beruhigende Wirkungauf das Kind haben. Dies kann einfaches Schaukeln sein, wiederholtes Vorsingen einerkurzen Melodie, Wiederholung einer gemeinsamen Handlung oder sogar wiederholtesAussprechen eines einzigen Wortes mit der gleichen Mimik und Gestik.
Ähnlich war auch das vorgegebene zyklisch-zeitliche Ritual bei O. H. der Punkt, woer aus der fesselnden Linearität des Erlebens aussteigen und sich auf die tragende Qua-lität eines zyklischen Prozesses verlassen konnte.
Und noch etwas: Die übermäßige Linearität des Zeiterlebens war etwas, was dasnormale Maß an Lebendigkeit, Gesundheit und Freude bei O. H. verhinderte. Wie ichschon im ersten Punkt dargestellt habe, wird die Grundlage von adäquater Befriedigungund Urvertrauen durch zyklische Austauschprozesse geschaffen, die auch im späterenLeben wirksam bleiben. Durch das Wiederentdecken einer gesunden zyklischen Erleb-nisqualität konnte O. H. später etwas von seiner ursprünglichen Zufriedenheit im Lebenwiederfinden.
G.S. war ein 26-jähriger Mann ausländischer Herkunft. Sein Hauptthema war Verlust: zuerstverlor er mit 4 Jahren seine Eltern, die nach Deutschland als Gastarbeiter zogen, dann verlor erseine Heimat, als er selber mit ca. 10 J. endlich zu den Eltern kam. In der bisherigen psychothera-peutischen Arbeit thematisierte er hauptsächlich seine ambivalente Beziehung zu beiden Eltern-teilen und erkannte dabei, daß er noch früher von beiden emotional verlassen wurde. Der Verlustder Heimat war ein Punkt, der ihn erst später beschäftigte, als er in einem Gespräch von mir einWort in seiner Sprache hörte. Dies überraschte ihn zuerst positiv, dann aber wurde er nachdenk-lich. Dies wurde zum Thema in der nächsten Einzelsitzung. Er erzählte ausführlich über seineErinnerungen an das heimatliche Dorf und wurde immer deprimierter dabei. Auf meinen Vor-schlag, den Ort aus seinen Erinnerungen auf der Bühne aufzubauen: den Hügel, den Weg hinunter,die ersten Häuser des Dorfes usw., reagierte er mit viel Aufregung. Es kamen Szenen von tieferSehnsucht nach der abwesenden Mutter und von tiefer Berührung durch die wachgerufene Erinne-rung an die Heimat. Im Interview benutzte ich dreimal Wörter in seiner Sprache: Hügel, Weg undFels. Langsam kam er zu einer tiefen Verzweiflung: ich hatte mit einem Kind zu tun, das für immerseinen heimatlichen Boden verloren hat. Er weinte und schrie: „Meine Heimat habe ich für immerund ewig verloren.... Der Hügel, der Weg, das Dorf.... das sind wunderschöne Dinge, wertvolle Er-innerungen, die ich nie wieder in meinem Leben finden werde“. Er zitterte am ganzen Körper undstrahlte totale Hilflosigkeit aus. Ich bat ihn, mit dem Berg in Berührung zu kommen, um aus seinerKraft zu schöpfen und übernahm selbst die Rolle des Berges, indem ich mich auf das Materialstütz-te, das ich durch den Rollentausch davor (G.S. mit dem „Berg“) gewonnen hatte. Insbesonderebetonte ich den Satz, daß ich schon ewig auf meinen Platz stehe und in Ewigkeit bleiben werde.Das Wort „ewig“ schien auf den Protagonisten eine wundersame Wirkung zu zeigen. Denn was
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 61
„ewig“ ist, kann nicht richtig verlorengehen. Es kamen jetzt Tränen anderer Art: warme heilsameTränen, wobei er immer wiederholte: „Du bist ewig da... Ich war weg.... Jetzt habe ich dich wie-der gefunden“. Am Ende der Sitzung schüttelte er meine Hand und sein ganzes Gesicht strahlteDankbarkeit aus.
In den nächsten Tagen erzählte er lebhaft über diese Erfahrung in der therapeutischen Gruppeund fand bei den Mitpatienten eine warme Unterstützung. Durch diese Episode verlor er seinebisherige devote Haltung (wohinter sich viel aggressives Potential versteckte) und wurde zu ei-nem anerkannten Mitglied im Gruppensoziogramm. Er war kein „Ausländer“ in der Gruppe mehr,sondern einer, der dazu beisteuert, daß die Gruppe etwas von der Funktion der gut genug versor-genden Mutter (Winnicott) weiterträgt.
In diesem Fall war ein wichtiges Prinzip enthalten, nämlich daß der „Riß“, der durchVerlust entstanden war und der Verleugnung, Aggressivität und unbewußten Neid aufandere Menschen hervorgerufen hatte, durch die Einführung der Dimension der Zeit-losigkeit zu heilen war. Wie auch im Fall von O. H., herrschte im Zeiterleben vonG.S. eine übertriebene Linearität, wodurch die verheerenden Folgen des Verlusttrau-mas „überdeckt“ und das schmerzhafte emotionale Erleben „für immer seine Heimatverloren zu haben“, abgewehrt wurden. Das, was für G.S. von Wert war, glaubte er inseinem Leben verloren zu haben. Die neu gewonnene Erfahrung, daß wertvolle Din-ge auch ewig sein können, hatte daher für G.S. eine heilende Wirkung. Sein Zeiter-leben wurde als Ganzes neu organisiert: seine bisherigen Phasen von Langeweilewurden immer seltener und insgesamt wirkte er im Alltag viel ruhiger, entspannterund ausgeglichener.
Epilog: die Rolle der Gruppe im Prozeß der therapeutischenZeitintegration.
In dieser Arbeit habe ich versucht, zwei wichtige Ideen vorzustellen: Die erste davonbesteht darin, daß jede Art von psychischer Störung auch eine Störung des Zeiterlebensbeinhaltet. Die zweite Idee ist, daß die psychodramatische Therapie, wie auch jede an-dere Art von Therapie, für die Patienten einen Prozeß von Aufbau einer reiferen (ge-sünderen) Integration des Zeiterlebens darstellt. Meine Erfahrung als Psychodramatikerzeigt, daß dieser Prozeß von Zeitintegration spezifische Instrumente erfordert, wovondie Gruppe wahrscheinlich einer der wichtigsten ist.
Die Gruppe im Psychodrama hat mehrere Bedeutungen. Einerseits besteht sie ausden potentiellen Protagonisten und Hilfs-Ichen, die dann auf die Bühne kommen unddie psychodramatische Inszenierung mittragen. Die Gruppe hat aber auch eine noch tie-fere Funktion: sie ist eine Art Boden für die therapeutische Behandlung, ähnlich wie dieMutter für das Kind, die ihm Schutz anbietet oder es ablehnt.
Diese Funktion der Gruppe gestaltet sich aber noch komplexer, weil sie (die Gruppe)ein sehr komplexes Gefüge ist: ihre Vielschichtigkeit ist mit der des Chors im altgrie-
62 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
chischen Theater zu vergleichen. Wie bekannt, war der Chor ein Begleiter der dramati-schen Aufführung, der sich wie ein gigantischer „Doppelgänger“ mit dem dramatischenHelden identifizierte und ihn affektiv unterstützte (Es-Funktion), gewisse verborgeneAspekte und zusätzliche Dimensionen der Handlung aufhellte und zurückmeldete (Ich-Funktion) und nicht zuletzt – als ein „Richter“ bestimmte Handlungsweisen des Heldenverurteilte (Über-Ich-Funktion).
Im Unterschied zum altgriechischen Chor übernimmt die psychodramatische Gruppediese diversen Aufgaben nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, da die Gruppegleichzeitig aus verschiedenen Individuen mit unterschiedlicher psychischer Strukturbesteht, die an den psychodramatischen Prozessen in vielfältiger Weise beteiligt sind.
Vom Aspekt des Zeiterlebens her bedeutet dies ein sehr differenziertes und reichhalti-ges Empfinden verschiedener Arten von Zeitlichkeit, die von der Gruppe als Ganzes ge-tragen werden und womit die einzelnen Teilnehmer in einen Austauschprozeß kommen.
In der ersten Fallgeschiche (B.A.) wurde die Pathologie der Patientin als ein Mythosdargestellt, dessen Aspekte die (inadäquate) Zeitlosigkeit, die zyklische Wiederholungdes selben Leidens und daher das Gefangensein ihres Jetzt in der Falle der Vergangen-heit, wie auch die Verwicklung ihrer Geschichte mit der ihrer Mutter (zeit-räumlicheVerwicklung) waren. Der Prozeß der Heilung war als Prozeß des Wiederfindens ihrerwahren Geschichte gestaltet, der sich stufenweise durch die Interaktion und Zeitwahr-nehmung der gesamten therapeutischen Gruppe ereignete.
In den beiden weiteren Fallgeschichten ging es um Patienten, deren momentane Pro-blematik auf traumatischen Erlebnissen beruhte, die auf einen zeitlich bestimmten Punktihrer Lebensgeschichte gewirkt haben. Die Folge war eine inadäquat übertriebene linea-re Zeitlichkeit in ihrem Erleben, wodurch die traumatische Erfahrung abgewehrt wurde.Eine Trauerarbeit schien bei beiden bisher unmöglich. Bei O. H. war das gesunde zykli-sche Erleben sehr begrenzt, bei G.S. war eine Aggressionshemmung und ein sehr devo-tes Auftreten zu beobachten.
Bei O. H. hatte ein zyklisch-zeitliches Ritual eine heilende Wirkung, das ohne dieTeilnahme der Gruppe (in ihrem mütterlichen Aspekt verstanden) unmöglich wäre. DieBearbeitung des Traumas von G.S. hatte mehrere Stufen: In den ersten drei war derKontakt zu mir und das Einzelsetting wichtig: Die Erwärmung für das Thema durch dasabsichtlich benutzte ausländische Wort, die Vertiefung durch den Aufbau der Szene unddie integrierende Katharsis (J.L. Moreno, 13) durch die Einführung der Dimension derZeitlosigkeit. Die Gruppe übernahm eine sehr wichtige Rolle auf der vierten Stufe, in-dem sie die wiedergefundene Identität von G.S. zelebrierte und ihm die Möglichkeitgab, eine neue Haltung zu erproben und zu entwickeln.
Als Letztes möchte ich nochmals betonen, daß die Kenntnisse über Zeitstrukturenund Pathologien des Zeiterlebens meiner Erfahrung nach eine gute Grundlage sind, umeffektive und brauchbare therapeutische Interventionen im Hier und Jetzt zu entwickeln.
Drumi Dimtschev: Vom Drama zum Psychodrama 63
Anmerkungen
1 Zu den Ortsveränderungen gehören noch die verschiedenen „Positionen“ der Gegenstände zueinan-der, ohne Berücksichtigung eines Geschwindigkeitsmoments.
2 Das Psychodrama ist wahrscheinlich die erste therapeutische Methode, die eine moderne Vorstellung vonRaum-Zeit-Verhältnissen verwirklicht.
3 Alle Namen in den Fallgeschichten sind geändert.4 Denken wir nur an die „stabilisierende Wirkung“ von Regelmäßigkeit und Wiederholbarkeit in Zeiten von
Krisen und Erschöpfung.5 So z.B. behaupten in einem Experiment die Kinder auf dieser Entwicklungsstufe, daß dasjenige Spiel-
zeugauto „mehr Zeit“ gebraucht hat“, welches am weitesten gefahren ist. Das, was unberücksichtigt bleibt,ist also der Faktor „Geschwindigkeit“. Das Kind ist noch nicht fähig, verschiedene Geschwindigkeitenmiteinander zu koordinieren und damit zu verstehen, daß ein schneller fahrendes Automobil in einer bes-timmten Zeit eine größere Strecke zurücklegt, als ein langsames.
6 Deswegen ist Begegnung nicht beschreibbar und zum Teil nicht erfaßbar. Sie ist wie ein Fluß, der, obwohlauch immer in „fließender“ Bewegung, doch immer derselbe bleibt (eben ein Fluß). Die Begegnung ist einegleichzeitige Offenbarung, wo kein Nacheinander und kein Abwechseln von Außen (Welt) und Innen(Selbst) besteht. Erst die Störung der Begegnung ist beschreibbar, reflektierbar und untersuchbar.
7 Piaget: „Die Zeit verstehen heißt also, durch geistige Beweglichkeit das Räumliche zu überwinden. Das be-deutet vor allem Umkehrbarkeit (Reversibilität). Der Zeit nur nach dem unmittelbaren Lauf der Ereignissefolgen heißt nicht, sie verstehen, sondern sie erleben, ohne ihrer bewußt zu werden. Sie kennen heißt dage-gen, in ihr voraus- und zurückzuschreiten und dabei ständig über den wirklichen Verlauf der Geschehnissehinauszugehen“ (zit.v.3).
8 Für Meister Eckhart hatte diese „Zeitlosigkeit“ etwas von der „Substanz“, die zur Seele oder zu Gott gehört.„Kein Zweifel, Zeit hat im Wesen weder mit Gott noch mit der Seele etwas zu schaffen: vermöchte die Seelevon der Zeit berührt werden, sie wäre nicht Seele; und vermöchte Gott von der Zeit berührt werden, er wärenicht der Gott“ (zit. in 7)
9 Solche Zeiteinheiten können in der „üblichen“ Sprache nur als „Augenblicke“ bezeichnet werden, weil dasnormale Zeitmaß für sie inadäquat erscheint.
10 Diese kurze Fallgeschichte stammt aus der Zeit, in der ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Tagesk-linik der Uni-Klinik 1 in Sofia/Bulgarien psychotherapeutisch tätig war. Damals habe ich immer versucht,geschlossene Therapiegruppen zu bilden, es gelang mir aber fast nie. In dem Fall arbeitete die Gruppe schoneinige Zeit, bevor Frau B.A. dazukam.
11 Ein wichtiger Aspekt der psychischen Störung besteht darin, daß der Betroffene einen bestimmten Bereichseines Erlebens „schicksalhaft“ nicht unter Kontrolle bringen kann und daher ständig wiederholen muß.Hierfür prägte Freud den Begriff Wiederholungszwang als einen wichtigen Bestandteil des neurotischen Lei-dens und dies verstand später E. Berne unter Skript.
12 Nach D. Stern (22) besteht der Kernpunkt einer Therapie im Finden der therapeutischen Schlüssel-metapher zum Verstehen und Ändern des Lebens des Patienten. Diese Metapher wird mit einer inten-siven Lebenserfahrung assoziiert, die man als den narrativen Entstehungspunkt der Pathologiebezeichnet.
Literatur
1. BLECKWEDEL, J., Die Inszenierung von Familienmythen. In: Psychodrama, 5, Heft 2, 1992.2. BOSCOLO, L., CECCHIN, J., HOFFMANN, L und PENN, P., Familientherapie – Systemtherapie. Das
Mailänder Modell, 2. Aufl., Verlag Modernes Lernen, Dortmund, 1990.3. CIOMPI, L., Außenwelt-Innenwelt: die Entstehung von Zeit, Raum, und psychische Strukturen,
Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1988.4. COTERELL, A., Die Welt der Mythen und Legenden, Th. Knaur Nachf., München, 1990.5. DIMTSCHEV, D., Der Sieg über Chronos oder wie kann ich als Psychodramatiker mit Zeitstrukturen
umgehen. Abschlußarbeit am Institut für Psychodrama Ella Mae Shearon, Köln, 1994.6. DORNES, M., Der kompetente Säugling, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M., 1993.
64 ZPS, Heft 1, 2002, S. 41-64
7. v. FRANZ, M.-L. Zeit: Strömen und Stille, Kösel, München, 1992.8. FRASER, J.T., Die Zeit. Auf den Spuren eines vertrauten und doch fremden Phänomens., 1987, dtv,
München, 1992.9. HAWKING, S.W., Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Urkraft des Universums.,
1988, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1991.10. KUN, N., STAROGRATZKI Legendi i Mitove, (deutsch: Altgriechische Legenden und Mythen), So-
fia, Nauka i Iskustvo, 1979, (Ausgabe in bulgarischer Sprache).11. LEUTZ, G., Psychodrama: Theorie und Praxis, Bd.1, Springer Verlag, 1974.12. LICHTENBERG, J.. Überlegungen zu einer Theorie der Technik. In: P. KUTTER (Hrsg.): Der thera-
peutische Prozeß. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt a.M., 1995.13. MORENO, J.L., Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis.
1959, Georg Thieme Verlag, 1988.14. MORENO, J.L., Psychodrama und Soziometrie. Edition Humanistische Psychologie, 1989.15. PETZOLD, H., Psychodrama-Therapie. Theorie, Methoden, Anwendung in der Arbeit mit alten
Menschen. Junfermann-Verlag, Paderborn, 1985.16. PIAGET, J., Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde. 1946, Suhrkamp, Frankfurt, 1974.17. PIAGET, J., Inhelder, B., Die Psychologie des Kindes. Fischer, Frankfurt, 1977.18. PÖPPEL, E., Erlebte Zeit und die Zeit überhaupt: Ein Versuch der Integration. In: Die Zeit, R. Ol-
denbourg Verlag München / Wien, 1983.19. SCHMITZ, H., System der Philosophie, Bd. 1, Die Gegenwart, H. Bouvier u. Co Verlag, Bonn,
1964.20. STANGIER, K.-W., Der Mythos – sein Sitz im Leben. In: Psychodrama 5, Heft 2, 1992.21. STERN, D., Tagebuch eines Babys. Was ein Kind sieht, spürt, fühlt und denkt. München: Piper
1991.22. STERN, D., Die Lebenserfahrung des Säuglings. Klett-Cotta, 1994.23. TREURNIET, N., Was ist Psychoanalyse heute ? In: Psyche Heft 2, Februar 1995.24. TSCHOLAKOV, M., unveröffentlichtes Manuskript über den anthropologischen Ansatz in der Phar-
makotherapie, Köln.25. WHEELER, J.A., Jenseits aller Zeitlichkeit. Anfang und Ende des Physikalischen Zeitskala. In: Die
Zeit, R. Oldenbourg Verlag München / Wien, 1983.
Anschrift des Autors: Drumi Dimtschev, Fischbecker Str. 14, 31785 Hameln