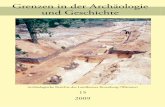Reaktionen und Veränderungen im niederrheinischen Protestantismus (2009)
Einige britannische Lehnnamen im Irischen: Brénainn (Brenden), Cathaír/Catháer und Midir
Transcript of Einige britannische Lehnnamen im Irischen: Brénainn (Brenden), Cathaír/Catháer und Midir
Einige britannische Lehnnamen im Irischen:Brenainn (Brenden), Cathair/Cathäer und Midir
Der folgende Beitrag wird drei bzw., wie sich herausstellenwird, vier verschiedene Personennamen aus alt- und mitteliri-schen Quellen behandeln und sie als Entlehnungen aus demBritannischen erklären. Diese Herleitung ist für einige der Na-men in allgemeiner Form schon früher vorgeschlagen worden,und zwar hauptsächlich aufgrund der Tatsache, daß sie inner-halb des irischen Flexionssystems indeklinabel sind. Der Ter-minus "Britannisch" ist dabei in seiner weiten Bedeutung zuverstehen, denn die Mehrheit der behandelten Namen wirdnicht aus dem Altbritannischen, sondern aus einem späterenStadium des Britannischen bereits nach der Apokope, demKymrischen, hergeleitet.
Bevor der erste Name diskutiert werden kann, muß zuerstseine lautliche Gestalt ermittelt werden, und hierbei sind zweiverschiedene Formen zu unterscheiden, die allerdings häufigauch als variae lectiones zueinander belegt sind:
l a Latinisiert Nom. Brendenus, Ad. 51b (Thes. II 277, 14), 105b
(279, 32), usw.; vgl. Brendinus, Akk. -um, Thes. II 324, 11, 17(Introd. Hy. IV; sonst Br(o)enaind)', Dat. Brondeno (l)/Bre'ndeno(?), Ad. 29b (Thes. II 275, 13)1
1 Dieselbe Person wie in Fei. May 16 (s. u. Nr. 2). Mit Akzentzeichen in Hs. A überdem r, da über der ew-Ligatur kein Platz ist: Der Akzent wird in Ad. S. 162 f. fürdiese eine Stelle in Hs. A (d. h. für A ad hoc) nicht als Längezeichen, sondern alslat. Betonungsmarkierung erklärt, mit entsprechender Editionskonvention e =langes e [e:], e' = betontes e ['e].
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 879
Latinisiert Gen. Brendini, Ad. 112b (2x, A, :-eni, B^; Thes. II280,4), 113a (v.ll. ebs.); = Thes. II 283, 20;2 284, 14; AI 486 (-3-);Brendani, AU 744 '.Brenaind, Tig. S. 246; vgl. Vok. Brindane, Trip.502,9Ib Gen. Brendin, Ad., Appendix S. 546, 3 (Hs. Blf :-en, B3; Thes. II281, 5); Brendain, AU 562 :Bre(a)namn, Tig. S. 144/CS 562/FM 556;AU 565 (:Brenaind, marg. (?))3 '.Brenainn, Tig. S. 147 (-nd)/CS 565:Nom. Brenainn, AI 573/FM 571 (-oinn)\ AU 5774 '.Brenainn, Tig.S. 152 (-wcö/AI 578/CS 576 :Nom. Brenainn, FM 576; u. a.2 Gen. Brenainn, Fei. May 16 (ohne Reim) '.Brendini, Tall. '.Bren-ainn, Gorm./Don.; F<§1. Nov. 29 (ohne Reim), = (Nom.? Gen.?)Brenaind, Tall. May 9; Brenainn/nd, AU 992 (-uind, interlin.),1036, 1040, usw.; vgl. 583 (add H2); ? vgl. Brenr, 752, usw.; Bren-ainn, FM 890, 956, 989, 991, u. a.; Tig. II S. 269; CGSH Nr. 670, 3Nom. Brenaind, Trip. 78, 15; CGSH Nr. 127, l (: Broenfind)', Bren-aind, CGSH Nr. 714, 10; Dat. Brenainn, Trip. 78, 13; 208, 2
Die beiden Formen werden z. T. für ein und dieselbe Persongebraucht (s. die Anmerkungen). Zur eindeutigen Feststellungder Quantität beider Silben fehlen sowohl für Form l als auchfür Form 2 Reimbelege: Im Falle von l existiert lediglich dieeinmalige und nicht aufschlußreiche Schreibung Brendeno/Bre'ndeno (s. l a mit Anm. 1; zur zweiten Silbe s. weiter unten);für 2 weisen immerhin die häufigere Schreibung Bre- und diediphthongische Variante Broe- (s. unter l und 2)5 auf langes eder ersten Silbe. Der Vokal der zweiten Silbe in Form l (a, b)erscheint als e, i und a; Form 2 ist indeklinabel.
Laut Meyer (1912, 436 f. Anm. 3) ist der etymologische Aus-gangspunkt ein Bahuvrihi-Kompositum Brenaind = Bren-find"Stinkhaar",6 mit davon abgeleiteter Koseform Brendan, dielatinisiert als Brendanus erscheint; den air. LatinisierungenBrendenus und Brendinus lägen demgegenüber alternativeKoseformen auf -en bzw. -in zugrunde; vgl. ähnlich Grosjean,
2 Dieselbe Person wie in F£l. Nov. 29 (s. u. Nr. 2).3 Dieselbe Person wie in Fei. Nov. 29 (s. u. Nr. 2).4 Dieselbe Person wie in Fei. May 16 (s. u. Nr. 2).5 Laut Vendryes (RC 39 (1922) 393 Anm. 1) Volksetymologie nach l braen [häufig,
< air. broen] "Tropfen".6 D. h. zu bren, o, ä, "stinking, fetid, putrid, rotten, foul" \mafinna, io, m./find, o,,
m. <— n., "a hair" (OIL)', zustimmend zu dieser Etymologie Vendryes, RC 39(1922) 393.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
880 Jürgen Uhlich
AB 78 (1960) 379-81: Brenaind -> Brendan, später Brendan,Bre(a)nnan.7 Diese Deutung findet ein appellativisches Gegen-stück in Triads Nr. 105: Tri bifocherdat marbdili: ossfoceird acongna, ßd foceird a duille, cethra focerdat a mbrenfinda.'Three live ones that put away dead things: a deer shedding itshorn, a wood shedding its leaves, cattle shedding their coat[Anm. 2: "literally, 'stinking hair'"]"; vgl. ferner bren-ulcha (zuulcha "Bart"), BB 296a5.8
Meyers Herleitung scheitert jedoch von vornherein an derForm Brenainn: Zu vergleichen sind hier die häufigen Zusam-mensetzungen mit dem formal identischen Hinterglied l finn,o, ä (< find), "weiß, hell, gesegnet", wie z. B. cenann "white-headed" < air. *cen(n)and < *k™enno-uindo-, reinterpretiertcendfind (s. Uhlich 1993, 199f.), oder der Personenname Barr-and = barrann "white-topped" < *barro-uindo-, reinterpre-tiert Barr(f)ind, Bairr(f)ind bzw. barrfind (s. ebd. 175). Ent-sprechend müßten im Falle einer Etymologie "Stinkhaar"(*mrakno-uindo~) die air. Formen Nom. *Brenand, Gen. Bren-aind (jeweils > [a/]mir. -nn) lauten, d. h. mit neutralem -n- undneutralem (Nom.) bzw. palatalem (Gen.) -nd (-nn) und entspre-chender Schreibung des unbetonten Vokals [a] dazwischen als-a- bzw. -(a)i- (vgl. GOI § 102, 2, 5). Schreibungen mit -i- imNom., also vor neutralem -nd (-nn), können demgegenüber nurauf Reinterpretation nach betontem find (-nn\ ebenfalls mitneutralem Auslaut) beruhen, jedoch wird in diesem Fall dieneutrale Qualität des vorhergehenden Konsonanten nicht mehrdurch -a- angezeigt,9 vgl. z. B. Barr(f)ind, nie *Barraind, wel-
7 Allerdings ohne Erklärung dieser angenommenen Kürzung der ersten Silbe;außerdem zum Vorkommen der latinisierten Formen Brendamcs, Brandanus,Brindanus, u. a.
8 Der von Grosjean G.C., 379 Anm. 3) als Vergleich angeführte ako. PersonennameBrenci, laut Jackson (JCeltS l (1949-50) 76, "opprobrious name of a slave") ="Stinkhound", ist nach Hughes (CMCS 22 (Winter 1991) 95-9; vgl. Arm 44 (1993)95-8; jeweils mit älterer Literatur) vielmehr als "Raven-hound" zu erklären,d. h. < kelt. *brano~kuü, = ir. Branchu (wozu s. Uhlich 1993, 185). - Eineandere Möglichkeit, das hier angesetzte Vorderglied bron- zu deuten, wäre viel-leicht der Anschluß an nir. brean "(Don. and Meatli)\ in Meath a 'brime,' perhapsbream" (Dinneen), welches laut Marstrander (ZCP 7 (1910) 374-6) von"stinkend, ..." etymologisch verschieden ist.
9 Oder sie wird überhaupt an den durch Reinterpretation gewonnenen neuen Hin-tergliedsanlaut assimiliert, vgl. z. B. Bairr(f)ind.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 881
ches folglich nur auf palatales -nd weisen könnte. Brenaindl-nngeht also in allen belegten Kasus (Nom., Gen., Dat.) auf palata-les -ndl-nn aus und ist somit auch, wie bereits festgestellt,indeklinabel.
Ein solches Fehlen einer Flexion läßt in der Regel auf einenLehnnamen schließen,10 und so betrachtet auch MacNeill "theindeclinable Irish name Brenainn as borrowed from 0. W.brenhin (contracted from breenhin)".n Um diese Herleitung zubeurteilen, ist es zunächst erforderlich, die Quelle der ange-nommenen Entlehnung, das ky. Wort für "König" brenin (GPCs. v.), sprachgeschichtlich zu analysieren; diesem liegt ein abrit.*brigantinos12 zugrunde, das sich folgendermaßen weiterent-wickelt hat: > *bri3antinos (mit abrit. "First Spirantization"13),> urky./urko./urbret. ^bri^antm > ^bri^'entin (mit internem i-Umlaut sowie Palatalisierung des -3-): 1) > abret. brientin(ion,PL); 2) > urky. ^bn^'entin > *bre3'entin (mit Vokalharmonie),> (aky.?) *6rejWÄm (8. Jh.?)14 > *bres'en(n)hin (9. Jh.) >*bre?en(n)hin (9. Jh.?) > aky. breennin, breenhin, brenn(h)in(Lland.) > mky. bre(y)enhin, brenhin > nky. brenin (PL bren-hin(o)edd).15
Die Entlehnung der ir. Form Brenainn aus diesem brit. Ety-mon muß in jedem Fall nach der ky. Weiterentwicklung voninlautendem *-nt- > *- %- > -n(n)h- stattgefunden haben,16
10 Vgl. O'Brien, Celtica 3 (1956) 173: "... small list of indeclinable names ... prob-ably borrowed from some other language".
11 Auf MacNeill verweist ohne Angabe der Quelle Meyer 1917, 10 Anm. 2.12 Zur Herkunft dieser Bildung s. Binchy 1970, 12-14; anders Charles-Edwards
1974, besonders 40ff.; wieder anders Hamp, EC 23 (1986) 50f.13 S. Sims-Williams 1990, 233, vgl. 225 zur möglichen Datierung dieses Lautwan-
dels vor 400 n. Chr.14 S. LHEB 500 f. (vgl. 505): "still a trace of the stop in the form of a faint glide",
bezüglich einer phonetischen Parallele im Schottisch-Gälischen.15 S. LHEB Ml, 453f., 506f., 684; vgl. Schrijver 1995, 71 f. Zur Kontraktion -ee· >
-e- (u. a.) vgl. VGKSI 302; WG 36, 67, cf. 171. Eine Folge der und damit Beweisfür die Länge des kontrahierten -e- (jedenfalls zunächst, d. h. unmittelbar nachder Kontraktion) ist nach WG 171 die Vereinfachung des ursprünglichen -nnh-(> -nn-) zu -n-, d. h. brennhin > brenin (im Gegensatz z. B. zu cerennydd <*karantiw-). Die Kontraktion setzt, nach den Belegen zu urteilen, sporadischschon im Aky. ein (brenn(h)in, Lland. 120, 22, 24, 26; 121, 1; vgl. auch LHEB453 f. zu arcibrenou, 9.-10. Jh.), aber allgemein gilt, daß ''uncontracted forms aremet with as late as the 16th cent." (WG 36, vgl. 34ff.).
16 Denn noch erhaltenes -nt(-) in abrit. (-lat.) Wörtern wurde bei der Entlehnungins Altirische zunächst durch -nd(-) substituiert und bei späteren Entlehnungen
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
882 Jürgen Üblich
welche nach LHEB 505 f. vielleicht schon im 8. Jh. begann undsicher im frühen 9. Jh. (829) vollzogen war. Ferner muß auchdas ursprüngliche *-g- über *-j- > *~3'-/-j- > * J- bereits so weitgeschwächt gewesen sein, daß sein Reflex von den entlehnen-den Sprechern des Irischen nicht mehr als phonologisch rele-vant wahrgenommen wurde; da das A/Mir, selbst ein palatali-siertes [3'] besaß, kommt hierfür wohl frühestens die Stufe *J-in Frage, die nach LHEB 452^4 wahrscheinlich im 9. Jh. (nach840) erreicht wurde.
Der sich aus diesen Datierungskriterien ergebende terminuspost quern für die Entlehnung scheint zunächst im Widerspruchzu den frühesten Belegen des Namens im Ir. zu stehen, nämlichGen. Brenainn in Fei. May 16, Nov. 29, letzterer = Brenaind,Tall. May 9, d. h., der Name erscheint bereits in zwei Texten(Fei. und Tall.), die beide in der altirischen Periode, um 830,verfaßt worden sind.17 Allerdings sind diese ursprünglich air.Sprachdenkmäler nicht in zeitgenössischen air. Handschriftenüberliefert, und so finden sich in den Handschriften zu beidenTexten zahlreiche Spuren späterer Sprachstufen, die im Laufedes Überlieferungsprozesses von den jeweiligen Abschreibernanstelle der ursprünglichen oder ursprünglicherer Formen inden Text eingesetzt wurden.18 Betrachtet man nun die frühereForm dieses Namens (zu den Einzelheiten s. weiter unten),frühair. Brenden, Gen. Brendin > air. Brendan, Gen. Bren-dain, so muß diese sich zur Zeit der Abfassung von Fei. undTall, bereits über *Brennan, Gen. *Brennain19 zu *Brennann,
unverändert als -nt(-) wiedergegeben; s. McManus, ßriu 34 (1983) 28, 60f., mitLiteratur.
17 S. 0 Riain, 'The Tallaght martyrologies, redated", CMCS 20 (Winter 1990)21-38: zwischen 828 und 833, gegenüber der früheren Datierung des Fei. durchThurneysen, "Die Abfassung des Felire von Oengus", ZCP 6 (1908) 6-8: zwi-schen 797 und 808. Die (nicht metrische) Martyrologie von Tallaght ist in ihrerUrform die unmittelbare Quelle von F<§L, s. Tall. XXf. und 0 Riain, I.e., 21-23.
18 Für Fe"l. s. die Liste von (nicht nur scheinbaren, sondern auch echten) '"MiddleIrish/scribal corruptions" in F<§1. XXVIII f. Vgl. Tall. XX zu einem petrifiziertenArchaismus in Tall. June 3: air. Gen. aui "(des) Enkels", in allen anderen Fällenmodernisiert (zu mir. (h)uio. ä.); vgl. Nom. Hua, Feb. 8, aus bzw. für air. aue..
19 Der air. Wandel nd > nn erscheint in Fei. bereits als vollzogen, s. GOI § 151 cund vgl. den Reim finde: bille (Aug. 8). Die häufigen Schreibungen in den Hand-schriften mit nd beruhen daher sämtlich auf schon air. oder erst mir. Hyperkor-rektion, vgl. ebf. in F61. einerseits find :finn (Jan. 9, Dec. 12,16; s. Fe*!.2 mit derWiedergabe der Lesungen aus drei Handschriften), mit den Schreibungen nd
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 883
Gen. *Brennainn2Q oder sogar noch weiter zu *Brenann, gen.*Brenainn21 entwickelt haben. Da Fei. zwar ein metrischerText ist, aber beide Belege des hier besprochenen Namens aneiner Versstelle stehen, die keinem Reim unterliegt, ist in bei-den Fällen nur die Silbenzahl metrisch relevant, nicht aber dieMerkmale Vokal- und Konsonantenquantität (also hier [e] vs.[e:] bzw. [n] vs. [N]). Dementsprechend kann im Urtext vonFei. jeweils Gen. *Bren(n)ainn (mit dieser Schreibung oderhyperkorrekt *Bren(d)aind, vgl. Anm. 19) gestanden haben,und Handschriftenlesungen wie brenainn, brenaind (s. Fei.2für drei der zehn Manuskripte) setzen entweder eine solcheForm direkt fort, und die Normalisierung im Text von Fei. alsBrenainn ist unberechtigt, oder - und dies gilt insbesondere füretwaige Handschriftenlesungen mit bre- - ihnen liegt die späte-re Form Gen. Brenainn (-nd) zugrunde, die im Laufe des Über-lieferungsprozesses von Abschreibern, wie meist üblich ohneMarkierung der Vokallänge, entweder für das orthographischidentische *Brenainn (-nd) oder für das fast identische *Bren-nainn (-nd-nd) in den Text eingesetzt worden ist, ohne diesilbische Struktur des Textes zu beeinträchtigen. Gleiches giltfür die oben angeführte Entsprechung Brenaind in Tall. May 9(statt Nov. 29), und die andere Parallelstelle in Tall. May 16erlaubt sogar einen gewissen Einblick in den soeben skizziertenÜberlieferungsprozeß, denn dort erscheint - zur Zeit von Tall,mit traditioneller Orthographie - noch die (latinisierte) frühair.Form Brendini: Wenn man von der Erwartung ausgeht, daßdie zwei gleichnamigen Heiligen des 6. Jahrhunderts im Urtextauch unter derselben Namensform verzeichnet waren, so hathier der Vorgang der Ersetzung der älteren durch die spätereForm nur die eine Textstelle erfaßt (sogar bei geringerer for-maler Ähnlichkeit der beiden Formen als in Fei.), während ander anderen Stelle der ursprüngliche Name zufällig nicht verän-dert wurde und somit hier noch den älteren Textzustand erken-nen läßt. Eine vergleichbare Überlieferungssituation zeigen die
und nn für ursprüngliches nd, und andererseits aher(e)ind, ahMrind (Nov. 21, s.Fei.2), mit der Schreibung nd für ursprüngliches nn.
20 Nach MacNeills Gesetz, s. GOI § 140, besonders Anm. zu innell (< *innel) <*indel, d. h. mit Eintritt der Wirkung auch oder erst nach dem Wandel nd > nn.
21 Mit Dissimilation wie in cenann (-nd) "white-headed" < *cennann (oder schon <*cennand) < *k™enno-uindo- u. a., s. Uhlich 1993 § 51.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
884 Jürgen Uhlich
verschiedenen Annalensammlungen: Dort erscheint nur in AUbis zum Jahr 885 die (in traditioneller Orthographie "frühklas-sisch"-air.) Form Gen. Brendain,22 dagegen nicht nur in denspäteren Einträgen in AU, sondern auch generell in allen ande-ren Sammlungen in den Parallelstellen zu AU, sofern ausge-schrieben, (Nom./)Gen. Brenainn (~nd\ Brea-, Bre-).23 Mit die-ser philologischen Beurteilung der vereinzelten Stellen Fei.May 16 und Fei. Nov. 29/Tall. May 9 liegt also kein zwingenderGrund vor, die Existenz der Form Brenainn schon für die Zeitum 830 und damit vor den oben besprochenen ky. Lautwandeln,insbesondere vor *-£-!-]- > *J-, anzusetzen.
Zur sprachlichen Beurteilung der Entlehnung von Brenainnaus dem Ky. sind abschließend noch drei weitere lautlicheMerkmale dieser Form zu besprechen, nämlich das lange -e-,die palatale Färbung des Auslauts und das unlenierte (doppeltgeschriebene) -nn. Die Herleitung des - - hängt davon ab, obsich der Zeitpunkt oder auch nur der terminus post quern derEntlehnung noch genauer (später) als nur auf das 9. Jahrhun-dert festlegen läßt: Liegt er nach dem - in der Literatur eben-falls nicht genau datierten - Einsetzen des längere Zeit wirksa-men Vorganges der Vokalkontraktion im Ky. (spätestens imAky. des 9.-10. Jahrhunderts, s. o. Anm. 15), so ist das -e- di-rekt aus dem langen -e- des Ky. übernommen. Sollte er jedochzwar nach 800, aber noch vor die ky. Kontraktion zu datierensein, so müßte das aus dem Ky. ins Alt- oder Mittelirischeübernommene -ee- erst im Rahmen oder vor dem Hintergrundder spätair. (sporadisch) und mir. Vokalkontraktion zu -e- ge-worden sein.24
Die palatale Qualität des Auslautes in -ainn (mit -ai- für [a]gefolgt von einem palatalen Konsonanten) aus ky. -in (mit -i-für [i(:)]) erscheint phonetisch plausibel, allerdings sind mir kei-
22 AU 562, 565, 576,577, 589, 601, 749, 770, 802, 807, 817, 844, 885; vgl. Brendinus,558; Brendani, 744.
23 Eine Ausnahme ist Brqndini, AI 486; im übrigen habe ich für die Annalen außerAU die Belege nur auszugsweise gesammelt.
24 Zur sporadischen air. Vokalkontraktion s. GOI § 113, zur regulären mir. Breat-nach 1994 § 3.2. Eine Kontraktion -ee- > -e- wäre allerdings innerhalb des ir.Systems ein isolierter Sonderfall, da bei mir. Kontraktionen der zweite Vokal,unabhängig von der kontextbedingten Schreibung, grundsätzlich [3] war; vgl.Uhlich 1996 § 5 a mit Anm.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 885
ne eindeutigen Parallelfälle für ein derartiges Übernahmemu-ster bekannt. Ein Fall wie ir. Patraic25 wirkt zwar vergleich-bar, falls <— ky. Paarig, jedoch wird dieser Name von Jackson(LHEB 610) direkt aus brit.-lat. *Padrigius abgeleitet.26 Einebessere Parallele bietet vielleicht air. notlaic, fern., <rWeihnach-ten", ursprünglich «— lat. Nätälicia (Neutrum PL), falls dieseswegen des kurzen -o- im Ir. zunächst < urky. *Nödölig, mit ky.vortoniger Kürzung < *Nödölig <— lat. Nätälicia, hergeleitetwerden muß27 und hier nicht nach dem geläufigen mir. Neue-rungsmuster bei air. fern. -Stämmen, bei dem die Nominativ-form auf neutrale Konsonanz durch die ursprüngliche Dativ-form auf palatale Konsonanz verdrängt wurde, der palataleAuslaut morphologisch motiviert ist.28
Das unlenierte auslautende -nn in Brenainn schließlich er-klärt sich letztendlich nach MacNeills Gesetz, welches "re-mained in operation for a long time" (laut GOI § 140), d. h., derAuslaut (<- ky. -n) wurde den ursprünglich durch MacNeillsGesetz geregelten phonotaktischen Voraussetzungen angepaßt.
25 S. z. B. Trip. 8, 4: Patraic, und 10, 21: Patraic, usw.26 Zum Muster air. -C" <- brit.-lat. -Cms vgl. das Suffix -6ir <- -ärms (s. McManus,
Arm 35 (1984) 146f.).27 S. LHEB 289f., 293; McManus, Uriu 34 (1983) 29, 31; vgl. Sims-Williams 1990,
258 n. 159. Anders jedoch LHEB 136, wo ein "British Latin *N$dQligia (withreduced in the British pretonic syllable ...)" angesetzt wird [leg. allerdings*N$dclligia, vgl. Sims-Williams, I.e.; die irrige Quantitätenverteilung in LHEBerklärt sich vielleicht durch Konfusion mit der Vorform * Nätälicia, s.u.]. Daaber in vulgärlat. Wörtern vortonige Langvokale normalerweise schon vor derZeit britannischer Lautwandel wie *ä > *ö gekürzt worden sind, vgl. ky. Nadol-ig < *Nätälicia < *Nätälicia, sind Parallelen zur Stützung des Ansatzes inLHEB 136, mit postulierter Wirkung einer noch dazu brit. [nicht ky.] Kürzungauch in lat. Wörtern, schwer oder gar nicht zu finden, denn die mky. VarianteNodolyc < *Nätälicia erklärt sich nach LHEB 290 als vereinzelte Ausnahme(ebenso wie ky. lonor < *Iänuärius, nicht *Ianor) und beruht auf borrowingfrom a higher and more educated level of Latin speech in which the pretonic VL.ä was not shortened"; von daher ist also nicht klar, ob die Zwischenstufe zwi-schen Nodolyc und *Nätälicia ein urky. *NödÖlig < *Nödölig oder ein brit.-lat.*N$d$ligia war, und nur in letzterem Fall würde sich air. notlaic wie Patraicerklären lassen.
28 Vgl. McManus, triu 35 (1984) Anm. 48 zu srait <- lat. strata und nain <- lat.nöna, nach dem Muster z. B. des Lehnwortes lat. schola —» air. scol, später scoilnach dem Dativ. Allerdings unterscheidet sich notlaic von diesen dadurch, daßdie lat. Ausgangsendung nicht -a, sondern -ia lautete, und ferner folgt es im Ir.zunächst nicht der -Flexion, vgl. zwar air. in mir. Überlieferung Dat. notlaicc(Fei. Nov. 13), aber mir. Gen. notlac, nollac (oder alter Gen. PL?).
57 Zeitschrift f. celt. Phil., Band 49/50
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
886 Jürgen Uhlich
Nachdem so gezeigt werden konnte, daß Brenainn sich alsEntlehnung aus dem Ky. herleiten läßt, ist jetzt die ältereForm dieses Namens zu behandeln. Hier weisen die oben (unter1) gegebenen Belege nicht (mit Meyer) für das Frühair, aufzwei alternative hypokoristische Formen auf -en bzw. -in, diedann später von einer dritten auf -an verdrängt worden wären,sondern die Verteilung in den latinisierten Belegen in Ad. istNom. Brendenus, Gen. Brendini, -und diese erweist nach Ad.S. 131, 134 einen kurzen Vokal in der zweiten Silbe, d. h., derLatinisierung zugrunde liegen frühair. Nom. *Brenden undGen. Brendin (vgl. den Beleg Brendin, v.l -en). Zu kontrastie-ren sind bei Ad. drei Latinisierungstypen (vgl. z. T. auch Ad.S. 136):
A I A2 B CCainnech: Finten: Daimen: Baethene:Cainnech-us Finten-us *Daimen-us Baithene-usCainnich-i Finten-i Daimen-i Baithene-iZu AI gehört ferner Comgell-m, Comgill-i.Vgl. in Thes. II 284 (Stowe Missal): Cainnichi, Comgilli, Brendini(A l).; Comgelli, Coemgeni (A 2); Lacteni (B); Ailbei (C).
In Typ A wird also ursprünglich die lat. Flexionsendung andie entsprechende frühair. Kasusform angefügt (A 1), dochkann daneben auch die unmarkierte Nominativform zur alleini-gen Grundlage der Latinisierung gemacht werden (A 2). Letz-tere Regel gilt grundsätzlich für Namen auf -en (B)29 und -ene(C). Im Falle des hier besprochenen (älteren) Namens liegenalso nicht mehrere verschiedene (früh)air. Suffixableitungenvor, sondern ein und dieselbe Form in verschiedenen Entwick-lungsstadien: frühair. Nom. Brenden, Gen. Brendin, jeweilslatinisiert zu Brenden-us, -o und Brendin-i (mit v. l Brenden-inach Typ A 2); > klassisch-air. Brendan, Gen. Brendain (>Brenna(i)ri), dieses erneut latinisiert zu Brendan-us,BQ und die
29 Oder war -en im Gen. unflektiert, d. h. ebf. = -en (s. GOI § 280,1 und S. 677)?Anders Ad. S. 136, doch werden dort als Belege für Genitivflexion nur Bildungen
. auf -an angeführt. - Nach dieser Typenverteilung ist im übrigen eine Unter-scheidung zwischen A2 und B nur durch zusätzliche Kriterien, wie z. B. Belege inspäteren Quellen oder allgemeinere etymologische Überlegungen, möglich.
30 Parallel ist der Personenname frühair. Finten, Gen. -in, > Fintan, Gen. -ain,
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 887
(von dort bezogene?) nir. Form Breandan entstand in Anglei-chung an die überaus häufigen Personennamenbildungen mitdem Suffix -an (wozu vgl. Uhlich 1993 § 102 a. E., mit Litera-tur).
Dieser so etablierte frühair. Name, für den eine inneririscheEtymologie bisher nicht vorgeschlagen worden ist, läßt sichnun als Entlehnung aus demselben brit. Etymon herleiten wiedie spätere und mit diesem in den Quellen gleichgesetzte FormBrenainn, allerdings aus einer früheren Entwicklungsstufe,nämlich abrit. *bri3antinos (s.o.): —» urir. ^bri^andinos31 >*bre3andenah?2 > frühair. *bre$yiden (mit Apokope und Syn-kope) > Brenden. Der Abstützung bedarf hierbei lediglich derangesetzte Übergang innerhalb des Frühair. von *-j?zd- > -nd-\Die Vereinfachung einer solchen komplexen Konsonantengrup-pe ist als solche plausibel, nur liegen mir keine genauen Paral-lelen vor. Einen interessanten nicht-parallelen Vergleich bietenjedoch die in GOI § 180, 2 behandelten Fälle mit Vereinfachungvon Gruppen aus Liquida + Nasal + Verschlußlaut, in de-nen, z. T. noch innerhalb des Air., nicht der erste Bestandteil rbzw. l, sondern der Nasal ausgestoßen wird, z. B. do-foirde <do-foirnde(a) "bezeichnet" (*to-fo-rind-), aildiu < *ailndiu(Komparativ von alaind "schön"): Die Tendenz zur Vereinfa-chung ist die gleiche, und der Unterschied in der Art der Ver-einfachung erklärt sich dadurch, daß Liquiden phonetisch stabi-lere Laute sind als der gutturale Frikativ [s].33 Damit liegen
der nicht nur (in Ad.) zu Finten-us, -i, sondern auch air. erneut zu Fintan-us, -ilatinisiert wurde (s. die Belege bei Uhlich 1993, 255).
31 Mit Substitution abrit. nt —> urir. nd wie in planta —» cland', s. o. Anm. 16.32 Mit betontem Umlaut (hier: Senkung) in der ersten Silbe sowie unbetonter Kür-
zung und Senkung in der dritten Silbe; vgl. entsprechend mit betonter Hebungund kurzem Vokal der zweiten Silbe molina -» air. muilenn "Mühle" (mit Über-gang zum o-Stamm), wo allerdings die frühair. Zwischenstufe *muilen(n) (mit-e- = [e], nicht wie später = [9]) nicht belegt ist. Vgl. auch McCone 1994 § 6.2; zuden urir. Umlauterscheinungen allgemein s. Pokorny, ZCP 12 (1918) 415-26,und GOI §§ 73-8.
33 Vgl. für r die Tatsache, daß die intervokalische Gruppe *~sn- mit Ersatzdehnungzur *-n- reduziert wird (s. GOI § 125), die Gruppe *-m- dagegen unveränderterhalten bleibt (vgl. earn "Haufen"), sowie die Apokoperegel, nach der unter denurir. Auslautkonsonanten z. B. *-r und *-ll vom Schwund ausgenommen sind(GOI § 175). Ähnliches gilt für das sporadische Beispiel scribdid (s. Ml. 14a6) <*scribndith (vgl. comscribndaith, Sg. 24a13; ungenau GOI § 180, 3), welches inder normalen Form scrflmid fortgesetzt wird: Auch hier entscheidet die höhere
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
888 Jürgen Uhlich
also klare Indizien vor, die für die Annahme eines derartigenÜbergangs im hier besprochenen Namen sprechen, doch ohneeine eindeutige Parallele läßt sich strenggenommen einstweilennur eine ad-hoc-Regel aufstellen: frühair. *~3nd- > -nd- (vor derverbleibenden Gruppe ohne Ersatzdehnung).
Zusammengefaßt bedeutet dies: Das britannische Etymon*brigantinos wurde (historisch zufallig) in zwei verschiedenenseiner späteren Entwicklungsstadien jeweils als Personennamein das Irische entlehnt, und mit diesem Befund läßt sich der lat.Name Patricius vergleichen, der nach gängiger Auffassungebenfalls zweimal in das Irische entlehnt wurde, erst —> Coth-raige (Thes. II 309, 6) u.a.,34 später -* Patraic (s.o. mitAnm. 25).
Als nächstes ist der Name Cathair/Cathaer zu behandeln;zunächst einige Belege, um die genaue Form zu bestimmen:
Nom./Akk./Dat. Cathair, R 116a 4 [:Cathuer, LL 387a34]; Cathaer,116C6; u. a.Gen. Cathair, R 117a30; Cathaer, 156b55 (:-air, LL, La., Lee., BB);u. a. (nach CGH)s. CGH: 12 x Nom./... -air, 6x Nom./... -aer
9x Gen. -air, 2x Gen. -aer
Aus diesen Schreibungen ergibt sich als vorherrschendesMuster ein indeklinabler Name Nom. Cathair, Gen. Cathair]daneben scheint jedoch auch ein Nom. Cathaer vorzuliegen, dermit dem Gen. Cathair dem Schema der o-Flexion folgen würde,und dieselbe Schreibung begegnet vereinzelt auch als Gen. Die-se mir. Schreibungen von Diphthongen (ai, ae) sind jedoch kei-ne zuverlässigen Zeugnisse zur Bestimmung der ihnen zugrun-deliegenden Formen35 und bedürfen daher der zusätzlichen Ab-
Stabilität von [ß] gegenüber [3], vgl. wiederum GOI § 125 zu *-jr- mit Ersatz-dehnung vs.*-ßr- ohne Veränderung.
34 Gegen diese Erklärung von Cothraige spricht sich allerdings Harvey, iSriu 36(1985) 1-9 (mit weiteren Verweisen), aus.
35 Die Schreibung Nom. Cathaer, die hier auf eine o-Flexion zu weisen scheint,kann ebensogut das Ergebnis einer beim Abschreiben mechanisch vorgenomme-nen rein orthographischen Neuerung für zugrundeliegendes *Cathair sein, wiesie für die Genitivschreibung -aer in jedem Fall angenommen werden muß("orthographische Diphthongierung", s. Uhlich 1993 § 27); vgl. eine entspre-chende Andeutung schon bei O'Brien, ßriu 16 (1952) 167 Anm. zu 13 d.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 889
Sicherung durch Reimbeispiele. Mir. Reimbelege für den un-strittigen Gen. Cathair gibt Marstrander, RC 36 (1915) 365f.,37 (1917-9) 294:
z. B. Gen. Cathair, LL 2641 (: cairi), 7123 (-air. : laich), 15709 (:tathair).
Der Nom./Dat. Cathair ist durch folgende mir. Reime gesi-chert (vgl. z. T. Marstrander, I.e. RC 36, allerdings mit nurvage begründeten Einwänden):
Dorigne Cathair demnach "Cathair of the many kinsmen heldfeis rachdim na rig Temrach; the right pleasant feast of the kings
of Temair;"Met. Ds. Ill 172, 53-4
(interner Reim a: b)
A sefichet cen tathair trait "Six [and] twenty [years] withoutreproach severe
ro chaith Cathair hua spent Cathair, descendant ofCormaic. Cormac"
LL 15185-6,36 vgl. MacC 202 f.(interner Reim a: b)
do Chathaoir, CGSHNr. 662, 23 (: caoil [Gen. Sg. mask.], Endreima:b)
Bressal ba bocfri each laid "Bresal who was generous inpaying for each poem,
mac Fiachach rigda rachain, the son of fair royal Fiachu;Flachufer nar chubaid d'aer Fiachu, no fitting subject of satire,mac don churaid do Chathair. was a son of the warrior Cathair."
O'Brien, Üriu 16 (1952) 161 § 13,vgl. 167 und Anm.37
Ein Nom. Cathaer wird nur gestützt durch:
Norn. Cathaer, ZCP 8 (1912) 272 § 65 (: raerif3 (Marstrander, RC 36(1915) 365).
36 Gedicht von Gilla Coemäin; von demselben Autor stammen Annalen bis zumJahre 1072 (s. LL S. VII).
37 'The poem is probably not much older than the manuscript, which can be datedby the terminal names in the pedigrees ... to approximately 1120", O'Brien, I.e.159.
38 'The language of the poem may well be that of the first half of the eleventh
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
890 Jürgen Üblich
Nach Meyer (Worth. § 44) ist der Name "flexionslos [d. h.Nom. = Gen. Cathair}. ... Schon dadurch erweckt er den Ver-dacht, daß er entlehnt ist. Es kommt hinzu, daß er sich aus demIrischen nicht erklären läßt. So liegt es nahe, an Übernahmeaus einem altkymr. *Cat-air zu denken, was wörtlich 'Schlacht-niederlage' oder 'Niederlage von Schlachthaufen' bedeutenwürde,"39 d. h. *Cat-air < *katu-agro-; zur lautlichen Seite ei-ner derartigen Entlehnung vergleicht Meyer mir. cathair,fern., "Stuhl": <- abrit. *cateira <- lat. cathedra.40
Das erste Vorkommen des Namens selbst datiert Meyer an-hand des Königs von Leinster Cathair Mär auf das 4. Jahrhun-dert, da dessen Enkel, Bresal Belach, nach AU im Jahre 435oder 436 gestorben ist.41 Wie jedoch O'Rahilly (EIHM 268f.)betont, handelt es sich hierbei um eine mythische Gestalt,42 und"the fact is that Cathaer Mär, as a non-historical character,does not belong to any century more than another."43
Gegen Meyers Erklärung wendet sich Marstrander (ÄC 36(1915) 364-7) mit vier Gegenargumenten: 1) Kelt. *-agro- habeim Ky. [richtig: Abrit.] des 4. Jahrhunderts noch nicht die Form*-atr gehabt. Diese Datierung beruht jedoch, wie gezeigt, aus-schließlich und zu Unrecht auf dem mythischen König CathairMar. Der Wandel *-jr- > *-ir- wird in LHEB 466 aufgrund der
century", Hayden, ZCP 8 (1912) 261, mit verschiedenen sprachlichen Kriterien,von denen metrisch relevant sind mir. Auslautvokalreime und Vokalkontraktion.
39 Genauer als Bahuvrmi zu fassen: "der durch Schlachtniederlagen charakterisiertist" = "der in Schlachten Niederlagen beibringt".
40 <— abrit. *cateira nach LHEB 124 Anm. 2; nicht "aus altkymr. *ca£air" (Meyer;richtig: *cateirj vgl. mky. kadeir), da zu dieser Zeit der intervokalische Dentalbereits zu [d] leniert war; vgl. zum Diphthong GOI § 918 (zur Zeitstufe allerdingsvage).
41 Vgl. Mors Bressail regis Laighen, AU 435 (vgl. 436); ... m. Bresail Belaig m.Fiachach-ba-aiccid m. Cathair Mair, R llT^ö-SO (CGH).
42 Z. B. fehlt sein Name auch in der Königsliste Rig Lagen, die vielmehr erst mitseinem Enkel Bresal Belach einsetzt (LL 5405 ff., nach E IHM 268 Anm. 1).
43 O'Rahillys eigener Herleitungsvorschlag - er nennt Meyers Etymologie ohneweitere Begründung schlicht "impossible" - von Cathaer [sie] als, "as I hope toshow elsewhere, ... a borrowing of an Ivernic (Hiberno-Brittonic) form of Celt.*Catu-tegernos, ^battle-lord'" wird durch nichts gestützt und ist schon lautlichunhaltbar. Vgl. O'Rahilly 1935, 327, wo "Cathaer" mit einem aky. Cattegir (ohneVerweis) "battle-lord" (= ir. Ca(i)tchem\ vgl. Uhlich 1993, 188) gleichgesetztwird; diese überraschende aky. Form findet sich tatsächlich in EWGT 12 § 27,steht dort jedoch nach Ausweis von ebd. § 22 (vgl. auch § 23) als Schreibfehlerfür die reguläre Form Cattegirn.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 891
Belege auf die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts (urky./urko./urbret.) datiert; bei solchen Schlußfolgerungen aus orthogra-phischen Daten ist jedoch zu beachten, daß auch noch nach demEintritt von Lautwandeln ältere Schreibweisen als traditionelleOrthographie fortleben können, weshalb die erste schriftlicheFixierung einer lautlichen Veränderung lediglich einen termi-nus ante quern für die Datierung des entsprechenden Lautwan-dels darstellen kann;44 dementsprechend könnte im vorliegen-den Fall theoretisch auch eine frühere Datierung erwogen wer-den.45 Sollte dieser Wandel jedoch trotzdem erst nach der Sono-risierung der brit. Tenues (s. Anm. 45) zu plazieren sein, sowäre das ir. -th- nicht lautgesetzlich erklärbar - < urir. [ ] < [t]<— abrit. [t] -, sondern die Form Cathair (statt *Caiair, mit -i-= [d] <— abrit. *kadairos) müßte sich analogisch an die überaushäufigen ir. Personennamen mit dem Vorderglied cath-"Kampf" angeglichen haben.46
Weitere Einwände Marstranders: 2) Weder ein gall. *Catu-agros noch ein aky. *Cat-air sind belegt. Dies kann MeyersEtymologie jedoch nicht entscheidend in Frage stellen, denn inmky. aergat, nky. aergad battle conflict" (s. GPC, GBGG) exi-stiert die Kombination genau dieser beiden Wörter, nur in um-
44 Zum Phänomen der traditionellen Orthographie vgl. McManus, ßriu 37 (1986)5f., und 1991 §§ 5.6-8 (am Beispiel der ir. Ogaminschriften). Vgl., ebf. speziell zuinschriftlichen Belegen, Sims-Williams 1990, 237: "... as a general rule, a record-ing of a phonological innovation in an inscription is significant chronological evi-dence, but a raw-recording is insignificant. Hence epigraphy can rarely stand inthe way of cwte-dating sound-changes."
45 Eine solche wird ohnehin angesetzt für den ähnlichen Wandel *-dr- > *-ir- (wiez. B. in der Vorgeschichte des angeführten Vergleichswortes cathair "Stuhl"),ebf. aufgrund der Belege (LHEB 429-31). Eine Datierung vor der Lenierung istjedoch nicht erforderlich, wenn man letzteren Vorgang mit Sims-Williams (1990,232f., vgl. 225) aufspaltet in eine (ir. und brit.) "First Spirantization of voicedstops amd [m]" (schon vor 400?) und einen späteren, jeweils einzelsprachlichverschiedenen zweiten Teil, <rVoicing of [p t k] in British" bzw. "Second Spirant-ization of [k(w) t k] in Irish". Damit ist hier auch, parallel zu *-gr- > *-jr- > *-ir-,ein Übergang *-dr- > *-dr- > *4r- anzusetzen.
46 Die Entlehnung wäre dann, sofern sie im Ir. synchron noch als Kompositumaufgefaßt wurde, als "hybrid" oder 'loan-blend" einzustufen, vgl. McManus,Urin 35 (1984) 142 f. Diese analogische Beeinflussung ist völlig naheliegend fürden Personennamen Cathair, nicht jedoch für das Appellativum cathair, das.deshalb sicher vor der brit. Sonorisierung (und der ir. zweiten Spirantisierung)entlehnt worden ist.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
892 Jürgen Üblich
gekehrter Reihenfolge,47 und die unterschiedliche Stellung derKompositionsglieder mindert auch nicht den Wert dieser Paral-lele, denn aergat ist ein Kompositum vom Typ Dvandva (bzw.dessen Untertyp der Synonymen- oder Hendiadyoinkombina-tion; s. Uhlich 1993 §§75 Anm. 64, 78 b), und ein entsprechen-der Personenname ist als Dvandva-Bahuvrihi aufzufassen (ebd.§§ 88 a, 89), und allen Dvandvatypen wesensmäßig gemein istdas Merkmal, daß ihre Glieder ohne semantische Konsequenzenumgestellt werden können (vgl. ebd. § 78 a).48
3) *agro- [bzw. sein Reflex] erscheint in brit. Komposita nurin erster Position. Hier genügt, abgesehen vom möglichen Zu-fall der Überlieferung, schon der Hinweis auf das eng verwand-te Gallische: Su-agrios "sehr wild", Ver-agri "die gewaltigenKämpfer" (KGP 119, 272, 290).
4) Cathair sei nicht indeklinabel, sondern ein ursprünglichero-Stamm Cathaer, Gen. Cathair, < *katu-airos, mit unklaremHinterglied; vgl. evtl. den Namen Aer (LL 1518) sowie das
. Appellativum der, ä, f., "Spott, Satire". S. jedoch oben zu denReimbelegen für Nom./Dat. Cathair und den nicht beweiskräf-tigen bloßen Schreibungen Cathaer (sowohl Nom. als auchGen.!); lediglich eines der angeführten Beispiele enthält einengesicherten Nom. Cathaer, der sich jedoch problemlos als se-kundär, nach dem produktiven Muster der o-Flexion, erklärt.49
Damit erübrigen sich die erwogenen Vergleiche für das Hinter-glied; doch der Name Aer ist ohnehin nur eine künstliche Bil-dung aus dem Lebor Gabala (ßrenri) und eine Variante zu Er
47 Ein entsprechender Personenname, Aergad (TYP S. 323, :Argat, Nr. 7), ist nichtzuverlässig bezeugt, s. EWGT 64 § 68: Argud mit den v.ll. Argudd, Elgud,Argat, Aergad.
48 Weitere Beispiele für die Kombination zweier Synonyme oder einander seman-tisch nahestehender Wörter aus dem Bereich "Kampf sowie z. T. auch für dasVorliegen beider Gliederreihenfolgen sind die ir. Personennamen Bodbchath vs.abret. Catu(u)odu u.a. (s. Uhlich 1993, 180) und Bua(i)dgalach (TBC-Rec I3470/TBC-LL 4069) vs. abret. Galbudic u. a. (Chrest. 131), ferner z. B. ahd.Hütiwic (u. a., Förstemann 838).
49 Vgl. O'Brien, Uriu 16 (1952) 167 Anm. zu 13 d, und allgemeiner Celtica 3 (1956)173 f. (teilweise zitiert unten zu Midir). Die strukturelle Stabilität einerursprünglichen o-Flexion wäre auch kaum durch eine noch dazu nur formaleanalogische Assoziation mit dem semantisch eher fernliegenden cathair "Stuhl"(Marstrander, I.e. 366) aufgewogen worden.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen
(s. CGH 620), und ein Name mit dem Hinterglied der wäresemantisch zumindest auffällig.50
Damit bleibt festzuhalten, daß von den vorgeschlagenen Her-leitungen für diesen Personennamen nur die (im Formalen nochzu wenig detaillierte) Anregung von Meyer plausibel ist und derursprünglich indeklinable Name Cathair als Entlehnung auseinem abrit. *katairos bzw. *kadairos oder einem aky. *catair(-t- = [d]) betrachtet werden muß.
Der dritte hier zu behandelnde Name ist der Göttername Mi-dir, auch hier zunächst einige Belege:
Nom./Dat./Akk. Midir, Üriu 12 (1934-8) 142,30 u.a. (auch Dat.,Akk.; 45 Belege); Met. Ds. II 4, 50 (Reim: dligid), 8, 86 (Reim:dligid), u. a.Mider, 170, 27 (:Midir), 29 (:Midir)Gen. Midir, 142, 18, u. a. (auch Vok.; 7 Belege)s. O'Brien, Celtica 3 (1956) 173; EIHM 567.
Daraus ergibt sich, ähnlich wie im Falle von Cathaer/Cath-air, ein grundsätzlich indeklinabler Name - Nom. = Gen. Midir-, doch erscheint daneben vereinzelt (und nur als v.l.) auch einNom. Mider, der dem Muster der o-Flexion entspricht. Ausdiesem Befund erschließt O'Rahilly einen ursprünglichen o-Stamm Mider < *Mediros, und der übliche Nom. Midir verdan-ke sich einer "notable tendency in Middle Irish to employ thegenitival forms of uncommon names as nominatives (cf. Mid. Ir.Goibnenri)".51 Wie jedoch O'Brien (Celtica 3 (1956) 173f.) be-tont, ist diese nur scheinbare Tendenz vielmehr das Resultateiner fortschreitenden Ausbreitung der produktiven o-Flexionim Mittelirischen (vgl. auch Üblich 1993 §§ 97-100). Hierausfolgt, daß die Annahme, "that an ordinary o-stem Miderchanged its declension ... is highly improbable; to suggest thatit became indeclinable - a tendency unknown in the language -is unthinkable"; Mider ist vielmehr erst sekundär nach dem
50 Auf der formalen Seite wären unter den Belegen zumindest Reste einerursprünglichen -Flexion zu erwarten (also Gen. *Cathaire), da diese auch inmask. air. Personennamen zunächst erhalten ist (s. Uhlich 1993 § 98).
51 EIHM 293 Anm. 3, 567: "root med-, as in 0. Ir. midiur, judge', [which] hasprobably much the same signification ... [as] Pwyll, whose name means 'wis-dom', 'the wise one'".
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
894 Jürgen Uhlich
Muster der o-Flexion entstanden, und Midir sei wie andereindeklinable Namen "probably borrowed from some otherlanguage" (O'Brien, I.e. 174).
Denselben Einwand erhebt Bergin (IHS 10 (1956-7) 423f.)und hält den Namen Midir grundsätzlich für undeutbar: "Ifmere guesses are allowed, one might explain Midir as a hypoco-ristic form of *Mid-ri < *Medu-riks 'King of the mead'... or ofCeltic *Medu-rios (= Sk. madhu-priyas) lover of mead', or of*Medio-riks 'king of Mide\ etc. I toss these suggestions up toglitter for a moment before they fall on the dustheap of idlefancies." Von diesen "idle fancies" läßt sich jedoch die erste zumAusgangspunkt einer Deutung machen, da sie weiter abstütz-bar ist: Zwar bleibt unklar, nach welcher formalen Regel einHypokoristikon Midir aus einem *Midri abgeleitet sein soll,aber die von Bergin angesetzte Bildung kelt. *medu-rik-s ist ingall. 52 tatsächlich belegt. Um auf dieser Grundla-ge nun ir. Midir zu erklären, ist auch in diesem Fall der Umwegüber das Britannische möglich: Ein neben dem Gall, auch fürdas Abrit. ansetzbares *medu-riks hätte sich weiterentwickelt> *mediris53 > *medir > mecft'r54 > aky. *Medir > mky. *Me-dyr > nky. *Meddyrf5 will man ir. Midir als Entlehnung auseinem dieser Entwicklungsstadien herleiten, so bedarf der nä-heren Erläuterung nur der Vokal -i- der ersten Silbe. AlsGrundlage hierfür kommt kaum das ursprüngliche abrit./urky.*-e-, sondern nur eine spätere Stufe ab dem urky. *-e- in Frage:Dieses ist aus älterem *-e- durch Binnensilbenumlaut ("internalaffection") entstanden, der nach LHEB 616 f. für das Ky. aufdas 7. (-8.) Jahrhundert zu datieren ist. Zwar werden beideLaute, [e] und [e], im Ky. graphisch gleichermaßen mit ( e )wiedergegeben, sie müssen sich jedoch phonetisch im Öffnungs-grad eindeutig voneinander unterschieden haben, denn im Ge-gensatz zu ursprünglichem [e] bewirkt umgelautetes [e] seiner-seits erneut Umlaut in der vorhergehenden Silbe, vgl. mky.
52 RIG I G-71, nach Lejeune (ebd.) gegenüber dem theoretisch möglichen -die wahrscheinlichere Lesung.
53 -d- durch erste Spirantisierung (vgl. oben Anm. 13), 4- durch Endsilbenumlaut.54 -e- durch Binnensilbenumlaut (s. weiter unten im Text).55 Vgl. die parallel gebaute Bildung *magloriks > mky. Meilyr (vgl. Uhlich 1993,
210 Anm. 154).
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 895
kerennyd "Freundschaft" < *karantiio- und ebestyl "Apostel"(PL) < *apostoli.56 Ein durch Umlaut entstandenes urky. e(vgl. auch LHEB 582) war demnach geschlossener (= [e]) alsursprüngliches e = [e], und solange keine Parallelfälle für dieEntlehnung eines solchen [e] ins Irische vorliegen, läßt sichimmerhin, wie schon oben im Falle von Brenden, einstweileneine ad-hoc-Regel formulieren, wonach zwar [e] —> zu erwarten-dem ir. e, aber [e] -> ir. i. Unter dieser Voraussetzung läßt sichder Name Midir also als Entlehnung aus urky. *medir oderaky. *Medir erklären.
Damit bleiben bei der hier vertretenen Herleitung der be-sprochenen drei irischen Personennamen noch folgende Detailsoffen oder bedürfen weiterer Absicherung: 1) Für die Herlei-tung des palatalen Auslauts von Brenainn liegen keine eindeu-tigen Parallelen vor; 2) die im Falle von Brenden angenommeneRegel *~snd- > -nd- bleibt zunächst ad hoc; 3) das gleiche giltfür das Wiedergabemuster ky. fe] —»ir. i im Falle von Midir, 4)es fehlen bislang Reimbeispiele zur eindeutigen Feststellungder Quantität der Erstsilbenvokale in Brenden und Brenainn;und 5) die hier angestellten Überlegungen betreffen lediglichdie linguistische Seite der angenommenen Entlehnungsvorgän-ge. In allen Fällen wäre noch eine außersprachliche Abstüt-zung, d. h. zusätzlich zum allgemeinen Hintergrund der irischenLehnwörter aus dem Britannischen oder dem Britannisch-La-teinischen z. B. ein genauerer historischer Kontext für die je-weilige Entlehnung, willkommen, um so die hier aufgezeigterein sprachliche Möglichkeit oder auch Plausibilität der Entleh-nung zu einer tatsächlichen Wahrscheinlichkeit zu erheben.
Vergleichende Sprachwissenschaft JÜRGEN UHLICHFB 11, Universität Marburg
56 Zusammen = "double affection", s. LHEB 591 f.; s. GPC s.w. "carennydd,cerennydd" bzw. "ebostol"; jeweils mit e durch Binnenumlaut und e durch Nach-folgeumlaut.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
896 Jürgen Üblich
Literatur(Abkürzungen, soweit nicht im DIL oder in der Bibliographie linguistique
aufgeführt)
Ad.: Adomnan's life ofColumba. Ed. A. 0. ANDERSON/M. 0. ANDERSON (London/Edinburgh/Paris/ ... 1961).
BINCHY, D. A., 1970: Celtic and Anglo-Saxon kingship (Oxford).BREATNACH, L., 1994: "An Mheän-Ghaeilge", in Stair na Gaeilge. In omos do
Pädraig 0 Fiannachta. Ed. K. McCoNE/ ... (Maynooth), 221-333.CGH: Corpus genealogiarum Hibemiae vol. 1. Ed. M. A. O'BRIEN (Dublin 1962,
Nachdruck 1976).CGSH: Corpus genealogiarum sanctorum Hibemiae. Ed. P. 0 RIAIN (Dublin
1985).CHARLES-EDWARDS, T. M., 1974: "Native political organization in Roman Britain
and the origin of MW brenhin", in Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschriftfür Hermann Güntert. Hg. M. MAYRHOFER/ ... (Innsbruck), 35-45.
Chrest: J. LOTH, Chrestomathie, bretonne. Premiere partie: Breton-armoricain(Paris 1890).
DIL: Dictionary of the Irish language (und Contributions to a dictionary ...)(Dublin 1913-75; compact edition 1983).
DINNEEN, P. S.: Focloir Gaedhilge agus Bearla. An Irish-English dictionary (Newedition Dublin 1927, reprinted with additions in 1934, ... reprinted 1979).
Don.: The martyrology of Donegal Ed. J. H. TODD/W. REEVES (Dublin 1864).EIHM: T. F. O'RAHILLY, Early Irish history and mythology (Dublin 1946, reprint-
ed ... 1976).EWGT: Early Welsh genealogical tracts. Ed. P. C. BARTRUM (Cardiff 1966).FÖRSTEMANN, E.: Altdeutsches Namenbuch. [I] Personennamen (zweite, völlig
umgearbeitete Auflage Bonn 1900, Nachdruck München/Hildesheim 1966).GBGG: Geirfa barddoniaeth gynnar Gymraeg gan. J. LLOYD-JONES (Caerdydd
1931-).GOI: R. THURNEYSEN, A grammar of Old Irish (Dublin 1946 und Nachdrucke).GPC: Geiriadur Prifysgol Cymru. A dictionary of the Welsh language (Caerdydd
1950-).KGP: K. H. SCHMIDT, "Die Komposition in gallischen Personennamen", ZCP 26
(1957) 33-301.LHEB: K.JACKSON, Language and history in early Britain (Edinburgh 1953;
reprinted Dublin 1994).LL: The Book of Leinster, formerly Lebar na Nuachongbala. Bd. I ed. R. I. BEST/
0. BERGIN/M. A. O'BRIEN (1954). II-V ed. R. I. BEST/M. A. O'BRIEN (1956,1957, 1965, 1967). VI ed. A. O'SULLIVAN (1983) (Dublin).
Lland.: The text of the Book ofLlan Ddv. Ed. J. GWENOGVRYN EVANS with the co-operation of J. RHYS (Oxford 1893).
McCoNE, K., 1994: "An tSean-Ghaeilge agus a re"amhstair", in Stair na Gaeilge. Inomos do Padraig 0 Fiannachta. Ed. K. McCONE/... (Maynooth), 61-219.
McMANUS, D., 1991: A guide to Ogam. Maynooth Monographs 4 (Maynooth).MEYER, K., 1912: "Ein mittelirisches Gedicht auf Brendan den Meerfahrer", Sit-
zungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 25,436^3.
O'RAHILLY, T. F., 1935: 'The Goidels and their predecessors". The Sir John Rh$smemorial lecture. PEA 21, 323-72.
RIG: Recueil des inscriptions gauloises. Sous la direction de P.-M. DUVAL. VolumeI: Textes gallo-grecs. M. LEJEUNE (Paris 1985).
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22
Britannische Lehnnamen im Irischen 897
SCHRIJVER, P., 1995: Studies in British Celtic historical phonology. Leiden Stud-ies in Indo-European 5 (Amsterdam/Atlanta, GA).
SIMS-WILLIAMS, P., 1990: "Dating the transition to Neo-Brittonic: Phonology andhistory, 400-600", in Britain 400-600: Language and history. Ed. A. BAMMES-BERGER/A. WOLLMANN (Heidelberg), 217-61.
Tall.: Themartyrology ofTallaght. Ed. R. I. BEST/H. J. LAWLOR. Henry BradshawSociety, vol. LXVIII (London 1895).
TBC-LL: Tain Bo Cualngefrom the Book of Leinster. Ed. C. O'RAHILLY (Dublin1970).
TBC-Rec. I: Tain Bo Cuailnge. Recension I. Ed. C. O'RAHILLY (Dublin 1976).Tig.: 'The Annals of Tigernach", ed. WH.STOKES. The third fragment. A.D.
489-766, RC 17 (1896) 119-263. The fourth fragment, A.D. 973-1088, ebd.337-420. Tig. II: The continuation, A. D. 1088-1178, RC 18 (1897) 9-59, 150-97,267-̂ 303 (Nachdruck 2 Bde Felinfach 1993).
TYP: Trioedd Ynys Pridein. Ed. R. Bromwich (Cardiff 1978).UHLICH, J., 1993: Die Morphologie der komponierten Personennamen des Altiri-
schen (Witterschlick/Bonn).UHLICH, J., 1996: "On the fate of intervocalic *-u- in Old Irish, especially between
neutral vowels", Uriu 46 (1995) 11̂ 48.VGKS: H. PEDERSEN, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. 2 Bde.
(Göttingen 1909, 1913; Nachdruck 1976).WG: J. MORRIS JONES, A Welsh grammar (Oxford 1913).Wortk.: K. MEYER, "Zur keltischen Wortkunde" I-IX. Sitzungsberichte der König-
lich Preußischen Akademie der Wissenschaften (1912-1919). X. ZCP 13 (1920)184-93.
Bereitgestellt von | De Gruyter / TCSAngemeldet | 46.30.84.116
Heruntergeladen am | 19.02.14 16:22