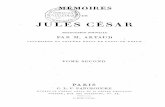Nord“ und „Süd“ im globalen Regieren
-
Upload
maastrichtuniversity -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nord“ und „Süd“ im globalen Regieren
ABHANDLUNG
PVS (2009) 50 203-225DOI 101007s11615-009-0133-6
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren
Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Zusammenfassung Die Diskussion um globales Regieren bezieht sich bislang vornehmlich auf die hoch industrialisierten Gesellschaften der OECD-Welt Innenpolitische Voraussetzungen fuumlr effektives und legitimes globales Regieren sind jenseits der OECD-Welt oftmals in geringerem Ausmaszlig gegeben als im Kreis der entwickelten Industriestaaten Aus der Perspektive der liberalen Auszligenpolitikforschung lassen sich unterschiedliche Strategietypen von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens ableiten die Implikationen fuumlr das Konzept von Global Govern-ance haben Eine innenpolitische Konstellationen beruumlcksichtigende Perspektive erlaubt auch ei-nen differenzierten Blick auf die normativen Herausforderungen globalen Regierens
Schlagwoumlrter Global Governance middot Internationale Regime middot Nord-Suumld-Beziehungen middot Auszligen-politikanalyse
Abstract The debate on global governance has been focused primarily on the highly industrial-ized countries of the OECD world However domestic preconditions for cooperative and effec-tive global governance tend to be precarious in many non-OECD countries The consideration of such factors allows to identify different types of global governance strategies employed by developing countries which have severe implications for the concept of global governance Such a perspective from liberal foreign policy analysis also enables a differentiated analysis of norma-tive challenges of global governance
Keywords Global Governance middot International Regimes middot North-South Relations middot Foreign Policy Analysis
copy VS-Verlag 2009
Dr Thomas Conzelmann ()Universiteit Maastricht FdCMW Grote Gracht 90ndash92 NL-6211 SZ Maastricht NiederlandeE-Mail TConzelmannmaastrichtuniversitynl
Dr Joumlrg FaustDeutsches Institut fuumlr Entwicklungspolitik Tulpenfeld 6 53113 BonnE-Mail joergfaustdie-gdide
204 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
1 Einfuumlhrung
Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen entwickelter und weniger entwickelter Welt erfahren seit geraumer Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit in der Teil-disziplin der Internationalen Beziehungen Ursaumlchlich hierfuumlr sind vornehmlich zwei Entwicklungen Zum einen verfolgen aufsteigende Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder wie China Indien Brasilien Suumldafrika oder Mexiko immer selbstbewusster eigene In-teressen in Fragen wie der aktuellen Welthandelsrunde der globalen Nonproliferations-politik der Weltklimapolitik oder bei institutionellen Groszligvorhaben wie der Reform der Vereinten Nationen Zum anderen stehen unmittelbar entwicklungsbezogene Themen wie Staatszerfall Terrorismusbekaumlmpfung und die Forderung nach einer Verbesserung der Governance-Strukturen in den Laumlndern des Suumldens in zunehmend staumlrkerem Maszlige auf der Agenda der internationalen Politik (Betz 2003 Risse 2007)
Diese Entwicklungen werfen nicht nur die Frage nach gangbaren politischen Hand-lungsoptionen auf mittels derer die Bearbeitung globaler Probleme zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo in friedlicher effektiver und legitimer Weise gelingen kann Sie stellen die wissenschaftliche Diskussion auch vor die in diesem Beitrag diskutierte Frage mit wel-chen konzeptionellen Zugaumlngen sich herausbildende Strukturen globalen Regierens zwi-schen der OECD-Welt und staatlichen wie gesellschaftlichen Akteuren aus Entwick-lungslaumlndern analysiert werden koumlnnen Zur Beantwortung dieser Frage bieten sich zunaumlchst zwei Ansaumltze an Erstens koumlnnten die sich abzeichnenden bdquoMachtverschiebun-gen im internationalen Systemldquo (Messner 2006 45) als neue Runde des Nord-Suumld-Konflikts gedeutet werden Allerdings ist die Heuristik des Nord-Suumld-Konflikts anti-quiert was vor allem mit der Staatszentriertheit des Konzepts sowie der zunehmenden Differenzierung des bdquoSuumldensldquo (und des bdquoNordensldquo) bezuumlglich soziooumlkonomischer Fak-toren internationaler Einflusspotenziale sowie Staatlichkeit und Herrschaftsweise zu-sammenhaumlngt (Boeckh 2004) Dieser Umstand macht auch die Identifizierung einer den bdquoNord-Suumld-Konfliktldquo definierenden Konfliktlinie unmoumlglich Ein zweiter Zugang zur Frage des Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo koumlnnte sich aus der Forschung uumlber bdquoRegieren in Raumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo ergeben Hierbei geht es im Wesentli-chen darum bdquoob und unter welchen Bedingungen legitime governance-Leistungen er-bracht werden koumlnnen ohne dass auf die Mechanismen demokratischer Rechtsstaaten zuruumlckgegriffen werden kannldquo (Risse 2007 240) Die Governance-Problematik wird hier vor allem auf die Erbringung von Kollektivguumltern und die Kontrolle von Herrschaft in schwachen oder zerfallenden Staaten bezogen
Zwar interessieren wir uns im Folgenden ebenfalls fuumlr die aus fragiler Zivilgesell-schaft und tief greifenden politischen wie oumlkonomischen Transformationsprozessen ent-stehenden Herausforderungen fuumlr effektives und legitimes Regieren Doch beschaumlftigt uns vor allem die Frage wie sich die zu globaler Mitwirkung befaumlhigten politisch und oumlkonomisch aufstrebenden Staaten in Prozesse des Regierens auf globaler Ebene ein-fuumlgen Diese Problemstellung erachten wir nicht nur im Zusammenhang mit der Dis-kussion um den globalen Bedeutungsgewinn einiger Entwicklungslaumlnder fuumlr relevant
Wir danken Steffen Bauer Helmut Breitmeier Lothar Brock Dirk Messner Juumlrgen Neyer Klaus Dieter Wolf sowie den Gutachtern der PVS fuumlr wertvolle Anregungen zu fruumlheren Ver-sionen dieses Beitrags
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 205
sondern auch vor dem Hintergrund der These dass sich die empirische und konzeptio-nelle Diskussion von Global Governance zu lange einseitig auf die hoch industrialisierten Gesellschaften bezogen hat (vgl MessnerNuscheler 2006 66-68 Risse 2007 236-240) Aus den Augen verloren wurde dabei dass eine Reihe innenpolitischer Voraussetzungen fuumlr effektives und legitimes globales Regieren im Raum jenseits der OECD-Welt ten-denziell problematischer ist als im Kreis der entwickelten Industriestaaten Zu nennen sind vor allem die Virulenz der aus oumlkonomischen und politischen Transformations-prozessen entstehenden gesellschaftlichen Konflikte und die haumlufig zu beobachtende Schwaumlche der Zivilgesellschaft Es gilt also die Diskussion um Global Governance empirisch und konzeptionell zu differenzieren indem solche haumlufig als unproblematisch unterstellte jedoch in vielen Entwicklungslaumlndern keinesfalls selbstverstaumlndliche in-nenpolitische Bedingungsfaktoren des globalen Regierens genauer in den Blick genom-men werden Vor diesem Hintergrund koumlnnen Aussagen zu unterschiedlichen auszligenpo-litischen Strategietypen von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens entwickelt werden von denen dann auch normative Implikationen fuumlr globales Regieren abzuleiten sind Entsprechend dieser Zielsetzungen ist die Argumentation in vier Schrit-te gegliedert
In Kapitel 2 zeigen wir dass die anhand politischer Prozesse in der OECD-Welt entwickelte Global-Governance-Heuristik nicht einfach undifferenziert auf die zuneh-mende Partizipation von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens ange-wandt werden kann Eine Reihe von Indikatoren illustriert dass jene Laumlndergruppe im Durchschnitt zwar aumlhnlich von Entgrenzungsdynamiken betroffen ist wie die OECD-Welt Doch gleichzeitig unterscheiden sich die innergesellschaftlichen Strukturen dieser Staaten deutlich von denjenigen der OECD-Laumlnder Mithin lassen sich in der OECD-Welt erprobte Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates kaum mittels einer bloszligen bdquoMaszligstabserweiterungldquo auf die fuumlr Global Governance relevanten Entwicklungs-laumlnder uumlbertragen
Aufbauend auf dieser Problemanalyse entwickeln wir in Kapitel 3 ein um innen-politische Faktoren erweitertes Konzept des globalen Regierens Dieses beruumlcksichtigt im Hinblick auf die Bearbeitung von globalen Problemen nicht nur die Relevanz und grundsaumltzliche Befaumlhigung eines Staates fuumlr globales Regieren sondern auch unter-schiedliche Strategien und Interessen mit denen sich Entwicklungs- und Schwel- len laumlnder in Prozesse globalen Regierens einbringen Diese Strategien und Interes-sen sind maszliggeblich von innenpolitischen Faktoren gepraumlgt namentlich von a) der Staumlrke des aus politischem und wirtschaftlichem Wandel resultierenden Transfor-mationsdrucks und b) dem demokratischen oder autoritaumlren Charakter von Herrschafts-strukturen Dabei konzen trieren wir uns vor allem auf die Mitwirkung oumlffentlich ver-fasster Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen der Global Governance Denn ohne die teils beachtlichen Leistungen zivilgesellschaftlicher Akteu-re aus manchen Entwicklungs laumlndern zu ignorieren kommt in Entwicklungslaumlndern aufgrund der meist eher schwach ausgepraumlgten Leistungsfaumlhigkeit zivilgesellschaftli-
206 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
cher Strukturen1 den staatlichen Akteuren bei der Partizipation in Prozessen des globa-len Regierens noch eine prioritaumlre Rolle zu2
Kapitel 4 formuliert dann unter Ruumlckgriff auf eine der Forschung zu internationalen Regimen entlehnte Unterscheidung zwischen Interessen- Mittel- und Wertekonflikten Hypothesen zum Auftreten von vier Strategietypen bei der Beteiligung von Entwick-lungslaumlndern an Prozessen globalen Regierens Diese werden anhand ausgewaumlhlter Bei-spiele knapp illustriert Die Unterscheidung in kooperative kompetitive distributive und konfrontative Strategien in Prozessen globalen Regierens erlaubt es Global-Gover-nance-Prozesse in Beziehung zu innenpolitischen Faktoren zu setzen und damit einer differenzierten Mehrebenenperspektive auf globales Regieren gerecht zu werden Kapi-tel 5 diskutiert abschlieszligend die normativen Implikationen einer solch modifizierten Perspektive auf globales Regieren
Einschraumlnkend sei angemerkt dass es im Folgenden nicht darum gehen kann die facettenreichen Prozesse globalen Regierens unter Beteiligung von Entwicklungslaumln-dern aus empirisch-analytischer Perspektive umfassend abzuarbeiten Ziel des Beitrags ist es aus der Kritik an der bislang dominanten Heuristik von Global Governance eine differenziertere Forschungsperspektive abzuleiten die anschlussfaumlhig an empirisch-analytische wie an normative Diskussionen des globalen Regierens ist
1 Wir folgen einem liberalen auf Locke Montesquieu und Tocqueville zuruumlckgehenden Kon-zept von Zivilgesellschaft Zivilgesellschaft ist als eine Sphaumlre freier vom Staate unabhaumlngi-ger Organisation und Artikulation gesellschaftlicher Interessen anzusehen die von der staatli-chen der wirtschaftlichen und der privaten Sphaumlre unterschieden werden kann Ihr kommt die Aufgabe zu gesellschaftliche Interessen zu artikulieren und partiell auch zu buumlndeln und so zumindest mittelbar auch auf staatliche Politik Einfluss zu nehmen Im Kontext bdquopartizipati-verldquo Ansaumltze der Entwicklungszusammenarbeit und von Governance-Ansaumltzen wird der Zivil-gesellschaft daruumlber hinaus auch eine unterstuumltzende Rolle bei der Politikimplementation zugedacht Die von uns konstatierte bdquoSchwaumlcheldquo der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungs-laumlndern besteht darin dass vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl die Unabhaumlngigkeit vom (Heimat-)Staat als auch von internationalen Geldgebern fehlt dass sie haumlufig nicht uumlber eine Massenbasis und eine feste Verankerung in der Gesellschaft verfuumlgen und intern haumlufig stark klientelistisch strukturiert sind Im Hinblick auf das governance-orientierte Verstaumlndnis der Zivilgesellschaft kommt als sekundaumlres Merkmal hinzu dass viele zivilgesellschaftliche Akteure nicht uumlber ausreichende Ressourcen verfuumlgen um wirkungsvoll zur Artikulation und Buumlndelung gesellschaftlicher Interessen und zur Implementation demokratisch legitimierter Politikergebnisse beizutragen Teilweise ist auch der gewaltfreie Konfliktaustrag nicht akzep-tiert Siehe hierzu allgemein die Beitraumlge in Merkel (2000)
2 Der Hintergrund ist somit nicht die These dass von den drei von Dingwerth (2008a 607-608) genannten Auspraumlgungen von Global Governance (intergovernmental regimes transgovern-mental networks private transnational governance) allein die beiden zuerst genannten bedeut-sam seien Allerdings rechnen wir angesichts der Schwaumlche der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungsgesellschaften damit dass die Auszligenvertretung von Interessen gouvernemental kanalisiert wird und deshalb einstweilen die Mitwirkung von staatlichen und gesellschaftli-chen Akteuren aus dem bdquoSuumldenldquo im Rahmen von intergovernmental regimes und transgovern-mental networks am bedeutsamsten fuumlr die Beteiligung von Entwicklungs- und Schwellen-laumlndern am globalen Regieren sein duumlrfte Auch die regierungsunabhaumlngige Beteiligung internationaler NGOs am globalen Regieren ist uumlberwiegend von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo dominiert (TussieRiggirozzi 2001 Dingwerth 2008a)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 207
2 Global Governance der bdquoNordenldquo und der bdquoSuumldenldquo
Global Governance praumlsentiert sich als ein vielgestaltiges Konzept das sowohl als po-litische Programmvokabel fuumlr eine bdquoWeltinnen-ldquo oder bdquoWeltordnungspolitikldquo wie auch als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Verwendung findet (BrandBrunnengrauml-ber 2000 MessnerNuscheler 2006 DingwerthPattberg 2006) Die Wurzeln von Global Governance als politischer Programmvokabel liegen vornehmlich in der Beschaumlftigung mit den Nord-Suumld-Beziehungen und den Weltkonferenzen der 1990er Jahre Dabei wird explizit auf entwicklungsrelevante Themen wie Armut und Umweltzerstoumlrung rekurriert und Global Governance als alternatives politisches Ordnungsmodell zur Loumlsung draumln-gender globaler Probleme empfohlen
Demgegenuumlber stellt die theoretisch-konzeptionelle Verwendung des Begriffs in der Politikwissenschaft auf Veraumlnderungen der politischen Steuerung bzw Steuerungsfaumlhig-keit ab Global Governance wird als kooperatives Regieren jenseits des Nationalstaates konzeptualisiert das durch einen horizontalen Politikstil die breite Beteiligung zivil-gesellschaftlicher Akteure und freiwillig eingegangene Verhandlungsloumlsungen zur Be-waumlltigung geteilter Probleme gekennzeichnet ist Die Verdichtung supranationaler Or-ganisationsformen die zunehmende Bedeutung transnationaler zivilgesellschaftlicher Allianzen und das Regieren in Mehrebenensystemen sind dabei die wichtigsten real-weltlichen Hintergruumlnde (Deutscher Bundestag 2002) Ihre normativen Impulse bezieht diese Auffassung von Global Governance aus der Diagnose einer schwindenden Steue-rungsfaumlhigkeit nationalstaatlicher Systeme sowie aus der Suche nach alternativen For-men effektiven und legitimen Regierens bdquojenseits des Nationalstaatesldquo (Zuumlrn 1998a) Aus dieser Perspektive sind die UN-Weltkonferenzen vor allem aufgrund der massiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interessant weniger hinsichtlich ihrer subs-tanziellen Aussagen zur Entwicklungsproblematik (vgl auch Messner 2001)
Allerdings ist diese analytische Variante der Diskussion von Global Governance von einer auch in der deutschen Politikwissenschaft zumindest in der Vergangenheit zu be-obachtenden bdquoWestverschiebung der Internationalen Beziehungenldquo gekennzeichnet (Noumllke 2003 524) Dass die wichtigsten empirischen Bezugspunkte der Global-Gover-nance-Diskussion lange Zeit innerhalb der OECD-Welt lagen hatte mit der verbreiteten Sichtweise zu tun dass Global Governance eine kollektive Anstrengung zur politischen Bewaumll tigung von maszliggeblich in der OECD-Welt auftretenden Phaumlnomenen der Denatio-na lisierung sei (Zuumlrn 1998b) Als Folge dieser Argumentation lag nahe anzunehmen dass innerhalb der OECD-Welt und insbesondere innerhalb der EU ein bdquoLaboratoriumldquo von Global Governance entstanden sei (JoslashrgensenRosamond 2001) das aufgrund sei-ner Vorreiterrolle Lehren fuumlr das Regieren jenseits der OECD-Welt bereithalten koumlnne
Auch wenn die Engfuumlhrung auf die OECD-Welt forschungspragmatisch legitim ist so koumlnnte sie in konzeptioneller und empirischer Hinsicht nur dann uumlberzeugen wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen gegeben waumlre Entweder muumlsste sich zeigen lassen dass die Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder von Prozessen der po-litischen oumlkonomischen und gesellschaftlichen Denationalisierung substanziell weniger betroffen sind als die OECD-Welt Fuumlr diesen Teil des Planeten bestuumlnde dann einstwei-len ein geringerer Bedarf an kooperativem Weltregieren Oder es muumlsste sich zeigen lassen dass sich bestimmte Voraussetzungen fuumlr die Teilnahme am kooperativen Welt-
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
204 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
1 Einfuumlhrung
Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen entwickelter und weniger entwickelter Welt erfahren seit geraumer Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit in der Teil-disziplin der Internationalen Beziehungen Ursaumlchlich hierfuumlr sind vornehmlich zwei Entwicklungen Zum einen verfolgen aufsteigende Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder wie China Indien Brasilien Suumldafrika oder Mexiko immer selbstbewusster eigene In-teressen in Fragen wie der aktuellen Welthandelsrunde der globalen Nonproliferations-politik der Weltklimapolitik oder bei institutionellen Groszligvorhaben wie der Reform der Vereinten Nationen Zum anderen stehen unmittelbar entwicklungsbezogene Themen wie Staatszerfall Terrorismusbekaumlmpfung und die Forderung nach einer Verbesserung der Governance-Strukturen in den Laumlndern des Suumldens in zunehmend staumlrkerem Maszlige auf der Agenda der internationalen Politik (Betz 2003 Risse 2007)
Diese Entwicklungen werfen nicht nur die Frage nach gangbaren politischen Hand-lungsoptionen auf mittels derer die Bearbeitung globaler Probleme zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo in friedlicher effektiver und legitimer Weise gelingen kann Sie stellen die wissenschaftliche Diskussion auch vor die in diesem Beitrag diskutierte Frage mit wel-chen konzeptionellen Zugaumlngen sich herausbildende Strukturen globalen Regierens zwi-schen der OECD-Welt und staatlichen wie gesellschaftlichen Akteuren aus Entwick-lungslaumlndern analysiert werden koumlnnen Zur Beantwortung dieser Frage bieten sich zunaumlchst zwei Ansaumltze an Erstens koumlnnten die sich abzeichnenden bdquoMachtverschiebun-gen im internationalen Systemldquo (Messner 2006 45) als neue Runde des Nord-Suumld-Konflikts gedeutet werden Allerdings ist die Heuristik des Nord-Suumld-Konflikts anti-quiert was vor allem mit der Staatszentriertheit des Konzepts sowie der zunehmenden Differenzierung des bdquoSuumldensldquo (und des bdquoNordensldquo) bezuumlglich soziooumlkonomischer Fak-toren internationaler Einflusspotenziale sowie Staatlichkeit und Herrschaftsweise zu-sammenhaumlngt (Boeckh 2004) Dieser Umstand macht auch die Identifizierung einer den bdquoNord-Suumld-Konfliktldquo definierenden Konfliktlinie unmoumlglich Ein zweiter Zugang zur Frage des Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo koumlnnte sich aus der Forschung uumlber bdquoRegieren in Raumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo ergeben Hierbei geht es im Wesentli-chen darum bdquoob und unter welchen Bedingungen legitime governance-Leistungen er-bracht werden koumlnnen ohne dass auf die Mechanismen demokratischer Rechtsstaaten zuruumlckgegriffen werden kannldquo (Risse 2007 240) Die Governance-Problematik wird hier vor allem auf die Erbringung von Kollektivguumltern und die Kontrolle von Herrschaft in schwachen oder zerfallenden Staaten bezogen
Zwar interessieren wir uns im Folgenden ebenfalls fuumlr die aus fragiler Zivilgesell-schaft und tief greifenden politischen wie oumlkonomischen Transformationsprozessen ent-stehenden Herausforderungen fuumlr effektives und legitimes Regieren Doch beschaumlftigt uns vor allem die Frage wie sich die zu globaler Mitwirkung befaumlhigten politisch und oumlkonomisch aufstrebenden Staaten in Prozesse des Regierens auf globaler Ebene ein-fuumlgen Diese Problemstellung erachten wir nicht nur im Zusammenhang mit der Dis-kussion um den globalen Bedeutungsgewinn einiger Entwicklungslaumlnder fuumlr relevant
Wir danken Steffen Bauer Helmut Breitmeier Lothar Brock Dirk Messner Juumlrgen Neyer Klaus Dieter Wolf sowie den Gutachtern der PVS fuumlr wertvolle Anregungen zu fruumlheren Ver-sionen dieses Beitrags
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 205
sondern auch vor dem Hintergrund der These dass sich die empirische und konzeptio-nelle Diskussion von Global Governance zu lange einseitig auf die hoch industrialisierten Gesellschaften bezogen hat (vgl MessnerNuscheler 2006 66-68 Risse 2007 236-240) Aus den Augen verloren wurde dabei dass eine Reihe innenpolitischer Voraussetzungen fuumlr effektives und legitimes globales Regieren im Raum jenseits der OECD-Welt ten-denziell problematischer ist als im Kreis der entwickelten Industriestaaten Zu nennen sind vor allem die Virulenz der aus oumlkonomischen und politischen Transformations-prozessen entstehenden gesellschaftlichen Konflikte und die haumlufig zu beobachtende Schwaumlche der Zivilgesellschaft Es gilt also die Diskussion um Global Governance empirisch und konzeptionell zu differenzieren indem solche haumlufig als unproblematisch unterstellte jedoch in vielen Entwicklungslaumlndern keinesfalls selbstverstaumlndliche in-nenpolitische Bedingungsfaktoren des globalen Regierens genauer in den Blick genom-men werden Vor diesem Hintergrund koumlnnen Aussagen zu unterschiedlichen auszligenpo-litischen Strategietypen von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens entwickelt werden von denen dann auch normative Implikationen fuumlr globales Regieren abzuleiten sind Entsprechend dieser Zielsetzungen ist die Argumentation in vier Schrit-te gegliedert
In Kapitel 2 zeigen wir dass die anhand politischer Prozesse in der OECD-Welt entwickelte Global-Governance-Heuristik nicht einfach undifferenziert auf die zuneh-mende Partizipation von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens ange-wandt werden kann Eine Reihe von Indikatoren illustriert dass jene Laumlndergruppe im Durchschnitt zwar aumlhnlich von Entgrenzungsdynamiken betroffen ist wie die OECD-Welt Doch gleichzeitig unterscheiden sich die innergesellschaftlichen Strukturen dieser Staaten deutlich von denjenigen der OECD-Laumlnder Mithin lassen sich in der OECD-Welt erprobte Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates kaum mittels einer bloszligen bdquoMaszligstabserweiterungldquo auf die fuumlr Global Governance relevanten Entwicklungs-laumlnder uumlbertragen
Aufbauend auf dieser Problemanalyse entwickeln wir in Kapitel 3 ein um innen-politische Faktoren erweitertes Konzept des globalen Regierens Dieses beruumlcksichtigt im Hinblick auf die Bearbeitung von globalen Problemen nicht nur die Relevanz und grundsaumltzliche Befaumlhigung eines Staates fuumlr globales Regieren sondern auch unter-schiedliche Strategien und Interessen mit denen sich Entwicklungs- und Schwel- len laumlnder in Prozesse globalen Regierens einbringen Diese Strategien und Interes-sen sind maszliggeblich von innenpolitischen Faktoren gepraumlgt namentlich von a) der Staumlrke des aus politischem und wirtschaftlichem Wandel resultierenden Transfor-mationsdrucks und b) dem demokratischen oder autoritaumlren Charakter von Herrschafts-strukturen Dabei konzen trieren wir uns vor allem auf die Mitwirkung oumlffentlich ver-fasster Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen der Global Governance Denn ohne die teils beachtlichen Leistungen zivilgesellschaftlicher Akteu-re aus manchen Entwicklungs laumlndern zu ignorieren kommt in Entwicklungslaumlndern aufgrund der meist eher schwach ausgepraumlgten Leistungsfaumlhigkeit zivilgesellschaftli-
206 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
cher Strukturen1 den staatlichen Akteuren bei der Partizipation in Prozessen des globa-len Regierens noch eine prioritaumlre Rolle zu2
Kapitel 4 formuliert dann unter Ruumlckgriff auf eine der Forschung zu internationalen Regimen entlehnte Unterscheidung zwischen Interessen- Mittel- und Wertekonflikten Hypothesen zum Auftreten von vier Strategietypen bei der Beteiligung von Entwick-lungslaumlndern an Prozessen globalen Regierens Diese werden anhand ausgewaumlhlter Bei-spiele knapp illustriert Die Unterscheidung in kooperative kompetitive distributive und konfrontative Strategien in Prozessen globalen Regierens erlaubt es Global-Gover-nance-Prozesse in Beziehung zu innenpolitischen Faktoren zu setzen und damit einer differenzierten Mehrebenenperspektive auf globales Regieren gerecht zu werden Kapi-tel 5 diskutiert abschlieszligend die normativen Implikationen einer solch modifizierten Perspektive auf globales Regieren
Einschraumlnkend sei angemerkt dass es im Folgenden nicht darum gehen kann die facettenreichen Prozesse globalen Regierens unter Beteiligung von Entwicklungslaumln-dern aus empirisch-analytischer Perspektive umfassend abzuarbeiten Ziel des Beitrags ist es aus der Kritik an der bislang dominanten Heuristik von Global Governance eine differenziertere Forschungsperspektive abzuleiten die anschlussfaumlhig an empirisch-analytische wie an normative Diskussionen des globalen Regierens ist
1 Wir folgen einem liberalen auf Locke Montesquieu und Tocqueville zuruumlckgehenden Kon-zept von Zivilgesellschaft Zivilgesellschaft ist als eine Sphaumlre freier vom Staate unabhaumlngi-ger Organisation und Artikulation gesellschaftlicher Interessen anzusehen die von der staatli-chen der wirtschaftlichen und der privaten Sphaumlre unterschieden werden kann Ihr kommt die Aufgabe zu gesellschaftliche Interessen zu artikulieren und partiell auch zu buumlndeln und so zumindest mittelbar auch auf staatliche Politik Einfluss zu nehmen Im Kontext bdquopartizipati-verldquo Ansaumltze der Entwicklungszusammenarbeit und von Governance-Ansaumltzen wird der Zivil-gesellschaft daruumlber hinaus auch eine unterstuumltzende Rolle bei der Politikimplementation zugedacht Die von uns konstatierte bdquoSchwaumlcheldquo der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungs-laumlndern besteht darin dass vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl die Unabhaumlngigkeit vom (Heimat-)Staat als auch von internationalen Geldgebern fehlt dass sie haumlufig nicht uumlber eine Massenbasis und eine feste Verankerung in der Gesellschaft verfuumlgen und intern haumlufig stark klientelistisch strukturiert sind Im Hinblick auf das governance-orientierte Verstaumlndnis der Zivilgesellschaft kommt als sekundaumlres Merkmal hinzu dass viele zivilgesellschaftliche Akteure nicht uumlber ausreichende Ressourcen verfuumlgen um wirkungsvoll zur Artikulation und Buumlndelung gesellschaftlicher Interessen und zur Implementation demokratisch legitimierter Politikergebnisse beizutragen Teilweise ist auch der gewaltfreie Konfliktaustrag nicht akzep-tiert Siehe hierzu allgemein die Beitraumlge in Merkel (2000)
2 Der Hintergrund ist somit nicht die These dass von den drei von Dingwerth (2008a 607-608) genannten Auspraumlgungen von Global Governance (intergovernmental regimes transgovern-mental networks private transnational governance) allein die beiden zuerst genannten bedeut-sam seien Allerdings rechnen wir angesichts der Schwaumlche der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungsgesellschaften damit dass die Auszligenvertretung von Interessen gouvernemental kanalisiert wird und deshalb einstweilen die Mitwirkung von staatlichen und gesellschaftli-chen Akteuren aus dem bdquoSuumldenldquo im Rahmen von intergovernmental regimes und transgovern-mental networks am bedeutsamsten fuumlr die Beteiligung von Entwicklungs- und Schwellen-laumlndern am globalen Regieren sein duumlrfte Auch die regierungsunabhaumlngige Beteiligung internationaler NGOs am globalen Regieren ist uumlberwiegend von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo dominiert (TussieRiggirozzi 2001 Dingwerth 2008a)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 207
2 Global Governance der bdquoNordenldquo und der bdquoSuumldenldquo
Global Governance praumlsentiert sich als ein vielgestaltiges Konzept das sowohl als po-litische Programmvokabel fuumlr eine bdquoWeltinnen-ldquo oder bdquoWeltordnungspolitikldquo wie auch als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Verwendung findet (BrandBrunnengrauml-ber 2000 MessnerNuscheler 2006 DingwerthPattberg 2006) Die Wurzeln von Global Governance als politischer Programmvokabel liegen vornehmlich in der Beschaumlftigung mit den Nord-Suumld-Beziehungen und den Weltkonferenzen der 1990er Jahre Dabei wird explizit auf entwicklungsrelevante Themen wie Armut und Umweltzerstoumlrung rekurriert und Global Governance als alternatives politisches Ordnungsmodell zur Loumlsung draumln-gender globaler Probleme empfohlen
Demgegenuumlber stellt die theoretisch-konzeptionelle Verwendung des Begriffs in der Politikwissenschaft auf Veraumlnderungen der politischen Steuerung bzw Steuerungsfaumlhig-keit ab Global Governance wird als kooperatives Regieren jenseits des Nationalstaates konzeptualisiert das durch einen horizontalen Politikstil die breite Beteiligung zivil-gesellschaftlicher Akteure und freiwillig eingegangene Verhandlungsloumlsungen zur Be-waumlltigung geteilter Probleme gekennzeichnet ist Die Verdichtung supranationaler Or-ganisationsformen die zunehmende Bedeutung transnationaler zivilgesellschaftlicher Allianzen und das Regieren in Mehrebenensystemen sind dabei die wichtigsten real-weltlichen Hintergruumlnde (Deutscher Bundestag 2002) Ihre normativen Impulse bezieht diese Auffassung von Global Governance aus der Diagnose einer schwindenden Steue-rungsfaumlhigkeit nationalstaatlicher Systeme sowie aus der Suche nach alternativen For-men effektiven und legitimen Regierens bdquojenseits des Nationalstaatesldquo (Zuumlrn 1998a) Aus dieser Perspektive sind die UN-Weltkonferenzen vor allem aufgrund der massiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interessant weniger hinsichtlich ihrer subs-tanziellen Aussagen zur Entwicklungsproblematik (vgl auch Messner 2001)
Allerdings ist diese analytische Variante der Diskussion von Global Governance von einer auch in der deutschen Politikwissenschaft zumindest in der Vergangenheit zu be-obachtenden bdquoWestverschiebung der Internationalen Beziehungenldquo gekennzeichnet (Noumllke 2003 524) Dass die wichtigsten empirischen Bezugspunkte der Global-Gover-nance-Diskussion lange Zeit innerhalb der OECD-Welt lagen hatte mit der verbreiteten Sichtweise zu tun dass Global Governance eine kollektive Anstrengung zur politischen Bewaumll tigung von maszliggeblich in der OECD-Welt auftretenden Phaumlnomenen der Denatio-na lisierung sei (Zuumlrn 1998b) Als Folge dieser Argumentation lag nahe anzunehmen dass innerhalb der OECD-Welt und insbesondere innerhalb der EU ein bdquoLaboratoriumldquo von Global Governance entstanden sei (JoslashrgensenRosamond 2001) das aufgrund sei-ner Vorreiterrolle Lehren fuumlr das Regieren jenseits der OECD-Welt bereithalten koumlnne
Auch wenn die Engfuumlhrung auf die OECD-Welt forschungspragmatisch legitim ist so koumlnnte sie in konzeptioneller und empirischer Hinsicht nur dann uumlberzeugen wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen gegeben waumlre Entweder muumlsste sich zeigen lassen dass die Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder von Prozessen der po-litischen oumlkonomischen und gesellschaftlichen Denationalisierung substanziell weniger betroffen sind als die OECD-Welt Fuumlr diesen Teil des Planeten bestuumlnde dann einstwei-len ein geringerer Bedarf an kooperativem Weltregieren Oder es muumlsste sich zeigen lassen dass sich bestimmte Voraussetzungen fuumlr die Teilnahme am kooperativen Welt-
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 205
sondern auch vor dem Hintergrund der These dass sich die empirische und konzeptio-nelle Diskussion von Global Governance zu lange einseitig auf die hoch industrialisierten Gesellschaften bezogen hat (vgl MessnerNuscheler 2006 66-68 Risse 2007 236-240) Aus den Augen verloren wurde dabei dass eine Reihe innenpolitischer Voraussetzungen fuumlr effektives und legitimes globales Regieren im Raum jenseits der OECD-Welt ten-denziell problematischer ist als im Kreis der entwickelten Industriestaaten Zu nennen sind vor allem die Virulenz der aus oumlkonomischen und politischen Transformations-prozessen entstehenden gesellschaftlichen Konflikte und die haumlufig zu beobachtende Schwaumlche der Zivilgesellschaft Es gilt also die Diskussion um Global Governance empirisch und konzeptionell zu differenzieren indem solche haumlufig als unproblematisch unterstellte jedoch in vielen Entwicklungslaumlndern keinesfalls selbstverstaumlndliche in-nenpolitische Bedingungsfaktoren des globalen Regierens genauer in den Blick genom-men werden Vor diesem Hintergrund koumlnnen Aussagen zu unterschiedlichen auszligenpo-litischen Strategietypen von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens entwickelt werden von denen dann auch normative Implikationen fuumlr globales Regieren abzuleiten sind Entsprechend dieser Zielsetzungen ist die Argumentation in vier Schrit-te gegliedert
In Kapitel 2 zeigen wir dass die anhand politischer Prozesse in der OECD-Welt entwickelte Global-Governance-Heuristik nicht einfach undifferenziert auf die zuneh-mende Partizipation von Entwicklungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens ange-wandt werden kann Eine Reihe von Indikatoren illustriert dass jene Laumlndergruppe im Durchschnitt zwar aumlhnlich von Entgrenzungsdynamiken betroffen ist wie die OECD-Welt Doch gleichzeitig unterscheiden sich die innergesellschaftlichen Strukturen dieser Staaten deutlich von denjenigen der OECD-Laumlnder Mithin lassen sich in der OECD-Welt erprobte Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates kaum mittels einer bloszligen bdquoMaszligstabserweiterungldquo auf die fuumlr Global Governance relevanten Entwicklungs-laumlnder uumlbertragen
Aufbauend auf dieser Problemanalyse entwickeln wir in Kapitel 3 ein um innen-politische Faktoren erweitertes Konzept des globalen Regierens Dieses beruumlcksichtigt im Hinblick auf die Bearbeitung von globalen Problemen nicht nur die Relevanz und grundsaumltzliche Befaumlhigung eines Staates fuumlr globales Regieren sondern auch unter-schiedliche Strategien und Interessen mit denen sich Entwicklungs- und Schwel- len laumlnder in Prozesse globalen Regierens einbringen Diese Strategien und Interes-sen sind maszliggeblich von innenpolitischen Faktoren gepraumlgt namentlich von a) der Staumlrke des aus politischem und wirtschaftlichem Wandel resultierenden Transfor-mationsdrucks und b) dem demokratischen oder autoritaumlren Charakter von Herrschafts-strukturen Dabei konzen trieren wir uns vor allem auf die Mitwirkung oumlffentlich ver-fasster Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen der Global Governance Denn ohne die teils beachtlichen Leistungen zivilgesellschaftlicher Akteu-re aus manchen Entwicklungs laumlndern zu ignorieren kommt in Entwicklungslaumlndern aufgrund der meist eher schwach ausgepraumlgten Leistungsfaumlhigkeit zivilgesellschaftli-
206 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
cher Strukturen1 den staatlichen Akteuren bei der Partizipation in Prozessen des globa-len Regierens noch eine prioritaumlre Rolle zu2
Kapitel 4 formuliert dann unter Ruumlckgriff auf eine der Forschung zu internationalen Regimen entlehnte Unterscheidung zwischen Interessen- Mittel- und Wertekonflikten Hypothesen zum Auftreten von vier Strategietypen bei der Beteiligung von Entwick-lungslaumlndern an Prozessen globalen Regierens Diese werden anhand ausgewaumlhlter Bei-spiele knapp illustriert Die Unterscheidung in kooperative kompetitive distributive und konfrontative Strategien in Prozessen globalen Regierens erlaubt es Global-Gover-nance-Prozesse in Beziehung zu innenpolitischen Faktoren zu setzen und damit einer differenzierten Mehrebenenperspektive auf globales Regieren gerecht zu werden Kapi-tel 5 diskutiert abschlieszligend die normativen Implikationen einer solch modifizierten Perspektive auf globales Regieren
Einschraumlnkend sei angemerkt dass es im Folgenden nicht darum gehen kann die facettenreichen Prozesse globalen Regierens unter Beteiligung von Entwicklungslaumln-dern aus empirisch-analytischer Perspektive umfassend abzuarbeiten Ziel des Beitrags ist es aus der Kritik an der bislang dominanten Heuristik von Global Governance eine differenziertere Forschungsperspektive abzuleiten die anschlussfaumlhig an empirisch-analytische wie an normative Diskussionen des globalen Regierens ist
1 Wir folgen einem liberalen auf Locke Montesquieu und Tocqueville zuruumlckgehenden Kon-zept von Zivilgesellschaft Zivilgesellschaft ist als eine Sphaumlre freier vom Staate unabhaumlngi-ger Organisation und Artikulation gesellschaftlicher Interessen anzusehen die von der staatli-chen der wirtschaftlichen und der privaten Sphaumlre unterschieden werden kann Ihr kommt die Aufgabe zu gesellschaftliche Interessen zu artikulieren und partiell auch zu buumlndeln und so zumindest mittelbar auch auf staatliche Politik Einfluss zu nehmen Im Kontext bdquopartizipati-verldquo Ansaumltze der Entwicklungszusammenarbeit und von Governance-Ansaumltzen wird der Zivil-gesellschaft daruumlber hinaus auch eine unterstuumltzende Rolle bei der Politikimplementation zugedacht Die von uns konstatierte bdquoSchwaumlcheldquo der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungs-laumlndern besteht darin dass vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl die Unabhaumlngigkeit vom (Heimat-)Staat als auch von internationalen Geldgebern fehlt dass sie haumlufig nicht uumlber eine Massenbasis und eine feste Verankerung in der Gesellschaft verfuumlgen und intern haumlufig stark klientelistisch strukturiert sind Im Hinblick auf das governance-orientierte Verstaumlndnis der Zivilgesellschaft kommt als sekundaumlres Merkmal hinzu dass viele zivilgesellschaftliche Akteure nicht uumlber ausreichende Ressourcen verfuumlgen um wirkungsvoll zur Artikulation und Buumlndelung gesellschaftlicher Interessen und zur Implementation demokratisch legitimierter Politikergebnisse beizutragen Teilweise ist auch der gewaltfreie Konfliktaustrag nicht akzep-tiert Siehe hierzu allgemein die Beitraumlge in Merkel (2000)
2 Der Hintergrund ist somit nicht die These dass von den drei von Dingwerth (2008a 607-608) genannten Auspraumlgungen von Global Governance (intergovernmental regimes transgovern-mental networks private transnational governance) allein die beiden zuerst genannten bedeut-sam seien Allerdings rechnen wir angesichts der Schwaumlche der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungsgesellschaften damit dass die Auszligenvertretung von Interessen gouvernemental kanalisiert wird und deshalb einstweilen die Mitwirkung von staatlichen und gesellschaftli-chen Akteuren aus dem bdquoSuumldenldquo im Rahmen von intergovernmental regimes und transgovern-mental networks am bedeutsamsten fuumlr die Beteiligung von Entwicklungs- und Schwellen-laumlndern am globalen Regieren sein duumlrfte Auch die regierungsunabhaumlngige Beteiligung internationaler NGOs am globalen Regieren ist uumlberwiegend von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo dominiert (TussieRiggirozzi 2001 Dingwerth 2008a)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 207
2 Global Governance der bdquoNordenldquo und der bdquoSuumldenldquo
Global Governance praumlsentiert sich als ein vielgestaltiges Konzept das sowohl als po-litische Programmvokabel fuumlr eine bdquoWeltinnen-ldquo oder bdquoWeltordnungspolitikldquo wie auch als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Verwendung findet (BrandBrunnengrauml-ber 2000 MessnerNuscheler 2006 DingwerthPattberg 2006) Die Wurzeln von Global Governance als politischer Programmvokabel liegen vornehmlich in der Beschaumlftigung mit den Nord-Suumld-Beziehungen und den Weltkonferenzen der 1990er Jahre Dabei wird explizit auf entwicklungsrelevante Themen wie Armut und Umweltzerstoumlrung rekurriert und Global Governance als alternatives politisches Ordnungsmodell zur Loumlsung draumln-gender globaler Probleme empfohlen
Demgegenuumlber stellt die theoretisch-konzeptionelle Verwendung des Begriffs in der Politikwissenschaft auf Veraumlnderungen der politischen Steuerung bzw Steuerungsfaumlhig-keit ab Global Governance wird als kooperatives Regieren jenseits des Nationalstaates konzeptualisiert das durch einen horizontalen Politikstil die breite Beteiligung zivil-gesellschaftlicher Akteure und freiwillig eingegangene Verhandlungsloumlsungen zur Be-waumlltigung geteilter Probleme gekennzeichnet ist Die Verdichtung supranationaler Or-ganisationsformen die zunehmende Bedeutung transnationaler zivilgesellschaftlicher Allianzen und das Regieren in Mehrebenensystemen sind dabei die wichtigsten real-weltlichen Hintergruumlnde (Deutscher Bundestag 2002) Ihre normativen Impulse bezieht diese Auffassung von Global Governance aus der Diagnose einer schwindenden Steue-rungsfaumlhigkeit nationalstaatlicher Systeme sowie aus der Suche nach alternativen For-men effektiven und legitimen Regierens bdquojenseits des Nationalstaatesldquo (Zuumlrn 1998a) Aus dieser Perspektive sind die UN-Weltkonferenzen vor allem aufgrund der massiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interessant weniger hinsichtlich ihrer subs-tanziellen Aussagen zur Entwicklungsproblematik (vgl auch Messner 2001)
Allerdings ist diese analytische Variante der Diskussion von Global Governance von einer auch in der deutschen Politikwissenschaft zumindest in der Vergangenheit zu be-obachtenden bdquoWestverschiebung der Internationalen Beziehungenldquo gekennzeichnet (Noumllke 2003 524) Dass die wichtigsten empirischen Bezugspunkte der Global-Gover-nance-Diskussion lange Zeit innerhalb der OECD-Welt lagen hatte mit der verbreiteten Sichtweise zu tun dass Global Governance eine kollektive Anstrengung zur politischen Bewaumll tigung von maszliggeblich in der OECD-Welt auftretenden Phaumlnomenen der Denatio-na lisierung sei (Zuumlrn 1998b) Als Folge dieser Argumentation lag nahe anzunehmen dass innerhalb der OECD-Welt und insbesondere innerhalb der EU ein bdquoLaboratoriumldquo von Global Governance entstanden sei (JoslashrgensenRosamond 2001) das aufgrund sei-ner Vorreiterrolle Lehren fuumlr das Regieren jenseits der OECD-Welt bereithalten koumlnne
Auch wenn die Engfuumlhrung auf die OECD-Welt forschungspragmatisch legitim ist so koumlnnte sie in konzeptioneller und empirischer Hinsicht nur dann uumlberzeugen wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen gegeben waumlre Entweder muumlsste sich zeigen lassen dass die Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder von Prozessen der po-litischen oumlkonomischen und gesellschaftlichen Denationalisierung substanziell weniger betroffen sind als die OECD-Welt Fuumlr diesen Teil des Planeten bestuumlnde dann einstwei-len ein geringerer Bedarf an kooperativem Weltregieren Oder es muumlsste sich zeigen lassen dass sich bestimmte Voraussetzungen fuumlr die Teilnahme am kooperativen Welt-
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
206 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
cher Strukturen1 den staatlichen Akteuren bei der Partizipation in Prozessen des globa-len Regierens noch eine prioritaumlre Rolle zu2
Kapitel 4 formuliert dann unter Ruumlckgriff auf eine der Forschung zu internationalen Regimen entlehnte Unterscheidung zwischen Interessen- Mittel- und Wertekonflikten Hypothesen zum Auftreten von vier Strategietypen bei der Beteiligung von Entwick-lungslaumlndern an Prozessen globalen Regierens Diese werden anhand ausgewaumlhlter Bei-spiele knapp illustriert Die Unterscheidung in kooperative kompetitive distributive und konfrontative Strategien in Prozessen globalen Regierens erlaubt es Global-Gover-nance-Prozesse in Beziehung zu innenpolitischen Faktoren zu setzen und damit einer differenzierten Mehrebenenperspektive auf globales Regieren gerecht zu werden Kapi-tel 5 diskutiert abschlieszligend die normativen Implikationen einer solch modifizierten Perspektive auf globales Regieren
Einschraumlnkend sei angemerkt dass es im Folgenden nicht darum gehen kann die facettenreichen Prozesse globalen Regierens unter Beteiligung von Entwicklungslaumln-dern aus empirisch-analytischer Perspektive umfassend abzuarbeiten Ziel des Beitrags ist es aus der Kritik an der bislang dominanten Heuristik von Global Governance eine differenziertere Forschungsperspektive abzuleiten die anschlussfaumlhig an empirisch-analytische wie an normative Diskussionen des globalen Regierens ist
1 Wir folgen einem liberalen auf Locke Montesquieu und Tocqueville zuruumlckgehenden Kon-zept von Zivilgesellschaft Zivilgesellschaft ist als eine Sphaumlre freier vom Staate unabhaumlngi-ger Organisation und Artikulation gesellschaftlicher Interessen anzusehen die von der staatli-chen der wirtschaftlichen und der privaten Sphaumlre unterschieden werden kann Ihr kommt die Aufgabe zu gesellschaftliche Interessen zu artikulieren und partiell auch zu buumlndeln und so zumindest mittelbar auch auf staatliche Politik Einfluss zu nehmen Im Kontext bdquopartizipati-verldquo Ansaumltze der Entwicklungszusammenarbeit und von Governance-Ansaumltzen wird der Zivil-gesellschaft daruumlber hinaus auch eine unterstuumltzende Rolle bei der Politikimplementation zugedacht Die von uns konstatierte bdquoSchwaumlcheldquo der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungs-laumlndern besteht darin dass vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl die Unabhaumlngigkeit vom (Heimat-)Staat als auch von internationalen Geldgebern fehlt dass sie haumlufig nicht uumlber eine Massenbasis und eine feste Verankerung in der Gesellschaft verfuumlgen und intern haumlufig stark klientelistisch strukturiert sind Im Hinblick auf das governance-orientierte Verstaumlndnis der Zivilgesellschaft kommt als sekundaumlres Merkmal hinzu dass viele zivilgesellschaftliche Akteure nicht uumlber ausreichende Ressourcen verfuumlgen um wirkungsvoll zur Artikulation und Buumlndelung gesellschaftlicher Interessen und zur Implementation demokratisch legitimierter Politikergebnisse beizutragen Teilweise ist auch der gewaltfreie Konfliktaustrag nicht akzep-tiert Siehe hierzu allgemein die Beitraumlge in Merkel (2000)
2 Der Hintergrund ist somit nicht die These dass von den drei von Dingwerth (2008a 607-608) genannten Auspraumlgungen von Global Governance (intergovernmental regimes transgovern-mental networks private transnational governance) allein die beiden zuerst genannten bedeut-sam seien Allerdings rechnen wir angesichts der Schwaumlche der Zivilgesellschaft in vielen Entwicklungsgesellschaften damit dass die Auszligenvertretung von Interessen gouvernemental kanalisiert wird und deshalb einstweilen die Mitwirkung von staatlichen und gesellschaftli-chen Akteuren aus dem bdquoSuumldenldquo im Rahmen von intergovernmental regimes und transgovern-mental networks am bedeutsamsten fuumlr die Beteiligung von Entwicklungs- und Schwellen-laumlndern am globalen Regieren sein duumlrfte Auch die regierungsunabhaumlngige Beteiligung internationaler NGOs am globalen Regieren ist uumlberwiegend von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo dominiert (TussieRiggirozzi 2001 Dingwerth 2008a)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 207
2 Global Governance der bdquoNordenldquo und der bdquoSuumldenldquo
Global Governance praumlsentiert sich als ein vielgestaltiges Konzept das sowohl als po-litische Programmvokabel fuumlr eine bdquoWeltinnen-ldquo oder bdquoWeltordnungspolitikldquo wie auch als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Verwendung findet (BrandBrunnengrauml-ber 2000 MessnerNuscheler 2006 DingwerthPattberg 2006) Die Wurzeln von Global Governance als politischer Programmvokabel liegen vornehmlich in der Beschaumlftigung mit den Nord-Suumld-Beziehungen und den Weltkonferenzen der 1990er Jahre Dabei wird explizit auf entwicklungsrelevante Themen wie Armut und Umweltzerstoumlrung rekurriert und Global Governance als alternatives politisches Ordnungsmodell zur Loumlsung draumln-gender globaler Probleme empfohlen
Demgegenuumlber stellt die theoretisch-konzeptionelle Verwendung des Begriffs in der Politikwissenschaft auf Veraumlnderungen der politischen Steuerung bzw Steuerungsfaumlhig-keit ab Global Governance wird als kooperatives Regieren jenseits des Nationalstaates konzeptualisiert das durch einen horizontalen Politikstil die breite Beteiligung zivil-gesellschaftlicher Akteure und freiwillig eingegangene Verhandlungsloumlsungen zur Be-waumlltigung geteilter Probleme gekennzeichnet ist Die Verdichtung supranationaler Or-ganisationsformen die zunehmende Bedeutung transnationaler zivilgesellschaftlicher Allianzen und das Regieren in Mehrebenensystemen sind dabei die wichtigsten real-weltlichen Hintergruumlnde (Deutscher Bundestag 2002) Ihre normativen Impulse bezieht diese Auffassung von Global Governance aus der Diagnose einer schwindenden Steue-rungsfaumlhigkeit nationalstaatlicher Systeme sowie aus der Suche nach alternativen For-men effektiven und legitimen Regierens bdquojenseits des Nationalstaatesldquo (Zuumlrn 1998a) Aus dieser Perspektive sind die UN-Weltkonferenzen vor allem aufgrund der massiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interessant weniger hinsichtlich ihrer subs-tanziellen Aussagen zur Entwicklungsproblematik (vgl auch Messner 2001)
Allerdings ist diese analytische Variante der Diskussion von Global Governance von einer auch in der deutschen Politikwissenschaft zumindest in der Vergangenheit zu be-obachtenden bdquoWestverschiebung der Internationalen Beziehungenldquo gekennzeichnet (Noumllke 2003 524) Dass die wichtigsten empirischen Bezugspunkte der Global-Gover-nance-Diskussion lange Zeit innerhalb der OECD-Welt lagen hatte mit der verbreiteten Sichtweise zu tun dass Global Governance eine kollektive Anstrengung zur politischen Bewaumll tigung von maszliggeblich in der OECD-Welt auftretenden Phaumlnomenen der Denatio-na lisierung sei (Zuumlrn 1998b) Als Folge dieser Argumentation lag nahe anzunehmen dass innerhalb der OECD-Welt und insbesondere innerhalb der EU ein bdquoLaboratoriumldquo von Global Governance entstanden sei (JoslashrgensenRosamond 2001) das aufgrund sei-ner Vorreiterrolle Lehren fuumlr das Regieren jenseits der OECD-Welt bereithalten koumlnne
Auch wenn die Engfuumlhrung auf die OECD-Welt forschungspragmatisch legitim ist so koumlnnte sie in konzeptioneller und empirischer Hinsicht nur dann uumlberzeugen wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen gegeben waumlre Entweder muumlsste sich zeigen lassen dass die Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder von Prozessen der po-litischen oumlkonomischen und gesellschaftlichen Denationalisierung substanziell weniger betroffen sind als die OECD-Welt Fuumlr diesen Teil des Planeten bestuumlnde dann einstwei-len ein geringerer Bedarf an kooperativem Weltregieren Oder es muumlsste sich zeigen lassen dass sich bestimmte Voraussetzungen fuumlr die Teilnahme am kooperativen Welt-
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 207
2 Global Governance der bdquoNordenldquo und der bdquoSuumldenldquo
Global Governance praumlsentiert sich als ein vielgestaltiges Konzept das sowohl als po-litische Programmvokabel fuumlr eine bdquoWeltinnen-ldquo oder bdquoWeltordnungspolitikldquo wie auch als politikwissenschaftliches Analyseinstrument Verwendung findet (BrandBrunnengrauml-ber 2000 MessnerNuscheler 2006 DingwerthPattberg 2006) Die Wurzeln von Global Governance als politischer Programmvokabel liegen vornehmlich in der Beschaumlftigung mit den Nord-Suumld-Beziehungen und den Weltkonferenzen der 1990er Jahre Dabei wird explizit auf entwicklungsrelevante Themen wie Armut und Umweltzerstoumlrung rekurriert und Global Governance als alternatives politisches Ordnungsmodell zur Loumlsung draumln-gender globaler Probleme empfohlen
Demgegenuumlber stellt die theoretisch-konzeptionelle Verwendung des Begriffs in der Politikwissenschaft auf Veraumlnderungen der politischen Steuerung bzw Steuerungsfaumlhig-keit ab Global Governance wird als kooperatives Regieren jenseits des Nationalstaates konzeptualisiert das durch einen horizontalen Politikstil die breite Beteiligung zivil-gesellschaftlicher Akteure und freiwillig eingegangene Verhandlungsloumlsungen zur Be-waumlltigung geteilter Probleme gekennzeichnet ist Die Verdichtung supranationaler Or-ganisationsformen die zunehmende Bedeutung transnationaler zivilgesellschaftlicher Allianzen und das Regieren in Mehrebenensystemen sind dabei die wichtigsten real-weltlichen Hintergruumlnde (Deutscher Bundestag 2002) Ihre normativen Impulse bezieht diese Auffassung von Global Governance aus der Diagnose einer schwindenden Steue-rungsfaumlhigkeit nationalstaatlicher Systeme sowie aus der Suche nach alternativen For-men effektiven und legitimen Regierens bdquojenseits des Nationalstaatesldquo (Zuumlrn 1998a) Aus dieser Perspektive sind die UN-Weltkonferenzen vor allem aufgrund der massiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interessant weniger hinsichtlich ihrer subs-tanziellen Aussagen zur Entwicklungsproblematik (vgl auch Messner 2001)
Allerdings ist diese analytische Variante der Diskussion von Global Governance von einer auch in der deutschen Politikwissenschaft zumindest in der Vergangenheit zu be-obachtenden bdquoWestverschiebung der Internationalen Beziehungenldquo gekennzeichnet (Noumllke 2003 524) Dass die wichtigsten empirischen Bezugspunkte der Global-Gover-nance-Diskussion lange Zeit innerhalb der OECD-Welt lagen hatte mit der verbreiteten Sichtweise zu tun dass Global Governance eine kollektive Anstrengung zur politischen Bewaumll tigung von maszliggeblich in der OECD-Welt auftretenden Phaumlnomenen der Denatio-na lisierung sei (Zuumlrn 1998b) Als Folge dieser Argumentation lag nahe anzunehmen dass innerhalb der OECD-Welt und insbesondere innerhalb der EU ein bdquoLaboratoriumldquo von Global Governance entstanden sei (JoslashrgensenRosamond 2001) das aufgrund sei-ner Vorreiterrolle Lehren fuumlr das Regieren jenseits der OECD-Welt bereithalten koumlnne
Auch wenn die Engfuumlhrung auf die OECD-Welt forschungspragmatisch legitim ist so koumlnnte sie in konzeptioneller und empirischer Hinsicht nur dann uumlberzeugen wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen gegeben waumlre Entweder muumlsste sich zeigen lassen dass die Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder von Prozessen der po-litischen oumlkonomischen und gesellschaftlichen Denationalisierung substanziell weniger betroffen sind als die OECD-Welt Fuumlr diesen Teil des Planeten bestuumlnde dann einstwei-len ein geringerer Bedarf an kooperativem Weltregieren Oder es muumlsste sich zeigen lassen dass sich bestimmte Voraussetzungen fuumlr die Teilnahme am kooperativen Welt-
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
208 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
regieren (wie eine stabile Staatlichkeit eine leistungsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine kooperative Handlungsorientierung) ndash sofern sie nicht bereits bestehen ndash im Zuge von soziooumlkonomischer Modernisierung bzw durch die Sozialisation der in globales Regie-ren eingebundenen Eliten quasi selbstgaumlngig ergeben In beiden Szenarien lieszligen sich Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder nahtlos in Global Governance integrieren sobald sie durch eine der OECD-Welt nahekommende Entgrenzungsdynamik undoder nach-holende Modernisierungsprozesse charakterisiert waumlren
Tabelle 1 Entgrenzungsprozesse und Strukturmerkmale in groszligen Entwicklungs- und OECD-Laumlndern
Strukturmerkmal Index Skala Niveau200506
Standard-abweichung
Veraumlnderung in Prozent
1980ndash200506
N
Entgrenzunga) Globalisierung
b) Handelsoffenheit
ETH Zuumlrich KOF-Globalisie-rungsindexFraser Institute Trade Openness Index
1ndash100
1ndash10
OECD 7952EL 5504
OECD 751EL 603
7621074
048089
3185
1131
823
823
Entwicklungsniveau UNDP Human Development Index
0ndash1 OECD 095EL 067
001 014
919
824
Demokratieniveau Freedom House Political RightsCivil Liberties
1ndash7 OECD 690EL 42
017168
523
826
Politische Stabilitaumlt World Bank Governance Indicators Political Stability
minus25ndash25 OECD 047EL ndash099
040074
erst ab 1996verfuumlgbar
826
Anmerkungen Basierend auf der Annahme dass lediglich Staaten ab einer gewissen Groumlszlige auf Pro-zesse globalen Regierens gestaltend Einfluss nehmen wurden nur Laumlnder ab einem Schwellenwert von 30 Millionen Einwohnern beruumlcksichtigt Auch bei einer Modifikation des Schwellenwertes (20 bzw 40 Millionen Einwohner) bleiben die aus der Tabelle ersichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Entwicklungslaumlndern erhalten Aufgrund fehlender Werte fuumlr die 1980er Jahre wurden Transformationsstaaten aus Suumldost- und Osteuropa sowie der ehemaligen UdSSR nicht beruumlck-sichtigt Zudem schwankt aufgrund teilweise fehlender Werte die Anzahl der in die Berechnung einbe-zogenen Entwicklungslaumlnder zwischen 23 und 26 Afghanistan und der Irak wurden nicht beruumlcksichtigt da diese Laumlnder 20052006 nicht durch ein Mindestmaszlig an Staatlichkeit gekennzeichnet waren Die Beruumlcksichtigung beider Staaten haumltte die in der Tabelle veranschaulichten Unterschiede zwischen der OECD-Welt und den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo noch weiter verstaumlrktOECD-Staaten Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Spanien Vereinigtes Koumlnigreich USAEntwicklungslaumlnder Aumlgypten Aumlthiopien Algerien Argentinien Bangladesch Brasilien China Demo-kratische Republik Kongo Indien Indonesien Iran Kenia Kolumbien Marokko Mexiko Myanmar Nigeria Pakistan Philippinen Suumldafrika Suumldkorea Sudan Tansania Thailand Tuumlrkei Vietnam Die 1994 bzw 1996 der OECD beigetretenen Staaten Mexiko und Suumldkorea wurden nicht in der OECD-Grup-pe aufgefuumlhrt da sie zu Beginn der Untersuchungsperiode nicht Mitglieder dieser Organisation waren) Die Freedom-House-Werte auf einer Skala 1ndash7 wurden transformiert houmlhere Werte bedeuten ein houmlheres Demokratieniveau
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 209
Anhand von Tabelle 1 laumlsst sich allerdings zeigen dass beide Annahmen problematisch sind Mit Blick auf Prozesse der Entgrenzung zeigen der mehrdimensionale KOF-Glo-balisierungsindex der ETH Zuumlrich und der Index fuumlr Handelsoffenheit der Fraser Stif-tung ein aumlhnliches Bild3 Waumlhrend das durchschnittliche Niveau der Entgrenzung in der OECD-Welt nach wie vor houmlher ist als in der betrachteten Gruppe der Entwicklungs-laumlnder war die Prozessdynamik im Zeitraum von 1980 bis 2005 in der Nicht-OECD-Welt deutlich staumlrker ausgepraumlgt Entgrenzungsprozesse haben also vor allem jenseits der OECD rapide zugenommen und mit ihnen die Sensitivitaumlt gegenuumlber den Ergebnis-sen globalen Regierens Beim Blick auf einen zentralen Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung (Human Development Index des UNDP) zeigt sich ein aumlhnliches Bild Niveauunterschiede bei gleichzeitig groumlszligerer Prozessdynamik in den Entwicklungslaumln-dern Die Werte stuumltzen die Annahme dass in Entwicklungslaumlndern politische Prozesse tendenziell staumlrker um die erstmalige Sicherung materieller Grundbeduumlrfnisse und poli-tischer Rechte weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen duumlrften und diese Gesellschaften zugleich angesichts der Geschwindigkeit der oumlkonomischen Transformation mit spezi-fischen Konflikten konfrontiert sind (Hegre et al 2003 RavallionChaudhuri 2007) Demgegenuumlber sind politische Prozesse in der OECD-Welt eher auf die Pflege kollek-tiver Guumlter bzw auf ordnungspolitische Reformen gerichtet (Zuumlrn 1998b 91)
Der Governance-Indikator der Weltbank zu politischer Stabilitaumlt und Gewalt verweist in diesem Zusammenhang darauf dass Entgrenzungsprozesse in der OECD-Welt unter vergleichsweise stabilen politischen Rahmenbedingungen und im Kontext weitgehend funktionierender Staatlichkeit stattfinden Demgegenuumlber mangelt es den Laumlndern des bdquoSuumldensldquo haumlufig an einer konsolidierten staatlichen Ordnung welche die Verhandlungs-teilnehmer in die Lage versetzen wuumlrde getroffene Vereinbarungen bdquonach innenldquo wir-kungsvoll umzusetzen zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und das er-zielte Politikergebnis zu legitimieren Damit entfaumlllt jedoch ein zentraler Baustein fuumlr die als Kennzeichen von Global Governance geltende Mehrebenenstruktur (vgl Deut-scher Bundestag 2002 419-421) Daruumlber hinaus existieren in den Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo immer noch manifeste Niveauunterschiede gegenuumlber der OECD-Welt mit Blick auf politische Freiheiten und Buumlrgerrechte4 Der Freedom-House-Index liefert einen Hinweis darauf dass es vielfach an strukturellen Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Organisation mangelt Ohne politische Freiheiten und buumlrgerliche Rechte verbleibt die Interessenaggregation und -artikulation unter der Kontrolle des Staates Zivilgesell-schaftliche Akteure koumlnnen dann kaum gesellschaftliche Interessen in das globale Re-
3 Der KOF-Globalisierungsindex der ETH Zuumlrich misst die bdquoEntgrenzungldquo eines Landes in drei Dimensionen (wirtschaftlich politisch kulturell) wobei wiederum jede Dimension eine Ag-gregatvariable darstellt (vgl Dreher 2006) Der Index zur Handelsoffenheit setzt sich aus Messgroumlszligen uumlber Handelsstroumlme eines Landes (im Verhaumlltnis zu seiner Groumlszlige) sowie aus Angaben uumlber tarifaumlre und nicht-tarifaumlre Handelsbeschraumlnkungen zusammen (Gwartney Lawson 2007)
4 Die vergleichende Transformationsforschung verweist dabei auf das Phaumlnomen dass viele Demokratisierungsprozesse in Afrika Asien und Lateinamerika stagnieren und sich unter-schiedliche Varianten defekter Demokratien und hybrider Systeme etabliert haben (MerkelCroissant 2000)
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
210 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
gieren einspeisen oder einen Legitimationsbeitrag zu dessen Ergebnissen leisten (vgl auch oben Fuszlignote 1)
Der Vergleich von OECD- und Entwicklungslaumlndern zeigt somit einerseits dass in den vergangenen Dekaden auch jenseits der OECD-Welt dynamische Entgrenzungspro-zesse stattgefunden haben welche die zunehmenden Versuche von Laumlndern des bdquoSuuml-densldquo erklaumlren die politischen Rahmenbedingungen von Globalisierung mitzugestalten Vor dem Hintergrund steigender globaler Interdependenzen kann aus der Perspektive der OECD-Welt langfristig auch kein Interesse bestehen auf eine Einbeziehung maszlig-geblicher Entwicklungslaumlnder zu verzichten (Stamm 2005) Andererseits verdeutlicht der Vergleich dass in vielen Gesellschaften des bdquoSuumldensldquo entscheidende strukturelle Vor-aussetzungen fuumlr ein kooperatives Mehrebenenregieren fehlen insbesondere eine demo-kratisch verfasste und artikulationsfaumlhige Zivilgesellschaft und eine liberaldemokratisch eingehegte funktionierende Staatlichkeit Hinzu kommt dass aufgrund der Zentralitaumlt von Verteilungsfragen in Entwicklungsgesellschaften dieser Aspekt auch im globalen Regieren zunehmend staumlrker diskutiert werden und zugleich auch die Umstrittenheit der normativen Grundlagen des Regierens zunehmen duumlrfte
Auch wenn sich aus modernisierungstheoretischer Perspektive argumentieren laumlsst dass sich solche Hemmfaktoren im Zuge einer bdquonachholendenldquo Entwicklung zumindest auf laumlngere Sicht aufloumlsen werden so mahnen die vielfaumlltigen Kontingenzen und Ruumlck-schlaumlge realweltlicher Entwicklungsprozesse (hierzu im Uumlberblick Betz 2003 Senghaas 2003) zumindest mittelfristig zu groszliger Vorsicht hinsichtlich der einfachen Uumlbertragung von Entwicklungserfahrungen der OECD-Welt Zumindest fuumlr eine bestimmte Uumlber-gangszeit5 stellt sich die Frage wie die Global-Governance-Perspektive die zweifels-ohne vorhandenen und in einigen Teilbereichen erfolgreichen Mitgestaltungsprozesse von Akteuren des bdquoSuumldensldquo integrieren kann
Doch ist eine solche Integration uumlberhaupt denkbar ohne zugleich die Grundpraumlmis-sen der Global-Governance-Diskussion zu dementieren Beispielsweise lieszlige sich argu-mentieren dass sich die Nord-Suumld-Beziehungen aufgrund der Schwaumlche der Zivilgesell-schaft in vielen Entwicklungslaumlndern nach wie vor als vornehmlich zwischenstaatliche Interaktion und somit als bdquointernationaleldquo Politik begreifen lassen Doch wuumlrde ein sol-cher Schritt nicht nur zu einer unangemessenen empirischen und geografischen Be-schraumlnkung der Global-Governance-Diskussion fuumlhren sondern auch die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo im globalen Regieren verkennen (Dingwerth 2008a) Es bliebe auch die Frage offen mit welcher anderen Heuristik die Beziehungen zwischen OECD-Welt und den Staaten und Gesellschaften Asiens Lateinamerikas und Afrikas dann beschrieben werden sollen In jedem Fall
5 Im Hinblick hierauf laumlsst sich allerdings bezweifeln dass die OECD-Welt stabil bei koopera-tiven Handlungsorientierungen verbleiben und sich in einem aumlhnlichen Maszlig wie heute in entsprechende Verhandlungsloumlsungen einbinden lassen wird So sehen Zuumlrn et al (2007 insb 149-156) einen Prozess zunehmender bdquoPolitisierungldquo globalen Regierens in der OECD-Welt und daruumlber hinaus den sie als unintendierte Nebenfolge der Trans- und Supranationalisierung des Regierens interpretieren In eine aumlhnliche Richtung gehen die Uumlberlegungen von Florini (2005 72-78) welche die Triebkraumlfte der genannten Entwicklung allerdings in zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohlfahrtstaatlichkeit im demografischen Wandel und im Wegfall niedrig qualifizierter Beschaumlftigung sieht
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 211
scheidet die antiquierte Heuristik des bdquoNord-Suumld-Konfliktsldquo oder der bdquoNord-Suumld-Bezie-hungenldquo aus Ein Blick auf die Standardabweichungen der Indikatoren in Tabelle 1 verdeutlicht die ausgepraumlgte Heterogenitaumlt soziooumlkonomischer Entwicklungsprozesse politischer Herrschaftsmerkmale und Interessenkonfigurationen in den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern6 und somit die Notwendigkeit einer staumlrker differenzierenden Analyse
Es erscheint uns aussichtsreich das Konzept Global Governance selbst zu modifizie-ren um die Mitwirkung staatlicher und gesellschaftlicher Akteure aus der sich entwi-ckelnden Welt angemessener zu beruumlcksichtigen und so dem Konzept tatsaumlchlich glo-balen Charakter zu verleihen Hierbei geht es zum einen um die Sichtbarmachung bestimmter empirisch problematischer Praumlmissen des Global-Governance-Konzeptes und zum anderen um eine systematische Beruumlcksichtigung innerstaatlicher Bedingungs-faktoren auszligenpolitischen Verhaltens Folgt man der liberalen Schule der vergleichen-den Auszligenpolitikforschung (MuumlllerRisse-Kappen 1990 Evangelista 1995 Moravcsik 1997) so duumlrften prekaumlre zivilgesellschaftliche Strukturen tief greifende politische Transformationsprozesse und politische Instabilitaumlt bzw die Erosion von Staatlichkeit einen manifesten Einfluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Aus solchen in-nenpolitischen Faktoren entwickeln sich dann kompetitive distributive oder auch kon-frontative Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren Diese Strategien werden in der Folge auch zu unterschiedlichen Formen des globalen Regierens fuumlhren Erst mit einer solchen Zweiebenenanalyse kann das variierende Ko-operations- und Konfliktpotenzial in Prozessen globalen Regierens zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo erfasst und zugleich auch die Heterogenitaumlt der Laumlnder des bdquoSuumldensldquo sichtbar gemacht werden Ein erster notwendiger Schritt ist somit die Auffaumlcherung der genann-ten innerstaatlichen Bedingungsfaktoren und damit zugleich auch die Differenzierung der Begrifflichkeit des Nord-Suumld-Konfliktes
3 Ein liberaler Ansatz des globalen Regierens
In der Diskussion um eine bdquoneue Macht der Entwicklungslaumlnderldquo (DeckerMildner 2005) wird haumlufig implizit von realistischen Praumlmissen ausgegangen Eine gaumlngige Pro-gnose lautet dass sich die Bevoumllkerungsgroumlszlige der Ressourcenreichtum und die rasant steigende Wirtschaftskraft von Staaten wie Indien China Russland und Brasilien in absehbarer Zeit auch in einen entsprechenden Einfluss auf internationaler Ebene uumlber-setzen werden Die merkantilistisch und geopolitisch angeleitete gegenuumlber Demokratie und Menschenrechten weitgehend blinde Afrikapolitik der chinesischen Staatsfuumlhrung (EisenmanKurlantzick 2006 KappelSchneidenbach 2006) die Ambitionen Brasiliens und Indiens auf einen staumlndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat oder die Rolle Brasiliens beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun 2003 (NarlikarTussie 2004) wer-den aus dieser Perspektive als Vorboten einer Entwicklung gesehen die bdquoder Globali-sierung bald ein nichtwestliches Gesichtldquo verleihen wird (DeckerMildner 2005 17) Am prononciertesten wird diese Annahme im Kontext der Debatte um die bdquoBRICsldquo
6 Vgl hierzu neben Boeckh (2004) auch Brock (1993) Tetzlaff (1996) Menzel (1999)
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
212 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
vertreten In ihr geht es um die Frage inwieweit eine begrenzte Anzahl von Entwick-lungs- und Schwellenlaumlndern ndash genannt werden neben den BRIC-Staaten (Brasilien Russland Indien und China) haumlufig auch Suumldafrika Indonesien und Mexiko ndash an Ein-fluss auf globaler Ebene gewinnen und wie sich die Auszligenpolitiken von OECD-Staaten gegenuumlber diesen Laumlndern aufstellen sollten7
Ein solcher Zugriff begreift vor allem die Ressourcen eines Landes als die Waumlhrung mit der Macht in den internationalen Beziehungen erworben wird Allerdings haben bereits die Interdependenztheoretiker der 1970er Jahre (KeohaneNye 1977) darauf hin-gewiesen dass nicht die Verfuumlgungsgewalt uumlber Ressourcen (control over resources) sondern der Einfluss auf die Ergebnisse des internationalen Regierens (control over outcomes) entscheidend ist Hierbei zaumlhlen nicht allein militaumlrische Macht Bevoumllke-rungsgroumlszlige oder oumlkonomisches Potenzial sondern auch bdquosoft powerldquo bzw bdquoco-optive powerldquo (Nye 1990 2004) und die Art und Weise wie diese in Verhandlungsprozesse eingebracht werden Ob die aufstrebenden Entwicklungslaumlnder auf absehbare Zeit selbst eine solche bdquoco-optive powerldquo entwickeln koumlnnen muss hier offen bleiben Entschei-dender scheint uns die Frage zu sein auf welche Weise Faktoren wie administrative Leistungsfaumlhigkeit oumlkonomische und soziale Transformationsprozesse im bdquoInnerenldquo von Staaten sowie nicht zuletzt die Struktur des politischen Systems Einfluss auf Ver-handlungspositionen und internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben (Putnam 1988 Moravcsik 1997 Zangl 1999) In der Ausblendung dieser Frage liegt ein Schwachpunkt nicht nur der Diskussion zu Global Governance sondern auch der zuvor erwaumlhnten Debatte zur Rolle der BRICs im internationalen Regieren Zwar werden Faktoren wie interne soziooumlkonomische Transformation und die damit einhergehenden Konflikte in der BRIC-Debatte bisweilen erwaumlhnt (z B Keefer 2007 RavallionChaudhuri 2007) jedoch werden sie nicht systematisch auf das Auszligenverhalten dieser Staaten zuruumlckbe-zogen
Zur Behebung dieses Defizits ist ein systematisch um innenpolitische Faktoren er-weiterter bdquoliberalerldquo Ansatz des globalen Regierens notwendig Im Folgenden greifen wir zwei innergesellschaftliche Faktorenbuumlndel heraus von denen plausiblerweise an-zunehmen ist dass sie von zentraler Bedeutung fuumlr die Erklaumlrung auszligenpolitischen Ver-haltens sind und zugleich in Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern gehaumluft in einer fuumlr kooperatives globales Regieren problematischen Weise auftreten erstens die Staumlrke des binnenpolitischen Transformationsdrucks und zweitens der Grad liberaldemokratischer Herrschaft
Wir diskutieren zunaumlchst weshalb wir einen Einfluss dieser beiden Faktorenbuumlndel auf die Governance-Strategien von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern auf globaler Ebene erwarten Dabei konzentrieren wir uns auf groumlszligere administrativ relativ leis-tungsfaumlhige und staatlich hinreichend gefestigte Vertreter dieser Kategorie Im Hinter-grund steht zum einen das interdependenztheoretische Argument dass nur solche Staa-ten signifikanten Einfluss auf internationale Verhandlungsprozesse ausuumlben welche zur Kontrolle ihres eigenen Schicksals (bzw ihrer bdquoInterdependenz-Verwundbarkeitldquo) eini-
7 Prononcierte Stellungnahmen in dieser urspruumlnglich von WilsonPurushothaman (2003) ange-stoszligenen Debatte sind Cooper et al (2006) Hurrell (2006) WintersYusuf (2007) FaustMessner (2008)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 213
germaszligen in der Lage sind Zum anderen unterliegen solche Laumlnder aufgrund ihres groumlszligeren Binnenmarktes und ihrer leistungsfaumlhigeren staatlichen Strukturen zwar immer noch deutlich aber eben nicht nahezu vollstaumlndig internationalen Einfluumlssen so wie es etwa in bdquoRaumlumen begrenzter Staatlichkeitldquo (Risse 2007) und in vielen kleineren Ent-wicklungslaumlndern der Fall ist Insofern besteht gerade hier ein starkes Interesse an den innenpolitischen Bedingungsfaktoren auszligenpolitischen Handelns
Ad 1) Binnenpolitischer Transformationsdruck
Indikatoren gesamtwirtschaftlicher Entwicklung wie der in Kapitel 2 diskutierte Human Development Index legen nahe dass in Schwellen- und Entwicklungslaumlndern politische Prozesse immer noch wesentlich staumlrker als in der OECD-Welt um die erstmalige Si-cherung von Grundbeduumlrfnissen weiter Bevoumllkerungsschichten kreisen Neben die Be-waumlltigung der damit einhergehenden soziooumlkonomischen Transformation tritt in vielen Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern noch das Problem der Transition zur Demokratie hinzu Gelten beispielsweise die BRICs als besonders chancenreiche Schwellen- und Entwicklungslaumlnder was eine aktive Beteiligung an Prozessen globalen Regierens be-trifft so handelt es sich doch entweder um autoritaumlre Regime wie China und Russland oder aber es sind Demokratien die sich noch im politischen Transformationsprozess befinden (Brasilien Suumldafrika) bzw deren Demokratien noch erhebliche Defizite auf-weisen wie Indien mit Blick auf die Qualitaumlt des dortigen Rechtsstaates
Transformationsprozesse wie Demokratisierung oder der Uumlbergang zu marktwirt-schaftlichen Wettbewerbsordnungen sind institutionelle Wandlungsprozesse die Ge-winner und Verlierer hervorbringen Mit der Parallelitaumlt von politischer und oumlkonomi-scher Transformation sowie zunehmender Transformationstiefe steigt tendenziell das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten Akteuren an Zwar sind auch in OECD-Laumlndern Reformen mit Reformverlierern und -gewinnern verbunden Doch die Trans-formationsprozesse in den meisten Laumlndern des bdquoSuumldensldquo sind substanzieller bei gleich-zeitig meist staumlrkerem sozialen Konfliktpotenzial und houmlheren politischen Risiken (HaggardKaufmann 1995 Hegre et al 2003) So erhoumlhen Demokratisierungsprozesse tendenziell die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Kriegen und der Entstehung von Finanzkrisen (MansfieldSnyder 1995 GleditschWard 2000 Faust 2004) Diese Zusammenhaumlnge lassen sich auf Transformationskonflikte zwischen einer bdquoerweiterten Waumlhlerschaftldquo aus ehemals politisch marginalisierten Gruppen und den gut organisierten Profiteuren der Autokratie in jungen Demokratien zuruumlckfuumlhren (vgl Bueno de Mesquita et al 1999 803 AcemogluRobinson 2006) Aumlhnliche Beobach-tungen wurden mit Blick auf die Auswirkungen auszligenwirtschaftlicher Liberalisierung gemacht So existieren Hinweise darauf dass mit einem houmlheren Niveau an Auszligen-handels offenheit zwar die Wahrscheinlichkeit interner Gewaltkonflikte abnimmt In ver-gleichsweise armen und groszligen Laumlndern mit lediglich maumlszligigem Demokratieniveau je-doch erhoumlht Handelsliberalisierung zumindest kurzfristig die Wahrscheinlichkeit ge- waltsamer Konflikte (vgl z B De Soysa 2002 Bussmann et al 2003 Hegre et al 2003 BussmannSchneider 2007) Insgesamt also beguumlnstigt eine zunehmende Transformati-onstiefe bei vergleichsweise hoher sozialer Polarisierung innergesellschaftliche Vertei-
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
214 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
lungskonflikte die auch Auswirkungen auf die Verhandlungspositionen von Entwick-lungslaumlndern in Prozessen globalen Regierens haben duumlrften
Ad 2) Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft
Dass das Niveau liberaldemokratischer Herrschaft erhebliche Auswirkungen auf das Auszligenverhalten von Staaten hat ist inzwischen allgemein anerkannt Dies legen nicht nur die Diskussionen zum demokratischen Frieden und der demokratiezentrierten Kon-fliktforschung nahe (Bueno de Mesquita et al 1999 GeisWagner 2006) Empirische Untersuchungen zeigen auch dass Demokratien kooperativer in ihren Auszligenwirtschafts-beziehungen sind so etwa im Hinblick auf Handelskooperation Technologietransfer oder Entwicklungspolitik (Mansfield et al 2002 MilnerKubota 2005 Faust 2008) In Autokratien die auf repressiveren und exklusiveren Herrschaftskoalitionen basieren ist hingegen die Bereitschaft zur internationalen Kooperation und zur Preisgabe nationaler Souveraumlnitaumlt geringer und entsprechende Routinen sind weniger stark eingeuumlbt als in der OECD-Welt Dies kann zum einen mit der Autokratien eigenen latenten politischen Instabilitaumlt (Merkel 1999 93) zu tun haben die deren Spielraum fuumlr auszligenpolitische Kompromisse einschraumlnkt Zum anderen werden autokratische Regierungen mit einem unkontrollierten und umfassenden Herrschaftsanspruch bdquonach innenldquo auch weniger be-reit sein diesen Herrschaftsanspruch durch die Umsetzung internationaler Vereinbarun-gen bdquovon auszligenldquo beschneiden zu lassen Zugleich wird in autokratischen Systemen die ohnehin haumlufig schwache Funktion der Zivilgesellschaft in Prozessen globalen Regie-rens weiter gehemmt Gesellschaftliche Selbstorganisation und die daraus folgende In-teressenartikulation und Interesseneinspeisung in globales Regieren entfallen wo auto-ritaumlr-korporatistische Regime oder Militaumlrdiktaturen die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Kraumlfte hemmen oder ganz unterdruumlcken
Die bis hierhin angestellten Uumlberlegungen fuumlhren zu der Hypothese dass sich durch die wachsende Teilhabe von Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern Veraumlnderungen in Prozessen globalen Regierens ergeben werden Tief greifende politische und oumlkonomi-sche Transformationsprozesse und der Charakter des politischen Systems insbesondere der Modus der innenpolitischen Interessenvermittlung duumlrften einen manifesten Ein-fluss auf das Auszligenverhalten von Staaten haben Insbesondere erwarten wir dass im Rahmen des globalen Regierens a) die Bereitschaft der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern zum Souveraumlnitaumltsverzicht geringer ausgepraumlgt ist b) innenpoli-tische Konflikte den Verhandlungsspielraum dieser Laumlnder auf globaler Ebene einengen c) globale Verregelungen zunehmend staumlrker auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und d) das haumlufige Fehlen leistungsfaumlhiger Zivilgesellschaften nicht nur die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in Prozesse globalen Regierens erschwert sondern auch zur Verkomplizierung der Mehrebenenarchitektur des globalen Regierens fuumlhrt Je staumlrker sich die gesellschaftlichen und oumlffentlichen Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern an Prozessen globalen Regierens beteiligen umso mehr duumlrfte dies in der Summe zu einer Differenzierung der Global-Governance-Architektur fuumlhren da gleich zwei ihrer Grundpfeiler infrage gestellt werden Zum einen ist dies die breite Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure mit den entsprechenden Implikationen fuumlr die Effektivitaumlt und Legitimitaumlt globalen Regierens zum anderen die kooperative Hand-
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 215
lungsorientierung der Beteiligten Dabei kann es sich im Rahmen dieses Aufsatzes al-lerdings lediglich um Tendenzaussagen auf einer sehr hohen Abstraktionsebene handeln Fuumlr die konkrete Prognose von Handlungsstrategien der Akteure aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern ist es notwendig zu einer Differenzierung solcher Aussagen auf der Grundlage je unterschiedlicher Kombinationen von Transformationsdruck und Herr-schaftsstruktur zu gelangen Ein Einstieg in eine solche Systematisierung findet sich im folgenden Kapitel
4 Vier Strategien von Global Governance
Im Folgenden werden wir vier Strategien von Global Governance identifizieren welche sich aus dem Zusammenspiel von binnenpolitischem Transformationsdruck und dem Ausmaszlig liberaldemokratischer Herrschaft aufseiten der Verhandlungspartner ergeben In der Beschreibung der Charakteristika dieser vier Formen orientieren wir uns an den Angeboten der (deutschen) Forschung zu internationalen Regimen Insbesondere der problemstrukturelle Ansatz also die Unterscheidung zwischen Werte- Mittel- und Inte-ressenkonflikten (Letztere nochmals unterschieden in Interessenkonflikte uumlber absolut und uumlber relativ bewertete Guumlter) die sich in unterschiedlichem Maszlige fuumlr eine koope-rative Problembearbeitung eignen (Efinger et al 1988 Zuumlrn et al 1990 RittbergerZuumlrn 1991) ist hierbei von Belang
Im Einklang mit den genannten Autoren ist davon auszugehen dass sich innerhalb einer auf bestimmte Sachprobleme bezogenen Interaktion kooperative bzw kompetitive Grundorientierungen der handelnden Akteure ergeben koumlnnen Dabei sind die zuvor diskutierten innergesellschaftlichen Faktoren von zentraler Bedeutung dafuumlr ob ein be-stimmter Konflikt seitens der handelnden Akteure eher als Werte- Mittel- oder Interes-senkonflikt eingeschaumltzt wird und dementsprechend eher kooperative oder unkooperative Akteurstrategien uumlberwiegen Im Hintergrund steht das Argument dass die bdquoobjektiveldquo Zuordnung bestimmter Sachmaterien zu einem bestimmten Problemtypus problematisch ist8 vor allem weil konkrete Problemfelder fast immer eine Mischung unterschiedlicher Konfliktgegenstaumlnde beinhalten und insofern Raum fuumlr unterschiedliche ndash durchaus strategisch gebrauchte ndash Deutungen eroumlffnen Beispielsweise wird das Problemfeld des globalen Handels oder des Klimaschutzes in den meisten OECD-Staaten vorrangig als ein Interessenkonflikt uumlber absolut bewertete Guumlter verstanden ndash im Falle einer Eini-gung uumlber weitgehende Liberalisierung oder strikten Klimaschutz koumlnnten am Schluss alle Verhandlungspartner profitieren Zugleich gibt es deutliche Anzeichen dafuumlr dass diese Verhandlungsmaterien seitens vieler Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder als Inte-ressenkonflikte uumlber relativ bewertete Guumlter verstanden werden ndash etwa hinsichtlich der aus anspruchsvollen Verregelungen im Handels- oder Umweltbereich resultierenden Verteilung von Strukturanpassungskosten zwischen entwickelter und sich entwickelnder Welt So hat sich die Doha-Runde im Rahmen der WTO vor allem deshalb festgefahren
8 Zur Diskussion des bdquoobjektivenldquo oder bdquosubjektivenldquo Charakters der Konflikttypologien bereits Zuumlrn et al (1990 158-159) Vertiefend hierzu Underdal (1995 115-116) Hasenclever et al (1997a 66-67)
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
216 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
weil seitens der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder argumentiert wird dass der Nutzen aus einer weiteren Handelsliberalisierung etwa im Bereich geistiger Eigentumsrechte ungleich verteilt ist Zu beobachten ist auch dass seitens einzelner Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder Werte- und Statusfragen akzentuiert werden welche internationale Verregelungsversuche weiter erschweren9
Unsere Kernhypothese lautet dass es weniger der generelle Handlungszusammen-hang oder die bdquoKonfliktformationldquo (Senghaas 1988) zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist welche uumlber solche Konfliktdeutungen und damit verknuumlpfte Strategien entscheidet vielmehr sind dies der binnenpolitische soziooumlkonomische Transformationsdruck sowie die Merkmale politischer Herrschaft (vgl hierzu auch Zuumlrn 1993) Diese sind von zen-traler Bedeutung dafuumlr ob ein bestimmter Konflikt eher als Werte- Mittel- oder Inter-essenkonflikt verstanden wird und dementsprechend zu eher kooperativen kompetiti-ven distributiven oder konfrontativen Akteurstrategien fuumlhrt Beim Vorliegen autoritaumlrer Herrschaftsstrukturen ist aumlhnlich wie in den Ost-West-Beziehungen vor 1990 mit dem Vorhandensein bdquokompetitiver Grundorientierungenldquo (RittbergerZuumlrn 1991 415) zu rechnen Dies bedeutet dass die Verhandlungspartner zu bdquopositionellenldquo Handlungsori-entierungen im Sinne Griecos (1988) neigen also die Frage der relativen Kosten-Nut-zen-Verteilung im Vergleich zu Verhandlungspartnern houmlher gewichten als den absolu-ten Nutzen fuumlr die Gemeinschaft der Verhandlungsparteien Der Grund ist dass die Wahrscheinlichkeit von unverregelt ausgetragenen Konflikten in den Beziehungen zwi-schen demokratischen und autokratischen Laumlndern houmlher ist und somit auch die Wahr-scheinlichkeit dass im Kalkuumll der Verhandlungspartner der relative Nutzen einer Ver-handlungsloumlsung in den Vordergrund tritt Demgegenuumlber sind in den Beziehungen zwischen liberal strukturierten Staaten kooperative und am absoluten Nutzen orientierte Verhandlungsloumlsungen staumlrker innenpolitisch abgestuumltzt und decken sich mit innerhalb der liberalen Staatengemeinschaft institutionalisierten Normen (Buzan 1993 Hasen-clever et al 1997b 17-24) In Gesellschaften im soziooumlkonomischen Transformations-
9 Hierfuumlr laumlsst sich beispielsweise die Diskussion um die sogenannten bdquoSingapore Issuesldquo (In-vestitionsregulierung Wettbewerbsrecht und oumlffentliches Beschaffungswesen) im Kontext der laufenden Doha-Runde in der WTO anfuumlhren Von den Gegnern einer Aufnahme dieser The-men in den Verhandlungsrahmen der WTO wurde argumentiert dass es sich hier um einen bdquoVersuch [handele] die Rechte auslaumlndischer Unternehmen auf Marktzugang in Entwick-lungslaumlndern fuumlr ihre Produkte und Investitionen zu maximieren waumlhrend die Rechte der gastgebenden Regierung die Taumltigkeit auslaumlndischer Firmen zu regulieren auf ein Minimum reduziert werden sollenldquo Die Aufnahme dieser Themen wuumlrde die betroffenen bdquoRegierungen davon abhalten oder hindern [] noumltige politische Maszlignahmen fuumlr Entwicklung und andere Ziele wie nationale Integration (sbquonation-buildinglsquo) und Ausgleich zwischen ethnischen Ge-meinschaften zu ergreifenldquo (Khor 2003 1) Eine aumlhnliche Argumentation war bereits bei der kontroversen Einbeziehung von Fragen des geistigen Eigentums in das WTO-Regelwerk zu beobachten in der ebenfalls eine Kontroverse um die Vereinbarkeit von Handelsliberalisie-rung und Entwicklung entbrannt war (Narlikar 2006 63-65) Nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen in Cancun stellte der brasilianische Auszligenminister Amorim als einen Erfolg des Gipfels heraus dass es trotz des Ausbleibens konkreter Ergebnisse gelungen sei bdquoden Respektldquo der Staatengemeinschaft fuumlr die Koalition der Entwicklungslaumlnder (G 2022) sicher-zustellen (bdquoWorld trade talks collapseldquo BBC News Service 1592003 vgl auch NarlikarTussie 2004)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 217
prozess tritt ein aumlhnliches Problem auf Es ist damit zu rechnen dass eine mit hohem Transformationsdruck konfrontierte Regierung Verregelungen staumlrker auf ihre Vertei-lungswirkungen hin befragt (und ggf populistisch ausschlachtet) als eine Regierung aus einem Land in dem dieses Problem weniger virulent ist In solchen Konstellationen duumlrfte es dann zu einer Akzentuierung von Verteilungsfragen und zur Betonung von entwicklungsbezogenen Wertekonflikten kommen Auch hieran koumlnnen ansonsten bei-derseitig vorteilhafte Verregelungen scheitern
Vor dem Hintergrund dieser Uumlberlegungen lassen sich aus der Varianz binnenpoliti-schen Transformationsdrucks und unterschiedlicher Herrschaftsstrukturen vier denkbare Strategie-Typen der Regierungen aus Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern im globalen Regieren ableiten (Tabelle 2) Dabei gehen wir davon aus dass sich eine autokratische Herrschaftsordnung vor allem hinsichtlich der Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten und einer auf bestimmte Sachfragen begrenzten Kooperationsbereit-schaft aumluszligern wird wohingegen ein hoher binnenpolitischer Transformationsdruck sich tendenziell staumlrker in der Thematisierung von Verteilungsfragen der Akzentuierung ent-wicklungsbezogener Wertekonflikte und einer insgesamt fragileren jedoch nicht sach-bereichsspezifisch differenzierten Kooperationsbereitschaft aumluszligern duumlrfte
Tabelle 2 Vier Strategien von Global GovernanceHerrschaftsordnung
Eher liberal Eher autokratisch
Tran
sfor
ma t
ions
druc
k
Niedrig bull Unproblematische Kooperationsbereitschaft
bull Fehlen von positionellen OrientierungenVorherrschen einer absoluten Bewertung von Interessenkonflikten
bull Geringe Bedeutung von Wertekonflikten
(kooperative Governance-Strategie)
bull Selektive Kooperations- bereitschaft
bull Fehlen von positionellen Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von souveraumlnitaumltsbezogenen Wertekonflikten
(kompetitive Governance-Strategie)Hoch bull Fragile Kooperations-
bereitschaftbull Positionelle Orientierungen
Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Tendenz zur Betonung von entwicklungsbezogenen Werte - konflikten
(distributive Governance-Strategie)
bull Selektive und fragile Kooperationsbereitschaft
bull Positionelle Orientierungen Vorherrschen einer relativen Bewertung von Interessenkonflikten
bull Hohe Wahrscheinlichkeit der Betonung verschiedener Formen von Wertekonflikten
(konfrontative Governance-Strategie)
Lediglich der nordwestliche Quadrant der Tabelle 2 entspricht dem in der akademischen und politischen Diskussion zu Global Governance vertretenen Bild von kooperativem globalen Regieren In Teilbereichen der internationalen Beziehungen und fuumlr einige we-nige Entwicklungslaumlnder ist eine solche kooperative Governance-Strategie zumindest punktuell tatsaumlchlich auch zu beobachten In der Tendenz verfuumlgen allerdings nur sehr wenige Entwicklungslaumlnder uumlber gefestigte liberaldemokratische Strukturen und sind zudem lediglich gering ausgepraumlgten soziooumlkonomischen Transformationsprozessen
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
218 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
ausgesetzt Ist dies der Fall fuumlgen sich solche Staaten meist auf kooperative Art und Weise in globale Verregelungen ein gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Maszlig-nahmen des capacity building Allerdings laumlsst sich beobachten dass es sich bei solchen Staaten vor allem um kleine bis mittelgroszlige Laumlnder handelt die sich (wie etwa Chile) nur noch bedingt zur Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenlaumlnder rechnen lassen
Wo Staaten der sich entwickelnden Welt zwar einen hohen binnenpolitischen Trans-formationsdruck gewaumlrtigen aber intern vergleichsweise liberal strukturiert sind wird es eher zu einer Wahrnehmung bzw Inszenierung von Interessenkonflikten als Streit uumlber relativ bewertete Guumlter kommen Konkret dreht es sich hier darum dass bestehen-de oder angestrebte Verregelungen auf ihre Verteilungswirkungen hin befragt werden und Wertekonflikte etwa in der pointierten Form bdquoFreihandel versus Entwicklungldquo akzentuiert werden Die Kooperationsbereitschaft bleibt dann insgesamt relativ fragil (distributive Governance-Strategie) Regierungen die auch noch steigenden Erwartun-gen eines Groszligteils der Bevoumllkerung mit Blick auf die Grundbeduumlrfnissicherung ausge-setzt sind werden in ihrem auszligenpolitischen Handlungsspielraum zusaumltzlich begrenzt Der durch ordnungspolitischen Wandel hervorgerufene Transformationsdruck politi-sche Instabilitaumlt und die innenpolitisch herausragende Bedeutung von Grundbeduumlrfnis-sicherung fuumlhren zu einer Akzentuierung von Statusfragen sowie von Werten wie Ent-wicklung und nationaler souveraumlner Kontrolle dieser Entwicklung in Prozessen globalen Regierens10 Hierfuumlr laumlsst sich beispielhaft die oben angesprochene Diskussion um die sogenannten Singapore Issues oder die Behandlung von Sonderregeln fuumlr Entwicklungs-laumlnder und von Agrarfragen in den WTO-Verhandlungen anfuumlhren (Hoekman et al 2004 NarlikarTussie 2004) Aumlhnliche Beobachtungen lassen sich fuumlr den Bereich des Klimaschutzes anstellen wo sich sowohl China als auch Indien mit entwicklungs- und souveraumlnitaumltsbezogenen Argumenten klar gegen anspruchsvolle Loumlsungen aussprechen (Scholz 2008)
Staumlrker autokratisch strukturierte Staaten mit politisch unterdruumlckten Verteilungskon-flikten wie etwa Russland und China stellen demgegenuumlber staumlrker die Frage einer politisch gleichberechtigten Teilhabe am globalen Regieren in den Vordergrund Hierbei kann die Kooperationsbereitschaft auf einer Reihe von Feldern vergleichsweise un-problematisch sein so z B bei Chinas bisheriger Mitwirkung in der WTO (Gu et al 2007 282-285) oder bei der Bekaumlmpfung der aktuellen globalen Finanzkrise Auf an-deren Feldern hingegen werden Macht- und Statusfragen betont und erschweren die Kooperation etwa hinsichtlich Russlands Energie- Ruumlstungs- und Nachbarschaftspoli-tik oder Chinas Auszligenpolitik gegenuumlber suumldostasiatischen und afrikanischen Entwick-lungslaumlndern (KappelSchneidenbach 2006 MacFarlane 2006 Gu et al 2008 285-287) welche beide stark von oumlkonomischen und geostrategischen Interessen angeleitet sind Wir sprechen dann von einer kompetitiven Governance-Strategie (nordoumlstlicher Quad-rant) in der lediglich selektive Kooperationsbereitschaft besteht sowie souveraumlnitaumltsbe-zogene Wertekonflikte existieren Die beiden zuletzt aufgefuumlhrten Beispiele beinhalten
10 Moumlglicherweise spielen hierbei auch historisch gewachsene Erfahrungen geringer Einfluss-moumlglichkeiten auf die Strukturanpassungspolitiken von IWF und Weltbank und eine daraus resultierende bdquoverstaumlndliche Skepsis gegenuumlber Global Governance-Strukturenldquo (Messner Nuscheler 2006 67) eine Rolle
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 219
allerdings zumindest latent auch distributive Konflikte In beiden Faumlllen kommt dem Zugang zu Rohstoffen zwecks der Alimentierung der eigenen wirtschaftlichen Dynamik eine wichtige Rolle zu In dem Maszlige in dem dann zu Wertekonflikten bzw Statusfra-gen auch Verteilungsfragen hinzutreten sind eher konfrontative Governance-Strategien (suumldoumlstlicher Quadrant) zu erwarten Eine kooperative Verregelung ist hierbei im Allge-meinen nur aumluszligerst schwierig zu erreichen und wird haumlufig von beiden Seiten auch nicht gewuumlnscht sein
5 Normative Folgeprobleme
Die oben getroffenen Aussagen zu wahrscheinlichen Strategien des globalen Regierens wurden aus theoretischen Uumlberlegungen abgeleitet und anhand einer Reihe empirischer Beispiele illustriert Inwieweit diese Strategien die Interaktionen und Verlaufsmuster von Global Governance insgesamt beeinflussen werden ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen da hierbei vor allem auch die Reaktionsmuster der OECD-Welt auf diese Strategien bedeutsam sind Optimistische auf die Moumlglichkeit einer schrittweisen Ein-bindung der neuen Mitspieler zielende Szenarien (Senghaas 2003 Messner 2006) sind ebenso vertreten wie duumlstere Prognosen einer bevorstehenden bdquoRuumlckkehr des Groszlig-machtnationalismusldquo (Kagan 2008 15) Allerdings wird auch das optimistische Szenario die Global-Governance-Architektur nicht unberuumlhrt lassen Insbesondere lassen sich be-reits heute einige normative Herausforderungen identifizieren die sich aus den geschil-derten Strategien des globalen Regierens ergeben koumlnnen und die uumlber die bekannten Legitimitaumltsprobleme von Global Governance (Zuumlrn 2000 Risse 2006) hinausgehen Drei dieser Herausforderungen sollen abschlieszligend kurz skizziert werden
Erstens bedarf es aus einer Top-down-Perspektive zur innergesellschaftlichen Umset-zung von globalen Vereinbarungen eines Mindestmaszliges an staatlich-administrativen und zivilgesellschaftlichen Kapazitaumlten Die hierfuumlr notwendige Existenz leistungsfaumlhiger staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Strukturen ist jedoch in einer Vielzahl von Laumln-dern jenseits der OECD-Welt allenfalls in Ansaumltzen gegeben
Zweitens sind auch aus einer Bottom-up-Perspektive effektive und legitime Prozesse globalen Regierens von der Faumlhigkeit der Verhandlungsteilnehmer abhaumlngig innenpoli-tisch zwischen konfligierenden Interessen zu moderieren und somit Legitimationsbeitrauml-ge fuumlr das Verhandlungsergebnis zu erbringen Autokratische Strukturen und die in vie-len Entwicklungslaumlndern begrenzte Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft untergraben die Legitimitaumlt von Global Governance weil die von staatlichen Akteuren vertretenen Praumlferenzen noch mehr als in Demokratien unter dem Vorbehalt einer fragwuumlrdigen innenpolitischen Abstuumltzung stehen
Drittens kann auch bei existierenden demokratischen Strukturen und staatlicher Handlungsfaumlhigkeit ein Effektivitaumlts- bzw Legitimitaumltsproblem globalen Regierens ent-stehen Laumlngst nicht alle Entwicklungslaumlnder sind undemokratisch und muumlssen ohne Vermittlungskapazitaumlten zivilgesellschaftlicher Akteure auskommen Doch die Praumlferen-zen dieser Akteure sind aufgrund von oumlkonomischem Transformationsdruck und der Prioritaumlt der Grundbeduumlrfnisorientierung oft nicht kongruent mit den aus der Perspekti-ve der OECD-Welt funktional erscheinenden Loumlsungsansaumltzen Insofern kann gerade
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
220 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Faumlhigkeit in Laumlndern wie etwa Indien oder Brasilien dazu fuumlhren dass demokratisch legitime Prozesse auf nationaler Ebene distributive oder kompetitive Prozesse globalen Regierens erzeugen die einer effektiven Problemloumlsung auf globaler Ebene zunaumlchst abtraumlglich sind11
6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Diskussion zu Global Governance ist eine der Wachstumsindustrien in der akade-mischen Disziplin der Internationalen Beziehungen Dabei hat die Vermischung pro-grammatischer und analytischer Verwendungen des Konzepts nicht nur zu einer undeut-lichen begrifflich-konzeptionellen Konturierung gefuumlhrt (DingwerthPattberg 2006) sondern auch zu einer empirischen Engfuumlhrung Vorrangig dienten die entwickelten Regionen des Globus als empirische und normative Bezugspunkte der Diskussion Vor diesem Hintergrund versuchte der vorliegende Beitrag moumlgliche Varianten tatsaumlchlich bdquoglobalenldquo Regierens zu diskutieren indem Strategien von vornehmlich staatlich orga-nisierten Akteuren aus Entwicklungslaumlndern im globalen Regieren und moumlgliche Impli-kationen fuumlr die Legitimitaumlt globalen Regierens in den Blick genommen wurden In der Diskussion dieser Fragen ist der vorliegende Aufsatz notwendig auf einer weitgehend abstrakten Ebene verblieben Vorrangig scheint uns zu sein die Ebene der innerstaatli-chen Praumlferenzformation mehr ins Blickfeld zu nehmen d h die innergesellschaftliche Heterogenitaumlt in entsprechend differenzierten Mehrebenenanalysen des globalen Regie-rens zu beruumlcksichtigen Ansatzpunkte sind die Fragen nach dem Charakter von Herr-schaft der Leistungsfaumlhigkeit der Zivilgesellschaft und nach dem Vorhandensein von politischen und oumlkonomischen Transformationskonflikten die in der Diskussion um Global Governance haumlufig nicht weiter beruumlcksichtigt werden (siehe jedoch Senghaas 2003 145-146)
In diesem Zusammenhang haben wir auch versucht die Anschlussfaumlhigkeit an die Forschung zu oumlkonomischen und politischen Transitionsprozessen in den Entwicklungs-regionen mit der Forschung zu internationalen Regimen und ihre Fortfuumlhrung in der Global-Governance-Diskussion zu verdeutlichen Die notwendige Belebung des Dia-logs zwischen der Entwicklungslaumlnderforschung und den Internationalen Beziehungen kann insbesondere auch die normative Diskussion zum Regieren jenseits des National-staates befruchten Herausforderungen bestehen wo Entwicklungslaumlnder aufgrund kon-fliktgeladener soziooumlkonomischer Transformationsprozesse und (in sich demokratisie-renden Staaten) mit Billigung ihrer Zivilgesellschaft eine Verregelung auf globaler Ebene torpedieren weil die Konsequenzen einer solchen Regulierung das innenpoliti-sche Konfliktpotenzial weiter erhoumlhen wuumlrden Vordergruumlndig verringert sich in solchen Situationen die Faumlhigkeit in globalen Verhandlungssystemen gemeinsame Probleme effektiv zu bearbeiten Beim zweiten Blick wird deutlich dass die zunehmende Mitspra-che von sich entwickelnden Laumlndern im globalen Regieren eine Neuverstaumlndigung uumlber die Aufloumlsung von Zielkonflikten notwendig macht ndash beispielsweise uumlber den zwischen
11 Vor allem Beitraumlge aus dem Bereich der Verhandlungsanalyse haben aufgezeigt wie schwer es sein kann zu global geteilten Fairnesskriterien zu gelangen (vgl Albin 2001)
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 221
Freihandel und Entwicklung im Kontext der nach wie vor blockierten Welthandelsrun-de Problematisch sind hier allerdings die sich in vielen Laumlndern jenseits der OECD-Welt erst entwickelnden zivilgesellschaftlichen Strukturen und die mangelhafte innen-politische Kontrolle der Regierenden Das globale Regieren zwischen bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo ist vor allem dann mit schweren Legitimitaumltsmaumlngeln behaftet wenn den staatlichen Verhandlungsfuumlhrern aus den sich entwickelnden Staaten eine demokratische Abstuumlt-zung fehlt Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die empirisch-konzeptionelle Erweite-rung der Global-Governance-Diskussion um Akteure aus den Entwicklungs- und Schwellenlaumlndern eine vordringliche Aufgabe sondern auch die Diskussion der norma-tiven Herausforderungen von Global Governance unter Beteiligung von sich entwi-ckelnden Laumlndern12
Literatur
Acemoglu Daron und James Robinson 2006 Economic Origins of Democracy and Dictatorship Cambridge Cambridge University Press
Albin Cecilia 2001 Justice and Fairness in International Negotiation Cambridge Cambridge University Press
Betz Joachim 2003 (Deutsche) Beitraumlge zur Entwicklungstheorie seit dem Ende des Ost-West-Konflikts In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 275-311
Boeckh Andreas 2004 Was ist von der Dritten Welt uumlbrig geblieben In Volker Rittberger Andreas Boeckh und Christoph Bertram (Hrsg) Weltpolitik heute Grundlagen und Perspek-tiven Baden-Baden Nomos 145-163
Brand Ulrich und Achim Brunnengraumlber 2000 Global Governance Alternative zur neoliberalen Globalisierung Muumlnster Westfaumllisches Dampfboot
Brock Lothar 1993 Aufloumlsung oder Ausbreitung Die Dritte Welt in ihrem fuumlnften Jahrzehnt In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Ordnung zwischen Gewaltproduktion und Friedensstiftung Baden-Baden Nomos 49-70
Bueno de Mesquita Bruce James D Morrow Randolph Siverson und Alastair Smith 1999 An Institutional Explanation of the Democratic Peace American Political Science Review 93 791-807
Bussmann Margit Harald Scheuthle und Gerald Schneider 2003 Die bdquoFriedensdividendeldquo der Globalisierung Auszligenwirtschaftliche Oumlffnung und innenpolitische Stabilitaumlt in den Entwick-lungslaumlndern Politische Vierteljahresschrift 44 302-324
Bussmann Margit und Gerald Schneider 2007 When Globalization Discontent Turns Violent Foreign Economic Liberalization and Internal War International Studies Quarterly 51 79-97
12 Unklar ist ob die im vorliegenden Beitrag ausgeklammerten oumlffentlich-privaten Netzwerke bzw uumlberwiegend von privaten Akteuren getragenen Verregelungen hier einen Ausweg bieten koumlnnen So zeigt sich selbst in Initiativen wie dem Forest Stewardship Council die explizit eine gleichberechtigte Teilhabe von Akteuren aus dem bdquoNordenldquo und dem bdquoSuumldenldquo anstreben dass Interessen des bdquoSuumldensldquo organisatorisch schwaumlcher und disparater vertreten sind und im Hinblick auf die Interpretation zentraler Prinzipien dieses privaten Regimes wie oumlkologische Nachhaltigkeit nach wie vor eine bdquodiskursive Dominanzldquo der Akteure aus der OECD-Welt festzustellen ist (Dingwerth 2008a 2008b)
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
222 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Buzan Barry 1993 From International System to International Society Structural Realism and Regime Theory Meet the English School International Organization 47 327-352
Cooper Andrew F Agata Antkiewicz und Timothy M Shaw 2006 Economic Size Trumps All Else Lessons from BRICSAM CIGI Working Paper 122006 Waterloo
De Soysa Indra 2002 Paradise is a Bazar Greed Creed Grievance and Governance 1989ndash99 Journal of Peace Research 39 395-416
Decker Claudia und Stormy Mildner 2005 Die neue Macht der Entwicklungslaumlnder Globale Ambitionen ndash regionale Verantwortung Internationale Politik 60 17-25
Deutscher Bundestag 2002 Globalisierung der Weltwirtschaft Schluszligbericht der Enquete-Kom-mission Opladen Leske + Budrich
Dingwerth Klaus und Philipp Pattberg 2006 Was ist Global Governance Leviathan 34 377-399Dingwerth Klaus 2008a Private Transnational Governance and the Developing World A Com-
parative Perspective International Studies Quarterly 52 607-634Dingwerth Klaus 2008b North-South Parity in Global Governance The Affirmative Procedures
of the Forest Stewardship Council Global Governance 14 53-71Dreher Axel 2006 Does Globalization Affect Growth Evidence from a New Index of Globali-
zation Applied Economics 38 1091-1110Efinger Manfred Volker Rittberger und Michael Zuumlrn 1988 Internationale Regime in den Ost-
West-Beziehungen ein Beitrag zur Erforschung der friedlichen Behandlung internationaler Konflikte Frankfurt a M Haag + Herchen
Eisenman Joshua und Joshua Kurlantzick 2006 Chinarsquos Africa Strategy Current History 105 219-224
Evangelista Matthew 1995 The Paradox of State Strength Transnational Relations Domestic Structures and Security Policy in Russia and the Soviet Union International Organization 49 1-38
Faust Joumlrg und Dirk Messner 2008 Arm aber einflussreich bdquoAnkerlaumlnderldquo als auszligenpolitische Herausforderung Aus Politik und Zeitgeschichte 432008 28-34
Faust Joumlrg 2004 Finanzkrisen in jungen Demokratien Zeitschrift fuumlr Politikwissenschaft 14 853-879
Faust Joumlrg 2008 Are More Democratic Donor Countries More Development Oriented World Development 36 383-398
Florini Ann M 2005 The Coming Democracy New Rules for Running a New World Washing-ton Brookings Institution
Geis Anna und Wolfgang Wagner 2006 Vom demokratischen Frieden zur demokratiezentrierten Friedens- und Konfliktforschung Politische Vierteljahresschrift 47 276-289
Gleditsch Kristian S und Michael D Ward 2000 War and Peace in Space and Time The Role of Democratization International Studies Quarterly 44 1-30
Grieco Joseph M 1988 Anarchy and the Limits of Cooperation A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism International Organization 42 485-507
Gu Jing John Humphrey und Dirk Messner 2007 Global Governance and Developing Coun-tries The Implications of the Rise of China World Development 36 274-292
Gwartney James D und Robert A Lawson 2007 Economic Freedom of the World 2007 Annual Report Vancouver The Fraser Institute
Haggard Stephan und Robert Kaufmann 1995 The Political Economy of Democratic Transi-tions Princeton Princeton University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997a Theories of International Re-gimes CambridgeLondon Cambridge University Press
Hasenclever Andreas Peter Mayer und Volker Rittberger 1997b Regimes as Links Between States Three Theoretical Perspectives Tuumlbingen Universitaumlt Tuumlbingen
Hegre Havard Nils Petter Gleditsch und Ranveig Gissinger 2003 Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Unrest In Gerald Schneider Katherine Barbieri und Nils
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 223
Petter Gleditsch (Hrsg) Globalization and Conflict Welfare Distribution and Political Un-rest Lanham u a Rowman amp Littlefield
Hoekman Bernard Constantine Michalopoulos und L Alan Winters 2004 Special and Differen-tial Treatment of Developing Countries in the WTO Moving Forward After Cancuacuten World Economy 27 481-506
Hurrell Andrew 2006 Hegemony Liberalism and Global Order What Space for Would-be Great Powers International Affairs 82 1-19
Joslashrgensen Knud E und Ben Rosamond 2001 Europe Regional Laboratory for a Global Polity CSGR Working Paper No 7101 Warwick Centre for the Study of Globalization and Regionalization
Kagan Robert 2008 Die Demokratie und ihre Feinde Wer gestaltet die neue Weltordnung Muumlnchen Siedler
Kappel Robert und Tina Schneidenbach 2006 China in Afrika Herausforderungen fuumlr den Westen GIGA Focus 122006 Hamburg German Institute of Global and Area Studies
Keefer Philip 2007 Governance and Economic Growth In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 211-242
Keohane Robert O und Joseph S Nye 1977 Power and Interdependence World Politics in Transition Boston Little Brown amp Co
Khor Martin 2003 bdquoSingapore Issuesldquo der Welthandelsorganisation WTO ndash neue drohende Ge-fahren fuumlr Entwicklungslaumlnder und Nachhaltigkeit httpwwwattacdecancuntexteissueskurzversion_si_khorpdf 12082007
MacFarlane S Neil 2006 The ldquoRrdquo in BRICs Is Russia an Emerging Power International Affairs 82 41-57
Mansfield Edward D Helen V Milner und B Peter Rosendorff 2002 Why Democracies Coop-erate More Electoral Control and International Trade Agreements International Organiza-tion 56 477-513
Mansfield Edward D und Jack Snyder 1995 Democratization and the Danger of War Interna-tional Security 20 5-38
Menzel Ulrich 1999 Das Ende der Einen Welt und die Unzulaumlnglichkeit der kleinen Theorien In Reinhold E Thiel (Hrsg) Neue Ansaumltze zur Entwicklungstheorie Bonn Deutsche Stif-tung fuumlr Entwicklung 379-388
Merkel Wolfgang 1999 Systemtransformation Eine Einfuumlhrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang (Hrsg) 2000 Systemwechsel 5 Zivilgesellschaft und Transformation Opladen Leske + Budrich
Merkel Wolfgang und Aurel Croissant 2000 Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien Politische Vierteljahresschrift 41 3-30
Messner Dirk 2001 Weltkonferenzen und Global Governance Anmerkungen zum radikalen Wandel vom Nationalstaatensystem zur Global Governance-Epoche In Thomas Fues und Brigitte I Hamm (Hrsg) Die Weltkonferenzen der 90er Jahre Baustellen fuumlr Global Gov-ernance Bonn Dietz 13-43
Messner Dirk 2006 Machtverschiebungen im internationalen System Global Governance im Schatten des Aufstieges von China und Indien In Tobias Debiel Dirk Messner und Franz Nuscheler (Hrsg) Globale Trends 2007 Frieden Entwicklung Umwelt Bonn Bundeszen-trale fuumlr politische Bildung 45-61
Messner Dirk und Franz Nuscheler 2006 Das Konzept Global Governance Stand und Perspek-tiven In Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg) Global Governance fuumlr Entwicklung und Frieden Perspektiven nach einem Jahrzehnt Bonn Dietz 18-79
Milner Helen V und Keiko Kubota 2005 Why the Move to Free Trade Democracy and Trade Policy in the Developing Countries International Organization 59 107-144
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
224 Thomas Conzelmann Joumlrg Faust
Moravcsik Andrew 1997 Taking Preferences Seriously A Liberal Theory of International Poli-tics International Organization 51 513-533
Muumlller Harald und Thomas Risse-Kappen 1990 Internationale Umwelt gesellschaftliches Um-feld und auszligenpolitischer Prozeszlig In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internatio nalen Beziehungen Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 375-400
Narlikar Amrita 2006 Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India International Affairs 82 59-76
Narlikar Amrita und Diana Tussie 2004 The G 20 at the Cancun Ministerial Developing Coun-tries and Their Evolving Coalitions in the WTO World Economy 27 947-966
Noumllke Andreas 2003 Intra- und interdisziplinaumlre Vernetzung Die Uumlberwindung der Regierungs-zentrik In Gunther Hellmann Klaus Dieter Wolf und Michael Zuumlrn (Hrsg) Die neuen Internationalen Beziehungen Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland Baden-Baden Nomos 519-554
Nye Joseph S 1990 Soft Power Foreign Policy 80 153-171Nye Joseph S 2004 Soft Power The Means to Success in World Politics New York Public
AffairsPutnam Robert D 1988 Diplomacy and Domestic Politics The Logic of Two-Level Games
International Organization 42 427-460Ravallion Martin und Shubham Chaudhuri 2007 Partially Awakened Giants Uneven Growth in
China and India In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 175-210
Risse Thomas 2006 Transnational Governance and Legitimacy In Arthur Benz und Yannis Papadopoulos (Hrsg) Governance and Democracy Comparing National European and International Experiences New York Routledge 179-199
Risse Thomas 2007 Governance in Raumlumen begrenzter Staatlichkeit Reformen ohne Staat In Klaus Dieter Wolf (Hrsg) Staat und Gesellschaft ndash faumlhig zur Reform Baden-Baden Nomos 231-245
Rittberger Volker und Michael Zuumlrn 1991 Transformation der Konflikte in den Ost-West-Bezie-hungen Versuch einer institutionalistischen Bestandsaufnahme Politische Vierteljahres-schrift 32 399-424
Scholz Imme 2008 Climate Change China and India as Contributors to Problems and Solutions In Hubert Schmitz und Dirk Messner (Hrsg) Poor and Powerful ndash The Rise of China and India and its Implications for Europe DIE Discussion Paper 132008 Bonn Deutsches In-stitut fuumlr Entwicklungspolitik 40-54
Senghaas Dieter 1988 Konfliktformationen im internationalen System Frankfurt a M Suhr-kamp
Senghaas Dieter 2003 Die Konstitution der Welt ndash eine Analyse in friedenspolitischer Absicht Leviathan 31 117-152
Stamm Andreas 2005 Entwicklungspolitik zur Mitgestaltung der Globalisierung Kooperation mit Ankerlaumlndern als Herausforderung und Chance In Dirk Messner und Imme Scholz (Hrsg) Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik Baden-Baden Nomos 119-135
Tetzlaff Rainer 1996 Theorien der Entwicklung der Dritten Welt nach dem Ende der Zweiten (sozialistischen) Welt In Klaus von Beyme und Claus Offe (Hrsg) Politische Theorien in der Aumlra der Transformation PVS Sonderheft 26 Opladen Westdeutscher Verlag 59-93
Underdal Arild 1995 Review Essay The Study of International Regimes Journal of Peace Research 32 113-119
Wilson Dominic und Roopa Purushothaman 2003 Dreaming with BRICs The Path to 2050 Goldman Sachs Global Economics Paper No 99 New York Goldman Sachs
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173
bdquoNordldquo und bdquoSuumldldquo im globalen Regieren 225
Winters L Alan und Shahid Yusuf 2007 Introduction Dancing with Giants In L Alan Winters und Shahid Yusuf (Hrsg) Dancing with Giants China India and the Global Economy Washington World Bank 1-34
Zangl Bernhard 1999 Interessen auf zwei Ebenen Internationale Regime in der Agrarhandels- Waumlhrungs- und Walfangpolitik Baden-Baden Nomos
Zuumlrn Michael 1993 Bringing the Second Image (Back) In About the Domestic Sources of Regime Formation In Volker Rittberger und Peter Mayer (Hrsg) Regime Theory and Inter-national Relations Oxford Clarendon Press 282-311
Zuumlrn Michael 1998a Regieren jenseits des Nationalstaates Globalisierung und Denationalisie-rung als Chance Frankfurt a M Suhrkamp
Zuumlrn Michael 1998b Gesellschaftliche Denationalisierung und Regieren in der OECD-Welt In Beate Kohler-Koch (Hrsg) Regieren in entgrenzten Raumlumen PVS Sonderheft 29 Opladen Westdeutscher Verlag 91-120
Zuumlrn Michael 2000 Democratic Governance beyond the Nation-State The EU and other Inter-national Institutions European Journal of International Relations 6 183-221
Zuumlrn Michael Martin Binder Matthias Ecker-Ehrhardt und Katrin Radtke 2007 Politische Ord-nungsbildung wider Willen Zeitschrift fuumlr Internationale Beziehungen 14 129-164
Zuumlrn Michael Klaus Dieter Wolf und Manfred Efinger 1990 Problemfelder und Situationsstruk-turen in der Analyse internationaler Politik Eine Bruumlcke zwischen den Polen In Volker Rittberger (Hrsg) Theorien der Internationalen Beziehungen Bestandsaufnahme und For-schungsperspektiven PVS Sonderheft 21 Opladen Westdeutscher Verlag 151-173