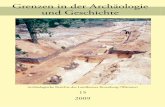ERBRECHT UND ERBFOLGE IM ANGLO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ERBRECHT UND ERBFOLGE IM ANGLO
ERBRECHT UND ERBFOLGE IN ENGLAND IM MITTELALTER UND DER FRÜHEN NEUZEIT
Seminararbeit
im Rahmen des DiplomandInnenseminars
LV-Nr. 030256
im SS 2012
eingereicht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Wien als 2. Teil der Diplomarbeit gemäß § 22 WrReStP
von
Claudia Ladinig-Morawetz (9806403)
Betreuer:
ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Neschwara
2
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG........................................................................................................................ 3
I) DAS COMMON LAW ..................................................................................................... 4
A) Begriff .........................................................................................................................................................................4
B) Historische Entwicklung......................................................................................................................................4
C) Quellen .......................................................................................................................................................................5
D) Writs ...........................................................................................................................................................................6
E) Equity..........................................................................................................................................................................7
II) DAS ERBRECHT ............................................................................................................ 8
A) Wichtige Begriffe des englischen Erbrechts..................................................................................................8 1. Executor ....................................................................................................................................................................................... 8 2. Administrator ............................................................................................................................................................................ 9 3. Unterscheidung von real und personal property ........................................................................................................ 9
B) Zeit der Angelsachsen........................................................................................................................................10 1. Quellen........................................................................................................................................................................................10 2. Testamentarische Verfügung............................................................................................................................................10 3. Gesetzliche Erbfolge .............................................................................................................................................................12
C) Zeit der Normannen............................................................................................................................................14 1. Quellen........................................................................................................................................................................................14 2. Testamentarische Verfügung............................................................................................................................................14 a) Mobilien ...............................................................................................................................................................................15 b) Immobilien .........................................................................................................................................................................17 Use ...............................................................................................................................................................................................18
3. Gesetzliche Erbfolge .............................................................................................................................................................18 a) Mobilien ...............................................................................................................................................................................18 b) Immobilien .........................................................................................................................................................................18
III) AUSBLICK ................................................................................................................. 21
IV) BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................ 23
3
Einleitung Das englische Recht ist wie kein anderes historisch gewachsen. Seine Grundlagen und Quellen reichen
bis in das Mittelalter zurück. Es kommt auch heute immer wieder noch vor, dass ein Rechtsstreit
aufgrund eines Gesetzes oder unter Berufung auf einen Präzedenzfall aus dem Mittelalter entschieden
wird.1 Seit der Eroberung durch die Angelsachsen hat es keine Revolution, keinen Bruch und keinen
Neuanfang im englischen Recht gegeben. Vielmehr ist die Entwicklung evolutionär verlaufen. Auch
ist das römische Recht niemals als geschlossenes System rezipiert worden. Nach dem Zeitalter der
Aufklärung wurden auf dem Kontinent zahlreiche Gesetzesbücher geschaffen.2 Eine solche
Kodifikationsbewegung gab es in England nicht. Die Gesetzgeber waren und sind die Richter. Ihre
Urteile haben Gesetzeskraft. Zwar gibt es auch Gesetze des Parlaments3, die aber nur die Entwicklung
korrigieren und erlassen werden, wenn den Gerichten eine Fortentwicklung nicht möglich ist.
Außerdem wird das von den Richtern geformte Common Law als Basis vorausgesetzt. Somit gibt es in
England auch keine großen Kodifikationen, sondern nur hunderte von Einzelgesetzen.4 Deshalb
verlangt auch keine andere geltende Rechtsordnung zu ihrem Verständnis so gebieterisch wie die
englische eine Beschäftigung mit ihren Grundlagen.5
Um einen Einblick in das mittelalterliche Erbrecht Englands zu bekommen ist es unerlässlich eine
gewisse Grundkenntnis des Common Law zu besitzen. Ich werde somit in der folgenden Arbeit zuerst
einen kurzen Einblick in das dieses geben bevor ich mich näher mit dem Erbrecht befassen werde. Die
behandelte Zeitspanne reicht, wie der Titel schon sagt, vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit.6
1 Henrich/Huber, Privatrecht, 12. 2 So etwa das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich (1896), in Frankreich der Code Civil (1804), das
Schweizerische Zivilgesetzbuch (1907) und in Österreich das ABGB (1812). Peter, Actio und Writ, 55f. 3 Seit 1483 werden die Gesetze teils in Jahresbänden, teils in Einzelausgaben publiziert. Als wichtigste Quelle ist
heute Halsbury`s Statutes of England and Wales, 4. Aufl. zu nennen (50 Bände), da diese Sammlung alle noch
geltenden Gesetze in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung, d.h. inklusive aller Änderungen und Ergänzungen,
enthält. Publiziert wurde die Sammlung zwischen 1985 und 1992. Durch Ergänzungslieferungen
(Loseblattsammlung) wird sie auf neuestem Stand gehalten. Henrich/Huber, Privatrecht, 31f.
Für die neueren Gesetzte sind die Sammlungen „The Public General Statutes (seit 1866)“ und „Current Law
Statutes Annotated (seit 1948)“ zu nennen. Online siehe auch http://www.legislation.gov.uk (12.9.13 18:34). 4 Henrich/Huber, Privatrecht, 11f. 5 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 177. 6 Der Begriff Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen dem Ende der Antike
(6. Jhd.) und dem Beginn der Neuzeit (15. Jhd.). Frühe Neuzeit ist die Epoche zwischen dem Spätmittelalter
(13. Bis 15. Jhd.) und dem Übergang vom 18. Zum 19. Jhd.
4
I) Das Common Law
A) Begriff Der Begriff hat sich aus dem französischen commune ley (Recht für alle oder gemeinsames Recht)
abgeleitet. Er ist nicht mit dem Deutschen „gemeinen“ Recht (Recht des Volkes) zu verwechseln. Mit
Common Law, welches ebenfalls mit „gemeinem Recht“7 zu übersetzen ist, meinte man die
Abgrenzung zu den bis ins hohe Mittelalter existierenden unterschiedlichen Rechten der einzelnen
germanischen Stämme auf dem Boden Englands. Das Common Law beruht auf ungeschriebenen
Gewohnheiten und wurde durch richterliche Entscheidungen fortgebildet.
Heute meint der Begriff Common Law zweierlei: Zum Einen wird darunter das gesamte englische
Recht (einschließlich der Equity und des Statute Law) in Abgrenzung zum Civil Law, dem
kontinentaleuropäischen Recht, verstanden; zum Anderen wird der Begriff Common Law innerhalb
des angloamerikanischen Rechtes im engeren Sinn als Gegensatz zur Equity und zum Statute Law
verwendet.8
B) Historische Entwicklung Die Wurzeln des englischen Rechts sind das Staatswesen der Angelsachsen (beginnend mit der
Ankunft der Jüten 449) und der Lehnstaat der Normannen seit William dem Eroberer (Schlacht bei
Hastings 1066).9 Das Common Law entwickelte sich im Mittelalter nach der Invasion der Normannen
als reisende Richter10 im Auftrag des Königs durchs Land zogen und Recht sprachen (daher: Case Law
bzw. Richterrecht). So setzten sie allmählich, um den Bedürfnissen des Feudalsystems gerecht zu
werden, überall das Common Law gegenüber den lokalen Gewohnheiten11 durch.12 Ab der Mitte des
13. Jahrhunderts konnte sich das Case Law endgültig gegen die unterschiedlichen örtlichen
Gewohnheiten durchsetzten. Seit dieser Zeit wurde es auch Common Law genannt13
7 Sowohl „Common“ als auch „Gemein“ gehen auf das lateinische „communis/ commune“ zurück. Die
Übersetzung „gemeines Recht“ für das Common Law ist daher auch nicht üblich, sondern es wird auch im
Deutschen im Allgemeinen als Common Law bezeichnet. Zu den verschiedenen Bedeutungen für den Ausdruck
„Gemeines Recht“ siehe Thieme, HRG I, 1506f. 8 Henrich/Huber, Privatrecht, 12; Werp, Ehegattenerbrecht, 5; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 185. 9 Werp, Ehegattenerbrecht, 26. 10 „itinerant justices“ oder „justice in eyre“. Eyre leitet sich vom lateinischen Wort iter, was so viel bedeutet wie
Reise/Weg, ab. Baker, English Legal History, 16. 11 Das englische Common Law wird deshalb als „gemeines Recht“ bezeichnet, da es sich, wie oben erwähnt,
gegenüber den lokalen Gewohnheiten durchsetzte und nicht wie das Gemeine Recht auf dem Kontinent nur
subsidiär hinter den Landesgewohnheiten galt. Radbruch, Rechtsvergleichende Schriften, 317. 12 Werp, Ehegattenerbrecht, 3. 13 Bernsdorff, Englisches Recht, 2f.
5
Die normannische Eroberung brachte allerdings keinen sofortigen Wandel, sondern eher eine
Ausprägung von Rechtsinstituten, die in Ansätzen schon unter den Angelsachsen vorhanden waren.
Große Änderungen gab es nur im Landrecht da sich unter den Normannen ein striktes Feudalsystem
herausbildete. In den nächsten drei Jahrhunderten vereinheitlichten sich die zahlreichen lokalen Rechte
zum Common Law.14
C) Quellen15 Als wichtigste Quellen sind die Darstellungen von Ranulf de Glanvilla und des Henrici de Bracton16
sowie die anonymen Werke Fleta und Britton zu nennen.17
Das Rechtsbuch von Ranulf de Glanvill18 trägt den Titel Tractatus de Consuetudinibus regni
Angliae.19 Dabei handelt es sich um eine kommentarartige Klagesammlung über das Recht und
Verfahren der Curia Regis, welches um 1187 entstand. Es besteht aus insgesamt vierzehn Büchern und
leitet die Reihe der sogenannten „books of authority“20 ein. Es ist die erste klassische Aufzeichnung
des englischen Rechts.21 Das Werk ist wahrscheinlich auf den ausdrücklichen Befehl König Heinrich
II. verfasst worden.22
Weiters ist Henrici de Bracton23 mit seinem Werk de legibus et consuetudinibus Angliae libri quinque
zu nennen, welches um 1250 entstand. Es ist die bedeutenste und umfassenste Darstellung des
englischen Rechts aus dem Mittelalter. Er führte die Einteilung der Klagen in rem und in personam
bzw. realis und personalis ein.24
Bei Fleta und Britton25 handelt es sich um Nachahmungen von Bractons Werk. Die Fleta trägt den
Titel ser commentarius iuris Anglicani und entstand um 1290 unter Edward I. Sie wird einem
unbekannt gebliebenen Verfasser26 im Fleetgefängnis zugeschrieben und daher auch Fleta genannt.27
14 Werp, Ehegattenerbrecht, 27f. 15 Zu den Quellen siehe Gans, Erbrecht, 262-281. 16 Für eine kurze Darstellung zu Glanvill und Bracton siehe St. P. Buhofer, Structuring the Law, 12-17. 17 Brunner, Anglonormannisches Erbfolgesystem. 13f. 18 Dieses Werk wird herkömmlicher Weise Ranulf de Glanvill zugeschrieben. Er übte unter Heinrich II. das Amt
des Chief Justitiar (Justizminister, oberster Richter) aus. Allerdings könnte das Werk auch von Huber Walter,
dem Sekretär und Nachfolger Glanvills oder von Geoffry fitz Peter, ebenfalls ein Sekretär von Glanvill, verfasst
worden sein. Siehe Ziegenbein, Real und Personal Actions, 19 Fußn. 9. 19Für eine Übersetzung siehe Beale, Glanville. 20 Books of authority sind Schriften, die als anerkannte Rechtsquellen bindende Kraft besitzen. Henrich/Huber,
Privatrecht, 34.. 21 Ziegenbein, Real und Personal Actions, 19f. 22 Crabb, Geschichte des englischen Rechts, 62. 23 Zu seinem Leben siehe Maitland, Bracton, 13ff. 24 Ziegenbein, Real und Personal Actions, 20f. 25 Zu Fleta und Britton siehe Nichols, Britton, xxiii-lxiv.
6
Britton28 ist ein Rechtsbuch in altfranzösischer Sprache, welches nach 1290 entstand. Der Autor ist
ebenfalls unbekannt.
D) Writs
Im deutlichen Unterschied zu den kontinentaleuropäischen Rechtssystemen ist im englischen Recht
nicht die Klage das Mittel zur Durchsetzung eines bestimmten Anspruchs, sondern dies geschieht mit
Hilfe eines sogenannten writs29 Als writ bezeichnete man eine schriftliche Anordnung des Königs als
obersten Gesetzgeber an den Sheriff oder einen anderen Gerichtsherrn30, bestimmte prozessuale
Maßnahmen (etwa die Vorladung des Beklagten) zu ergreifen. Solche writs wurden auf einseitigen
Antrag des Klägers, also ohne Anhörung des Beklagten ausgestellt. Der Kläger musste den writ im
Chancellor`s Office (königliche Kanzlei) beantragen, eine Gebühr entrichten und das Siegel für den
writ beim höchsten Justizbeamten (dieser war im Namen des Königs tätig), dem Capitalis Iusticiarius,
später dem Chancellor, einholen.31
Zunächst sind writs für jeden Einzelfall entstanden. Da jedoch immer wieder gleiche Sachverhalte von
den Antragstellern zur Grundlage ihres Klagebegehrens gemacht wurden, griffen die Schreiber des
Kanzlers, denen die Ausfertigung der writs oblag, zu Mustern von früher ausgestellten Schriftstücken
zurück. Somit entwickelten sich für den Text32 der einzelnen writs sehr bald standardisierte, in der
Praxis mit charakteristischen Kurznamen33 bezeichnete Formen (forms of Action) heraus. In diese
musste dann nur noch Name und Wohnort der Parteien sowie eine kurze Umschreibung des
Streitverhältnisses aufgrund der Angaben des Klägers eingesetzt werden. Gegen Ende des 12. Jh.
hatten sich in der Übung des Chancellors etwa 75 feststehende writs herausgebildet, die sich im 13.
Und 14. Jh. noch erheblich erweiterten. Sie wurden bald in einem Verzeichnis, dem „Register of
Writs“34 zusammengefasst.35 Dieses wurde erstmals unter der Herrschaft Henry`s VIII im 16. Jhd.
gedruckt.
26 Zur Diskussion über die Identität des Verfasser der Fleta siehe Denholm-Young, Fleta. 27Für eine Übersetzung siehe Richardson, H.G., G.O. Sayles., Fleta. (Selden Society, vols. 72, 89, 99,1955-82);
Zur Fleta allgemein siehe Plucknett, Legal Literature, 78f; Plucknett, Common Law, 265. 28 Herausgegeben und Übersetzt von Nichols, Britton. 29Writ wird abgeleitet von „to write“ = schreiben, d.h., das Geschriebene; siehe Bernstorff, Englische Recht, 3. 30 Wenn an Stelle der königlichen oder Grafschaftsgerichte ein lehnsherrliches Gericht den Fall zu entscheiden
hatte. Peter, Actio und Writ, 19. 31 Bernstorff, Englisches Recht, 3; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 181. 32 Die Sprache der writs war bis 1731 Latein. Erst dann gingen Kanzlei und Gerichte im schriftlichen Verkehr
zum Englischen über. Peter, Actio und Writ, 20. 33 So etwa writ of right, writ of detinue, writ of mort d`ancestor usw: 34Siehe Haas/Hall, Writs. 35 Bernstorff, Englisches Recht, 3; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 181; Henrich/Huber, Privatrecht, 13.
7
Es war wichtig, dass sich der Kläger vor Einleitung des Prozesses sorgfältig überlegte, welche
Klageformel auf den gegebenen Sachverhalt passte und ihm zur Durchsetzung seines Klagebegehrens
verhelfen konnte. Dies war oft nicht leicht, da die Zahl der writs immer größer und daher die
Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Sachverhalten immer komplizierter wurde.36
Der rechtstechnische Unterschied zur Klage ist dabei der, dass ein writ kein prozessuales Mittel zur
Durchsetzung eines beliebigen materiellen Anspruchs ist, sondern ein rein prozessrechtliches
Instrument, das über die Begründetheit eines Anspruchs noch keinen Schluss zulässt.
Da jeder einzelne writ das Vorliegen von jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen erforderlich
machte, war durch die Auswahl des richtigen writ der Prozessverlauf bereits bis ins Detail festgelegt.
Denn jeder writ bedingte die Abfolge unterschiedlicher Prozesshandlungen, die Vertretung der
Prozesspartein, die Zulassung und Bewertung von Beweisen etc.; Hauptsorge des Klägers war es
somit, die richtige Klagenart zu wählen.37
E) Equity38 Neben dem System der Common Law- Rechtssprechung bildete sich die der Equity heraus. Denn trotz
der fortlaufenden Ausweitung der Anwendungsbereiche der writs wurde das Common Law bereits seit
dem 14. Jh. von den Rechtssuchenden als zu starr, unbeweglich und damit als ungenügend empfunden.
Der Grund dafür lag vor allem im streng formalisierten Prozessverlauf. Dieser nahm den Common
Law Courts die Möglichkeit nach den Grundsätzen der fairness und reasonableness, nach Treu und
Glauben zu entscheiden. Somit konnte z.B. auch der arglistig Handelnde Recht bekommen, wenn die
Klageformel (writ) stimmte. Ein weiterer Mangel des Aktionensystems der writs war seine
Beschränktheit auf ganz wenige Rechtsfolgen. Es gab z.B. keine Verurteilung zur Erfüllung eines
Vertrages oder auf Unterlassung von Handlungen sondern letztlich nur die Zahlung von
Schadenersatz.
In solchen Fällen wandten sich die Rechtssuchenden an den König, mit der Bitte um Gerechtigkeit und
Gnade. Als die Bittgesuche an den König mit der Zeit immer zahlreicher wurden, delegierte der König
seine Befugnisse an den Kanzler, welcher zunächst im Namen des Königs, später seit dem Ende des
15. Jh. als selbstständiger Richter entschied. So entstand ein neues Gericht, der Court of Chancery.
In diesem urteilte der Kanzler ohne writs, sondern nur Kraft königlicher Vollmacht und nach seinem
Gefühl der Billigkeit. Der Kanzler konnte so neue Rechte begründen und neuartige Rechtsbehelfe
schaffen.39
36 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 181. 37 Lavizzari, Common Law und Civil Law, 12. Einige Beispiele für die prozessualen Verschiedenheiten von
writs finden sich bei Peter, Actio und Writ, 39-43. 38 Equity leitet sich ab vom lateinischen „aequitas“ = Billigkeit, Gleichheít, Bernsdorff, Englisches Recht, 5 Fn.
13. 39 Henrich/Huber, Privatrecht, 15; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 184.
8
Ursprünglich entschied der Kanzler von Fall zu Fall, weitgehend nach freiem Ermessen. Doch mit der
Zeit hielt sich der Court of Chancery mehr und mehr an seine in früheren Entscheidungen
aufgestellten Grundsätze. So verfestigten sich die Maximen, welche diesen Entscheidungen zugrunde
lagen immer mehr zu einem eigenen, neben den Common Law stehenden Normengefüge, dem Recht
der Equity.40
Über die Rechtssprechung des Kanzlers, der bis 1529 grundsätzlich Geistlicher war41, flossen viele
Grundsätze des kanonischen Rechts in das Recht der Equity ein.
Das Verfahren unterschied sich von dem des Common Law erheblich. Wenn dem Kanzler der von
dem Petenten vorgetragenen Sachverhalt nicht von vornherein als ungeeignet erschien, so lud er den in
der Bittschrift genannten Gegner zu einer Verhandlung. Diese fand nicht vor dem Königsgericht,
sondern vor ihm selbst statt. Die formalen Beweisregeln des Writ-Verfahrens spielten keine Rolle. Der
Gegner des Bittsuchenden musste unter Eid dem Kanzler zu dem gesamten Sachverhalt Rede und
Antwort stehen. Der Kanzler entschied dann alleine, ohne Jury. Die Durchsetzung der von ihm
getroffenen Entscheidung wurde durch Haftstrafen gesichert.42
II) Das Erbrecht Im Folgenden werden zunächst zu einem besseren Verständnis einige wichtige Institutionen des
englischen Erbrechts vorgestellt; die Zeit der Angelsachsen (449-1066) und die Ära der Normannen
(ab 1066) werden getrennt behandelt
A) Wichtige Begriffe des englischen Erbrechts
1. Executor
Im Englischen Recht kommt dem executor (Testamentsvollstrecker) erhebliche Bedeutung zu, da er
die Erbschaftsverwaltung führt. Der Executor im heutigen englischen Recht geht auf den executor
universalis des mittelalterlichen kanonischen Rechts zurück; er gilt als Universalnachfolger des
Erblassers.
Der Ursprung der executors ist im 12. Jahrhundert zu suchen. Er verwirklichte die Durchsetzung der
von der Kirche geförderten Testamente über chattels43. Er war ursprünglich eine Art Treuhänder, ein
Vertrauter des Erblassers, der für die Abwicklung des Nachlasses zu sorgen hatte. Er befriedigte die
Gläubiger und übertrug den Restnachlass mittels Rechtsgeschäfte auf die im Testament genannten
Personen. Bevor er allerdings mit der Verwaltung beginnen konnte musste das Kirchengericht in
40 Henrich/Huber, Privatrecht, 16f; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 185. 41 1529 wurde mit Thomas More der erste weltliche Kanzler ernannt. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 185. 42 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 184. 43 Bewegliches Hab und Gut.
9
einem probate-Verfahren44 die Gültigkeit des Testaments und seine ordnungsgemäße Errichtung
geprüft und festgestellt haben.45
2. Administrator
Falls der Erblasser in seinem Testament keinen exekutor ernannt hatte, dann hatte die Kirche das
Recht zur Erbschaftsverwaltung. Allerdings wählte in der Praxis der Bischof meist ein
Familienmitglied des Verstorbenen aus an seiner Stelle administrator zu sein. Durch das Überreichen
der letters of administration46 durch den Bischof wurde dieser administrator ernannt. Im Jahr 1357
erklärte ein Statut diese Praxis für zwingend. Die Position und die Funktion des administrators ist
seither der des executors angeglichen.
Heute ist die Ernennung einen administrators notwendig, wenn gesetzliche Erbfolge eintritt, oder es
zwar ein Testament gibt, aber darin kein executor bestimmt ist. Daneben gibt es für besondere
Sachlagen noch weitere Ernennungsformen, die aber in der gegenständlichen Arbeit zu weit führen
würden.47
3. Unterscheidung von real und personal property
Nach der normannische Eroberung entstanden unterschiedliche Erbregeln für den persönlichen Besitz
(personal property) und den Grundbesitz (real property). Diese Unterscheidung wurde erst mit dem
Administration of Estates Act 1925 aufgehoben. Über real property gab es keine Dispositionsbefugnis.
Dieses Verbot wurde allerdings mit Hilfe der uses48 umgangen.49
44 Die Idee, die Richtigkeit und Gültigkeit eines Testaments zu untersuchen und festzustellen wurde in England
von den Kirchengerichten entwickelt. Diese hatten im Mittelalter über die Erbfolge bei personal property zu
entscheiden. Bei den weltlichen Gerichten, die über das Recht von real property zu entscheiden hatten, gab es
ein solches Verfahren nicht. 45 Werp, Ehegattenerbrecht, 17; Henrich/Huber, Privatrecht, 121. 46 Der früheste uns überlieferte letter of administration datiert in das Jahr 1313. Seit dem Statut von 1285 war es
üblich, dass die Witwe und nahe Verwandte zum Administrator ernannt wurden. Sie mussten ein Inventar
aufstellen, die Schulden des Erblassers begleichen und eine Dreiteilung des restlichen Vermögens vornehmen.
Ein Drittel bekam die Witwe, ein Drittel die Kinder und ein Drittel war der „dead man`s part“. Der Bischof war
allerdings rechtlich gesehen weiterhin für die Schulden und auch für die rechtmäßige Verteilung zuständig. Dies
hatte zur Folge, dass die administrators weder klagen noch geklagt werden konnten. Erst im Jahr 1357 wurden
sie den executors gleichgestellt. Siehe Plucknett, Common Law, 729f. 47 Werp, Ehegattenerbrecht, 18. 48 Siehe unten S. 16. 49 Henrich/Huber, Privatrecht, 116f.
10
B) Zeit der Angelsachsen50 Zu dieser Zeit lassen sich nur wenig gesicherte Aussagen über das Erbrecht und die Erbfolge treffen.
Von früheren Rechtshistorikern wurde teilweise angenommen, dass die Familie als Einheit das Land
besaß und nicht das Individuum. Dies wird heute jedoch eher verneint.51
1. Quellen
Es ist uns zwar ein reichhaltiger Schatz an Rechtsquellen überliefert, allerdings hängen die wenigsten
mit dem Erbrecht zusammen. Zu nennen sind die Gesetze der angelsächsischen Könige von Aethelbert
bis Cnut52. Diese sind nicht in Latein, sondern in Angelsächsisch verfasst und regeln nur Teile von
Rechtsgebieten bzw. Ausnahmefälle. Eine Vielzahl von Gewohnheiten wird wohl als so
selbstverständlich angesehen worden sein, dass man sie nicht niederschrieb.53 Weiters sind Urkunden
zu nennen, welche die verschiedenartigsten Rechtsgeschäfte betreffen und uns oft einen Einblick in
Gebiete geben über welche die Gesetze schweigen.54
2. Testamentarische Verfügung
Die ersten Testamente tauchten um die Zeit Alfreds55 auf. Diese wurden wohl vom kanonischen bzw.
vom römischen Recht übernommen.56 Vom 9. Bis Ende des 11. Jahrhunderts wurde der Ausdruck
cwide57 für das Testament verwendet. Es handelte sich auch nicht um Testamente in unserem heutigen
Verständnis, sondern um unwiderrufliche, bilaterale Rechtsgeschäfte. Sie hatten Geschenke zum
Gegenstand, die der Erblasser zu Lebzeiten für die Zeit nach seinem Tod machte.58 Auch wurde der
Kirche immer, von einer einzigen in der Literatur bekannten Ausnahme59 abgesehen, ein Teil des
Vermögens vermacht. Meistens handelte es sich dabei um ein Stück Land.60 Der Rechtsakt selbst war
zwar mit der mündlichen Verkündung vor Zeugen abgeschlossen, doch zu Beweiszwecken war die 50 Diese Periode beginnt mit der Ankunft der Jütten auf der Insel von Thanet 449 und endet mit der Eroberung
der Normannen 1066. Holdsworth II, 14. 51 Plucknett, Common Law, 522, 712; Holdsworth II, 90f. 52 Originaltext, deutsche Übersetzung und Erläuterungen finden sich in Liebermann, Gesetze. 53 Holdsworth II, 19. 54 Schmid, Gesetze, xv. 55 Ab etwa 886 war er König der Angelsachsen. Das älteste uns erhaltene Testament ist jenes von Aethelnoth
und seiner Frau Gaenberg aus Kent. Drout, 8; Originaltext und Übersetzung der Testamente finden sich bei
Thorpe, Diplomatarium Anglicum. 459-605; Whitelock, Wills, 2-99. 56 Gans, Erbrecht, 307. 57 Die ursprüngliche Bedeutung von cwide war Rede, Vortrag, dictum. Im Laufe der Zeit wurde das Schriftstück,
in welchem das mündliche cwide zum Beweis niedergeschrieben wurde, ebenfalls cwide genannt. Whitelock,
Wills, xiii; Cwide in: Bosworth, Dictionary, 84. 58 Werp, Ehegattenerbrecht, 27. 59 Bei der Ausnahme handelt es sich um das Testament von Cynethryth. Tollerton, Wills, 54, Fn. 264. 60 Tollerton, Wills, 54.
11
schriftliche Dokumentation wichtig, worauf die Kirche auch sehr bedacht war. Testamente wurden zur
Sicherung unter anderem in Kirchen hinterlegt.61
Folgende Formen von Verfügungen von Todes wegen lassen sich erkennen: Die „death-bed gifts“
bzw. „novissima verba“. Dabei handelt es sich um Geschenke vom Totenbett aus. Diese letzten Worte
wurden im Allgemeinen zu einem Priester gesprochen. Weiters sind die „donationes ( irrevocabilis)
post obitum“ zu nennen. Der Erblasser pflegte zu Lebzeiten zu sagen: „ I give...after my death...“, „ I
give...after my death and the death of X and Y...“ oder eine ähnliche Formulierung62
Das Konzept des späteren executors des Common Laws hatte zu dieser Zeit schon seine Anfänge.
Eine Vielzahl von angelsächsischen Testamenten beinhalteten Empfehlungen, wer eine gewisse
Verantwortung über die Absichten des Erblassers haben sollte. Entweder sie galten als Repräsentanten
des Testators, welches auch die Aufgabe des späteren executors war oder sie hatten den Schutz bzw.
das mund63 über das Testament selbst inne. Im Allgemeinen wurde der König gebeten diesen Schutz
zu übernehmen. Auch die Kirche, entweder als Gemeinschaft oder einzelne ihrer Angehörigen, wurde
oftmals gebeten. Ebenso wurden Adelige, hochrangige Tharnen (Barone) und Brüder des
Verstorbenen genannt.64
Es gibt keine Hinweise darauf, dass es zu dieser Zeit eine Beschränkung der testamentarischen
Verfügung über bewegliches Vermögen gab.65 Wenn unbewegliches Vermögen betroffen war, wurde
zwischen folkland und bookland66 unterschieden. Über folkland wissen wir sehr wenig. Über bookland
konnte man wahrscheinlich frei testamentarisch verfügen. Allerdings gab es in König Alfred`s
Gesetz67 ein Verbot das Land außerhalb der next of kin zu vererben. Diese Einschränkung galt
allerdings nur, wenn dies ausdrücklich vom Erblasser angeordnet wurde.68
61 Tollerton, Wills, 61; Whitelock, Wills, viii-xv. 62 Whitelock, Wills, viii; Holdsworth II, 95f. 63 Mund in: Bosworth, Dictionary, 243. 64 Tollerton, Wills, 51; Holdsworth II, 96f. 65 Holdsworth II, 93; Gans, Erbrecht, 307; Young, Family Law, 135. 66 Folkland war Land, welches von Privatpersonen aufgrund von Gewohnheitsrecht besessen wurde. Das Recht
wurde nicht wie beim bookland in einer Urkunde festgehalten, sondern existierte nur Kraft Gewohnheit.
Gesicherte Aussagen lassen sich nicht treffen. Aber wohl konnten Besitzer von folkland das Land nicht frei
verkaufen oder vererben. Es wird angenommen, dass das Land zwar von Einzelpersonen besessen wurde, aber
als Teil einer Art Dorfgemeinschaft, welche das gesamte Land gemeinsam kultivierten. Somit waren die Rechte
am Land gebunden und durch die Gewohnheiten der Gemeinschaft definiert. Das Recht an bookland hingegen
wurde in einer Urkunde festgehalten und war nicht gewohnheitsrechtlichen Ursprungs. Es handelte sich um
Geschenke vom König an Kirche und Adlige. Siehe Holdsworth II, 67-70. 67 „Jemand, der Urkunden-Grundbesitz hat, welchen ihn seine Verwandten hinterliessen: (über ihn) setzen wir
nun fest, dass er ihn nicht aus seiner Sippe veräussern darf, wenn Urkunde oder Zeugnis vorhanden ist, dass
dies ein Verbot sei (von Seiten) jener Personen, die ihn zu Anfang erwarben, und jener, die ihn ihm gaben, dass
12
Ehepaare und auch Frauen allein konnten über ihr Vermögen testamentarisch verfügen. Ein Viertel der
erhaltenen Testamente stammt von Ehepaaren. Elf Testamente stammen von Frauen allein.69
Von den angelsächsischen Königen sind nur zwei Testamente auf uns gekommen, nämlich jene von
König Alfred und jenes von König Eadred.70
Die meisten Testamente sind uns durch spätere Abschriften von Kirchenschreibern71 erhalten. Nur 15
aller Testamente72 sind im Original auf uns gekommen.73
3. Gesetzliche Erbfolge
Es können kaum gesicherte Aussagen gemacht werden. Wahrscheinlich hatte zu dieser Zeit auch jede
Gegend eigene Gewohnheiten. In den Gesetzen der angelsächsischen Könige sind eher Regelungen für
außergewöhnliche Fälle74 zu finden als für den Normalfall.75 Es lässt sich beinahe nur aus einer
Analogie zu den anderen Germanen auf dem Kontinent auf einige Grundsätze schließen.76
So gibt es Anhaltspunkte, dass die Angelsachsen zur Berechnung der Verwandtschaftsgrade dieselbe
Methode wie die Sachsen auf dem Kontinent77 anwendeten. Dabei wurden die Grade an den Gelenken
des menschlichen Körpers berechnet. Am Kopf standen die Eltern, Brüder und Schwestern im Genick,
Cousins ersten Grades an der Schulter, Cousins zweiten bis sechsten Grades standen am Ellbogen,
Handgelenk, und am ersten, zweiten und dritten Gelenk des Mittelfingers. Am Fingernagel endete das
Verwandtschaftsverhältnis (next of kin).78
Jeder Blutsverwandte besaß einen Anspruch auf das Erbe, sofern kein näherer Verwandter mehr lebte.
War kein Blutsverwandter mehr vorhanden fiel der Nachlass an den König oder die Allgemeinheit.79
Zuerst erbten die Söhne zu gleichen Teilen. Waren keine Söhne vorhanden erbten die Töchter zu
gleichen Teilen, nach diesen die Enkel. Danach die anderen Verwandten, wohl in folgender
er so nicht (veräussern) dürfe; und dies erweise (wer die Veräusserung anficht) mit des Königs und des Bischofs
Zeugnis vor seinen Verwandten.“ Alfred, 41 in: Liebermann, Gesetze, 75. 68 Holdsworth II, 94f. 69 Drout, 27. 70 Tollerton, Wills, 80. 71 So z. B. der Codex Wintoniensis, welcher zwischen 1130 und 1150 datiert und das Sacrist`s Register of Bury
St. Edmunds aus dem späten 13. Jh. bis Anfang des 14. Jh. Drout, 9. 72 Uns sind zwischen 55 und 62 Testamente erhalten. Die Anzahl variiert von Forscher zu Forscher. Drout, 7. 73 Drout, 8. 74 So wird z. B geregelt, dass wenn eine Nonne ohne Erlaubnis des Königs oder des Bischofs aus dem Kloster
entführt wird, diese nichts vom Erbe des Entführers erhält, es sei denn sie hat ihm Kinder geboren. Alfred, 8 in:
Liebermann, Gesetze, 55. 75 Holdsworth II, 92. 76 Phillips, Angelsächsisches Recht, 145. 77 Diese ist im Sachsenspiegel I. 3, § 3 beschrieben. 78 Young, Family Law, 127; Holdsworth II, 92. 79 Young, Family Law, 139.
13
Reihenfolge: Vater, Mutter, Brüder, Schwestern. Das Recht der Repräsentation gab es zu dieser Zeit
wohl noch nicht. Dieses wurde erst später, zu Zeiten des Common Law, eingeführt.80
In den Gesetzen Cnuts81 ist zu lesen, dass dem Herrn nur die Heergeräte des Verstorbenen zustanden.
Dieser hatte das bewegliche Vermögen auf die Witwe, die Kinder und die nächsten Verwandten
aufzuteilen. Allerdings ist eine solche Teilung des Vermögens des Erblassers zwischen der Witwe, den
Kindern und den next of kin nicht zu verallgemeinern. Dieser Hinweis auf eine solche Teilung der
Erbschaft ist nur kasual und für eine allgemeine Gültigkeit ist die Sprache zu unpräzise.82
Dass alle next of kin einen Anspruch auf das Erbe hatten, hing wohl unter anderem damit zusammen,
dass diese auch zur Blutrache verpflichtet waren. Bis zu welchem Grade allerdings die Verpflichtung
zur Blutrache (und somit wohl auch die Erbberechtigung) ging ist in keiner Quelle klar überliefert.83
Zu erwähnen ist, dass Ehegatten nicht zu den next of kin gehörten. Sie bildeten mit dem Ehegatten und
den Kindern eine Hausgemeinschaft und waren nicht Teil der maeght (Gesamtheit der Verwandten).84
Zu dieser zählte nur die gesamte Blutsverwandtschaft. Die Frau blieb auch nach der Heirat Teil ihrer
eigenen maegth.85 Vom Vermögen über welches nicht testamentarisch verfügt wurde stand der Witwe
die Hälfte zu. Die andere Hälfte gebührte den Kindern. Die Hälfte der Witwe korrespondiert mit der
gesetzlichen Morgengabe, welche die Hälfte des gesamten Vermögens des Mannes ausmachte. Ein
gesetzliches Erbrecht hatte die Ehefrau nicht.86 Waren keine Kinder und andere Verwandten
vorhanden, so erhielt die Witwe das gesamte Vermögen als wittum zur Nutzung.87 Wenn sich die
80 Holdsworth II, 132f. 81 „ Und wenn einer ohne letztwillige Verfügung aus diesem Leben scheidet, sei es (sie unterblieb) durch seine
Nachlässigkeit, sei es durch plötzlichen Tod, dann nehme aus dessen Fahrhabe der Herr nichts mehr als sein
richtiges Hergewaete (Kriegsrüstung). Viehlmehr werde unter seiner Anordnung die Habe höchst gerecht
verteilt an Ehefrau und Kinder und nahe Verwandte, jedem nach dem Maass, das ihm gebührt“ Leges Cnuti II
70 in: Liebermann, Gesetze, 357. 82 Young, Family Law, 133. 83Ob das im Sachsenspiegel erwähnte genauso in England galt ist fraglich. Gans, Erbrecht, 307; Phillips,
Angelsächsisches Recht, 145f. 84 Vgl. die Magschaft bei den Germanenrechten vom Kontinent. Diese ist eine durch die gemeinsame
Abstammung von einem Vorfahren begründete Verwandtschaft. http://www.rzuser.uni-
heidelberg.de/~cd2/drw/e/ma/gsch/magschaft.htm. 85 Young, Family Law, 123. 86 Holdsworth II, 135f. 87 Gans, Erbrecht, 308; vgl. das Wittum im österreichischen Recht: im österreichischen Landesbrauch des 16.
Und 17. Jhd. war ebenfalls noch kein Ehegattenerbrecht bekannt. Das ABGB in der Fassung 1811 gestand der
Frau neben Kindern nur ein Nutzungsrecht, ohne Kinder ein Erbrecht auf ein Viertel zu; Alleinerbe war sie nur
bei Fehlen erbberechtigter Verwandter. Seit 1914 bekommt die Ehefrau neben Kindern ein Viertel, neben Eltern
und Großeltern die Hälfte. 1978 wurden diese Quoten auf ein Drittel bzw. zwei Drittel aufgewertet. Kocher,
Privatrechtsentwicklung, 157f.
14
Witwe aber innerhalb eines Jahres wieder verheiratete verlor sie dieses und auch alle anderen Güter,
welche sie von ihrem verstorbenen Mann erhalten hatte und diese fiel den nächsten Verwandten zu.88
C) Zeit der Normannen89
Seit der Eroberung durch die Normannen gab es in England, wie schon erwähnt, kein privates
Grundeigentum mehr. Die Krone war und ist auch heute noch Eigentümerin des gesamten englischen
Bodens. Alle anderen erhielten das Land zur Nutzung in tenure (Lehen). Es gab freie (free tenures)
und nicht freie Lehen (non-free tenures). Als freie Lehen gab es das eigentliche Ritterlehen (knight
service) und das socage90. Die Lehre der tenures stellte somit die Bedingungen auf, zu denen Land
gewährt wurde. Die Lehre der estates setzte dann die tatsächliche Laufzeit dieser Lehen fest. Beim
estate of freehold war die Laufzeit unbestimmt. Beim estate less than freehold war die Dauer
festgesetzt oder bestimmbar. Diese beiden Formen unterteilten sich in weitere Unterformen.91
1. Quellen
Zu den Quellen des anglonormannischen Erbrechts siehe die Ausführungen zu den Quellen des
Common Law.92 Im Besonderen sind zu nennen das siebente Buch Glanvills, welches
Erbschaftssachen und Testamente behandelt, sowie das zweite Buch Bractons, welches sich ebenfalls
mit dem Erbrecht beschäftigt. Außerdem kann aus den erhaltenen Testamenten und Statuten auf
einiges zu diesem Thema geschlossen werden.
2. Testamentarische Verfügung
Die Ausbildung des normannischen Feudalsystems nach William dem Eroberer beeinflusste
maßgeblich die Entwicklung des Rechts der letztwilligen Verfügung. Testamente über real property
waren, anders als in angelsächsischr Zeit, aufgrund des Feudalsystems bis ins 16. Jh. die absolute
88 Leges Cnuti II 73, 73a in: Liebermann, Gesetze, 360. 89 Die Normannen waren ursprünglich Wikinger, die im 9. Jhd. ihre Heimat in Skandinavien verließen und an
den westeuropäischen Küsten einfielen. Unter anderem setzten sie sich auch in der Normandie fest, woher sich
auch ihr Name ableitet. Im 11. Jhd. begannen sie auch England zu erobern, was ihnen 1066 mit der Schlacht von
Hastings auch gelang. In der Folgezeit bildeten sie eine von den angelsächsischen und dänische Bewohnern
abgegrenzte Population. Trulsen, Pflichtteilsrecht, 15. 90 Dieses wird meist vom angelsächsischen Wort soc, Pflug, abgeleitet. Man kann es jedoch auch von socne,
Freiheit, herleiten. Denn Inhaber eines socage waren gerade mit einer größeren Freiheit gesegnet als das
Ritterlehen. Dafür war es eine im Vergleich zum Ritterlehen unehrenhaftere Art des Grundbesitzes. Crabb,
Englisches Recht, 67. 91 Werp, Ehegattenerbrecht, 5ff. 92 Siehe oben S. 5.
15
Ausnahme. Es bestanden lediglich Testamente über personal property.93 Es war üblich ein Testament
zu errichten; das Unterlassen wurde sogar als Sünde angesehen.94
a) Mobilien
Wollte jemand ein Testament errichten, so wurde sein bewegliches Vermögen, nach Abzug der
Schulden, dreigeteilt. Einen Teil bekam die Ehefrau, einen Teil die Nachkommen und nur über ein
Drittel konnte der Erblasser frei testieren.95 Waren entweder nur eine Ehefrau, oder nur Nachkommen
vorhanden, so konnte er über die Hälfte seines beweglichen Vermögens verfügen. Die andere Hälfte
fiel dann jeweils entweder der Witwe oder aber den Kindern zu. Nur wenn weder Frau noch Kinder
vorhanden waren, konnte er über sein gesamtes bewegliches Vermögen frei testieren. Der „freie“ Teil
wurde im Allgemeinen der Kirche vermacht. Diese Teile des Vermögens nannten sich wife`s part,
bairn`s part und dead`s part.96 Der Teil, welcher der Frau und den Kindern zustand wurde ihr pars
rationabilis genannt. Wurde ihnen dieser Anteil vorenthalten konnten sie ihr Recht mit dem writ de
rationabili parte bonorum einklagen.97 Die Klage war gegen den executor gerichtet, da dieser nach
Eintritt des Erbfalls das bewegliche Vermögen verwalten musste.98
In einem Großteil von England verschwand diese Beschränkung der Testierfreiheit im 16. Jhd.. Nur in
York (bis 1692), Wales (bis 1696) und London (bis 1724) dauerte sie noch etwas fort.99
Zu erwähnen sei noch das sogenannte heriot. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Gabe des
Vasallen bei dessen Tod an den Herrn. Es bestand für gewöhnlich aus dem besten Stück Vieh.
Allerdings hing dieses nicht direkt mit der Erbschaft zusammen.100
Seit dem 12. Jhd. hatten die Kirchengerichte die Jurisdiktion von Testamenten über bewegliches
Vermögen inne. Sie waren auch für deren Errichtung, deren Widerruf und Interpretation zuständig.101
Örtlich zuständig war der Bischof jener Diözese, in deren Wirkungsbereich der Testator gelebt hat.
93 Werp, Ehegattenerbrecht, 41; Trulsen, Pflichtteilsrecht, 15-18; Plucknett, Common La, 727. 94 Holdsworth III, 535. 95 „When...any one wishes to make his Will, if he be not involved in Debts, all his moveables should be divided
into three equal parts; of which one belongs to his Heir, another to his Wife, and the third is reserved to
himself...“ Glanville VII, 5 8 in: Beames, Glanville, 163f. 96 Crabb, Englische Recht, 90; Werp, Ehegattenerbrecht, 44; Holdsworth III, 550. 97 Holdsworth III, 550; Werp, Ehegattenerbrecht, 45; EB 1911, Will (Law). 98 Werp, Ehegattenerbrecht, 45; Plucknett, Common Law, 744. 99 Werp, Ehegattenerbrecht, 45; Holdsworth III, 552; In Schottland besteht diese Dreiteilung bis heute. Trulsen,
Pflichtteilsrecht, 21. 100 Crabb, Englisches Recht, 71. 101 „When a party, summoned by authority of this writ, alleges any thing against the testament itself; either that
it was not reasonabily made, ort hat the thing claimed was not as asserted left by it, then, the plea ought to be
heard and determined in the Court Christian; because pleas concerning testaments ought to be agitated before
the Ecclesiastical Judge...“ Glanville VII, 8 in: Beames, Glanville, 167.
16
Hinterließ ein Testator jedoch sogenannte bona notabilia102 außerhalb der Diozöse in welcher er
verstorben war, so musste die Testamentsprüfung im Prerogative Court des Erzbischofs von
Canterbury bzw. von York erfolgen, je nachdem in welcher Provinz sich die Vermögensstücke
befanden. Waren bona notabilia in beiden Provinzen vorhanden, musste auch in beiden eine Prüfung
des Testaments stattfinden. Diese Zuständigkeit der Kirche dauerte bis 1857. Durch den Court of
Probate Act wurde den geistlichen Gerichten die Jurisdiction über Testamentsangelegenheiten
entzogen und auf ein neu geschaffenes weltliches Gericht, den Court of Probate, übertragen. Dieses
ging 1875 wiederum im High Court of Justice auf.103
Die weltlichen Gerichte akzeptierten die grants of probate durch den Bischof als Beweis für die
Wirksamkeit des Testaments. Die Kirche war unter anderem wohl deshalb darauf bedacht den letzten
Willen zu schützen und durchzusetzen, weil der Testator der Kirche selbst einen Teil zur Rettung
seiner Seele vermachen sollte, was auch in aller Regel passierte. Man sah dies als wichtige religiöse
Pflicht an.104 Da zu dieser Zeit aber nur Grundbesitz großen Reichtum bedeutete, war die Bedeutung
der Kirchengerichte begrenzt.105
Das Testament konnte schriftlich, mündlich oder teilweise schriftlich und teilweise mündlich106
errichtet werden. Das schriftliche Testament konnte unterschiedliche Formen aufweisen. So konnte
das gesamte Testament oder nur der Beglaubigungsvermerk vom Testator selbst geschrieben,
unterschrieben und gesiegelt worden sein. Es waren aber weder Unterschrift noch Siegelung107
gesetzlich notwendig, falls es anders als Testament des Testators bewiesen werden konnte. Es konnte
auch von einer Dritten Person für den Testator geschrieben worden sein. In der Regel wurde das
Testament in der ersten Person verfasst. Es sind uns zwar auch Testamente in der dritten Person
überliefert, aber diese machen nur einen geringen Teil aus. Das mündliche Testament wurde laut
Glanville108 vor zwei oder mehr ehrenhaften Zeugen errichtet. Unter den Zeugen musste kein Priester
sein, außer dies wurde von einigen lokalen Gewohnheiten verlangt.109 Das Testament konnte, anders
als noch zur angelsächsischen Zeit, jederzeit widerrufen werden.110 102 Dabei handelt es sich um nichtlehnsrechtliche Vermögensstücke von 5 Pfund und mehr. Schirrmeister, Recht,
329. 103 Schirrmeister, Recht, 329. 104 Werp, Ehegattenerbrecht, 41. 105 Trulsen, Pflichtteilsrecht, 20. 106 Das mündliche Testament war eher in den niederen Gesellschaftsschichten verbreitet. Das schriftliche
Testament wurde in Latein, Französisch oder Englisch verfasst und war bei der privilegierteren Bevölkerung
üblich. Plucknett, Common Law, 739. 107 Unterschriften waren sehr selten. Meist wurde die Echtheit durch das Siegel des Testators, manchmal noch
von den Siegeln des executors und/oder von Zeugen, bestätigt. Plucknett, Common Law, 739. 108„The testament ought to be made in the presence of two or more lawful man, either clergy or lay...“ Glanville
VII, 6 in: Beames, Glanville, 166. 109 Holdsworth III, 537f.
17
Das Recht ein Testament zu errichten hatte nur der Mann. Einer Frau war nur dann die Errichtung
eines Testaments erlaubt, wenn sie volljährig und unverheiratet war und keinerlei Behinderungen
hatte. Der Ehemann konnte ihr aber, unter jederzeitigen Widerruf, die Errichtung eines Testaments
gestatten. Dies ergab sich daraus, da mit der Heirat das bewegliche Vermögen der Frau auf den Mann
überging. Der Mann konnte somit grundsätzlich auch über die chattels (bewegliches Vermögen) der
Frau testamentarisch verfügen.111 Dies galt jedoch nicht für ihre paraphernalia112. Der Mann durfte
über diese zwar zu Lebzeiten verfügen und damit auch Schulden begleichen, aber er durfte darüber
nicht letztwillig verfügen.113 Verheiratete Frauen dürfen erst seit 1882114 auch ohne Zustimmung des
Mannes über ihr Vermögen letztwillig verfügen.115
Die Testierfähigkeit begann bei Männern mit vierzehn und bei Frauen mit zwölf Jahren.116
Typischer Inhalt von Testamenten117 war eine religiöse Einleitung gefolgt von mehr oder weniger
genauen Anweisungen über das Begräbnis. Weiters wurde ein Teil des Vermögens den Armen und der
Kirche hinterlassen. Eine Zuwendung für den Bau von Brücken oder die Renovierung von Straßen war
nicht selten. Das am meisten charakteristische an mittelalterlichen Testamenten ist die genaue
Auflistung und Beschreibung von Mobiliar, Becher, Kleidung, Waffen, Bücher etc.. Meist wurde auch
eine oder mehrere Personen zum executor ernannt. Normalerweise wurde dem executor für dessen
Aufwand ebenfalls ein Teil des Nachlasses zugewendet.118
b) Immobilien
Wie schon erwähnt, gab es keine testamentarische Verfügung über real property. Der Grund für diese
Entwicklung lag darin, dass der König bzw. die anderen Feudalherrn dadurch finanzielle Nachteile
erleiden konnten. War nämlich kein gesetzlicher Erbe mehr vorhanden, fiel das Land an den
Lehnsherrn zurück. Bei testamentarischer Verfügung wäre das wohl in den meisten Fällen nicht der
Fall gewesen.119
110 Holdsworth III, 540. 111 Werp, Ehegattenerbrecht, 41f. 112Dies leitet sich ab vom griechischen parav neben und fernhv Mitgift/Aussteuer. Dabei handelt es sich um die
persönlichen Güter der Frau wie Kleidung und Schmuck. 113 Werp, Ehegattenerbrecht, 40; Holdsworth III, 544. 114 Dies wurde durch den Married Woman`s Property Act eingeführt. Dies war ein Gesetz des Parlaments,
welches auch verheirateten Frauen erlaubte eigenes Vermögen zu besitzen und darüber zu verfügen. Werp,
Ehegattenerbrecht, 62f. 115 Werp, Ehegattenerbrecht, 63, 99. 116 Holdsworth III, 545. 117 In Nicolas, Testamenta Vetusta sind einige Tetamente abgedruckt. 118 Holdsworth III, 45-47. 119 Werp, Ehegattenerbrecht, 46.
18
Use
Um diese Beschränkung zu umgehen entwickelte man im Laufe des 13. Jhd. das Rechtsinstitut der
uses. Hierbei wurde unter den Parteien vereinbart, dass der ursprüngliche Eigentümer A bis zu seinem
Tode nur nutzungsberechtigt blieb, da B im Zeitpunkt der Eigentumsübertragung von A auf B
Vollrechtsinhaber des Grundstücks wurde. Diese Rechtsposition hatte er jedoch nur to the use und im
Interesse des Begünstigten C inne, welcher das Grundstück nach dem Tode des A vom Treuhänder B
erhielt. Der mittelalterliche Begriff use wandelte sich in späterer Zeit zu trust.120
Im Jahre 1535 wurde unter Henry VIII das Statute of Uses121 erlassen. Durch dieses Gesetz wollte man
die Praxis dieser Umgehung verbieten. Diejenigen, die das Land bisher nur to the use besaßen,
besaßen es fortan at law. Allerdings wurde schon im Jahr 1540 mit dem Statute of Wills die Praxis der
uses wider zugelassen.122
3. Gesetzliche Erbfolge
a) Mobilien
Im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche Arten der Verteilung. Zu Beginn fand wohl eine Aufteilung
zwischen Witwe, Kinder und nahen Verwandten statt. Der König oder andere Lehnsherrn hatten
keinen Anspruch auf die beweglichen Güter des Verstorbenen. Allerdings kam es bald zu einem
Disput zwischen König, Lehnsherrn, Bürgergemeinden, Bischöfen und dem Papst um die Möglichkeit
der Einziehung des beweglichen Vermögens falls kein Testament vorhanden war. Glanville123 sagte
klar, dass wenn jemand ohne Testament stirbt seine chattels dem Lehnsherrn zufallen.124
Ein Continuum bei diesen verschiedenen Gewohnheiten war die Zuständigkeit der Kirchen für
Aufsicht und Verteilung. Dies wurde zu anfangs vom Bischof selbst übernommen. Durch ein Statut
von 1357 war die Kirche verpflichtet einen administrator zu ernennen.125
b) Immobilien
Hier ist zunächst zwischen Ritterlehen und socage (Land wovon keine Kriegsdienste geleistet wurden)
zu unterscheiden.
Das Ritterlehen war unteilbar und fiel dem ältesten Sohn zu. Somit wurde die angelsächsische Praxis
der gleichen Erbfolge aller Söhne durch die Primogenitur abgelöst. Nur in Kent und einigen anderen
120 Werp, Ehegattenerbrecht, 46; Henrich/Huber, Privatrecht, 108f. 121 Text: Baker, Sources, 132-134. 122 Werp, Ehegattenerbrecht, 47; Henrich/Huber, Privatrecht, 109; Moffat, Trusts, 39-42. 123 Glanville VII, 16 in: Beames, Glanville, 184f. 124 Plucknett, Common Law, 727f. 125 Plucknett, Common Law, 729.
19
Gegenden blieb auch nach der normannischen Eroberung diese Gewohnheit, gavelkind126 genannt,
noch erhalten.127 Handelte es sich hingegen um ein socage und war das Land von alters her teilbar, so
erbten alle Söhne zu gleichen Teilen. Dem ältesten blieb allerdings der Stammsitz (primum foedum
bzw. capitale mesnagium) erhalten, wenn er seine Brüder abfand.128 War das Land nicht von alters her
teilbar, bekam je nach lokaler Gewohnheit der älteste oder der jüngste Sohn das Erbgut. Hinterließ ein
Erblasser nur Töchter so erbten diese, ohne Rücksicht auf den Charakter des Lehens, zu gleichen
Teilen. Der ältesten Tochter war wiederum das Hauptgut vorbehalten. Der Gatte der ältesten Tochter
musste allerdings das Homagium129 für das gesamte Lehen leisten.130 Die Primogenitur war seit
Glanville in stetiger Ausbildung und zur Zeit Bractons wurde sie auch bei socage angewendet.131
Diese neuen Regeln wurden im Rahmen der Parentelenordnung ausgebildet. Zuerst erbten die Kinder,
dann die Enkelkinder usw. bis ins Unendliche. Solange Deszendenten des Erblassers vorhanden
waren, blieben alle übrigen Verwandten vom Erbe ausgeschlossen.132
Aszendenten wurden nicht berücksichtigt. Dies erklärt sich aus dem feudalen Charakter des englischen
Grundbesitzes jener Zeit. Denn es konnte niemand gleichzeitig jemandes Lehnherr und Erbe sein. Die
jüngeren Söhne wurden nämlich oftmals von ihren Vätern unterbelehnt um einen gewissen Ausgleich
für die Bevorzugung des Erstgeboren zu schaffen. Falls nun der jüngere Sohn ohne Nachkommen vor
dem Vater oder dem älteren Bruder sterben sollte, sollte das Land nicht an diese zurückfallen.133
Hatte der Erblasser keinerlei Nachkommen folgen die Deszendenten aus der zweiten Parentel; nämlich
seine Geschwister und deren Abkömmlinge. Erst wenn weder Geschwister noch Deszendenten
derselben vorhanden waren, folgte die nächst höhere Parentel; somit die der Großeltern. Da diese als
Aszendenten nicht in Frage kamen, waren Onkeln und Tanten des Erblassers bzw. ihre Deszendenten
an der Reihe. Laut Bracton134, welcher die Ausführungen Glanvilles ergänzte, schloss nach aufwärts
die Zählung mit dem sechsten Grad. 135
126 Der Begriff leitet sich ab von „gif eal cyn“, was soviel bedeutet wie „gegeben allen Kindern“. Nach einer
anderen Meinung von „gavel od. gavol und „gecynd“ Natur/Art des Dienstes. Crabb, Englische Recht, 79. 127 Crabb, Englisches Recht, 79; Plucknett, Common Law, 530. 128 Brunner, Erbfolgesystem, 29f; Crabb, Englisches Recht, 80. 129 Dabei handelt es sich um ein rituelles Treueversprechen des Lehnsnehmers an seinen Lehnsherrn. Plucknett,
Common Law, 533f. 130 Glanville VII, 3 in: Beames, Glanville, 152-157; Brunner, Erbfolgesystem, 31f; Crabb, Englisches Recht, 80. 131 Brunner, Erbfolgesystem, 30. 132 Brunner, Erbfolgesystem, 16; Plucknett, Common Law, 714. 133 Holdsworth III, 175-177; Plucknett, Common Law, 715. 134 Bracton II, 30. 135 Brunner, Erbfolgesystem, 18.
20
Ob ein Eintrittsrecht (Repräsentationsrecht) bestand war zur Zeit Glanvilles136 noch nicht geklärt.
Wenn also der erstgeborene Sohn vor dem Vater verstarb, dieser Sohn aber wiederum einen Sohn
hatte, war die Frage wer das Erbe in Anspruch nehmen konnte; der zweitgeborene Sohn, oder der
Enkel.137 Zur Zeit Bractons war das Repräsentationsrecht hingegen schon allgemein anerkannt. Die
Kinder erbten durch das Recht des Vaters/der Mutter und nicht Kraft eigenen Rechts. So erbte der
Sohn einer Tochter des Erblassers nach den für die Erbfolge der Tochter geltenden Grundsätzen.138
Diese Regel wurde allerdings wegen des casus regis nicht für Onkel und Neffen übernommen. Im Jahr
1199 übernahm König John den Thron und überging somit seinen Neffen Arthur, den Sohn seines
Bruders Geoffrey. Somit war es, zumindest während der Regierungszeit von John unmöglich einem
Neffen den Vorzug vor seinem Onkel zu geben ohne den König zu verleumden.139
Die männlichen Verwandten wurden im Allgemeinen bevorzugt. Allerdings gingen die weiblichen
Deszendenten sowohl nach Glanville als auch nach Bracton allen Kollateralen vor. Der
Geschlechtervorzug war demnach auf die einzelnen Parentelen beschränkt, ohne seine Wirkung über
diese hinaus zu erstrecken. Somit ergab sich ein Vorrecht der männlichen Linie vor der weiblichen
Linie nur in derselben Parentel. Der Geschlechtervorzug äußerte sich ebenfalls in dem Vorzug der
männlichen Aszendenten und der durch sie vermittelten Verwandtschaft vor den weiblichen
Aszendenten und den Verwandten von dieser Seite her.140
Zu erwähnen sei auch noch die Regel, dass eine Vollblütige Schwester ihrem Halbbruder in der
Erbfolge vorging. In anderen Fällen war die Position des Halbblürtigen nicht ganz klar. 141
Jedes neu begründete Lehen war ursprünglich eine Verleihung sub modo. Dies bedeutete, dass dieses
Gut nur an die Deszendenten des Erblassers übergehen konnte, nicht aber an die Kollateralen.
Wenn das Neulehen in den Erbgang kam, erweiterte sich somit der Kreis der Erbberechtigten von
Erbfall zu Erbfall in der Folge der Parentelenordnung.142
War der Erbe beim Erbfall noch minderjährig (Männer unter 21, Frauen unter 14), so war der
Lehnsherr zur Aufsicht berechtigt. Auch konnte er die Einkünfte des Minderjährigen an sich nehmen,
aber er musste ihn angemessen versorgen und ihm das Vermögen bei Volljährigkeit ohne Schulden, so
136 „But when any one dies, leaving a younger son, and a Grandson, the Child of his eldest son, great doubt
exists, as to which of the two the Law prefers in the succession to the other...“ Glanville VII, 3 in: Beames,
Glanville, 158f. 137 Brunner, Erbfolgesystem, 32; Plucknett, Common Law, 716f. 138 Brunner, Erbfolgesystem, 33f. 139 Holdsworth III, 175; Plucknett, Common Law, 717f. 140 Brunner, Erbfolgesystem, 35f. 141 Brunner, Erbfolgesystem, 28; Plucknett, Common Law, 719-721. 142 Brunner, Erbfolgesystem, 37.
21
weit es Vermögen und Dauer der Aufsicht erlaubten, zurückgeben. Erbten Töchter ein Lehn blieben
sie so lange unter der Aufsicht des Lehnsherrn bis sie mit seiner Zustimmung heirateten.143
Zu erwähnen sei nochmals, dass Ehepaare sich nicht gegenseitig beerben konnten. Diese hatten nur
besondere Rechte beim Tod des jeweils anderen. Der Ehemann hatte das Recht der tenancy by the
curtesy of England144 und der Frau gebührte das dower. Wenn der Mann durch die Heirat Land als
Mitgift von seiner Frau bekommen hatte, so stand ihm dieses bei Tod der Frau zu, wenn diese ihm ein
Kind geboren hatte. Wahrscheinlich bezog sich dieses Recht auch auf Land, welches die Frau geerbt
hatte und nicht nur auf ihre Mitgift.145 Die Frau hingegen hatte das Recht des dower146. Dadurch erhielt
sie ein Drittel der Länderein des verstorbenen Gatten. Dieses konnte sie auch behalten, falls sie sich
nach Ablauf eines Jahres wieder verheiratete.147
Heimfall trat ein, wenn es keine gesetzlichen Erben mehr gab. 148
III) Ausblick In England gab es nie eine Rezeption des römischen Rechts wie auf dem Kontinent. Vom 12. bis zum
16. Jhd. wurde der Corpus Iuris Civilis in fast allen Ländern Mittel- und Westeuropas übernommen.
Um 1500 wurde dieser sogar in Schottland als geltendes Rechtsbuch eingeführt. England war zwar
erheblichen Einflüssen des rezipierten römischen Rechts ausgesetzt, aber König, Adel und Juristen
verschlossen sich gegenüber einer Aufnahme des römischen Rechts in das Common Law.
Dennoch weist die Entwicklung des mittelalterlichen Common Law in vielen Punkten Ähnlichkeit mit
der des römischen Rechts auf. Beide waren Juristenrecht, beide waren gespalten in eine ältere,
strengere und eine jüngere, nach Billigkeit strebende Schicht. Weiters dachte man sowohl in Rom als
auch in England nicht in Ansprüchen, sondern in Klagetypen. Beide waren daher von
aktionsrechtlichem Denken beherrscht.
Trotz des zeitlichen Abstandes von mehr als einem Jahrtausend ist in vielen weiteren Einzelheiten die
Entwicklung in parallelen Bahnen verlaufen.149
Rechtsgrundlage des Testamentsrechts ist auch heute noch im Wesentlichen der Wills Act 1837,
allerdings mit einigen Modifikationen. So wurde die Testierfähigkeit von ursprünglich 21 auf 18
herabgesetzt und Frauen dürfen seit 1882 ein Testament errichten.150 143 Crabb, Englisches Recht, 69. 144 Die Bezeichnung curtesy erschien erstmalig zur Zeit Edward I (1272-1307) in den French Year Books of
Edward I.`s age. Über die Ableitung des Namens herrschen unterschiedliche Theorien. Siehe Werp,
Ehegattenerbrecht, 30f. 145 Werp, Ehegattenerbrecht, 29. 146 Es gab fünf Arten von dower. Siehe Werp, Ehegattenerbrecht, 33-38; Holdsworth III, 189-197. 147 Werp, Ehegattenerbrecht, 33. 148 Crabb, Englisches Recht, 71f. 149 Peter, Actio und Writ, 66-68. Ausführlich siehe Peter, Actio und Writ; Holdsworth II, 145-149.
22
Rechtsgrundlage für die gesetzliche Erbfolge ist der Administration of Estates Act von 1925. Dieser
wurde inzwischen allerdings mehrfach geändert. Seit seinem Inkrafttreten wurde bewegliches und
unbewegliches Vermögen gleich behandelt. Auch wurde die Position des überlebenden Ehegatten
immer mehr gestärkt.151
150 Henrich/Huber, Privatrecht, 117. 151 Henrich/Huber, Privatrecht, 119.
23
IV) Bibliographie Baker, English Legal History = J. H. Baker, An Introduction to English Legal History (4.ed.), Oxford
New York 2007.
Baker, Sources = Baker and Milsom Sources of English Legal History Private Law to 1750 (2.ed.),
Oxford 2010.
Beale, Glanville = J. H. Beale, A Translation of Glanville, Washington 1900.
Bigelow, History of Procedure = M. M. Bigelow, History of Procedure in England from the Norman
Conquest, Boston 1880.
Bosworth, Dictionary = J. Bosworth, A Dictionary of the Anglo-Saxon Language, London 1838.
Brentano, Erbrechtspolitik = L. Brentano, Erbrechtspolitik, alte und neue Feudalität, Stuttgart 1899,
179-210.
Brunner, Erbfolgesystem = H. I. Brunner, Das anglonormannische Erbfolgesystem: Ein Beitrag zur
Geschichte der Parentelenordnung nebst einem Excurs über die älteren normannischen Coutumes,
Leipzig 1869.
Buhofer, Structuring the Law = St. P. Buhofer, Structurin the Law: The Common Law and the Roman
Institutional System, Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht 5/2007.
Crabb, Englisches Recht = G. Crabb, Geschichte des englischen Rechts, Darmstadt 1839.
Drout = M.Drout, Anglo-Saxon Wills and the Inheritance of Tradition in the English Benedictine
Reform in: Selim 10 (2000), 3-43.
Faith, Inheritance Customs = R. J. Faith, Peasant Families and Inheritance Customs in Medieval
England, in: The Agricultural History Review Vol. 14 No. 2 (1966), 77-95.
Gans, Erbrecht = E. Gans, Das Erbrecht in seiner weltgeschichtlichen Entwicklung, Band 4 Das
Erbrecht des Mittelalters 2. Teil, Stuttgart Tübingen (1835).
24
Haas/Hall, Writs = E. de Haas and G. D. G. Hall, Early Registers of Writs, Selden Soc., vol. 87,
London 1970.
Haertle, Probate Court = E. A. Haertle, The History of the Probate Court, in: Merquette Law Review
Vol. 45, 1962.
Hall, Glanvill = G. D. G. Hall (ed.), The Treatise on the laws and Customs of the Realms of England
Commonly Called Glanvill, Oxford (1993).
Henrich/Huber, Privatrecht = D. Henrich und P. Huber, Einführung in das englische Privatrecht, 2.
Aufl., Darmstadt (1993).
Holdsworth II = W. S. Holdsworth, A History of English Law, Vol. II, London (31923).
Holdsworth III = W. S. Holdsworth, A History of English Law, Vol. III, London (31923).
Letizia Lavizzari, Common Law und Civil Law. Ein Rechtsvergleich und seine Bedeutung für das
schweizerische Recht (Probearbeit in der Allgemeinen Staatslehre), Fribourg 2006.
Kocher, Privatrechtsentwicklung = G. Kocher, Grundzüge der Privatrechtsentwicklung und
Rechtswissenschaft in Österreich, Wien Köln Weimar 1997.
Liebermann, Gesetze = F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, 1. Band, Text und
Übersetzung, Halle 1903.
Liebermann, Angelsachsen = F. Liebermann, Die Geschichte der Angelsachsen, Halle 1912.
Meiers, Entwicklung und Reform der Sachmängelhaftung = Th. Meiers, Die Entwicklung und Reform
der Sachmängelhaftung des Verkäufers beim Stückkauf im deutschen Recht zwischen 1992 und 2008
unter vergleichender Berücksichtigung des englischen Rechts, Frankfurt am Main 2010.
Moffat, Trusts = G. Moffat, Trusts Law Text and Materials (4.ed.), Cambridge 2005.
Nichols, Britton = F. M. Nichols, Britton, The Frensh Text carefully revised with an English
Translation, Introduction and Notes, Oxford 1865.
Nicolas, Testamenta Vetusta = N. H. Nicolas, Testamenta Vetusta, 2 Volumes, London 1826.
25
Peter, Actio und Writ = H. Peter, Actio und Writ, Eine vergleichende Darstellung römischer und
englischer Rechtsbehelfe, Tübingen 1957.
Phillips, Angelsächsisches Recht = G. Phillips, Versuch einer Darstellung der Geschichte des
Angelsächsischen Rechts, Göttingen 1825.
Phillips, Rechtsgeschichte = G. Phillips, Englische Reichs- und Rechtsgeschichte seit der Ankunft der
Normannen im Jahre 1066 nach Christi Geburt, Erster Band, Berlin 1827.
Plucknett, Common Law = T. F. T. Plucknett, A Concise History of the Common Law, London 1956.
Plucknett, Legal Literature = T. F. T. Plucknett, Early English Legal Literature, Cambridge 1958.
P&M, English Law = F. Pollock/F. w. Maitland, The History of English Law Before the Time of
Edward I.
Radbruch, Rechtsvergleichende Schriften = G. Radbruch, Rechtsvergleichende Schriften, Heidelberg
1999.
Schirrmeister, Recht = G. Schirrmeister, Das Bürgerliche Recht Englands, Band I: Erstes Buch.
Allgemeiner Teil Erste Hälfte, Berlin 1906.
Schmid, Gesetze = R. Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen: in der Ursprache mit Übersetzung,
Erläuterungen und einem antiquarischen Glossar, Leipzig 1858.
Thieme, HRG = H. Thieme, Gemeines Recht, in: HRG I (1971), 1506f.
Thorpe, Diplomatarium Anglicum = B. Thorpe, Diplomatarium Anglicum Aevi Saxonici, London
1865.
Tollerton, Wills = L. Tollerton, Wills and Will-making in Anglo-Saxon England, York 2011.
Trulsen, Pflichtteilsrecht = M. Trulsen, Pflichtteilsrecht und englische family provision im Vergleich,
Tübingen 2004.
26
Turner, Glanvill =. R. V. Turner, Who was the Autor of Glanvill? Reflections on the Education of
Henry II`s Common Lawyers in: Law and History Review Vol. 8 No 1 (1990), 97-127.
Werp, Ehegattenerbrecht = S. Werp, Ehegattenerbrecht in England, Münster Studien zur
Rechtsvergleichung Bd. 33, Münster 1998.
Whitelock, Wills = D. Whitelock (Hrsg.), Anglo-Saxon Wills, Cambridge 1930.
Wolf, Ehegattenerbrecht = U. Wolf, Zum internationalen Ehegüter- und Ehegattenerbrecht in England,
Münster 1999.
Young, Family Law.=. E. Young, The Anglo-Saxon Family Law in: Essays in Anglo-Saxon Law,
Boston: Little, Brown and Company 1905.
Ziegenbein, Real und Personal Actions = U. Ziegenbein, Die Unterscheidung von Real und Personal
Actions im Common Law, Berlin 1971.
Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung = K. Zweigert/ H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung:
auf dem Gebiete des Privatrechts, 3. Aufl., Tübingen 1996.