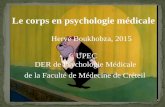Medizin, Psychologie und Beratung im Islam
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Medizin, Psychologie und Beratung im Islam
11
Einleitung
Eine umfangreiche Psychotherapie- und Beratungsszene,
wie sie sich in Europa und auf der Grundlage christlich-
jüdisch-humanistischer Traditionen herausgebildet hat, kennt
die islamische religiöse Tradition bislang nicht. Ratschläge
aus der Überlieferung der Sunna und der Hadithe halfen in
der Vergangenheit. Sie bestimmten Denken, Gefühls- und
Handlungsnormen der Menschen in den Ländern, in denen
der Islam die vorherrschende Religion war, wenn schwierige
Situationen zu bewältigen waren.
Religiöse und therapeutische Lebensdeutungen sind im Is-
lam nicht so ausdifferenziert aufeinander bezogen wie im
Umfeld des Christentums. Es werden zunehmend von Musli-
men Wege gesucht, um eine therapeutisch fundierte Therapie-
und Beratungspraxis im islamischen Kontext zu entwickeln.
Sicherlich gibt es bereits praktische und theoretische Überle-
gungen zur Nutzung westlicher Therapiekonzepte für die
Arbeit mit Muslimen. Westliche Therapiekonzepte werden in
der Regel auf ihren Nutzen befragt, den sie in der Anwen-
dung haben. Die jeweilige weltanschauliche Fundierung sol-
cher Konzepte wird kritisch gesehen oder abgelehnt.
Christlich-muslimische Begegnungen zeigen Ansätze zur
inhaltlichen philosophischen und religiösen Verständigung
über Psychotherapie und Medizin, Seelsorge und Beratung im
Horizont der beiden Religionen. Einige solcher Begegnungen
haben mich bewogen, eine Annäherung zwischen der Bera-
tungspraxis in den Traditionen des Sufismus und den moder-
nen »westlichen« Psychotherapie- und Beratungskonzepten
zu suchen. Literarische Beispiele aus islamischer Religions-
12
wissenschaft, Religionsgeschichte und Medizingeschichte
ergänzen die Ergebnisse meiner persönlichen Gespräche zum
Thema.
Begegnungen zwischen europäisch- christlichen Beratern
und Muslimen zeigen, welcher Weg bisher gegangen wurde.
In der Durchführung und Leitung interkultureller Arbeits-
gruppen habe ich erfahren, inwieweit auf beiden Seiten – der
christlichen wie der muslimischen – langsame, aber zugleich
wichtige Schritte im Verstehen des jeweiligen Gegenübers
möglich waren. Dies hat mich ermutigt, aus praktischen Er-
fahrungen literarische Schlüsse zu ziehen. Diese Schlüsse be-
anspruchen lediglich, Anstöße zum Weiterdenken zu sein,
keine fertigen Konzepte.
Zugleich möchte ich einen Überblick geben über Ansätze
zur Gestaltung der multikulturellen Betreuung, wie sie in
einzelnen Altenheimen durchgeführt wird oder in der Pla-
nung ist, über Beratungskonzepte im bikulturellen Setting
und informieren zur Situation von Psychotherapie und hel-
fendem Handeln in verschiedenen islamischen Kontexten.
Mit dem vorliegenden Buch möchte ich einen informativen
Einstieg in die historischen und aktuellen Grundlagen von
Medizinverständnis, von Vorstellungen über Seelsorge und
Beratung im Islam anbieten und gleichzeitig die Diskussion
kulturell divergenter und religionsverschiedener Beratungsan-
sätze anregen, wie ich sie bis jetzt mit persönlichem Gewinn
»narrativ« führen konnte.
Ich danke Herrn Dr. Ismail Altintas, Beauftragter für inter-
religiösen Dialog bei der DITIB, Köln, für Gespräche und
Zusammenarbeit, Herrn Dr. Dr. Ilhan Ilikilic, Mainz, für
Gespräche und das Überlassen von Literatur.
Mein Dank gilt Herrn Dr. Hansjörg Schmid, Studienleiter
der Akademie der Diözese Rottenburg – Stuttgart, für die
Bereitstellung von Literatur. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer meines Seminars »Ethik des Helfens im Kontext ver-
13
schiedener Religionen« an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt/Main im WS 2005/6 haben mit For-
mulierungen und Anregungen zu meinem jetzt veröffentlich-
ten Text beigetragen. Dies möchte ich dankend erwähnen.
Königstein im Januar 2007 Ulrike Elsdörfer
17
1 Gesundheit im Islam
In der auf dem Koran und den Lehren des Propheten Mo-
hammed fußenden Tradition rangiert an erster Stelle der
Leitsatz: Gesundheit und Wohlbefinden sind eine Gabe Got-
tes. Der Mensch muss verantwortlich mit ihnen umgehen.
Nach muslimischem Glauben ist der Körper und die Ge-
sundheit eine Gottesgabe, für die der Muslim gegenüber Gott
Verantwortung trägt. Der Mensch ist Inhaber und Nutznie-
ßer seines Körpers; Gott hingegen ist dessen Eigentümer. Es
ist eine islamische Pflicht, die Gesundheit zu bewahren und
gegebenenfalls für deren Wiederherstellung erforderliche
Maßnahmen zu treffen. Sowohl Krankheit als auch Heilung
finden für einen Muslim nicht ohne Kenntnis und Erlaubnis
Gottes statt. Die Krankheitserreger und die medizinischen
Maßnahmen sind Vermittler der Krankheit bzw. der Heilung,
deren erste Ursache Gott ist. Dem Muslim obliegt es jedoch,
sich erforderlicher und geeigneter Mittel zu bedienen, um von
Gott geheilt zu werden. Ein Krankheitszustand kann nach
islamischen Quellen als Prüfung Gottes oder als Gnadener-
weis und Sündenvergebung gedeutet werden. Obwohl das
Verständnis der Krankheit als Strafe Gottes nicht mit islami-
schen Quellen zu begründen ist, wird sie vom einen oder
anderen Muslim durchaus als solche wahrgenommen.1
1.2 Das Verständnis von Gesundheit im Islam
Ein gläubiger Muslim ist bereits durch die Befolgung der
18
grundlegenden Vorschriften seiner Religion auf dem Wege,
seine Gesundheit zu erhalten. Tägliche Gebete, die den gan-
zen Körper betreffen, und Fasten führen dazu, Leib und Seele
in ein Gleichgewicht zu bringen. Dieses Gleichgewicht ist nie
zweiseitig auf Körper und Seele und damit nur auf Vorgänge
im Menschen bezogen zu verstehen, als handele es sich hier
um ein besonders ausgewogenes, humanistisches Gesund-
heitskonzept. Sondern es geht um den Dreischritt: Körper-
Seele-Gott, der im Zusammenklang dieser drei verschiedenen
Komponenten gesehen werden muss, um das Gesundheits-
konzept des Islam wirklich zu verstehen. So konstatiert der
islamische Religionswissenschaftler und Mediziner Ilhan
Ilkilic:
»Der Heidelberger Medizinhistoriker Heinrich Schipper-
ges unterstreicht in seinem Buch ›Gesundheit und Gesell-
schaft‹ den philologischen Zusammenhang zwischen den
Begriffen Gesundheit und Islam: ›Wir haben zu berück-
sichtigen, dass der Islam die einzige Hochreligion ist, die
das Wort ›Gesundheit‹ bereits in ihrem Titel trägt und
damit diesen Zentralbegriff zum Fundament der Weltan-
schauung und Lebenshaltung gemacht hat. ›s,l,m = ›sa-
lam‹ bedeutet: ein rundum Wohlsein an Leib, Seele und
Geist, das Heile eben. Die Reflexivform von salam ist is-
lam, die Ganzhingabe an das Heile. Wer sich zu diesem
Heil bekennt, ist ein ›muslim‹«.2
Ausgehend von Quellen aus dem Koran, wird unterschieden
zwischen geistiger, seelischer und körperlicher Krankheit,
wobei der körperlichen Krankheit der weiter oben erwähnte
Wert einer Prüfung Gottes zukommen kann, während die
seelische Erkrankung vielfach als die Folge eines Abfalls vom
richtigen Glaubensweg gedeutet und damit tendenziell eher
verurteilt als behandelt wird. Ilkilic stellt fest:
19
»Auch wenn der Ausgangspunkt der lexikalischen und
metaphorischen Bedeutung des Begriffs Krankheit in die-
sen Versen ein nicht wünschenswerter Zustand ist, so ist
die koranische Beurteilung dieser beiden Zustände unter-
schiedlich, d.h. ein kranker Mensch und ein an Gottes
Existenz zweifelnder Mensch ( was synonym mit der Vor-
stellung von »seelischer Krankheit« gewertet wird, die
Verfasserin) sind nach koranischer Auffassung anders zu
bewerten. Während der erste Krankheitsbegriff, der des
Unglaubens und der Heuchelei, mit der göttlichen Er-
mahnung und Verdammnis in Zusammenhang steht, ist
der zweite Begriff Krankheit als solcher immer mit dem
Trost und der Barmherzigkeit Gottes verbunden. ›Er
weiß, dass es unter euch Kranke geben würde.‹ (Sure
73/20). Die Kranken sollen keine Gewissensnöte haben,
wenn sie ihren, von Gott auferlegten, religiösen und sozi-
alen Pflichten nicht nachkommen können ... ›Gott will
für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwer-
nis.‹« (Sure 2/185)3
Diese letztere Unterscheidung zwischen körperlicher und
seelischer Erkrankung und ihren Wertungen innerhalb des
religiösen Denkens wird auch noch weiterhin beschäftigen. In
der Geschichte des Christentums, und durchaus noch in sei-
ner gegenwärtigen Praxis, liegen ähnliche Wertungen vor.
In Bezug auf geistige Erkrankung wird innerhalb des Islam
die Auffassung vertreten, dass ein geistig erkrankter Mensch
nicht religionsmündig sei. Er müsse sich nicht vor Gott ver-
antworten und unterliege somit lediglich der Fürsorge seiner
Zeitgenossen, die im verständnisvollen Umgang mit ihm ihre
Religionspflichten erfüllen können.
Krankheit in ihrem Charakter als göttlich gegebenes
Schicksal muss von dem Gläubigen, wie alles, was Gott ihm
auferlegt, geduldig und annehmend ertragen werden. Es ist
Aufgabe der ganzen Gemeinde, besonders der Imame4, im
20
Rahmen von Seelsorge und Gebet dem Kranken auf diesem
Wege zu helfen. Sie sollen ihm jede Form der Auflehnung als
ein Unrecht gegen Gottes leitenden und gerechten Willen und
seine Fügungen vor Augen halten.
1.2 Geschichte der islamischen Medizin
In der antiken griechischen Medizin wird von einem
Grundkonzept über die Beschaffenheit des Menschen ausge-
gangen: Danach wird alle Nahrung, alle Flüssigkeit, die der
Mensch aufnimmt, durch einen Stoffwechselprozess in vier
Kardinalsäfte verwandelt: Blut, Schleim, gelbe und schwarze
Galle.
Wenn der Mensch krank ist, ist im Zusammenfluss dieser
Säfte eine Unordnung eingetreten. Je nachdem, wie der Fluss
und die Menge dieser Säfte beschaffen sind, entwickelt der
Mensch mit der Zeit ein spezielles Temperament: Diese jewei-
lige, in einer Person vorherrschende Gemütslage wird als
sanguinisch, phlegmatisch, cholerisch und melancholisch
bezeichnet. Bei der Entstehung von Krankheiten ist zu beach-
ten, von welcher Ausgangslage in der Mischung der Körper-
säfte der Behandelnde auszugehen hat, um die richtige Medi-
zin zu finden. In diesem Konzept wird in Ansätzen von einer
Vermischung von Körper- und Seelenzustand ausgegangen,
die als ein erster Ansatz zu einer psychosomatischen Medizin
betrachtet werden könnte. Diesem Ansatz wurde allerdings
nicht in allen Bereichen der islamischen Denktraditionen
weiter nachgegangen. Er wurde besonders in den im engeren
Sinne religiösen Betrachtungen islamischer Gelehrter nicht
wieder aufgenommen, bzw. bewusst ignoriert.
Die griechische Auffassung von einer Verbindung von leib-
lichem und seelischem Befinden durch die Beschaffenheit der
Körpersäfte fand weit mehr Eingang in die islamische Ge-
21
sundheitslehre als in das theologische Menschenbild. Ge-
sundheit wird verstanden als Ausfluss seelischen und geisti-
gen Wohlbefindens, also als Zusammenfluss aller positiven
Strömungen in den Körpersäften. Alles, was zur Erhaltung
dieses Zustandes seelischen und geistigen Wohlbefindens
beiträgt, ist als gut und nützlich zu werten.
»So heißt es, dass ein Mann nicht in einem Lande woh-
nen solle, in dem nicht folgende vier Dinge vorhanden
seien: ein gerechter König, fließendes Wasser, ein geeigne-
ter kundiger Arzt und Heilmittel«.5
Die Gesundheit ist in der Anschauung der islamischen Medi-
ziner ein natürliches Phänomen des Körpers und ein hohes
Gut für den Menschen. Hier ist zu unterscheiden zwischen
dem medizinischen und dem theologischen Menschenbild
und damit der Bedeutung der Gesundheit als oberstem Gut.
Für die islamischen Theologen ist Gesundheit immer ein
Ergebnis des guten Verhältnisses zu Gott. Damit steht Ge-
sundheit immer innerhalb der Triade Gott – Seele – Körper.
Sie ist nie nur ein Ergebnis immanenten Ausgleichs zwischen
Körper und Seele. Sie kann im Rahmen des zu entwickeln-
den Gottesverhältnisses als zweitrangig oder gar hinderlich
angesehen werden. Denn gerade der kranke Mensch sucht
mehr nach der Beziehung zu einem heilenden und helfenden
Gott.
Um das Jahr 1000 n. Chr. wurden die Zielsetzungen der
Medizin von islamischen Gelehrten unter zwei Gesichtspunk-
ten gesehen: Der Erhaltung der Gesundheit und der Heilung
der Krankheit. Diesen beiden Zielen ist das ethische Bestre-
ben des Arztes gewidmet, wobei der Arzt in religiöser Per-
spektive ein Instrument des Heilungswillens Gottes darstellt.
Wege der Erkenntnis für den Arzt liegen im eifrigen Studi-
um der Philosophie und auch der religiösen Quellen seiner
Religion. Weisheit, Gerechtigkeit, Großmut und Redlichkeit
22
gehören zur theoretischen und praktischen Qualität eines
guten Arztes. Es wird unterschieden zwischen dem Arzt, der
ein Studium der Philosophie, der Weisheit, hinter sich ge-
bracht hat, und dem, der zwar mit Kräutern und Methoden
heilen kann, aber keinen großen Fundus an Erkenntnis über
die Welt und den Menschen mit sich bringt. Der so genannte
»Philosophenarzt« nimmt in seiner theoretischen Begründung
Anleihen bei den griechischen Philosophen, der Heiler bei den
traditionellen Formen der Heilkunst in den Kulturen, in de-
nen der Islam heimisch wurde. Genuin islamisch ist in beiden
Vorstellungen nur der Verweis auf die Abhängigkeit aller
Heilkunst von dem ordnenden und leitenden Willen des einen
Gottes.
Zeitgleich mit den genannten Ansätzen, im 11. Jahrhun-
dert, tritt aber noch ein anderes Denken auf. Abu Said Ibn
Bahtisu kennt die griechische Philosophie und fordert, fußend
auf deren Annahmen, den weitergehenden Schritt der Tren-
nung von philosophischer Spekulation und empirischer Evi-
denz. Die Ärzte sollen am Krankenbett, in der sichtbaren,
fühlbaren und nachprüfbaren Welt der praktischen Erfah-
rung, ausgebildet werden, nicht in erster Linie aus den Bü-
chern der Philosophen.
»In seiner Gesundheitslehre (des Abu Said Ibn Bahtisu,
die Verfasserin) stehen Leib und Seele sehr eng zueinan-
der und sind durch psychosomatische Ansätze geprägt.
Ein Gesundheitszustand ist erst dann möglich, wenn so-
wohl der Körper und die Seele sich in ihrer ›natürlichen
Ordnung‹ befinden. Ein Abweichen vom natürlichen Zu-
stand bedeutet Krankheit. ›Der Mensch gehört in das
Reich der Lebewesen, besteht aus einer Seele und einem
Körper, wobei die Seele den Körper in ihre Dienste
nimmt, durch ihn wirkt und aus ihm heraus ihre Kräfte
enthüllt. Es ist offenbar, dass der Körper des Menschen
den Gegenstand aus verschiedenen Richtungen bemühen
23
muss und dass sie sich um die Erhaltung seiner Gesund-
heit und seines Wohls bemüht.‹
Abu Said Ibn Bahtisu widerspricht dem platonischen Du-
alismus und vertritt die Meinung, dass die Seelenheilkun-
de nicht zur Philosophie, sondern zum Tätigkeitsbereich
der Medizin gehört. Auch anders als Galen6 vertritt er die
Meinung, dass der menschliche Körper nicht gesund wer-
den kann, wenn die Seele von einer Krankheit befallen
wird ...
Mit seinem Gesundheitsbegriff ist Ibn Bahtisu ›viel weiter
als die griechische Medizin gegangen, indem er die seeli-
sche Ursache körperlicher Krankheiten feststellte, und
umgekehrt folgerte, dass jede seelische Krankheit auch
eine körperliche Krankheit sei. Ibn Bahtisu teilte daher
die Therapie in eine somatische und eine psychische auf,
die er beide zum Aufgabenbereich des Arztes rechne-
te‹.«7
200 Jahre später wird sogar innerhalb der islamischen Ge-
lehrten-Literatur von einem interkulturellen und interreligiö-
sen Konsens bezüglich der Wirklichkeit der Heilkunst gere-
det. Said Ibn Hassan schreibt:
»Immer waren die Völker sich einig, und es stimmen die
Zeugnisse durch richtige Analogie und fortdauernde Er-
fahrungen überein in den Vorzügen der Heilkunst, ihrer
Erhabenheit sowie dem (zwingenden) Bedürfnis der Men-
schen nach ihr. Dies beweisen die religiösen Gesetze, ver-
schieden wie sie sind, und die Glaubensrichtungen, fest-
stehend, wie sie sind.«8
Said Ibn Hassan bezieht sich auf den Propheten Mohammed,
von dem folgender Ausspruch tradiert wird:
»Die Wissenschaft besteht aus zwei Wissenschaften, näm-
24
lich der Wissenschaft von den Körpern (d.h. der Medizin)
und von den Religionen«.9
Für das Studium der Medizin wie auch der Religionswissen-
schaften ist für Said Ibn Hassan eine gesunde körperliche und
seelische Konstitution notwendig:
»Wenn es dem Arzt nicht gelungen ist, seine Gesundheit
zu bewahzren und seine Krankheit loszuwerden, so liegt
es nahe, dass er andere nicht heilen kann«.10
Bei der Wiederherstellung der Gesundheit arbeitet der Arzt
im Dienste der Natur, die Gott der Erhabene beauftragt hat,
die beseelten Körper gesund zu erhalten, ihre Zustände zu
verbessern und ihre Beschwerden zu heilen. Der Arzt ist im-
mer nur ein Diener der Natur.11
Hellenistische Auffassungen werden hier mit den Grundla-
gen des Islam verbunden. Natur ist die wesentliche Größe für
die Medizin, dennoch ist ursächlich die Wirkkraft Gottes
hinter der Anwendung und Einsicht in das Wirken der Natur
notwendig. Nur wenn er beides berücksichtigt, handelt der
islamische Arzt im Einklang mit seiner Religion.
In Bezug auf den Menschen, der gelegentlich zum Patien-
ten wird, gilt der von Medizinern und Theologen gleicherma-
ßen vertretene Ansatz: Gesundheit wird als Voraussetzung
betrachtet, um die Religion mit allen ihren Ansprüchen voll
leben zu können. Soziale, religiöse und familiäre Verpflich-
tungen können nur von dem Menschen entsprechend den
Grundforderungen des Islam erfüllt werden, der seiner Ge-
sundheit nicht durch falsche Lebensform schadet. Deshalb
gehört das richtige Verhalten zum Erhalt der Gesundheit
geradezu zum Katalog der religiösen Pflichten des Muslims,
steht ihnen allen voraus und wurzelt in dem Glauben an die
von Gott gegebene gute Schöpfung, die er verpflichtet ist, zu
bewahren.
25
1.3 Medizinische Gesundheitskonzepte im Islam
1.3.1 Hygiene
»Reinheit« ist einer der Zentralbegriffe des islamischen
Glaubens. Schon ein Hadith12 bezeugt, dass die Reinheit die
Hälfte des islamischen Glaubens ausmache. Sicher ist hier
sowohl an körperliche Vorgänge wie an seelisch-spirituelle
Vorgänge zu denken.
Leib und Seele gehören nach der gängigen islamischen
Anthropologie eng zusammen, und so ist es nicht verwunder-
lich, wenn in Texten des Korans ein religiöser Heilauftrag
und die dazugehörigen hygienischen Bestimmungen mit glei-
cher Bedeutung genannt werden. Im holistischen, streng mo-
notheistisch orientierten Menschenbild des Islam steht der
Mensch mit Leib und Seele, Handeln, Fühlen und Denken,
mit seiner Nahrung und seinen Gewohnheiten, Gott gegen-
über.
»Die Sauberkeit hat nämlich vier Stufen: Die erste Stufe
ist die Reinigung des Äußeren von Schmutz und Aus-
scheidungen, die zweite besteht darin, seine Glieder von
frevelhaftem und sündhaftem Tun fernzuhalten, die dritte
Stufe ist das Freiwerden des Herzens von Unsittlichkeit,
die vierte Stufe ist das Freiwerden des Herzens von allem
anderen außer Gott, dem Erhabenen. Diese vierte Stufe
ist die Reinigung nach Art der Propheten und der wahr-
haft Frommen«.13
Basierend auf klassischen Quellen unterscheidet man bis heu-
te im Alltag eines Muslims zwei Arten von Waschungen:
Ganz- oder Teilkörperwaschung.
Die Teilkörperwaschung findet vor den Gebeten statt, in-
26
dem Arme, Gesicht, Hände, Mund- und Nasenhöhlen sowie
die Füße gewaschen werden. Die Ganzkörperwaschung wird
nach dem Geschlechtsverkehr, nach der Menstruation und im
Wochenbett und öfter vor dem Freitagsgebet ausgeführt.
Waschungen stehen auch im Zusammenhang mit der Vorbe-
reitung und Durchführung der Pilgerfahrt, dem Hadsch.
Die Reinigungsvorschriften haben früh das Bild muslimi-
scher Städte geprägt. Ein Badezimmer oder ein Duschraum
gehört zu jedem Haus. Schon seit dem 7./8. Jahrhundert wa-
ren Badehäuser Bestandteile des muslimischen Stadtbildes. Sie
wurden oft unmittelbar in die Nähe der Moscheen gebaut.
Badehäuser dienten nicht nur der rituellen Reinigung, son-
dern auch der Gesundheitsvor- und fürsorge. Die feuchte
Wärme hatte einen lockernden und beruhigenden und ent-
spannenden Effekt, regte das Immunsystem an und bot auch
geistig-seelische Erholung. Badehäuser waren darüber hinaus
soziale Treffpunkte.
1.3.2 Diätetik
Ähnlich wie hygienische Vorschriften, finden sich auch
Hinweise zur Diät und zur Art der Ernährung bereits in den
Hauptquellen des Islam. Dabei ist gerade bei den Einschrän-
kungen der Nahrungsmittel interessant, dass der Prophet
Mohammed im Koran gegen die Sitten der arabischen Kultur
seiner Zeit vorgeht. Alkohol und Schweinefleisch gehörten
selbstverständlich zur arabischen Küche in der vorislamischen
Zeit. Somit bedeutete das Verbot dieser Nahrungsmittel einen
bewussten Einschnitt in das Erbe der Kultur, um sich von
dieser als neu entstandene Gemeinschaft zu distanzieren.
Der Opferkult war damals in Mekka eine gängige Praxis,
wobei die Opfertiere nicht verzehrt werden durften. Dies
entspricht den Handlungsanweisungen in den meisten Opfer-
ritualen der Religionen. Der Islam wendet sich gegen diese
27
Gewohnheit und erlaubt aus sozialen Gründen das Verteilen
des Fleisches von Opfertieren und dessen Verzehr.
Die Diätetik war nicht nur für die Gesundheitsvorsorge,
sondern auch für die Fürsorge wichtig. Die Behandlung be-
stimmter Krankheiten folgte nach den Qualitäten der Nah-
rung mit dem Ziel, Ausgleich und Harmonisierung der Kör-
persäfte zu schaffen. Für die Auswahl der Nahrungsmittel
und der Diäten, die im Rahmen von Therapien eingesetzt
werden konnten, lagen Vorgaben in der mündlichen Traditi-
on und in der Literatur bereit. Generell kann davon ausge-
gangen werden, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
von Krankheit und Heilmittel unter den immer kargen Be-
dingungen des Lebens beachtet werden musste.
»Wenn er (der Arzt) mit Nahrungsmitteln heilen kann, so
muss er Drogen meiden, und wenn er mit Drogen heilen
kann, so muss er das Operationsmesser meiden, es sei
denn, dass es unbedingt notwendig ist«.14
Ein zeitgenössischer islamischer Theologe äußert sich auf
türkischen Internet-Informationen über Gesundheit in der
Absicht, den Menschen auch heute aus dem Islam heraus zu
begründen, warum sie ihren Körper durch maßvolles und
gesundes Essen erhalten sollen: Sie erhalten damit die Gabe,
die Gott ihnen gegeben hat.
»Wir sollen unseren Umgang mit Essen, Trinken, körper-
lichen Aktivitäten und deren Entwicklung, Schlafen und
Ausruhen überprüfen und unsere Fehler hinsichtlich die-
ses Umgangs verbessern. Wir sollen reichlich Obst und
Gemüse zu uns nehmen und übermässiges Essen und ein-
seitige Ernährung vermeiden. Frische Luft und körperli-
che Aktivitäten sollen wir für wichtig halten und uns um
eine gesunde Entwicklung unserer Kinder kümmern ...«15
28
1.3.3 Ausgewogene Lebenshaltung
Im Koran wird darauf hingewiesen, dass der Mensch nach
einem bestimmten Maß geschaffen wurde und dass er des-
halb auch bestimmte Kriterien des Maßes einhalten soll.
»... und die, die, wenn sie spenden, weder verschwende-
risch noch zurückhaltend sind, sondern die Mitte dazwi-
schen halten. (Sure 25/67). Esst und trinkt und seid nicht
maßlos. Er liebt ja die Maßlosen nicht.« ( Sure 7/31).
Eine Lebensführung in Mitte und Maß wird in der islami-
schen Tradition als wichtigstes Prinzip angesehen. Ein gesun-
der Ausgleich der Körpersäfte macht seelisch und körperlich
gesund und ist die Voraussetzung für ein ausgeglichenes Got-
tesverhältnis. Die Lebensbedingungen in der Entstehungszeit
des Islam und der Umwelt zu dieser Zeit mögen mit zu sol-
chen Grundsätzen beigetragen haben. Allerdings lässt sich
auch auf den Einfluss des griechischen Denkens verweisen.
Ausgleich und Gleichgewicht verschiedener Kräfte im Zu-
sammenspiel für die Gesundheit von Körper und Seele sind
hier eine ebenso wichtige Voraussetzung.
1.3.4 Prophetenmedizin
Die Hadithe des Propheten in Bezug auf medizinische
Maßnahmen, Ernährung, Gesundheit und Krankheit sowie
Hygiene werden als so genannte »Prophetenmedizin« tra-
diert. Die Entscheidungen, Empfehlungen und Unterlassun-
gen des Propheten sind für einen Muslim bindend und haben
handlungsleitenden Charakter. Es existieren allerdings Debat-
ten darüber, inwieweit solche zeitbedingten Empfehlungen
und Meinungen späteren Deutungen und Auslegungen unter-
liegen. Da dem Propheten unterstellt wird, dass er nicht lügen
29
kann, haben auch seine Aussagen zur Medizin eine Wahr-
heitsbedeutung. Man überlegt, ob es Aufgabe der modernen
Naturwissenschaften sei, den wissenschaftlichen Wert der
Hadithe des Propheten zu untersuchen, um sie in den Dienst
der Menschheit zu stellen. Man meint aber auch durchaus,
alleine das Praktizieren der Empfehlungen, Verbote, Meinun-
gen des Propheten habe so etwas wie einen gottesdienstli-
chen, rituellen Wert.
»Die Argumentation der anderen Position, die den ver-
bindlichen Charakter der prophetischen Medizin bezwei-
felt, beinhaltet zwei Begründungsebenen. Zunächst er-
streckt sich der Zweck des Prophetentums nicht auf die
Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse. Vielmehr liegt
die Aufgabe darin, den Menschen die Gottesbotschaft zu
verkünden und aus dieser Botschaft ableitbare Glaubens-
prinzipien und deren praktische Implikationen aufzuzei-
gen«.16
In seinen Anfängen bildete der Islam in vielen Bereichen eine
grundlegende Neuerung. Und so war man geneigt, auch in
Sachen Gesundheit von dem Propheten Mohammed Neues zu
erfahren. Er aber betonte, dass seine nicht überall perfekte
praktische Erfahrung dazu führen könne, dass seine Aussagen
in die Irre führen. Wo experimentelle Erfahrung oder wissen-
schaftliche Kenntnisse Voraussetzung seien, müssten seine
Aussagen nicht als geltende Gesetze betrachtet werden.
Bücher über Prophetenmedizin werden noch bis heute ge-
schrieben und erfreuen sich durchaus eines hohen Ansehens
unter den Laien in der Bevölkerung islamischer Länder. Dies
ist sicherlich der Popularität der Hildegard – Medizin inner-
halb des christlichen Kontextes vergleichbar. Allerdings ist
die Rolle des Propheten und der verhältnismäßigen Unan-
tastbarkeit seiner Meinungen in der populären Perspektive
nicht mit der von Hildegard von Bingen zu vergleichen. Die
30
Aussagen der Prophetenmedizin sind allerdings für die Fach-
welt im Sinne einer normativen Quelle weitgehend uninteres-
sant geworden, wenn auch moderne Mediziner in Publikatio-
nen immer wieder auf die Rolle der Religion und der
Meinung des Propheten rekurrieren, um medizin – wissen-
schaftliche Positionen gegenüber den Menschen plausibler zu
machen. Letztendlich aber orientiert sich die Fachwelt der
islamischen Mediziner an den Standards der internationalen
Diskurse in der Medizin. Für sie rangieren an erster Stelle die
empirisch gewonnenen Resultate der wissenschaftlichen,
experimentellen Medizin und deren Ergebnisse.
1.4 Islamische Mystik und Medizin
In der islamischen Mystik wird die Gesundheit nicht als
das höchste Gut und nicht als die wesentlich Voraussetzung
für den Menschen und seine ganzheitliche Existenz gewertet.
In der Mystik existiert eine strengere, religiös gebundene
Lebensform und Weltanschauung, für die ein intaktes Got-
tesverhältnis zumindest in der Geschichte einen größeren
Wert als die äußere Gesundheit des Leibes darstellte. Es wird
sogar innerhalb der Denkweisen der islamischen Mystik an-
genommen, dass ein gesunder Mensch oft eher die Neigung
habe, seine Gesundheit zu genießen und das Gottesverhältnis
dabei gerade aufgrund seiner Sorglosigkeit zu vernachlässi-
gen. Was in der strengen koranischen Auslegung nicht so
deutlich anklingt, wird hier vorausgesetzt: dass der Mensch
getrennt zu betrachten ist in der Differenz von Leib und See-
le. Beide haben eine unterschiedliche Wertigkeit für die reli-
giöse Existenz, und so kann die Krankheit des einen, des
Körpers, für die Gesundung der anderen, der Seele, durchaus
vorteilhaft sein.
Ein solches Denken resultiert aus einem dualistischen
31
Menschenbild, wie es in der antiken Welt verschiedentlich zu
finden war, nicht unbedingt aber den primären Quellen des
Islam, dem Koran und den Hadithen des Propheten, zugrun-
de liegt. Islamische Mystiker nahmen in ihrem Menschenbild
Anleihen bei den umgebenden kulturellen Einflüssen, nicht
zuletzt bei den Christen und deren mystischen Strömungen
und deren dualistischen Menschenbildern.
So kann im dualistischen Verständnis, in dem Körper und
Seele voneinander getrennt sind, in dem Heilung des Körpers
und Heil der Seele nicht unbedingt im Einklang stehen müs-
sen, Krankheit eine heilsame Konsequenz für den Menschen
haben; sie kann seine Seele wieder näher zu Gott zurück zu
bringen, sie kann ihn läutern und in einem spirituellen Sinne
reinigen. Ein solcher Gedankengang taucht bereits in antiken
Quellen, bei Heraklit, auf, der die Vorteile der Krankheit zu
nennen weiß: »Krankheitserfahrung macht Gesundheit ange-
nehm und gut, Hunger, Sättigung, Ermüdung das Ausru-
hen.«17
Al Ghazzali (gest.1111), einer der bedeutendsten Gelehrten
des islamischen Mittelalters, hält die Medizin für eine wesent-
liche Wissenschaft für den Menschen, um sein Wohlbefinden
zu befördern. Er stellt jedoch auch fest, dass die Gesundheit
beim Menschen das Gefühl der Bedürfnislosigkeit und damit
indirekt das Empfinden der Überheblichkeit gegenüber Gott
fördern könne. Der Mensch erlebt dagegen, wenn er krank
geworden ist, seine Schwäche, seine Machtlosigkeit und seine
Angewiesenheit auf Gott. So ist die Krankheit nach Al Ghaz-
zali für den Menschen eine wichtige Erfahrung, die ihn erst in
seiner inneren Konstitution reifen lässt. Für Al Ghazzali ist es
sogar mit dem islamischen Glauben und dem postulierten
guten Schöpferwillen Gottes vereinbar, wenn ein Mensch
unter Umständen eine Therapie ablehnt, die doch im klassi-
schen Verständnis eine Mitwirkung am Heilungswillen Got-
tes bedeutet und damit nicht vom Menschen zurückgewiesen
werden darf.
32
Eine Therapieverweigerung ist dann zu rechtfertigen, wenn
im Erleben der Krankheit für den Menschen ein geistlicher
Gewinn liegt, der ihn über das alltägliche reine Vegetieren
erhebt. In diesem Zusammenhang wird sogar von dem Be-
griff »Einstellung einer geistigen Elite« gesprochen, d.h. von
der geistigen Entwicklung von Menschen, die freiwillig, im
Sinne einer Läuterung, Leidenszustände auf sich nehmen und
absichtlich nicht den Arzt zu bemühen.
Es wird davon berichtet, dass auch Mohammed in man-
chen Fällen darauf verzichtete, einen Mediziner zuzuziehen,
weil er sich und seinen Zustand direkt dem Handeln Gottes
an ihm aussetzen wollte.
»Da nun die Krankheit viele Vorteile mit sich bringt, ver-
treten manche die Meinung, man sollte nichts unterneh-
men, wodurch diese aufgehoben wird, weil sie darin ei-
nen Gewinn für sich sehen, nicht, weil sie es als Verlust
erachten, wenn man sich einer Behandlung unterzieht.
Wie könnte es auch ein Verlust sein, wo doch der Pro-
phet es getan hat!«18
Ein »elitäres« geistliches Selbstverständnis, dem auf jeden
Fall die Beziehung der Seele zu Gott an erster Stelle steht,
überwiegt hier. Die körperliche Gesundheit des Menschen
scheint für das Gottesverhältnis zweitrangig zu sein. Ein sol-
ches Selbstverständnis wurzelt in einer vorausgesetzten philo-
sophischen und theologischen Grundannahme: In diesem
Denken werden Leib und Seele in einem Gegensatz gesehen.
Sie ergänzen sich nicht gegenseitig. Die Seele wird gegenüber
dem Körper als höherwertig betrachtet.
Im anderen Fall, aus dem eher medizinisch-
naturwissenschaftlichen Blickwinkel, werden Leib und Seele
als komplementär erachtet und können nicht so klar als ver-
schieden bedeutsam für Gott angesehen werden. Beide zu-
sammen – Körper und Seele – bilden in ihrer Einheit erst das
33
Gegenüber zu Gott, der auch beide zusammen als gut und
gesund geschaffen hat und erhalten will.
Es ist nicht ganz leicht, die zum Teil aus dem 8. und 9.
Jahrhundert nach Christus kommenden, ursprünglichen Leh-
ren der islamischen Mystiker einem Diskurs über heutige
Gesundheitsverständnisse im Islam gegenüberzustellen. Die
Anschauungen der Mystiker müssen auf ihrem historischen
Hintergrund, auf ihrem Erwachsen aus hellenistischen Men-
schenbildern, aus hellenistischer Medizin und Psychologie,
aber auch aus den Einflüssen der christlichen asketischen
Strömungen gesehen werden. Es ist sinnvoll, die kommunitä-
ren Lebensformen der Sufis mit einzubeziehen, wenn man ihr
Menschenbild und die Ausprägung dessen, was sie über Kör-
per und Seele des Menschen lehren, verstehen will. Dies er-
fordert eigentlich eine weitläufige, vor allem religiöse Einord-
nung, die hier nicht geschehen kann. Dennoch ist es
unerlässlich, die islamische Mystik in Kurzform zu erwähnen,
da sie gerade mit ihrem Interesse an der inneren, seelischen
Entwicklung des Menschen eine Grundlage für »Psychologie
im Islam« gelegt hat. In dieser Hinsicht sollen einige Gedan-
ken aus der Geschichte des Sufismus19 zum Tragen kommen.
Sufis, Menschen, die sich in grobe Gewänder (Wollgewän-
der, wie der Name im Arabischen am ehesten zu deuten ist)
hüllten, lebten unter einfachen Bedingungen hauptsächlich
ein Leben der Hingabe an Gott. Sie suchten im »Dhikr«, im
täglichen Gottesgedenken, in der Anbetung des Gottesna-
mens in Gesang und Gebet, und in religiösen Übungen auf
einem »mystischen Pfad« ihre Seele zu erziehen, zu vervoll-
kommnen und sie immer mehr mit Gott zu vereinigen. Reli-
giöse Führer, die Scheichs, begleiteten Novizen und Fortge-
schrittene mit spirituellen Übungen und asketischen Auflagen
als Seelenführer und Pägagogen. In ihren Übungen ging es
einigen Sufis auch um die Ausdrucksformen des Körpers, vor
allem durch den Tanz bis zur Ekstase, so etwa den wohl be-
rühmtesten Sufis, den tanzenden Derwischen. Allerdings wa-
34
ren solche extremen Ausdrucksformen der Seele in der Nähe
Gottes nie den Anfängern erlaubt, sondern nur denen vorbe-
halten, die schon einen gewissen Weg ihrer seelischen und
religiösen Reifung hinter sich hatten.
Die Sufis verrichteten, wie alle Muslime, ihre täglichen
Gebete und alle anderen Grundpflichten ihrer Religion. Dar-
über hinaus aber entdeckten und verfolgten sie spezielle Ziele
eines heiligen und geheiligten Lebens. Es ging ihnen in abge-
wandelter Form um einen Weg der Selbsterkenntnis, der Läu-
terung von individuellen Leidenschaften und der Reifung der
Seele, sodass sie sich dem Ziel, Gott im Rahmen der Selbster-
kenntnis immer näher zu kommen, im Laufe der Zeit besser
widmen konnten. Ihre Psychologie hatte also ein religiöses
Ziel. Dabei gingen sie davon aus, dass die Seele des Men-
schen in ihrem ursprünglichen Zustand in einem Gegensatz
zum Guten steht, dass die Seele ohne pädagogische Anleitung
und Übungen nur ihren triebhaften Neigungen folgt und dass
sie dazu angetan ist, zum Bösen aufzureizen. Wenn aber der
Mensch diesen triebhaften Zustand seiner Seele erkennt und
beginnt, sich dagegen zu erheben, entwickelt sich in seiner
Seele eine Phase der Selbstanklage. Schließlich führt die Ent-
wicklung der Seele im dritten Schritt, in der Überwindung
und Beherrschung der Leidenschaften dazu, dass sie ihren
Frieden findet.
Dieser Dreischritt der seelischen Entwicklung ist als die
Psychologie der Sufis zu betrachten. Sie wurzelt direkt in
deren theologischem Verständnis:
»Der Koran hatte dem Menschen einen sehr hohen Platz
angewiesen, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Die Sufis
aber beschäftigten sich intensiv mit den verschiedenen
Aspekten des Menschen. Die Handlungen der göttlichen
Allmacht werden am Menschen durchgeführt; er ist, wie
Rumi20 so treffend sagt, ›das Astrolab der Eigenschaften
der Erhabenheit‹«.21
35
Die Mystiker haben viele Wege gefunden, um diesen hohen
Rang des Menschen zu beweisen. Einer ihrer Lieblingsverse
ist daher: »Und wir werden euch unsere Zeichen in den
Horizonten und in euch selbst zeigen – seht ihr denn nicht?«
(Sura 41/53) – ein Vers, den sie als Befehl Gottes auffassten,
in ihr eigenes Herz zu blicken, um dort die Quellen des Wis-
sens und schließlich den göttlichen Geliebten zu finden, der
dem Menschen ›näher als die Halsschlagader‹ ist ( Sura
50/16).
Bisher wurde hier die islamische Mystik vor allem aus his-
torischen Quellen betrachtet. Selbstverständlich ist die mysti-
sche Bewegung innerhalb des Islam nicht nur als vergangen
zu verstehen. Es ist bekannt, dass nach der Gründung der
modernen Türkei durch Atatürk im Jahre 1925 die Sufi-
Orden in diesem Land verboten wurden. Sufismus lebt aber
weiter in Ägypten und vielen Ländern Asiens, selbstverständ-
lich auch in der Türkei.
»So haben einige mystische Führer in der Türkei, die
schweigend, aber intensiv ihren Freunden die alles umfas-
sende Liebe predigen und danach leben, eine Anzahl von
Jüngern angezogen. Ähnlich ist es in anderen muslimi-
schen Ländern, obgleich in manchen der Einfluss des
›Dorfheiligen‹ oder des mystischen Führers groß genug
ist, selbst politische Entscheidungen zu beeinflussen. An-
dere geistige Meister, vor allem in Nordafrika, sind stark
genug, selbst hochgebildete Europäer anzuziehen. Martin
Lings Buch ›A Sufi Saint of the Twentieth Century‹ gibt
einen guten Eindruck von dieser geistigen Welt, ähnliche
Biographien könnten auch über andere Mystiker zwi-
schen Istanbul und Delhi geschrieben werden.«22
In Europa gibt es interessierte Interpreten der Lebensformen
des religiösen Anliegens des Sufismus; es existieren auch Sufi-
Gemeinschaften; eine sehr berührende Feier eines Dhikr er-
37
Islam und westliche Wissenschafts-Diskurse
Seit dem 18. Jahrhundert, als auf breiterer Basis von Euro-
pa Interesse an muslimischen Ländern gehegt wurde, gibt es
auch einen philosophischen und naturwissenschaftlichen
Austausch im Bereich der Medizin zwischen beiden Kulturen.
Nachdem im Mittelalter eine Blüte der islamischen Medi-
zin zu verzeichnen war, und diese damit Europa überflügelte,
geriet nun das Verhältnis zur Medizin als Naturwissenschaft,
wie sie in Europa entdeckt worden war, in eine andere Di-
mension für die Muslime. Vielfach war der »kulturelle Aus-
tausch« durch militärische Usurpation der europäischen
Mächte erzwungen worden. Menschen in muslimischen Län-
dern sahen ein, dass sie sich dem »Fortschritt« und dem
Denken des Westens und Europas nicht entziehen konnten.
Reformbewegungen entstanden, innerhalb derer die Gesell-
schaften den europäischen Einflüssen ausgesetzt wurden. Es
wurden Stimmen laut für die Emanzipation und schulische
Bildung der Frauen, gegen das Tragen des Schleiers24, der als
nicht zu den Inhalten des Islam genuin zugehörig entdeckt
wurde.
Der Islam und seine Interpretationsmöglichkeiten beschäf-
tigten auch die, die, auf dem Boden ihrer Religion, die »west-
liche Medizin« bedachten und begrüßten.
»Die allgemeine positive Einstellung des Islam zu den
Natur- und Geisteswissenschaften einerseits, die von der
islamischen Wissenschaftsgeschichte bezeugt wird, und
der unverkennbare säkulare Charakter der modernen
Wissenschaften und ihre Anwendungsformen anderer-
38
seits, die oft mit den Grundnormen des Islam kollidieren,
bestimmen bis heute die Hauptpositionen dieser Diskur-
se. Zweifelsohne haben diese Ansätze einen klaren Ein-
fluss auf die Argumente, die im Rahmen der bioethischen
Diskussion vertreten sind. Diese Positionen können grob
in zwei Hauptgruppen aufgeteilt werden.«25
Die Mehrheit derjenigen, die von islamischer Perspektive auf
die modernen Naturwissenschaften sehen, betrachten diese
als wertfrei. Sie sehen die in diesen Wissenschaften ange-
wandten Methoden als neutral und objektiv an, frei von vor-
gegebenen ideologischen Komponenten. Es wird auch nicht
unterstellt, dass die Anwendung naturwissenschaftlicher Me-
thoden genuin »westlich« sei und damit in der Vorgabe poli-
tisch festgelegt. Es gibt nur gute und schlechte Ziele und Er-
gebnisse, die man mit diesen Methoden erreichen kann.
Solange durch den Islam vertretene gute Ziele mit modernen
naturwissenschaftlichen Zwecken erreicht werden, sind sie
vertretbar.
Viele islamische Betrachter gehen davon aus, dass trotz
heutiger Wissenschaftserkenntnisse und Techniken zentrale
Probleme der Menschheit nicht auf diese Weise gelöst werden
können. Sie empfinden die modernen Naturwissenschaften
nur als eine Weiterentwicklung der von den Muslimen schon
im Mittelalter gefundenen Lösungen in der Medizin, die da-
mals von Europa übernommen wurden. Sie gehen davon aus,
dass die heutige Rückständigkeit der muslimischen Länder im
Bereich der Naturwissenschaften und Technik nur dadurch
entstanden ist, dass sich die Muslime zu sehr von der Religi-
on abgewandt haben. Eine neue Beschäftigung mit den Quel-
len des Glaubens würde demnach auch die Quellen zur Be-
wältigung der Welt neu sprudeln lassen.
Anders wurde in der Geschichte über den Islam als eine
wissenschaftsfeindliche Religion geurteilt, als es um die poli-
tische Abschaffung und Zurückdrängung der Religion in der
39
Türkei ging. Hier wurden nicht die Wissenschaften auf dem
Boden der Wahrheiten des Islam gesehen, sondern der Islam
wurde eher nach den Kriterien der Naturwissenschaften und
Gesellschaftswissenschaften zur Zeit Atatürks gewertet. Für
Atatürk galt:
»Für alles auf der Welt, ob für materielle Dinge, ob für
geistige Dinge, für das Leben oder für den Erfolg, ist die
Wissenschaft, die Naturwissenschaft, der wahre Wegfüh-
rer; außerhalb der Wissenschaft und der Naturwissen-
schaft nach einem Wegführer zu suchen, ist Gedankenlo-
sigkeit, Ignoranz und ein Abweg«.26
Insgesamt betrachtet kann, auf dem Hintergrund der einen
oder anderen Argumentation, davon ausgegangen werden,
dass sich die Menschen in islamischen Ländern nicht den
modernen Naturwissenschaften und damit der Nutzung der
modernen Medizin verschließen. Schon im Rahmen des Os-
manischen Reiches wurden Wissenschaftler und Studenten
zum Austausch und Studium nach Europa geschickt.
In Bezug auf heutige Debatten über Biomedizin und Gen-
technik lassen sich folgende religiöse Positionen finden: For-
schungstätigkeit an der Schöpfung Gottes ist nichts anderes
als ein Versuch, die Zeichen Gottes zu verstehen und dies
sogar als eine Tätigkeit im Rahmen der religiösen Pflicht zu
betrachten. Es gibt somit eine Forschungspflicht im Bereich
der Gentechnik, die der Menschheit neue Horizonte eröffnet
hat. Sich dieser Forschung zu verschließen, sie begrenzen zu
wollen, bedeute, die Schöpfungsgewohnheiten Gottes gerade-
zu zu verdunkeln.27
Ähnliches wie für die Forschung innerhalb der Gentechnik
gilt auch für die humangenetischen Forschungen mit Embry-
onen. »Für gute Zwecke« sind sie zu befürworten und beför-
dern das Schöpfungswerk Gottes, für das der Forscher dann
zum positiven Instrument werden kann.
40
Gegen die euphorische Vereinnahmung der Wissenschaften
für die Religion steht die kritische und distanzierte Betrach-
tung anderer Forscher, wenn es um die atheistischen oder
religions-neutralen Begründungen der Naturwissenschaften
und ihrer Methoden geht. Da diese Wissenschaften in Europa
auf weitgehend säkularem Boden gewachsen sind, ist schon
nach ihrer Fundierung im Rahmen eines Glaubenssystems,
bzw. ihrer Position in diesem kritisch zu fragen. Ihr Wissen-
schaftsverständnis, ihre Ziele und Inhalte müssen erst auf das
islamische Wissenschaftsverständnis, auf das islamische Men-
schenbild und seine Wertvorstellungen hin überprüft werden.
Danach müsse die Wissenschaft sich messen lassen an der
Ethik, die aus den Lehren der Religion resultieren. So gab es
hier auch kritische Stellungnahmen zu »Wissenschaft und
westlicher Technik«. Zwischen verschiedenen Versuchen, die
Offenbarungsqualitäten der Religion mit den Vorgaben und
Methoden der empirischen Wissenschaften zu »versöhnen«,
wird von den muslimischen Denkern hin und her manövriert
und gedanklich operiert.
Es gibt immer wieder gänzlich kritische Positionen, die den
Koran nicht als ein Lehr- und Empfehlungsbuch für Biowis-
senschaften umgedeutet haben möchten. Er sei eine Schrift
mit normativem ethischem Inhalt, und in dieser Hinsicht
kollidiere er mit Methoden und Möglichkeiten moderner
empirischer Humanwissenschaften. Dies sei als Dissonanz zu
respektieren. Ebenso werden gelegentlich die Sichtweisen der
Biologie als ideologisch angesehen, das Menschenbild der
Biologie als »despotisch«. Es gäbe einen Unterschied zwi-
schen islamischem und biologischem Menschenbild. Dies zu
betrachten, erfordere eine schnelle intellektuelle Auseinander-
setzung mit den jetzigen und in der Zukunft möglichen gen-
technischen Anwendungen.28
Die kasuistischen Entscheidungsformen der konventionel-
len Urteilsbildung und ihre klassische Bedeutung im prakti-
schen Leben der Muslime sowie die von der europäischen
41
postmodernen Philosophie nicht unberührten wissenschaftli-
chen Diskussionen in der islamischen Welt müssen als Ein-
flussfaktoren bei der Entstehung dieser unterschiedlichen
Positionen betrachtet werden.
»Aus der heutigen Perspektive ist es nicht leicht, die zu-
künftige Entwicklung und Wirkung dieser Ansichten auf
die bioethischen Debatten zu prognostizieren. Anderer-
seits ist es unschwer vorherzusagen, dass die modernen
bioethischen Problemfelder wie Stammzellenforschung,
Klonen des Menschen u. a., einen Diskurs über die nor-
mativen Begriffe wie Menschenwürde, Person, Leiblich-
keit, Integrität auch in der innerislamischen Diskussion
unverzichtbar machen werden. Diese Erfordernis scheint
jedoch ohne eine gewisse hermeneutische Sensibilisierung
für die islamischen Hauptquellen schwierig zu leisten zu
sein.«29
2.1 Medizin und Gesundheit innerhalb der modernen Kultur islamisch geprägter Länder
E-Health ist neben E-Medizin der Umschlagplatz des In-
ternets für international diskutierte Meinungen zu Gesund-
heit und Wellness.30 E-Medizin benutzt das Internet eher für
akademisch betriebene Biomedizin in Forschung und Lehre,
während für E-Health der medizinische Laie der Adressat ist.
Im Folgenden werden die Themen betrachtet, die in türki-
schen, arabischen und persischen Internet-Seiten von Fach-
personal für interessierte Laien rund um das Thema Gesund-
heit angeboten werden. Es fällt auf, dass, abgesehen von den
Publikationen im türkischen Bereich, auch von medizinischen
Fachleuten und Naturwissenschaftlern gerne auf religiöse
Bezüge, Vorschriften und Traditionen rekurriert wird, um die
42
eigene vorgestellte Meinung plausibel zu machen. Das Einbet-
ten eines naturwissenschaftlich begründeten Diskurses in
einen traditionellen, dem Leser geläufigen Kontext scheint die
Akzeptanz des Gesagten deutlich zu erhöhen.
E-Health umfasst Internetbereiche, die verständlich über
Gesundheitsvorsorge und -verbesserung, insbesondere in
medizinischen Aspekten, und über Behandlung von Krank-
heiten, informieren, ohne den Besuch des Arztes ersetzen zu
wollen.
Auf türkischen Internet-Seiten wird unterschieden zwi-
schen »Männergesundheit«, »Frauengesundheit« und »Kin-
dergesundheit«. Es gibt natürlich auch andere, etwa an den
zu behandelnden Symptomen orientierte Auflistungen. Diese
genannte Rubrik aber lässt erahnen, wie sehr hier eine an
tradierten gesellschaftlichen und familiären Vorstellungen
orientierte Gesellschaft angesprochen wird.
Chronische Erkrankungen wie Diabetes werden immer
wieder im Hinblick auf ihre Bedeutung und Behandlung im
Rahmen der Erfüllung religiöser Pflichten dargestellt. (Fasten
im Ramadan – mit Diabetes und entsprechender die Gesund-
heit erhaltender Diät?) In der Türkei spielt Sport im Rahmen
der Erhaltung der Gesundheit eine ähnliche Rolle wie in Eu-
ropa, in arabischen und persischen Gesundheits-Erklärungen
ist der Sport kein wesentlicher Faktor für die Gesundheit der
Menschen.
Im Bereich der türkischen Informationen wird stark mit
Werbung gearbeitet, der Informationswert dahinter muss
manchmal erst evaluiert werden. Es ist interessant, dass sich
keine türkische Internet-Seite über einen generellen Begriff
von Krankheit und Gesundheit äußert, schon gar nicht religi-
onsspezifische Aspekte behandelt. Dies heißt aber nicht, dass
es keinen derartigen Begriff gibt. Der den Gesundheitsinfor-
mationen zugrunde liegende Begriff ist von einem naturwis-
senschaftlichen Denkansatz geprägt. Krankheit wird dem-
nach als eine messbare Abweichung von einem
43
durchschnittlich definierten biologischen Funktionieren ver-
standen und hat für den Menschen einen Leid zufügenden
Charakter. Deshalb muss die Krankheit kuriert werden, unter
anderem auch, damit der Patient wieder zur durchschnittlich
von ihm geforderten Leistung fähig wird. Es wird weder der
Begriff von Leid problematisiert noch wird in Frage gestellt,
inwieweit gängige Leistungsvorstellungen kulturell oder für
den jeweiligen Menschen sinnvoll sind.
Es geht hier, ähnlich wie in Europa, nicht um eine norma-
tive Funktion von Krankheit, sondern um eine funktionale
Definition. Bei 90% der evaluierten türkischen Internet-
Seiten spielen die islamische Religion, das durch sie geprägte
Glaubens- und Krankheitsverständnis und die aus diesem
System sich ableitenden Handlungsnormen keine Rolle.
Von einem türkischen Professor für islamische Theologie
wird für den Umgang mit der Gesundheit ein Prophetenaus-
spruch zitiert: »Unser Körper ist ein erforderliches Mittel
für unser Leben. Er ist ein unsere Seele tragendes Reittier.
Unsere Verpflichtung besteht darin, dass wir unseren Kör-
per vor Krankheiten schützen, ihm sein Recht geben, ihn
sehr gut pflegen. Essen, Ausruhen, medizinische Fürsorge,
Vorsorgeuntersuchungen und therapeutische Maßnahmen
sind dafür erforderlich.«31 Die genannten Aussagen beinhal-
ten die zwei wichtigsten Definitionen der Gesundheit für
den muslimischen Glauben: Gesundheit als Voraussetzung
für die Erfüllung der religiösen Pflichten und Gesundheit als
einer Gabe Gottes. Muslimsein definiert sich dadurch, dass
eine religiöse Praxis möglich ist, die Gebets- und soziale
Aufgaben übernimmt. Daher muss der Mensch, der solchen
Anforderungen nachkommt, körperlich und seelisch gesund
sein. Bewahrung und Wiederherstellung der Gesundheit sind
also Mitarbeit am Aufbau der Religion und an der Schöp-
fung Gottes.
Basierend auf seinem theologischen Gesundheitsverständ-
nis gibt der Professor der islamischen Theologie seinen Lesern
44
Empfehlungen zum Umgang mit ihren Ärzten und mit sich
selbst:
»›Ich empfehle meinen sehr verehrten Lesern und sehr ge-
ehrten Geschwistern (im Islam), dass sie bitte sehr enge
Beziehungen zu den Ärzten pflegen mögen. Sie sollen die
Ärzte sowohl finanziell als auch emotional unterstützen
und dabei ihre Gesundheit sehr sorgsam bewahren. Me-
dizinische Vorsorge, Prävention und (richtige) Hand-
lungsweisen bezüglich der Krankheiten sind sehr wich-
tig.‹32 Der Autor schließt mit dem Appell: ›Liebe
Geschwister (im Islam), ich bitte Euch um Achtung Eurer
physischen und metaphysischen, seelischen sowie körper-
lichen Gesundheit‹«.33
Die Empfehlungen des Theologen erinnern an eine Auflistung
von sechs nicht natürlichen Dingen, die sowohl in der abend-
ländischen als auch in der morgenländischen Medizinge-
schichte zu finden sind. Zusätzlich werden hier medizinische
Kontrolluntersuchungen empfohlen. Dies verweist auf die
große Wertschätzung der empirischen Wissenschaft auch für
den Theologen, zeigt aber gleichzeitig die Gebundenheit der
Hinweise an die Tradition. In diesem Zusammenhang ist zu
beobachten, dass auch die Prophetenmedizin immer wieder in
die Internet-Seiten Eingang findet. Es werden da Hygiene-
maßnahmen und Hinweise auf Früchte und andere Nah-
rungsmittel aus den Fundus der Überlieferungen des Prophe-
ten gegeben.
Bioethische Fragestellungen, die differenzierte naturwissen-
schaftliche Vorkenntnisse voraussetzen, werden eher selten in
der Öffentlichkeit diesen Internet-Seiten vorgestellt. Im Hin-
blick auf die Debatte um Hirntod und Organtransplantation
ist zu beobachten, dass sich auf die ethische Befürwortung
der Organspende zurückgezogen wird. Organspende ist im
Sinne der sozialen Seite der islamischen Lehren eine geradezu
45
humanistische Verpflichtung des Muslims, wobei die Debatte
um die Definition des Hirntodes in den Hintergrund tritt.
Themen, die in Bezug zu Sexualität, Sexualhygiene, männ-
licher Beschneidung stehen, finden in vielen Internet-Seiten
Beachtung, zumal für diese in der traditionellen Gesellschaft
selten öffentlich diskutierten Fragestellungen ein noch nicht
wirklich befriedigtes Diskussions-Interesse zu existieren
scheint.
Auch die arabischen Empfehlungen unterscheiden zwi-
schen »Männer«-, »Frauen«- und »Kindergesundheit«, blei-
ben aber nicht in der laizistischen, naturwissenschaftlich fun-
dierten Debatte stehen. »Islamische Medizin« (die
Aussprüche und Empfehlungen des Propheten), »Arabische
Medizin und Naturheilmethoden« und »Heilung durch Ge-
bet« sind weitere Diskussionthemen dieses Forums. Auch in
diesen Veröffentlichungen wird ein Begriff von Gesundheit
vorgestellt. Gesundheit ist ein Zustand des mentalen, psychi-
schen und sozialen Wohlbefindens. Es liegt ein ganzheitliches
Menschenbild vor, das alle Bereiche des Menschen umfasst.
Lebensqualität wird durchaus als ein Schlüsselbegriff angese-
hen.
Religion wird generell als wichtig angesehen, Koran-Verse
unterstreichen das. Die Ärzte benutzen kulturell- religiöse
Argumente oder beschreiben Handhabungen als gesundheits-
fördernd, die in der Eigenverantwortung des Patienten liegen
und in der Regel ideell aus religiösen Vorschriften gespeist
sind. Ergebnisse der modernen Medizin werden von der mus-
limischen Leserschaft in diesem Rahmen der Einbettung in
religiös-kulturelles Erbe wahrgenommen, sie werden hier
nicht als fremd erlebt und werden im Kontext der religiösen
Vorstellungen des Alltags verstanden.
Geister und Dämonen sind noch lange nicht aus dem ge-
samten Krankheits- und Gesundheitskonzept dieser Empfeh-
lungen verschwunden. Der Einfluss des bösen Blicks und der
Dämonen auf die psychisch-körperlichen Zustände des Men-
46
schen ist ein weitgehend akzeptierter Glaube in der islami-
schen Kultur. Manchmal wird dieser Glaube als hinderlich
für eine angemessene Diagnose und Therapie diskutiert,
manchmal werden aber religiöse Heilmethoden wie das Ge-
bet zum Schutz vor Dämonen, die einige Krankheiten und
Anomalien am Menschen verursachen sollen, als ein zur Ge-
sundheit gehörendes Thema und als Behandlungsmethode
angesehen.
Neue und technisch-naturwissenschaftlich hergestellte
Therapiemethoden brauchen manchmal religiöse Legitimati-
on. In-vitro-Fertilität wird als nicht islamisch abgelehnt, aber
generell wird Unfruchtbarkeit als eine Krankheit angesehen,
die Gott und der Prophet nicht gewollt haben. Sie kann daher
mit einigen Methoden behandelt werden. So können Eingriffe
in körpereigene Prozesse und die Behandlung der Frau durch
einen männlichen Arzt mitunter als religiös unproblematisch
angesehen werden, wenn es dem legitimierten Ziel dient.
Handlungsbestimmend ist die Religion in der Gesellschaft,
was durch die arabische Sprache deutlich wird. Die religiöse
Sprache wird aber nicht unbedingt als ein Widerspruch zur
Wissenschaftlichkeit der Medizin empfunden.
Manche Krankheiten, wie AIDS, stehen noch immer unter
dem Bann religiöser Verurteilung. AIDS gilt als eine Strafe
Gottes, da diese Krankheit in Zusammenhang mit einem
Tabubereich der islamischen Gesellschaft, der Sexualität,
steht.
Persische Internet-Seiten bewegen sich im Verständnis von
Krankheit und Gesundheit, von Nutzung naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse, in einem Zwischenbereich zwischen den
arabischen und den türkischen Veröffentlichungen.
Gesundheit aus dem Internet ist für islamische Gesellschaf-
ten noch eine Neuheit. Daher bleibt offen, welche Rolle die
dort vorgestellten Informationen im gesamten Kontext der
Gesellschaften spielen können, in denen sie gelesen werden.
Dennoch werden sie rezipiert, und es lässt sich mindestens
47
aus dem Texten ein Vorverständnis derer entnehmen, die
dort veröffentlichen. Da das Internet ein weitläufig genutztes
Medium in islamisch geprägten Gesellschaften ist, kann da-
von ausgegangen werden, dass Publikationen im Internet
»Meinung machen« werden, bzw. bereits auf einen erwarte-
ten und eruierten Konsens hin formuliert wurden.
Nutzen und Risiken dieser Form medizinischer und ge-
sundheitsmäßiger Aufklärung stehen nahe beieinander.
2.2 Islam und Psychologie
Vom neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Medizinver-
ständnis innerhalb islamischer Kulturen soll nun noch einmal
ein Blick in die Geschichte geworfen werden. Nicht nur der
Körper, auch die Seele unterlag einem spezifischen Begriff
von Gesundheit (und Krankheit):
»In seiner Gesundheitslehre (des Abu Said Ibn Bahtisu,
die Verfasserin) stehen Leib und Seele sehr eng zueinan-
der und sind durch psychosomatische Ansätze geprägt.
Ein Gesundheitszustand ist erst dann möglich, wenn so-
wohl der Körper und die Seele sich in ihrer ›natürlichen
Ordnung‹ befinden. Ein Abweichen vom natürlichen Zu-
stand bedeutet Krankheit.
Mit seinem Gesundheitsbegriff ist Ibn Bahtisu »viel wei-
ter als die griechische Medizin gegangen, indem er die
seelische Ursache körperlicher Krankheiten feststellte,
und umgekehrt folgerte, dass jede seelische Krankheit
auch eine körperliche Krankheit sei. Ibn Bahtisu teilte
daher die Therapie in eine somatische und eine psychi-
sche auf, die er beide zum Aufgabenbereich des Arztes
rechnete.«34
48
Mit dieser fortschrittlichen, weitgehend empirischen Betrach-
tung des Menschen und seiner Gesundheit bzw. Krankheit ist
der islamische Mediziner des 11. Jahrhunderts richtungwei-
send für seine Kultur geworden. Seine Ansichten übertrafen
damals bei weitem das in Europa in dieser Hinsicht entwi-
ckelte Denken und Forschen.
Nerven- und Gemütsleiden wurden in vielen antiken Kul-
turen in die Nähe des Wirkens dämonischer Mächte angesie-
delt. Damit waren sie zugleich einem empirischen Zugriff
entzogen, und der betroffene Mensch war in seiner Verant-
wortung für seine Krankheit entlastet. Gleichzeitig waren
aber beide auch stigmatisiert, d.h. es konnte aus den genann-
ten Positionen heraus kaum eine Weiterentwicklung im Sinne
von Behandlung und Heilungsversuchen entstehen.
So blieben seelische Erkrankungen oft unbehandelt, die Pa-
tienten wurden weggesperrt und verwahrt. Das Leben wurde
ihnen so erträglich wie möglich gemacht, das Gemüt beru-
higt.
Annemarie Schimmel bemerkt:
»Man darf ja nicht vergessen, dass im islamischen Mittel-
alter Nerven- und Geisteskrankheiten oft durch Musik-
anwendung behandelt wurden, wie es schon Avicenna
empfiehlt. Das Bassin im Irrenhaus neben der großen
Moschee in Divrigi (Anatolien, erbaut 1228), wo das
Wasser eine süße, beruhigende Melodie hervorbrachte,
oder die Bayezid Külliyesi in Edirne (gebaut 1730) mit
ihrer Musikhalle im Irrenhaus sind gute Beispiele dafür,
wie Musik bei medizinischer Behandlung verwendet
wird.«35
Der Begriff der »Psychologie« beschränkt sich nicht auf die
medizinische oder philosophische Definition von seelischen
Anomalien. Es geht in erster Linie sogar um die Beschreibung
der Möglichkeiten und Funktionen der Seele, ihre Beschaf-
49
fenheit und mögliche Bezogenheit auf andere Faktoren au-
ßerhalb ihrer selbst.
Mehrmals ist bereits das islamische Konzept vom »Drei-
schritt der Seele« angeklungen. Die Seele, zunächst in ihrer
natürlichen, »animalischen« Beschaffenheit im Menschen
wirkend, braucht den äußeren Anstoß, die Herausforderung
aus Normen und geistigen Qualitäten, um sich ihrer Trieb-
haftigkeit bewusst zu werden. Ist das geschehen, so beginnt
ein Prozess der Selbstbeobachtung, der Selbst- oder Fremd-
Erziehung der Seele. Wenn sie diesen Prozess durchlaufen
hat, findet die Seele einen inneren Ausgleich, ihren Frieden.
Die Tätigkeiten und Qualitäten der menschlichen Seele
werden dabei nicht allein immanent gesehen, sondern im
Gegenüber zum transzendenten, herausfordernden Fragen
Gottes. Selbst der Ausgleich zwischen Körper und Seele, als
homöostatischer Zustand beschrieben, wurde in der Ge-
schichte der Kulturen nicht ohne die transzendente Einwir-
kung göttlicher Kräfte erreicht.
Ein ausgeglichener Gesundheitszustand zwischen Körper
und Seele als zu erreichendes, wünschenswertes Ziel ist si-
cherlich aus der griechischen und römischen Antike bekannt
(mens sana in corpore sano36). Aber auch dieser Zustand ist
in diesem Kontext nicht anders zu denken als auf dem Hin-
tergrund der Einwirkung göttlicher Eigenschaften. Dennoch
wurde bereits damals im griechisch-römischen Umfeld der
Sport, der Körper und Seele gleichermaßen trainiert und ver-
bindet, hoch angesehen.
Psychologie als eine »Lehre von der Seele« im Verhältnis
zum Körper als einzigem Gegenüber ist eine neuzeitliche Vor-
stellung. Die Annahme, es gehe in der Medizin und ihren
Anwendungen und Therapien um einen immanenten Aus-
gleich von Gegensätzen, im Idealfall um eine durch Medizin
hergestellte Gesundheit ohne das Einwirken übernatürlicher
Kräfte, geht nicht konform mit den Religionen. Dennoch
erwachsen aus dieser Annahme eines immanenten Ausgleichs
50
die meisten modernen Menschenbilder, die um die Belastbar-
keit und den Nutzen des Menschen für die jeweiligen Gesell-
schaften kreisen – um seine physische und psychische Kom-
patibilität zu geforderten Erwartungen an ihn.
»Psychologie im Islam«, also innerhalb des Kontextes der
Religion, ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem Psycholo-
giebegriff westlicher Gesellschaften. Daher ist es auch vorei-
lig, eine Methodendebatte über mögliche Erfolge bestimmter
»Methoden« der Psychologie anzuregen. Dennoch werden
sich alle islamischen Gesellschaften nicht auf Dauer dem Sog
des globalisierten Lebens entziehen können und wollen, in
denen sich neue Fragestellungen, immer wieder neue Men-
schenbilder und methodische Zugänge zum Menschen mit
ihren speziellen ideologischen Vorgaben entwickeln. Diese
Menschenbilder werden als schweigende, faktische Realität
neben den alten religiösen Quellen bestehen, und es wird
sinnvoll sein, geistige Brücken zwischen beiden zu suchen.
»Methode ist ein Weg zur Wirklichkeit« – das ist eine der
Annahmen hinter den psychologischen Menschenbildern und
deren Praxis, wie sie in westlichen Gesellschaften bekannt
sind. Für das Christentum haben Theologen, Psychotherapeu-
ten und Psychologen in den vergangenen 50 Jahren Wege
gesucht, eine Vereinbarkeit von religiös fundiertem Denken
und den in der Regel agnostisch orientierten Humanwissen-
schaften herzustellen. So existieren, ausgehend von grundle-
genden deutschen und anderen europäischen Studien, variie-
rende Konzept zur intellektuellen und praktischen
Annäherung von Theologie und Tiefenpsychologie37. Dies
setzt sich fort in der theologischen Reflexion aller nachfol-
genden Methoden, die aus der Tiefenpsychologie hervorge-
gangen sind.
Es wird zu fragen sein, inwieweit dies auch für die »Psy-
chologie im Islam« gilt – sowohl für deren religiös motivierte,
tradierte Antworten wie für aktuelle Fragestellungen in isla-
misch orientierten Gesellschaften.
51
2.2.1 Psychologie in der islamischen Mystik
Unter der Überschrift »Der Mensch und sein Weg zur
Vollkommenheit«38 gibt Annemarie Schimmel Auskunft über
die Psychologie in der Geschichte des Islam, besonders seiner
mystischen Strömungen. Diese repräsentieren in Hinsicht auf
Menschenbild und Gedanken über individuelle Seelenführung
den Islam in breiter Hinsicht.
»Die Stellung des Menschen im Islam, und ganz beson-
ders im Sufismus, ist ein Kontroversthema für westliche
Gelehrte. Einige waren der Überzeugung, dass der
Mensch als Gottes ›Diener‹ oder ›Sklave‹ vor dem All-
mächtigen keinerlei Wert habe; er verschwindet fast, ver-
liert seine Persönlichkeit und ist nichts als das Instrument
eines unwandelbaren Geschicks. Der Begriff des Huma-
nismus, auf den die europäische Kultur so stolz ist, wäre
diesen Gelehrten zufolge dem islamischen Denken grund-
sätzlich fremd«.39
Vorherbestimmung und freie Wahl der eigenen, selbst ver-
antworteten Handlungen – eine Thematik, die auch die
christliche Theologie immer wieder bewegt hat, bestimmt die
Überlegungen der islamischen Theologen.
»... während der Mensch die Wahl zwischen Gehorsam
und Rebellion genießt – oder unter ihr leidet (obgleich
diese Wahl durch die Vorherbestimmung begrenzt sein
mag). Dem Menschen wurde die ›amana‹ gegeben (Sura
33/73), jenes anvertraute Gut, das zu tragen Himmel und
Erde sich weigerten. Dieses Gut ist verschiedenartig in-
terpretiert worden – als Verantwortlichkeit, Willensfrei-
heit, Liebe oder Kraft der Individuation«.40
So ist dieser Weg der Individuation der Weg nach innen,
52
der »mystische Pfad« der Sufis. Er ist die Reise in das eigene
Herz, wo der Suchende am Ende im »Meer der Seele« seinen
Frieden findet.41
In dem liebenden Herzen, in dem der Sufi Ruhe findet, lebt
Gott. Das Herz ist der Spiegel, in dem Gott sich anschauen
kann, aber es muss zu diesem Zwecke mit Übungen der As-
kese ständig »poliert« werden, sodass aller Staub und Rost
verschwinden und das ewige Licht sich klar reflektieren kann.
In anderen Quellen wird von einem »Zerbrechen des Her-
zens« angesichts der Nähe Gottes gesprochen:
»›Wo immer eine Ruine ist, ist Hoffnung auf einen
Schatz – warum suchst du nicht den Schatz ›Gott‹ in dem
verwüsteten Herzen?‹ Attar spricht auch oft davon, dass
Zerbrechen ein Mittel ist, Frieden und Einheit zu erlan-
gen – der zerbrochene Mühlstein dreht sich nicht länger,
und der Puppenspieler im Ushturname zerbricht alle Fi-
guren, die er benutzt hat, und legt sie in die Schachtel
›Einheit‹ zurück«.42
Eine Sufi-Geschichte mag verdeutlichen, welche Dimensionen
die Psychologie in den Traditionen der Mystiker annehmen
kann:
»Gott schuf die Herzen siebentausend Jahre vor den Lei-
bern und bewahrte sie in der Station der Nähe zu Sich;
und Er schuf die Geister siebentausend Jahre vor den
Herzen und bewahrte sie im Garten der Vertrautheit mit
Sich; und Er schuf die innersten Bewusstseinsteile sieben-
tausend Jahre vor den Geistern und bewahrte sie im Gra-
de der Vereinigung mit Sich. Dann setzte er das innerste
Bewusstsein im Geist gefangen, den Geist im Herzen und
das Herz wiederum im Leibe. Dann prüfte Er sie und
sandte Propheten, und so begann jedes von ihnen wieder
seine eigene Station zu suchen. Der Leib beschäftigte sich
53
mit dem Gebet, das Herz erlangte Liebe, der Geist gelang-
te zur Nähe des Herrn, und das innerste Bewusstsein
fand Ruhe in der Vereinigung mit Ihm«.43
55
3 Seelsorge im Islam
»Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen
sind untereinander Freunde.
Sie fordern zum Guten auf und verwehren Böses
und verwirklichen das Gebet und geben die Armen-
abgabe und gehorchen Gott und Seinem Gesandten.
Ihrer erbarmt sich Gott. Gott ist mächtig, weise.«
Koran, Sura 9,71
»Im Islam gibt es keine institutionalisierte Seelsorge«44 –
das ist – noch – eine gängige Auffassung unter den Muslimen.
Es wird auch in dieser Form von den Christen vertreten, die
sich der Seelsorge im Islam zuwenden.
Solange es diese institutionalisierte Seelsorge im Sinne der
Beschäftigung eines Imams, einer islamischen Seelsorgerin
oder Theologin zur Begleitung von Menschen in Kranken-
häusern, Altersheimen und Gefängnissen noch nicht oder nur
selten – zumindest in Europa – gibt, werden wenige Konzepte
für Beratung und Seelsorge auf der Basis psychologischer
oder psychotherapeutischer Theorien in islamischen Kreisen
diskutiert. Die Begleitung eines Menschen, der im Rahmen
einer speziellen Institution Rat sucht, gestaltet sich in ähnli-
cher Form wie jedes andere Seelsorge-Gespräch. Ein solches
Gespräch leitet sich her von der religiösen Motivation des
Beraters, der seine Sensibilität und Einfühlung selbstverständ-
lich in die Situation hinein geben muss.
Theoretisch gehört es im Islam im Rahmen der eigenen
Fähigkeiten dazu, »Gutes zu fördern und Böses zu unterbin-
den«, indem man den Mitmenschen zur Seite steht, füreinan-
56
der betet, Kranke besucht, sich um Gefangene kümmert,
Sterbende und Trauernde nicht allein lässt.
Dies alles ist ausgerichtet auf die theologische Annahme,
dass der recht geleitete Muslim, wenn er nach den Vorschrif-
ten seiner Religion lebt, zur der »Glückseligkeit in beiden
Wohnstätten«, in diesem und dem nächsten Leben, Zugang
erhält.45 Eine solche Annahme basiert auf der Lehre des Ko-
rans und der Auslegungsgeschichte von Hadithen (mündlich
überlieferten Aussprüchen) des Propheten.
In gewachsenen Dorfgemeinschaften oder in Großfamilien
war es bisher kein Problem, Menschen zu finden, auf die man
sich in Fällen von Krankheit, Konflikten und Problemen be-
rufen konnte. Spezielle Seelsorge und Beratung von Men-
schen auf der Basis der religiösen Tradition übten auch Sufis
in ihren Tekken (Kloster – ähnlichen Wohngemeinschaften)
aus oder in Karawansereien.46
Mit der zunehmenden Veränderung einiger islamischer Ge-
sellschaften wird aber eine ähnliche Entwicklung zur Speziali-
sierung der religiösen Hilfs-Angebote eintreten, wie sie sich
im Christentum entwickelt hat.
Eine besondere Rolle spielten traditionell die Lehrerinnen
und Lehrer der Religion, die Imame; daneben geht vor allem
von den Sufis mit ihren mystischen Traditionen, in denen
man sich mit der spirituellen Entwicklung des einzelnen be-
fasste, ein wichtiger Einfluss auf die Seelsorge aus.
»Der Grund, warum gerade der Imam, der als Vorbeter
und Religionsbeauftragter in der muslimischen Gemeinde
fungiert, diese Aufgaben übernimmt, ist, dass an mehre-
ren Stellen im Koran dieses als eine allgemeine Pflicht der
muslimischen Gemeinschaft und ihres Vorstehers, aufge-
zählt wird«.47
57
3.1 Seelsorge im Krankheitsfall
Wenn ihm bekannt wird, dass eine muslimische Schwester
oder ein muslimischer Bruder sich in stationärer Behandlung
befindet oder zu Hause erkrankt ist, nimmt man Kontakt zu
diesem Menschen auf und besucht ihn. Wenn es sich um eine
muslimische Schwester handelt, holt man sich vorher die
Erlaubnis der Verwandten ein. Im persönlichen Bericht wur-
de erwähnt, dass in solchen Fällen die Ehefrau des Imams
Besuche bei erkrankten Frauen übernimmt, wenn sie das
möchten. Die Inhalte eines Krankenbesuches sind neben dem
Gespräch über das persönliche Befinden die rituellen Gebete
bzw. die Durchführung oder Hilfestellung bei rituellen Wa-
schungen, wenn der Kranke dazu nicht selbst in der Lage ist.
Ersatzhandlungen für die rituellen Pflichten können bespro-
chen werden. Kranke dürfen während einer Krankheit nicht
fasten, sind also von einer rituellen Pflicht ausgenommen,
können diese aber nach der Genesung nachholen.
Trotz des Fastenmonats Ramadan sollen sich Kranke kei-
ner notwendigen Untersuchung entziehen. Es ist wichtig, dem
Kranken deutlich zu machen, dass Gott den Gläubigen die
Erfüllung religiöser Pflichten während ihrer Krankheit er-
leichtert. Wenn möglich, spricht der Imam mit dem Kranken
über die Inhalte des Glaubens, er rezitiert die 36. Sure des
Korans. Hier werden die Eigenschaften der Schöpfung geprie-
sen, das Leben im Jenseits beschrieben. Die Auflehnung ge-
genüber Gott wird verboten und Geduld mit der Krankheits-
zeit geboten.
Falls der Kranke die Suren des Korans aufsagen kann, soll
er das tun; denn man glaubt, dass die Rezitation der Suren
des Korans heilende Wirkung habe. Ein türkisches Sprich-
wort sagt: »Die Erde und der Himmel werden mit Gebeten
aufrechterhalten«.48 Wenn ein Moslem stirbt, ist es wichtig,
mit ihm und für ihn das muslimische Glaubensbekenntnis zu
rezitieren. Wenn der Sterbende selbst das Glaubensbekennt-
58
nis sagen kann, so ist das ein Beweis dafür, dass er ein guter
Mensch war und in ständiger Beziehung zu Allah steht. Die
Aufgabe des Imams ist es auch, die Angehörigen zu trösten,
den Toten zu waschen als Vorbereitung auf dem Weg zu
Gott.
Das irdische Leben ist eine Prüfung, deshalb ist das Ende
des irdischen Lebens der Anfang des Lebens im Jenseits. Lei-
den in der Welt verringert die Strafen im Jenseits nach der
Auffassung des Islam.
Die beschriebene, in der tradierten Religion verwurzelte
Seelsorge erfordert im Gegenüber einen gläubigen Moslem.
Wenn der Gesprächspartner nicht so religiös ist, erfolgt die
Annäherung in seelsorgerlicher Hinsicht eher neutral- über
sein Befinden oder ein ihn interessierendes Thema, sodass
nicht der Eindruck von Missionierung entsteht. Es geht dar-
um, Trost zu spenden, nicht eine Notlage religiös zu überhö-
hen.
3.2 Seelsorge in Gefängnissen
Seelsorge in der Strafanstalt versteht Altintas als eine reli-
giös wegweisende Tätigkeit. Es werden auch soziale Aufga-
ben übernommen.
Der Imam möchte durch seine Präsenz dem Häftling das
Gefühl nehmen, Außenseiter zu sein. Er möchte seine Schuld-
gefühle lindern durch Verweis auf die Güte Gottes. Er möch-
te erreichen, dass der Häftling seinen Aufenthalt im Gefäng-
nis als Chance zum Umdenken begreift, als einen
Lernprozess. Trotz seiner engen Zelle soll der Häftling einen
weiten Horizont erhalten. Der Imam soll den Häftling für die
Gesellschaft »wiedergewinnen«.
Dazu sieht der Imam eine Verpflichtung, sich um die Ver-
sorgung mit muslimischer Kost zu bemühen, Botengänge zu
59
erledigen oder sich der Angehörigen des Häftlings anzuneh-
men.
Außer dieser spezialisierten Seelsorge übernimmt der Imam
auch die »Alltags-Seelsorge.« Nach den Gebeten in der Mo-
schee kommen die Menschen zu ihm. Er ist telefonisch und
über Internet erreichbar.
Das vorgestellte Konzept von Ismail Altintas beschreibt die
Situation der derzeit in Deutschland ausgeübten Seelsorge
unter den Muslimen. Halima Krausen schildert in den ein-
gangs erwähnten Passagen die ursprüngliche Ausgangslage
für Seelsorge und Zuwendung zu Menschen in Krisen,
Krankheiten und Notlagen, wie sie in den traditionellen isla-
mischen Gesellschaften vorkommen.
3.3 Perspektiven für islamische Seelsorge in Europa
Auch Krausen rekurriert auf die gesellschaftliche Wand-
lung sowohl in orientalischen wie europäischen islamischen
Gemeinden:
»Während diese Strukturen auch im Orient immer mehr
in den Sog des Großstadtmilieus geraten, haben sie in
Deutschland, wo es erst seit der Zeit des Wirtschafts-
wunders Muslime in größerer Zahl gibt, noch gar nicht
wachsen können. Erst allmählich entsteht aus den zu-
nächst improvisierten, dann weitgehend auf die Bedürf-
nisse der unmittelbar eigenen Gemeinde zentrierten Mo-
scheen eine übergreifende religiöse Infrastruktur. Zu den
Kaufleuten, Studierenden und Arbeitsmigranten und ih-
ren Familien, die ursprünglich nicht auf einen dauerhaf-
ten Aufenthalt eingestellt waren, ist eine neue Generation
hinzugekommen, die in Deutschland aufgewachsen, in
60
verschiedenen Berufsgruppen tätig und in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen aktiv ist. Es gibt Dachorganisatio-
nen, die nach außen Interessen vertreten. Es entstehen
Organisationen, an die man sich mit rechtlich-ethischen
und theologischen Fragen wenden kann, und für Bera-
tung und Seelsorge gibt es auch Menschen, die über ent-
sprechende Ausbildungen verfügen«.49
Ihre Aufgabe wird es immer mehr sein, das Leben zwischen
den Werten mehrerer Kulturen und Sichtweisen für die Mus-
lime zu erleichtern. Die Muslime können ihre eigene religiöse
Konzeption von Gemeinschaft nicht mehr wie im türkischen
Dorf und in der Großfamilie leben, mit allen Einbindungen
und Verpflichtungen, sondern sie müssen Wandlungen
standhalten, in denen ihre eigenen Komplexitäten und Wider-
sprüche enthalten sind. In diesem Spannungsfeld bekommen
soziale Probleme, Familienkonflikte und Veränderungen in-
nerer Überzeugungen eine andere Dimension. Fragen nach
erlebter Diskriminierung treten auf, Armut und Arbeitslosig-
keit belasten die Menschen, die nicht mehr in ihrem früheren
Umfeld aufgefangen sind.
Es gibt zunehmend bi-kulturelle Familien. Damit werden
Ehe- und Generationenkonflikte oft zum Kulturkampf, be-
kommen die Intensität eines Weltuntergangs, wenn das Kon-
kurrenzverhältnis zwischen Christentum und Islam eine Rolle
spielt. Vorurteile tragen zu diesem Szenario bei und bewirken
Abwehr, Flucht in Traumwelten, ungeduldige Suche nach
Wurzeln, Resignation und psychosomatische Krankheiten. Es
entwickelt sich die Frage nach dem geographischen und dem
religiösen Woher; damit wandelt sich das Verständnis des
Islam.
»Immer wieder begegne ich Menschen, in denen sozusa-
gen zwei Persönlichkeiten nebeneinander bestehen: eine
traditionelle, verbunden mit der Muttersprache, und eine
61
deutschsprachige mit Bildern und Erfahrungen vom Le-
ben als Muslim in diesem Land, und es geht darum, zwi-
schen beiden eine Brücke zu bauen, mit dem zentralen
Prinzip des Islam als Pfeiler«.50
Es stellt sich die Frage für die Muslime: Wohin gehe ich?
Die Berufswahl kann in Konflikt geraten mit wirtschafts-
ethischen Prinzipien des Islam. Die Wahl des Ehepartners
wird nicht mehr nach traditionellen Werten stattfinden (Mit-
sprache der Eltern), die Sorge für die alten Menschen be-
kommt eine andere als die traditionelle Dimension. Es gibt
wenige Hilfen für ethische Entscheidungen außerhalb des
Generationenkonfliktes in der Familie – keinen islamischen
Religionsunterricht.
»Eine ganze Generation junger Muslime muss sich so gut
wie allein und ohne Leitbilder durch einen regelrechten
Werte- und Normendschungel kämpfen, begleitet von
vielen traumatischen Erfahrungen und Ängsten.« 51
Die Ängste übertragen sich oft auch auf das Gottesbild ...
Befürchtungen und Hoffnungen sind ... direkt mit diesen
Orientierungsfragen verbunden. Es geht um die Frage, ob
Entscheidungen und Pläne richtig oder falsch sind in Bezug
auf eine religiöse Zukunft, und damit entstehen Gewissens-
ängste.
Im Islam gibt es keine Beichte. Es wird nur die Hinwen-
dung zur Barmherzigkeit Allahs erwartet, sodass der Gläubi-
ge auf seine Vergebung hoffen kann. Es gibt keine pastorale
Instanz, wenn auch der Imam eine stellvertretende Rolle ein-
nimmt. Er vertritt aber die Gemeinde der Gläubigen, nicht
Gott in irgendeiner sakralen Weise. Jeder einzelne Moslem
hat seine unmittelbare Beziehung zu Gott, in der es keine
religiösen Vermittler gibt.
Beide ReferentInnen, Krausen und Altintas, reflektieren zu-
62
letzt, ob ihre Form der Seelsorge auch in einem islamischen
Land möglich wäre bzw. ob ein nicht-islamischer Seelsorger
einem Moslem weiterhelfen könne:
»Krausen: ›Dazu muss ich sagen, dass ich mich in ver-
schiedenen Ländern aufgehalten habe und einen Teil von
dem, was ich zu meiner Arbeit brauche, dort gelernt ha-
be. Grundsätzliche Hindernisse habe ich nicht gesehen,
wenn ich die Sprache verstehe und mit den gesellschaftli-
chen Spielregeln vertraut bin‹. Altintas: ›Muslimische Kranke zweifeln daran, dass ein
nicht-muslimischer Seelsorger diese Aufgabe erfüllen
kann, da ein Anhänger einer anderen Religion keine aus-
reichende Unterstützung bieten kann ... Einige Kranke
denken, sie liefen Gefahr, der nicht-muslimische Seelsor-
ger könnte sie von seinem eigenen Glauben überzeu-
gen‹.«52
3.4 Konfliktfelder in der Begegnung mit muslimischen Patienten
Grundsätzliche Erwägungen zum Selbstverständnis als
Muslum beschäftigen den Mediziner Ilhan Ilkilic, wenn er
formuliert:
»Das Erleben von Schamgefühl und Intimitätsverständ-
nis beeinflusst bei einem Muslim die Wahrnehmung sei-
nes Körpers als Leib und impliziert zugleich im gesell-
schaftlichen Leben einige Handlungsformen ... Die
Bedeckung des Körpers und das Vermeiden von Körper-
kontakt mit Fremden gewinnen durch die islamischen
Wertvorstellungen einen normativen Charakter ... Bei ei-
nem Arztbesuch oder Klinikaufenthalt bleibt jedoch ein
63
körperlicher Kontakt während einer Untersuchung oder
Therapie unumgänglich. Ein Krankheitsfall wird in der is-
lamischen Rechtslehre als Ausnahmezustand verstanden,
in dem manche islamische Handlungsformen, die im All-
tagsleben Gültigkeit besitzen, diese verlieren oder durch
eine Lockerung teilweise und vorübergehend außer Kraft
gesetzt werden können.
So wird eine medizinische Untersuchung durch einen Arzt
oder eine Ärztin gleichen Geschlechts bevorzugt, ist aber
nicht unabdingbar, wenn dies nicht möglich ist. So kann
ein Händedruck, der für den Arzt und das Pflegepersonal
Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft
verkörpert, für eine muslimische Patientin peinlich und
unangenehm sein oder sogar aufdringlich wirken.
Um dieses Konfliktfeld zu konkretisieren, einige Beispiele:
Ein muslimischer Patient von 60 Jahren war eine Zeitlang
gelähmt und musste im Krankenhaus vom Pflegepersonal
gepflegt und gewaschen werden. Später erzählte er von seinem Krankenhausaufenthalt: ›Nicht die Krankheit war
mir das Schlimmste, sondern von einer fremden Frau ge-
pflegt und gewaschen zu werden.‹«53
Speisevorschriften beziehen sich auch auf die angewendete
Medizin. Sie sollte keinen Alkohol enthalten und nicht auf
der Anwendung von Gelatinepräparaten o. ä. basieren, die
aus Schweinen gewonnen worden sind. Eine Überlieferung
sagt:
»Gott hat gegen jede Krankheit ein Heilmittel herab ge-
sandt. Also behandelt diese, aber nicht mit etwas Verbo-
tenem. Es gibt allerdings auch den Grundsatz ›Notlagen
heben Verbote auf‹.«54
Um zu einer Entscheidungsfindung im Falle einer Behandlung
zu kommen, spielt es für Muslime eine wichtige Rolle, die
64
Familienangehörigen zu befragen. Ebenso ist der Besuch der
Familie ein bedeutender sozialer Ausdruck innerhalb des
islamischen Habitus.
Im Krankenhaus kommt oft die unzureichende sprachliche
Kommunikation erschwerend für Ärzte hinzu. Wenn sie die
Angehörigen zuziehen, um eventuell zu dolmetschen, müssen
sie das Beziehungsverhältnis innerhalb der Familie bei den
Antworten mit berücksichtigen. Traditioneller Weise ver-
schweigt die Familie in islamischen Ländern eine schwere
Diagnose, um den Patienten nicht zu belasten. Wenn ein
Fremder aus dem Umkreis des Klinikpersonals hinzu gezogen
wird, kann wiederum die Schamgrenze des Patienten verletzt
werden, da er oder sie sich nicht in seiner oder ihrer Gegen-
wart über intime körperliche Vorgänge unterhalten will.
3.5 Trauerverständnis und Trauerrituale
Neben den theologischen Ausführungen zum Themen-
komplex »Tod und Trauer« gibt Ilhan Ilkilic praktische
Hinweise, um Muslimen an der Grenze des Lebens angemes-
sen zu begegnen:
»Der Tod als existentielle allgemeinmenschliche Erfah-
rung betrifft im islamischen Glauben sowohl die Leib-
lichkeit als auch die Geistigkeit des Menschen. Der Koran
versteht den Tod nicht als das Ende des Menschen, son-
dern als Tor vom Diesseits zum Jenseits. Der Tod ist als
Heimkehr zum Schöpfer zu verstehen. Die Seele verlässt
im Sterbeprozess den Körper bis zum Tag der Auferste-
hung, an dem sich beide wieder vereinen werden. Nach-
dem der Todesengel die Seele des Verstorbenen vom Kör-
per getrennt hat, findet im Grab eine Befragung statt.
Danach harrt die Seele des Verstorbenen bis zum Jüngs-
65
ten Gericht entweder in gelassener oder angstvoller Er-
wartung aus«.55
Der letzte Besuch bei einem Sterbenden hat für den muslimi-
schen Glauben große Bedeutung. Hier kann in der Begegnung
und im Gespräch noch eine Versöhnung stattfinden, ein Streit
geklärt werden, Vergebung gewährt werden. Der letzte Be-
such ist auch ein Zeichen der Freundschaft und Solidarität.
Koranrezitation am Sterbebett gehört zu den Selbstverständ-
lichkeiten, zahlreiche Besucher sind erwünscht. Pflegeperso-
nal und Mitpatienten mögen darin eine Belastung und Be-
fremdung erleben, gelegentlich den Patienten vor der
Anstrengung bewahren wollen. Diese »Anstrengungen« ge-
hören aber genuin zu seinem Leben. »Die in islamischen
Quellen beschriebene Sinndeutung des Todes wird von Mus-
limen im Alltag durch Redewendungen folgendermaßen wie-
dergegeben: »›So wie wir auf die Welt gekommen sind, so
mögen wir auch von ihr scheiden. Möge Gott ein schönes
Ende ermöglichen.‹ Und: ›Gott möge uns am Ende Koran
(Koranrezitation) und Iman (Glaube, d.h. Aussprache des
Glaubensbekenntnisses) ermöglichen‹.«56
So übernehmen vorzugsweise die Angehörigen oder auch
ein Imam die Funktion der Sterbebegleitung durch Rezitation
des Korans mit dem Sterbenden. Die Sterbebegleitung inner-
halb der eigenen Religion ist wichtig und sollte nicht von
anderen übernommen werden.
Nach dem Tod werden dem Verstorbenen die Hände ge-
kreuzt oder beiseite gelegt, die Augenlider geschlossen und
das Kinn mit einem Stück Stoff festgebunden. Dann wird die
Kleidung ausgezogen und der Körper in ein Stück Stoff ge-
hüllt.57
Die Beisetzung soll möglichst am gleichen Tag stattfinden.
Die Waschung vor der Beisetzung soll mit warmem Wasser
stattfinden, wie bei einem lebendigen Menschen, der Verstor-
bene wird dann in weiße Tücher gehüllt – ein einfaches Tuch
66
wie das weiße Tuch der Pilger in Mekka. Der Verstorbene
wird nur für das Totengebet und die Überführung zum Grab
in einen Sarg gelegt. Im Grab wird er – nur mit dem Toten-
tuch bekleidet – auf die rechte Seite gelegt, mit dem Gesicht
nach Mekka. Die Verbrennung von Toten wird von den
Muslimen abgelehnt.
Für die Seelsorge im Krankenhaus heißt das: Wahrzuneh-
men, welche Rituale von den Muslimen begangen werden,
ihnen Raum und Zeit und entsprechende Würdigung zuteil
werden zu lassen, dezent begleitend und möglichst abstinent
mit eigenen Ritual- und Deutungsangeboten umzugehen.
Laute Trauer mit Schreien und Wehklagen ist durch den
Propheten verboten worden. Dennoch gibt es entsprechende
Szenen. Auch hier ist es angemessen, einen Raum für diese
Ausdrucksformen zu schaffen, der den Muslimen entgegen-
kommt und die anderen Patienten nicht belastet. Jedes Kran-
kenhaus wird dafür Wege finden können.
3.6 Offene Themen in der Begegnung mit Muslimen
Zunehmend bieten Altersheime in Deutschland multikultu-
relle Betreuung an, achten auf Speisevorschriften und religiö-
se Angebote für muslimische Bewohner. Vereinzelt entstehen
Heime, die auf einer Konzeption von Multikulturalität auf-
gebaut sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die
Migranten und Migrantinnen, sofern sie lange in Deutsch-
land gelebt haben und für ihren Lebensabend nicht in ihr
Heimatland zurückkehren wollen oder können, sich deutsche
Gewohnheiten zugelegt haben. Stereotypen in der Begegnung
sind also nicht angebracht. So wollte man in einem Senioren-
heim einer türkischen Bewohnerin etwas Gutes tun und ser-
vierte ihr Schafskäse und Oliven zum Frühstück. Nach eini-
67
ger Zeit bemerkte die Frau: »Nun lebe ich schon 35 Jahre in
Deutschland und liebe Marmeladebrötchen, aber hier be-
komme ich die nicht serviert.«
71
4 Interreligiöse Begegnung
Für viele Menschen bedeutet interkulturelle Begegnung
hauptsächlich das Eine: Etwas nicht Verlässliches und nicht
Gewohntes, das immer Gefahren in sich birgt. Im Regelfall
wird angenommen, dass die Begegnung von Fremden oder
mit ihnen schwer wird, dass sie oft misslingt, sodass man
nachher sagen kann: »Ich wusste es ja, so etwas kann nicht
gehen!« Manche Menschen machen es sich umgekehrt eher
zu leicht im interkulturellen Verstehen.
Sie vereinnahmen alles innerhalb ihrer eigenen Denkge-
wohnheiten. Wenn alles Verschiedene »untergebuttert« wird,
weil unterstellt wird, dass »Fremde sich anpassen müssen«,
ist es nicht schwer, an der Oberfläche Verstehen zu arrangie-
ren. Dieses Verhalten trägt meistens nicht so weit, wie es
beansprucht wird.
Wie also geschehen Begegnungen zwischen Menschen ver-
schiedener Kulturen – gerade dann, wenn diese Personen von
beiden Seiten ihr »Ureigenes« in die Begegnung hinein geben?
Wenn sie sich verlieben, wenn sie heiraten und mit Kindern
in der einen oder anderen – oder beiden Kulturen – leben
müssen?
Wie also lebt man interkulturell am Rande des Lebens,
wenn Menschen krank werden, wenn sie den Tod fürchten,
wenn Gefahren drohen, die oft sehr unterschiedlich einge-
schätzt und bewältigt werden? Wie ist das Fremde auszuhal-
ten, wenn die Nähe gesucht wird? Wie lässt sich einem Frem-
den Nähe signalisieren, ohne dass es unecht wird?
Viele Fragen und wenige Antworten, vor allem stellen die
Antworten in der Theorie nur eine mögliche Annäherung dar
72
und müssen durch die konkrete Erfahrung korrigiert und ver-
lebendigt werden. An Beispielen aus dem Alltag, anhand von
einmaligen oder auch langen Begleitungen von Menschen soll
nun in der praktischen Perspektive von Erfahrungen das »un-
spektakuläre Umgehen mit dem Fremden« aufgezeigt werden;
Es gilt, eine unspektakuläre, aber nicht leichte Antwort auf
die Frage nach interkultureller Kommunikation zu suchen
und gegebenenfalls zu finden. Das folgende Beispiel einer
Begegnung eines christlichen Beraters mit einem Muslim mag
das illustrieren.
4.1 Die schwierigen Erfahrungen von Herrn Z
Herr Z., verheiratet, zwei Kinder, stammt aus Marokko
und ist Moslem. Ich kenne ihn durch seine regelmäßige Teil-
nahme am christlich-islamischen Gesprächskreis unserer Kir-
chengemeinde. Mich erstaunt, wie wichtig Herrn Z. die Teil-
nahme an unserem interreligiösen Dialogkreis ist.
Obwohl Herr Z. im Anschluss an unsere Treffen oft arbei-
ten muss, versäumt er kaum eine Zusammenkunft. Wenn er
wegen seiner Arbeit nicht kommen kann, entschuldigt er sich
vorher, was nur die Wenigsten tun. Er bereichert unsere Tref-
fen, weil er sich intensiv mit seiner Lebensgeschichte und
seinem Glauben einbringt. Er diskutiert gerne und agiert
auffallend emotional, was ich nicht immer verstehe. Seine
Emotionalität wird für mich verständlicher, als er eines
Abends davon berichtete, dass er hier in Deutschland bereits
im Gefängnis saß und vor einiger Zeit nach Marokko, in sein
Herkunftsland, gegen seinen Willen abgeschoben wurde. Wir
alle sind betroffen von seinen Schilderungen, fragen aber
nicht nach. Ich selbst fürchte, es könnte noch emotionaler
werden, was ich vermeiden möchte, weil ich noch am Thema
des Abends weiter arbeiten möchte.
73
Einige Monate später, im Anschluss an unser Treffen, fragt
mich Herr Z., ob ich ihm dabei behilflich sein könne, einen
deutschen Pass zu bekommen. Er hätte ihn schon seit langer
Zeit beantragt, doch seine Frau hätte es immer wieder zu
verhindern gewusst, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft
bekommt. Beiläufig erwähnt er dann, er wolle auch gerne,
dass seine Frau mit zu unseren Treffen komme, aber die hätte
immer Ausreden.
Was seinen Einbürgerungswunsch anlangt, da sei ihm Frau
R. bisher bereits sehr behilflich gewesen. Frau R., osteuropäi-
scher Herkunft, arbeitet bei der Beratungsstelle unserer Kir-
che, würde sich schon lange um ihn und seine Familie bemü-
hen. Ich sage ihm zu, mich um sein Anliegen zu kümmern.
Am nächsten Tag setze ich mich mit Frau R. in Verbin-
dung, um zu erfahren, was ich für Herrn Z. über ihre Bemü-
hungen hinaus noch tun könne. Frau R. erzählt mir von der
Familiengeschichte Herrn Z.s. Dabei erfahre ich einiges, was
ich bisher noch nicht wusste. Herr Z. ist seit einigen Jahren
mit einer Deutschen marokkanischer Herkunft verheiratet.
Die beiden haben miteinander zwei Kinder. Herr Z., so sagte
mir Frau R., könne schon lange die deutsche Staatsbürger-
schaft besitzen, würde seine Frau nicht jedes Mal kurz vor
Ablauf der Wartefrist die Scheidung einreichen und ihren
Mann vor die Tür setzen. Das alles sei jedoch nur inszeniert,
um gegen ihren Mann ein Druckmittel zu haben, denn sie
fürchtet, er werde sie verlassen, sobald er die ersehnte Staats-
bürgerschaft habe. Sobald der Einbürgerungsbescheid ihres
Mannes dann abgelehnt sei, würde sie jedes Mal wieder mit
ihm zusammen ziehen.
Bei der ersten Trennung hätten sie es sogar so weit getrie-
ben, dass Herr Z. verhaftet und nach Marokko abgeschoben
worden ist. Danach zog seine Frau die Scheidung wieder
zurück, und so hätte ihr Mann nach einigen Monaten wieder
zurückkehren können. Natürlich lebe Herr Z. nun in ständi-
ger Panik, wieder abgeschoben zu werden. Das ganze Szena-
74
rio sei Frau R. mittlerweile schon sehr vertraut, denn es hätte
sich einige Male wiederholt.
Was sie besonders erstaunt hätte, selbst wenn Frau R. ih-
ren Mann vor die Tür gesetzt habe, würde sie ihn doch täg-
lich besuchen und die beiden würden auch regelmäßig sexuell
miteinander verkehren.
Im Augenblick sei es nun wieder soweit, dass Herr Z. kurz
vor der Einbürgerung steht. Sie, Frau R., hätte bereits mit der
zuständigen Behörde gesprochen, aber es könne nicht scha-
den, wenn ich mich dort auch noch einmal melden würde.
Das Gespräch mit Frau R. hat mich zunächst sprachlos
werden lassen. Ich denke, der arme Herr Z., was musste der
schon alles mit machen. Furchtbar, wenn man solche Erfah-
rungen mit den Ausländergesetzen unseres Staates machen
muss. Ist das in Ordnung?
Dann ärgere ich mich über die Frau von Herrn Z. Wie
kann man nur so ein Theater veranstalten, denkt die denn gar
nicht an die Kinder, die doch auch ihren Vater brauchen und
sehr unter dem ständigen Hin und Her leiden.
Ich setze mich noch am Nachmittag desselben Tages mit
Frau N. in Verbindung, die bei der Stadtverwaltung für die
Passerteilung zuständig ist. Sie kennt die persönlichen Um-
stände von Herrn Z. und will sich bemühen, mit der Passaus-
stellung etwas schneller zu sein als Frau Z. mit ihrem neuerli-
chen Scheidungsantrag, bzw. diesen nicht umgehend zur
Kenntnis nehmen. Auch sie ist der Meinung, das Verfahren
müsse jetzt endlich mal geregelt werden. Nur wegen der Frau
Z. wolle sie sich nicht noch ein paar Mal mit dem Fall be-
schäftigen. Ich stimme ihr zu und befürworte ihr geplantes
Vorgehen.
Einen Monat später. Beim nächsten Treffen unseres Ge-
sprächskreises kommt Herr Z. mir freudig entgegen. Er hat
endlich seinen deutschen Pass und bedankt sich für meine
Hilfe. Beim Ausflug unseres Gesprächskreises fahren diesmal
75
auch die Frau und die Kinder von Herrn Z. mit. Mir scheint
die Familie sehr harmonisch zu sein.
Nochmals einige Monate später. Herrn Z. habe ich schon
länger nicht mehr gesehen. Seine Freunde berichten mir, dass
er im Krankenhaus sei. Als ich ihn besuch, finde ich ihn auf
der Intensivstation vor. Zunächst fragt ein Pfleger, wer ich
sei. Herr Z. müsse gefragt werden, ob er mich sehen wolle, er
dürfe auf gar keinen Fall aufgeregt werden. Ich frage mich,
wie das gehen soll, wo doch viele Lebensbereiche von Herrn
Z. traumatisch besetzt sind. Nachdem Herr Z. eingewilligt
hat, mich zu empfangen, schildert mir der Pfleger noch kurz,
was mich erwartet. Herr Z. hatte Hirnbluten und ist notope-
riert worden. Er ist halbseitig gelähmt, und ein Schlauch leitet
Flüssigkeit aus seinem Kopf. Was Herr Z. erzählt, sei auch
nicht immer stimmig. Einiges gehe durcheinander.
Ich finde Herrn Z. wie vom Pfleger geschildert vor. Er sitzt
in einem Stuhl und begrüßt mich. Er erzählt von seiner
Krankheit und von seinen Sorgen um die Familie. Er hätte
schon seit Tagen nicht mehr geschlafen. Wir unterhalten uns
eine Stunde und reden noch über den Glauben. Herr Z. be-
richtet, dass ihn die Freunde aus der Moschee täglich besu-
chen und sich um ihn und seine Familie kümmern. Seine Frau
erwähnen wir nicht. Der Pfleger, den ich später frage, erzählt,
seine Frau würde Herrn Z. selten besuchen.
Der Besuch bei Herrn Z. hat mich erschüttert, und ich
merke, wie viel Energie ich in dem Gespräch gelassen habe.
Ständig überlegte ich, was darf ich sagen, was nicht und was
könnte ihn aufregen? Er, der früher nur so vor Energie spritz-
te, liegt nun so elend da. Dabei ist er gerade einmal so alt wie
ich. Und was wird aus den Kindern, die sind doch noch rela-
tiv klein? Ich habe das Gefühl, das könnte mein letzter Be-
such bei Herrn Z. gewesen sein.
Obwohl ich jede Woche in die Klinik gehe, um Menschen
aus meinem Altersheim zu besuchen, vermeide ich in den
folgenden vierzehn Tagen, bei Herrn Z. herein zu schauen.
76
Obwohl ich oft Schwerkranken und Sterbenden begegne, hat
mich der Fall von Herrn Z. doch selbst tief betroffen. Ich
nehme mir aber fest vor, ihn im nächsten Monat wieder zu
besuchen. Eher kann ich nicht.
Beim nächsten Treffen unseres Gesprächskreises berichten
Freunde, dass Herr Z. noch einmal operiert wurde und da-
nach verstorben ist. Wir beten gemeinsam für ihn und seine
Familie.
4.1.1 Fragen
In der Nachbetrachtung des Beraters rollt dieser noch ein-
mal – nach einem gewissen zeitlichen Abstand seine Erinne-
rung an die erlebte Problematik auf:
Nachdem nun ein Jahr seit dem Tod von Herrn Z. vergan-
gen ist, sehe ich viele Fragen noch offen. Damals war ich von
der Lebensgeschichte Herrn Z.s emotional sehr angerührt,
von seiner Krankheit und seinem Tod. Heute ist mir klar,
dass meine Emotionen die Sicht für die Komplexität seiner
Lebens – und seiner Familiengeschichte behindert haben.
In unserem Ungang miteinander schien es vordergründig
keine Rolle zu spielen, dass er Moslem ist und ich Christ. Wir
diskutierten miteinander über unseren Glauben, doch immer
so, dass es den anderen nicht verletzte. Intensiver nachzu-
fragen und auch manchmal mein Unverständnis zu äußern,
wäre hilfreicher für unser gegenseitiges Verständnis gewe-
sen, das merke ich heute. Mir fällt im Nachhinein auch auf,
dass ich Herrn Z. sehr isoliert wahrgenommen habe und
seine Lebens- und Familiengeschichte allein aus meiner
Sichtweise, einer christlich-deutschen-männlichen, betrach-
tet habe. Vieles, was noch ungeklärt war, schien mir klar zu
sein.
So habe ich mich bzw. Herrn Z. nie gefragt, wieso er ei-
gentlich die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollte, und
77
weshalb sie ihm so wichtig war. Ich habe nicht gefragt, wa-
rum Frau Z. mit allen Mitteln zu verhindern suchte, dass ihr
Mann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Fürchtete
sie einen Machtverlust? Sicherlich hatte sie durch ihre deut-
sche Staatsbürgerschaft große Gewalt über ihren Mann und
konnte somit eine andere Rolle einnehmen, als es ihr nach
islamisch geprägter Tradition zugekommen wäre.
Überhaupt steht Frau Z. außerhalb des Blickfelds aller, die
sich um die Familie bemühen. Frau R., Frau N. und ich er-
greifen gleichermaßen Partei für Herrn Z. und betrachten
Frau Z. nur mit Unverständnis. Dabei wäre es sicher hilfrei-
cher gewesen, sich um beide gemeinsam zu kümmern. Hätte
sich dann der frühe Tod von Herrn Z. verhindern lassen?
Wichtig wäre es gewesen, mit den Ehepartnern ihre Ängste
und Vorbehalte gegeneinander zu besprechen. Wie haben sie
überhaupt zu einander gefunden? War es eine Liebesheirat
oder wurden sie einander versprochen? Ich weiß zwar von
solchen Eheversprechen im islamischen Kulturraum, aber was
bedeutet das für eine Beziehung?
Die größte Angst von Frau Z. war, von ihrem Mann ver-
lassen zu werden, und das versuchte sie mit allen Mitteln zu
verhindern. Was bedeutet das für eine muslimische Frau?
Würde sie jemals wieder ein anderer Mann heiraten?
Je mehr ich über Herrn Z. nachdenke, umso mehr unbe-
antwortete Fragen tauchen auf. Fragen, die sich nicht zuletzt
auch durch unsere Herkunft aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen ergeben.
Ich lerne für mich aus diesem Fall, dass es gut ist, reichlich
Fragen zu stellen, Fragen zu den Brüchen, zum Glauben und
Denken, zu den Gefühlen, zu den Ängsten, zu den Freuden,
wenn ich mich um Menschen aus einem anderen Kulturkreis
sorge. Es ist gut zu fragen: »Wie ist es bei Euch?« Es hilft
auch zu sagen: »Das verstehe ich nicht.«
Denn auch wenn ich mich mit der fremden Kultur befasse,
so bin ich doch immer ein gänzlich Unwissender, weil ich
78
nicht in der anderen Kultur lebe und sie bestenfalls von au-
ßen kenne.
4.2.2 Grenzen des interkulturellen und interreligiösen
Verstehens
»Wie ist es bei Euch?« ist eine sinnvolle und hilfreiche Fra-
gestellung – vor allem dann, wenn wirklich den Erklärungen
zugehört wird. Natürlich ist es vor allem dann hilfreich,
wenn wirkliche und ehrliche Antworten gegeben werden.
Wie ist es für junge Menschen, von den Eltern einen Ehe-
partner ausgesucht zu bekommen? Die Antworten werden
vielfältig sein – je nachdem, ob eine 50 jährige Frau gefragt
wird, die mit dem Mann, den sie auf Wunsch der Eltern hei-
ratete, gut oder schlecht leben konnte – oder ob ein junges
Mädchen gefragt wird, das noch nicht heiraten möchte, das
aber von Eltern versorgt werden soll. Es kommt auch darauf
an, ob zu dieser Problematik alte oder junge Männer gefragt
werden. Die Fragestellung lässt sich akademisch bearbeiten
– über Befragungen und Statistiken, sie lässt sich spekulativ
aus den Grundsätzen und Traditionen einer Gesellschaft
lösen. Es kann behauptet werden, dass in traditionellen
Gesellschaften kaum ein Weg besteht, wie sich junge Men-
schen vor der Ehe treffen können – es sei denn, die Familien
arrangieren das Treffen. Anders ist es gesellschaftlich nicht
akzeptiert.
Die Rolle der Eltern für die generelle Auswahl des Le-
bensweges der Kinder ist in der Welt sehr verschieden defi-
niert. Die Dominanz der Eltern für den Lebensweg der Kin-
der ist auch in westlichen Gesellschaften durchaus
vorhanden, und sei es über die Auswahl der Schulen und
informellen Bildungsmöglichkeiten, die schon den Kindern
zur Verfügung stehen. Dies zeigt sich besonders dann, wenn
solche Bildungsmöglichkeiten von den einen Eltern ausgiebig
79
genutzt werden können, während sie anderen – oft aus finan-
ziellen Gründen, versagt bleiben.
Dieses eine Beispiel mit seiner breiten Ausfächerung soll il-
lustrieren, wie schwer es ist, die fremd wirkenden Verhal-
tensmuster einer anderen Kultur in ihren verschiedenen Zu-
sammenhängen zu verstehen. In Deutschland diskutiert man
eifrig pädagogische Fragen unter Eltern heranwachsender
Kinder, bedenkt Berufs – und Entwicklungschancen. Den
Muslimen, besonders in den nicht so »westlichen« Gesell-
schaften, wird allzu leicht unterstellt, dass sie wenig bis keine
Zukunftserwartungen – und hoffnungen für ihre Kinder he-
gen. Es wird schnell unter dem Gesichtspunkt »Zwangsmass-
nahme« gesehen, was sicherlich im Einzelfall mehr unter das
Stichwort »Tradition« gehören mag und eventuell durchaus
mit positiven Gefühlen für die Kinder verbunden ist.
Zeit, Gespräche mit Muslimen, Phantasie und die Bereit-
schaft, die eigene Tradition nicht als Selbstverständlichkeit
stehen zu lassen, während andere Traditionen kritisch gese-
hen werden, gehören hier zum Dialog.
Was bedeutet innerhalb eines bestimmten Kontextes ein
Ausweis-Dokument? Der deutsche Pass? Der Pass des Lan-
des, das verlassen wurde ? Was bedeutet eine »Rückführung«
für einen Asylbewerber, der seit 18 Jahren Duldung im Gast-
land erfahren hat, dort aufgewachsen ist, zur Schule ging und
das Herkunftsland, dessen Pass er wider Willen besitzt, nicht
kennt? Es hilft auf jeden Fall, zu sagen: »Das verstehe ich
nicht.« Es mag aber darüber hinaus im genannten Fall nur
sinnvoll sein, sich für den betroffenen Menschen über alle
Verstehens-Grenzen einzusetzen.
»Das verstehe ich nicht« – ist sicherlich auch dann eine
sinnvolle Auskunft, wenn an Lebensgrenzen etwa ein Seelsor-
ger, Begleiter gesucht wird. Alle Aufklärung über Ritualgebe-
te und Glaubensbekenntnisse der Muslime sollte nicht dazu
führen, als Nicht-Muslim eine Funktion zu übernehmen, die
nur Eingeweihten zugänglich ist. Die Wichtigkeit der Rituale
80
beim Sterben wurde bereits an anderer Stelle erwähnt. Sie
können oft sehr schwer ersetzt werden, bei aller Bereitschaft,
beizustehen, zu trösten und zu helfen – dies kann als Nicht-
Ernst-Nehmen des Menschen und des muslimischen Glau-
bens empfunden, als Kränkung gewertet werden. Verstehen
ist nie mit Vereinnahmen gleichzusetzen.
Reflexionen zu dieser Thematik haben Kurt Schmidt und
Gisela Egler58 veröffentlicht:
»Stellen wir uns nun vor, eine Krankenschwester macht
die protestantische Seelsorgerin auf eine schwerkranke
Muslimin aufmerksam, die im Krankenhaus keinen Bezug
zu muslimischen Verwandten hat. Es entwickelt sich ein
Vertrauensverhältnis zwischen beiden und die Frage steht
im Raum, ob ein gemeinsames Gebet für die Heilung der
Kranken möglich ist. Diese Situationsbeschreibung ver-
deutlicht bereits, dass das gemeinsame Gebet keine abs-
trakte Sache ist. Die Frage ist deshalb nicht nur, ›darf‹ die
Seelsorgerin dies (aus christlicher bzw. aus muslimischer
Sicht), sondern vielmehr, ›kann‹ sie dies.
Das gemeinsame Gebet unterstreicht die Nähe und die
Begleitung, die Hoffnung, die guten Wünsche, aber – und
das ist der entscheidende Punkt – es ist dadurch keine
Demonstration einer generellen Einheit zweier Religio-
nen.
Dies führt zu folgender Einschätzung: Grundsätzlich
kann aus protestantischer Sicht die interreligiöse Seelsor-
ge alles beinhalten, was im Respekt voreinander oder vor
Gott aus ganzem Herzen geschieht und heilsam ist.«59
Liegt ein Muslim im Sterben, sollen die Angehörigen verstän-
digt werden. Für gläubige Muslime beginnt und endet das
Leben mit dem Bezug zu Gott. Deshalb wird er, wenn er
irgend kann, noch das von klein auf gelernte Glaubensbe-
kenntnis sprechen. Wenn er das nicht mehr kann, mag ein
81
anderer Muslim das für ihn tun. Der/die christliche Seelsor-
ger/in wird den Sterbenden in verschiedenster Weise unter-
stützen, aber nicht mit ihm das Bekenntnis sprechen. Damit
wird er/sie automatisch zum/zur Muslim/in. Dieser Sprechakt
ist vergleichbar mit der Taufe als Eingangsritual in den christ-
lichen Glauben. Deshalb gibt es hier eine Grenze des Verste-
hens und der Begleitung, die zu respektieren ist.
82
5 Interkulturelle und innerislamische Beratungs- und Betreuungspraxis
Es wurde in ersten Kapiteln des Buches betrachtet, was
über viele Jahrhunderte, aber auch aktuell innerhalb der Me-
dizin im Bereich der islamischen Religion erkannt und be-
dacht wurde und wird. Es wurde versucht, zu erklären, wie
islamische Zugänge zu moderner, naturwissenschaftlich ge-
prägter Medizin aussehen können. Dies konnte nur in einem
Rahmen geschehen, in dem Aspekte beschrieben wurden.
Diese Aspekte gleichen Momentaufnahmen, sie sind Fokus-
sierungen auf bestimmte Phänomene, und sie sind gleichzeitig
nur ein Ausschnitt aus vielen Überlegungen.
Seelsorge im Islam, soweit sie an normativen Quellen aus
Koran und Sunna gebunden ist, kam in Eigen-Beschreibungen
zu Wort. Seelsorge im Islam, aber mit den Implikationen
modernen, westlich-psychologischen Denkens wurde als
Möglichkeit an den Horizont der Überlegungen gestellt. Seel-
sorge innerhalb der vielfältigen Tendenzen der islamischen
Mystik wurde aus Quellen referiert.
Erste Eindrücke aus Beispielen interkultureller Begeg-
nungspraxis wurden im vorhergehenden Kapitel vorgestellt
und in ihren Facetten und Rahmenbedingungen diskutiert.
Im Folgenden soll nun ein genauerer Blick auf die Praxis
von Beratung und Seelsorge im Kontext der islamisch-
christlichen Begegnung geworfen werden. Es geht um die
Beratung bi-religiöser und bi-kultureller Familien, es geht um
das Kennen lernen islamischer helfender Institutionen im
christlich geprägten Umfeld Deutschlands. Muslime, die in
deutschen Institutionen, mit und ohne Blick auf multikultu-
83
relle Betreuung leben, werden vorgestellt werden. Kranken-
häuser, vor allem solche, die Langzeitpatienten aufnehmen,
Psychiatrien, Altersheime werden auf ihre multikulturelle
Praxis hin untersucht werden. Letztlich wird die Frage ge-
stellt werden, inwieweit die »Fragmentierung des Lebens
einzelner Menschen in Institutionen«, wie sie in Deutschland
in sozialen Einrichtungen praktiziert wird, dem islamischen
Lebensgefühl entgegensteht, einem Menschenbild, das den
Menschen als Familienwesen anspricht, einer Vorstellung von
sozialem Verhalten, die aus Familientraditionen entwachsen
ist. Nicht zuletzt haben unterschiedliche soziale Konzepte
unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Rechtsgrundsätze,
nach denen – oft erst durch Erfahrungen der Praxis – zu fra-
gen ist.
5.1 Beratung und Begleitung bi-kultureller Familien
Wenig in der Seelsorgeliteratur beachtet, aber schon lange
existent, sind bi-kulturelle Familien, in denen sowohl kultu-
relle als auch religiöse Traditionen von Christentum und
Islam miteinander gelebt werden. Christlich-muslimische
Vereinigungen und Beratungsstellen für bikulturelle Paare
und Familien bemühen sich, Wege für eine gelebte spirituelle
Begegnung beider Religionen innerhalb des kleinen Rahmens
von Familien und Partnerschaften zu finden.
Beziehungs- und Machtfragen und Genderprobleme mi-
schen sich hier mit religiösen und kulturellen Fragestellungen.
Vermischt werden durch Kleidung und Habitus hergestellte
religiöse Schablonenvorstellungen mit religiös und theolo-
gisch substantieller Auseinandersetzung.60
Eva Butt gibt Einblick in ihre Praxis der Eheberatung in bi-
kulturellen und bi-religiösen Partnerschaften.61 Sie geht da-
84
von aus, dass am Anfang der Klärung von Beziehungen ein
Bearbeiten des Begriffes von »Kultur« und von dessen Gren-
zen vorgenommen werden muss.
»Kultur umfasst alle Bereiche menschlichen Lebensvoll-
zugs; von der materiellen Lebenssicherung über die sozia-
le Lebensordnung bis zu einer ästhetischen und wertori-
entierten Umweltauseinandersetzung.«62
Butt nimmt an, dass viel zu viele Probleme einer bi-
nationalen und bi-kulturellen Partnerschaft auf kulturelle
Unterschiede zurückgeführt werden. Deshalb erfragt sie
daneben den Familienstatus beider Partner aus den Her-
kunftsfamilien (wie viele Geschwister?), soziale Bedingungen
des Aufwachsens in ihren jeweiligen Herkunftsländern und
andere Faktoren ihrer Sozialisation, die jeweils individuell
verschieden sind. Sie alle kommen zusammen, um Charakter-
eigenschaften von Menschen zu prägen.
»An einem Beispiel möchte ich versuchen, das aufzuzei-
gen: Nehmen wir ein christlich-muslimisches Paar, das
ein unterschiedliche Auffassung von Kindererziehung hat
und von allem, was mit diesem Thema zusammenhängt.
Die Ehefrau ist deutsche katholische Christin, 35 Jahre
alt, der Ehemann ein tunesischer Muslim, 39 Jahre. Die
beiden haben zwei Kinder: eine Tochter Amira (6 ½ Jah-
re) und einen Sohn Karim (2 Jahre).
Die beiden Eheleute verstehen sich durchschnittlich gut,
sie haben Höhen und Tiefen in ihrer Partnerschaft hinter
sich wie in den meisten Paarbeziehungen, und jetzt kom-
men die beiden mit zwei Fragen zu mir in die Beratung:
Erstens die unterschiedliche Auffassung zum Thema Reli-
gionsunterricht der Tochter. Sie kommt gerade in die
Schule, und es geht darum, welchen Religionsunterricht
sie besuchen darf, soll, will – und überhaupt.
85
Zweitens. Der Sohn ist mittlerweile zwei Jahre alt und
noch nicht beschnitten. Die Frau möchte gern, dass er ge-
tauft wird, und der Mann möchte natürlich, dass er be-
schnitten wird. Es stellt sich heraus, wie bei so vielen Paa-
ren, dass Religion bis zur Geburt der Kinder kein Thema
war. Sie haben sich über vieles – auch über die Zukunft –
Gedanken gemacht und sich auch mit den Herkunftskul-
turen und -familien beschäftigt. Das Thema Religion war
für beide nicht so wichtig und wurde daher nicht beson-
ders diskutiert. Da das erste Kind ein Mädchen war, ka-
men sie um das Thema Beschneidung herum. Die Taufe
wurde noch ein wenig aufgeschoben, aber jetzt, wo der
Schuleintritt bevorsteht, taucht ein großes Fragezeichen
auf. Genauso ist es mit der Beschneidung des Sohnes, weil
der Heimatbesuch bei der tunesischen Familie ansteht. Es
ist für den Vater unmöglich, mit dem unbeschnittenen
Sohn nach Tunesien zu reisen«.63
Nun versucht die Beraterin, herauszufinden, auf welcher
Ebene der Beziehung das Paar die Fragen behandelt, ob es
ausschließlich um religiöse Fragen geht. Es könnten hinter
den religiösen Auffassungen Fragen nach der Durchsetzungs-
fähigkeit des einen oder anderen Partners stehen, oder es
könnten Modalitäten der üblichen Kommunikation zwischen
beiden deutlich werden.
Es geht auch für das Paar darum, gemeinsame Wertvorstel-
lungen für die Erziehung der Kinder zu erarbeiten, die ihre
kulturellen Hintergründe umgreifen. Auf jeden Fall gibt es in
allen Problemen keine Patentrezepte, sondern die beiden
müssen mit ihren Vorgaben individuelle Lösungen finden.
»Bei unserem Paar war der Religionsunterschied bisher
kein zentrales Thema, da beide sich als tolerant und offen
erlebt hatten und keinen großen Wert auf äußere religiöse
Formen legten. Bei der Eheschließung war es möglich ge-
86
wesen, durch eine standesamtliche Heirat das Thema Re-
ligion zu umgehen. Möglicherweise gab es jedoch schon
zum damaligen Zeitpunkt Vorbehalte seitens der deut-
schen Herkunftsfamilie hinsichtlich der Eheschließung
der Tochter mit einem Muslim, wahrend die Familie des
tunesischen Partners – bedingt durch die räumliche Ent-
fernung – vermutlich nicht sehr stark involviert war.
Durch die Kinder, insbesondere das erste Kind, wird die
Meinung der Herkunftsfamilien und deren Einstellung zu
Religion wieder aktuell, auch wenn beispielsweise die
muslimische und die christliche Seite gar nicht religiös
sind; mit den Enkelkindern wird diese Frage wieder wich-
tig.
Bei vielen Paaren kommt es zu diesem Zeitpunkt zu einer
großen Beziehungskrise, da der Druck der Herkunftsfa-
milien erhebliche Loyalitätskonflikte auslöst. Beide Part-
ner haben den Wunsch, es ihrer Familie recht zu machen
und dem sozialen Umfeld gegenüber ihr Gesicht zu wah-
ren ...
Ich gebe dem Paar zu bedenken, dass wir als interreligiöse
Familien die Chance haben, für unsere Kinder und unser
Umfeld ein Modell für Toleranz und Verständigung zu
sein. Dabei ist es für die Entwicklung der Kinder sehr
wichtig, dass wir nicht über Nebensächlichkeiten streiten,
auch wenn es gerade im Moment sehr aktuell ist. Wir
sollten statt dessen den Kindern vorleben, dass es um viel
wichtigere Dinge geht, die die Religionen mitzuteilen ha-
ben, also um das Wesentliche, den Kern der Religion.
Zentral bleibt in jedem Fall, dass die Kinder beide Religi-
onen kennen lernen sollten und soviel wie möglich miter-
leben z.B. in Form von Festen, Gebeten und Ritualen.
Natürlich wird unser Umfeld dominiert von der christ-
lich-abendländischen Religion und Kultur.
Als Beraterin gebe ich Denkanstöße, die das Paar darin
unterstützen, Vereinbarungen auszuhandeln und zu er-
87
proben. Kompromissbereitschaft und Toleranz sind dabei
wichtige Faktoren.«64
Mit diesen Vorschlägen, Beispielen, Hinweisen aus einer Be-
ratungssituation ist umrissen, vor welchen Problemen bi-
kulturelles und bi-religiöses Familienleben stattfinden kann.
Taufe oder Beschneidung ? – eine Frage nach dem Ritual
und seiner Bedeutung in der Religion, eine Frage nach dem
Selbstverständnis des muslimischen Vaters – schließlich eine
Frage, die die »extended family« betrifft und die sie als
Großeltern, Onkel und Tanten nach einem neuen, bewussten
Selbstverständnis ihrer eigenen Religion fragen lässt.
Seelsorge wird hier als »kulturell sensible« Seelsorge dann
eine Chance haben, wenn es ihr gelingt, die unterschiedlichen
kulturellen Muster und Ausdrucksformen des Glaubens in
einen offenen Kommunikationszusammenhang zu bringen. Es
muss ermöglicht werden, dass alle bei ihren erlernten Tradi-
tionen verbleiben können, ohne deren Substanz preis zu ge-
ben, dass sie aber andererseits ohne Angst ȟber den Teller-
rand« schauen können.
Am Ende einer solchen Kommunikation zwischen Eltern,
Großeltern und Kindern, zwischen ihren verschiedenen kultu-
rellen und religiösen Vorstellungen und Zugängen mag in
einzelnen Fällen eine gelungene, originelle und theologisch
beiden Religionen angemessene rituelle Form entwickelt wer-
den. Regine Froese berichtet von einem deutsch-türkischen
Ehepaar, das im Beisein beider Familien ihr Kind von einem
evangelischen Pfarrer und einem Imam in einem eigens ent-
worfenen Ritual segnen ließ.65
Zunehmend geht es in Deutschland und Europa darum,
dass Menschen unterschiedlicher kultureller Tradition und
unterschiedlicher religiöser Herkunft bleibend miteinander
leben werden und die europäischen Gesellschaften gestalten
werden. Dies ist, wie derzeit erst langsam erkannt wird, eine
brennende soziale Frage, die politisch gelöst werden muss.
88
Daneben ist es eine Frage der Bewusstseinsveränderung auf
vielen Ebenen: In Bezug auf Familienstrukturen, Geschlech-
ter-Beziehungen, Einstellungen zur Religion, zu Freizeit und
Berufsleben geschehen ständige Wandlungen, meistens im
Rahmen praktischen Vollzugs. Muslime und Christen sehen
sich in Ausübung ihrer Religion vielen gemeinsamen Heraus-
forderungen gegenüber, die Gesellschaften mit weitgehender
säkularer Prägung jeder Religionsausübung entgegen bringen.
5.2 Islamische helfende Organisationen
Neben der medizinischen und psychologischen Beratung
stellt sich auch für Muslime die Frage nach der Notwendig-
keit von Betreuung und Versorgung Hilfsbedürftiger. Hierzu
gibt es traditionelle religiöse Vorstellungen im Umkreis des
islamischen Gedankens der »Wohlfahrt«:
»Das islamische Wohlfahrtswesen ist genauso breit ge-
fächert und hat im Laufe der Jahrhunderte ebenso unter-
schiedliche Ausprägungen erfahren wie sein christliches
Pendant. Allein die Untersuchung des islamischen Stif-
tungswesens könnte zu dem Schluss verleiten, diesem
käme eine universelle Bedeutung im Islam zu. Beispiels-
weise kann eine fromme Stiftung von Landbesitz zur dau-
erhaften Versorgung eines Krankenhauses dem Stifter
sowohl die Hoffnung auf jenseitige Vergeltung der Gabe
durch Allah vermitteln als auch sein soziales Prestige ge-
waltig erhöhen; das Stiftungswesen ist seit der Ausprä-
gung klassischer Institutionen der Scharia eine bedeutsa-
me Rechtsform; es beeinflusst die Wirtschaft ganzer
Landstriche; Stiftungen von Moscheen und sozialen Ein-
richtungen eröffnen gesellschaftliche Räume, sie bilden
für ihre Nutzer eine Möglichkeit sozialer Sicherung; Stif-
89
tungen besitzen eine klassische Form, die jedoch seit der
Kolonialzeit und der Entstehung von einzelnen National-
staaten je nach Rechtssystem Wandlungen unterworfen
ist«.66
Mit diesem Auftakt beginnt Bärbel Beinhauer-Köhler ihre
Studie zu »Formen islamischer Wohlfahrt in Deutschland«.
Im weiteren Verlauf ihrer Recherchen bemerkt sie:
»Auch der Gedanke eines Zusammenspiels von körper-
licher Heilung und geistlichem Heil von Patienten ist
angesichts der modernen Medizin in den Hintergrund
getreten ...«67
Dieses Zusammenspiel interessiert im weitesten Sinne, wenn
Fragen nach Beratung und Seelsorge im Kontext einer Religi-
on auftreten. Im Folgenden soll untersucht und referiert wer-
den, welche Hinweise Beinhauer – Köhler für diesen speziel-
len Aspekt der »Wohlfahrt« im Islam gibt.
Durch den Koran selbst ist festgelegt, dass der Mensch als
die Krone der Schöpfung Statthalter (Khalifa) Gottes ist. Der
Mensch ist ausgestattet mit äußerlicher Schönheit und der
Anlage zum Guten. Der Mensch besteht aus Körper und Geist/
Seele. Es wurde bereits erwähnt, dass in der Zuordnung der
beiden Teile bzw. deren Interdependenz im Laufe der Religi-
onsgeschichte und deren jeweiliger Ausprägung Unterschiede
gemacht wurden.68 Die Bedeutung der Seele in ihrem Verhält-
nis zu Gott wurde herausgehoben: dagegen war der gesunde
Ausgleich von Körper und Seele gelegentlich in den Hinter-
grund getreten. Hierzu bemerkt Beinhauer – Köhler:
»Auch andere Zeugnisse des islamischen Geisteslebens
illustrieren die herausragende Rolle der seelisch – geisti-
gen Komponente des menschlichen Wesens, so betont der
Verfasser einer berühmten Kosmologie, al – Qazwini ( ca.
90
1203 – 1283), der Mensch unterscheide sich vom Tier
durch seinen Verstand und die Fähigkeit, Verantwortung
zu übernehmen, und er schreibt: ›Diese Seele nun verhält
sich im Körper wie der Verwalter im Königreich, und die
Fähigkeiten und Organe sind ihre Dienerschaft ... Der
Körper also ist das Königreich der Seele, ihr Aufenthalts-
ort und ihre Stadt‹.«69
Über vorderorientalische Einflüsse, über den Hellenismus und
die Gnosis ist diese vergleichsweise »Ambivalenz«70 gegen-
über dem Körper spürbar, die sich in einer gewissen Abwer-
tung des Körpers im Sufismus ausdrückt.71
Beinhauer-Köhler bemerkt ebenso, dass die Prophetenme-
dizin um einen ausgewogenen Anteil des Körpers an der ge-
samten Existenz des Menschen bemüht ist:
»Demzufolge gebühre dem Körper grundsätzlich ein ent-
scheidender Anteil am Menschsein. Vermutlich liegt es
am alltagsorientierten Charakter der Gattung Hadith72,
dass Überlegungen zur menschlichen Seele dort weniger
Raum einnehmen. Stattdessen hat jedoch die Frage nach
dem persönlichen Glauben die frühen Muslime in hohem
Maße beschäftigt. Es gilt, den Glauben in jeder Hinsicht
zu stärken und zu praktizieren. In diesem Zusammen-
hang fällt das Stichwort des gihad, was zunächst einmal –
neutral – ›Einsatz für die Sache Gottes‹ bedeutet«.73
Im Rahmen seiner Grundverpflichtungen gegenüber der Reli-
gion, der Arkan, soll der Muslim Armensteuer, Zakat, abge-
ben. Entscheidend für die Ausübung der Frömmigkeit ist
nicht nur die Seelenqualität des Einzelnen, sondern auch das
angemessene soziale wie religiöse Leben der Gemeinschaft,
der Umma.
Über die Zakat hinaus ist es jedem Muslim freigestellt,
weitere Almosen (Sadaqa) zu geben.
91
»Die Scharia hat ... eigenständige Rechtsinstitutionen ent-
stehen lassen, die weiter unten gesondert betrachtet wer-
den: Aus dem Aufruf zur Armenspende erwuchs die re-
gelmäßige Abgabe der zakat, private Schenkungen
mündeten ins Stiftungswesen (waqf/hubs) ... Für die
Umma besteht das Ideal eines allgemeinen Wohlergehens,
wo das Wohl der Gemeinschaft (maslaha) vor das des
Einzelnen gestellt wird.«74
In der Wende zum 20. Jahrhundert wurden vielfach in islami-
schen Ländern europäische Gedanken rezipiert, darunter auch
der Sozialismus. Auf dem Hintergrund des koranischen »Um-
ma«-Gedankens wurden politische islamisch-sozialistische
Vorstellungen entwickelt, die in verschiedenen Ländern noch
heute zur herrschenden Staats-Ideologie zählen.
Beinhauer-Köhler untersucht in ihrer Studie die Aspekte
von Hilfeleistungen innerhalb ausgesuchter islamischer Ge-
meinden in Deutschland und islamischer internationaler
Hilfsorganisationen. Die Verteilung von Geldern aus der
Zakat, von Opferfest und Sadaqa, werden beschrieben. Es
werden Projekte genannt, in die diese Hilfe in aller Welt
fliesst. Besonders bei internationalen Hilfsorganisationen wie
»Humanity First« wird darauf Wert gelegt, dass keine Hilfe-
leistungen für einen militant verstandenen Gihad gegeben
werden.75
»Humanity First« ist eine von mehreren internationalen is-
lamischen Hilfsorganisationen.
»Insgesamt scheint ein quietistisches Verständnis von
Gihad zusammen mit dem fortwährenden missionari-
schen Bemühen um neue Mitglieder indirekt zu bewirken,
dass die Einsätze von Humanity First auch westlichen
Kriterien von humanitärer Hilfe genügen.«76
Yasar Colak gibt einen detaillierten Überblick über den der-
92
zeitigen Stand von religiösen Dienstleistungen in der Türkei.
Dies scheint hier besonders interessant, weil die gegenseitige
Verbundenheit zwischen Muslimen in der Türkei und den in
Deutschland lebenden Muslimen noch hoch ist. Im Rahmen
des praktizierten Entsende-Verfahrens für die in Deutschland
tätigen Imame ist es von Bedeutung, den Wissens- und Pra-
xisstand von Beratung im Rahmen religiöser Begleitung in
der Türkei zu kennen.
»Religiöse Dienste in der Türkei werden wie folgt geglie-
dert: die öffentlichen Dienste, die von freiwilligen Orga-
nisationen angebotenen Dienste sowie Universitäten und
Forschungsinstitute, die diese Dienstleistungen wissen-
schaftlich unterstützen. Da die Dienstleistungen der frei-
willigen Organisationen sowie der Akademien einen Un-
tersuchungsbereich für sich darstellen, wird sich dieser
Beitrag auf die praktischen Dienste des Amtes für Religi-
öse Angelegenheiten für die Gesellschaft beschränken ...
Wie allgemein bekannt ist, ist Religion ein Mittel, »das
notwendige Kommunikationssysteme bereitstellt, die da-
zu dienen, den Sinn des Lebens zu bereichern, das Leben
menschenwürdig zu gestalten sowie zur besseren gegen-
seitigen Verständigung der Menschen beizutragen.«77
Die letztgenannte Begründung des Kommunikationssystems
Religion soll aus den Ausführungen Colaks herausgearbeitet
werden. Er selbst stellt fest:
»Wenn die Gesellschaft in Bezug auf Religion nicht rich-
tig aufgeklärt wird oder die Aufklärung durch inkompe-
tente Personen erfolgt, so entsteht in der Gesellschaft statt
Harmonie und Frieden Chaos, statt Toleranz Fanatismus,
statt der Freiheit der Menschen der Verfall in Form des
Aberglaubens«.78
93
Unter dem Titel »Religiöse Führungs- und Beratungsdienste«
führt Colak aus, was im Bereich von Beratung und Seelsorge
vom Amt für Religiöse Angelegenheiten in Ankara angeboten
wird:
»Die Angehörigen des Amtes, egal welchen Titel sie ha-
ben oder in welcher Position sie arbeiten, haben ähnliche
Aufgaben wie die Sozialarbeiter in der westlichen Gesell-
schaft. Sie versuchen, die Probleme der Menschen unter
dem Gesichtspunkt des Islam zu lösen. Schwerpunktmä-
ßig bieten die Beauftragten Führungs- und Beratungs-
dienste zu den Themen Glauben, Gebetsverrichtung und
Moral. Des Weiteren leisten sie den Menschen bei famili-
ären Auseinandersetzungen, Krankheit und Tod Beistand,
beten bei Hochzeiten, Trauungen und Beschneidungen
oder vollziehen religiöse Trauungen.
Die Abteilungen, die religiöse Führungs- und Beratungs-
dienste anbieten, sind das Hohe Amt für Religiöse Ange-
legenheiten, das Amt für Muftis, Moscheen, Veranstalter
von Korankursen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Waisen-
häuser, Heime für schwer erziehbare Kinder und Alten-
heime.
An das Hohe Amt für Religiöse Angelegenheiten wenden
sich täglich Hunderte von Personen per Telefon, Email,
Post und persönlich. Ihnen werden unter Berücksichti-
gung ihres Bildungsstandes sowie ihrer sozialen und psy-
chologischen Voraussetzungen religiöses Wissen, Rat-
schläge und psychologische Hilfe vermittelt. Täglich
erhält das Amt für Religiöse Angelegenheiten ca. 150 An-
rufe. Außerdem erhielt es von 1999 bis 2002 insgesamt
5.280 Emails. Darüber hinaus erhielt man ca. 2.000 reli-
gionsbezogene persönliche Fragen per Post. Wichtige
Themenbereiche sind Glaubensvorschriften (Gebet, Fas-
ten, Spenden, Pilgerfahrt, Fragen zum Opferfest), Koran-
übersetzungen und -interpretationen sowie finanzielle
94
und wirtschaftliche Themen (Kauf/Verkauf, Zinsen, Bör-
se, akkreditierte Verkäufe, Aktien, Gewinnanteile etc.),
familienrechtliche Themen (Ehe, Scheidung, innerfamiliä-
re Auseinandersetzungen und Lösungsvorschläge), religi-
öse Fragen mit medizinischem Schwerpunkt (Abtreibung,
Verhütung, Transplantation, künstliche Befruchtung,
Klonen) sowie religiöse Anschauungen, die zerstörende
Wirkung auf die Gesellschaft haben (Satanismus, Moon-
Sekte; Zeugen Yehovas u.a.), ferner Fragen nach Mission,
Häresie und Aberglauben. Auch die Ämter der Muftis
leisten in diesem Rahmen Dienste. Schriftliche Fragen, die
an diese Ämter gerichtet werden, sind oft problematischer
sozialer Natur und werden registriert.
Absolventinnen der Theologischen Fakultät, die in den
Bezirksämtern der Muftis als Fachberaterinnen für Glau-
bensangelegenheiten arbeiten, bieten hauptsächlich Füh-
rungs- und Beratungsdienste für Frauen an. Diese Dienst-
leistung ist für Frauen, die von den in den Moscheen
angebotenen Diensten nicht ausreichend profitieren kön-
nen, von lebenswichtiger Notwendigkeit. Derzeit sind in
55 Bezirken Fachberaterinnen tätig.«
Inhaltliche Vergleiche anzustellen zwischen dem aufgeführten
Katalog an Hilfs- und Beratungsangeboten islamischer Insti-
tutionen in der Türkei und deutschen diakonischen und cari-
tativen Bemühungen, wäre interessant und würde hervorhe-
ben, welche Vielfalt an Hilfsangeboten in beiden Religionen
bereitgestellt werden. Zum gegenwärtigen Stand der Informa-
tion ist es allerdings eher sinnvoll, sich auf den von Colak
dargestellten Rahmen von »islamischer Hilfe« zu beziehen
und ihn vor allen in seiner sozialen und geistigen Einbettung
in die derzeitige Situation der Türkei zu stellen.
Moscheen und die dort Beauftragten bieten dezentral sozial
unterstützende Dienste für die Muslime an; Moscheen sind
nicht nur Orte des Gebets, sondern sie sind auch Aufent-
95
haltsorte für alte Menschen, die dort ihren Tag verbringen
können; in 55 Bezirken wurde erkannt und umgesetzt, dass
Frauen in Notlagen spezielle Hilfen brauchen, die meistens
Moscheevereine mit kulturellen und Freizeitangeboten nicht
leisten können. Colak selbst bemerkt:
»Wir sind der Überzeugung, dass diese Aufzeichnungen
ein ergiebiges Feld für Forscher hinsichtlich der Probleme
unseres Landes darstellen«.79
Auch in Bezug auf »Gefängnisseelsorge« gibt es Vereinbarun-
gen zwischen dem Justizministerium und dem Amt für Religiö-
se Angelegenheiten. Männliche und weibliche Beauftragte
arbeiten seit 2001 für die Resozialisierung von Angeklagten
und Straftätern in verschiedenen Formen von Gefängnissen.
Moscheebeauftragte haben einen weiten Aufgabenkatalog
von sozialen Diensten über religiöse Begleitung an den Wen-
depunkten des Lebens. Sie sollen Schulen, Krankenhäuser,
Waisenhäuser und Altenheime besuchen, sie sollen helfen und
beraten bei der Vorbereitung und Durchführung der Pilger-
fahrten, sie sollen sich um Räume und Gebäude kümmern.
Colak schließt mit dem Hinweis:
»Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die Beauftrag-
ten für religiöse Führung und Betreuung ihren Aufgaben
in der sich verändernden und entwickelnden Gesellschaft
auch wirklich gerecht werden. Es sollte erwähnt werden,
dass das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter in
diesen Bereichen nicht ausreichend sind. Wir vertreten die
Ansicht, dass dieser Zustand in engem Zusammenhang
mit der Bildung und der bereits erwähnten sozialen Struk-
tur unseres Landes steht. Aus diesem Grunde wäre die
Aufnahme eines eigenständigen Faches ›Psychologische
Betreuung und Führung‹ in die theologische Ausbildung
gerechtfertigt«.80
96
5.3 Muslime und Altenheim
In Deutschland existieren einige wenige Altenheime, die
sich bewusst auf multikulturelle Betreuung ihrer Bewohner
einstellen. Ein kurzes Beispiel dieser Problematik wurde be-
reits weiter oben gegeben.81
Moscheegemeinden sorgen sich um die Beschäftigung und
Unterrichtung der Kinder, geben Frauen Möglichkeiten, sich
in der Moschee zu treffen. Sie sind auch, wie in ihren Hei-
matländern, dafür offen, alte Menschen tagsüber in der Mo-
schee und den dazugehörigen Einrichtungen zu begrüßen. Wo
aber eine solche Versorgung für einen alten Menschen nicht
ausreicht, weil er oder sie eine Behinderung hat oder sonst
nicht mehr zum Verlassen des Hauses in der Lage ist, verlas-
sen sich Muslime bisher auf den Zusammenhalt der Familien.
»Nach dem Thema professioneller Altenbetreuung für
Muslime in Deutschland gefragt, äußerten sich fast sämt-
liche Befragten ablehnend‹.82 Man erinnerte immer wie-
der daran, dass im Islam laut Koran die Versorgung alter
Menschen Aufgabe der jüngeren Familienmitglieder sei.
Allerdings ist man sich z.T. der wachsenden Notwendig-
keit für Seniorenheime angesichts sich vor allem in Städ-
ten wandelnder Familienstrukturen durchaus bewusst, so
führt z.B. die türkische, an die Religionsorganisation
Diyanet angeschlossene Vaqif-Stiftung in Istanbul ein Al-
tersheim.
Bisher ist jedoch keine Initiative von Muslimen erkenn-
bar, auch in Deutschland ein solches zu errichten. Gleich-
zeitig werden in Notfällen, wenn eine Familie die Betreu-
ung nicht leisten kann, jedoch durchaus deutsche
Einrichtungen angenommen ...«83
Beinhauer-Köhler stellt ein multikulturell ausgerichtetes Haus
in Duisburg vor, in dem derzeit zehn TürkInnen leben:
97
»Das Haus zeichnet sich durch zweisprachiges Pflegper-
sonal sowie durch zahlreiche Details der Einrichtung aus,
die unterschiedlichen kulturellen Prägungen Rechnung
tragen: Im Keller befindet sich ein kleiner Gebetsraum
mit eigener Waschgelegenheit für die rituellen Waschun-
gen. Dieser wird jedoch weniger von den stark pflegebe-
dürftigen oder sich u.U. nicht an Religion orientierenden
Bewohnern benutzt, umso mehr von den Besuchern, die
zu den Gebetszeiten dann eine gute Möglichkeit zum Ge-
bet finden. In der Küche wird selbstverständlich auf die
islamischen Speisevorgaben geachtet, ebenso wie Kochni-
schen auf den Fluren und dortige Sitzgelegenheiten er-
möglichen, dass größere Besuchergruppen sowie Besucher
auf Anfrage oder mit Betreuung auch selbst dort kochen
können, so dass auch umfangreichere Familien wie ge-
wohnt und in angenehmem Umfeld zusammenkommen
können«.84
Eine Bestandsaufnahme zur Situation von Muslimen am Ende
des Lebens, in Sterben und Tod zu geben, wird derzeit man-
cherorts versucht:
»Muslimische Gräberfelder sowie kultursensible Pflege in
Altenheimen und Krankenhäusern sind vielerorts noch immer
keine Selbstverständlichkeit.«85 So wurde auf der dritten
Fachtagung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
im Mai 2006 formuliert.
Migranten der ersten Generation hatten es sich zum Ziel
gesetzt, nach einigen Jahren Arbeit für den Lebensabend in
ihre alte Heimat zurück zu gehen. Aber ihre Lebensentwürfe
änderten sich, und es wurde daraus ein Daueraufenthalt in
der neuen Umgebung. Ältere Mitbürger sind oft auf Hilfen
angewiesen, andererseits engagieren sie sich oft noch im Ge-
meinwohl und in den Vereinen. Es stellt sich die Frage, ob die
Institutionen, die Unterstützung anbieten, kulturell sensibel
genug sind, um seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden,
98
jedoch von Geburt einer anderen Kultur angehörenden Men-
schen eine »Heimat« zu bieten? Es stellt sich die Frage, in-
wieweit Vereine und gemeinnützige Einrichtungen das Poten-
tial kulturfremder Helfer annehmen können und wollen?
»›Wohnanlage für Ältere‹ ins Türkische übersetzt« – so
lautete eine Überschrift in einer überreligionalen deutschen
Tageszeitung. Darunter standen Angebote, die das Amt für
Soziale Angelegenheiten einer deutschen Großstadt ihren
über 60 Jahre alten Bürgern macht. Die Wohnanlagen der
Stadt sollen künftig auch nicht-deutschen älteren Mitbürgern
zur Verfügung stehen.86
Derzeit leben in Deutschland 800.000 MigrantInnen, die
älter als 60 Jahre alt sind. Der größte Teil davon sind ehema-
lige männliche Gastarbeiter. Diese sind noch immer nicht
gewohnt, mit deutschen Institutionen umzugehen oder scheu-
en davor aus verschiedenen Gründen zurück. Deshalb stellt
sich die Frage, wie mit beidseitigen Verunsicherungen umge-
gangen werden kann und inwieweit es interkulturelle Initiati-
ven für alt werdene MigrantInnen gibt, um ihre Isolation zu
verhindern?
Kultursensible Altenpflege will pflegebedürftige Menschen
entsprechend ihrer religiösen und kulturellen Identität wahr-
nehmen und ihnen eine gleichwertige Behandlung entgegen
bringen. Das Adam Müller – Guttenbrunn Haus in Stuttgart
– Rot hat für ein solches Programm erste Konzepte entwi-
ckelt und setzt sie bereits um. Es geht um die Kooperation
mit anderen Migrationsdiensten und um die interkulturelle
Schulung der Pflegedienste und der ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen. Mehrsprachiges Informationsmaterial erleichtert
den Zugang.
Familien müssen stärker in den Rhythmus des Heimes ein-
bezogen werden, Räume für familiäre Feiern zur Verfügung
gestellt werden. Kulturübergreifende Veranstaltungen und
Fernseh- und Radioangebote in verschiedenen Sprachen sind
genauso sinnvoll wie muttersprachliche Begleitung zu Ärzten
99
und anderen Einrichtungen. Die verschiedenen Religionsge-
meinschaften müssen Zugang zum Haus haben und ihre An-
gebote machen und die Menschen begleiten können; die
Lehrpläne der Pflegedienstschulen müssen »multikultureller«
werden.
Besonders wichtig sei, dass jeder einzelne Bewohner des
Heimes einen Biografiebogen ausfülle, aus dem seine Interes-
sen, sein Tagesrhythmus, seine Ernährungsgewohnheiten
hervorgehen.
Drei Projekte in Frankfurt wurden gemeinsam mit musli-
mischen MitarbeiterInnen innerhalb von Einrichtungen der
Diakonie entwickelt. So wurde die Eröffnungsfeier des multi-
kulturellen Altenpflegezentrums in Frankfurt-Höchst als ein
großes Fastenbrechen zusammen mit dem türkischen Koch
veranstaltet. Im gegenseitigen Begegnen entwickelte sich Ver-
trauen auf beiden Seiten.
Neben den stationären Einrichtungen sind aber auch in-
formelle Treffen von älteren MigrantInnen zu fördern. Die
Menschen können ihre Potentiale entdecken, sie können
Übersetzungshilfen leisten und ihre Lebenserfahrung für die
nächste Generation zur Verfügung stellen. Sie sind wichtige
Kulturvermittler für die jüngere Generation. Frauen müssen
ermutigt werden, sich stärker und auch außerhalb der Mo-
scheevereine öffentlich zu engagieren, deshalb ist alle inter-
kulturelle ehrenamtliche Arbeit zu fördern. Wichtig ist vor
allem die Vernetzung von Verbänden, Kommunen und Ein-
zelpersonen und deren entsprechende Einwirkungen auf die
Politik.
Mit diesem Fazit und den vorgestellten Anfängen und An-
regungen gab die Tagung einen Einblick in den Stand der
interkulturellen Begegnung unter den Senioren.
Bis Ende 2006 soll in Deutschland das erste türkische Al-
tersheim entstehen – ein gemeinsames Projekt der Türkischen
Gemeinde Berlin und eines deutschen Pflegeheimbetreibers.
Damit wird eine Lücke geschlossen werden unter den konfes-
100
sionellen Anbietern. Evangelische, katholische und jüdische
Altenheime gibt es bereits, hier wird nun ein islamisches
Haus errichtet. Es ist vor allem für die türkischen Rentner
gedacht, die auch im Alter noch nicht gut deutsch sprechen
und die sich noch sehr stark den Wertvorstellungen ihres
Heimatlandes verbunden wissen.
Es wird nach islamischen Speisevorschriften gekocht wer-
den, es soll ein Gebetsraum vorhanden sein und ein Raum, in
dem sich große Familien treffen können.
Die Errichtung dieses Hauses ist ein Pilotprojekt in
Deutschland. Wenn es Erfolg haben sollte, können weitere
Heime folgen. Allerdings ist noch unklar, wie hoch die Nach-
frage nach einer solchen Einrichtung ist, da immer noch vom
Koran her die innerfamiliäre Verantwortung für die alten
Menschen der gebotene Maßstab ist.
Derzeit leben in Berlin 40 TürkInnen in Altersheimen.
5.4 Muslime und Krankenhaus
Krankenhäuser der Regelversorgung oder Universitätskli-
niken sind in Deutschland meistens eingerichtet auf Multikul-
turalität. Unter dem Pflegepersonal findet man, sofern sie aus
islamischen Ländern kommen, insbesondere türkischstämmi-
ge Personen. Ärzte stammen aus vielen verschiedenen islami-
schen Ländern. Seitens der Krankenhausleitungen werden oft
multikulturelle religiöse Räume den Kapellen vorgezogen, die
nur den christlichen Konfessionen vorbehalten sind. Zumin-
dest ist das so zu beobachten, wenn es sich um Neu-
Errichtungen handelt. Ein multikulturelles Team unter den
Krankenhausseelsorgern, bestehend aus Vertretern verschie-
dener Religionen, ist allerdings eher selten. Andere europäi-
sche Länder – etwa Großbritannien, sind hier weiter. Luthfa
Meah, Muslimin aus London, schreibt dazu Folgendes:
101
»Als Zweites wurde mit der zunehmenden Zahl musli-
mischer Patientinnen und Patienten in den vergangenen
Jahren deutlich, dass es dringend notwendig ist, muslimi-
sche Krankenhausseelsorger einzustellen. Resultat dieser
Einsicht ist, dass zunehmend auch muslimische Kranken-
hausseelsorger sich um spirituelle Bedürfnisse der Patien-
ten kümmern. Diese jedoch sind vornehmlich Männer.
Man sollte bedenken, dass die Einstellung von mehr
weiblichen muslimischen Krankenhausseelsorgerinnen die
Therapien unterstützen würde und dem Heilungsprozess
der Klientinnen entgegen käme.«87
In Bezug auf die allgemeine Berücksichtigung der Lebensge-
wohnheiten der Muslime in britischen Krankenhäusern, gibt
sie diese Einschätzung:
»Muslime haben spezielle Ernährungsgewohnheiten. Der
Konsum von bestimmten Speisen und Getränken wie
Schweinefleisch und Alkohol ist Muslimen verboten. Tie-
re müssen in einer bestimmten Weise geschlachtet wer-
den, damit das Fleisch für den Verzehr zugelassen ist.
Wenn Muslime nicht streng nach ihren Vorschriften zu-
bereitetes Fleisch erhalten, ziehen sie es vor, vegetarische
Nahrung zu sich zu nehmen. Das Nationale Gesundheits-
system hat auf diesen Bedarf reagiert und bietet seit eini-
gen Jahren nach muslimischen Vorschriften zubereitete
Nahrung an. Darüber hinaus muss besondere Aufmerk-
samkeit auf den Monat Ramadan verwendet werden,
wenn Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
fasten. Kurz vor Sonnenaufgang brauchen Muslime ein
gutes Frühstück, kurz nach Sonnenuntergang eine nahr-
hafte Mahlzeit. Fasten ist keine religiöse Verpflichtung
für Menschen, die unter psychischen Störungen leiden –
sie sind von der Fastenregel ausgeschlossen«.88
102
Auf Schwierigkeiten für die Diagnose und Therapie, wie sie
allein durch die Sprachbarrieren entstehen, wird weiter unten
noch einmal in einem Beispiel eingegangen werden89. Der
Mediziner Emil Zimmermann stellt in seiner Publikation
»Kulturelle Missverständnisse in der Medizin«90 ein Modell
vor, das in der Freiburger Universitätsklinik praktiziert wird.
Hier sind muttersprachliche Experten mit medizinischer oder
pflegerischer Vorbildung als »Sprachmittler« tätig, die in der
Begegnung von Arzt und Patienten mehr als nur Worte aus-
tauschen und übermitteln können. Es wird Wert darauf ge-
legt, dass die entsprechenden Sprachmittler eine umfassende-
re Kenntnis von Kultur und volksmedizinischem Verständnis
in ihrem Land haben. Sie müssen in der Lage sein, eine »Be-
schwerde über die kranke Leber« nicht nur als physische
Indikation zu betrachten, sondern die Klage des Patienten
und sein Schmerzerleben auch in ihrem psychischen Aus-
druckswert einzuschätzen.91 So seien auf deutschen Kranken-
stationen zwar die Schwierigkeiten und Missverständnisse
mit ausländischen Patienten Alltagsprobleme, ein spezielles
Eingehen auf ihre Vorstellungen und Bedürfnisse sei aber nur
vereinzelt gegeben. Dadurch würde nicht nur die Stationsar-
beit wesentlich erleichtert, sondern vor allem die affektiven
Beziehungen zwischen ihnen und dem pflegerischen und ärzt-
lichen Personal verbessert. Für ausländische Patienten sei es
jedoch besonders schwer, sich damit abzufinden. Sie seien in
einem noch viel stärkeren Maße als deutsche Patienten verun-
sichert. Es sei zu verstehen, wenn ausländische Patienten,
ganz unbewusst, sofort personale Beziehungen zum Stations-
personal aufzubauen versuchen. Es entspräche ihrer Prägung
und wirke gleichzeitig hilfreich, um ihre Ängste, Verunsiche-
rungen und sozialen Verluste zu verkraften.
»Finden sie unter den Ärzten der Station – vor allem aber
unter den Pflegenden – die eine oder andere Persönlich-
keit, die für ihr Fremdsein keine Barriere darstellt, um ei-
103
ne natürliche ungezwungene Beziehung aufzubauen, und
die vielleicht sogar noch bereit ist, gewisse Zugeständnis-
se zu machen und auf bestimmte Eigentümlichkeiten ihres
Verhaltens einzugehen, so legen sie bereitwillig ›ihr gan-
zes Herz in die Waagschale‹, um die geforderte Patienten-
rolle peinlichst genau zu erfüllen.«92
Zimmermann betrachtet zunächst das Patientenverhalten im
Allgemeinkrankenhaus, er erläutert hier das Verhältnis zu
verschiedenen Symptomen physischer Erkrankungen.
Die weitere Untersuchung bezieht sich auf das Zusammen-
spiel von seelischen, psychosozialen und religiösen Faktoren
für Gesundheit im multikulturellen Horizont. Und so liegt
der Fokus hier auf dem Kranksein in der Form der psychi-
schen Erkrankung. Beispiele aus Großbritannien und Infor-
mationen über die Geschichte und Gegenwart der christlich-
muslimischen, deutsch-türkischen Begegnungen im Bereich
der Psychiatrie und Psychotherapie werden vorgestellt. Dies
bedeutet nicht, dass Beratung, Seelsorge und psychosoziale
Betreuung für muslimische PatientInnen im Allgemeinkran-
kenhaus ebenfalls relevant sind.
5.4.1 Psychiatrie und Psychotherapie
5.4.1.1 Großbritannien
Luthfa Meah beschreibt die Situation der Muslime in
Großbritannien im Hinblick auf die Möglichkeit, psychothe-
rapeutische und psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen:
»Psychische Erkrankungen bei ethnischen Minderheiten
häufen sich merklich. Untersuchungen belegen, dass
schwarze Bevölkerungsgruppen schneller in stationäre
Behandlung eingewiesen werden als die ethnische Mehr-
104
heit. Gleichzeitig ist auffällig, dass bei ethnischen Min-
derheiten größerer Widerstand besteht, professionelle
medizinische Hilfe bei psychischen Erkrankungen in An-
spruch zu nehmen. Das betrifft sowohl das Aufsuchen
von allgemeinmedizinischen Praxen als auch von Fach-
kliniken. In Regierungskreisen in Großbritannien ist die
Tatsache bekannt, dass die Behandlung psychischer Er-
krankungen bei ethnischen Minderheiten verbessert wer-
den muss, und dass den kulturellen Bedürfnissen entspre-
chende, für diese Arbeit besonders qualifizierte
Einrichtungen zur Verfügung stehen müssen. Als Schlüs-
sel für eine bessere Versorgung psychischer Erkrankungen
dieser Bevölkerungsgruppen wird der Abbau von Kom-
munikationsbarrieren zwischen dem Personal in Kliniken
und den Patienten gesehen. Voraussetzung ist es, sich die
Themen genau anzuschauen, die im Umgang mit musli-
mischen Klienten eine Rolle spielen«.93
Luthfa Meah beschreibt dann die volksreligiösen Hinter-
gründe vieler Muslime, die eine Behandlung im Sinne westli-
cher Medizin – und Psychotherapiekonzepte erschweren.
Viele Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten, Leidenszu-
stände und Ängste werden in der Religiosität des Volkes als
Folgen von Einwirkungen böser Geister angesehen.
Einen anderen Grund für die Zurückhaltung der Muslime
bei der Inanspruchnahme psychiatrischer und psychothera-
peutischer Dienste sieht Meah in der religiösen Tradition der
Muslime; hier gehört die Versorgung Kranker in den Aufga-
benbereich der Familienangehörigen und der Moscheege-
meinde. Psychisch Kranke werden nicht in »Pflegeheime«
gebracht.
»Die Moschee könnte zusätzlich als medizinisches Zent-
rum betrachtet werden (und das wird sie auch traditionell
in muslimischen Ländern), da man sich an den Imam
105
wendet, um gleichsam ›spirituelle Verschreibungen‹ zu
erhalten. Darüber hinaus gilt das Gebet als Therapie für
physische und psychische Leiden. Die Moschee hält
fruchtbare Ressourcen zur Heilung vor und hat in sich
das Potential, seelische Gesundheit zu stärken«.94
Diese letzten Gedanken werden an anderer Stelle95 eine weite-
re Erörterung finden.
5.4.1.2 Deutschland
Einen »Ratgeber für Muslime bei psychischen und psycho-
sozialen Krisen« stellen Malika Laabdallaoui und S. Ibrahim
Rüschoff vor.96
Ähnliche Phänomene, wie sie auch von Meah geschildert
werden, greifen auch sie auf. Volksreligiosität ist nicht immer
»kompatibel« zu effektiver psychologischer und psychiatri-
scher »westlicher« Hilfe. Muslime verweigern die Mitarbeit
an der Therapie, weil sie sie aus religiösen Gründen ablehnen.
Dies kann theologisch fundiert sein, aber auch im Bereich des
schwer zu überbrückenden Vorurteils angesiedelt sein. So
werden Jinn97 als Bestandteil des islamischen Glaubens angese-
hen, Magie und der Zauber des »bösen Blicks« in den Bereich
des Aberglaubens verwiesen. Für die psychiatrische Behand-
lung selbst wird aber auf diese religiösen Ursachen wenig
Rücksicht zu nehmen sein, insofern eine medikamentöse Ein-
stellung oder verhaltenstherapeutische Behandlungen in der
Regel vorrangig notwendig sind. Waschzwänge, Höhenangst,
Furcht vor Spinnen oder allgemeine innere Unruhe werden
medizinisch-therapeutisch weitgehend kulturell unabhängig
behandelt. Anders sehen beide VerfasserInnen den Zugang zu
Erkrankungen im Bereich der Depressionen und Suizidalität,
da hier ein enger Konnex zu den religiösen Vorstellungen der
Patienten besteht. Die Psychoanalyse wird als eine, wenn auch
selten angewandte Methode durchaus bejaht, obwohl sie in
ihren theoretischen Vorgaben die Religion ablehnt.
106
Wichtig ist beiden Verfassern die Frage nach der Kommu-
nikation zwischen TherapeutInnen und KlientInnen. Es geht
ihnen darum, dass eine Therapie nur gelingen kann, wenn die
Einstellung zum Islam geklärt ist, wenn der Therapeut nicht
eine religiöse Vorstellung entweder »überstülpen« oder »weg-
therapieren« möchte – und wenn die Patientin im Islam aus-
reichend bewandert ist, um mit ihren religiösen Gefühlen,
meistens Ängsten, angemessen umzugehen. Dass sich hier
Fehlformen aufgrund mangelnder Vorkenntnisse entwickeln,
ist bedauerlich (und stellt sich für den Umgang mit der christ-
lichen Religion im therapeutischen und beraterischen Setting
oft genauso dar).
Ob es sinnvoll und erfolgversprechender ist, eine/n musli-
mischen TherapeutIn mit muslimischen PatientInnen zu be-
fassen, lassen die Autoren offen. In der Praxis suchen ratsu-
chende muslimische KlientInnen selbstverständlich auch im
christlichen Umfeld geprägte TherapeutInnen auf. Somit be-
steht der Bedarf, sich über religiöse Vorstellungen und Ge-
wohnheiten individuell vor und während einer Therapie oder
Beratung auszutauschen.
Letztlich aber gibt es noch andere Faktoren zu berücksich-
tigen, wenn über Muslime und deren Versorgung innerhalb
der somatischen und psychosomatischen Medizin nachge-
dacht wird:
»Weiterhin werden Muslime in zunehmendem Maße
auch als Wirtschaftsfaktor wichtig. Das führt z.B. kon-
kret dazu, dass eine ostwestfälische Reha – Klinik ver-
mehrt muslimische Patienten gewinnen wollte. Es wurde
ein Konzept für diese Klinik erarbeitet, das sich inzwi-
schen seit mehreren Jahren bewährt und insbesondere
vielen praktizierenden muslimischen Frauen erstmals eine
Kur erlaubt, die bisher trotz dringender Indikationen we-
gen der fehlenden Umstände ( z.B. getrenntgeschlechtliche
Anwendungen ) nicht möglich war«.98
107
Über fragmentarische »Behandlung« hinaus sollen aber
Muslime ganzheitliche Wahrnehmung erfahren können:
»Für die Versorgungsstrukturen ergibt sich als wichtige
Konsequenz, muslimische Patienten und Klienten nicht
nur als Migranten und Ausländer wahrzunehmen, son-
dern in der Art und der Auswahl der therapeutischen An-
gebote auch die Religion als Leben gestaltendes Element
ausreichend zu würdigen. Hier sind vor allem in Kran-
kenhäusern islamisch unbedenkliche Speisen, Behandlun-
gen durch gleichgeschlechtliche Therapeuten, getrennt ge-
schlechtliche Anwendungen oder Hilfe und Unterstützung
bei der Möglichkeit, die Gebete zu verrichten, zu nennen.
Um das notwendige Vertrauen auf der Patientenseite zu
schaffen, ist der Einsatz praktizierender Muslime beim
Personal von großer Bedeutung, die sich in ihrer Religion
auskennen und Patienten entsprechend beraten kön-
nen«.99
5.4.1.3 Deutsch-Türkische Transkulturelle Psychiatrie
Ein historischer Überblick über die Situation der Transkul-
turellen Psychiatrie veranschaulicht den Stand der Diskussion
um die Betreuung psychisch kranker oder gefährdeter Men-
schen in Migrationskontexten, hier im Hinblick auf den Aus-
tausch Deutschland – Türkei.
Seit mehr als hundert Jahren bestehen Beziehungen zwi-
schen der Psychiatrie Deutschlands und der Türkei. Der erste
Lehrstuhlinhaber in der Türkei, Rasit Tehsin (1870–1936)
hat seine psychiatrische Ausbildung an der Universitätsklinik
Heidelberg absolviert...Auch sein Nachfolger, Mazhar Os-
man (1884–1951) war Schüler von Kraepelin100 und pflegte
eine sehr intensive Beziehung zur deutschen Psychiatrie mit
gegenseitigen Besuchen, regelmäßigen Kongressteilnahmen
und Studienaufenthalten von türkischen Ärzten in Deutsch-
108
land. Dieser ursprünglich sehr enge Kontakt zwischen der
Psychiatrie beider Länder veränderte sich nach dem 2. Welt-
krieg. Die Beziehungen zwischen der türkischen und ameri-
kanischen Psychiatrie gewannen zunehmend an Bedeutung,
Kontakte zur Psychiatrie in Deutschland verloren die ur-
sprüngliche Vorrangstellung. Trotz dieser Entwicklung waren
namhafte Vertreter der türkischen Psychiatrie ... über viele
Jahre hin an Universitätskliniken des deutschen Sprachraums
tätig und übernahmen später Lehrstühle in der Türkei.
Die wachsende Zahl türkischer Arbeitsmigranten in den
deutschsprachigen Ländern und deren psychische Probleme
hatten schon lange zu gemeinsamer fachlicher Kooperation
herausgefordert. Doch gab es bis 1994 keine institutionali-
sierten Kontakte zwischen psychiatrischen, psychologischen
und sozialpädagogischen Fachkräften beider Länder. Es wur-
den lediglich Vorträge türkischer Psychiater in Deutschland
aufgrund persönlicher Verbindungen organisiert. Fragen der
Migrationspsychiatrie fanden in der Türkei nur randständiges
Interesse. Aber auch in Deutschland fand diese Thematik
trotz ihrer Bedeutung für die psychiatrische Versorgung eines
wachsenden Bevölkerungsanteiles keine angemessene Auf-
merksamkeit. Weder in Forschung noch in Fragen psychiatri-
scher Versorgung wurde sie verankert. Vereinzelte Publika-
tionen erhellen den Eindruck etwas, aber insgesamt wurde im
Hinblick auf die psychische Gesundheit türkischer Migran-
tInnen wenig gearbeitet. Es handelt sich bei Forschungen
über die psychosoziale Situation türkischer Frauen und Ju-
gendlicher, über das Krankheitsverhalten türkischer Patienten
um Einzelaktivitäten, befristete Forschungsprojekte, die oft
nicht koordiniert waren und wenig Breitenwirkung hatten.
Angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit und der
damit verbundenen Zuspitzung gesundheitlicher Probleme
der türkischen Arbeitsmigranten war eine Intensivierung und
Koordinierung der Kontakte türkischer und deutscher Fach-
kräfte aus dem Gesundheitswesen dringlich geworden.
109
Der erste Deutsch-Türkische Psychiatriekongress fand im
April 1994 in Antalya statt. Er stellte einen wesentlichen
Schritt zu regelmäßigem und interdisziplinärem Austausch
von Fachleuten beider Länder dar. Es waren Psychiater, Psy-
chologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, Vertreter von Religi-
onswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sprachwissenschaf-
ten und Wirtschaftswissenschaften anwesend. Politiker und
Journalisten begleiteten den Kongress. Das Thema lautete:
»Psychologie und Pathologie der Migration und des Kultur-
wandels«.
Der Kongress war erfolgreich. Es wurden Konzepte für die
psychosoziale Betreuung von Arbeitsmigranten im deutschen
Sprachraum entwickelt. Es begann eine Vernetzung von
Fachleuten.
Eine Deutsch-Türkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und psychosoziale Gesundheit e.V. (DTGPP)
wurde gegründet. Ein wesentliches Merkmal der Gesellschaft
ist die Möglichkeit der Mitgliedschaft von Personen aus ver-
schiedenen Ländern, insbesondere der Türkei und den
deutschsprachigen Staaten.
Mehr als 220 Experten aus der Türkei, der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland, nahmen an dem Kongress teil; neben
Psychiatern und Psychologen auch zahlreiche Vertreter weite-
rer Fachrichtungen, die zur Förderung und Wiederherstellung
psychischer Gesundheit beitragen.
Seit den fünfziger Jahren sind Millionen von Arbeits-
migranten und Flüchtlingen nach Westeuropa gekommen.
Die vorhandenen präventiven und kurativen Strukturen er-
wiesen sich bislang in ihrer Funktion für die Bewältigung der
hieraus erwachsenden gesundheitlichen Probleme als unzurei-
chend. Dies führte zu bedrohlichen Entwicklungen, welche
die Veranstalter und Teilnehmer des Kongresses zu folgenden
Empfehlungen führten.
Das Leben in Flüchtlingslagern, Elendsquartieren und
Ghettos bedroht die gesunde Entwicklung und das friedliche
110
Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft. Da heilkundliche
Maßnahmen allein nicht ausreichen, sind die Politiker gefor-
dert, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse präventiv und kor-
rigierend umzusetzen und weitere Forschung zu fördern.
Zu der von Politikern und Arbeitsmigranten ursprünglich
erwarteten und auch vorgesehenen Remigration ist es nur bei
einem Teil der Migranten gekommen. Bei vielen kam es zu
langfristigen Aufenthalten, die zunehmend endgültigen Cha-
rakter tragen. Hieraus ergeben sich bei nicht wenigen indivi-
duelle, familiäre und gesellschaftliche Konflikte. Diese for-
dern auf heilkundlichem Gebiet nachstehend aufgeführte
Vorkehrungen, die nur mit politischer Flankierung durch-
führbar sind.
a. Bei Diagnostik, Behandlung und Betreuung psychisch
gestörter Migranten sind psychosoziale und kulturelle Fakto-
ren, die bisher weitgehend unbeachtet geblieben sind, zu be-
rücksichtigen. Einrichtungen der gemeindenahen psychiatri-
schen Versorgung müssen auch für Patienten dieser
Bevölkerungsgruppe zugänglich gemacht werden.
b. Umgehend sollten Modellmaßnahmen mit wissenschaft-
licher Begleitung begonnen und alsbald zu einem flächen-
deckenden Versorgungssystem entwickelt werden. Dabei
bedarf es muttersprachlicher Therapeuten und speziell ausge-
bildeter Dolmetscherdienste.
c. Die Bedürfnisse der allmählich aus dem Berufsleben aus-
scheidenden Arbeitsmigranten sind sicherzustellen, wobei
besondere Aufmerksamkeit einem Gutachtenwesen zu wid-
men ist, welches auch soziokulturelle Faktoren berücksich-
tigt.
d. Gesetzliche Maßnahmen, wie die Änderung des Staats-
bürgerschaftsrechtes und gesetzliche Verankerung der Wie-
derkehroption sind erforderlich. Bereits in Vorschul- und
Schulalter werden Weichen für eine körperlich und psychisch
gesunde Entwicklung und gesellschaftliche Integration ge-
111
stellt. Entsprechend ist hier eine intensive Öffentlichkeitsar-
beit und Erwachsenenbildung zu fördern. Jeglicher Form von
ethnischer und religiöser Diskriminierung ist entgegenzuwir-
ken. In diesem Zusammenhang wird die Dringlichkeit eines
Antidiskriminierungsgesetzes betont.
e. Auch die Reintegration der in ihr Herkunftsland zu-
rückgekehrten Migranten bedarf wirksamer Unterstützung.
Entsprechende Einrichtungen sind zu schaffen und zu för-
dern.
Folgende konkrete Schritte wurden auf dem Kongress ein-
geleitet:
– Gründung der Türkisch-Deutschen Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit.
– Fortsetzung der Kooperation in Arbeitskreisen, die bereits
während des Kongresses zu unterschiedlichen Themen ini-
tiiert wurden (u.a. muttersprachliche Therapeuten;
Migrantenversorgung im öffentlichen Dienst; Hilfe bei der
Remigration; psychologisch-psychiatrisches Wörterbuch;
Psychotherapie und Psychosomatik; Gutachtenfragen).
– Regelmäßige Folgekongresse mit interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit.
Die Gründung der »Deutsch-Türkischen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit«
am 28. Nov. 1994 in Marburg erfolgte als wesentliches Er-
gebnis des Kongresses in Antalya. Dabei wurden in der Sat-
zung als Ziele der Gesellschaft die Förderung der Zusam-
menarbeit von türkischen und deutschen Fachkräften aus
Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit und anderen Fächern,
die zur psychischen Gesundheit beitragen, benannt. Regel-
mäßige binationale Tagungen, Austausch von Fachkräften
und Publikationen sollen angeregt werden. Dies betrifft auch
Forschung und Lehre, die sich mit der Verbesserung der psy-
112
chosozialen Lage von Migranten, Remigranten und deren
Angehörigen in der Türkei und den deutschsprachigen Län-
dern befasst. Nicht zuletzt soll eine angemessene Gesetzge-
bung für die Belange von Migranten und Remigranten geför-
dert werden.
Drei weitere Kongresse in Istanbul 1996, Berlin 1998 und
Antalya 2000 folgten. Themen waren »Integration und
Krankheit? Wege und Irrwege der Migration«, »Psychosozia-
le Versorgung in der Migrationsgesellschaft« und »Persön-
lichkeit und Migration«.Ein Symposium über »Begegnung
mit dem Fremden« wurde 1999 in Marburg organisiert sowie
ein weiteres Symposium in Aachen 2000 und in Berlin 2001
zum Thema »Transkulturelle Psychiatrie«. Es entstanden
Fachtagungen zum Gutachtenwesen mit Juristen, Medizinern
und Sozialwissenschaftlern. Auch in der Türkei gab es zahl-
reiche Aktivitäten der Gesellschaft, die im deutschsprachigen
Raum mehr als 160 Mitglieder zählt, von denen weniger als
die Hälfte türkischstämmig und bilingual ist. In der Türkei
sind ca. 60 Mitglieder aus verschiedenen Berufsgruppen re-
gistriert, meistens Wissenschaftler und Mitglieder von Uni-
versitäten.
Die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen in Deutsch-
land und in der Türkei und die Entwicklung länderübergrei-
fender Projekte entsteht meistens aus dem Wunsch der bilin-
gualen Mitglieder heraus. Es besteht ein Unterschied in den
Vorstellungen der Mitglieder in der Türkei und in Deutsch-
land. Psychiatrische Versorgung für Minoritäten in Deutsch-
land und Konzepte der Transkulturellen Psychiatrie sind für
die deutschen Mitglieder wichtig. In der Türkei hingegen
besteht wenig Interesse an den Themen der Migration, mehr
aber an den generellen Themen der Psychiatrie.
Geplant ist schließlich der Aufbau von Partnerschaften
zwischen Institutionen in Deutschland und der Türkei. Dabei
ist an Kliniken, aber auch andere psychosoziale Versorgungs-
institutionen zu denken. Es könnten so neue Strukturen der
113
Kooperation entstehen. Die Verbesserung der psychosozialen
Versorgung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern
in Deutschland ist darüber hinaus auch weiterhin ein zentra-
les Thema. Es ist zu hoffen, dass der Arbeitskreis »Transkul-
turelle Psychiatrie« bei der Bundesdirektorenkonferenz (Lei-
tungskonferenz psychiatrischer Krankenhäuser) die
Sensibilität für die Situation nichtdeutscher Patienten verbes-
sert.101
117
6 Entwicklung einer kulturell sensiblen Kommunikation
Zwischen Arzt-Visite, Krankengymnastin, Gebäudereini-
gung und Austeilung des Mittagessens für die Patienten, sind
Psychologen und Seelsorger bei ihrer beratenden und beglei-
tenden Arbeit auf den Stationen im Krankenhaus tätig: Im-
mer wieder ergeben sich ähnliche Gesprächs-Situationen: Im
Krankenzimmer in der Frauenstation gibt es drei Betten.
Zwei Frauen lesen und scheinen sich zu langweilen oder sie
fühlen sich gestört. Im dritten Bett liegt eine alte Frau. Sie
trägt ein Kopftuch, eine dunkle Bluse, hochgeschlossen, die
Decke bis zur Mitte über den Körper gezogen. Um sie herum
stehen mehrere Menschen. Sie unterbrechen ihre Unterhal-
tung, sehen ebenfalls zur Besucherin hin, lächeln freundlich,
signalisieren, dass die Patientin nicht deutsch spricht ...
So stellt sich eine der nicht seltenen Erfahrungen im multi-
kulturellen Alltag eines Krankenhauses dar. Eine traditions-
gebundene Muslima, vermutlich gebürtig in der Türkei, zwei
deutsche Frauen, vermutlich christlich sozialisiert, Patientin-
nen im gleichen Zimmer.
Eine andere Situation: Im Dreier-Zimmer der Männersta-
tion nach dem Besuch der beiden ihrer Sprache nach deut-
schen, vermutlich im christlich-abendländischen Kulturkreis
aufgewachsenen Männer steht nun für die Krankenhausseel-
sorgerin das Gespräch mit dem muslimischen Patienten an.
Immerhin liegt er im selben Zimmer, und es wäre unhöflich,
einfach wieder zu gehen. Wenigstens »Guten Tag« sagen, auf
jeden Fall nicht einen Besuch oder ein Gespräch aufnötigen.
Der Patient aber freut sich, ist dankbar für ein Gespräch,
118
erzählt viel. Am Ende nimmt er zwei Rosen aus dem von
Freunden mitgebrachten Blumenstrauß und überreicht sie
seiner Gesprächspartnerin. »So begegnet man einer Frau und
einer Besucherin eines Kranken in meiner Kultur«.
Zwei völlig verschiedene Verhaltensweisen, die oft in Ste-
reotypen vorkommen – sie begegnen einer aufmerksamen
Betrachterin auf dem gleichen Gang durchs Krankenhaus.
Hinter den Türen der Behandlungszimmer gibt es andere
Beobachtungen: Immer wieder schleichen sich Missverständ-
nisse in die Kommunikation ein, weil der Arzt nicht türkisch
oder arabisch spricht. Der blumige Bericht der alten Türkin
lässt, wenn er übersetzt wird, nur schwer Rückschlüsse auf
ihre wirkliche Erkrankung zu.
Und wer übersetzt? Der Islamwissenschaftler und Medi-
zinethiker Ilhan Ilkilic bemerkt: »Wie kann ein Arzt sicher
sein, wenn er einer anderen Sprache nicht kundig ist, ob ein
Reinigungspersonal das Gesagte wirklich gut verstanden und
angemessen übersetzt hat? In der Praxis ist es nicht selten,
dass türkische Krankenschwestern und Schülerinnen nicht die
türkische Sprache beherrschen. Umso schwieriger wird es
dann, wenn eine alte türkische Frau ihre Beschwerden in
einem Dialekt mit metaphorischen Begriffen zum Ausdruck
bringt.102
Eine deutsche Patientin kommt ins Krankenhaus. Sie ist
hochschwanger und im Moment sichtlich unglücklich und
überfordert von ihrer Situation. »Wenn ich gewusst hätte,
was alles auf mich zukommt, hätte ich kein Kind gewollt. In
der Schwangerschaftsgymnastik wurde alles so leicht darge-
stellt, nun habe ich starke Schmerzen, und es geht nichts
vorwärts.« Medizinisches Personal ist bemüht, der Patientin
die Situation so erträglich wie möglich zu machen, gleichzei-
tig aber auch nichts zu dramatisieren, da derlei Klagen alltäg-
lich sind.
Anders ist es im Falle einer misslungenen Kommunikation
zwischen einem Arzt und einer türkischen schwangeren Frau:
119
»Am ... wird bei einer damals 23jährigen Frau türkischen
Frau ihre zweite Entbindung im Rahmen eines Kaiserschnitts
und eine Sterilisation durchgeführt. Vor der Entbindung äu-
ßerte die Frau dem Arzt gegenüber: »Nix Baby mehr«, was
als ein Wunsch nach Sterilisation ärztlicherseits verstanden
wurde. Der Arzt hat sie über die Bedeutung und Folgen sowie
Operationstechniken einer Sterilisation informiert. Nach der
Aufklärung nickte die Patientin, die rudimentäre deutsche
Sprachkenntnisse besaß, auf die Frage, ob sie alles verstanden
habe. Ein Tag später wurde der Eingriff durchgeführt. Später
verklagte die türkische Frau den Arzt auf Schmerzensgeld, er
habe sie ohne ihr Wissen sterilisiert.103
Was formal vielleicht durch die Anstellung eines Dolmet-
schers bis zu einem gewissen Grad zu lösen wäre, wirft eine
inhaltliche Problematik auf: Im Rahmen des eigenen Denk-
systems und Kulturkreises verstehen sich Menschen mit un-
terschiedlichen Signalen; da ist zum einen die gleiche Sprache,
aber auch Gefühle spielen eine große Rolle, selbst wenn sie
nur in Ansätzen gezeigt werden. Der Gesprächspartner ver-
steht sein kulturell nahes Gegenüber, den anderen Deutschen
oder die Schweizerin, oder er meint zu verstehen, und er
kommt wenigstens zu einer gewissen Annäherung an die
signalisierte Aussage.
Anders ist es, wenn die Sprache die einzige, dazu sehr un-
vollkommene Brücke zum gemeinsamen Erleben ist. Sicher
mag eine deutsche Ärztin, ein deutscher Krankenpfleger,
einfühlen, wie es der gebärenden fremdsprachigen Frau zu-
mute ist. Dennoch versteht er nicht jede Gefühlsregung. Ihre
eher hilflose sprachliche Aussage bedeutet hier ganz offen-
sichtlich den ersten gewählten Zugang zu ihr, der von ihm
genutzt wird.
Es mag sein, dass gerade da, wo »Fremdheit« vermutet
wird, auf die Worte besonders geachtet wird – und so wird
das gefühlsmäßige Verstehen verhindert und das eigentliche
Missverständnis hergestellt.
120
Ärzte und Ärztinnen aus islamischem Kulturkreis, Pfleger
und Krankenschwestern, die in islamischer Tradition auf-
wuchsen, befördern selbstverständlich den Gesundheitsauf-
trag des multikulturellen Krankenhauses, sie tun dies nicht
nur für die muslimischen Patienten. Krankenhäuser sind
Räume kulturellen Austauschs in der deutschen und in vielen
der europäischen Gesellschaften, die einen wesentlichen Bei-
trag zu der Integration kulturell verschiedener Menschen
leisten.
Im Regelfall werden dabei die Medizin und auch die Hu-
manwissenschaften, die als Konzepte hinter beratender Hilfe
stehen, als empirisch orientiert, wertneutral und kulturunab-
hängig angesehen. Ob dies so ist, und welchen Beitrag zur
Gesundheit eines Menschen sie in einer wertpluralen Gesell-
schaft leisten können, soll im Folgenden untersucht werden.
Es soll aus der Reflexion bestehender Beratungsansätze,
die innerhalb der christlichen, westlichen Kultur entwickelt
wurden, eine Perspektive für interkulturelle Bezüge in der
Begegnung in verschiedenen Institutionen eröffnet werden.
Zugleich soll ein Ausblick auf die Möglichkeiten kulturell
sensiblen gegenseitigen Verstehens im interreligiösen Aus-
tausch gegeben werden.
6.1 Wege zur interkulturellen und interreligiösen Begegnung
Ausgehend von den Veränderungen der Kommunikation
und des Zusammenlebens nicht nur in Deutschland, sondern
in der ganzen Welt, hat die Gesellschaft für Interkulturelle
Seelsorge und Beratung (SIPCC) sich folgende Ziele gesetzt:
Die »Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Bera-
tung« (SIPCC) widmet sich auf jährlichen Tagungen in ver-
schiedenen Ländern der Begegnung von Menschen aus unter-
121
schiedlichsten Ländern und Kulturen der Welt. SIPCC hat
mehr als 200 Mitglieder aus Ländern aller Erdteile und ver-
schiedenen Kulturen.
Im »Interkulturellen Forum« kann jede/ jeder zu Wort und
– was manchmal bedeutsamer ist – zu emotionaler und bildli-
cher Wahrnehmung durch andere gelangen.
Das Interkulturelle Forum dient der Reflexion der kulturel-
len Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dabei geht es vor allem
auch um eigene Bilder und Vorurteile. Die Erfahrungen kul-
tureller Verschiedenheiten, Ähnlichkeiten und Gemeinsam-
keiten sollen nicht nur erlebt, sondern auch angesprochen, so
weit wie möglich öffentlich gemacht und in einen interkultu-
rellen Dialog eingebracht werden. Die Erweiterung der ge-
genseitigen Wahrnehmung hat folgende Lernziele:
– sich den Fragen in Bezug auf eigene und andere Kulturen
zu öffnen
– gegenseitige kulturelle Achtung und Würdigung zu stärken
– fremden Kulturen angstfreier zu begegnen und Toleranz zu
leben
– mit unterschiedlichen und gegensätzlichen Prägungen Ge-
meinschaft zu bilden
– im eigenen seelsorgerlichen und beraterischen Arbeitsfeld
mit unterschiedlichen kulturellen Mustern bewusster zu
arbeiten.
Diese Lernziele setzen diverse Einstellungen voraus:
– Bereitschaft zum aktiven Zuhören und zum offenen Spre-
chen
– Gegenseitige Wertschätzung
– Geduld miteinander und Mut, Spannungen auszuhalten
– Bereitschaft, sich auf Fremdes einzulassen
– die eigene persönliche, kulturelle und spirituelle Prägung
einzubringen
– gelungene Schritte der Verständigung zu würdigen
Im interkulturellen Dialog ist es wichtig, einander Geschich-
ten von sich zu erzählen und auch, wie man andere wahr-
122
nimmt. Diese Geschichten werden von guten und schmerzli-
chen Erfahrungen, von der Freude des Zusammentreffens
und der Angst, Fremdem zu begegnen, handeln. Ebenso ist es
wichtig, im interkulturellen Dialog Fragen zu stellen und
zuzuhören, um neue Einsichten zu gewinnen.
Es geht darum, sich von interkulturellen Erfahrungen zu
erzählen undzu fragen: Was habe ich in meinen Begegnungen
mit Menschen anderer Kulturen gelernt? Welches sind die
kulturellen Hintergründe für meine Erfahrung und mein Ler-
nen?
Die Frage nach der kulturellen Selbst- und Fremdwahr-
nehmung setzt sich in der Arbeit von SIPCC in Reflexions-
gruppen fort. Dort treffen sich Mitglieder verschiedener Kul-
turen zum Gespräch. Vor allen Dingen aber findet kulturelles
Lernen statt an der Anschauung und gemeinsamen Betrach-
tung der Beratungspraxis der Mitglieder von SIPCC.
In der Mehrzahl in beratenden Berufen tätig, bringen sie
ihre Begegnungen anhand von Beispielen ein, beraten sie mit
anderen und gehen mit einer neuen Sicht der eigenen Erfah-
rung und Praxis aus der kollegialen Begegnung hinaus.
SIPCC sieht sich dem Ziel verpflichtet,
– Austausch zwischen Kulturen zu fördern bei Bewahrung
der eigenen kulturellen Identität,
– würdigt die Vielfalt der Menschen, Gruppen und Völker
– erkennt, dass Menschen in vieler Hinsicht gleich sind
– begreift menschliche Verhaltensweisen, Einstellungen,
Überzeugungen und religiöse Glaubensaussagen von den
jeweiligen geschichtlichen und räumlichen Lebenszusam-
menhängen her ( Kontextualität)
– fordert heraus, Fremdheit zu erkennen und einen Dialog
mit Fremden zu führen
– deckt auf, wie sehr Menschen, Kulturen und Völker auf-
einander Einfluss nehmen – und zwingt, den eigenen Le-
bensstil kritisch zu hinterfragen
– regt an, den Menschen aus anderen Kulturen in der eige-
123
nen Nachbarschaft angstfreier, mit weniger Vorurteilen zu
begegnen
– sieht jeden einzelnen Menschen als unverwechselbare Per-
son mit seiner eigenen Würde.
Deshalb beinhaltet die konkrete Arbeit von SIPCC in den
Zusammenhängen von Beratung und Seelsorge
– Interkulturalität mit religiösen Wahrheiten zu verbinden
und mit psychosozialen Grundsätzen
– Einstellungen und Methoden zu entwickeln, die Menschen
aus verschiedenen Kulturen auf kompetente und professio-
nelle Weise Lebensbegleitung anbieten.
Im Sinne dieser programmatischen und in der Praxis bereits
erprobten Vorgabe sollen nun einzelne psychotherapeutische
Ansätze und deren Weiterentwicklung auf interkulturelle
Beratungs-Konzepte hin betrachtet werden.
6.2 Ethnopsychoanalyse
Die Psychoanalyse, wie sie in verschiedenen Formen und
aus verschiedenen Ansätzen heraus in Europa und Amerika
gelehrt und praktiziert wird, basiert auf europäisch-
amerikanischen kulturellen Vorgaben. Ihre Entdeckung des
Unbewussten beansprucht für sich eine universale Geltung,
die inhaltliche Füllung dieser Entdeckung kann aber nicht als
universal angesehen werden. Sie ist abhängig von lange tra-
dierten Inhalten der jeweiligen Kulturen, innerhalb deren
Beratung und Therapie stattfindet. Eine mögliche Universali-
tät mag – je nach Auffassung – nur in bestimmten, kultur-
übergreifenden Archetypen oder in bestimmten generellen
Konstrukten über die Beschaffenheit des menschlichen Psyche
(Es – Ich – Über-Ich) anzutreffen sein.
Nach der Auffassung Freuds ist der individuelle Werde-
gang einer Person, zumindest im Hinblick auf die Ausbildung
124
seiner Psyche, mit den Entwicklungsstadien ganzer gesell-
schaftlicher Gruppen vergleichbar. Die Forschungen Freuds
gingen dahin, neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Psycho-
analyse gewinnen zu können, indem er das Seelenleben
»westlicher«, »zivilisierter« Menschen mit dem der »primiti-
ven« Völker vergleicht. Dabei wurde davon ausgegangen,
dass der moderne Mensch und seine Psyche, sein Seelenleben
das Ergebnis einer langen Entwicklung der Menschheit dar-
stelle. So seien bestimmte Verhaltensweisen, Denkweisen und
Charakteristika dieser Vergangenheit der gesamten Mensch-
heit auch beim einzelnen »Exemplar« des modernen Men-
schen zu beobachten. Freud ging davon aus, dass eine Inter-
dependenz bestehe zwischen der Entwicklung des
Individuums, seiner Umgebung und seiner Geschichte. Die
Psychoanalyse könne also nicht nur aus dem aktuellen Um-
feld lernen, sondern auch aus der kollektiven Vergangenheit
vieler Völker, um Heilmethoden für seelische Störungen zu
entwickeln. Lernen konnte der Psychoanalytiker schon da-
mals von Anthropologen und Ethnologen, die mit gesammel-
ten Daten, mit Hilfe der Empirie, der Mythenforschung und
der Beschäftigung mit gesellschaftlichen Traditionen schon
vertraut gewesen sind.
Freud kommt durch das Studium des Unbewussten seiner
Zeitgenossen zu dem Schluss, dass die modernen Menschen
den »Primitiven« näher stehen als gemeinhin angenommen
wird.
Freuds Gedanken muten heute eurozentristisch an, und
obwohl Freud kein Rassist ist und obwohl er die Theorien
Darwins gekannt haben wird, nimmt er nicht dessen Er-
kenntnisse auf, sondern orientiert sich an einem Modell, das
die Evolution vom Einfachen zum Komplexen hin sieht, ohne
historisch bedingte Entwicklungen und Einflüsse der Umwelt
mit ein zu beziehen. Er hält sich an die »vergleichende Me-
thode«, mit der von einem äußerlich ähnlichen Verhalten auf
eine Ähnlichkeit in Ursprung und Zweck dieses Verhaltens-
125
merkmals geschlossen wird. Freud arbeitet im Hinblick auf
seine völkerkundlich-psychologischen Studien eher spekulativ
und wählt solches Material aus, das zu seinen »ethnopsycho-
analytischen« Theorien passt. Widersprüchliches wird dabei
ausgeklammert.
Karl Abraham gehörte zu den ersten Psychoanalytikern,
die sich mit der Ethnologie befassten. Schon 1909 schrieb er
eine Studie »Traum und Mythos«
»Der Umgang der Analytiker mit der Ethnologie war in
ihren frühen Beiträgen meist dilettantisch und methodisch
nicht gesichert. In der Regel war das Interesse der Psy-
choanalytiker kurzfristig; es beschränkte sich darauf, in
der ethnologischen Literatur Belege zu finden, die Paralle-
len zu ihren klinischen Beobachtungen von Träumen,
Symbolen, Phantasien, neurotischen Symptomatiken und
weiteren seelischen Mechanismen aufzuweisen schienen.
Mit der Anwendung und Bestätigung psychoanalytischer
Ideen auf dem Gebiet der Ethnologie konnte der Gültig-
keitsbereich der Psychoanalyse räumlich auf außereuro-
päische Kulturen und zeitlich auf die Ursprünge der kul-
turellen Entwicklung der Menschheit ausgedehnt
werden.«104
Weniger an der Ethnologie und der Erforschung fremder
Völker interessiert, hat Carl Gustav Jung mit der Entwick-
lung seiner Archetypenlehre in ähnliche Richtung gedacht.
Auch Jung postuliert eine kulturgeschichtliche Entwicklung
der Menschheit, die von frühen Stufen der Symbolbildung in
immer differenziertere Bereiche der Wahrnehmung und der
Entwicklung kultureller und geistiger Stufen hin führt. Wie
Kulturen Entwicklungsschritte gehen und dabei für die ge-
samte Kultur geltende Symbole herausarbeiten, so geht auch
die einzelne Seele jedes Menschen den Weg der Individuation,
der Ausprägung individueller Qualitäten der Psyche, basie-
126
rend auf dem, was ihr durch kulturelles Erbe und gelernte
Tradition zugewachsen ist. Jede einzelne Seele prägt ihre
Symbole aus, die ihr Orientierung vermitteln und die zugleich
wie ein »Anker«, ein Haltepunkt im sich wandelnden Seelen-
leben fungieren.
»Der Begriff des Archetypus ... wird aus der vielfach
wiederholten Beobachtung, dass zum Beispiel die Mythen
und Märchen der Weltliteratur bestimmte, immer und
überall wieder behandelte Motive enthalten, abgeleitet.
Diesen selben Motiven begegnen wir in Phantasien,
Träumen, Delirien und Wahnideen heutiger Individuen.
Diese typischen Bilder und Zusammenhänge werden als
archetypische Vorstellungen bezeichnet. Sie haben, je
deutlicher sie sind, die Eigenschaft, von besonders lebhaf-
ten Gefühlstönen begleitet zu sein. Sie sind eindrucksvoll,
einflussreich und faszinieren. Sie gehen hervor aus dem
an sich unanschaulichen Archetypus, einer unbewussten
Vorform, die zur vererbten Struktur der Psyche zu gehö-
ren scheint und sich infolgedessen überall auch als spon-
tane Erscheinung manifestieren kann«.105
Mit allen diesen grundsätzlichen Annahmen, wie sie von den
Gründern der Psychoanalyse formuliert wurden, arbeitet die
Ethnopsychoanalyse. Sie prüft deren empirisch evaluierten
Gehalt und erweitert deren Grundannahmen durch ethnolo-
gisch gefundene und gesicherte Daten: Es ist vor allem zu
bedenken, dass sowohl die Forschung innerhalb der Ethnolo-
gie wie auch innerhalb der psychoanalytischen Wissen-
schaftsbereiche ständigen Wandlungen und Interdependenzen
unterliegt.106
Die Grundsteine der Ethnopsychoanalyse wurden bereits
in den 1930er Jahren gelegt, als auch die Psychoanalyse eine
erste Blütezeit hatte. In beiden Bereichen wurde eine Zäsur
gesetzt durch den Zweiten Weltkrieg. So gelang die prakti-
127
sche Entdeckung der Ethnopsychoanalyse erst in den 1950er
Jahren. Innerhalb der Sozialwissenschaften hat sich die
Ethnopsychoanalyse als qualitative Methode bewährt und
kann somit als eine selbständige Weiterführung und Ergän-
zung der klassischen Psychoanalyse angesehen werden. Im
praktischen Bezugsrahmen gehören ihre Erkenntnisse zur
Basisausbildung in der Exil- und Migrationsforschung, in
Themen der Akkulturation, Fragen der Anpassung, sowie der
Psychotraumatologie. Berücksichtigt werden sollen dabei
Wechselwirkungen von Sozialstruktur, Sozialisationsmustern
und Persönlichkeitsorganisation. Auch heute noch wird der
zentralen Fragestellung, wie gegebene Institutionen den Cha-
rakter der Menschen formen, nachgegangen. Jede Kultur
erzeugt über primäre Institutionen (Familienorganisation,
Säuglings- und Kinderpflege, Gruppenbeziehungen) eine spe-
zifische Grundstruktur der Persönlichkeit, die über sekundäre
Institutionen (Religion, Ritual, Mythen) reguliert wird und
Äußerungsformen und Möglichkeiten findet, um Bedürfnisse
zu befriedigen.
Georges Devereux, der Vorreiter der Ethnopsychoanalyse,
nahm an, Geisteskrankheiten und das Funktionieren der Psy-
che seien universell. Nichtsdestotrotz spielen sich Krankhei-
ten und Psychotherapien jedoch immer in einem bestimmten
kulturellen Umfeld ab, ungeachtet der Tatsache, ob dieses
wahrgenommen wird oder nicht. Devereux unterschied zwi-
schen einem ethnischen Unbewussten, das aus kulturtypi-
schen Verdrängungsprozessen, die von ethno-typischen
Traumen ausgehen, resultiert und dem idiosynkratischen
Unbewussten, das die schicksalsmäßigen traumatischen Situa-
tionen eines jeden Einzelnen umfasst. Beide Typen des Unbe-
wussten sind nicht ersetzbar, sondern zwei Dimensionen
desselben Gegenstandes. So ist es zum Beispiel bei Migranten
möglich, dass sich ihre Probleme nicht auf den üblichen We-
gen der Medizin und Psychiatrie analysieren lassen, da sie
erst durch einen bestimmten religiösen oder kulturellen Ver-
128
lust bzw. Zwang entstanden sein können und oftmals mit
dem Verlorengehen der Gruppenidentität und -dynamik in
Verbindung stehen. So scheinen bei Migranten die Krank-
heitsbilder oft mit einem Identitätsproblem der Zugehörigkeit
zu zwei Welten in Verbindung zu stehen, betrachtet man zum
Beispiel die Stummheit von Migrantenkindern, sobald sie das
Haus der Eltern verlassen. Hier versucht die Ethnopsychoa-
nalyse das komplexe Zusammenspiel zwischen der kulturel-
len und psychischen Ebene zu berücksichtigen. Wie eingangs
erwähnt, widmet sich die Disziplin auch den Problemen des
Lebens im Exil. Oft muss ein therapeutischer Ansatz in einem
solchen Fall das politische, soziale und kulturelle Umfeld der
Kinder berücksichtigen. Eltern im Exil (oftmals übernimmt
die Kindererziehung jedoch die Mutter) wollen ihrem Kind
die Werte der Kultur ihrer Herkunft näher bringen, dürfen
aber trotzdem nicht vernachlässigen, dass dieses Kind in ei-
nem Land lebt und einer Kultur aufwächst, die ihrer oftmals
sehr fremd ist. Nicht selten »müssen« Migrantenkinder in
sich Elemente verschiedener Welten, Logiken und Zugehö-
rigkeiten vereinen. Hier stellt sich die Frage nach Besonder-
heit und Universalität eines bestimmten (Krankheits-)bildes.
Wo beginnt das individuelle Verhalten oder die rein subjekti-
ve Perzeption des Kindes, und wo geht es um in dieser Kultur
immanente problematische Aspekte (z.B. das sehr unter-
schiedliche Rollenverständnis von Jungen und Mädchen in
z.B. türkisch-muslimischen Elternhäusern).
In der Praxis versuchen Therapeuten, durch Traumanaly-
sen, einer Erforschung des Sexuallebens, durch Spielanalysen
der Kinder oder psychoanalytische Auswertungen von My-
then, Ritualen und Zeremonien, den Menschen zu einem
besseren Verständnis ihres Problems / ihrer Krankheit zu
verhelfen. Jedoch muss man sich bei einer jeden Psychoanaly-
se immer bewusst sein, dass die Wahrnehmung einer Situati-
on von der Persönlichkeit des Wahrnehmenden grundlegend
beeinflusst wird.
129
Bei der Migrationsforschung geht es darum, herauszufin-
den, wie eine Person die Gleiche bleiben kann / soll, wenn
sich um sie herum alles grundlegend ändert. Therapeuten
werden in einem solchen Fall versuchen, Mythen, Rituale und
Erzählungen aus der Heimat des jeweilig Betroffenen zu fin-
den, um kulturelle Elemente der Herkunft zu nutzen und eine
therapeutische Beziehung zu unterstützen.
Ethnopsychoanalyse zu betreiben heißt also: Die äußeren
Umstände anderer Kulturen sind nicht völlig fremd, und auf-
grund ihrer Kenntnis kann der Berater oder Therapeut even-
tuelle religiöse oder durch Kultur bedingte Schemata besser
erkennen und therapieren. Eine solche Kenntnis von kulturel-
len Divergenzen wird sich im zwischenmenschlichen Verhal-
ten und besonders bei therapeutischer Arbeit »bezahlt ma-
chen«. Es kann nur hilfreich sein, den kulturellen
Hintergrund eines Mitmenschen zu kennen und auf diesen
reagieren zu können.107
6.2.1 Ethnopsychoanalyse im islamischen Kontext
Jalil Bennani, Psychiater und Psychoanalytiker, absolvierte
seine psychoanalytische Ausbildung in Europa und hat an-
schließend in Rabat/ Marokko eine therapeutische Praxis
eröffnet und dort wissenschaftliche Schriften veröffentlicht,
Thema: Migration der Psychoanalyse.
»Die Fragestellung der wissenschaftlichen Migration und
des Exils wandte er auf die Psychoanalyse in seinem Land
an und untersuchte dieses Thema historisch in Bezug auf
die Etablierung der Psychoanalyse in seinem Land (Ben-
nani, 1996, 2000). Die Psychoanalyse hat ihre ersten
Spuren in Marokko im Zuge der Auswanderung des fran-
zösischen Psychoanalytikers René Laforgue in den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts hinterlassen. Bei der Un-
130
tersuchung der ›Migration der Psychoanalyse‹ in Marok-
ko berücksichtigt Bennani verschiedene historische Ab-
schnitte und kulturelle Kontexte, wobei Kolonialge-
schichte, arabisch-islamische Kultur, traditionelle Formen
der Psychotherapie, Zweisprachigkeit, Diaspora in
Frankreich und in Kanada, Liberalisierung und Öffnung
des Landes und anderes als Faktoren der Wissenschafts-
entwicklung wirksam sind.
Benanni ist durch seine wissenschaftliche und publizisti-
sche Tätigkeit stark am Aufbau und der Verbreitung der
Psychoanalyse und Psychotherapie und der Verbreitung
des Ansatzes der Ethnopsychoanalyse in Marokko betei-
ligt, die in den 1970er Jahren begannen.«108
Benanni wendet die ethnopsychoanalytischen Ansätze vor
allem heuristisch und interpretativ an. Dabei wird der Anteil
der Begegnungen des 19. Jahrhunderts zwischen europäischer
und islamisch- arabischer Kultur als fundamentales und auf-
rüttelndes Ereignis mit in Betracht gezogen. Zum damaligen
Zeitpunkt fanden entscheidende, oft später negativ empfun-
dene Einflüsse der Europäer auf die arabisch-islamische Kul-
tur statt. Sie waren (z.T. militärisch) beherrschend, heraus-
fordernd, zum Teil zerstörerisch. Auf jeden Fall haben sie
sich tief greifend bemerkbar gemacht. Nur im Betrachten
dieser Umbrüche kann die plausible Entwicklung eines neuen
Ansatzes für diese spezielle, daraus entstandene Situation zu
gewährleisten sein – so Bennani.
Als interpretativer Ansatz zum Verstehen des Seelenlebens
eines Menschen müsse die Psychoanalyse von jeder Kultur für
sich »neu entdeckt« werden, sonst könne sie keinen eigenen
Zugang zum Unbewussten der Kultur und der Menschen in
ihr finden. So könne sie sich damit auch nicht als kritisches
Instrumentarium für eine Kultur bewähren. Und nur im Neu
– Entdecken der alten europäischen Ansätze für den jeweili-
gen nicht-europäischen Kontext könne die Psychoanalyse im
131
ethnopsychoanalytischen Zusammenhang eine wissenschaft-
liche Eigenständigkeit und eine Tradition ausbilden.109Andere
arabische Psychoanalytiker haben schrittweise auf diesen
Gedanken und Konzepten Bennanis aufgebaut. Allerdings
liegt insgesamt die Verbreitung der Psychoanalyse im diesem
gesamten Kulturkreis eher in den Anfängen.
6.3 Ethnopsychoanalyse und interkulturelle psychoanalytische Therapie
1995 erschien das Buch Interkulturelle psychoanalytische
Therapie von Peter Möhring und Roland Apsel, in dem Fol-
gendes formuliert wurde:
»Die Psychoanalyse kann zu der Entwicklung interkul-
tureller Psychotherapie Wichtiges beitragen, denn sie ver-
fügt, besonders unter Einbeziehung der Ethnopsychoana-
lyse, über die theoretische Breite, die eine angemessene
Würdigung der Bedeutung der Kultur für die Persönlich-
keitsentwicklung in ihren bewussten und unbewussten
Phasen erlaubt. Auch über die psychische Repräsentanz
des Fremden, die für die interkulturelle Begegnung so
zentral ist, kann die Psychoanalyse grundlegende Aussa-
gen machen, indem die Erfahrung des Fremden zunächst
entwicklungspsychologisch als grundsätzliche Erfahrung
des befremdenden Anderen, des anderen Geschlechts, so-
dann auch des eigenen »Fremden«, des Unbewussten, de-
finiert wird, um dann auf die Erfahrung mit fremden Kul-
turen und deren Angehörigen bezogen zu werden. So kann
sie theoretische Einsichten für interkulturelle Begegnungen
formulieren, die Personen in ihrer aktuellen Situation, ih-
rem kulturellen Kontext und dem Verhältnis von bewuss-
ten und zu unbewussten psychischen Inhalten erfasst«.110
132
In der Folge bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Zahl
der Publikationen auf diesem Gebiet rasant gestiegen. Aber
nicht nur die Theorie und die in sich interessante Verbindung
von Psychoanalyse und Ethnologie wurden hier reflektiert. Es
ging auch zunehmend um die Darstellung und Reflexion
bereits erfolgter praktischer Ansätze. Zu einer Tagung unter
dem Titel »Ethnopsychoanalyse als gesellschaftliche Praxis:
Interkulturelle Therapie« wurde 2001 nach Zürich eingela-
den.111
In den evaluierten praktischen Erfahrungen ging es um die
Beratung von Menschen im Kontext der Migration und auch
um die Arbeit mit Asyl Suchenden, die an psychischen Beein-
trächtigungen leiden. Es wird konstatiert:
»Im psychosozialen Feld der Arbeit mit Exilanten und
Flüchtlingen gingen in den letzten Jahren deutliche Pro-
fessionalisierungs- und Spezialisierungsprozesse vor sich,
bei denen Ansätze aus ethnopsychoanalytischen Unter-
suchungen Beachtung fanden und aufgenommen wur-
den. Ähnliche Prozesse lassen sich an verschiedenen Or-
ten beobachten; ihre Protagonisten und Prota-
gonistinnen kämpfen auf vorgeschobenen auf psycho-
sozialem Neuland.«112
Nähere Erklärungen zu diesem Neuland gibt Peter Möhring,
indem er die ethnopsychoanalytische Forschungsmethode
beschreibt:
»Es wird versucht, das eigene Empfinden angesichts des-
sen, was es zu beobachten gibt, festzuhalten und bis in
seine unbewussten Dimensionen hinein zu verstehen. Dies
führt auch in der Regel zu einer veränderten Einstellung
gegenüber der eigenen Kultur und heutzutage ist das in
frage stellen des Eigenen, also der westlichen Industriege-
sellschaften, zu einem wichtigen Nebenprodukt der Eth-
133
nologie geworden. Der psychoanalytische Forscher ist ge-
genüber dem Emigranten meistens in einigen Punkten im
Vorteil. Er kann die Analyse seines Erlebens, soweit er es
– vielleicht auch noch mit Hilfe von Kollegen – vermag,
geduldig, aufwendig und sich zwischen dem Erleben, der
Deutung und der Abstraktion bewegend als Prozess der
Bewusstwerdung vorantreiben. So wird beispielsweise
analysierbar und verstehbar, warum eine Forscherin in
einer fremden Kultur der Südsee spontan keine Angst vor
sexuellen Übergriffen von Männern, stattdessen aber von
Frauen, entwickelt: Es stellt sich heraus, dass es dort ei-
nen Initiationsritus gibt, bei dem Mädchen von älteren
Frauen defloriert wurden ...«113
Ein vorurteilsloses und bedingungsloses Hineinversetzen in
die Erlebniswelt der fremden Kultur kann hier für den Analy-
tiker Anhalte und, wie er selbst zugesteht, Annäherungswerte
an das tatsächliche Erleben von Menschen bringen, die in
ihnen fremden Kulturen leben und sich emotional zurecht
finden müssen.
Dabei ist auch mit zu berücksichtigen, in welche Kultur
sich ein Mensch emotional hinein begeben muss. Manche
Kulturen erschließen sich durch ihren Selbstausdruck leicht
dem Zugang von außen, andere bieten eine verschlossene
Eigenwelt, mit der der Fremde nur schwer in Kontakt
kommt. So sind Schwierigkeiten bei der Anpassung an frem-
de Kulturen von vielen Faktoren abhängig und haben nicht
nur mit dem individuellen Zugang eines Menschen zu tun.
Toleranz und Gastlichkeit eines Gastlandes sind natürlich
enorm erleichternd. Sie sind geeignet, in der Kürze der Zeit,
die einem Fremden zur Gewöhnung bleibt, ›gute‹ Bilder der
Fremde zu schaffen. So können Vorurteile und Ängste leich-
ter abgebaut werden.
Im Falle von Migration werden also individuelle Schwachstel-
len der Psyche eines Menschen leicht zu Sollbruchstellen.
134
Deshalb sind sowohl präventive wie therapeutische Überle-
gungen und Maßnahmen besonders angezeigt.
6.4 Familien- und Systemische Therapie und Interkulturalität
Die Systemische Therapie wurde in den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts entwickelt und basiert auf der Familien-
therapie, die in den 50er Jahren entstanden ist. In dieser Zeit
begann man in den USA damit, bei Therapien nicht nur den
Klienten zu sehen, sondern das gesamte Umfeld, in dem er
sich bewegte. So wurde die Familie mit in die Therapie einbe-
zogen, so weit möglich, mit aktiver Präsenz oder wenigstens
in den Überlegungen zum seelischen Umfeld und Kommuni-
kationsrahmen des Patienten. Die Familientherapie fand un-
ter Paul Watzlawick Anerkennung als eine eigene Therapie-
form, die seelische Störungen als die Folge einer familiären
Kommunikationsstörung sieht und nicht nur als ein Problem
der individuellen Psyche. Durch Helm Stierling fand die Fa-
milientherapie auch Eingang in Deutschland, besonders an
der Universität Heidelberg. Aus vielen verschiedenen Konzep-
ten entwickelte sich dann, was seit 1980 »Systemische The-
rapie« genannt wird.
Verschiedene Schulen formen zusammen den Gesamtan-
satz der Familien- und Systemtherapie:
– Die strukturelle Familientherapie (Minuchin)
– Die psychoanalytische Familientherapie (Buchholz, Rich-
ter, Paul)
– Erlebniszentrierte und wachstumsorientierte Familienthe-
rapie ( Kempler, Papp und Satir)
– Strategische, systemisch-kybernetische Therapie ( Palazzo-
li, Sevini und Watzlawick)
135
– Narrative, systemisch-konstruktivistische Therapie und
Beratung
– ( Andersen, Ludewig und Stierling)
Systemisches Denken ist eine Methode, die Welt zu erfassen.
Es wird davon ausgegangen, dass alle Menschen in Systeme
von Denken und Handeln eingebunden sind, die jeweils ihre
eigenen Regeln und Verläufe haben. Sie grenzen sich in ihrer
Art von anderen Systemen ab. So verhält sich jeder Mensch
entsprechend dem Beziehungssystem, in dem er lebt und das
er kennt. Dieses System ist aber nicht feststehend, sondern in
ständiger Bewegung. Die Elemente des Systems stehen mit-
einander in Verbindung, und erst aus dem Zusammenspiel
einzelner Elemente des Systems kann etwas Neues erwachsen.
Das bedeutet: Wenn das System sich verändert, dann hat
das Auswirkungen auf die Umwelt dieses speziellen Systems
und der in ihm agierenden Menschen.
Für den Therapeuten ist es wichtig, das System einer Fami-
lie zu verstehen, wenn er mit seinem Klienten arbeitet. Er
muss wissen, aus welchem Hintergrund heraus der betreffen-
de Mensch denkt, fühlt und handelt. Denn um eine Änderung
zu erreichen, muss eine Wandlung von innen her möglich
sein.114
Ein Therapeut kann verschiedene Wege suchen, um das
System seines Klienten zu verstehen, sich in dieses System
hinein begeben – entweder, indem er die Familie zu sich ein-
lädt oder, indem er sie in ihren Räumen besucht. Diese Vor-
gehensweise nennt man Joining. Der Berater kann versuchen,
die Strukturen und die Sprache der Familie in der persönli-
chen Begegnung und im der Familie vertrauten Umfeld ken-
nen zu lernen. Dazu muss er Fragen stellen. Diese zirkulären,
die Thematik einkreisenden Fragen, betreffen das Muster der
Kommunikation, nicht in erster Linie deren formalen Inhalt.
Die Fragen tasten sich an das gefühlsmäßige Geschehen her-
an, umgehen es (zirkulär). Es sollen Selbst- und Fremdbilder
in der Kommunikation und Phantasien in und über den zwi-
136
schenmenschlichen Bereich genannt werden. Damit kann den
beteiligten Personen an einem systemischen Prozess bewusst
gemacht werden, wie sie miteinander umgehen, sich dabei
eventuell schaden oder die Kommunikation erschweren.
Es sollen Beziehungsmuster und Hintergründe für das Ver-
halten einzelner Menschen aufgedeckt werden, um daran zu
arbeiten. Der Perspektivenwechsel des Beraters spielt eine
wichtige Rolle, um in festgefahrener Kommunikation deut-
lich zu machen, wo es vielleicht gangbare Auswege geben
könnte. Es werden Möglichkeiten konstruiert. »Was wäre,
wenn?« Durch solche Fragen kann der Horizont für Wahr-
nehmungen erweitert werden. Es finden sich vielleicht neue,
bisher unbekannte Lösungsmöglichkeiten.
Mit diesen Schritten beschreibt Christoph Morgenthaler115
das Vorgehen innerhalb der Interventionen der Systemischen
Therapie sowie deren Ziele.
Wenn Berater und Hilfesuchender aufeinander treffen, ent-
steht ein drittes System jenseits der beiden, aus denen diese
Personen heraus kommen, denken und handeln. Dies ist de-
ren gemeinsames System. Es ist eine Art Arbeitsbündnis, das
als Metasystem für einen bestimmten Rahmen etabliert wur-
de.116
Den speziellen Fokus auf die »Interkulturaliät« legt Chris-
toph Schneider-Harpprecht, wenn er die Methoden der struk-
turellen Familientherapie sichtet.117
Schneider-Harpprecht spricht von der
»Einsicht, dass die Familie und ein je spezifisches Ver-
ständnis der Familie in den meisten Kulturen so zentral
ist, dass sie in die Arbeit von Beratung und Seelsorge un-
bedingt einbezogen werden muss«.118
Es ist zum einen hilfreich und sehr interessant, Schneider-
Harpprechts umfangreiches Werk zu Interkultureller Bera-
tung und Seelsorge zu zitieren und für den Kontext der Seel-
137
sorge und Beratung zu betrachten, wie sie im Islam in Europa
und in einigen islamischen Ländern in den Anfängen prakti-
ziert und reflektiert wird.
Zum anderen entsteht dabei die Problematik, dass Schnei-
der-Harpprecht seine Darstellungen, Überlegungen und Kon-
zepte zwar weitläufig angelegt hat, dabei aber von der Multi-
kulturalität im amerikanischen Raum – Nord- und Südamerika
– ausgeht. Es treten auch in der Reflexion der Multikulturalität
der USA selten Muslime als eine spezielle Bevölkerungsgruppe
auf. Schneider-Harpprecht übernimmt oder entwickelt selbst
ein Konzept von »Marginalisierung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen in den USA«, das in dieser Weise auch im Ansatz
nicht auf Muslime in Europa übertragbar ist.
Die Situation der »Schwarzen« in den USA, der eingewan-
derten Spanisch und Portugiesisch sprechenden Bevölke-
rungsgruppen in den USA ist in sich sehr verschieden, dar-
über hinaus lassen sich wenige Verallgemeinerungen aus dem
allgemeinen Tatbestand der sozialen Benachteiligung oder
kultureller Divergenzen ableiten. Um dies sachgemäß tun zu
können und eventuell den einen oder anderen Gedanken auf
die Situation der verschiedenen Muslime in Europa zu über-
tragen, müsste eine sorgfältige Analyse der jeweiligen histori-
schen Gegebenheiten voraus gehen.
Dennoch sollen Aspekte der Untersuchung Schneider-
Harpprechts zu Wort kommen, die vielleicht eine vorsichtige,
umsichtig reflektierte Verallgemeinerung von Phänomenen
ermöglichen. Vielleicht können sie doch als erste Ansätze zu
Lösungsmöglichkeiten für die gesuchte Seelsorgepraxis der
Muslime beitragen.
»Es ging darum, Grundkenntnisse über den Einfluss der
Ethnizität auf den familiären Prozess, das heißt auf das
Verständnis von Familie, den familiären Lebenszyklus,
auf bedeutsame Sitten und Riten, Wertorientierungen und
charakteristische Probleme zu gewinnen. Damit sollten
138
den Familientherapeuten und -beratern Faustregeln an die
Hand gegeben werden, die ihnen helfen, einen kulturell
adäquaten Stil zu finden. Sie müssen beispielsweise wis-
sen, dass in der schwarzen Kultur »Familie« die weitere
Verwandtschaft, Nachbarschaft und Gemeinde umfasst,
dass die italienische Familie sich stets auf drei bis vier
Generationen erstreckt und bei den Chinesen alle Ahnen
und Nachkommen in die Familie eingeschlossen sind.
Ebenso müssen sie verstehen, dass in den kulturellen
Gruppen das Suchen äußerer Hilfe unterschiedlich bewer-
tet wird: Italiener halten sich an die Familie und nehmen
Fremde erst als letztes Mittel in Anspruch. Schwarze
misstrauen fremden Institutionen, abgesehen von der Kir-
che. Chinesen, Puerto Ricaner und auch Norweger soma-
tisieren psychischen Stress und bevorzugen ärztliche Hil-
fe, weil körperliche Symptome für sie akzeptabler sind als
psychische«.119
Es wird später zu überlegen sein, was dieses Beispiel für ver-
schiedene kulturelle Ausprägungen im Islam und unter den
Muslimen austragen kann.
Kritik an dem Ansatz der Familientherapie übt Schneider-
Harpprecht während der Darstellung der amerikanischen
Literatur zum Thema vor allem daran, dass in der Familien-
therapie zu wenig in politischen Dimensionen gedacht wird.
Es fehlt die Einordnung der jeweiligen Situation der Familien
in den größeren gesellschaftlichen Kontext, aus dem heraus
diese geformt wurden und in den hinein sie agieren. Die Zir-
kel der Interaktion innerhalb der Familie, ihre wie auch im-
mer geartete Hierarchie, ihr offenes System, das sich wandeln
kann, stehen aber in ständiger direkter Interdependenz zur
umgebenden Gesellschaft.
139
Narrative Therapie
Die Familientherapie hat sich im Laufe ihrer Geschichte
immer mehr vom Beobachten und Analysieren familiärer
Interaktionsprozesse nach einem eruierten therapeutischen
Muster weg bewegt. Es ging in der Folge mehr darum, nicht
einem vorgegebenen Schema zu folgen, sondern die sprachli-
chen Mitteilungen der jeweiligen Familien »ernst zu neh-
men«, zu hören, welche Wirklichkeit die Familien selbst kon-
struieren. Sprachliche Wahrnehmungen wurden ebenso
wichtig wie die Sensibilität für die emotionale Interaktion.
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung, die sich weniger
am vorgefertigten Struktur-Modell orientiert, sondern den
Lebens-Geschichten freien Raum gibt, entwickelten Michael
White, David Epston u.a. die Narrative Therapie.120
»Im Grunde genommen baut die gesamte systemische
Familientherapie auf konstruktivistischen Grundsätzen
auf. ... Je stärker sich die Familientherapie verbreitete,
desto mehr geriet jedoch in Vergessenheit, dass die Theo-
rien über die Familienstruktur und -dynamik in erster Li-
nie Metaphern sind. Die Kritik der neueren Vertreter ei-
ner konstruktivistischen Therapie wie Anderson,
Goolishian oder White an den strategischen und struktu-
rellen Modellen der Familientherapie erinnert diese an ih-
re eigenen Wurzeln. Sie haben eine Wende der struktura-
listisch-systemischen Sicht zu einer hermeneutisch-
narrativen Sicht der Therapie vollzogen, in der sie dem
Inhalt dessen, was die Familien erzählen, zumindest eben-
so große Bedeutung beimessen wie den Interaktionen ...
Den TherapeutInnen geht es darum, die Weltsicht der
Familie zu verstehen, sich von ihr leiten zu lassen und
nicht vorgefertigte Theoriemodelle überzustülpen. Ange-
sichts der Relativität der Wirklichkeitsperspektiven hat
die von den Familienmitgliedern vorgetragene Sicht ihre
140
eigene Berechtigung und ist aus ihrer Sicht verständlich.
Gemeinsames Verstehen der Probleme ist darum unum-
gänglich. Das führt zu Veränderungen im Therapeuten-
Verhalten. Die TherapeutInnen sind bereit, ihre eigene
Sichtweise zu relativieren. Sie lassen sich verstehend und
Fragen stellend auf die Familien ein. Die Klienten und
nicht die Therapeuten sind die Experten für die Lösung
der Probleme. Man kann dies als eine teilweise Rück-
wendung zur verstehenden und bedingungslos anneh-
menden Haltung der klientenzentrierten Gesprächspsy-
chotherapie von Carl Rogers121 werten, auf jeden Fall
jedoch als einen Versuch, die Machtposition des Thera-
peuten zu verlassen«.122
Es geht also in der narrativen Therapie um eine größere Sen-
sibilität gegenüber den Machtstrukturen, die durch vorgefer-
tigtes »Expertenwissen« aufgebaut werden. Es soll eine grö-
ßere Bescheidenheit im Hinblick auf die Geltung
theoretischer Modelle praktiziert werden. Politische Haltun-
gen, Werte hinter Erzählungen, dargestellte Sachverhalte
sollen als bedeutsam in ihrem Gehalt betrachtet werden,
nicht nur in ihrem Wert für die Interaktion. »Erzählungen«
sind lokalisiert in der Geschichte von Menschen, im Verlauf
der Zeit.123 Menschen präsentieren in der Therapie ihr Leben
in Geschichte und Zeitbezügen. Die Kommunikation inner-
halb dieser Erzählungen entwickelt eine »intertextuelle
Welt«. Diese Welt ist geprägt von den Einflüssen der sozialen
Einbindung der Menschen und den Machtverhältnissen in
ihnen. Dabei kommt es darauf an, zu erkennen, inwieweit
Menschen dominante Sichtweisen der Wirklichkeit verinner-
licht haben, die ihnen die eigene Entwicklung erschweren.
»Die Geschichten der Menschen sind also das Ergebnis
des Einsatzes der Techniken der Macht, die sich ausge-
hend vom lokalen Bereich in den Individuen einnistet, sie
141
unterwirft und sich ausbreitet. Was die narrative Thera-
pie versucht, könnte als eine Operationalisierung von
Foucaults Ziel der ›Ent- unterwerfung‹ als einer subjekti-
ven Befreiung von den Einflüssen der herrschenden
Machtkonstellationen verstanden werden. Sie arbeitet
problemorientiert, das heißt: sie will den Menschen hel-
fen, sich neu zu den Problemen, von denen sie erzählen,
zu verhalten, und die Techniken der Macht, denen diese
sich verdanken, zu identifizieren. Von zentraler Bedeu-
tung ist darum die ›Externalisierung des Problems‹, die
Suche nach alternativen Problemlösungen, ihre Verstär-
kung und Einübung. Menschen, die ihre Probleme nicht
lösen können, beginnen sich ohnmächtig zu fühlen und
meinen, zunehmend von dem Problem beherrscht zu
werden, statt es zu beherrschen. Die narrative Therapie
verhilft den Klienten durch ›Externalisierung‹ zur Distan-
zierung von ihrem Problem, die ihnen ins Gedächtnis
ruft, dass sie ein von dem Problem unabhängiges Leben
haben, ihr Selbstvertrauen und das Vertrauen in ihre Fä-
higkeiten, die Situation zu kontrollieren, stärkt«.124
Der Mensch, der sich so als unabhängig von einem bestimm-
ten Problemkomplex erlebt, wird freier, seine Situation zu
betrachten. Seine Problematik wird durch den inneren Ab-
stand »dekonstruiert«, und gleichzeitig wird der Weg frei für
die Konstruktion neuer Perspektiven. Besonders interessant
werden in diesem Zusammenhang alle Erzählungen, die einen
Lösungsansatz in sich tragen, von geglückten Erfahrungen
des Klienten berichten. Sie bilden den Ansatz für Neu-
Entwicklungen.
»Die Realität, welche die Ratsuchenden narrativ präsen-
tieren, wird umerzählt und erscheint in einer neuen Per-
spektive. Die Erzähler entwerfen zunehmend Versionen,
die sich von der dominanten Geschichte, in der das Pro-
142
blem über sie herrscht, unterscheiden. Sie schreiben einen
Teil ihrer Lebensgeschichte neu und erleben sich dadurch
in neuer Weise als Subjekte«.125
Narrative Therapie verbindet also, stärker als die vorausge-
gangene Familien- und systemische Therapie, individuelle
Problemlösungen mit der Analyse der Einbindung von Men-
schen in soziale Machtgefüge. Innerhalb der sozialen Einbin-
dungen können Individuen lernen, einen Handlungs- und
Freiheitsraum zu gewinnen.
Narrative Therapie beansprucht für sich, genau wie die
Familientherapie, eine Kurzzeitpsychotherapie zu sein. Mit
gezieltem Fokus auf bestimmten Fragestellungen möchte sie
Menschen befähigen, mit dem Gesamt-Rahmen ihres Lebens
konfliktloser umgehen zu können. Es geht um »lösungsorien-
tierte Beratung«, d.h. weniger um die Frage eines gesamten
Lebenskonzeptes und des inneren Zusammenhanges als um
die Ausrichtung auf jeweils mögliche Perspektiven. Realisti-
sche Zukunftspläne sollen angegangen werden, Lösungen
entworfen werden, die unter den jeweiligen politischen und
sozialen Bedingungen für die jeweilige Person gangbar sind.
Arbeitsphasen in der Beratung sind:
– »Zielfokussierung – Formulieren von wünschenswerten
Zielen«
– Suche nach Zeiten und Setting des Lebensgelingens
(Reframing)
– Stellvertretende Lebensdeutung und die Ko-Konstruktion
von Lösungswegen126
Diesen methodischen Ansätzen liegt eine narrative Orien-
tierung zugrunde. Es sollen Aspekte der Lebensgeschichte
als Fundament für eine mögliche Gestaltung der Zukunft
betrachtet werden. Dies dient dem Zweck, Menschen zu
ermutigen, ihre Lebensgeschichte selbst aktiv zu entwerfen
und eine Kompetenz im Rahmen von Empowerment zu
entwickeln. Schneider-Harpprecht definiert »Empower-
143
ment« als Ermutigung, Lebenswirklichkeit neu zu kon-
struieren.
»Kontextualisierung geschieht, wenn ›Selbstbilder und
Selbstpräsentationen‹ des Individuums ebenso kritisch re-
flektiert werden wie die sozialen und kulturellen Kontex-
te, die den Verlauf seiner individuellen Entwicklung und
den seiner Probleme beeinflusst haben. Weitere Schritte
sind der konkrete Vorgriff auf die Zukunft, der einlädt,
sich von der Überzeugung, die gegenwärtige problembe-
ladene Situation sei unveränderbar, zu verabschieden. Die
Gesprächspartner werden ermutigt, gemeinsam mit den
Beratern Zukunftsentwürfe zu konstruieren. Ein dritter
Schritt ist die ›Herstellung von Kollektivität‹, das Teilen
von Erfahrungen mit anderen Betroffenen und die ge-
meinsame Organisation der Vertretung der eigenen Inte-
ressen. Sie will den gemeinschaftlichen »Abschied aus ei-
ner Position der Abhängigkeit und Defizienz und die
gemeinsame Reise in eine Position der Stärke durch sozia-
le Teilhabe und Sich-Einmischen«.127
Abschließend bemerkt Schneider-Harpprecht:
»Nach White und Epston tragen die Menschen selbst
dazu bei, dass ihre Probleme ungelöst bleiben«.128
144
7. Erzählen in Religion und Therapie
Die Darstellung verschiedener, auf europäisch-
amerikanischen Denktraditionen fußender Therapie- und
Beratungsansätze führt zunächst nicht weiter in dem Versuch,
konkret existente Kommunikation zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen in Deutschland oder auch zwischen Musli-
men und Muslimen in vielen islamischen Ländern zu erfas-
sen.
Es mutet wie ein theoretisches Spiel an, diese Ansätze zu
beschreiben, wenn sie im Kontext des Islam bislang wenig
Verortung gefunden haben. Sicherlich bedauert das Hohe
Amt für Religiöse Angelegenheiten in der Türkei, dass adä-
quate Hilfen oft fehlen, um die Beauftragten für religiöse
Führung und Betreuung zu befähigen, ihrer Aufgabe in einer
sich wandelnden Gesellschaft gerecht zu werden. Es wird
auch festgestellt, dass die Religion Kommunikationssysteme
bereitstellt, die dazu dienen, den Sinn des Lebens zu berei-
chern, das Leben menschenwürdig zu gestalten sowie zur
besseren gegenseitigen Verständigung der Menschen beizu-
tragen.129
Es stellt sich aber die Frage nach der Verknüpfung der be-
schriebenen therapeutischen und kommunikativen Ansätze
mit dem »Kommunikationssystem Religion«. Diese Verknüp-
fung ist im Islam ebenso vielfältig wie im Kontext der christ-
lichen Gesellschaften. Sie hängt ab von der Geschichte eines
Gebietes, eines Volkes, sie hängt ab von sozialen Strukturen
und Machtverhältnissen.
Die Debatte über die Menschenrechte und ihre Auslegung
findet hier Eingang in den Kontext von Religion, Psychologie
145
und Therapie. Die Frage nach kultureller Analyse unter dem
Gesichtspunkt der Macht muss gestellt werden, da die jewei-
lige dominante Auslegung von Religion von gesellschaftli-
chem Status quo abhängt.
Es ist auch zu überlegen, ob der Islam grundsätzlich mehr
gekennzeichnet ist von der Ausprägung bestimmter Archety-
pen religiösen Erlebens, die sich als Konstanten in vielen is-
lamisch geprägten Gesellschaften zeigen – oder ob er ein je
eigenes »System« darstellt, das nach Stand der Entwicklung
der umgebenden Gesellschaften Varianten aufweist.
Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Es
sollen Reflexionen aus dem Kontext des Christentums, der
christlichen Kultur und Theologie herangezogen werden und
auf ihre Möglichkeit befragt werden, als Anstoß zu »Trans-
formationen« für den Islam nutzbar gemacht zu werden.
Nicht zuletzt besteht ein enger Bezugsrahmen zwischen Re-
ligion, Medizin und Psychologie, insoweit beide Religionen,
besonders der Islam, Körper und Seele des Menschen – und
deren Existenz gegenüber einer Transzendenz – im Blick ha-
ben.
7.1 Gemeinsame Werte in Medizin, Psychologie und Religion
Mit einem Zitat aus Überlegungen des Theologen und
Ethikers Dietrich Ritschl kann der Rahmen gesteckt werden
für die hier angeschnittenen Fragestellungen:
»Um aber Appellen ... Wirkung zu verleihen, bedürfe es
einer einheitlichen weltweiten ethischen Ausrichtung. Bei
der Mannigfaltigkeit der Kulturen und ethischer Grund-
entscheidungen sei das aber schwer möglich, da ja noch
nicht einmal Christen in der Lage seien, eine für alle ver-
146
bindliche Ethik zu formulieren (dies ist als eine selbstkri-
tische Reflexion zu verstehen, nicht als Kritik an anderen
Religionen, die Verfasserin).
›Der Gedanke der Menschenwürde‹, fuhr Ritschl fort,
›hatte sich aber über alle Grenzen hinweg gehalten.‹ Dif-
ferenzen würden einander angeglichen, so dass die Men-
schenrechte eine mögliche Basis für eine universale Ethik
werden könnten. Dennoch handele es sich bei dem Begriff
›Menschenwürde‹ um ein Ideal, einen Fluchtpunkt für
ethische Entscheidungen ...«130
»Ethische Entscheidungen« im Hinblick auf die Anwendung
der Ergebnisse moderner Humanwissenschaften werden von
Ritschl in Bezug gesetzt zu den Aussagen der christlichen
Religion – sie stehen aber auch auf dem Prüfstand vor den
Lehren und Traditionen des Islam. Wie Ilhan Ilkilic bemerkt,
bedarf es dazu auch wesentlicher Wandlungen in den Zugän-
gen zu den Quellen des islamischen Glaubens131 – sowohl in
der Interpretation der literarischen Quellen wie auch in deren
geistesgeschichtlicher und religionspsychologischer Interpre-
tation und Rezeption.
»Menschenrechte sind in Hoffnung antizipierte Definiti-
onen der Minimalbedingungen des gesellschaftlichen
menschlichen Zusammenlebens im Kleid juristischer Sät-
ze. Sie sind also einerseits Fluchtpunkte soziopolitischen
und anthropologischen Denkens und Handelns, anderer-
seits sind sie Versprechen an jetzt noch Entrechtete.132
In der Ethik geht es um Orientierung zum Handeln. Man
spricht von ›Handlungsorientierung‹ und den verschiede-
nen Schichten oder Ebenen, auf denen die Fixpunkte zu
finden sind, die solcher Orientierung dienen«.133
Theologie ist eine »Klarifikationsmaschine«, eine »Testappa-
ratur«, die Aussagen der Vergangenheit, Gegenwart und
147
Zukunft auf ihre Verstehbarkeit, Kohärenz und Flexibilität
überprüft ... Der Theologe stehe so in einem »Strom« der
Tradition. Diesen »Strom« aus Sprache, Handlungen und
Erinnerungen nennt Ritschl die »Story«.
»Was ist eine Story? Es scheint, dass das Wort auf zwei
Ebenen eine Bedeutung hat. Story ist, zunächst einmal,
eine literarische Form, eine Narration, eine Erzählung,
d.h. ein kurzer oder langer Komplex von Sätzen, die sich
mit einem Ereignis oder einer Sequenz von Ereignissen
oder auch Taten so befassen, dass diese Ereignisse, Taten
oder Gedanken mehr oder weniger kohärent erscheinen
... Daneben gibt es aber auch einen zweiten Gebrauch des
Begriffs Story, der vom ersten oft nur unscharf unter-
schieden werden kann. Wir sprechen von der Story Jesu,
oder von der Story der modernen Physik oder der westli-
chen Demokratie ...; und wir brauchen den Ausdruck
»Story of my life« oder Story meiner Ehe (und wir be-
haupten nicht, sie je vollständig erzählen zu können).
Die Beziehung zwischen beiden Arten von Story ist für
uns von besonderem Interesse. Die Frage entsteht
sogleich, ob einige der Stories des zweiten Typus die Ei-
genschaft haben, nicht erzählbar zu sein ...«134
Nicht erzählbare, tabuisierte Stories – Stories, die auch nicht
wandelbar sind. Was bewirken sie?
Was bewirken Stories, die erzählt werden zum Zwecke der
Wandlung?
Stories, die individuelle Lebensgeschichten von Arbeits-
migrantInnen zum Inhalt haben, die in einer ihnen fremden
Kultur alt werden? Stories, die einer sich verändernden
»westlichen« Gesellschaft erzählt werden?
»So sind für Hunderttausende die mit der Migration ver-
bundenen Pläne nicht in Erfüllung gegangen. Obwohl ihr
148
Ziel, den gravierenden ökonomischen Unzulänglichkeiten
in ihren Herkunftsgesellschaften und den damit verbun-
denen unerträglichen sozialen Zwängen zu entfliehen, um
die Lebensbedingungen ihrer Familien zu verbessern,
hartnäckig verfolgt wurde, konnte es doch von vielen
nicht erreicht werden oder musste aufgrund ungeplanter
familialer, soziokultureller oder wirtschaftlicher Konstel-
lationen entscheidende Änderungen erfahren. Die einst-
mals gesetzte Migrationsfrist wurde so immer wieder ver-
längert und die Rückkehr mehr und mehr hinausgezögert,
nie aber ganz aufgegeben, ja öfter sogar konkret ange-
gangen, ohne jedoch den Absprung wirklich zu schaffen.
Mit der fortschreitenden Änderung der sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse zu Hause, vor allem durch die
Migration der dynamischsten und arbeitsfähigsten Grup-
pen und dem damit verbundenen Strukturwandel, nahm
auch die Bindung an die Heimat immer mehr ab. Wurden
ursprünglich die Werte, Normen und Rollen, ja selbst die
einfachsten Formen der Lebensführung ihrer Herkunfts-
gesellschaft als richtig, besser, sogar als die eigentlich
menschlichen empfunden und im Gegensatz gesehen zu
denen der Residenzgesellschaft, so verwischten sich mit
der Zeit die scharfen Trennungslinien«.135
Und somit wächst die Notwendigkeit, neue individuelle Sto-
ries zwischen den erfahrenen Orientierungslinien zu erzählen.
Stories, die von den Brüchen und den durchgezogenen »Ro-
ten Fäden« einer Biographie berichten. Stories, die von ande-
ren gehört werden.
Stories schließlich, in denen sich Menschen Wesentliches
mitteilen über ihre Kultur und Religion, über ihre Herkunft
und ihre Sehnsucht, über die Verschiedenheiten und Gemein-
samkeiten – mit dem Ziel der von allen gesuchten Men-
schenwürde?
149
»Inzwischen sind auch die Autoren in der Philosophie
und in der Psychiatrie dem Phänomen der ›Story‹ nachge-
gangen. Freilich bietet es keinen Ersatz für saubere Begrif-
fe und klare Unterscheidungen. Es ist aber als eine Form
des Sprechens (und Hörens) erkannt worden, das noch
sozusagen »unterhalb« der Begriffe, an der Basis, seine
Funktion hat. Und wenn es stimmen sollte, dass nicht nur
die einzelnen Menschen, nicht nur einzelne Völker und
Kulturen, sondern die gesamte Menschheit eine erinner-
bare und antizipierbare ›story‹ hat, so wäre damit der äu-
ßere Rahmen der Ethik durchaus abgesteckt.
Wenn die umfassende Hoffnung Frieden und Gerechtig-
keit, also eine wirklich neue Welt zum Inhalt hat, so ist
auch jede Erneuerung, jede Therapie, jede Hilfe ... ein
Zeichen und ein Teil der antizipierten ›Gesamt-Story‹ mit
ihrem guten Ende«.136
Annemarie Schimmel beschreibt die kulturelle Differenz zwi-
schen traditioneller Anthropologie im Islam und den Grund-
annahmen »westlichen Denkens« mit folgenden Worten:
»Die Stellung des Menschen im Islam, und ganz beson-
ders im Sufismus, ist ein Kontroversthema für westliche
Gelehrte. Einige waren der Überzeugung, dass der
Mensch als Gottes »Diener« oder »Sklave« vor dem All-
mächtigen keinen Wert habe; er verschwindet fast, ver-
liert seine Persönlichkeit und ist nichts als das Instrument
eines unwandelbaren Geschicks. Der Begriff des Huma-
nismus, auf den die europäische Kultur so stolz ist, wäre
diesen Gelehrten zufolge dem islamischen Denken grund-
sätzlich fremd«.137
Wenn das denn für den Islam, zumindest in einer traditionel-
len Auslegung, zutrifft, dann steht eine wesentliche Begeg-
nung vieler Menschen aus dem islamischen Kulturkreis mit
150
ihrer eigenen Individualität an. Ein Weg der Individuation,
resultierend aus der noch neuen Erfahrung von fragmentier-
ten Lebensentwürfen, muss gefunden werden, eine »eigene
Story« erzählt werden.
7.2 Fragmentierung des Lebens und Familienkultur
»Familiensysteme erscheinen als sprachliche Systeme, die
ihre eigenen ›Sprachspiele‹ entwickeln. Die sprachliche In-
teraktion bestimmt das Selbst, die Weltsicht, Einstellun-
gen und Werte ihrer Mitglieder und verknüpft sie mit
Narrativen, mit Geschichten, mit denen sie kodiert sind
und überliefert werden. Auf diesem Hintergrund versteht
die von Michael White, David Epston, Tom Anderson,
Harold Goolishian, Hoffman und anderen vertretene
›narrative Therapie‹ den therapeutischen Prozess als De-
konstruktion und Umerzählung von Lebens-Geschichten
(re-authoring lives). Probleme und Konflikte, die Men-
schen erleben, sind verbunden mit symbolischen Wirk-
lichkeitskonstruktionen, mit Geschichten, die erzählt,
verzerrt oder unterdrückt werden können. Veränderun-
gen in Beziehungen sind möglich, wenn die Menschen die
Geschichten verändern, die ihre Sicht der Realität definie-
ren. Darum ermutigen narrative Therapeuten ihre Klien-
ten dazu, ihre Geschichten zu erzählen. Sie sind besonders
interessiert an Geschichten über alternative gelungenen
Problemlösungen (unic outcomes) und versuchen gemein-
sam mit den Klienten Geschichten zu finden, in denen
neue Formen, sich selbst und die anderen wahrzunehmen,
symbolisiert werden«.138
Hermeneutisches Prinzip ist auch hier, wie in der Bestim-
151
mung einer möglichen universalen Begründung für Ethik, die
Narrativität.
Individuelle oder auch für eine bestimmte ethnische oder
religiös fundierte Gruppe geltende Stories bilden die Grund-
lage für diskursives Verstehen. In dieser Annahme haben
Therapie, Medizinethik und Religion offenbar einen Konsens.
Zur Veranschaulichung des Hintergrundes für die »Narrative
Therapie« dienen noch weitere Differenzierungen:
»Die narrative Therapie zeichnet sich durch besondere
kulturelle Sensibilität aus. Beraterinnen und Berater steu-
ern den therapeutischen Prozess zwar aktiv. Sie sind je-
doch Teil eines Teams von teilnehmenden Beobachtern
(reflecting team)139, das in einen offenen Austausch mit
der Familie tritt und die Möglichkeit hat, Kulturunter-
schiede und kulturbedingte Schwierigkeiten im Bera-
tungsprozess aufzudecken und zu bearbeiten. Die narrati-
ve Therapie arbeitet mit den Symbolisierungen der
Klienten und ermutigt sie, Problemlösungen innerhalb des
symbolischen Rahmens ihrer regionalen und familiären
Kultur zu finden. Sie sucht Auswirkungen des ›kulturellen
Kolonialismus‹ in Psychotherapie und Sozialarbeit zu
überwinden und eignet sich gerade dadurch dazu, Identi-
täts- und Beziehungsprobleme anzugehen, die sich im
Kontext kultureller Konflikte entwickelt haben«.140
In Bezug auf die beobachtete Multikulturalität vieler Klienten
in der narrativen Therapie ist sicherlich Folgendes zu beden-
ken:
»José Szapocznik und William Kurtines haben darauf
hingewiesen, dass die Forschung generell mit der Vorstel-
lung eines ›idealisierten historischen und homogenen Kul-
tur-konzeptes‹141 gearbeitet hat, das der Realität der meis-
ten Familien in der modernen Gesellschaft (auch der
152
ethnischen Minderheiten) nicht gerecht wird. Sie leben in
einem multikulturellen Kontext, in dem sie dem Einfluss
verschiedener Kulturen ausgesetzt sind«.142
In »Multikulturelle systemische Praxis« stellen Arist von
Schlippe, Mohammed El Hachimi und Gesa Jürgens143 so-
wohl theoretische Zugänge wie auch darin eingebundene
Praxismodelle der systemischen Beratung besonders in der
Arbeit mit muslimischen Familien dar. In einer eindrucksvol-
len »Wanderung« durch die Welt der multikulturellen Zu-
gänge zu Menschen wird beschrieben, was dazu gebraucht
wird: Die Bereitschaft zum Suchen, die Einfühlung und Liebe,
die schließlich eine gewisse Erkenntnis ermöglichen. Nach der
Erkenntnis steht allerdings für den Berater die Selbstgenüg-
samkeit: »Auch das beste Pferd kann nicht zwei Sättel tra-
gen«.144
Es wird beschrieben, was beim Thema »Multikultur« die
Regel ist:
»Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Reali-
täten und Perspektiven. Unsere Hoffnung ist es, damit ein
konkretes Beispiel dafür zu geben, wie ›Fremdheit als
Chance gesehen werden kann und nicht nur als besonde-
res Problem in einem möglichst reibungslos zu organisie-
renden Versorgungssystem«.145
Im Gespräch mit der marokkanischen Familie von Mo-
hammed kommen wir auf das Thema ›Einsamkeit in
Deutschland‹. Spontan sagt einer unserer Gesprächspart-
ner: ›Einsamkeit ist für mich kein Problem, mein Problem
ist eher, dass ich nie einsam bin. Immer ist jemand um
mich herum!‹ So kann – je nach Kontext- Einsamkeit
oder Gemeinsamkeit gleichzeitig das Problem und die Lö-
sung sein.
›Aber wir sind in Afrika ... nicht die alte Klanstruktur
außer Acht lassen, deren oberstes Gesetz lautet: Teile al-
153
les, was du hast, mit deinen Brüdern, mit den anderen
Mitgliedern des Klans, oder wie man hier sagt, mit den
Cousins (in Europa ist die Bindung zwischen Cousins
ziemlich lose und schwach, in Afrika ist ein Cousin müt-
terlicherseits wichtiger als der eigene Ehepartner). D.h.
wenn du zwei Hemden hast, gib ihm eines ab, wenn Du
eine Schüssel Reis hast, gib ihm davon die Hälfte. Wer
gegen dieses Prinzip verstößt, verurteilt sich selbst zum
Außenseiter, dazu, aus dem Klan ausgestoßen zu werden,
zum Status des einsamen Individuums, ein Zustand, der
jeden mit Schrecken erfüllt. In Europa wird der Individu-
alismus hoch geschätzt, in Amerika sogar höher als alles
andere; in Afrika hingegen ist der Individualismus ein
Synonym für Unglück, ein Fluch oder eine Tragödie‹«.146
7.3 Der ganze Mensch – Leib und Seele
Es soll noch eine weitere spezielle Situation der »Multikul-
turalität« näher betrachtet werden. So wird klarer, welche
Unterschiede in der Vorstellung von emotionalem Zusam-
menhalten in Familien kulturell bestehen können:
»... zum anderen sind die Vorstellungen von pflegen und
gepflegt werden, wie sie auf unseren Krankenstationen
herrschen, denen, die unsere ausländischen Patienten
mitbringen, in weitem Umfange völlig entgegengesetzt.
Während hier die der Krankenpflege zugewiesene Aufga-
be sich mehr und mehr auf die Behandlung der Krankheit
richtet und dadurch immer weniger auf das Kranksein
des Patienten, ... ist es in all diesen Gesellschaften soziale
Verpflichtung (...), Kranken uneingeschränkt beizustehen.
So empfinden ausländische Patienten die in deutschen
Krankenhäusern geltenden Pflegeformen, die Stationsre-
154
geln und die ihnen zugewiesene Patientenrolle als fremd,
ja als unnatürlich.
Auch ihre Angehörigen, die gewohnt sind, einen Großteil
der pflegerischen Aufgaben zu übernehmen, fühlen sich
dadurch in die Distanz zu ihrem Angehörigen gedrängt
und ihrer sozialen Verpflichtung entzogen. Auch wenn sie
nicht in die Pflege einbezogen werden, so wird doch eine
dauernde Präsenz beim Kranken – auch nachts – ange-
strebt. Für Muslime ist es nicht nur soziale Verpflichtung,
sondern auch ein religiöses Gebot, das im Koran veran-
kert ist«.147
Für einen Nordeuropäer ist die Trennung des Kranken von
seiner Familie im Falle eines Krankenhausaufenthaltes selbst-
verständlich geworden. Wenn der Patient in einer Klinik sta-
tionär aufgenommen ist, reduziert sich die Anteilnahme, die
Bereitschaft zu Pflege und Unterstützung des Angehörigen auf
die Zeit des Besuches auf der Station – die in der Regel einge-
grenzt ist. Auch die Anteilnahme an der Erkrankung, an aku-
ten Schmerzen oder Schwächezuständen, ist naturgemäß
distanziert, wenn der Kontakt auf den Besuch reduziert ist.
Patienten, die Erfahrung mit einem solchen auf das Kranken-
hauspersonal delegierten Umgang mit Krankheit und Pflege
haben, werden sich darauf einstellen: Es kommt nicht ständig
Besuch, andere müssen arbeiten. Die Patienten werden ihre
Erwartungen vielleicht mehr auf das Fernsehen oder Lesen
richten als auf den mitfühlenden Besuch. Sie werden vielleicht
den erzwungenen Abstand vom Alltag als eine Chance zur
Ruhe und zum Rückzug nutzen. Sie werden ihre Erkrankung
als unabhängig von der sonstigen familiären Einbindung
erleben.
Wer aber gewöhnt ist, eine vertraute Gruppe um sich zu
haben, die vielleicht eine andere Sprache spricht als die der
Pflegenden und Ärzte, wird andere seelische Symptome ha-
ben. Er oder sie wird etwa mehr Angst bei Behandlungen
155
entwickeln und eventuell mehr unter der Einsamkeit leiden.
Daher mögen äußere Bedingungen in vielen Fällen auch di-
rekt auf das Befinden im Zusammenhang des Krankheits-
symptoms Einfluss haben; und so kann ein Magengeschwür
im einen Fall durch die Ruhe und die Medikamente heilen,
weil die Patientin nicht unter der Isolation vom Alltag leidet.
Im anderen Fall können Ruhe und Abgeschiedenheit von der
Außenwelt dazu beitragen, dass die Medikamente alleine
nicht erreichen, was die Mediziner versprechen.
Es liegen verschiedene Konstruktionen von dem vor, was
»Patientenwirklichkeit« sein kann und soll. Diese Konstruk-
tionen werden sowohl von Medizin und Krankenhaus her
vorgenommen, wie auch von den Patienten und ihrem famili-
ären Umfeld.
Es liegen darüber hinaus verschiedene Familienkonzepte
vor, von denen eines dem kulturellen Raum seit langer Zeit
angepasst ist, das andere sich aber erst an veränderte Um-
stände gewöhnen muss.
Fragmentarisierung wird im einen Falle als Selbstverständ-
lichkeit gelebt, im anderen Falle als Ausnahmezustand und
als Quelle von einer Mangelerfahrung.
Die ganzheitliche Auffassung von Leib und Seele und so-
mit die Vorstellung des ganzheitlichen Betroffenseins aller
Organe durch die Krankheit ist oft der Grund dafür, dass
Menschen aus traditionell geprägten Gesellschaften nicht
die Körperreaktion benennen wollen oder können, die
krank ist.
»Es ist für unsere ausländischen Patienten kaum vorstell-
bar, dass – wie im Denken unseres naturwissenschaftlich
orientierten Medizinsystems – ein Organ oder ein Körper-
teil krank sein soll und der Rest des Körpers gesund.
Aussagen wie ... ›alles krank‹, ›alles schmerzt‹, sind somit
nicht auf Sprachschwierigkeiten zurückzuführen oder gar
auf geringe Differenzierungsfähigkeit aufgrund mangeln-
156
der Intelligenz, sondern sind Ausdruck eines ganzheitlich
empfundenen Krankseins«.148
Ähnliches gilt im Hinblick auf die seelische Gesundheit. Sie
ist nur im ganzheitlichen System, das Körper und Seele um-
fasst, zu verstehen.
»Nicht die Leber hat sich pathologisch verändert, nicht
die Lunge ist ›geschrumpft‹, weder ›pumpt das Herz leer‹,
noch ist der ›Magen verschlossen‹, und genau so wenig
hat der Nabel seine Lage verändert, ist aus der Mitte ge-
wichen, sondern der Mensch hat ›seine Mitte verloren‹,
ist aus dem Gleichgewicht geraten, aus seiner Zentriert-
heit, und das will er uns durch diese Metapher sagen, in
der Hoffnung, dass wir ihn in seiner Ganzheitlichkeit, in
seiner leiblichen, seelischen und sozialen Befindlichkeit,
verstehen und ernst nehmen.
Können und wollen wir dies, werden wir vielen helfen
können, helfen können aus einer sehr bedrückten und
bedrückenden Situation herauszufinden«.149
Zimmermann beschreibt die »Narrativität« seiner Patienten
aus einer anderen Kultur im Hinblick auf deren »Organspra-
che«. Seelisches Leid wird im Körper lokalisiert und auf die-
sem Wege dem sprachlichen Ausdruck überhaupt erst zu-
gänglich.
Zimmermanns Bilder sind präzise, und sie vermitteln
nachvollziehbare Eindrücke aus der Sicht des Mediziners.
Leider differenziert Zimmermann unter den »ausländischen«
Kulturen nur sehr wenig. Er setzt südeuropäische und vor-
derasiatische Kulturen gleich, was sicherlich eine gewisse
Vereinfachung der Sichtweise ermöglicht. Dies mag Phäno-
mene, die der Mediziner beobachtet, ein Stück weit erklären.
Fragen nach sozialer Einordnung, nach den Auswirkungen
gesellschaftlicher Macht – und Verteilungsverhältnisse, klin-
157
gen an. Sicherlich spielen sie für die Beobachtbarkeit von
Krankheitsphänomenen unter MigrantInnen eine große Rol-
le. Denn über die gleiche ökonomische Situation, nicht so
sehr über gleiche kulturelle Vorgaben, ist das medizinische
Phänomen entstanden, das Zimmermann das »Gastarbeiter-
syndrom« nennt:
»So stellte ein Großteil der psychiatrischen und sozialpo-
litischen Untersuchungen ›außergewöhnliche Syndrome‹
heraus, die dann allgemein als ›Entwurzelungssyndrome‹,
als ›Heimwehkrankheit‹ oder ›nostalgisches Syndrom‹
klassifiziert wurden ... und schließlich dann als so ge-
nannte ›Gastarbeitersyndrome‹ in die medizinische Litera-
tur eingingen.« 150
Verhängnisvolle Missverständnisse in der Medizin und im
Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen entstehen na-
türlich vor allem dadurch, dass die Sprachen nicht ausrei-
chend beherrscht werden. Ein Beispiel des Nicht-Verstehens
der Sprache, das bis zur juristischen Konsequenz führte, hat
Ilhan Ilkilic gegeben, indem er das Missverständnis zwischen
türkischer Patientin und Arzt anlässlich einer Geburt und
anschließender Sterilisation schilderte.151 Ein anderes Beispiel
geben von Schlippe, El Hachimi und Jürgens. Es geht um die
Zustimmung zur Dialyse-Behandlung eines dreijährigen Kin-
des; Sprachprobleme wie auch die schwierige Vermittlung
inhaltlicher Sachverhalte machten es den Ärzten schwer, hier
zum für das Kind therapeutisch angemessenen Ziel zu kom-
men. Die Autoren resümieren: »Niemand ist nur für sich
allein krank.«152
Körperliche Krankheit liegt also auf der Schnittstelle bio-
logischer, psychologischer und sozialer Prozesse und ist
damit eingebunden in die jeweiligen kulturellen Zugänge.
Der ganze Mensch wird behandelt, nicht nur das jeweilige
Organ.
158
Zum Phänomen der kulturellen Divergenz gehören auch
religiöse Auffassungen:
»So wurde von den Eltern eines 15jährigen an Krebs er-
krankten türkischen Mädchens die Kommunikation mit
den Mitarbeitern des psychosozialen Dienstes gänzlich
abgebrochen und diejenige mit dem medizinischen Perso-
nal auf ein Minimum reduziert. ... Was war passiert? Den
Eltern war mitgeteilt worden, dass ihre Tochter die Be-
handlung nicht überleben werde und dass innerhalb der
nächsten Wochen mit ihrem Tod zu rechnen sei. Von ei-
nem anderen Vater türkischer Herkunft kam die Informa-
tion, dass der Grund des aktuellen Kontaktabbruchs dar-
in liege, dass die Eltern des Mädchens glaubten, nur der
Todesengel Ezrail könne Todesbotschaft überbringen.
Manchmal trete jedoch der Teufel in Menschengestalt auf
und bringe dadurch den Tod, dass er ihn voraussage. Für
solche Teufel wurden nun die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Klinik gehalten: Ihre Vorhersage erst, so die
Sicht der Familie, habe den Tod herbeigerufen.«
7.4 Die universelle Methode des Erzählens
»Freundliche Rede lockt selbst
eine Schlange aus ihrem Loch«
(Arabisches Sprichwort)153
Zu Beginn des Kapitels 7 wurde die Frage aufgeworfen,
inwieweit eine Religion wie der Islam unter dem Begriff »Sys-
tem« zu fassen sei. Systeme sind wandelbar, und zwar durch
die bewusste und unbewusste Interaktion von Menschen.
Eine Religion fußt aber in ihrem Selbstverständnis auch
auf unwandelbaren Dokumenten, die als göttlichen Ur-
159
sprungs angesehen werden. Das gilt für die jeweiligen »heili-
gen Bücher«, aber auch für Erzählungen, Gesetze und Leh-
ren, die hohen normativen Wert haben.
Legenden aus dem Leben des Propheten, Lehren und Er-
zählungen von Sufi-Meistern, Hadithe des Propheten – sie
sind im guten Sinne Ausdruck der Phantasie und der Erzähl-
freudigkeit des Volkes. Sie werden aber sicher kaum als Zei-
chen von »Narrativität« von eben diesem Volk angesehen
werden. Dem Heiligen wohnt eine besondere, entrückte Di-
mension inne, die von normalen Erzählungen nicht eingeholt
werden kann. In jeder Volksreligiosität besteht die Tendenz,
aus Geschichten über heilige Personen Dogmen für das, was
diese Personen vermittelt haben, zu machen. An Dogmen
aber kann über die Jahrhunderte nichts mehr geändert wer-
den, sie garantieren unwandelbare Realität.
Wie unterschiedlich nimmt sich dazu der Begriff der »Nar-
rativität«, der Story aus, von der behauptet wird, sie sei in-
terpretierbar und wandelbar? Bei der es eine Umerzählung
und ein Reframing gibt.
7.4.1 Der Beitrag der Sprache
Sprache und alle Überlegungen zu deren Einsatz, ihrer
Formkraft, ihrer Schaffenskraft für die Ausbildung von Reali-
tät, stehen am Anfang der folgenden Ausführungen. Über
Sprache und Sprachen, eigene und fremde, wird jeder Zugang
zu Religion, Therapie und Medizin, zu Körper, Seele und
Geist, erst darstellbar und kommunizierbar. Beispiele erläu-
tern die Gefühlsimplikationen von Worten und Sachverhal-
ten:
»Auf einer Wanderreise durch den Atlas in Marokko sagt
der Bergführer zu dem begleitenden Dolmetscher: ›Bald
kommen wir an eine Stelle, wo wir schwimmen können!‹
160
Der Dolmetscher ermahnt die Reisegruppe, ihr Badezeug
bereitzuhalten. Als sie an den Ort kommen, findet sich
ein kleiner Bach, etwa knöcheltief mit Wasser gefüllt.
›Hey, du hast gesagt, wir können schwimmen!‹ sagt der
Dolmetscher. ›Können wir auch‹ ist die Antwort. Deut-
lich wird: Es gibt nur ein einziges Wort für Waschen und
Schwimmen – und in der Region ist es überhaupt nicht
üblich, zu schwimmen, so wie wir es in unserem Kultur-
kreis gewohnt sind. Wasser tritt dort, wenn überhaupt,
dann in Form von Rinnsalen und kleinen Bächen auf.
In den 30er Jahren prägten Sapir und Whorf die Hypo-
these von der linguistischen Relativität. Kurz gesagt, be-
deutet sie, dass äußerlich vergleichbare Begriffe in ver-
schiedenen Kulturen völlig unterschiedliche
Bedeutungsfelder besetzen können. Die Autoren gingen
bereits damals von der Überlegung aus, dass die Sprache
den Gedanken formt und dass in unterschiedlichen Kul-
turen durch unterschiedliche Sprachen ganz verschiedene
Bilder von Wirklichkeit erzeugt werden.«154
Nicht nur die objektive Wirklichkeit von »Baden« oder »Wa-
schen« ist hiervon berührt, sondern ebenfalls die Wirklich-
keit, die aus emotionaler Wahrnehmung entsteht:
»Auf einer Marokko-Reise hält ein Polizist uns wegen ei-
ner Verkehrsübertretung an. Nachdem er den (deutschen)
Ausweis des Fahrers (Mohammed) überprüft hat, lässt er
uns ohne Strafe weiterfahren. Auf erstaunte Nachfrage:
›Sie Armer, Sie müssen in der Fremde leben, sie sind ge-
straft genug!‹ In der ›Landkarte des Polizisten war ein
Aufenthalt in Deutschland nur als ›Strafe‹ vorstellbar, in
diesem Fall zu unserem Glück«.155
Emotionalität, die das »Eigene« als das Selbstverständliche
ansieht, belegt das »Fremde« mit Misstrauen. Begriffe, die
161
sprachlich verschieden ausgelegt werden können, verbinden
sich oft mit unterschiedlicher emotionaler Rezeption. Und so
entsteht ein neuer Sinn-Zusammenhang.
Neben der Formulierung dieser grundsätzlichen Fragen be-
schäftigt sich Theux-Bauer mit dem psychoanalytischen Wi-
derstand und der Übertragung auf eine nicht gleichsprachige
Therapeutin:
7.4.2 Sprache und Machtstrukturen
Sprache allein deckt aber nicht alle Wahrnehmungen der
Menschen in ihrem soziokulturellen Umfeld ab. Sprache ist
eingebettet in Strukturen, sie basiert auf Vorerfahrungen.
Eine Wahrnehmung kultureller Differenz unter dem Aspekt
der Machtfrage schlägt James Poling vor.156 Nicht jede Emp-
findung von Entwertung basiert allein auf frühkindlich-
familiären Erfahrungen, was natürlich auch ein Ausfluss von
Machtverhältnissen ist. Es kann aber ebenso eine reale, aktu-
elle Abwertung des erwachsenen Menschen aufgrund seiner
Rasse, seines Geschlechtes, seiner sozialen Situation vorlie-
gen. Er oder sie sieht sich vor einer Barriere, die weit weniger
zu überwinden zu sein scheint als es etwa in Erinnerung und
Aufarbeitung von Kindheits-Erlebnissen möglich ist.
»Nicht alle Unterschiede zwischen Personen und Grup-
pen können auf Sprache, Wissen, Einstellung, soziale und
materielle Erfahrung zurückgeführt werden. Manchmal
gibt es Unterschiede, die als Ungleichheiten oder als Un-
recht gekennzeichnet werden müssen ...
Wir müssen in der Lage sein, Einzelnen und Familien
Verständnis entgegenzubringen, deren Identität dadurch
beschädigt ist, dass ihre Kultur durch die Kultur der
Herrschenden beeinträchtigt und zerstört worden ist ...
162
Nach dieser Definition beruht kulturelle Vorherrschaft
a) auf einem System verkürzender Stereotypisierungen,
das b) die materiellen Lebensgrundlagen kontrolliert und
c) die eigene Kultur anderen als normativ aufzwingt.« 157
Es ist nicht zu übersehen, dass Poling für den amerikanischen
Kontext und seine speziellen Definitionen von Dominanz und
kultureller Subordination spricht. Dennoch verweist er auf
einen Gesamtzusammenhang, der auch für die Begegnung
zwischen Christentum und Islam, Okzident und Orient und
andere kulturelle Gegensätze zutrifft. Er erinnert an die
Grenzen der alles und alle verbindenden Sprache, die dann
gegeben ist, wenn Sprache zum Instrument wird – zum In-
strument der stärkeren Seite.
»Vorherrschaft erwächst aus einem System von Einstel-
lungen, Verhaltensweisen und Unterstellungen, das
Menschen nach sozial konstruierten Kategorien wie
Rasse, Geschlecht, Klasse etc. objektiviert und die
Macht hat, diesen Personen Autonomie, Zugang zu Res-
sourcen und das Recht auf Selbstbestimmung zu verwei-
gern, indem die Werte der vorherrschenden Gesellschaft
als die Norm gesetzt werden, an der alles andere gemes-
sen wird«.158
Sprache transportiert Einstellungen, nicht nur bewusste, son-
dern auch unbewusste Einstellungen. Was in Sprache ausge-
drückt wird, ist in der Psyche »vorsortiert« – in der Mutter-
sprache, in der fremden Sprache des Gastlandes. Liebe,
Angst, Abhängigkeit, Freude, Unterwerfung ... sie alle finden
ihren adäquaten Ausdruck – wenn der Mensch dazu fähig ist,
finden sie sich wieder in verschiedenen Sprachen, die unter-
schiedliche Nähe und Distanz zu dem jeweiligen eigenen Er-
leben des Sprechenden haben.
Eine machtgebundene Sprache wird immer auch psychi-
163
sche Repräsentanzen nutzen, die ihr helfen, Menschen zu
binden und zu unterjochen.
»Die Abwehrmechanismen, die aus dieser gewaltsamen
Konfrontation des Kolonisierten mit dem Kolonialsystem
entstehen, organisieren sich zu einer Struktur, in der sich
die kolonialisierte Persönlichkeit offenbart.«159
7.4.3 Religiöse Sprache und magisches Denken
Andere Konnotationen von Macht, Erzählen, Sprache als
Ausdruck von seelischen Bedingungen gehen von volksreligi-
ösen Vorstellungen aus. Luthfa Meah bestätigt mit ihren
Erkenntnissen die Wahrnehmung von Zimmermann, der das
Misstrauen eines Elternpaares gegenüber Diagnose und Me-
dizin westlicher Ärzte beschreibt. Diese Ärzte greifen mit
ihrer Diagnose in den Bereich der »Geister und Engel« der
islamischen Vorlksreligion ein, machen sich zu deren Kon-
kurrenz.
»Ein Grund dafür, dass Muslime zögern, die im engli-
schen Gesundheitssystem vorhandenen Einrichtungen zu
nutzen, liegt darin, dass sie misstrauisch gegenüber der
dort angewandten medizinischen Behandlung sind. Die
Patienten und ihre Familien erklären mentale und emoti-
onale Störungen von ihrem kulturellen Hintergrund her
und werden deshalb oft von dem medizinischen Personal
nicht verstanden. Zwei Phänomen werden immer wieder
als Ursache für Erkrankungen genannt: das eine ist die
Besessenheit von Geistern ( Jinn), das andere Schwarze
Magie (Jhado). Muslime glauben, dass neben den Men-
schen Geister als weitere Kreaturen existieren. Der Koran
sagt: ›Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum ge-
164
schaffen, dass sie Mir dienen sollen‹ (Sure 51, 56). Die
Geister hält man für Geschöpfe, die für menschliche Au-
gen unsichtbar sind, sich jedoch im selben Luftraum auf-
halten und vornehmlich in »Wüsten, Ruinen und an un-
reinen Orten wie Dunghaufen, Badezimmern und
Friedhöfen« zu finden sind. Man geht davon aus, dass es
unter den Geistern Gläubige gibt, die nach den Regeln
des Korans leben. Daneben existieren unter den Geistern
Ungläubige, die Regeln übertreten und sich an Menschen
vergreifen. Wenn ein Geist in einen Menschen fährt, dann
geschieht dies aus verschiedenen Gründen, z.B. weil der
Geist diesen Menschen beneidet. Es kann aber auch sein,
dass ein Mensch die Privatsphäre eines Geistes stört und
dieser sich rächt.
Muslime glauben, dass Geistbesessenheit oder Schwarze
Magie Ursache für psychische Störungen sind, die an-
dernfalls als Schizophrenie, Angst oder Phobie, Depressi-
on, Zwangsvorstellungen, Hysterie oder Gedächtnisver-
lust diagnostiziert würden. Muslime gehen traditionell in
die Moschee zur Behandlung und bitten dem Imam um
Schutzgebete160, um Exorzismus von jeder Art der Geist-
besessenheit, um Amulette, die man trägt, um sich vor
der Wirkung Schwarzer Magie zu schützen. Weiteren
Schutz bietet das Trinken von Heiligem Wasser.« 161
So zieht Meah die Konsequenz, dass in vielen Fällen die
»westliche« Beratung und Psychotherapie von den Muslimen
emotional nicht verstanden wird, als zweitrangig und kultu-
rell unpassend betrachtet wird. Dies gilt – wie gesehen – auch
für andere Bereiche von medizinischer Diagnostik und The-
rapie. Gute psychische, auch physische Gesundheitsversor-
gung muss auf die speziellen spirituellen Bedürfnisse und
Vorstellungen kulturell divergierender Menschen eingehen.
Dies wiederum ist vorrangig eine Aufgabe der »Kommunika-
tion ohne Vorbehalte«, der Kommunikation, die die dargebo-
165
tenen Erzählungen als eine Form der Wirklichkeitskonstruk-
tion akzeptiert und mit ihnen wertschätzend umgeht.
Schlussfolgerung: Eine veränderte Story kann nur dann
überzeugt und überzeugend erzählt werden, wenn dafür ein
plausibler Grund eingetreten ist. Solange gilt die gewohnte
Interpretation.
7.4.4 Religiöse Sprache und therapeutische Sprache
Religiöse Sprache kann die psychischen Eigenschaften und
Auswirkungen von machtgebundener Sprache in sich tragen.
Magisches Denken fördert machtgebundene Sprache und
angstbesetzte Erzählungen. Für viele Verlautbarungen aus
islamischen Kulturen wird diese Behauptung gelten – zumin-
dest wird sie leicht aus der »westlichen Perspektive« unter-
stellt.
Religiöse Sprache steht daher vielfach im Gegensatz zu
therapeutischer Sprache, die alle Macht – Konnotationen
eher zu vermeiden versucht.
Um aber der »Narrativität« als universeller religiöser und
therapeutischer Qualität Ausdruck zu verleihen, ist es sinn-
voll, die verschiedenen Sprachebenen auf Ähnlichkeiten hin
zu befragen.
Jalaluddin Rakhmat, Mitglied eine zeitgenössischen indo-
nesischen Sufi – Ordens, erklärt therapeutisch- narrativ reli-
giöse Inhalte, indem er sie in die bekannten, volkstümlich
überlieferten Geschichten seiner islamischen Tradition einbet-
tet.
Abul Said Abul Khayr wird erinnert als der Sufi, der den
ersten Sufi-Orden gründete:
»Wenn einer seiner Schüler vor ihm einen Heiligen er-
wähnte, der über das Wasser gehen konnte, sagte er: ›Seit
unerdenklicher Vorzeit haben Frösche das schon immer
166
gekonnt!‹ Wenn er dann noch einen Heiligen erwähnte,
der fliegen konnte, gab er zurück: ›Mücken können das
besser!‹ Wenn der Schüler weiter nachfragte, was das bes-
te Zeichen zum Erweis von Heiligkeit sei, sagte er: ›Der
beste Weg, näher zu Gott zu kommen, ist, den besten
Dienst an der Menschheit zu tun, das Glück in ihre Her-
zen zu bringen‹.162«
Eine andere Geschichte wurde sehr berühmt:
»Die Kinder Israels sagten eines Tages zu Moses: ›Oh
Moses, wir wollen unseren Herrn zu einem Mahl einla-
den. Sprich mit Gott, damit er unsere Einladung an-
nimmt!‹ Moses gab wütend zurück: ›Wisst ihr denn nicht,
dass Gott jenseits dessen steht, dass er Nahrung nötig
hätte?‹ Aber als Moses auf den Berg Sinai stieg, sagte
Gott zu ihm: ›Warum hast Du mich von der Einladung
nicht unterrichtet? Meine Diener haben mich eingeladen.
Sag ihnen, dass ich zu ihrem Festessen am Freitagabend
kommen werde.‹
Moses sagte das seinen Leuten, und jeder begann, über
Tage hin große Vorbereitungen zu machen. Am Freitag-
abend kam ein alter Mann an, erschöpft von einer langen
Reise. ›Ich bin so hungrig, sagte er zu Moses. ›Bitte gib
mir irgendetwas zu essen!‹ Moses sagte: ›Hab Geduld.
Der Herr aller Welten kommt gerade. Nimm diesen Krug
und hol etwas Wasser. Du kannst auch noch bei der Be-
dienung helfen. Der alte Mann brachte Wasser und fragte
dann nochmals nach Essen. Aber es wollte ihm niemand
zu essen geben, bevor der Herr eingetroffen wäre. Es
wurde später und später, und schließlich begann jeder,
Mose zu kritisieren, weil er sie in die Irre geführt hätte.
Moses bestieg den Berg Sinai und sagte: ›Mein Herr, ich
muss mich jetzt vor jedermann schämen, weil Du noch
nicht gekommen bist, wie Du es versprochen hattest zu
167
tun.‹ Gott erwiderte: ›Ich bin doch gekommen: Ich bin ja
direkt auf Dich selbst zugegangen! Aber als ich Dir sagte,
ich sei hungrig, hast Du mich zum Wasserholen ge-
schickt. Ich habe Dich dann nochmals gefragt, wurde
aber zum Bedienen geschickt. Weder Du noch Deine Leu-
te waren in der Lage, mich in Ehren zu empfangen.‹
›Mein Herr, ein alter Mann kam und fragte mich nach
Essen. Aber er war nur ein Sterblicher.‹«
Nun schlägt die anschauliche Narrativität dieser Geschichte,
die therapeutischen Wert hat, um in die Zitation einer religi-
ösen Belehrung:
»Ich war mit jenem, meinem Diener zusammen. Ihn zu
ehren hätte bedeutet, mich zu ehren. Ihm zu dienen wäre
mir zu dienen gewesen. Alle Himmel sind zu klein, um
mich zu fassen, aber nicht die Herzen meiner Diener. Ich
esse nicht und trinke nicht – aber meine Diener zu ehren,
das ist, mich zu ehren. Für sie zu sorgen, das ist, für mich
zu sorgen«.163
Macht (Gottes) wird in diesem Kontext als höchstes vor-
bildliches Dienen angesehen, Lehre im Gewand der Erzäh-
lung vorgeführt. Sprache zielt auf Begegnung in vielen Ebe-
nen.
Eine »aufgeklärte« islamische Theologie bedient sich hier
der Erzählsprache.
Ein wenig erinnert diese Form der Erzählung an Jesu
Gleichnisse, deren Einfachheit im Setting und deren Facetten-
reichtum in der Bedeutung. Die Geschichte zielt darauf ab,
rationale und emotionale Einsicht zu erwirken, Angst, Ab-
hängigkeit und Magie zu reduzieren. Es kommt nicht darauf
an, sich Gott gewogen zu machen durch devote Haltung,
sondern ihn sich zum Freund zu machen durch Nachahmen
seiner Qualitäten. In dieser Sprache verbinden sich verschie-
168
dene theologische Strömungen, Lehrtradition und Erzähltra-
dition – zu einer überzeugenden Synthese.
7.5 Islamische Narrativität und kulturell sensibles Verstehen
Jalaluddin Rakhmat erzählt eine Geschichte aus seiner
Praxis als Sufi – berater in Indonesien:
»Frau Tommy ist eine Frau um die 40. Sie war fünfzehn
Jahre lang verheiratet. Jahrelang haben sie und ihr Mann
glücklich in einer ziemlich stabilen Familie gelebt. Sie hat
zwei Kinder. Ihr Ehemann hat ein gutes Geschäft, und sie
leitet ein Ausbildungsunternehmen. Eines Nachts wacht
sie schweißgebadet auf. Jemand flüsterte unaufhörlich:
›Töte deinen Mann!‹ ›Töte deine Kinder!‹
Ihr war bewusst, dass es ein Wahn war. Trotzdem fürch-
tete sie sich, dass sie eines Tages töten würde. Schrecken
und Furcht, mit Zweifel vermischt, waren die deutlichen
Zeichen eines Angstzustandes. Sie ging zu einem Psychia-
ter, der fragte, ob sie irgendeine Droge genommen habe.
Sie bestätigte das, aber sie habe Drogen lange Zeit vor ih-
rer Hochzeit genommen. Sie habe sehr wenig genommen,
einfach um in ihrer Gruppe ›dazu zu gehören‹. Der Arzt
verschrieb ihr ein bestimmtes Medikament, dessen Name
sie mir nicht mitteilte.
Der in der Stadt bekannte Psychiater hatte sehr wenig
Zeit für Gespräche. Sie war enttäuscht. Viele Freunde
empfahlen ihr, traditionelle Glaubensheiler aufzusuchen.
Sie ging von Glaubensheiler zu Glaubensheiler. Die Angst
blieb. Schließlich kam sie zu mir... Sie hatte auch von ei-
nigen Glaubensheilern erfahren, dass die Krankheit von
einem Jinn164 hervorgerufen sein könnte. Sie bat um mei-
169
ne Hilfe, um den verstörenden Jinn loszuwerden.«
Rakhmat schickt die Frau zu einem Exorzisten, der sie von
dem bösen Geist befreien soll:
»Sie rief mich später an und sagte, sie misstraue der Be-
handlung meines Freundes. ... Während sie medizinisch
behandelt wurde, wurde sie gelehrt, einen bestimmten
Gottesnamen in einer bestimmten Weise fortlaufend auf-
zusagen. Sie lernte, sich auf die Namen Allahs zu kon-
zentrieren und die bösen Gedanken loszuwerden. Sie hör-
te dem Verlesen des Korans zu und meditierte die
Übersetzung.
Es ist meine Gewohnheit, jede Sitzung mit einem Gebet
zu beschließen. Gerade als ich zu einer Konferenz abreis-
te, kam sie zu mir. Sie sage, sie fühle sich besser. Sie ver-
sprach, das zikr165, das ich ihr empfahl, zu verrichten und
während meiner Abwesenheit meinen Freund aufzusu-
chen. Wir beteten zusammen. Ich versprach ihr, sie in
meine Gebete einzuschließen. Die Geschichte ist jedoch
noch nicht abgeschlossen«.166
Ein »Reframing« dieser Story ist also möglich – dies sicher-
lich nicht in der Terminologie der Familientherapie, aber
vielleicht in deren Geist. »Unic outcomes« – »Ent-
unterwerfung« – mit diesen Begriffen arbeitet westliches the-
rapeutisches Denken. Es schafft zum Teil Externalisierungen,
es schafft erst eine eigene »therapeutische« Bildsprache aus
den Impulsen des Unbewussten, um zu fokussieren.
Islamische Volksreligiosität dagegen bietet die Fokussie-
rung der Impulse aus dem Unbewussten, nicht nur des einzel-
nen Menschen, sondern eines kollektiven Unbewussten be-
reits in den Jinn. Hier geht es darum, diese entstandene,
internalisierte Fokussierung eher zurück zu drängen, um in
den Bildern des mythologischen Rahmens, aber mit einem
170
gewissen interpretativen Spielraum einen neuen Lebensent-
wurf »nach vorne« zu wagen. Gebet und das rituelle Erin-
nern und Wiederholen der guten Namen Gottes binden die
Angst vor dem eigenen Unbewussten und seinen Konfigurati-
onen. Die Klientin bleibt »auf dem Punkt« und fällt nicht
zurück.
Offen bleibt die Frage nach Mühen, intellektuellem und
seelischem Aufwand einer tiefenpsychologischen Durcharbei-
tung dieses mythologischen Denkens und seiner Symbolisie-
rungen. In ihr dürfte sicherlich das langwierigste und kompli-
zierteste Unterfangen zu sehen sein. Zudem ist dies nicht
theoretisch möglich, sondern im Sinne des ethnopsychoanaly-
tischen Ansatzes im begegnenden Sich-Hinein-Begeben in die
Situation der muslimischen Menschen.
Offen bleibt ebenfalls, ob dieser »westliche« Denk-Zugang
für Muslime aus ihren theologischen und praktisch- volksre-
ligiösen Vorstellungen heraus in größerem Umfang und in
absehbarer Zeit akzeptabel werden kann. Laabdalloui/ Rü-
schoff sehen das für die deutsche Situation als möglich an:
»Ähnliches gilt für bestimmte Persönlichkeitsstörungen,
die mit extremen Stimmungsschwankungen, Selbstverlet-
zungen und Leistungsversagen einhergehen. Mit diesen
Patienten arbeiten einige muslimische Therapeuten seit
Jahren recht erfolgreich mit einem aus der Psychoanalyse
und verwandten Schulen abgeleiteten Therapieverfahren,
auch wenn Freud völlig inakzeptable Aussagen über die
Religion gemacht hat. Die Erfahrung mit den Patienten
zeigt es: Sie werden ausgeglichener, bestehen besser in
schwierigen Lebenssituationen, im Beruf und in ihrer Fa-
milie. Auch ihr Verhältnis zu Gott entspannt sich: Wo
vorher vielleicht nur Angst war, ist mehr Vertrauen ent-
standen, ist das Gebet nicht mehr nur ängstliche Pflicht,
die bei Verletzung mit Strafe bedroht wird, sondern ver-
mittelt Ruhe und Geborgenheit.
171
Das Problem der Verwendung ›westlicher‹ Therapie-
schulen sind weniger die Methoden selbst, sondern ihre
unterschiedliche Durchführbarkeit bei verschiedenen Pa-
tienten, ...«167
Da Beratung, Therapie und Seelsorge im Falle des Islams wie
des Christentums unterschiedliche kulturelle Zusammenhän-
ge umspannen und in rationaler und mythologischer Einbet-
tung geschehen, sind die Formen auch völlig verschieden.
Laabadallaoui / Rüschoff sprechen von der »Landkarte des
Menschen«:
»Alle zeichnen daher eine ›Landkarte« des Menschen, die
keinesfalls mit der ›Landschaft‹, also dem Menschen
selbst, verwechselt werden darf ... So wie sich eine Wan-
derkarte von einer Straßenkarte oder einer Seekarte un-
terscheidet, sind auch Psychotherapieverfahren für unter-
schiedliche Störungen unterschiedlich geeignet ...«168
Landkarten können auch Umstände darstellen, die historisch
gewachsen sind – eine Morphologie der Oberfläche, die sich
in vielen Jahrhunderten zu dem geformt hat, was sie ist und
die zudem vieles mit abbildet, was neuerlich wieder in ande-
rer Form entstanden ist.
Damit möchte ich schließen und überleiten von der mo-
dernen zur traditionellen Psychologie des Islam. In beiden
Kontexten werden sich Muslime zukünftig bewegen, in
Deutschland und in vielen anderen, sich wandelnden kultu-
rellen Kontexten. Für Deutschland zitiere ich noch einmal
Laabdalloui/ Rüschoff:
»Was Muslime anbieten können, ist die Bereitschaft zur
eigenverantwortlichen Mitgestaltung unserer Gesellschaft
auf der Grundlage der bereits erwähnten Anerkennung
und Respektierung der Verfassung und der bestehenden
172
Rechtsordnung. Dazu gehört gerade auch die islamische
Ethik als gottergebene Lebensweise. Diese Möglichkeit,
hier und dort auch anders sein zu dürfen, könnte eine Be-
reicherung für eine zunehmend vom Materiellen be-
stimmte Gesellschaft sein. Muslime sollten wählen, sich
politisch und sozial engagieren, Kindergärten und Schu-
len betreiben wie andere auch, unser Land verteidigen
oder Ersatzdienst leisten, als Frauen und Männer Berufe
lernen und studieren und ihre Kinder zu gottesfürchtigen
Menschen erziehen. Die Möglichkeiten und Grenzen die-
ser Teilhabe sind allerdings nicht fertig vorhanden und
können vor allem auch nicht aus den sog. ›islamischen‹
Ländern importiert werden, sondern müssen in Europa
von europäischen Muslimen auf den Grundlagen und im
Geiste ihrer Religion ohne Ratschläge von außen entwi-
ckelt werden. Dies ist ein Prozess, der viel Kompetenz
und auch viel Zeit benötigt.«169
Dies gilt für die speziellen Fragen nach Migration und Integ-
ration, die in Europa gestellt werden. Für den Islam im weit-
läufigen Kontext Asiens mögen andere Zugänge hilfreich
sein. Mit diesen, traditionelleren Aspekten möchte ich nun
schließen. Die psychologisch sensible, anthropologisch orien-
tierte Sprache im Sufismus kann beitragen zum religiös- the-
rapeutischen Diskurs im Islam. Sie ist poetisch: Und so gehört
sie ganz sicher mit zu den Wegbereitern therapeutischer Ge-
danken.
Ein Gedicht Rumis
Lasst uns uns neu verlieben
Und Goldstaub über die ganze Welt verstreuen.
Lasst uns zu einem neuen Frühling werden
Und fühlen, wie die Brise mit himmlischem Duft driftet.
Lasst uns die Erde mit Grün einkleiden
173
Und- wie der Saft eines jungen Baumes –
Lasst zu, wie die Gnade uns von innen stützt.
Lasst uns aus unseren versteinerten Herzen Edelsteine
schnitzen
sie sollen unseren Pfad zu der Liebe hin erleuchten.
Der Glanz der Liebe ist kristallkar
Und durch sein Licht sind wir gesegnet.170
und eine letzte Geschichte, die von der sensiblen Wahr-
nehmung spricht, können das verdeutlichen:
»Vor langer Zeit war einmal die Mutter eines der
ottomanischen Sultane sehr den caritativen Stiftungen zu-
getan. Sie baute Moscheen und große Hospitäler und ließ
öffentliche Brunnen graben in Teilen von Istanbul, die bis
dahin ohne Wasser waren. Eines Tages ging sie und beo-
bachtete den Bau des Hospitals, das sie gerade errichten
ließ. Da sah sie, wie eine Ameise in den nassen Beton des
Fundamentes fiel. Sie hob die Ameise aus dem Beton her-
aus und setzte sie auf den Boden.
Einige Jahre später verstarb sie. In der Nacht erschien sie
einer Reihe ihrer Freunde im Traum. Sie erstrahlte vor
Freude und innerer Schönheit. Ein Freund fragte sie, ob
sie ins Paradies gekommen sei wegen all ihrer wunderba-
ren mildtätigen Stiftungen. Aber sie antwortete: ›Ich bin
im Paradies, aber nicht wegen dieser Stiftungen. Es ist um
einer Ameise willen‹«.171
174
Anmerkungen
1 Ilhan Ilkilic: Begegnung und Umgang mit muslimischen Patienten, S. 17,
Bochum 2005
2 Heinrich Schipperges: Gesundheit und Gesellschaft, 2003, hier zitiert in:
Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition, S. 1, Bochum 2005
3 Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition ..., S. 2, Bochum 2005
4 Die hauptamtlichen Religionsbeauftragten und Führer der islamischen
Gemeinden
5 Zitat aus den Schriften eines frühen islamischen Mediziners, Ali b.Sahl
Rabban at-Tabari (gest.nach Chr. 855), hier in: Ilhan Ilkilic, Gesund-
heitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der islamischen Traditi-
on ... S. 4
6
hellenistischer Mediziner
7 Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition, S. 6
8 s.o., S. 6
9 s.o., S. 7
10
s.o., S. 7
11
s.o., S. 7
12
Hadithe sind Aussprüche des Propheten Mohammed, die von seinen
Anhängern gesammelt und aufgeschrieben wurden und die der korani-
schen Tradition beigegeben wurden. Sie dienen oft auch als Grundlage
für Rechtsfindungen
13
Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition ..., S. 9
14
Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition ..., Zitat von Said Ibn al Hassan, S. 16
15
Ilhan Ilkilic, Irfan Inse, Azra Porgholam-Ernst: E-Health in muslimi-
schen Kulturen, S. 10
16
Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition, S. 20
175
17
Heinrich Schipperges, 1985, hier in: Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständ-
nis und Gesundheitsmündigkeit in der islamischen Tradtion ..., S. 7 18
Zitat Al Ghassali, in: Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesund-
heitsmündigkeit in der islamischen Tradition ..., S. 8 19
Sufismus ist hier der Sammelbegriff für die mystischen Strömungen des
Islams, hier dargestellt in: Annemarie Schimmel: Mystische Dimensio-
nen des Islam. Die Geschichte des Sufismus, Frankfurt /Main 1995 20
Anatolisch-persischer Mystiker, Begründer des Ordens der tanzenden
Derwische 21
Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, S. 270 22
s.o., S. 572 23
Christlich-muslimisch-jüdische Pfingsttagung der Akademie Arnolds-
hain 2006, Thema: Gerechtigkeit hat viele Gesichter 24
Ich verweise auf die Darstellung Qasim Amins, Sozialreformer im 19.
Jahrhundert in Ägypten, in: Ulrike Elsdörfer, Frauen in Christentum
und Islam, S. 106 ff. 25
Ilhan Ilkilic: Modernisierungs- und Verwestlichungs-Diskussionen und
bioethische Fragen am Beispiel innerislamischer Diskurse, in: T. Eich
(Hg.): Instrumentalisierung des Kulturbegriffs, 2005 26
Ilhan Ilkilic: Modernisierungs- und Verwestlichungsdiskussionen ..., S. 3 27
s.o., S. 4 28
Ilhan Ilkilic: Modernisierungs ..., hier wird der pakistanische Biologe
und Islamwissenschftler Munawar Ahmad Anees zitiert, S. 7 29
Ilhan Ilkilic: Modernisierungs- und ..., S. 9 30
Im Folgenden werden Erhebungen und Fakten referiert, die unter dem
Titel »E-Health in muslimischen Kulturen« von Ilhan Ilkilic, Irfan Ince
und Azra Pourgholam-Ernst zusammengestellt wurden 31
Ilhan Ilkilic: E-Health in muslimischen Kulturen, S. 9 32
s.o., S. 10 33
s.o., S. 10 34
Ilhan Ilkilic: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition, S. 6 35
Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, S. 256 ff. 36
lat: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist 37
Hier ist besonders auf die grundlegenden Ansätze von Dietrich Stoll-
berg: Therapeutische Seelsorge, 1969, von Joachim Scharfenberg: Reli-
gion zwischen Wahn und Wirklichkeit, 1972 und Klaus Winkler: Seel-
sorge, 2. Aufl. 2000 zu verweisen. Daneben geben Jürgen Ziemer:
Seelsorgelehre, 2000, Michael Klessmann: Pastoralpsychologie, 2004
und Susanne Heine: Grundlagen der Religionspsychologie, 2005, um-
fassende Auskünfte über den Stand der jeweiligen Diskussionen
176
38
Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, S. 268 ff. 39
s.o. 40
s.o, S. 270 41
s.o., S. 271 42
s.o., S. 272 43
s.o., S. 274 44
S.S.Balic: Stichwort »Seelsorge«, Abschnitt »Islam«, in: A.T. Khoury,
Lexikon religiöser Grundbegriffe., Köln, Graz, Wien 1987 45
Halima Krausen: Seelsorge im Islam, in: U.Pohl-Patalong: Seelsorge im
Plural, S. 233 46
Ismail Altintas: Islamische Seelsorge in der Praxis, Aufsatz 2005 47
Ismail Altintas: Islamische Seelsorge in der Praxis 48
Ismail Altintas: Islamische Seelsorge in der Praxis 49
Halima Krausen: Seelsorge in Islam, S. 234 50
s.o., S. 237 51
s.o., S. 139 52
Ismail Altintas: Islamische Seelsorge in der Praxis 53
Ilhan Ilkilic: Gesundheits-und Krankheitsverständnis der Muslime als
Herausforderung für das deutsche Rechtswesen, S. 6 54
s. o ., S. 8 55
Ilhan Ilkilic: Begegnung und Umgang mit muslimischen Patienten,
Bochum 2005, S. 48 56
s.o., S. 49 57
s.o., S. 50 58
Kurt W. Schmidt, Gisela Egler: Den Christen ein Christ, den Muslimen
ein Muslim? Überlegungen zu einer protestantischen Sicht interreligiöser
Seelsorge im Krankenhaus, in: ( Klinik-) Seelsorge im multireligiösen
Kontext, 1999 59
s.o., S. 35 60
Näheres hierzu in: Ulrike Elsdörfer: Frauen in Christentum und Islam,
Königstein 2006 61
Eva Butt: Ehebegleitung, in: Handbuch interkulturelle Seelsorge, Neu-
kirchen 2002 62
s.o., S. 144 Greverus, Zitat aus : K. Jacobs (Hg.): Beratung im interkul-
turellen Kontext 63
s.o., S. 144/45 64
s.o., S. 146-149 65
Regine Froese: Christlich-muslimische Erziehung 2004, in :WzM, Heft
3, 2005, S. 229 ff 66
Bärbel Beinhauer-Köhler: Formen islamischer Wohlfahrt in Deutsch-
land, in: THEION, Diakonie der Religionen 2, 2005, S. 76
177
67
s.o., S. 77 68
Ich verweise auf meine Ausführungen unter dem Kapitel 1.4. 69
Al-Qazwini: Die Wunder des Himmels und der Erde, hier in: Beinhauer-
Köhler, S. 88 70
s.o., S. 88 71
Ich verweise auf mein Kap. 1.4 und 2.2.1 dieses Buches 72
Aussprüche und Lehrmeinungen des Propheten Mohammed 73
s.o., S. 86 74
s.o., S. 90 75
s.o., S. 152 76
s.o. 77
Yasar Colak: Religiöse Dienstleistungen in der Türkei, in: THEION;
Diakonie der Religionen 2, S. 11 78
s.o., S. 11/12 79
s.o., S. 17 80
s.o., S. 18/19 81
s. Kapitel 3.6 dieses Buches 82
Beinhauer-Köhler berichtet von einer von ihr durchgeführten Umfrage
unter Muslimen 83
Beinhauer-Köhler: Formen islamischer Wohlfahrt in Deutschland, in :
THEION, S. 159, 2005 84
s.o. 85
Arbeitsbericht der Tagung »Alt werden in der neuen Heimat« der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Mai 2006 86
Frankfurter Rundschau vom 18.7. 2006: Die Stadt Wiesbaden hat die
Broschüre »Wohnanlage für ältere Menschen« ins Türkische übersetzen
lassen. Damit sollen sich künftig auch türkisch sprechende Senioren in
Wiesbaden über das Angebot der Altenwohnanlagen informieren kön-
nen. 87
Luthfa Meah: Die muslimische Gemeinschaft und die Behandlung von
psychischen Erkrankungen, in: Weiß, Federschmidt, Temme: Ethik des
Helfens in verschiedenen Religionen, S. 159 88
s.o., S. 160 89
s. Kapitel 6, Einleitung 90
Emil Zimmermann: Kulturelle Missverständnisse in der Medizin. Aus-
ländische Patienten besser versorgen, Bern 2000 91
Für türkischstämmige Patienten ist die Leber der Sitz emotionaler Be-
findlichkeiten, sie gilt als ein sehr sensibles und anfälliges Organ. Wenn
sie als krank bezeichnet wird, betrachtet sich der Patient insgesamt als
sehr krank – so Zimmermann: Kulturelle Missverständnisse in der Me-
dizin, S. 48
178
92
s.o., S. 64 93
s.o., S. 156 94
s.o., S. 158 95
Kapitel 7 96
Laabdallaoui, Rüschoff: Ratgeber für Muslime bei psychischen und
psychosozialen Krisen, 2005 97
Geister, die im Bereich der islamischern Volksreligion bekannt sind. Ihre
Existenz ist im Koran begründet 98
Laabdalloui, Rüschoff: Ratgeber für Muslime ..., S. 17 99
s.o., S. 21 100
deutscher Psychiater, der grundlegende Forschungen in der Psychiatrie
betrieben hat 101
Passagen des Kapitels 5.4.1 sind entnommen aus: Eckhardt Koch, Kurt
Heilbronn, Meryam Schouler-Ocak: Deutsch-Türkische Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit ( DTGPP
e.V.). Entstehungsgeschichte, Entwicklung, Ziele und Ausblick, Internet
www.dtgpp.de, 2006 102
Ilhan Ilkilic: Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Muslime als
Herausforderung für das deutsche Rechtswesen, in: Globalisierung in
der Medizin, Aufsatz Berlin 2005 103
s.o. 104
Johannes Reichmayr: Ethnopsychoanalyse, S. 32, 2003 105
Das Gewissen in psychologischer Sicht, in: Das Gewissen, Studien aus
dem C.G. Jung-Institut, S. 199ff., Zürich 1958 106
Passagen dieses Textes entstammen einer Seminararbeit von Jannis
Hissler, Goethe-Universität Frankfurt/M., 2006 (Seminar: Ethik des
Helfens im Kontext verschiedener Religionen, U. Elsdörfer) 107
Teilweise Zitate aus der religionswissenschaftlichen Seminararbeit von
Julia Scheller, Goethe-Universität Frankfurt/Main, 2006 ( Seminar : E-
thik des Helfens im Kontext verschiedener Religionen, U.Elsdörfer) 108
Johannes Reichmayr: Ethnopsychoanalyse, S. 258 109
s.o., S. 221, 225 und 258 110
Möhring/ Apsel: Interkulturelle psychoanalytische Therapie, 1995 111
Johannes Reichmayr: Ethnopsychoanalyse, S. 244 112
s.o., S. 244/245 113
Peter Möhring: Kultur, Krankheit und Migration, in: Peter Möhring,
Roland Apsel: Interkulturelle psychoanalytische Therapie, S. 100 114
Christoph Morgenthaler: Systemische Seelsorge, S. 60-62, 1999 115
s.o., S. 146-164 116
Passagen dieses Textes wurden entnommen aus der Seminararbeit von
Linda Smith, Goethe-Universität Frankfurt/Main, 2006 (Seminar: Ethik
179
des Helfens im Kontext verschiedener Religionen, U. Elsdörfer)
117 Christoph Schneider-Harpprecht: Interkulturelle Seelsorge, Habilitati-
onsschrift, 2001 118
s.o., S. 177 119
s.o., S. 178/179 120
Michael White, David Epston: Narrative means to therapeutic ends,
New York 1990 121
Der amerikanische Psychotherapeut Carl R. Rogers begründete in den
50er und 60er Jahren des 20.Jahrhunderts die klienten-zentrierte Ge-
sprächspsychotherapie. Im Mittelpunkt dieser Theorie steht die »bedin-
gungslose Annahme« des Klienten, seiner gefühlsmäßigen und sprachli-
chen Äußerungen – als Methode gilt das »Spiegeln« der Aussagen und
Emotionen; damit sollen Denk- und Verhaltensweisen bewusst gemacht
werden,damit sie anschließend reflektierend durchgearbeitet werden
können. 122
Christoph Schneider-Harpprecht: Interkulturelle Seelsorge, S. 194 ff. 123
Michael White, David Epston: Narrative means to therapeutic ends 124
s.o., S. 194 125
s.o., S. 196 126
s.o., S. 299 127
s.o., S. 299 128
s.o., S. 304 129
Ich verweise auf meine Ausführungen in Kap. 5.1. 130
Ingrid Genkel, Jens Müller-Kent: Leben werten? 1998, S. 49 131
Ich verweise auf meine Ausführungen in Kapitel 2 132
Dietrich Ritschl: Konzepte, Ökumene, Medizin, Ethik. Gesammelte
Aufsätze, 1986, S. 255 133
s.o., S. 51 134
Dietrich Ritschl, Hugh. O. Jones: »Story« als Rohmaterial der Theolo-
gie, 1976, S. 18 ff. 135
Emil Zimmermann: Kulturelle Missverständnisse in der Medizin, S. 140 136
Dietrich Ritschl, Hugh O. Jones: »Story« als Rohmaterial der Theolo-
gie, 1976, S. 209 ff. 137
Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, S. 268 ff. 138
Schneider-Harpprecht, S. 183/184 139
Tom Anderson, (Hg.): The reflecting team, hier in: Schneider-
Harpprecht, S. 184 140
s.o., S. 184 141
José Szapocznik, William M. Kurtines: Family Psychology and cultural
diversity: Opportunities for theory, research, and application. In.
Schneider-Harpprecht: S. 182
180
142
s.o., S. 182 143
Arist von Schlippe, Mohammed El Hachimi, Gesa Jürgens: Multikultu-
relle systemische Praxis, Heidelberg 2004 144
s.o., S. 135 145
s.o., S. 73 146
Kapuscinski 1999, S. 39 ff.: In: s.o., S. 98 147
Emil Zimmermann: Kulturelle Missverständnisse in der Medizin. Aus-
ländische Patienten besser versorgen, S. 65 148
Emil Zimmermann: Kulturelle Missverständnisse in der Medizin, S. 50 149
s.o., S. 148 150
s.o., S. 31 151
s. die Einleitung zu Kapitel 6 152
Schlippe, El Hachimi, Jürgens: Multikulturelle systemische Praxis, S.
211/ 212. Im genauen Wortlaut heißt es hier: »Die dreijährige Halime
wurde wegen Niereninsuffizienz auf der Dialysestation einer Klinik be-
handelt. Eine Zwillingsschwester von Halime war im März des Jahres
kurz nach Dialysebeginn auf der Intensivstation in der Klinik verstor-
ben. Alle drei Kinder leiden bzw. litten an folgenden Störungen: Nieren-
insuffizienz, Sehfehlern, geistiger Behinderung. Die ältere Tochter wird
bereits dialysiert ... Die Gesprächsinhalte werden in dem folgenden be-
schriebenen Gespräch übersetzt, auch Herr B., – in Deutsch angespro-
chen – antwortet in seiner Muttersprache.
Der Gesprächsanlass: Dem überlebenden Zwillingsmädchen Halime
soll unter Narkose ein Katheter eingepflanzt werden, da sein Gesund-
heitszustand eine Narkose erfordert. Die Eltern verweigern den Eingriff.
Sie wollen die Tochter mit nach Hause nehmen. In einem gemeinsamen
Gespräch mit Ärzten, einer Krankenschwester, einer Mitarbeiterin des
psychosozialen Dienstes und einer türkisch sprechenden Familienthera-
peutin sollen einerseits die Eltern noch einmal – diesmal in ihrer Mut-
tersprache – über den Zustand ihrer Tochter und die Notwendigkeit der
Dialyse als lebenserhaltende Maßnahme aufgeklärt werden. Anderer-
seits sollen die Gründe für die Haltung der »einfach strukturierten« El-
tern eruiert werden.
Das Gespräch ergibt Folgendes: Die Eltern hatten weder verstanden, in
welchem gesundheitlichen Zustand ihre Tochter (Halimes Zwillings-
schwester) auf die Intensivstation verlegt worden ist, noch wie und wa-
rum sie dort behandelt wurde, und letztlich auch nicht, warum sie ge-
storben ist. Die Zustimmung zur Einpflanzung des Katheters
verweigerten sie aus zwei Gründen. Zum einen ging es ihrer Tochter ih-
rer Meinung nach so gut, dass eine Dialyse nicht notwendig war, zum
anderen befürchteten sie auch, dass das Mädchen genauso wie die kurz
181
vorher verstorbene Schwester aus der Narkose nicht mehr aufwachen
könnte. Im Gespräch konnten die Eltern überzeugt werden, dass der
Gesundheitszustand ihrer Tochter eine Dialyse notwendig machte. Ihre
Einschätzung, dass die ›falsche‹ Behandlung ihrer anderen Tochter de-
ren Tod verursacht hatte, konnte jedoch nur teilweise korrigiert wer-
den.« 153
von Schlippe, El Hachimi, Jürgens: Multikulturelle systemische Praxis,
S. 75 154
von Schlippe, El Hachimi, Jürgens: Multikulturelle systemische Thera-
pie, S. 54 155
s.o., S. 98 156
Wahrnehmung kultureller Differenz und die Machtfrage. In: Hau-
schildt, Schneider-Harpprecht, Temme, Weiß: Handbuch interkulturelle
Seelsorge, S. 63-78 157
Poling, Handbuch S. 70 158
s.o., S. 70 159
s.o., S. 71 160
Zwei der meist gesprochenen Gebete der Muslime lauten: »Ich nehme
meine Zuflucht beim Herrn des Frühlichts vor dem Übel dessen, was er
erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie hereinbricht,
vor dem Übel der Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines Nei-
ders, wenn er neidet» ( Sure 113, 1-4) und: »Ich nehme meine Zuflucht
beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der
Menschen, vor dem Übel des Einflüsteres, der entweicht und wieder-
kehrt, der den Menschen in die Brust einflüstert, ( sei dieser ) von den
Jinn oder den Menschen» ( Sure 114, 1-5), zitiert aus: Luthfa Meah: Die
muslimische Gemeinschaft und die Behandlung von psychischen Er-
krankungen, S. 157 161
Luthfa Meah: Die muslimische Gemeinschaft und die Behandlung von
psychischen Erkrankungen, S. 157/158 162
Jalaluddin Rakhmat: Die Ethik des Helfens im Islam, Vortrag, gehalten
auf der Tagung »Ethik des Helfens im Kontext verschiedener Religio-
nen«, September 2002, Basel, S. 5. auch enthalten in: Weiß; Fe-
derschmidt, Temme: Ethik des Helfens in verschiedenen Religionen 163
s.o. 164
einem Geist 165
an anderer Stelle in diesem Buch auch »Dikr« genannt – phonetische
Veränderungen entstehen aus der Interpretation des zugrunde liegenden
arabischen Buchstabens 166
Jalaluddin Rakhmat: Aus meiner Praxis des Helfens und Beratens, in:
Weiß, Federschmidt, Temme. Ethik und Praxis des Helfens in verschie-
182
denen Religionen, S. 144/145
167 Laabdalloui/ Rüschoff: Ratgeber für Muslime ... S. 32
168 s.o.
169 s.o., S. 20
170 Zitat eines Gedichtes von Jalaluddin Rumi, in Jalaluddin Rakhmat: Die
Ethik des Helfens im Islam, Vortrag – gehalten in Basel 2002, auch in:
Weiß, Federschmidt, Temme. Ethik des Helfens in verschiedenen Reli-
gionen 171
s.o.
183
Literatur
Abdullah, Mohammed Salim ( Hg. Fitzgerald, M.,Khoury, A. Th., Wanzura,
W.): Geschichte des Islam in Deutschland, Köln 1981
Akgün, Lale: Psychokulturelle Hintergründe türkischer Jugendlicher der
zweiten und dritten Generation: In: Lajos, Konstantin (Hg.): Die psycho-
soziale Situation von Ausländern in der Bundesrepublik, Opladen 1993
Altintas, Ismail: Islamische Seelsorge in der Praxis, Aufsatz, Frankfurt/Main
2005
Altwerden in der neuen Heimat – Arbeitspapiere einer Tagung der Akademie
der Diözese Rottenburg – Stuttgart, 2006
Anderson, Tom (Hg.): The reflecting team. Dialogues and dialogues about
the dialogues, New York 1991
Antes, Peter: Ethik und Politik im Islam, Stuttgart 1982
Apsel, Roland, Möhring, Peter (Hg.): Interkulturelle psychoanalytische
Therapie, Frankfurt/Main 1995
Bakar, Osman: The History and Philosophy of Islamic Medicine, Cambridge
1999
Balic, Smail: Ruf vom Minarett. Weltislam heute – Renaissance oder Rück-
fall? Eine Selbstdarstellung, Hamburg 1984
Batzli, Stefan, Kissling, Fridolin, Zihlmann, Rudolf: Menschenbilder- Men-
schenrechte. Islam und Okzident: Kulturen im Konflikt, Zürich 2003
Becher, Werner, Campbell, Alastair V., Parker, G.Keith: Wagnis der Freiheit.
Ein internationaler Kongress für Seelsorge und Beratung, Göttingen 1981
Beinhauer-Köhler, Bärbel: Formen islamischer Wohlfahrt in Deutschland, in:
Beinhauer-Köhler, Bärbel, Benad, Matthias, Weber, Edmund(Hg):
THEION, Jahrbuch für Religionskultur: Diakonie der Religionen 2, Schwer-
punkt Islam, S. 75-166, Frankfurt/Main 2005
Bielefeldt, Heiner: Muslime im säkularen Rechtsstaat, Bielefeld 2003
Bielefeldt, Heiner, Heitmeyer; Wilhelm (Hg.): Politisierte Religion, Frank-
furt/Main 1998
Boos-Nünning, Ursula (Hg.): Die türkische Migration in deutschsprachigen
Büchern 1961-1984. Eine annotierte Bibliographie. Opladen 1990
Breuer, Rita : Familienleben im Islam. Traditionen – Konflikte – Vorurteile,
Freiburg 1998
Butt, Eva: Ehebegleitung. Gott hat viele Namen. Bireligiöse Beratung am
184
Beispiel eines deutsch- tunesischen Paares. In: Federschmidt, Karl, Hau-
schildt, Eberhard, Schneider-Harpprecht, Christoph, Temme, Klaus,
Weiß, Helmut: Handbuch Interkulturelle Seelsorge, S. 143-151, Neukir-
chen 2002
Clinebell, Howard J.: Modelle beratenden Seelsorge, München 1971
Colak, Yasar: Religiöse Dienstleistungen in der Türkei, in: THEION, Jahr-
buch für Religionskultur: Diakonie der Religionen 2, Schwerpunkt Islam,
S. 11-22 Frankfurt 2005
Cole, Juan R.I. and Keddie, Nickie R. (Ed.): Shi´ism and Social Protest, Yale
1986
David, Matthias und Borde, Theda: Kranksein in der Fremde. Türkische
Migrantinnen im Krankenhaus, Frankfurt/Main 2001
Devereux, Georges: Ethnopsychoanalyse: Die komplementaristische Metho-
de in den Wissenschaften vom Menschen, Frankfurt/Main 1978
Devereux, Georges: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften,
Frankfurt/ Main 1988
Der Koran arabisch-deutsch. Aus dem Arabischen von Max Henning. Über-
arbeitung und Einleitung von Murad Wilfried Hofmannn, Istanbul 2003
Domenig, Dagmar: Migration, Drogen, transkulturelle Kompetenz, Bern
2001
Drechsel, Wolfgang: Lebensgeschichte und Lebensgeschichten, Göttingen
2006
Dreesen, Thomas u.a. (Hg.): Christlich-muslimische Ehen und Familien,
Frankfurt/ Main 1998
Eckart, Wolfgang: Geschichte der Medizin, Berlin 1994
Eich, Thomas und Grundmann, Johannes: Muslimische Rechtsmeinungen zu
Hirntod, Organtransplantation und Leben, in: Zeitschrift für medizini-
sche Ethik, 49/3, 2003, S. 302-309
El Hachimi, Mohammed, Schlippe, Arist von, Jürgens, Gesa: Multikulturelle
systemische Praxis. Ein Reiseführer für Beratung, Therapie und Supervi-
sion, Heidelberg 2003
Elsdörfer, Ulrike: Vielfältige Gesichter der religiösen Begegnung. Reflexionen
und Praxisprotokolle, Frankfurt/Main 2004
Elsdörfer, Ulrike: Seelsorge im Islam, Aufsatz, Frankfurt/Main 2005
Elsdörfer, Ulrike: Frauen in Christentum und Islam. Dialoge – Traditionen –
Spiritualitäten, Königstein 2006
Elsdörfer, Ulrike: Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind
untereinander Freunde. Islamische Seelsorge und seelsorgerliche Begeg-
nung mit Muslimen, in: Wege zum Menschen. Zeitschrift für Seelsorge
und Beratung, heilendes und soziales Handeln, 59.Jahrgang, Heft 2, April
2007
Epston, David, White, Michael: Narrative means to therapeutic ends. New
York 1990
185
Erdheim, Mario: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine
Einführung in den ethnopsychologischen Prozess, Frankfurt/ Main 1982
Erikson, Erik H.: Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 1984
Ethnopsychoanalyse 6 (Jahrbuch): Forschen, erzählen und reflektieren,
Frankfurt/ Main 2005
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern / Islam-Kommission (Hg).: Über
die Grenzen gehen. Ehen zwischen christlichen und muslimischen Part-
nern, Neuendettelsau 1996
Faber, Heije, van der Schoot, Ebel: Praktikum des seelsorgerlichen Ge-
sprächs, Göttingen 1980
Federschmidt, Karl, Hauschildt, Eberhard, Schneider-Harpprecht, Christoph
Temme, Klaus, Weiß Helmut: Handbuch Interkulturelle Seelsorge, S.
143-151, Neukirchen 2002
Foucault, Michel: Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und
Medizin, Berlin 1976
Freedman, J., Combs, G.: Narrative therapy. The social construction of
preferred realities, New York 1996
Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt 1968
Freud, Sigmund: Die Zukunft einer Illusion, Frankfurt 1968
Freud, Sigmund: Totem und Tabu, Frankfurt 1973
Freud, Sigmund: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, Frank-
furt 1981
Froese, Regine: Christlich-muslimische Erziehung 2004, in: Wege zum Men-
schen. Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales
Handeln, Heft 3, 57. Jahrgang 2005 – »Wandel der religiösen Familien-
erziehung«
Fürst, Walter, Wittrahm, Andreas, Feeser- Lichterfeld, Kläden, Tobias (Hg.):
»Selbst die Senioren sind nicht mehr die alten ...«, Münster 2003
Geiger, Ingeborg: Interkulturelle Gesundheitsförderung. Ein Leitfaden für
den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Aufbau des Handlungsfeldes
Migration, Bielefeld 2000
Genkel, Ingrid, Müller-Kent, Jens: Leben werten? Göttingen 1998
Goldziher, Ignaz: Die Gottesliebe in der islamischen Theologie. Der Islam 9,
1919
Goldziher, Ignaz: Al-Ghazzalis Streitschrift gegen die Batiniya, Leiden 1916
Goody, Jack: Islam in Europe, Cambridge 2004
Grewendorf, Günther, Hamm, Fritz, Sternefeld, Wolfgang: Sprachliches
Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Be-
schreibung, Frankfurt/Main 1999
Haase, Helga (Hg.): Ethnopsychoanalyse. Wanderungen zwischen den Wel-
ten, Stuttgart 1996
Haasen, Christian und Yagdiran, Oktay (Hg.): Beurteilungen psychischer
Störungen in einer multikulturellen Gesellschaft, Freiburg/Br., 2000
186
Halm, Heinz: Die Schiiten, München 2005
Hegemann, Thomas, Salman, Ramazan: Transkulturelle Psychiatrie: Kon-
zepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen, Bonn 2001
Heine, Susanne: Grundlagen der Religionspsychologie, Göttingen 2005
Heise, Thomas (Hg.): Transkulturelle Psychotherapie. Hilfen im ärztlichen
und therapeutischen Umgang mit ausländischen Mitbürgern, Berlin 1998
Hissler, Jannis: Ethnopsychoanalyse, religionswissenschaftliche Seminarar-
beit, Frankfurt/Main 2006
Hofmann, Murad: Der Islam im 3.Jahrtausend, München 2000
Hofmann, Murad: Islam, München 2001
Hovannisian, Richard G. (Ed.): Ethics in Islam, Los Angeles, 1983
iaf Bremen: Homo migrans – Liebe ohne Grenzen. Zur Situation binationaler
lesbischer und schwuler Partnerschaften, Bremen iaf 1996
Ilkilic, Ilhan: Begegnung und Umgang mit muslimischen Patienten. Eine
Handreichung für Gesundheitsberufe, Bochum 2005
Ilkilic, Ilhan, Ince, Irfan, Pourgholam-Ernst, Azra: E-Health in muslimischen
Kulturen. Zentrum für Medizinische Ethik: Medizinische Materialien,
Bochum Dezember 2004
Ilkilic, Ilhan: Gesundheitsverständnis und Gesundheitsmündigkeit in der
islamischen Tradition, Zentrum für Medizinische Ethik. Medizinische
Materialien, Bochum Januar 2005
Ilkilic, Ilhan: Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Muslime als
Herausforderung für das deutsche Rechtswesen, Aufsatz, Berlin 2005
Ilkilic, Ilhan: Das muslimische Glaubensverständnis von Tod, Gericht, Got-
tesgnade und deren Bedeutung für die Medizinethik, Bochum 2002
Ilkilic, Ilhan: Modernisierungs- und Verwestlichungs- Diskussionen und
bioethische Fragen am Beispiel innerislamischer Diskurse, Aufsatz, Bo-
chum 2004
Ilkilic, Ilhan: Die aktuelle Biomedizin aus der Sicht des Islam, in: Kulturelle
Aspekte der Biomedizin. Bioethik, Religionen und Alltagsperspektiven, in:
S. Schicktanz, Ch.Tannert und P .Wiedemann (Hg.),Frankfurt, New York
2003
Islamische Religionsgemeinschaft Hessen: Darstellung der Grundlagen des
Islam, Frankfurt/Main 1999
Jacobs, K. (Hg.): Beratung im interkulturellen Kontext. Dokumentation einer
Weiterbildung für Beraterinnen und Berater der Sozialen Dienste, Berlin,
iaf 2005, in: Butt, Eva: Ehebegleitung. Gott hat viele Namen. Bireligiöse
Beratung am Beispiel eines deutsch-tunesischen Paares. In: Karl Fe-
derschmidt, Eberhard Hauschildt, Christoph Schneider-Harpprecht,
Klaus Temme, Helmut Weiß: Handbuch Interkulturelle Seelsorge, S. 143-
151, Neukirchen 2002
Jaffé, Aniela: Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung, Olten 1981
Jonas, Hans: Technik, Medizin, Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwor-
187
tung, Frankfurt/Main 1987
Josuttis, Ursula: »Außen bin ich Deutsche, innen aber Südländerin«. Seelsor-
ge und Beratung bei Menschen mit einer multikulturellen Identität, in:
Karl Federschmidt, Karl, Hauschildt, Eberhard, Schneider-Harpprecht,
Christoph, Temme, Klaus, Weiß, Helmut (Hg.): Handbuch Interkulturelle
Seelsorge, S. 119-129, Neukirchen 2002
Jung, Carl Gustav : Gesammelte Schriften. Das Symbolische Leben, Band 18,
I und II, Olten 1981
Jung, Carl Gustav: Psychologie und Religion, Olten 1971
Jung, Carl Gustav: Antwort auf Hiob, Olten 1971
Jung, Carl Gustav: Über psychische Energetik und das Wesen der Träume,
Stuttgart 1980
Jung, Carl Gustav : Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewuss-
ten, Olten 1971
Jung, Carl Gustav: Typologie, Olten 1971
Jung, Carl Gustav: Über die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge,
Olten 1971
Jung, Carl Gustav: Die Psychologie der Übertragung, Olten 1973
Jürgens, Gesa, El Hachimi, Mohammed, Schlippe, Arist von: Multikulturelle
systemische Praxis. Ein Reiseführer für Beratung, Therapie und Supervi-
sion, Heidelberg 2003
Karakasoglu, Yasemin: Islam und Moderne, Bildung und Integration, in:
Rumpf, Mechthild et al.: Facetten islamischer Welten, Bielefeld 2003
Kapuscinski, R.: Afrikanisches Fieber. Erfahrungen aus 40 Jahren. Frank-
furt/Main 1999
Kassel, Maria: Biblische Urbilder. Tiefenpsychologische Auslegung nach
C.G. Jung, Stuttgart 1980
Khoury, Adel: Der Koran – erschlossen und kommentiert v. A. K., Düssel-
dorf 2005
Khoury, Adel: Der Koran-, 2.Auflage, Gütersloh 1992
Kiesel, Doron, von Lüpke, Hans: Vom Wahn und vom Sinn. Krankheitskon-
zepte in der multikulturellen Gesellschaft, Frankfurt/Main 1998
Klessmann, Michael: Handbuch der Krankenhausseelsorge, Göttingen 1996
Koch, Eckhardt, Heilbronn, Kurt, Schouler-Ocak, Meryam: Deutsch-
Türkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale
Gesundheit: Entstehungsgeschichte, Entwicklung, Ziele und Ausblick, In-
ternet www.dtgpp.de, 2006
Krausen, Halima: Seelsorge im Islam, in: Pohl-Patalong, Uta, Muchlinsky,
Frank: Seelsorge im Plural, S. 233 - 242, Hamburg 1999
Krones, Tanja: Interkulturelle Depressionforschung in Deutschland, Mar-
burg 2001
Lemmen, Thomas: Islamische Organisationen in Deutschland, Bonn 2000
Luchtenberg, Sigrid: Interkulturelle kommunikative Kompetenz. Opladen
188
1999
Ludewig, Karl: Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen
Therapie, Heidelberg 2005
Maletzke, Gerhard: Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwi-
schen Menschen verschiedener Kulturen, Opladen 1996
Meah, Luthfa: Die muslimische Gemeinschaft und die Behandlung von
psychischen Erkrankungen. Anregungen aus dem britischen Gesundheits-
system, in: Weiß, Helmut, Federschmidt, Karl, Temme, Klaus: Ethik und
Praxis des Helfens in verschiedenen Religionen. Anregungen zum interre-
ligiösen Gespräch in Beratung und Seelsorge, S. 156-163, Neukirchen
2005
Menzel, Peter A.: Fremdverstehen und Angst. Fremdenangst als kulturelle
und psychische Disposition und die daraus entstehenden interkulturellen
Kommunikationsprobleme, Bonn 1993
Mernissi, Fatima: Islam und Demokratie, Freiburg 2002
Mihciyazgan, Ursula: Die Fremden als »die zu Entfremdenden« und die
Fremden als »die Anderen«. Fremdheit im Christentum und im Islam aus
religionssoziologischer Sicht. In: Gemeinsam 27(a), 24-34
Minuchin, Salvador: Familie und Familientherapie. Theorie und Praxis
struktureller Familientherapie, Freiburg 1992
Möhring, Peter, Apsel, Roland (Hg.): Interkulturelle psychoanalytische
Therapie, Frankfurt/Main 1995
Möhring, Peter: Kultur, Krankheit und Migration. In: Möhring, Peter, Apsel,
Roland (Hg.): Interkulturelle psychoanalytische Therapie, S. 74-93,
Frankfurt/Main 1995
Modena, Emilio: Das Fremde verstehen. Erfahrungen mit ArbeiterInnen aus
dem Mittelmeerraum in der psychoanalytischen Gruppen- und Einzelthe-
rapie. In: Möhring, Peter, Apsel, Roland (Hg.): Interkulturelle psychoana-
lytische Therapie, S. 20-46, Frankfurt/Main 1995
Molinari, Daniela: Dem Fremden begegnen – die Wiederinszenierung des
Kulturschocks. Möglichkeiten und Grenzen im Bereich der Beratung und
Therapie von Immigrantenfamilien, in: Peter Möhring, Roland Apsel: In-
terkulturelle psychoanalytische Therapie, S. 46-74, Frankfurt/Main 1995
Morgan, A.: What is narrative therapy? Adelaide 2000
Morgenthaler, Christoph: Fremdheit unter Brüdern. Die Ethik des Helfens
im Islam und was daraus in einem christlichen Kontext zu lernen ist, in:
Weiß, Helmut, Federschmidt, Karl, Temme, Klaus: Ethik und Praxis des
Helfens in verschiedenen Religionen. Anregungen zum interreligiösen Ge-
spräch in Beratung und Seelsorge, S. 146-156, Neukirchen 2005
Morgenthaler, Christoph: Systemische Seelsorge: Impulse der Familien- und
Systemtherapie für die kirchliche Praxis, Berlin 1999
Müller-Kent, Jens, Genkel, Ingrid: Leben werten? Göttingen 1998
Mujtaba, Sayid, Rukni, Musawi Lari: Westliche Zivilisation und Islam.
189
Muslimische Kritik und Selbstkritik, Ghom 1990
Nagel, Tilmann: Geschichte der islamischen Theologie. Von Mohammed bis
zur Gegenwart, München 1994
Oesterreich, Cornelia: Systemische Therapie an den Grenzen unterschiedli-
cher kultureller Wirklichkeiten. In: Heise, Thomas (Hg.): Transkulturelle
Psychotherapie. Hilfen im ärztlichen und therapeutischen Umgang mit
ausländischen Mitbürgern, Berlin 1998
Özdemir, Cem: Ich bin Inländer. Ein anatolischer Schwabe im Bundestag,
München 1999
Özelsel, Michaela: Gesundheit und Migration. Eine psychologisch –
empirische Untersuchung an Deutschen sowie Türken in Deutschland
und in der Türkei, München 1990
Palazzoli, Mara Selvini, Cirillo, Stefano, Selvini, Matteo, Sorrentino, Anna
Maria: Die psychotischen Spiele in der Familie, Stuttgart 1996
Parin, Paul: Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopsychoanalytische Studien,
Hamburg 1992
Pfleiderer, Beatrix et. al.: Ritual und Heilung. Eine Einführung in die
Ethnomedizin, Berlin 1995
Poling, James N.: Wahrnehmung kultureller Differenz und die Machtfrage.
Drei Stufen kultureller Analyse, in: Federschmidt, Karl, Hauschildt, E-
berhard, Schneider-Harpprecht, Christoph, Temme, Klaus, Weiß, Helmut
(Hg.): Handbuch Interkulturelle Seelsorge, S. 63-71, Neukirchen 2002
Rahman, Fazlur: Health and Medicine in Islamic Tradition, New York 1987
Rakhmat, Jalalludin: Die Ethik des Helfens im Islam, in: Weiß, Helmut,
Federschmidt, Karl, Temme, Klaus: Ethik und Praxis des Helfens in ver-
schiedenen Religionen. Anregungen zum interreligiösen Gespräch in Bera-
tung und Seelsorge, S. 125-146, Neukirchen 2005
Reichmeir, Johannes: Ethnopsychoanalyse. Geschichte, Konzepte, Anwen-
dungen, Gießen 2003
Ritschl, Dietrich: Konzepte, Ökumene, Medizin, Ethik. Gesammelte Auf-
sätze, München 1986
Rogers, Carl R.: Carl Rogers on Encounter Groups, New York 1970
Rosenthal, Franz: Science and Medicine in Islam, Hampshire 1990
Salman, Ramazan, Hegemann, Thomas: Transkulturelle Psychiatrie: Kon-
zepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen, Bonn 2001
Salman, Ramazan u.a. (Hg.): Handbuch Interkulturelle Suchthilfe. Modelle,
Konzepte und Ansätze der Prävention, Beratung und Therapie, Gießen
1999
Saragih, Mercy Anna: Besuch bei muslimischen Nachbarn nach dem Unfall-
tod ihres Sohnes, in: Weiß, Helmut, Federschmidt, Karl, Temme,
Klaus(Hg.): Ethik und Praxis der Helfens in verschiedenen Religionen, S.
290-293, Neukirchen 2005
Sass, Hans-Martin (Hg.): Medizin und Ethik, Stuttgart 1989
190
Sass, Hans-Martin: Menschliche Ethik im Streit der Kulturen, Medizinethi-
sche Materialien, Bochum 2003
Scharfenberg, Joachim: Seelsorge als Gespräch, Göttingen 1980
Scharfenberg, Joachim: Religion zwischen Wahn und Wirklichkeit. Gesam-
melte Beiträge zur Korrelation von Psychoanalyse und Theologie, Ham-
burg 1972
Scheller, Julia: Ethnopsychoanalyse, Seminararbeit Universität Frank-
furt/Main, 2006
Schimmel, Annemarie: Der Islam. Eine Einführung, Stuttgart 1990
Schimmel, Annemarie: Rumi – Ich bin der Wind und du bist das Feuer,
Leben und Werk des großen Mystikers, München 2003
Schimmel, Annemarie: Mystische Dimensionen des Islam, München 1985
Schimmel, Annemarie: Der Sufismus, in: Burgmer, Christoph: Der Islam.
Eine Einführung durch Experten, S. 68-81 Mainz 1996
Schimmel, Annemarie: Sufismus. Eine Einführung in die islamische Mystik,
München 2000
Schimmel, Annemarie: Die Zeichen Gottes, München 1995
Schipperges, Heinrich: Gesundheit und Gesellschaft: ein historisch-kritisches
Panorama, Berlin 2003
Schlippe, Arist von, El Hachimi, Mohammed, Jürgens, Gesa.: Multikulturelle
systemische Praxis. Ein Reiseführer für Beratung, Therapie und Supervi-
sion, Heidelberg 2003
Schmidt, Kurt, Egler, Gisela: Den Christen ein Christ, den Muslimen ein
Muslim? Überlegungen zu einer protestantischen Sicht interreligiöser
Seelsorge im Krankenhaus, in: (Klinik) Seelsorge im multireligiösen Kon-
text, Frankfurt/Main 1999
Schneider-Harpprecht, Christoph: Interkulturelle Seelsorge, Göttingen 2001
Schulte-Herbrüggen, Odo: Die moralischen Emotionen. Neurobiologische
und neuropsychologische Beiträge zum Verständnis psychosozialen und
ethischen Verhaltens, in: Weiß, Helmut, Federschmidt, Karl, Temme,
Klaus: Ethik und Praxis des Helfens in verschiedenen Religionen. Anre-
gungen zum interreligiösen Gespräch in Beratung und Seelsorge, S. 25-35,
Neukirchen 2005
Sen, Faruk, Goldberg, Andreas: Türken in Deutschland. Leben zwischen
zwei Kulturen, München 1994
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz(Hg.): Christen und Muslime in
Deutschland, Bonn 2003
Sich, Dorothea et. al.: Medizin und Kultur. Eine Propädeutik für Studierende
der Medizin und der Ethnologie, Frankfurt/Main 1995
Smith, Linda: Die Systemische Seelsorge, religionswissenschaftliche Seminar-
arbeit, Frankfurt/Main 2006
Southern, Richard W.: Das Islambild des Mittelalters, Mainz 1981
Spiegel, Yorick: Doppeldeutlich. Tiefendimensionen biblischer Texte, Mün-
191
chen 1978
Spuler-Stegemann, Ursula: Muslime in Deutschland. Nebeneinander oder
Miteinander, Freiburg 1998
Stauch, Karimah Katja: Die Entwicklung einer islamischen Kultur in
Deutschland. Berliner Beiträge zur Ethnologie, Bd.8, Berlin 2004
Steinkamp, Hermann: Seelsorge als Anstiftung zur Selbstsorge, Münster
2005
Stollberg, Dietrich: Therapeutische Seelsorge, Göttingen 1969
Stollberg, Dietrich: Seelsorge durch die Gruppe, Göttingen 1972
Stollberg, Dietrich: Wenn Gott menschlich wäre ... Auf dem Wege zu einer
seelsorgerlichen Theologie, Stuttgart 1978
Studien aus dem C.G. Jung-Institut, hier: Das Gewissen, S. 199, Zürich 1958
Szapocznik, José, Kurtines, William R.: Family Psychology and cultural
diversity: Opportunities for theory, research, and application. In: Nancy
Rule Goldberger/ Jody Bennet Veroff(Hg.): The culture and psychology
reader. In: Christoph Schneider-Harpprecht: Interkulturelle Seelsorge,
Göttingen 2001
Tan, Dursun: Das fremde Sterben. Sterben, Tod und Trauer unter Migrati-
onsbedingungen, Frankfurt/Main 1998
Taylor, Charles: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung,
Frankfurt/Main 1997
Tibi, Bassam: Der Islam und das Problem der kulturellen Bewältigung sozia-
len Wandels, Frankfurt/Main 1985
Topper, Uwe: Sufis und Heilige im Maghreb, München 1991
Varela, Maria del Mar Castro ( Hg.): Suchbewegungen. Interkulturelle
Beratung und Therapie, Tübingen 1998
Visser, Marijke et. al (Hg.): Kultursensitiv pflegen. Wege zu einer interkultu-
rellen Pflegepraxis, München 2002
Volkan, Vamik D.: Psychoanalyse der frühen Objektbeziehungen, Stuttgart
1978
Watzlawick, Paul u.a.: Menschliche Kommunikation, Bern, Stuttgart, Toron-
to, 1985
Weiß, Helmut: Ansätze einer Hermeneutik des helfenden Gesprächs in inter-
religiöser Hilfe und Seelsorge, in: Weiß, Helmut, Federschmidt, Karl,
Temme, Klaus: Ethik und Praxis des Helfens in verschiedenen Religionen.
Anregungen zum interreligiösen Gespräch in Beratung und Seelsorge, S.
241-247, Neukirchen 2005
Weiss, Regula: Macht Migration krank? Eine transdisziplinäre Übersicht zur
Gesundheit von Migrantinnen und Migranten, Zürich 2003
White, Michael, Epston,David: Narrative means to therapeutic ends. New
York 1990
Winkler, Klaus: Seelsorge, Berlin 2000
Ziemer, Jürgen: Seelsorgelehre, Göttingen, 2000