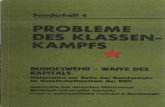Von Impotenz und Migräne – eine kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus...
-
Upload
uni-marburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Von Impotenz und Migräne – eine kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus...
Von Impotenz und Migräne – eine kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen
des Papyrus Ebers*
Tanja Pommerening (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Der Papyrus Ebers ist die bekannteste heilkundliche Sammelhand-schrift der Ägypter. Sie wurde um 1550 v. Chr. niedergeschrieben und führt mehr als 800 Einzeltexte auf, darunter zahlreiche Rezepte. Auf einer Internetseite von viagraforce.com1 wird behauptet, dass darunter ein Rezept gegen Impotenz sei; Ähnliches beteuert ein Fachartikel im International Journal of Impotence Research von 20042 unter Darbietung des entsprechenden Rezeptes in einer Übersetzung von Bendix Ebbell3:
Another for weakness of the male member (i. e. impotence): hyoscyamus |, beans |, bran (?) |, DArt |, sawdust of pine |, sawdust of mrj |, sawdust of willow |, sawdust of zizyphus |, sawdust of sycamore |, sawdust of juniperus |, juice of acacia |, juice of zizyphus |, juice of tamarix |, juice of sycamore |, flaxseed |, fruit of tamarix |, white oil |, goose-fat |, pig’s dung |, pignon |, myrrh |, onion |, colocynth |, ? of gjt |, water-melon |, tjw |, bcbc |, ? |, njt of flax |, northern salt |, salt from oasis |, inb |, red ochre, yellow ochre |, natron |, grease of ox, SASA |, are mixed together and (it) is bandaged therewith.
Ziel der folgenden Ausführungen wird zunächst sein zu klären, ob der herangezogene Text tatsächlich ein Beispiel für Impotenzbehandlung bietet. Kol. 82,22 des Papyrus Ebers4 liefert die Rezeptüberschrift: k.t *1 Dieser Beitrag war Teil der Einleitung in die Thematik des Symposiums. 1 „Viagra FORCE: Impotence and Pre-Viagra Age,“ http://www.viagraforce.
com/impotence_n_previagra_age.html, (Zugriff 24. Juni 2009). 2 SHOKEIR/HUSSEIN (2004): 385–388. 3 Eb 663 = pEbers 82,22–83,8. Der vorliegende zitierte Wortlaut ist EBBELL
(1937): 97 direkt entnommen, da SHOKEIR/HUSSEINs Abschrift der Über-setzung Ebbells stellenweise fehlerhaft ist.
4 Der Papyrus wurde von der Leipziger Universitätsbibliothek verfilmt, digi-talisiert und ins Internet gestellt: SCHOLL/KUPFERSCHMIDT (Zugriff 2. Juli 2009). Die Tafel mit Kol. 80–82 ist allerdings in den Wirren des 2. Weltkriegs
154 Tanja Pommerening
n.t gnn mt. Während gnn bestimmt „Weichheit“ oder „Schlaffheit“ meint,5 ist die Bedeutung von mt keinesfalls auf das ‚männliche Glied‘ einzuschränken.6 Der mt-Begriff im Ägyptischen ist einer der wenigen, dessen kontemporäres ‚anatomisch-physiologisches‘ Konzept aus meh-reren Texten bekannt und in der Sekundärliteratur ausreichend erörtert worden ist.7 Demnach sind mt.w kanalartige Verbindungsleitungen zwischen Körperorganen und Körpergliedern. Der Terminus bezieht sich auf Hohlgefäße und Stränge und lässt sich kaum mit heutiger anatomischer Terminologie verbinden.
Drei Traktate in den heilkundlichen Texten benennen u. a. den Verlauf der mt.w und die in ihnen transportierten Stoffe,8 ohne im Übrigen vollständig überein zu stimmen. Es zeigt sich aber, dass HAty-Herz und After zentrale Punkte sind, in die alle mt-Leitungen münden. Anhand des in den Traktaten beschriebenen anatomischen Verlaufs dieser mt.w kann man verfolgen, welche Leitungen oder Stränge aus moderner Sicht beschrieben worden sind: zuweilen eine Vene, zu-weilen eine Arterie, mal der Samen- oder der Harnleiter, mal ein spezieller Muskelstrang. Das Ägyptische kennt für diese modernen Bezeichnungen keine spezielle Terminologie, d. h. es wird zwar der Verlauf der Leitungen beschrieben, es werden aber keine weiteren Ter-mini für definierte Hohlgefäße entwickelt.
Eb 663 ist Bestandteil einer größeren Gruppe von 70 Rezepten,9 die den mt.w gewidmet ist. Sofern ein spezielles mt gemeint ist, wird seine Lokalisation genannt, bspw. das mt in der linken Hälfte (mt m gs iAbi), das mt des Knies (mt n mAs.t) oder die mt.w der Zehe (mt.w nw sAH).10 Wäre, wie Ebbell annimmt, mit mt an manchen Stellen das
verlorengegangen, so dass hier auf die Faksimileausgabe von EBERS (1875) zurückgegriffen werden muss.
5 Vgl. auch GRUNDRISS VII,2: 920, s. v. (gnn). 6 Zu Ebbells damaligen Überlegungen, dass mt auch das männliche Glied sein
könne, siehe EBBELL (1929): 11–13. Gegen mt = Penis und Ebbells Deu-tungen richtet sich schon GRUNDRISS I: 75 wie auch NUNN (1997): 60.
7 Zum mt.w-Begriff genauer GRUNDRISS VII: 400–408; BARDINET (1995): 63–68.
8 Eb 854/55 = Kol. 99,2–102,16; Eb 856 = Kol. 103,1–18; Bln 163 = Kol. 15,1–16,3.
9 Eb 627–Eb 696 = Kol. 79,5–85,16. 10 Eb 631 = Kol. 79,10; Eb 634 = Kol. 79,19; Eb 647 = Kol. 81,1; Eb 648 =
Kol. 81,4.
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 155
„männliche Glied“ gemeint, so wäre auch hier eine nähere Lokalisation oder begriffliche Eingrenzung zu erwarten, wie es im Demotischen denn tatsächlich der Fall ist, das uns das Syntagma mt n Hw = wörtlich „mt-Leitung des Mannes“ überliefert hat.11 Im Mittelägyptischen wäre dementsprechend mit mt n TAy zu rechnen, da im Demotischen Hw auch anstelle des in dieser Zeit nicht mehr verwendeten Wortes TAy treten kann.12 Weder mt n TAy noch mt n Hw sind aber in den heilkundlichen Texten vordemotischer Zeit belegt. In ihnen erscheint der Phallus stets unter der Bezeichnung Hnn oder bAH.13
Nur weil Ebbell nun mt nicht als bspw. „mt-Leitung“ übersetzt hat, sondern als „male member“ (männliches Glied) deutet, ergibt sich für ihn durch die Verbindung mit dem Wort gnn = „Weichheit“ die Inter-pretation Impotenz. Ebbell missachtet daher sowohl die allgemeine Beleglage der mt.w als auch, durch seine konkrete Übersetzung, die da-hinterstehenden Konzepte.14
Dieses Beispiel habe ich aus drei Gründen ausgewählt. Erstens um auf den für die ägyptische Heilkunde zentralen mt.w-Begriff eingehen zu können, zweitens um eine von Ebbells konkreten Übersetzungen zitie-ren zu können und drittens um zu demonstrieren, wie sich seine Übersetzung, die immerhin aus dem Jahre 1937 stammt, in rezenten Zeitschriften und im Internet immer noch verbreitet. Man kann sich an dieser Stelle fragen, ob es unter den existierenden Übersetzungen nicht auch bessere gibt, bzw. welche für die besseren gehalten werden. 11 Innerhalb einer Rezeptur, die veranlassen soll, dass eine Frau einen Mann
liebt: pLondon-Leiden XII,14, ed. GRIFFITH/THOMPSON (1904): 88f.; (1905) XII,14. Zu Hw, das sich von mä. aHAw.ti „Kämpfer“ ableitet und ab der 18. Dynastie in Gebrauch war, siehe WB I: 217,8–218,2; ERICHSEN (1954): 297f.; VYCICHL (1983): 319, s. v. àooyt, vgl. auch ibid., S. 205.
12 Vgl. das Syntagma mä. irT.t n.t msi.t TA.y > dem. irte n ms Hwt, siehe insb. dazu POMMERENING (2010).
13 Wobei Hnn das Glied und bAH im medizinischen Kontext auch enger gefasst die Eichel meinen kann, vgl. GRUNDRISS VII,2: 608 und GRUNDRISS VII,1: 240; TLA-Belege zu Lemma-Nr. 106810 u. 53510.
14 Nur der Vollständigkeit halber eine angemessene Übersetzung, die in jedem Fall eines Kommentares bedürfte: „ein anderes der Weichheit der mt-Leitung“ bzw. deutlicher „ein anderes (Heilmittel) gegen mt-Leitungserwei-chung“. Zur Abk. k.t für k.t pXr.t n.t ..., siehe GRUNDRISS VII,1: 291, §8. Auf n.t folgt die Krankheitsbezeichnung wie so häufig in Verkürzung der Form pXr.t n.t Verbum + Krankheit, d. h. zu ergänzen wäre bspw. dr = beseitigen.
156 Tanja Pommerening
Ebbells Übersetzung des Papyrus Ebers von 1937 war die erste eigenständige ins Englische. Georg Ebers, der 1875 die erste Ausgabe des nach ihm benannten Papyrus besorgt hatte, u. a. durch Anfertigung einer Lithographie, hielt sich selbst mit einer fortlaufenden Über-setzung zurück, um in seinem Werk, wie er selbst meinte, nicht „unsichere und daher kurzlebige Resultate ... niederzulegen“, „wenige Jahrzehnte ... seitdem die junge Wissenschaft der ägyptischen Sprach-forschung mit derselben Strenge der Kritik zu operieren begonnen hat, welche die classische Philologie schon lange von ihren Jüngern fordert.“15 Zudem fühlt er sich als „Nichtmediciner“ in seinem Blick eingeengt.16 Mit der „Uebersetzung sämmtlicher Krankheiten, gegen welche Arzeneimittel vorgeschlagen werden“ – einem Verzeichnis aller Überschriften der Einzeltexte – legt er dennoch erste Teilüber-setzungen vor;17 und mit Hilfe des dem zweiten Band beigefügten hieroglyphisch-lateinischen Glossars von Ludwig Stern wird das heilkundliche Wortgut erstmals erschlossen.18
Die erste fortlaufende Übersetzung fertigte 1890 Heinrich Joachim
an, und zwar in die deutsche Sprache. Er vermerkt in seinem Vorwort: Bei der Abfassung dieses Buches, das hauptsächlich für das ärztliche Publikum bestimmt ist, war es mein Hauptbestreben, dem Leser eine mög-lichst wörtliche Uebersetzung zu liefern. (...) Auf diese Weise soll dem Leser eine eventuelle Mitarbeiterschaft ermöglicht werden, insofern er nunmehr selbst in der Lage ist, die unsicheren Stellen ... zu prüfen und eventuell zu klären.
Joachims Übersetzung fand eine weite Verbreitung und wurde seiner-zeit von Biologen, Chemikern, Medizinern und Pharmazeuten gleicher-maßen rezipiert und kommentiert;19 1973 erschien ein photomecha-nischer Nachdruck.
15 EBERS (1875): IIIf. 16 EBERS (1875): III. 17 EBERS (1875): 24–36. 18 Die erste vollständige hieroglyphische Transkription erfolgte 1913 durch
Walter Wreszinski, der zwar ebenfalls eine Übersetzung und einen Kommen-tar ankündigte, dieser Vorgabe aber nicht standhielt.
19 Bspw. KRONFELD, Ernst M. 1892. Geschichte des Safrans (Crocus sativus L. var. culta autumnalis) und seiner Cultur in Europa. Wien: Perles; BLANCK, Edwin. 1929. Handbuch der Bodenlehre: Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Lehre von der Entstehung des Bodens. Berlin: Springer; ARTELT, Walter. 1929. Geschichte der Anatomie der Kiefer und der Zähne bis zum Ausgang der Antike. Leiden: Brill;
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 157
Im Jahre 1930 übertrug Cyril P. Bryan Joachims Übersetzung recht frei in die englische Sprache, ungeachtet dessen, dass sie längst veraltet und unbrauchbar war, weil die Erschließung der altägyptischen Sprache nach 40 Jahren große Fortschritte gemacht hatte. Bryans „rendition into English of German and other translations of the Egyptian origi-nal“ galt dem „English-speaking student“ und war die erste breit ver-fügbare Übersetzung ins Englische.
Ebbell besorgte somit 1937 die erste eigenständige Translation ins Englische. Er war getrieben vom Anspruch, den Sinn möglichst vieler Krankheitsnamen und Symptome zu erfassen, und zahlreiche Drogen zu identifizieren.20 In einem Appendix21 führt er alles auf, was über die Deutungen des Wörterbuchs (WB) von Erman und Grapow hinaus-geht. Man findet dort 1:1-Übersetzungen für Erkrankungen wie Rheuma, Gonorrhoe, Lepra, Asthma, Hämorrhoiden und Bilharziose, die Ebbell im ägyptischen Wortgut des Papyrus Ebers auszumachen glaubte. Nicht erst seit heute ist seine Übersetzung ohne Frage obsolet. Umso mehr erstaunt es, wie häufig sie in jüngeren Artikeln zitiert wird (Tab. 1).
Diese und die später noch folgenden Daten habe ich mit Hilfe der „Cited Reference“-Funktion des Web of Science 22 ermittelt, einer an der
PROKSCH, Johann K. 1895. Die Geschichte der venerischen Krankheiten: Eine Studie. Bonn: Hanstein; HUBER, Johann Ch. 1891. Bibliographie der klinischen Helminthologie. München: Lehmann.
20 EBBELL (1937): 9 (Foreword): „... I hope I have succeeded in determining the sense of many names of diseases and symptoms and in identifying various drugs; besides, I believe I have found out what is referred to in most of the descriptions of diseases. I therefore hope that my translation will be able to deepen the knowledge of the Papyrus Ebers, and give the readers a fairly clear impression of its interesting medical contents and of the high level of which the ancient Egyptian medical art had attained.“
21 EBBELL (1937): 129–135. 22 Universitätsbibliothek Mainz. „Datenbank-Infosystem (DBIS): Web of
science,“http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_mz &colors=&ocolors=& lett= f&titel_id=2142 (Zugriff 2. Juli 2009). Folgende Datenbanken lagen zu dieser Zeit der Citation Database zugrunde: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 1945–present; Social Sciences Citation Index (SSCI) 1956–present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 1975–present; Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) 1990–present; Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH) 1990–present.
158 Tanja Pommerening
1. STEVERDING, D.
2008.
The history of African
trypanosomiasis.
Parasites & Vectors 1:
Art. No. 3.
2. TIPTON, C. A.
2008.
Historical perspective: The
antiquity of exercise, exercise
physiology and the exercise
prescription for health.
World review of nutrition
and dietetics 98: 198–245.
3. KURIYAMA, S.
2008.
The forgotten fear of
excrement.
Journal of medieval and
early modern studies 38:
413–442.
4. LASKARIS, J. 2008. Nursing mothers in Greek
and Roman medicine.
American journal of
archaeology 112: 459–464.
5. HUNDSBERGER,
H.; VERIN, A.;
WIESNER, C., et al.
2008.
TNF: a moonlighting protein
at the interface between
cancer and infection.
Frontiers in Bioscience 13:
5374–5386.
6. LASKARIS, J. 2005. Error, loss, and change in the
generation of therapies.
Studies in ancient medicine
31: 173–189.
7. STRITZKER, J.;
WEIBEL, S.; HILL,
P. J., et al. 2007.
Tumor-specific colonization,
tissue distribution, and gene
induction by probiotic
Escherichia coli Nissle 1917 in
live mice.
International journal of
medical microbiology 297:
151–162.
8. MCCLUSKY, D. A.;
MIRILAS, P.;
ZORAS, O., et al.
2006.
Groin hernia – Anatomical
and surgical history.
Archives of surgery 141:
1035–1042.
9. DE LA TORRE, J. C.
2006.
How do heart disease and
stroke become risk factors for
Alzheimer’s disease?
Neurological research 28:
637–644.
10. WESTERHOF, W.
2006.
The discovery of the human
melanocyte.
Pigment cell research 19:
183–193.
11. OKASHA, A. 2005. Mental health in Egypt. Israel journal of psychiatry
and related sciences 42:
116–125.
12. LUCAS, R.; KRESSE,
M.; LATTA, M., et
al. 2005.
Tumor necrosis factor: How
to make a killer molecule
tumor-specific?
Current cancer drug targets
5: 381–392.
Tab. 1: Artikel von 2005–2008, in denen EBBELL (1937) zitiert wird
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 159
Universität Mainz verfügbaren fachübergreifenden Datenbank, die die Zitate in wissenschaftlichen Zeitschriften erfasst und dabei inter-disziplinär ein breites Fächerspektrum von Kunst, Geistes- und Sozial-wissenschaften, Medizin, Naturwissenschaften und Technik abdeckt. Insgesamt sind dort derzeit mehr als 9000 wissenschaftliche Zeit-schriften mit ca. 37 Millionen Artikeln aller Fachgebiete verzeichnet.
Hiernach ergibt sich, dass seit 1999, dem Jahr, in dem die derzeit neueste pEbers-Übersetzung von Wolfhart Westendorf in deutscher Sprache auf den Markt kam, 47 Artikel Ebbells Übersetzung zitieren. Dies erscheint für ein Werk von 1937 recht viel, doch werden die Daten erst transparent, wenn man sie mit der Zitierhäufigkeit anderer Ebers-Übersetzungen vergleicht. Dazu zunächst eine kurze Übersicht über das, was nach Ebbell geschah.
Mit dem Grundriss der Medizin der Alten Ägypter in neun Bänden aus den Jahren 1954 bis 1973 liegen die Ergebnisse des bislang größten Projektes zur altägyptischen Medizin vor, ein Meilenstein in der Auf-arbeitung der heilkundlichen Texte. Grapow23 distanziert sich im Vor-wort ausdrücklich von den „überklugen und zum erheblichen Teil verkehrten oder doch sehr unsicheren Deutungen und Umdeutungen“ Ebbells. Die im vierten Band bereitgestellten Übersetzungen des drei-köpfigen Autorenteams Grapow, Deines, Westendorf bleiben nah am Text und sind in der Interpretation relativ zurückhaltend. Die acht übrigen Bände liefern Kommentare, Wörterbücher, Ergänzungen und Hintergründe, wobei die komplexe Informationsvernetzung die Nut-zung des GRUNDRISSes nicht gerade einfach macht. Zudem hat man die Einzeltexte aus dem Kontext und ihrer individuellen Papyrus-zugehörigkeit gelöst, völlig neu unter anatomischen und patho-logischen Gesichtspunkten zusammengestellt und somit den ursprüng-lichen Anordnungsprinzipien und möglichen Entwicklungen wenig Rechnung getragen. Auch ist zwar nicht unter den LeserInnen dieses Beitrags, wohl aber beim Normalnutzer die Kenntnis der deutschen Sprache leider immer schlechter geworden. Insofern hätte Paul Ghaliounghuis englische Ebers-Übersetzung von 1987, die vom GRUNDRISS ausging, möglicherweise gute Chancen gehabt, Ebbells Werk abzulösen, doch lag sie zwar 1987 gedruckt vor, gelangte jedoch erst 2005 in den Verkauf und ist nach wie vor schwer zugänglich.
23 GRUNDRISS II: 92.
160 Tanja Pommerening
Mehr noch als die Mitarbeiter des GRUNDRISSes berücksichtigte Thierry Bardinet in seinen Übersetzungen und Kommentaren der medizinischen Papyri die altägyptischen Krankheitskonzepte. Sein Werk von 1995 bietet darüber hinaus die erste zusammenhängende Translation der heilkundlichen Papyri ins Französische. Bardinet emp-fiehlt in seinem Vorwort, dass man sich vor deren Lektüre dem einlei-tenden Teil widmen solle, der die heilkundlichen Konzepte und Theo-rien über Physiologie und Pathologie bereitstellt.24
Die derzeit neueste Übersetzung des Papyrus Ebers findet sich im Handbuch der Medizin von Wolfhart Westendorf aus dem Jahre 1999, das in der Reihe „Handbuch der Orientalistik“ erschienen ist. Westen-dorf orientiert sich deutlich am GRUNDRISS, bringt sein Werk jedoch auf den neuesten Stand der Forschung und vermerkt in den Anmer-kungen dementsprechend die aktuelle Sekundärliteratur zu Einzel-problemen. Im Gegensatz zum GRUNDRISS präsentiert Westendorf den Ebers-Text in fortlaufender Übersetzung.
Über den Science Citation-Index des Web of Science lässt sich nun er-mitteln, wie häufig die genannten Werke zitiert wurden (Tab. 2; Abb. 1 und 2). Um abgrenzend zu zeigen, wie die neueren Übersetzungen wissenschaftlich integriert sind, wurden die Daten in zwei Zeit-abschnitte untergliedert. Den Scheidepunkt bildet das Erscheinen von Westendorfs Handbuch der Medizin 1999.
Tab. 2: Zitierhäufigkeit der Werke
24 BARDINET (1995): 10.
Autor Nach-druck Sprache Ziel-
gruppe 1950–1998
1999– 6/2009
JOACHIM (1890) 1973 deutsch Ärzte 24 9
BRYAN (1930) 1974 englisch 0 2
EBBELL (1937) - englisch Ärzte 76 47
GRUNDRISS (1954–1973) - deutsch 37 27
GHALIOUNGHUI (1987) - englisch 0 2
BARDINET (1995) - französisch 4 34
WESTENDORF (1999) - deutsch 0 10
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 161
Abb. 1: Prozentuale Zitierhäufigkeit von Übersetzungswerken in Artikeln 1950–1998
Abb. 2: Prozentuale Zitierhäufigkeit von Übersetzungswerken in Artikeln 1999–6/2009
162 Tanja Pommerening
Es zeigt sich, dass EBBELL (1937) auch in neuerer Zeit am häufigsten zitiert wird. Ebenfalls überraschend ist die Unverwüstlichkeit von Joachims Übersetzung. Ein Blick in die Artikel, die ihn zitieren, lässt allerdings in manchen Fällen Zitierketten vermuten. Die groß ange-legten und breit kommentierten Werke wie der GRUNDRISS, WESTENDORF (1999) und BARDINET (1995) sind nicht in dem Maße vertreten, das man erwarten würde, sind sie doch jünger, ausführlicher, kritischer und überhaupt wissenschaftlicher. Sie wurden zwar teilweise in den wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen, haben die älteren aber noch nicht gänzlich zurückgedrängt. Die Zahlenangaben lassen erkennen, dass BARDINET gegenüber WESTENDORF bevorzugt wird.
Es versteht sich von selbst, dass die hier vorliegenden Daten nur Anhaltspunkte liefern. Beim unmittelbaren Vergleich muss bewusst sein, dass in manchen der genannten Werke nicht nur eine Überset-zung des Papyrus Ebers zu finden ist, wie bei EBBELL (1937), GHALIOUNGHUI (1987), BRYAN (1930) und JOACHIM (1890), sondern einer Vielzahl heilkundlicher Papyri, wobei zudem noch Hintergrund-informationen geliefert werden (so im GRUNDRISS, bei WESTENDORF und BARDINET). Unter diesem Gesichtspunkt verwundert die Zitier-häufigkeit von JOACHIM und EBBELL (1937) umso mehr.
Wie lassen sich diese Ergebnisse nun im Lichte der Fragestellung unseres Symposiums interpretieren? Klassifiziert man die Zeitschriften, in denen die soeben vorgestellten Werke zitiert werden, nach ihrer Herausgeber- und Leserschaft in naturwissenschaftliche und geistes-wissenschaftliche, so ergibt sich folgendes Bild (Abb. 3).
Abb. 3: Absolute Zitierhäufigkeit von Übersetzungswerken in naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Artikeln ab 1999
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 163
JOACHIM (1890), BRYAN (1930) und EBBELL (1937) werden fast aus-schließlich in naturwissenschaftlichen Zeitschriften zitiert, der GRUND-RISS und WESTENDORF (1999) überwiegend in geisteswissenschaftli-chen. Bardinets Werk spricht in hohem Maße Naturwissenschaftler, aber auch Geisteswissenschaftler an. Dies korreliert mit der Herkunft der Verfasser: Joachim, Ebbell und Bardinet sind Ärzte, Bardinet ist zudem noch Ägyptologe. Unabhängig von der Art der Übersetzung wird hier die Einschätzung der hauptberuflichen Kompetenz des Urhebers sowie dessen Präsenz in entsprechenden Fachkreisen eine Rolle gespielt haben. Bardinets Doppelqualifikation mag dazu geführt haben, dass seine Arbeit dem von Ägyptologen erstellten GRUNDRISS und Westendorfs Handbuch den Rang abläuft.25
Die Auflagenhöhe und Auflagenzahl einer jeden pEbers-Über-tragung beeinflusst deren Beliebtheit natürlich ebenso wie darüber hinaus die Publikationssprache. So kann man davon ausgehen, dass die englische Übersetzung des Arztes Ghaliounghui mehr Anhänger ge-funden hätte, wäre sie in den Verkauf gelangt. Joachims Werk profitiert mit Sicherheit vom 1973 erstellten Nachdruck, wie auch Bryan, dessen Joachim-Übersetzung stets neu aufgelegt wird.
Hinsichtlich der Vorliebe für Ebbells Übersetzung muss man sich zudem fragen, inwieweit sein Vorgehen, den ägyptischen Text in die moderne medizinische, botanische usw. Terminologie zu überführen, eine naturwissenschaftlich vorgeprägte Leser- und Autorenschaft über-haupt erst angesprochen hat. Seine Zielgruppe, wie auch die von Joachim, sind Ärzte. Daraus ergibt sich die Frage, ob nicht eine zusätz-liche Kommentierung, die den modernen Naturwissenschaftler in seiner Zeit abholt, angemessen und notwendig sei.26 Ein solcher Kom-mentar, der die Relation zwischen modernen und antiken Begrifflich-keiten herzustellen hätte, wäre parallel zu einem kontextuellen bzw. konzeptuellen anzulegen. 25 Ein ähnliches Phänomen zeigt sich übrigens im Bereich der Ausgaben
altägyptischer mathematischer Texte. Die des Ägyptologen PEET (1923) wird überwiegend von Ägyptologen zitiert, die der Mathematical Association of America zugedachte Ausgabe der Mathematiker CHACE/BULL/MANNING/ ARCHIBALD (1927–1929) von ihresgleichen. Hinweis Annette Imhausen.
26 Diese Frage wurde während des Vortrags direkt an das Publikum gerichtet, im Laufe des Symposiums mehrfach aufgegriffen und kontrovers diskutiert. Im Allgemeinen forderten Wissenschaftshistoriker und auf diesem Gebiet arbeitende Philologen eine breitere Kommentierung als Fachphilologen.
164 Tanja Pommerening
Ein Zwischenergebnis ist festzuhalten: Es steht außer Frage, dass aus historischer Sicht die derzeit besten Übersetzungen diejenigen sind, die altägyptische heilkundliche Konzepte ausarbeiten und moderne Ter-minologien im Übersetzungstext vermeiden. In jedem Fall ist ein Kommentar erforderlich, der den übersetzten Abschnitt in den histo-rischen Kontext einbindet. Darüber hinaus wird man aber einen Großteil der interessierten naturwissenschaftlich vorgeprägten Leser nur gewinnen, wenn man sie mit Hilfe ihrer Fachsprache abholt. Ein weiterer Kommentar könnte daher dazu dienen, kritisch und sorgfältig die derzeitigen modernen Textinterpretationen zu revidieren.
Das soeben vorgeführte Ebbell-Beispiel ist nur eine Seite der Me-daille; denn es besteht heute wie schon seit ca. 50 Jahren seitens der gesamten Fachwissenschaft, also der ägyptologischen und der medizin-historischen, kein Zweifel daran, dass Ebbells „Impotenz“-Über-setzung falsch ist. Sie ist das perfekte Beispiel einer Übersetzung, die nur in außerfachwissenschaftlichen Kreisen, dort aber durchaus von WissenschaftlerInnen, unkritisch rezipiert wird.
Ganz anders verhält es sich mit denjenigen Deutungen, die in einer definierten Hinsicht stimmen können, aber genau dann falsch werden, wenn sie als 1:1-Gleichsetzungen in der Übersetzung erscheinen. Gerade solche Fälle benötigen stärker als bislang üblich eine Erläu-terung. Und diese Erläuterung sollte das irgendwie Richtige und das irgendwie Falsche sehr genau beschreiben, d. h. das Verhältnis des ausgangssprachlichen Bedeutungsfeldes zum zielsprachlichen. Da diese Verhältniserläuterung relativ zu dem zu deutenden Ausgangstext ana-chronistisch ist, hat sie in der eigentlichen Übersetzung nichts zu suchen. Es ist also ein der reinen Übersetzung beizuordnender Kom-mentar zwingend erforderlich. Dieser Kommentar sollte den Ana-chronismus aufzeigen und dem breiteren Publikum einen historisch korrekten – eben nicht-anachronistischen – Zugang zur Bedeutung des Urtextes ermöglichen.
Zur Illustrierung dessen, was ein Kommentar durch Berück-sichtigung diachroner Verläufe und auch originär – d. h. zur Erläute-rung der Sache selbst und zum wissenschaftlichen Fortschritt – beizu-tragen vermag, werde ich im folgenden das Beispiel der „Migräne“-Übersetzung von ägypt. mHr.t m gs dp sowohl in die Zielsprachen unseres 21. Jahrhunderts als auch ins antike Griechisch revidieren.
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 165
Ausgangspunkt ist pEbers 47,14f. in den Übersetzungen von Westendorf und Bardinet:27
Westendorf: „Ein anderes (Heilmittel) für die Krankheit im halben Kopf (Migräne). Schädel des Welses; werde zu Asche erhitzt (und gegeben) in Öl/Fett; werde der Kopf damit gesalbt vier Tage lang.“ Bardinet: „Autre (remède), pour la migraine (littéralement: les maux qui sont dans un côté de la tête): crâne de silure, frit dans de la graisse/huile. Enduire la tête avec (cela), quatre jours de suite.“
Beide Übersetzer bringen die Leiden in der Hälfte des Kopfes (mHr.t m gs dp) unmittelbar mit Migräne zusammen. Dies scheint zunächst einzuleuchten, wenn man, wie die Autoren, in griech. ἡμικρανία eine Lehnübersetzung aus dem Ägyptischen sieht und die griech. ἡμικρανία-Krankheit mit der heutigen Migräne gleichsetzt.
Entsprechend muss überprüft werden: (1) ob ἡμικρανία eine Lehnübersetzung des ägyptischen Syntagmas
sein kann (2) ob die griech. ἡμικρανία-Krankheit der heutigen Migräne ent-
spricht und (3) ob das ägyptische Leiden symptomatisch dem griechischen
überhaupt gleichkommen kann. Allein dass diese Überprüfungen notwendig sind, zeigt, dass solch eine Übertragung ohne Kommentar nicht verantwortbar ist.
Die sprachliche Seite lässt sich in einem solchen genauer beleuch-ten. Das ägyptische Syntagma gs dp ist heilkundlich in zwei Ver-bindungen belegt, einerseits hier im Papyrus Ebers als Ort des Leidens: „Leiden in der Hälfte des Kopfes“ (mHr.t m gs dp) und andererseits im späteren Papyrus Beatty V (um 1250 v. Chr.) in der Überschrift „Buch der Beschwörung der ‚Kopfhälfte‘“ (gs-dp).28
Im Griechischen ist das Wort ἡμικρανία, das man bislang unmittel-bar mit dem Ägyptischen hat zusammenbringen wollen, erstmals bei Galen belegt.29 Hieraus ist auf dem Weg über lat. hemicrania und spät- oder mittellat. (h)emigrania unter anderem das dt. Wort Migräne entstan- 27 = Eb 250; WESTENDORF (1999): 594 (Hervorhebung durch Unterstreichen
ist hier durch Fettdruck wiedergegeben); BARDINET (1995): 289. 28 pChester Beatty V vs. 4,1, ed. GARDINER (1935), Bd. 2: Taf. 28A. Hier ist das
Syntagma insgesamt mit einem Fleischstück determiniert, was ebenfalls andeutet, dass eine anatomische Region gemeint ist und keine Erkrankung.
29 ROSE (1995): 1–3. Im TLG sind ebenfalls keine früheren Belege vermerkt.
166 Tanja Pommerening
den. Galens ἡμικρανία ist aber bereits eine Weiterentwicklung der ur-sprünglichen Benennung ‚Hälfte des Schädels‘, denn das griech. Suffix -ία verändert die akute Schmerzsymptomatik des ‚halben Schädels‘ in den Namen einer mehr oder weniger dauerhaften Krankheit. Galen beschreibt die ἡμικρανία folgendermaßen:30
[Über die Hemikranie]31 Ein schmerzhafter Krankheitszustand befällt einen halben Teil des Kopfes, und zwar manchmal den rechten (Teil), aber zuweilen sucht sie auch den andersseitigen (Teil) heim, wobei sie (vom Kranken) lediglich gemäß der (Längen)ausdehnung derjenigen Naht Besitz ergreift, die sich längs desselben (d. h. des Kopfes) erstreckt.32
Eine Lehnübersetzung des ägyptischen gs-dp in das Griech. lässt eigentlich das Wort ἡμικράνιον erwarten, das man im Griech. tatsäch-lich vorfindet, und zwar im magischen pLondon 121 aus dem 3./4. Jh. n. Chr.33 und in den Kyraniden34, deren erste Kompilation aus
30 Galenus, De compositione medicamentorum secundum locos, lib. II, cap. III (12.591
KÜHN): [Περὶ ἡμικρανίας.] Πάθος ὀδυνηρὸν γίνεται κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος τῆς κεφαλῆς ἐνίοτε μὲν τὸ δεξιὸν, ἔστι δ’ ὅτε καὶ κατὰ θάτερον, ὁριζόμενον τῇ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς ἐκτεταμένῃ ῥαφῇ...
31 Der textkritische Status der von Kühn in eckige Klammern gesetzten Kapitelüberschrift „Περὶ ἡμικρανίας“ ist bislang völlig unklar: diese Über-schrift ist entweder ein ursprünglicher Bestandteil der ihr unmittelbar folgen-den Krankheitsdefinition oder erst (so dass der hier übersetzte Satz zum Zeitpunkt seines – eben vielleicht vorgalenischen – Entstehens eine andere Krankheit als die Hemikranie gemeint haben könnte) von Galen hinzugefügt worden oder sogar ein erst postgalenischer Zusatz (der vielleicht aus einer der frühen lateinischen Übersetzungen stammt, wo – so 12.591 KÜHN – das Wort „hemicrania“ auch im Definitionstext erscheinen kann: „Cap. III. [De Hemicrania.] Hemicrania affectio dolorifica…“). Dass Galen selbst mit diesem „schmerzhaften Krankheitszustand“ die ‚ἡμικρανία‘ gemeint hat, ist indes gesichert, da das Wort ‚ἡμικρανίαν‘ in der gleichen Textpassage (12.592 KÜHN) ebenfalls erwähnt wird.
32 D. h. die so bestimmte Krankheit findet lediglich parallel zur Pfeilnaht (Sutura sagittalis) des knöchernen Schädels statt, so dass die vorliegende Definition jeden Stirnschmerz ausschließt.
33 PGM VII.199–201 = Papyri Graecae Magicae, ed. PREISEDANZ VII 199–201: Πρὸς ἡμικράνιον· λαβὼν ἔλαιον εἰς τὰς χεῖράς σου εἰπὲ λόγον ‘ὁ Ζεὺς ἔσπειρεν λίθον ῥαγός·σχίζει τὴν γῆν. οὐ σπείρει·οὐκ ἀναβαίνει. (Gegen die Hemikranie: Nachdem du Öl in deine Hände genommen hast, sprich die folgende Formel/Beschwörung: „Zeus säte einen Stein der Weintraube: er spaltet den Erdboden; sät er [aber] nicht, [so] bewegt er sich nicht nach oben.“)
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 167
dem 4. Jh. n. Chr. stammt. Bei einem Pseudo-Galen (2. Jh. n. Chr.)35, in einer allerspätestens im 3. Jh. n. Chr. verfassten Zauberformel36 und in Cyr. 1,1637 wird das Syntagma πόνος ἡμικρανίου verwendet, das so viel heißt wie „das Leiden des halben Schädels“.
Weil die Verbindung πόνος ἡμικρανίου dem ägyptischen Syntagma mHr.t m gs-dp nahekommt, kann im Gegensatz zur bisherigen Her-leitung als wahrscheinlich angenommen werden, dass πόνος ἡμικρανίου aus mHr.t m gs-dp lehnübersetzt worden ist, und nicht, wie bislang ver-mutet, die Galen’sche ἡμικρανία, die m. E. erst eine Weiterentwicklung darstellt.38 Allerdings muss man hier prinzipiell darauf hinweisen, dass das ägyptische Wort dp (tp) in den heilkundlichen Texten im 2. Jt. v. Chr. wie auch im Demotischen in der Regel den ganzen Kopf, quasi mit Trennlinie am Hals, bezeichnet, das griechische κράνιον hingegen nur dessen oberen Teil, den in den mittelägyptischen heilkundlichen Texten das Wort Dnn.t anatomisch benennt, das im Demotischen nicht belegt ist. Sowohl κράνιον als auch Dnn.t meinen dabei nicht nur den knöchernen Hirnschädel, sondern bisweilen und im engeren Sinne die gesamte obere Kopfpartie. Diese kommt denn auch im ägyptischen Rezept gegen das Leiden pharmazeutisch zum Einsatz, nämlich in Form von Dnn.t des Welses. Der Wels fällt besonders durch seine zwei
34 Cyr. 2,2, ed. KAIMAKES (1976): 116: Περὶ ἀλώπεκος [...] ἐὰν δέ τις τὸ μόριον
αὐτοῦ ἐνειλήσας ῥάκει περιάψῃ τῇ κεφαλῇ, πάντα πόνον κεφαλῆς καὶ ἡμικράνιον καὶ σκοτώματα ἰᾶται. (Über den Fuchs: [...] Wenn sich jemand dessen in einem Tuch eingewickelten Penis rund um den Kopf festbindet, so heilt das einen jeden Kopfschmerz und die Migräne und die Skotomata.)
35 Ps.-Galenus, De remediis parabilibus libri III (14.502 KÜHN): [Πρὸς πόνον ἡμικρανίου.] Καρδάμου σπόρον τρίψας μῖξον μετ’ ὠοῦ λευκῷ καὶ κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ ἐπάνω θὲς στυπία, ἢ τοῦ ἀετοῦ τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστοῦν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ περίαπτε ὁμοίως καὶ τοῦ γυπός. ἄλλο. οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάβρακος εὑρισκόμενοι λίθοι κεφαλαλγίαν ἰῶνται καὶ εἰς ἡμικρανίαν περιαπτόμενοι δεξιὸς δεξιᾷ καὶ ἀριστερὸς ἀριστερᾷ.
36 REITZENSTEIN (1926): 176–178. 37 Cyr. 1,16, ed. KAIMAKES (1976): 82: Εἰς δὲ τὸν πορφυρίτην λίθον γλύψον τὸ
πτηνόν, καὶ παρὰ τοὺς πόδας τὸ κηρύκιον·ὑπὸ δὲ τὸν λίθον ἀκρόπτερον τοῦ πτηνοῦ· καὶ κατακλείσας φόρει πρὸς τὰς περιωδυνίας τῆς κεφαλῆς καὶ ἡμικρανίου πόνον.
38 Bestimmte pseudo-galenische Quellen und die Kyraniden erweisen sich damit einmal mehr als Fundgrube für Untersuchungen zur Überlieferung alt-ägyptischer Heiltraditionen in neuem Kontext. Vgl. schon POMMERENING (2010).
168 Tanja Pommerening
sehr langen, in alle Richtungen beweglichen Barteln am Oberkiefer auf, die im Heilpräparat sehr augenfällig gewesen sein müssen und mögli-cherweise den Schmerzpunkt mit versinnbildlichen.39 Es steht daher zu vermuten, dass zunächst auch die Rezeptur bei der Entlehnung der Erkrankungsbezeichnung bekannt war.
Geht man von einer Lehnübersetzung aus, so dürfte zu dem ver-mutlich posthippokratisch-hellenistischen Entlehnungszeitpunkt,40 der sich leider nicht mehr jahrhundertgenau bestimmen lässt, die dem Leiden zugewiesene Symptomatik in Ägypten und Griechenland über-eingestimmt haben. In dieser Zeit wäre sowohl gs-dp = ἡμικράνιον als auch mHr.t m gs-dp = πόνος ἡμικρανίου gewesen. Zur Vermeidung ter-minologischer Unklarheiten möchte ich das Leiden zum Entlehnungs-zeitpunkt als ‚ägypt.-griech. Hemikranie‘ bezeichnen.
Die zweite Prüfung, die anvisiert war, nämlich ob die griechische ἡμικρανία-Krankheit der heutigen Migräne entspricht, kann man unter diesen Voraussetzungen konkretisieren. Es stellt sich die Frage, inwie-weit die ‚ägypt.-griech. Hemikranie‘ der heutigen Migräne gleich-kommen kann und ob die altägyptische mHr.t m gs-dp zur Zeit der Abfassung der Beatty-Papyri um 1250 v. Chr. mit der ‚ägypt.-griech. Hemikranie‘ übereinstimmt. Dies betrifft die Symptome und den Krankheitsbegriff. Denn die durchschrittenen Zeiträume sind beträcht-lich und die jeweils beteiligten Heilkundekonzepte unterscheiden sich deutlich voneinander, nicht nur das moderne vom antiken, sondern auch das griechische vom ägyptischen.
39 Zur Vorstellung der Wirkweise, die auch durch das Herstellungsverfahren
„werde zu Asche erhitzt“ bedingt ist, ist eine gesonderte Arbeit in Vor-bereitung. Wie schon WESTENDORF (1999): 141 bemerkt, gibt das Rezept Eb 730 (pEbers 88,8f.), das die identische Rezeptur anführt, um einen Dorn aus der Haut zu ziehen, den Hinweis, dass die gs-dp-Erkrankung als Dorn im Kopf aufgefasst wurde.
40 ἡμικρανία (vgl. o. Anm. 30) ist im Corpus Hippocraticum und überhaupt in vorgalenischer Zeit nicht belegt. Hingegen findet man bei Aretaeus, lib. VII (Curatio cephalaeae) 2,19, ed. HUDE (1958): 149,5, und Galenus (der sich hier mit einem Text des Archigenes [1./2. Jh. n. Chr.] auseinandersetzt), De locis affectis II 8 (8.90–95 KÜHN), die ἑτεροκρανία, die einen stets einseitigen Schmerz bezeichnet, der mindestens bis zu Schläfe, Ohr, Auge oder Augenbraue reichen kann, d. h. das Gesicht mit einbezieht. Schwindel, Erbrechen, Schwere, Lebensunmut u. ä. können hinzukommen.
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 169
Blickt man in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts, so findet man in dem Wort Hemikrania eine breite Palette unterschiedlicher Leiden und Krankheiten. In dieser Zeit war Galen und mit ihm das Nachleben der antiken Medizin am Ausklingen und Virchows Zellularpathologie und mit ihr eine streng naturwissenschaftliche Neuausrichtung der Heilkunde noch nicht geboren. Die damalige Diskussion, was unter Hemikrania zu verstehen sei, war rege. Zum Beispiel beschrieb man sie als intermittierende oder dauerhafte Neuralgie von leichter oder schwe-rer Intensität, daneben aber auch als einseitigen in Augennähe loka-lisierten Schmerz, der mit Krankheitsgefühl und Übelkeit verbunden sei, oder, allgemeiner noch, als einseitigen Kopfschmerz.41 Im Gegen-satz dazu ist heute mit Migräne ein festes neurologisches Krankheitsbild umrissen, das differentialdiagnostisch von anderen Erkrankungen, die ebenfalls halbseitigen Kopfschmerz verursachen können, abgegrenzt wird; dazu zählen unter anderem Tumoren, Blutungen oder Entzün-dungen. Zudem ist halbseitiger Kopfschmerz in Augennähe ein typi-sches Symptom des Clusterkopfschmerzes, der nicht unter die heutige Migränedefinition fällt. Migränesymptome sind nach heutiger Defini-tion anfallartige Kopfschmerzen, die wiederholt und meist halbseitig auftreten und von vegetativen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und/oder Lärmscheu und neurologischen Ausfällen begleitet sein können.42
Dies alles relativiert das auf sprachlicher Ebene vorhandene krankheitshistorische Kontinuum zwischen dem ägyptischen Leiden, dem ägypt.-griech. Leiden, der Hemikrania des 19. Jahrhunderts und der Migräne des beginnenden 21. Jahrhunderts n. Chr. so stark, dass eine Übersetzung mHr.t m gs dp = Migräne ungeeignet wäre. Im Über-setzungstext darf daher ausschließlich mHr.t m gs dp als „Leiden in der Hälfte des Kopfes“ erscheinen. Die reine Übersetzung unseres Bei-spieltextes aus dem Papyrus Ebers sollte also wie folgt aussehen:
Ein anderes (Heilmittel) für das Leiden in der Hälfte des Kopfes (k.t n.t mHr.t m gs dp). Obere Kopfpartie des Welses (Dnn.t n.t nar); werde zu Asche erhitzt in Öl (snwx Hr mrH.t); werde der Kopf damit gesalbt vier Tage lang (gs dp im r hrw 4).
41 N. N. (1832): 237–239. 42 PSCHYREMBEL (1990): 1062.
170 Tanja Pommerening
Die gesamten übrigen Überlegungen gehören dagegen in den Kom-mentar, der auch unser nosologisches Wissen über das mit gs dp angesprochene Leiden enthalten sollte.
Über das ägyptische Leiden wissen wir nicht viel mehr als das Benennungsmotiv und eine aus den Rezepttexten ersichtliche Klassifi-kation, die sich aus der Abgrenzung der Rezepte voneinander ergibt. pBeatty V kennt neben dem „Buch der Beschwörung der Kopfhälfte“ (mDA.t n.t Sn.t gs-dp) „ein anderes Buch zum Beseitigen der ‚Schläfen-hälfte‘“ (k.t mDA.t n.t dr gs-mAa) und zwei Beschwörungen der „hq-Leiden“ (HA.t-a m Sn.wt n.t hq.w).43 Aufgrund der Determinierung des Wortes hq durch einen speienden Mund und die gegen hq anzuwen-dende Beschwörungsphrase „Mögest Du ausfließen, komme heraus aus der linken Schläfe“ (Sp=k pr m mAa iAbi) hat Westendorf, wie zuvor der GRUNDRISS, auch hq und gs-mAa als Migräneformen angesehen.44 Besser wäre es jedoch – berücksichtigt man die mit neuen differential-diagnostischen Methoden einhergehenden Bedeutungsverschiebungen der heutigen Fachterminologie – von ‚möglichen Migränesymptomen‘ zu sprechen. Die Belege zeigen jedenfalls, dass die ägyptische Klassifi-kation solcher Kopfleiden durch die Lokalisation der Symptome orientiert war, so dass unter anderem auch das, was wir heute mit Migräne verbinden – die wohl erst von den Griechen krankheitsbe-grifflich konstituiert wurde – in mehrere Bezeichnungen aufgesplittert erscheint, denen unterschiedliche Heilmethoden zugeordnet sind. Die ägyptische gs-dp-Erkrankung unterscheidet sich in der Schmerz-lokalisation kaum von der Galen’schen ἡμικρανία, wenn auch Galen die Hemikranieschmerzen genauer lokalisiert.45 Über den Schmerz hinaus-gehende Symptome sind weder bei ihm noch ägyptischerseits beschrie-ben. Die Krankheitsätiologien jedoch könnten unterschiedlicher kaum sein: Galen greift unter anderem auf seine Temperamentenlehre zurück, die medizinischen Beschwörungstexte Ägyptens lassen erken-nen, dass Dämonen oder sonstige Widersacher für die Schmerzen im Kopf verantwortlich gemacht wurden. Dementsprechend therapierte Galen mit Pharmaka, die ägyptischen Heiler hingegen wandten verbale 43 pChester Beatty V vs. 4,1–9; 4,10–6,4; 6,5–7, ed. GARDINER (1935), Bd. 2:
Taf. 28Af. Neueste Übersetzung ins Deutsche bei FISCHER-ELFERT (2005): 39–41.
44 WESTENDORF (1999): 69. 45 Vgl. o. Anm. 30.
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 171
wie auch andere Formen der Magie an. Dem ägyptischen ‚Schläfenschmerz‘ kam eine eigene Behandlung zu, bei Galen wird er unter ἡμικρανία subsumiert. Übelkeit und Schwindel, die sich mög-licherweise hinter der ägyptischen hq-Erkrankung verbergen, sind Symptome einer schwer verlaufenden ἑτεροκρανία. Die ‚ägypt.-griech. Hemikranie‘ ist von ihrer Bedeutung zwar nicht zu fassen, wird aber vermutlich in ihrer Symptomatik ebenfalls kaum von Galens ἡμικρανία abweichen. Sie bedarf einer eigenen Untersuchung, die jeden Kom-mentar vom Umfang her sprengen würde. Denn hierbei wäre das Verhältnis zwischen dem ägyptisch-griechischen Hemikraniekomplex und dessen griechisch-medizinsprachlicher Umgebung noch genauer zu erhellen, was einer engen Zusammenarbeit zwischen der Ägypto-logie und der klassischen Philologie bedarf.
Das zweite Beispiel sollte auf die Gefahr bei der Verwendung heutiger Krankheitsbezeichnungen in Übersetzungen hinweisen, wobei bewusst ein ägyptisches Syntagma gewählt wurde, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ins alexandrinische Griechisch lehnübersetzt wor-den ist und das in dieser Neuformung als sprachliche Konstante der griechischen, lateinischen, mittellateinischen und sogar modern-volks-sprachlichen Terminologie der wissenschaftlichen Medizin bis heute überlebt hat. Rein ausdrucksgeschichtlich, also lautausdrucksgeschicht-lich, kann man sagen, dass die griechische Hemikranie unsere heutige Migräne ist. Begriffs- und terminologiegeschichtlich hingegen unterlag das so bezeichnete krankheitshistorische Kontinuum einem vielfältigen diachronen Wandel, der bereits innerhalb des Entlehnungsvorgangs begonnen haben dürfte. Ich möchte annehmen, dass erst die grie-chische Wissenschaftsart die Hemikranie-Erkrankung konstruiert hat.
Die Auseinandersetzung mit den zwei Textbeispielen aus derzei-tigen Übertragungen des Papyrus Ebers sollte zeigen, dass eine neue und neuartige Übersetzung mit breitem Kommentar erforderlich ist und dass dieser Kommentar neben der synchronen Sprach- und Sach-erklärung des ägyptischen Textes auch diachrone Aufschlüsse bieten muss, um den Bedeutungswandel klarzumachen. Darüber hinaus kommt man nicht umhin, zur Beschreibung, Relationierung und Ver-ortung des Sachverhalts im Kommentar die moderne Fachterminologie zu bemühen.
Ein geeignetes Medium für all dies könnte das Internet mit Hypertext sein, weil es für eine schnelle und weite Verbreitung sorgt und den größten Gestaltungsspielraum bietet, das Informationsgeflecht
172 Tanja Pommerening
des Papyrus Ebers und seiner Übersetzungsrezeption zu entwirren, was in Buchform, wie der GRUNDRISS gezeigt hat, nur mit Einschrän-kungen und mit großer Mühe möglich ist. Der Hauptvorteil einer Internetpublikation ist der durch anklickbaren Hypertext realisierbare, unmittelbare und multidimensionale Anschluss des Kommentars an die Übersetzung. Es kommt hinzu, dass der fast unbegrenzte Daten-raum des Netzes auch Platz für eine Volltext-Faksimilierung der gesamten Übersetzungs- und sonstigen Deutungsgeschichte bietet. Der Anfang ist gemacht, da die Originalhandschrift – auch sie wäre hyper-textuell einzubinden – großenteils bereits im Netz steht.
Literaturverzeichnis
BARDINET, Thierry. 1995. Les papyrus médicaux de l’Egypte pharaonique. Traduction intégrale et commentaire (Penser la médicine). Paris: Fayard.
BRYAN, Cyril Phillips. 1930. The Papyrus Ebers. Translated from the German Version. London: Bless. [Unveränd. Nachdruck Chicago, Ill.: Ares Publishers 1974.]
CHACE, Arnold Buffum, Ludlow BULL, Henry Parker MANNING und Raymond Clare ARCHIBALD. 1927–1929. The Rhind Mathematical Papyrus. 2 Bde. Oberlin, Ohio: Mathematical Association of America.
EBBELL, Bendix. 1929. „Der chirurgische Teil des Papyrus Ebers.“ Acta orientalia 7: 1–47.
EBBELL, Bendix. 1937. The Papyrus Ebers. The Greatest Egyptian Medical Document. Copenhagen: Levin & Munksgaard.
EBERS, Georg. 1875. Papyros Ebers – Das hermetische Buch über die Arzeneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift. 2 Bde. Leipzig: Engelmann. [Neudruck der Ausgabe Osnabrück: Biblio-Verlag 1987.]
ERICHSEN, Wolja. 1954. Demotisches Glossar. Copenhagen: Munksgaard. FISCHER-ELFERT, Hans-Werner. 2005. Altägyptische Zaubersprüche (Reclams Uni-
versal-Bibliothek, 18375). Stuttgart: Reclam. GARDINER, Alan Henderson. 1935. Hieratic Papyri in the British Museum. Third
Series. (Chester Beatty Gift). London: British Museum Press. GHALIOUNGUI, Paul. 1987. The Papyrus Ebers. A New English Translation, Com-
mentaries and Glossaries (Academy of scientific research and technology). Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale.
GRIFFITH, Francis Llewellyn und Herbert THOMPSON. 1904–1909. The Demotic Papyrus London and Leiden. 3 Bde. London: Grevel.
Kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers 173
GRUNDRISS = Grapow, Hermann, Hildegard von Deines und Wolfhart Westen-dorf. 1954–1973. Grundriss der Medizin der Alten Ägypter. 9 Bde. Berlin: Aka-demie-Verlag. I: Grapow, Hermann. 1954. Anatomie und Physiologie. II: Grapow, Hermann. 1955. Von den medizinischen Texten. III: Grapow, Hermann. 1956. Kranker, Krankheit und Arzt. IV,1: Deines, Hildegard von, Hermann Grapow und Wolfhart Westendorf.
1958. Übersetzung der medizinischen Texte. IV,2: Deines, Hildegard von, Hermann Grapow und Wolfhart Westendorf.
1958. Erläuterungen. V: Grapow, Hermann. 1958. Die medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschrift
autographiert. VI: Deines, Hildegard von, und Hermann Grapow. 1959. Wörterbuch der ägyp-
tischen Drogennamen. VII,1 und 2: Deines, Hildegard von, und Wolfhart Westendorf. 1961f. Wörter-
buch der medizinischen Texte. VIII: Westendorf, Wolfhart. 1962. Grammatik der medizinischen Texte. IX: Deines, Hildegard von, und Hermann Grapow und Wolfhart Westendorf.
1973. Ergänzungen. HUDE, Karl. 1958. Aretaeus (Corpus medicorum Graecorum, 2). 2. Aufl. Berlin:
Akademie-Verlag. JOACHIM, Heinrich. 1890. Papyros Ebers – Das älteste Buch über Heilkunde. Berlin:
Reimer. [Photomechanischer Nachdruck Berlin: de Gruyter 1973.] KAIMAKES, Dimitris. 1976. Die Kyraniden (Beiträge zur klassischen Philologie, 76).
Meisenheim am Glan: Hain. KÜHN, Karl Gottlob. 1826. Claudii Galeni opera omnia. Bd. 12. Leipzig: Knobloch.
[Reprint Hildesheim: Olms 1965.] KÜHN, Karl Gottlob. 1827. Claudii Galeni opera omnia. Bd. 14. Leipzig: Knobloch.
[Reprint Hildesheim: Olms 1965.] N. N. 1832. „On Hemicrania.“ The American Journal of the Medical Sciences 10: 237–
239. NUNN, John Francis. 1997. Ancient Egyptian Medicine. London: British Museum
Press. PEET, Thomas Eric. 1923. The Rhind Mathematical Papyrus. London: University
Press. POMMERENING, Tanja. 2010. „Milch einer Frau, die einen Knaben geboren hat“.
In: Kousoulis Panagiotis (Hg.), Proceedings of the X International Congress of Egyptologists (Orientalia Lovaniensia Analecta). Leuven: Peeters [im Druck].
PREISENDANZ, Karl. 1973–1974. Papyri Graecae Magicae. Die Griechischen Zauber-papyri. 2 Bde. 2. Aufl. Stuttgart: Teubner.
PSCHYREMBEL. 1990. Klinisches Wörterbuch. 256. Aufl. Berlin/New York: de Gruyter.
REITZENSTEIN, Richard. 1926. „Ein christliches Zauberbuch und seine Vorlage.“ Archiv für Religionswissenschaft 24: 176–178.
174 Tanja Pommerening
ROSE, Frank Clifford. 1995. „The History of Migraine from Mesopotamian to Medieval Times.“ Cephalalgia 15, Suppl. 15: 1–3.
SCHOLL, Reinhold und Jens KUPFERSCHMIDT. „Das Papyrus-Projekt Halle-Jena-Leipzig,“ http://papyri-leipzig.dl.uni-leipzig.de/receive/UBL Papyri_schrift _00035080 (Zugriff 2. Juli 2009).
SHOKEIR, Ahmed Abdurrahman und M. I. HUSSEIN. 2004. „Sexual Life in Phara-onic Egypt: Towards a Urological View.“ International Journal of Impotence Re-search 16: 385–388.
TLA = Thesaurus Linguae Aegyptiae. http://aaew.bbaw.de/tla/ TLG = Thesaurus Linguae Graecae. http://www.tlg.uci.edu/ VYCICHL, Werner. 1983. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven: Peeters. WB = Erman, Adolf und Hermann Grapow. 1982. Wörterbuch der aegyptischen
Sprache. 5 Bde. 4. Aufl. Berlin: Akademie-Verlag. WESTENDORF, Wolfhart. 1999. Handbuch der altägyptischen Medizin. 2 Bde.
(Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, 36). Leiden/Boston/Köln: Brill. WRESZINSKI, Walter. 1913. Der Papyrus Ebers – Umschrift (Die Medizin der alten
Ägypter, 3). Leipzig: Hinrichs’sche Buchhandlung.